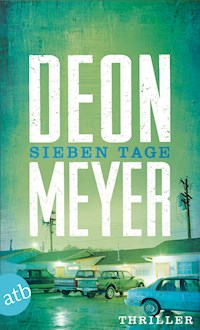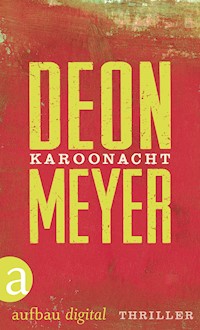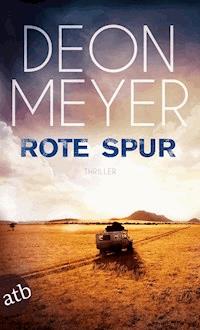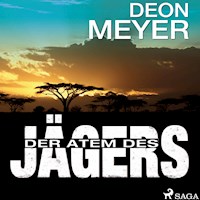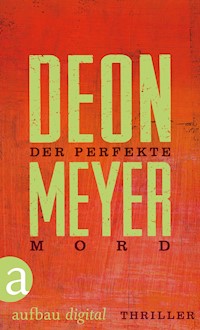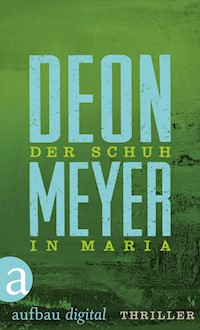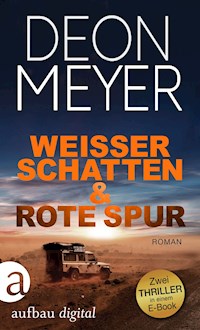4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der größte Raubzug der Geschichte
Bennie Griessel, aus Kapstadt in die Provinz verbannter Ermittler, will es wagen: Er hat seiner Freundin Alexa versprochen, sie zu heiraten. Doch der rätselhafte Tod einer Studentin kommt ihm in die Quere. Ihre Leiche wird in Stellenbosch gefunden – mit seltsamen Bissspuren. Dann macht ein spektakulärer Raubüberfall alles noch brenzliger. Und währenddessen rückt Bennies Hochzeitstag unaufhörlich näher, an dem er unbedingt pünktlich sein muss – am besten ohne eine Schusswunde.
Eine rasante Fahrt in menschliche Abgründe vor der spektakulären Landschaft Südafrikas
»Deon Meyers Name auf dem Cover ist eine Garantie für crime writing at its best.« Tess Gerritsen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
An einem Berghang bei Stellenbosch wird eine Studentin tot aufgefunden – mit rätselhaften Bissspuren an den Beinen.
Ein ehemaliger Elitesoldat wird auf seinem Anwesen getötet, und der Mord trägt eine deutliche Botschaft: Wer redet, stirbt!
Eine Safariführerin wird als Honigfalle für den größten Raubüberfall in der Geschichte Südafrikas angeworben, und ein Netzwerk von korrupten Bürokraten und Polizisten versucht, jeden einzelnen Schritt der Ermittlungen zu sabotieren.
Bennie Griessel und sein Partner Cupido haben alle Mühe, den Überblick zu behalten und die einzelnen Fäden zu entwirren. Doch sie haben ein großes Ziel: Sie wollen den Mörder finden, um wieder von ihrer ehemaligen Eliteeinheit in Kapstadt aufgenommen zu werden. Bennie hat jedoch noch ganz andere Sorgen. Er will heiraten, und bis dahin müssen die Ermittlungen abgeschlossen sein – aber der Termin rast wie ein Schnellzug ohne Bremsen auf ihn zu.
»Deon Meyers Name auf dem Cover ist eine Garantie für crime writing at its best.« Tess Gerritsen
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Deon Meyer
Die Stunde des Löwen
Ein Bennie-Griessel-Thriller
Aus dem Afrikaans von Stefanie Schäfer
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Zitat
Rotkatze
Kapitel 1
Strandwolf
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Leopard
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Katze
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Hyäne
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Löwe
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Löwe
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Danksagung
Glossar mit Erklärungen der afrikaanssprachigen Wörter und anderer Begriffe
Erläuterungen
Impressum
Für Marianne in Liebe
Im Löwen steckt oft eine urwüchsige, kreative Energie. Dieses Zeichen verkörpert das Feuer, das in uns allen lodert.
www.mindbodygreen.com
Bei der Gier nach Gold geht es nicht um Gold. Es geht um die Mittel für Freiheit und Wohlstand.
Ralph Waldo Emerson
Die Gier nach Gold ist universal und der am tiefsten verwurzelte kommerzielle Instinkt der menschlichen Spezies.
Gerald M. Loeb
Rotkatze
(Caracal caracal)
Bennie & Vaughn
1
Anjané van Tonder saß im Büro der Kripo Stellenbosch, in der rechten Hand ihr großes iPhone fest umklammert.
Ihr gegenüber auf der anderen Seite des ramponierten Behördenschreibtischs saßen auf ramponierten Holzstühlen zwei ramponierte Ermittler. Sie hatten sich ihr als Unteroffiziere Bennie Griessel und Vaughn Cupido vorgestellt. Beide blickten stirnrunzelnd und mit gesenkten Köpfen auf das Anzeigenformular, das sie akribisch, mit peinlich akkurater Handschrift, in korrektem Afrikaans und mit wahrheitsgemäßer Darstellung des Sachverhalts ausgefüllt hatte.
Anjané hatte geschrieben, sie sei zwanzig Jahre alt und studiere im zweiten Jahr Philologie mit den Hauptfächern Afrikaans, Niederländisch und Allgemeiner Sprachwissenschaft. Sie wohne im Minerva-Studentinnenwohnheim.
Und sie sei bestohlen worden.
Die Studentin war eine hübsche junge Frau mit langem, glattem blondem Haar, großen, hellgrünen Augen und makelloser Haut. Ihre rosigen Lippen waren vor unterdrückter Frustration zusammengepresst. Die beiden Männer ihr gegenüber – und dieses trostlose Zimmer – verursachten ihr Beklemmungen.
Erstens: Warum schüttelten sie die Köpfe, als kapierten sie nicht, was in ihrer Aussage stand? Sie hatte doch alles klar und deutlich erklärt!
Zweitens: Dieser Griessel sah … einfach nicht vertrauenerweckend aus. Mit seinen seltsamen Augen, mandelförmig und dunkel. Und traurig. Nicht bekümmert; eher melancholisch. Sein Haar war ungepflegt und zu lang für einen Mann seines Alters. Sein Gesicht vom Leben gezeichnet. Vom Alkohol. Über seinem dad bod trug er ein knittriges Hemd und eine formlose Jacke, die garantiert von Pick n Pay stammten.
Drittens: Dieser Cupido war ihr zunächst vielversprechender erschienen. Forsch, athletisch und attraktiv, obwohl sein schneeweißes Hemd am Bauch ein wenig spannte. Gut angezogen, das Haar kurz und akkurat geschnitten. Aber auch der Schwarze war ihr irgendwie unangenehm; er hatte etwas Herablassendes an sich. Als die beiden hereingekommen waren, hatte sie den Blick erhascht, den er seinem Kollegen zugeworfen hatte und der zu sagen schien: nicht schon wieder!
Sie hatte Rechte! Sie war das Opfer eines heimtückischen Verbrechens geworden!
Der Griessel-Typ blickte von dem Anzeigenformular auf. »Juffrouw«, sagte er, »was genau hat man Ihnen denn nun gestohlen?«
»Nicht ›man‹ – es war Kayla Venter! Sie hat mein IP gestohlen.«
»Ist das was Elektronisches?«, fragte Cupido verwundert.
Sie drehte die Augen Hilfe suchend zum Himmel. »Mein I. P.«, wiederholte sie langsam und deutlich. »Das bedeutet intellectual property. Geistiges Eigentum.«
Verständnislos sahen die beiden sie an.
Der Mut verließ sie allmählich. Wie viel Pech konnte man haben? Das waren eindeutig die am wenigsten hellsten Kerzen im Polizeikronleuchter, und ausgerechnet die musste sie erwischen.
Griessel sagte: »Okay. Jetzt erzählen Sie uns doch noch einmal alles von Anfang an. Mit Ihren eigenen Worten.« Er klang sehr geduldig, was nun wirklich nicht nötig war.
»Aber Sie haben doch meine Aussage!«, erwiderte sie. »Das sind meine eigenen Worte.«
»Sie müssen uns das schon etwas näher erklären«, sagte Cupido. »Also bitte, fangen Sie noch mal ganz von vorn an.«
Sie atmete langsam ein, um sich zu beruhigen. »Ich habe eine Insta-Story gepostet«, sagte sie. »Vorgestern. Daraufhin hat Kayla Venter mein geistiges Eigentum gestohlen.«
»Eine Insta-Story?«, fragte Griessel.
»Instagram?«, fragte sie. »Sie kennen Instagram nicht?« Sie aktivierte ihr Handy.
»Natürlich kennen wir Instagram«, erwiderte Cupido.
»Super. Also, ich habe diese Story auf Instagram gepostet …« Sie bearbeitete das Display des Handys mit den Daumen, drehte den Ermittlern den Bildschirm zu und startete das Video.
Man sah die Victoriastraat, die Straße, die mitten durch den Universitätscampus führte. Die Kamera folgte einer jungen Frau von hinten. Sie hatte langes, rotes Haar, athletische Beine und trug einen Minirock. Das Video war mit Musik unterlegt, Unheil verkündend und bedrohlich. Während die Rothaarige ahnungslos weiterlief, erschienen Wörter auf dem Bildschirm, eines nach dem anderen, in dramatischer Kursivschrift:
Rotkatze.
Hört.
Rotkatze.
Schwört.
Rotkatze.
Wird zerstört.
Das Bild wurde schwarz.
Erwartungsvoll sah sie die beiden an.
»Das ist Ihre Insta-Story?«, fragte dieser Griessel.
»Genau. Und dann …«
»Und was hat das zu bedeuten?«, fragte Cupido und zeigte auf das Display ihres Handys.
»Das ist ein Gedicht«, erklärte sie.
»Das ist mir klar. Aber was bedeutet es?«
»Es ist eine Allegorie.«
»Das hilft mir auch nicht weiter.«
Sie seufzte. Sie hätte es wissen müssen. »Eine Allegorie ist ein Gedicht, dessen Worte eine tiefere Bedeutung haben. Eine Rotkatze ist ein listiges Tier. Es stiehlt Schafe und hat sehr große Ohren, die von sechzehn Muskeln bewegt werden. Das Gedicht handelt also von einer Rotkatze, die gut hören kann, aber das rettet sie nicht. Sie kann trotzdem zerstört werden. Die tiefere Bedeutung dahinter ist, dass Kayla Venter versuchen kann, Gerüchte über mich zu verbreiten – alles Lügen! –, aber sie kommt damit nicht durch.«
»Die junge Frau im Video ist Kayla Venter?«
»Genau.«
»Und sie hat Ihr geistiges Eigentum gestohlen?«
»Richtig. Und hier habe ich den Beweis«, sagte Anjané. »Schauen Sie mal.« Wieder bearbeitete sie ihr Handy und zeigte ihnen das Display. »Sie hat meine Story geklaut, sie verändert und dann das hier gepostet.«
Dasselbe Video. Dieselbe Musik. Dieselben Worte. Bis kurz vor dem Ende. Da erschienen die Wörter NIE UND NIMMER in blutroten Buchstaben.
»Wie kann sie ein Video stehlen, auf dem sie selbst zu sehen ist?«, fragte Cupido.
»Das Gedicht!«, erwiderte Anjané. »Sie hat mein Gedicht gestohlen. Mein geistiges Eigentum!«
Wieder starrten sie sie an. Wie Dorfdeppen.
Das Handy von diesem Griessel-Typen klingelte. Er schaute darauf und sagte zu ihr: »Entschuldigung, da muss ich rangehen. – Kolonel?«
»Was wollen Sie unternehmen?«, fragte Anjané diesen Cupido.
»Wir kommen sofort, Kolonel«, sagte Griessel und beendete den Anruf.
»Juffrouw«, sagte Cupido äußerst ernsthaft. »Der Diebstahl geistigen Eigentums überschreitet unsere Kompetenzen.«
Darauf war sie auch schon gekommen. »Wer kann mir denn dann weiterhelfen?«
»Vaughn, der Kolonel will uns in seinem Büro sprechen«, sagte Griessel. Beide Ermittler standen auf.
»Juffrouw«, sagte Griessel, »wir würden Ihnen raten, sich mit einem Anwalt in Verbindung zu setzen, einen, der auf Urheberrecht spezialisiert ist. Das ist eine zivilrechtliche Angelegenheit.«
»Sie können Schadenersatz von Kayla Venter verlangen«, fügte Cupido hinzu. »Und zwar nicht zu knapp. Das wird ihr eine Lehre sein.«
»Würden Sie uns jetzt bitte entschuldigen?«, sagte Griessel. »Wir müssen zu unserem Vorgesetzten.«
»Viel Glück!«, verabschiedete sich Cupido.
»Wiedersehen«, sagte Griessel.
Sie gingen hinaus.
Anjané hätte schwören können, dass sie diesen Cupido lachen hörte, aber ganz sicher war sie sich nicht.
Im Auto sagte Cupido: »Was haben wir denn jetzt schon wieder falsch gemacht, Benna?«
»Nichts«, sagte Griessel, »jedenfalls nicht, dass ich wüsste.«
»Wie hat er sich angehört?«
»Du kennst doch Witkop. Der hört sich immer an, als ob er stocksauer wäre.«
»Klang er normal stocksauer oder besonders stocksauer?«
»Er hat sich ganz normal angehört.«
»Und er hat gesagt, dass wir auf der Stelle kommen sollten?«
»Er hat gesagt, wir sollten so schnell wie möglich kommen.«
»Benna, ich glaube, es ist so weit!«
»Was denn?«
»Die Valke wollen uns wiederhaben, Partner! Ganz bestimmt! Kein Diebstahl geistigen Eigentums mehr, keine geklauten Fahrräder und verlorenen Handys mehr. Jetzt geht’s wieder um die großen Fische, Pappie. Endlich!«
»Ich weiß nicht, Vaughn …«
»Glaub mir, Benna, ich hab das im Urin.«
Griessel und Cupido eilten den Korridor im ersten Stock des Polizeipräsidiums Stellenbosch entlang, drei Kilometer westlich der Polizeiwache.
Cupido klopfte an.
»Herein«, ertönte es von drinnen.
Sie traten ein.
Luitenant-Kolonel Waldemar »Witkop« Jansen war der Chef der Kripo. Er stand kurz vor der Pensionierung; ein kleiner, grantiger, grauhaariger Terrier mit schneeweißem Chaplin-Schnauzer. Stirnrunzelnd blickte er sie hinter seinem Schreibtisch hervor an. Sie wussten, dass sein Gesichtsausdruck nicht unbedingt seine Laune widerspiegelte.
»Morgen. Setzen Sie sich«, sagte Jansen.
Sie grüßten und nahmen Platz.
»Als Sie von den Valke hierher versetzt wurden, habe ich befürchtet, Sie würden uns nur Ärger machen«, begann der Kolonel.
Sie warteten.
»Ich habe mich geirrt. Sie leisten gute Arbeit. Ihre Akten sind vorschriftsmäßig geführt. Aber, und jetzt hören Sie mir gut zu, ich kann Sie leider noch nicht befördern. Bis auf Weiteres behalten Sie den Rang eines Stabsfeldwebels. Aber ich werde Sie versetzen. In die Abteilung Schwer- und Gewaltverbrechen.« Die Abteilung Schwer- und Gewaltverbrechen war die einzige spezialisierte Abteilung bei der Kripo Stellenbosch.
»Vielen Dank, Kolonel«, sagte Griessel.
Cupido schwieg enttäuscht.
»Freuen Sie sich nicht zu früh. Sie müssen rund um die Uhr verfügbar sein, sieben Tage die Woche. Alle vier Wochen Bereitschaft sind ab jetzt passé. Das Dezernat für Schwerverbrechen ist chronisch unterbesetzt; da kommt viel Arbeit auf Sie zu. Verstanden?«
»Ja, Kolonel.«
»Schaffen Sie das?«
Cupido kam wieder zu sich. »Kolonel, das ist genau unser Ding. So haben wir auch bei den Valke gearbeitet, Tag und Nacht. Und da man uns jederzeit zurückbeordern kann, erwartet uns das sowieso bald wieder.«
»Damit sieht es allerdings ziemlich schlecht aus«, erwiderte Jansen.
»Kolonel?«
»Anscheinend haben Sie es noch nicht gehört …«
»Was, Kolonel?«, fragte Griessel.
»Das mit Brigadier Manie. Die oberste Polizeiführung hat ihn versetzt. Wahrscheinlich, weil er ein durch und durch integrer Polizist ist.«
Brigadier Musad Manie war der Chef der DPMO des Westkaps gewesen – des Direktorats für Schwerverbrechen, allgemein als »die Valke« bekannt, solange Griessel und Cupido der Eliteeinheit angehört hatten.
»O nein!«, stieß Vaughn Cupido hervor.
»Die ganze Polizei ist nur noch ein stinkender Sumpf«, sagte Jansen, »und die Mistkerle in Pretoria ziehen uns da immer weiter rein. Wir hatten geglaubt, dass es durch die neue Regierung mit der Plünderung unseres Landes vorbei wäre. Dabei sitzen die alle noch an ihren Hebeln, die korrupten Scheißkerle. Hinter den Kulissen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal froh sein würde, in Rente zu gehen.«
Es war das erste Mal, dass sie Witkop Jansen etwas Negatives über die Polizei sagen hörten. Wortlos saßen sie da, stumm und niedergeschlagen.
»Nun?«, fragte Jansen schließlich. »Sind Sie bereit für Dezernat S und G?«
Strandwolf
(Schabrackenhyäne – Parahyaena brunnea)
Christina Jaeger
2
Wie verhält man sich, wenn man von einem Löwen angegriffen wird?
Die Frage kam von einer der Frauen, in breitem texanischem Slang.
Neun Amerikaner saßen spätabends um das Lagerfeuer tief im Okavangodelta, vier Ehepaare mittleren Alters und eine rüstige Witwe Ende sechzig. Über ihnen wölbte sich die Milchstraße wie die Kuppel einer Kathedrale. Die Touristen waren mit den Gedanken jedoch nicht beim atemberaubenden Nachthimmel. Ihre Augen waren auf Christina gerichtet, ihren Safariguide. Sie nannten sie »Chris« oder »Chrissie«. Der weiche Feuerschein fiel auf die attraktive junge Frau, ihre honigfarbene Haut, das lange schwarze Haar, das ihr in einem geflochtenen Zopf über den Rücken hing, ihren eleganten Hals und die hohen Wangenknochen.
Chrissie lächelte. Das fragten die Ausländer jedes Mal und taten dabei so, als hätten sie keine Angst, sondern wären nur neugierig.
Sie antwortete: »Wenn ihr weglauft, sterbt ihr lediglich müde.« Sie wartete, bis sich das nervöse Gelächter gelegt hatte. Dann erklärte sie, dass Usain Bolt ungefähr 44 Stundenkilometer erreichen könne, 43,99, um genau zu sein. Ein Löwe schaffe 80.
Chrissie war eine geübte und fesselnde Erzählerin. Sie wusste, wie wichtig kurze Pausen waren, und setzte sie geschickt ein. Deswegen zögerte sie jetzt, so dass man nur das knisternde Feuer und den harmonischen Chor der Frösche hörte.
Sie erklärte, dass der Angriff eines Löwen meistens nur ein Scheinmanöver sei. Ein Test. Sein Gebrüll sei ohrenbetäubend und äußerst beängstigend. Er wolle einem einen Schrecken einjagen, so dass man flüchtete. Doch wenn man das tat, war man Katzenfutter.
»Man muss sich ihm entgegenstellen.« Christina stand von dem Klappstuhl auf, stemmte ihre athletischen Beine in den Safariboots kräftig in den Boden, hob die Arme und spreizte die Finger. »Macht euch so groß und breit, wie ihr könnt. Und dann schreit ihr ihn an. So laut ihr könnt. Klatscht in die Hände. Zeigt keine Angst. Dann bricht er seinen Angriff ab. Das machen sie immer so. Wenn sich Menschen so verhalten, sind sie verwirrt. Wenn der Löwe stehen bleibt, zieht ihr euch zurück. Ganz, ganz langsam. Immer mit dem Gesicht zum Tier. Wenn es sich bewegt, bleibt ihr stocksteif stehen. Wenn es stehen bleibt, geht ihr weiter rückwärts.«
Die Amerikaner hingen an ihren Lippen.
Langsam ließ sie die Arme sinken und setzte sich wieder. »Der Trick«, sagte sie, »besteht darin, dem Löwen zu erlauben, sich in Würde zurückzuziehen. Was nun mal für alle männlichen Wesen gilt.«
Wieder lachten sie, wie immer. Über den Witz, und um die Spannung abzubauen. Christina wusste genau, was sie als Nächstes fragen würden: »Wie oft bist du schon von einem Löwen angegriffen worden?« Vier-, fünfmal, würde sie antworten. Dann würde sie aus alter Gewohnheit ihre Jagdwaffe näher zu sich hinziehen, die Ruger-Hawkeye-Repetierbüchse. Sie erzählte, sie arbeite jetzt schon seit vier Jahren hier in der Letsatsi Lodge, und sie habe diese Waffe noch nie einsetzen müssen. Aber sie trage sie immer bei sich, und sie könne gut damit umgehen. Deswegen könnten alle ihre Wandersafari morgen früh unbesorgt genießen. Sie wären absolut sicher.
Doch noch bevor die Frage kam, nahm Christina eine Bewegung wahr, einen Ankömmling knapp außerhalb des Feuerscheins. Eine vage bekannte Silhouette, ein irgendwie vertrauter Schritt. Sie wandte sich zu der Gestalt um und erkannte ein Gesicht aus ihrer Vergangenheit wieder.
Ihr Herz schlug ein klein wenig schneller.
Der Mann im Halbdunkel nickte ihr zu. Ein subtiles Zeichen, eine Geste, die besagte: Ich bin deinetwegen gekommen. Dann verschwand er hinter der Holzbalkenwand der Lapa, des offenen Sitzplatzes, und ging in Richtung der Buschkneipe.
Rousseau. Ian oder Iwan oder so ähnlich. Er hatte damals in Simbabwe für Ehrlichmann gearbeitet. Es musste inzwischen sieben oder acht Jahre her sein. Ehemaliger Soldat. Hochgewachsen, breite Schultern, große Hände, ruhig und zurückhaltend. Sie hatte ihn gemocht.
Das alles kam ihr in den Sinn, während sie am Lagerfeuer noch ein paar Minuten mit den Amerikanern plauderte. Dann verabschiedete sie sich und ging ihn suchen.
Er saß vor einem halb leeren Bierglas und stand auf, als Christina auf ihn zukam. Hellblaue Augen, kurzer, rotbrauner Bart, wie in ihrer Erinnerung. »Hallo, Floh«, begrüßte er sie freundlich lächelnd.
Es war seltsam, diesen Namen wieder zu hören. Sie ging zunächst darüber hinweg. »Rousseau«, sagte sie, »was machst du hier?«
Er wartete, bis sie sich neben ihn gesetzt hatte. »Willst du was trinken?«
»Nein danke.«
Er nickte, hob langsam sein Bier zum Mund und nahm einen Schluck. Dann sah er sie an. »Ich wollte dir einen Job anbieten.«
Sie zog die Augenbrauen hoch.
Rousseau überzeugte sich erst, dass der Barkeeper außer Hörweite war, und sprach dann so leise, dass wirklich nur sie ihn hören konnte. »Es geht um einen Zwanzig-Millionen-Dollar-Raub«, sagte er. »Und wir brauchen dich dabei.«
Sie sah ihn unverwandt an und wartete auf ein Zeichen dafür, dass das ein Witz sein sollte. Bis sie ein leichter Adrenalinschub durchfuhr. Er meinte es ernst.
»Was heißt ›wir‹?«, fragte sie.
»Brenner, ich und noch zwei andere. Zusammen mit dir wären wir zu fünft.«
Brenner. Sie erinnerte sich an Brenner. Sie traute ihm nicht. »Wieso ich?«
»Wir brauchen eine Honigfalle. Und zwar eine mit einem kühlen Kopf. Und wir hoffen, dass du noch Kontakte hast, die uns die Dollars wechseln können.«
»Ich weiß nicht … Diese Kontakte sind schon seit Jahren eingeschlafen.«
»Wir haben einen Plan B. Aber er ist etwas riskant, also wäre es toll, wenn du es versuchen könntest.«
»Wem gehört das Geld?«
»Das ist ja das Interessante daran! Wir schaden niemandem. Es ist ein Teil des Geldes, dass die Chandas dem Staat gestohlen haben. Sie konnten es nicht außer Landes bringen.«
Natürlich wusste Christina über die drei indischen Geschäftsleute Bescheid, Brüder, die angeblich dabei geholfen hatten, ihr Heimatland Hand in Hand mit dem ehemaligen Präsidenten gewissenlos auszuplündern. Die Südafrikaner, die während dieser Zeit hierhergekommen waren, hatten über nichts anderes geredet.
»Wo ist das Geld?«
»Du musst mir erst sagen, ob du dabei bist«, erwiderte er mit einem entschuldigenden Lächeln.
Sein Blick war melancholischer als in ihrer Erinnerung, und sein Bart wies die ersten grauen Haare auf.
»Wie viel Zeit habe ich, um es mir zu überlegen?«
»Wann kommt der Hopper morgen?« Rousseau meinte die Cessna Caravan, die täglich Touristen herbrachte und abholte.
»Um zehn.«
Er nickte. Bis dahin hatte sie Zeit.
Plötzlich fiel ihr sein Vorname wieder ein.
»Igen«, sagte sie. »Ich heiße jetzt Christina. Chrissie.«
»Und mit Nachnamen?«
»Jaeger.«
Er ließ das kurz auf sich einwirken. »Chrissie. Jaeger.« Und dann: »Gefällt mir.«
»Lebt Ehrlichmann noch?«, fragte sie.
3
Sie lag im Bett und lauschte über Kopfhörer Beethovens Violinkonzert, gespielt von Nigel Kennedy. Dabei dachte sie nach.
Um kurz nach Mitternacht nahm sie ihre Jagdbüchse und ging hinunter ans Ufer. Sie schob eines der Mokoros, der langen Einbaumboote, ins Wasser und stakte in Richtung Osten. Eine dünne Mondsichel schwebte dicht über dem Horizont.
Sie dachte an Ehrlichmann.
Igen Rousseau hatte ihr erzählt, dass er von Elfenbeinwilderern erschossen worden war. Schon vor über einem Jahr, nur ein paar Kilometer südlich von Kariba.
Nach und nach wurden sie immer weniger. Die letzten der Naturschützer, die noch in einem ursprünglicheren Südafrika großworden waren. Und die geglaubt hatten, vieles retten zu können.
So, wie ihr Vater.
Ehrlichmann, der sich damals während der WWF-Elefantenzählung frühmorgens neben sie gesetzt hatte. Sie hatten zusammen Kaffee getrunken, den Sonnenaufgang beobachtet und den erwachenden Vögeln gelauscht. Irgendwann hatte er voller Mitgefühl gesagt: »Ich habe deinen Vater gekannt. Louis van Jaarsveld war der genialste Spurenleser, der mir je begegnet ist.«
Sie hatte ihm nicht geantwortet.
»Und ich glaube, du wirst noch besser werden als er.«
Das war, bevor sie versucht hatte, die Diamanten zu schmuggeln.[1]
Christina hatte sich gefragt, was Ehrlichmann anschließend von ihr gedacht hatte. Denn irgendwann mussten sie es herausgefunden haben, er und seine Komplizen. Deswegen wollten die Männer sie jetzt wahrscheinlich für ihren großen Raubüberfall anwerben.
Sie hörte im angrenzenden Kanal ein Flusspferd schnauben. Die Flusspferde bereiteten ihr kein Kopfzerbrechen. Es waren die Riesenkrokodile, die ihr Angst machten.
Sie brauchte noch 20 Minuten, bis sie die Stelle erreicht hatte, an der die Tiere ihren Vater gefressen hatten.
Sie zog das Mokoro an Land, drehte es um und setzte sich darauf, die Büchse auf dem Schoß.
»Ich wollte dir Auf Wiedersehen sagen, Papa«, flüsterte sie.
4
Die erste Begegnung mit ihren Komplizen empfand sie als surreal, wie eine Out-of-Body-Erfahrung.
Christina klingelte an der Tür eines Einfamilienhauses in Rooihuiskraal, Pretoria. Nebenan spielten Kinder Fußball und alberten herum. Vier Jahre lang hatte sie das Okavangodelta nicht verlassen, und wieder in der Stadt zu sein fühlte sich seltsam, schön und nervig an, alles auf einmal.
Brenner öffnete die Tür, weißes T-Shirt, Rugbyhose, barfuß. Er sah mehr oder weniger noch genauso aus wie früher. Vielleicht hatten sich die Falten in seinem Gesicht etwas tiefer eingegraben, aber er war noch immer schlank und durchtrainiert. Kurz geschnittenes Haar, Stoppelbart. Intensiver Blick. Ein Alphamann. Er hatte früher in einer Spezialeinheit gedient und noch immer dieses Distanzierte an sich. Diese Aura.
Er lächelte sparsam, wie sie es von ihm kannte. Trotz allem schien er sich über das Wiedersehen zu freuen, als erlaube er den Erinnerungen von früher, seine Deckung etwas aufzuweichen. »Christina Jaeger«, sagte er, wie um sich den Namen einzuprägen. Er hatte sie als Cornel van Jaarsveld gekannt. Sie konnte sich nicht entsinnen, dass er sie jemals Floh genannt hatte.
»Brenner«, begrüßte sie ihn.
»Freut mich, dass du gekommen bist. Komm mit durch, wir sind hinten.« Mit einem Blick auf ihren Rucksack fügte er hinzu: »Den kannst du hierlassen«, und deutete auf das Wohnzimmersofa.
»Schon okay«, sagte sie und folgte ihm durch das Esszimmer und die Küche. Ein Männerhaushalt. Praktisch. Pieksauber und ordentlich. Spießig.
Durch die Hintertür gingen sie hinaus, wo die anderen drei schon auf Gartenstühlen saßen. Christina grinste in sich hinein. Typisch südafrikanisch – man plante einen Raubüberfall, während man gemütlich um den Braai-Altar saß. Das Holz knisterte, und eine dünne Rauchfahne kringelte sich faul gen Himmel, ein Sühneopfer an die Götter des Verbrechens. Neben dem Grill stand ein Metalltischchen, auf dem das Fleisch und die traditionellen Braaibroodjies, die Toastsandwiches mit Käse, Tomate und Zwiebel, schon in den ikonischen, ovalen Hartaluschüsseln warteten. Sie fragte sich, wer die Brote zubereitet hatte.
Die Männer standen gleichzeitig auf. Igen Rousseau begrüßte sie herzlich. Die anderen beiden kannte Christina nicht – ein Muskelprotz und ein komischer, hagerer Typ. Neugierig musterten sie sie.
Was sie wohl vor ihrer Ankunft über sie geredet hatten?
»Das ist Christina Jaeger«, stellte Brenner sie vor. »Ig kennst du ja schon. Der hier«, fuhr er fort und zeigte auf den Muskelmann, »ist Themba Jola. Themba war früher bei den Fallschirmjägern, aber ich bin ja nicht nachtragend.« Der Xhosa trug ein Muscleshirt, wie es sich für Bodybuilder gehörte, da schließlich die Resultate der harten Arbeit im Gym zur Schau gestellt werden mussten. Aber ihr gefiel die Art, wie er ihr die Hand schüttelte, begleitet von einem breiten, sympathischen Lächeln.
Neben Jola stand der komische Typ. Er hatte ausgeprägte asiatische Züge, musste aber noch andere genetische Einflüsse haben. Das pechschwarze, glatte Haar fiel ihm bis auf die Schultern. Unter dem linken Ärmel seines T-Shirts hervor schlängelte sich ein Drachentattoo den Arm entlang. Er war kleiner als die beiden anderen, strahlte aber eine intensive Energie aus. »Jericho Yon«, stellte Brenner ihn vor. »Der beste Buschpilot in ganz Afrika. Wie nennen ihn ›Jer‹.«
Yon nickte; sein Haar wippte mit. Sanft ergriff er ihre Hand. Sie fand seinen Blick etwas verschlagen.
Es klingelte an der Tür. »Das ist Niekie«, sagte Brenner. »Setzt euch schon mal, ich mache ihm auf.« Auf dem Weg zur Haustür kehrte er noch einmal um und sagte: »Keine Namen, solange er hier ist.«
Christina nahm ihren Rucksack ab, lehnte ihn an den freien Stuhl neben Igen Rousseau und setzte sich. »Niekie?«, fragte sie ihn. »Du hast gesagt, wir wären zu fünft.«
Igen lächelte. »Niekie ist … warte, ich will dir nicht die Überraschung verderben.«
Niekie war fett und etwa Mitte dreißig. Er trug Militärboots, eine Tarnhose und ein grünes T-Shirt, das über seinem stattlichen Bauch spannte. Er hielt eine Zigarette zwischen den Fingern. »Wie geht’s?«, fragte er und begrüßte jeden mit einer Gettofaust.
»Das ist Nick Berry«, erklärte Brenner. »Niekie, du weißt, dass ich dir niemanden vorstelle?«
»Klar, Mann, besser ist das«, sagte Niekie. Er kam zu Christina und zog fest an seiner Zigarette. »Da haben wir ja eine richtig süße Honigfalle«, sagte er anzüglich und starrte auf ihre Brüste.
Während sich Niekie einen Stuhl heranzog, warf Christina Brenner einen Blick zu, der besagte: Was macht dieser Idiot hier?
»Niekie nimmt nicht an der Operation teil«, erklärte Brenner.
»Von mir aus kann ich mitmachen«, sagte Niekie. »Egal wann, egal wo, ich bin bereit.«
Brenner stand am Grill und stocherte in der Kohle herum. »Sag’s ihnen, Niekie. Erklär ihnen, warum du hier bist.«
5
Es war, als hätte Niekie nur auf seinen großen Augenblick gewartet. »Ich habe das Geld gesehen. Ich stand so dicht davor!« Mit Daumen und Zeigefinger deutete er weniger als einen Zentimeter an. Dann zog er ein letztes Mal an seiner Zigarette und schnippte sie in Richtung Feuer.
Weit daneben.
»Niekie arbeitet für Ace Security«, erklärte Brenner. »Die Firma bewacht das Depot, in dem das Geld liegt.«
»Es ist eher ein altes Lagerhaus«, warf Niekie ein, der die Aufmerksamkeit genoss. »Früher war da ein großer Laden drin, und die jetzigen Besitzer haben das Gebäude zu einer Art Fort ausgebaut. Sie haben Stahlkammern reingesetzt und in kleinere Tresore aufgeteilt, mit unheimlich dicken Wänden und unheimlich dicken Türen. In den Tresoren liegt auch noch anderes Zeug, nicht nur Geld.«
»Anderes Zeug?«, fragte Jericho Yon stirnrunzelnd. Er klang gereizt, und man hört einen leichten Kap-Akzent heraus. »Was für anderes Zeug?«
»Ich weiß nicht, Mann, wir haben die anderen Tresore nie von innen gesehen.«
»Und woher weißt du dann, dass in dem einen Dollars drin sind?«
»Dazu kommen wir noch«, sagte Brenner.
Yon nickte leicht. Sein Haar bewegte sich kaum.
»Erzähl ihnen die Geschichte, Niekie«, sagte Brenner.
Der dicke Niekie war leicht angefressen. Er holte eine weitere Zigarette heraus und würdigte Yon keines Blickes, während er sprach. »Also, wir waren immer zu viert pro Schicht. Jede Schicht dauert acht Stunden. Und in den acht Stunden passiert rein gar nichts, denn es kommt nie jemand vorbei, und man sitzt nur rum, redet Scheiße, behält die Kameras im Auge und patrouilliert durch den Gang.«
Er klappte sein Zippo auf, zündete sich seine Zigarette an und klappte das Feuerzeug wieder zu. Geschickt, als hätte er es geübt.
»Der Gang ist ein langer Korridor zwischen den Tresoren, und man stellt sich immer wieder vor, was in den Dingern drin ist, denn man erzählt uns nichts. Aber es ist sicher, dass etwas drin ist, weil dieser Laden eine verdammte Festung ist. Eines Tages bei der zweiten Schicht, sechzehn Uhr bis Mitternacht, hat uns gegen sechs die Zentrale angerufen und Bescheid gesagt, dass um halb sieben ein Typ vorbeikommen und einen Schlüssel abgeben würde. Um acht würde dann ein anderer Typ kommen und den Schlüssel in Empfang nehmen, um in einem Tresor etwas zu überprüfen. Die Zentrale hat uns Codenamen für die beiden gegeben, und sie mussten jeweils den richtigen nennen. Romeo und Foxtrott. Romeo durfte nicht reinkommen, sondern sollte nur den Schlüssel abgeben. Foxtrott war der wichtige Typ, der durfte reinkommen. Er würde zu den Tresoren gehen, aber wir dürften ihn nicht begleiten, wir sollten im Kontrollraum bleiben. Die Kameras müssten wir ausschalten. Der Kontrollraum liegt vorne, neben der Tür. Eine Wahnsinnstür mit kugelsicherem Einwegspiegel, durch den man den Parkplatz im Blick hat. Neben dem Kontrollraum gibt es eine Küche und ein Klo. Jedenfalls kam um halb sieben Typ Nummer eins, Romeo, und brachte einen Schlüssel. So einen langen Spezialschlüssel mit ganz vielen Zacken unten dran. Wir wussten, dass der Schlüssel zu einem der Tresore passte, aber wir haben ihn nur übernommen und nichts damit gemacht. Dann haben wir bis acht Uhr auf den Foxtrotttypen gewartet, und die anderen von meiner Schicht haben Kaffee gekocht und sind schiffen gegangen, und auf einmal war ich allein mit dem Schlüssel, und da bin ich auf die Idee gekommen, mit meinem Handy Fotos davon zu machen. Von dem Schlüssel, nicht von dem Kollegen, der geschifft hat«, sagte Niekie und wartete darauf, dass jemand lachte.
Nur Igen Rousseau lächelte. Bestimmt aus Höflichkeit, dachte Chrissie.
Niekie zog an seiner Zigarette und blies betont langsam den Rauch aus. »Jedenfalls bin ich ungefähr eine Woche später mit den Fotos zu einem Kumpel von mir gegangen. War früher Schlosser, baut aber inzwischen elektrische Garagentore ein. Aber er kennt sich immer noch gut aus. Er hat gesagt, das wäre ein Z-Tech Chromium, ein superkomplizierter Sicherheitsschlüssel, aber auf dem Foto war deutlich die Seriennummer zu erkennen. Man kann solche Schlüssel online bestellen. Der Haken daran ist: Wenn man nur den Schlüssel bestellt, muss man einen Kaufnachweis vorlegen. Vom ganzen Schloss. Da dachte ich, ich versuch’s mal. Ich habe zwei Schlösser bestellt, sauteuer, fast viertausend für beide zusammen. Der Kaufnachweis war ein popeliges PDF-Dokument, und wenn man sich auskennt, kann man die ganz leicht verändern. Ich habe also die Seriennummer von dem Foto eingesetzt und einen Monat gewartet, dann habe ich den Schlüssel bestellt.«
Er trat die Kippe mit seinem schweren Stiefel aus.
»Und dann habe ich bei jeder Schicht auf meinem Rundgang eine andere Tresortür ausprobiert. Immer nur eine. Wenn ich wusste, dass die anderen Karten gespielt oder Kaffee gekocht haben oder sonst wie abgelenkt waren. Schließlich durften sie nicht sehen, was ich machte. Der Schlüssel passte auf den fünften Tresor. Ich habe reingeschaut und diesen Riesenberg Dollars gesehen, in Plastikfolie verpackt.«
»Woher weißt du, dass es zwanzig Millionen sind?«, fragte Yon herablassend und warf sein langes, schwarzes Haar über die Schulter.
Chrissie war genauso genervt von Niekie wie er. Sie kannte Männer wie Niekie Berry. Zu faul oder zu dumm, um Polizist oder Soldat zu werden, fanden sich aber trotzdem unglaublich cool – Actionfiguren in Uniform, oft mit Pistole auf der Hüfte, Großmäuler, die schwadronierten, welche Heldentaten sie vollbringen würden, wenn man sie nur ließe.
»Reine Mathematik, Mann«, antwortete Niekie. »Ich habe den Stapel ausgemessen. Er bestand aus Hundertern, Fünfzigern und Zwanzigern. Wenn es nur Zwanziger gewesen wären, wären es rund sieben- bis achttausend gewesen. Aber mit den Fünfzigern und den Hundertern dabei … Ich will nicht sagen, dass es genau zwanzig Millionen sind. Es könnten auch achtzehn sein oder fünfundzwanzig. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenhaufen Geld. Und das bei dem Wechselkurs, Mann! Auch wenn es nur fünfzehn Millionen Dollar wären, mal fünfzehn, wären das zweihundertfünfundzwanzig Millionen Rand!«
Chrissie unterdrückte den Impuls, den Kopf zu schütteln. Niekie glaubte, sie würden den offiziellen Wechselkurs für die gestohlenen Dollars erhalten. Dabei würden sie vielleicht fünf Rand pro Dollar bekommen, wenn sie Glück hatten. Trotzdem waren es dann immerhin noch 75 Millionen Rand, geteilt durch fünf, also 15 Millionen für jeden. Mehr als genug.
Sie fragte sich, welchen Anteil Niekie bekommen würde.
»Okay«, sagte Brenner. »Danke, Niekie. Jetzt begleite ich dich wieder raus, das verstehst du, oder?«
Niekie stand widerwillig auf. »Okay. Cool.« Er schaute Chrissie an. »Mach’s gut«, sagte er. »Wir sehen uns.«
Sie reagierte nicht und wartete gemeinsam mit den anderen in unbehaglichem Schweigen, während Niekie zur Hintertür ging. Igen Rousseau und Themba Jola hoben zum Abschied die Hand zum Gruß.
Nachdem sich die Hintertür geschlossen hatte, sagte Yon: »Zehn Prozent für dieses fette Arschloch? Das darf doch nicht wahr sein!«
6
Brenner klemmte das Fleisch in den Klapprost. Koteletts und Würstchen. Er sagte: »Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen, dass er nicht an der Operation teilnimmt.«
»Wie bist du denn an den gekommen?«, fragte Christina.
Brenner verzog die Lippen zu seinem schmalen Lächeln. »Ich war mit seiner Schwester verheiratet.«
Sie hatte nicht gewusst, dass er verheiratet gewesen war.
»Sogar SEKs machen manchmal Fehler«, bemerkte Themba Jola.
Brenner nickte. »Es hat keinen Zweck, wenn man nie zu Hause ist. Sie ist eine liebe Frau. Ganz anders als Niekie. Er ist das schwarze Schaf der Familie.« Er legte den Rost über die Kohle und wandte sich an Christina. »Er hat von meiner Ex gehört, dass ich aus Simbabwe zurück bin. Da ist er zu mir gekommen. Mit seinem Vorschlag.«
»Bestimmt wollte er die Operation leiten«, bemerkte Jericho Yon.
Christina gefiel es nicht, dass Niekie an der Sache beteiligt war. Sie versuchte, ihr Unbehagen in Worte zu fassen. »Wenn die Chandas erfahren, dass ihr Geld gestohlen wurde … Dann werden sie sich zuerst das Security-Personal vorknöpfen. Die können sich doch denken, dass Insider daran beteiligt sein müssen.«
»Chrissie hat recht«, sagte Rousseau. »Aber erstens werden die wohl kaum die Polizei einschalten. Das Geld haben sie dem südafrikanischen Staat gestohlen. Zweitens hat die Security ein rotierendes System. Niekie arbeitet schon seit vier Monaten nicht mehr im Depot. Es ist unwahrscheinlich, dass er unter Verdacht gerät.«
»Aber er ist so ein Idiot, dass er seine zehn Prozent garantiert mit dicken Karren und Frauen verprasst«, unkte Yon. »Ich kenne solche Typen. Er ist ein Risiko.«
Brenner drehte den Rost. »Es gibt immer Risiken, Jericho.«
»Liegt in der Natur der Sache«, stimmte ihm Themba Jola zu.
»Wenn er anfängt, mit dem Geld um sich zu schmeißen, kümmere ich mich darum«, versprach Brenner.
»Wenn er vor vier Monaten zuletzt im Depot war, woher wissen wir dann, dass das Geld noch da ist?«, fragte Christina.
»Weil seine Kollegen das Lager immer noch bewachen.«
»Und woher wissen wir, dass das Geld wirklich von den Chandas stammt?«, hakte sie nach.
»Niekie hat doch von dem zweiten Typen erzählt, der den Schlüssel an sich genommen und den Tresor geöffnet hat, diesem Foxtrott.«
»Ja.«
»Niekie hat gesagt, dass er zwei Wochen später einen Bericht in den Nachrichten gesehen hat, über die Zamisa-Kommission, ihr wisst schon, Richter Zamisa, der die Ermittlungen hinsichtlich der Staatsplünderung und Korruption geleitet hat. Dabei wurde ein Foto von Foxtrott gezeigt, dessen richtiger Name offenbar Ishan Babbar lautet.«
Christina sagte der Name nichts. »Und wer soll das sein?«
»Babbar«, wiederholte Brenner. »Er ist …«
»Ein ganz übler Kerl«, sagte Themba Jola.
»Er hat für den Inlandsgeheimdienst gearbeitet«, fuhr Brenner fort. »Unter unserem ehemaligen Präsidenten, Joe Zaca. Er hat die Drecksarbeit gemacht. Die Staatsanwälte der Zamisa-Kommission sagen, er hätte Zaca mit den Chandas bekannt gemacht. Ein Mittelsmann und der Vollstrecker für alle.«
»Wie sicher ist sich Niekie, dass er es war?«
»Todsicher.«
»Der Vollstrecker?«, fragte Christina.
»Wenn man nicht tat, was die Chandas wollten, schickten sie Babbar vorbei, um einem auf die Sprünge zu helfen«, erklärte Rousseau.
»Oder einen aus dem Weg zu räumen«, ergänzte Brenner.
»Wird er dann auch den Diebstahl untersuchen?«, fragte Chrissie.
»Sicher. Aber er wird uns niemals erwischen.«
»Es sei denn, der Fettkloß legt uns rein«, sagte Jericho Yon.
»Ich werde mich darum kümmern«, sagte Brenner.
7
Sie aßen drinnen am Esstisch.
Die Männer redeten über Sport. Rugby und Fußball.
Christina fragte sich wiederholt, was sie da eigentlich machte. Bei diesen Männern, dem Blatjang, dem Ketchup und den weißen Papierservietten.
Sie vertraute Rousseau und Brenner, weil Ehrlichmann ihnen vertraut hatte.
Und sie hatte Ehrlichmann vertraut, weil ihr Vater Gutes über ihn berichtet hatte. Dass er integer gewesen sei. Dass er die Natur Afrikas bewahren und beschützen wollte, und zwar aus uneigennützigen Gründen, nicht für Geld oder Ansehen oder eine Fernsehserie auf National Geographic. Sondern weil er diese Natur aus tiefstem Herzen liebte.
Und sie hatte Ehrlichmann vertraut, weil sie in den paar Monaten der Zusammenarbeit mit ihm erkannt hatte, dass er tatsächlich so war.
Brenner schob seinen leeren Teller beiseite, legte Messer und Gabel akkurat darauf ab und blickte in die Runde. »Okay, los geht’s. Es gibt ein paar Regeln. Nummer eins: Handys. Wir – Igen und ich – haben euch alle persönlich angeworben, wir haben nie eure Handynummern benutzt. Dabei wollen wir es auch belassen. Ihr alle bekommt gleich neue Handys von mir. Ihr werdet sie auf keinen Fall zum Telefonieren benutzen, sondern nur über Telegram kommunizieren. Falls ihr es nicht kennt: Es ist ein Messengerdienst, verschlüsselt und sicher, wir haben ihn schon für euch heruntergeladen. Ihr verschickt damit ausschließlich Nachrichten an Gruppenmitglieder. Nummer zwei: kein Alkohol, keine Drogen. Ihr könnt saufen, so viel ihr wollt, wenn ihr das alles hinter euch habt, aber bis dahin keinen Tropfen. Nummer drei: keine festen Gewohnheiten. Wir treffen uns nie zweimal am selben Ort. Versucht aber auch, euer eigenes Verhalten unvorhersehbar zu machen. Geht nicht immer in denselben Coffeeshop, dasselbe Restaurant oder denselben Supermarkt. Und Nummer vier, das versteht sich wohl von selbst: Redet mit niemandem über die Operation. Irgendwelche Fragen?«
Keiner hatte Fragen.
Brenner nickte Igen zu.
Rousseau sagte: »D-Day ist Samstag, der dritte April. Warum der dritte April? Weil es das Osterwochenende ist. Die Typen von der Security werden die Nase voll und keinen Bock auf die Arbeit haben. Und wenn sie Alarm schlagen, wird die Reaktion darauf hoffentlich langsamer ausfallen als normalerweise. Wir peilen achtzehn Uhr an, dann ist die Schicht schon zwei Stunden da und hat noch sechs Stunden vor sich, bevor die nächste auftaucht. Wir haben sechs Stunden, um so weit wie möglich abzuhauen. Der dritte April bedeutet außerdem, dass wir von jetzt an achtundzwanzig Tage haben. Wir glauben, dass die Zeit ausreicht, um zu planen, zu üben und die Fahrzeuge zu besorgen. Aber die große Frage ist …« – er schaute Christina an – »… kannst du in dieser Zeit die Dollarhändler aktivieren?«
»Ich werde runter ans Kap müssen.«
Brenner und Rousseau sahen sich an.
»Was ist?«, fragte Christina.
»Wir dachten, deine Kontakte sitzen in Simbabwe«, sagte Rousseau.
»Oder weiter nördlich«, sagte Brenner.
Sie schüttelte nur den Kopf, insgeheim dankbar dafür, dass sie so wenig von damals wussten.
»Kannst du morgen schon los?«, fragte Brenner.
»Ja.«
»Was meinst du, wie schnell du alles regeln kannst?«
»Keine Ahnung. Es sind alte Kontakte …«
»Brauchst du mehr als eine Woche?«
»Hoffentlich nicht.«
»Okay«, sagte Rousseau. »Lasst uns den Tisch abräumen. Es wird Zeit, euch zu zeigen, womit wir arbeiten.«
8
Rousseau hatte einen Aktenordner, strahlend blau wie der Himmel Afrikas. Er schlug ihn auf und holte ein paar Fotos heraus.
Das Lager war ein unauffälliges, einstöckiges Gebäude, ein wenig heruntergekommen, in einer Art Industriegebiet. Vor dem Gebäude erstreckte sich eine weitläufige Asphaltfläche.
»Das ist das Depot«, erklärte Rousseau. »In Sparta. In der Nähe von Kempton Park.«
»Sieht wie eine Ruine aus«, bemerkte Jola.
»Ich glaube, genau deshalb haben sie es ausgewählt«, erwiderte Jericho Yon.
»Deswegen, und auch wegen der Entfernung zur Straße«, ergänzte Rousseau. »Diese Teerfläche war früher der Parkplatz. Schaut, da ist die Kamera, die das Areal abdeckt. Die Security sieht uns von Weitem kommen. Auf den einzigen Eingang zu. Alle anderen sind zugemauert. Der Eingang besteht aus einer Doppeltür aus Stahl und Beton. Neben der Tür – man sieht es hier nicht richtig, es liegt im Schatten – befindet sich ein Fenster, ungefähr drei Meter breit, einen Meter über dem Boden. Doppelverglasung, kugelsicher, einwegverspiegelt. Sie können euch sehen, aber ihr sie nicht. Unter dem Fenster befindet sich eine Gegensprechanlage, so dass sie hören können, was ihr sagt, wenn ihr draußen seid. Das Gebäude ist ideal für seine Zwecke geeignet. Es gibt keine einzige Schwachstelle.«
»Was ist mit dem Dach?«, fragte Themba Jola.
»Flachdach, Stahlbeton.«
»Okay.«
»Der Schwachpunkt sind die Leute«, fuhr Brenner fort.
»Die Security«, sagte Rousseau.
»Niekie hat gesagt, sie sind unmotiviert, unterbezahlt und überentspannt. Gelangweilt. Es passiert nie etwas. Ab und zu klingelt ein Hausierer, den sie so lange ignorieren, bis er weggeht«, sagte Brenner. »Es gibt keine Lieferungen; das Zeug in den Tresoren war von Anfang an dort. Nichts wird rausgeholt, nichts wird reingebracht.«
»Sie spielen Poker, schauen YouTube und Pornos auf ihren Handys, kochen Kaffee und Tee, sie essen und beklagen sich«, sagte Rousseau.
»Und sie reden über Sex«, fuhr Brenner fort.
»Die ganze Zeit«, sagte Rousseau.
»Und das machen wir uns zunutze.«
Christina wollte ein Uber bestellen, aber Rousseau bot ihr an, sie zum Flughafen zu fahren.
Sie nahmen einen Toyota Hilux mit Einzelkabine, ungefähr zehn Jahre alt, absolut unauffällig. Unterwegs auf der N1, kurz hinter Doringkloof, fragte er: »Warum machst du mit?«
Sie schaute zum Fenster hinaus auf den stockenden Verkehr. »Ich vertraue euch. Dir und Brenner.«
»Nein. Ich meine, warum hast du deinen Job in Letsatsi aufgegeben? Du hattest da … Das war doch deine große Leidenschaft.«
»Reiche, verkaterte Touristen durch den Busch zu führen?«
»Nein, ich meine, der Busch. Afrika. Tut mir leid, es geht mich ja eigentlich nichts an.«
»Ich weiß, was du meinst«, sagte sie. »Schon in Ordnung.« Sie deutete hinaus auf die Masse langsam dahinrollender Fahrzeuge, die Menschen, die starr geradeaus schauten. »Schau, es ist entweder das da, diese sinnlose Existenz, dieses seelentötende Leben von neun bis fünf auf einer Arbeitsstelle, die man im Grunde nicht mal mag. Und jedes Jahr schuldest du der Bank mehr, ständig fällt der Strom aus, die Straßen haben jeden Morgen mehr Schlaglöcher, mehr Ampeln sind kaputt, und du musst hilflos mitansehen, wie dein Land und deine Umgebung allmählich vor die Hunde gehen. Oder du wirst Safariführerin in einer Afrika-Illusion, die nur noch in den Blasen der Reservate und in den Köpfen von Amerikanern und Europäern existiert. Das Afrika von Ehrlichmann und meinem Vater ist tot. Die Blasen werden immer kleiner. Ich will raus, bevor …«
»Bevor es dir das Herz bricht.«
»Ja, bevor es mir das Herz bricht.«
9
Im Flieger hörte sie Rossinis Streichersonaten und dachte über Rousseaus Frage nach.
Ihre Antwort war nur ein kleiner Teil der Wahrheit gewesen; die Ohren des Flusspferds, die über das Wasser ragten, der größte Teil verbarg sich unter der Oberfläche. Aber Igen hatte sich erst einmal damit begnügt.
Und wenn sie ihm die ganze Wahrheit erzählen würde?
Dann hätte sie vielleicht gesagt: »Igen, als wir uns vor sieben Jahren begegnet sind, war mein Motto ›Scheiß auf die ganze Menschheit‹. Denn diese Menschheit hatte nichts anderes verdient. Diese Menschheit, die alles, was gut, richtig und schön war, zerstörte. Was zum Beispiel? Zum Beispiel meinen Vater. Die Menschheit hat meinen Vater verraten, verstoßen und verspottet. Weil er anders war. Die Menschheit macht unsere Erde kaputt. Bringt Ökosysteme zum Kippen. Löscht Kulturen aus. Ich denke so oft an das, was mir mein Vater über seine Zeit bei den Buschleuten erzählt hat. Diese Harmonie, diese Wertschätzung, der Respekt einander und der Umwelt gegenüber, in der sie lebten. Alles ist weg, Igen, alles weg! Nicht nur die Umwelt, auch die Werte gibt es nicht mehr. Zugrunde gerichtet. Ausradiert.
Dieses ›Scheiß auf die ganze Menschheit‹ hat mich dazu gebracht, ziemlichen Mist zu bauen. Ich will mein Verhalten nicht schönreden; ich will nur erklären, wie es dazu kommen konnte. Als alles den Bach runterging, musste ich untertauchen. Zwei Jahre lang war ich in Europa, danach vier Jahre lang im Okavangodelta, wo ich einen Zufluchtsort gefunden hatte. Ich bin für eine Weile von der Bildfläche verschwunden, dorthin, wo ich dem, was ich kenne und liebe, näher sein konnte, und auch meinem Vater.
Allmählich bin ich wieder zu mir gekommen und habe das Schlimme und Schmerzliche verarbeitet, das passiert war. Mein Gleichgewicht wiedergefunden. Bin bequem geworden. Habe angefangen, mich zu langweilen, um ehrlich zu sein. Vor ein paar Monaten dann habe ich über die Elefantenkuh gelesen, die als Letzte ihrer Art in den Wäldern bei Knysna überlebt hatte. Alle anderen ihrer Spezies waren ausgerottet worden. Irgendwann tauchte diese alte Kuh auf, der Wildhüter hat sie gefilmt. Er hat gesagt, ihm sei es vorgekommen, als habe sie den ganzen Wald abgesucht nach ihrer Herde. Das hat mich irgendwie ganz tief getroffen, Igen. Denn diese Kuh hat gehofft, die anderen irgendwann zu finden. Kannst du dir vorstellen, wie einsam sie sein muss, wie sehnsüchtig, wie sie trauert und hofft? Du weißt, dass Elefanten trauern. Du hast Ehrlichmann lange genug begleitet, um es mit eigenen Augen gesehen zu haben.
Ich habe mich gefragt, warum mich das Schicksal dieser Kuh so tief betroffen und traurig gemacht hat. Und irgendwann wurde mir klar, Igen, dass ich so bin wie sie. Ich war im Okavango, weil ich insgeheim gehofft habe, ich würde meine Herde wiederfinden. Aber auf einmal wurde mir klar, dass das unmöglich war. Meine Herde war tot. Ich musste da raus. Aber wie? Und dann kamst du mit deinem Angebot, und auf einmal wusste ich die Lösung.
Deswegen habe ich zugestimmt.«
Was Igen wohl dazu gesagt hätte?
Auch das war nur ein Teil der Wahrheit. Aber sie würde ihm weder das noch die volle Wahrheit erzählen, denn man musste seine Schwächen verbergen. Menschen waren wie kichernde Tüpfelhyänen. Sie suchten gezielt nach deinen Schwächen. Und anders als Löwen, die man konfrontieren und anschreien konnte, gab es kein Entkommen, wenn einen des Nachts ein Rudel Tüpfelhyänen jagte.
Es war sechs Jahre her, dass sie zuletzt am Kap gewesen war. Kapstadt hatte sich verändert, und irgendetwas war in diesem Prozess verloren gegangen. Etwas vom typischen Charakter der Stadt, fand sie. Ein Teil von dem, was sie ausgemacht hatte.
Altmans Büro befand sich an der Ecke Loopstraat und Riebeekstraat im ersten Stock eines malerischen, zweistöckigen viktorianischen Hauses. Sie wusste, dass er ihr nicht freiwillig einen Termin einräumen würde, deswegen wartete sie an einem Cafétisch an der Straße auf ihn. Um die Mittagszeit, denn sie rechnete damit, dass sich Altman nicht verändert hatte. Er war ein Mann, der Wert auf sein Mittagessen legte, wie er gerne betonte. Er arbeitete von frühmorgens bis um eins und gönnte sich dann ein gutes Essen und ein gutes Glas Wein in einem guten Restaurant. »Das muss man sich verdienen, kezele. Und ich verdiene mir das jeden Tag«, hatte er gesagt, als sie sich am Tisch gegenübersaßen und sie zugesehen hatte, wie er ein Stück von seinem blutigen Filetsteak abschnitt.
Sie wartete darauf, dass es eins wurde, bestellte koffeinfreien Kaffee und trank langsam.
Christina erinnerte sich daran, wie sie zum ersten Mal bei ihm gewesen war, und dachte: Mann, war ich damals fertig. So verletzt. So wütend. So rücksichtslos und furchtlos.
Sie war durch eine merkwürdige Verkettung der Umstände auf ihn aufmerksam geworden. Sie hatte nicht gewusst, wie sie die Rohdiamanten loswerden sollte, und da hatte sie auf dem Flughafen Chizarira in Simbabwe zufällig eine liegen gelassene Zeitung aufgelesen, eine Ausgabe des Cape Argus. Die Titelseite zeigte das Foto eines weißen Anwalts und eines Schwarzen Bandenbosses vor dem Obersten Gerichtshof in Kapstadt. Der Untertitel lautete: Restless-Ravens-Boss Willem »Tweetybird« de la Cruz und sein Anwalt David Altman nach ihrem gestrigen Sieg vor dem Obersten Gerichtshof.
Acht Tage später hatte sie in Altmans Büro gesessen und ihm ein Angebot gemacht.
»Zieh dich aus, kezele«, hatte er gesagt.
»Sie spinnen wohl!«
»Ich will nur sichergehen, dass du nicht verkabelt bist. Runter mit den Klamotten oder raus aus meinem Büro.«
Da hatte sie sich ausgezogen. Komplett. Er hatte einen Kreis mit dem Zeigefinger beschrieben, um ihr zu bedeuten, dass sie sich umdrehen sollte, und sie hatte sein listiges Grinsen gesehen, als er sie ansah.
»Sehr hübsch«, hatte er gesagt.
»Sie haben sie doch nicht alle!«
Christina zog sich wieder an, und sie trafen eine Vereinbarung.
Wütend, kaputt, rücksichtslos und furchtlos.
Beim Mittagessen hatte sie ihn gefragt, was kezele bedeutete. »Es ist ein jüdisches Kosewort und bedeutet ›Kätzchen‹.«
Das Diamanten-Ding war ein Reinfall.
Sie trank von ihrem Koffeinfreien und fragte sich, was er sagen würde, wenn er sie wiedersah.
10
Sie ging auf dem Bürgersteig hinter ihm her.
Er war alt geworden. Sein Gang war nicht mehr so selbstsicher, die Locken waren gänzlich ergraut. Aber sein Anzug war noch immer maßgeschneidert, die goldenen Manschettenknöpfe blitzeblank. Sie sagte seinen Namen, und er drehte sich um. Im ersten Augenblick hellte sich seine Miene auf beim Anblick der hübschen jungen Frau, doch dann traf ihn die Erkenntnis. Seine Augenbrauen hoben und senkten sich, sein Mund ging auf, Wut und Angst spiegelten sich in seiner Mimik wider.
Schließlich fluchte er: »Kus Emek!«, und wich vor ihr zurück.
»Ich will Ihnen ein Angebot machen«, sagte sie.
»Hau ab!«, erwiderte er, drehte sich um und eilte zielstrebig die Loopstraat hinauf.
Christina schloss zu ihm auf. Er war einen Kopf größer als sie, erschien ihr aber kleiner als in ihrer Erinnerung. »Zwanzig Millionen Dollar in Hundertern, Fünfzigern und Zwanzigern. Ich brauche jemanden, der sie wechseln kann. Elektronische Überweisung gegen Cash.«
Er verlangsamte kurz seine Schritte.
Sie fasste Mut und fuhr fort: »Ich nehme elf Rand pro Dollar.«
Er ging weiter. An der Kreuzung Strandstraat mussten sie an einer roten Ampel stehen bleiben, umgeben von anderen Passanten. Altman sah sie nicht an.
Die Ampel sprang auf Grün. Er ging weiter, Chrissie neben ihm her. Sie ließ ihm Zeit, das Ganze zu verarbeiten.
Vorbei an Madmacs Motorcycles. Dann blieb er stehen. »Deinetwegen wäre ich beinahe umgebracht worden! Wenn sie Tweetybird nicht erwischt hätten, wäre ich dran gewesen!«
Es war eine grobe Verdrehung der Wahrheit, aber sie widersprach ihm nicht. »Zehn Rand pro Dollar.«
Er starrte sie einfach nur an. »Du bist mir eine, kezele. Du bist mir schon eine.«
Sie reagierte nicht; wartete einfach nur ab.
Der Blick, mit dem Altman sie ansah, veränderte sich allmählich. Die Wut wich Erstaunen. Genau so hatte er sie angeschaut, als sie nackt vor ihm gestanden hatte.
»Darf ich dich zum Mittagessen einladen?«, fragte er.
Das Restaurant in der Parlementstraat hieß FYN. Die Höhe des Raumes und die Kunstinstallationen zwischen den Hängeleuchten raubten ihr den Atem.
Der Manager begrüßte Altman mit Namen und gab ihnen einen Tisch am Fenster. Christina warf einen Blick auf die Speisekarte.
»Eine bedeutende Summe«, sagte er. »Zwanzig Millionen.«
»Aber Sie sind ja auch ein bedeutender Geschäftsmann, David.«
»Ist das Geld heiß?«
»Das ist ja das Gute daran. Ist es nicht. Es wird weder Wirbel in den Medien noch polizeiliche Suchaktionen geben.«
»Meine Güte, du bist wirklich nicht mehr mein kleines naives kezele, stimmt’s? Wie alt sind die Scheine?«
»Neu. Drei bis vier Jahre alt.«
Er nickte. Das war gut. »Ich muss mich ein bisschen umhören. Die Summe aufteilen. Sie ist zu groß für eine einzige Transaktion.«
»Ich brauche aber einen Online-Transfer. Ich zeige das Bargeld, Sie erledigen die Überweisung. Zeitgleich.«
»Zehn Rand pro Dollar wirst du nicht bekommen. Du hast Glück, wenn du vier kriegst.«
»Ich habe ein Angebot über acht fünfzig«, log sie.
»Fünf.«
»Nein.« Doch wenn er dabei bliebe, würde sie darauf eingehen. Es war angemessen unter diesen Umständen, und es bedeutete, dass sie 100 Millionen Rand erhalten würden. 18 Millionen für jeden, selbst, nachdem Niekie Berry seine zehn Prozent bekommen hatte.
»Dann schlage ich vor, dass du die Acht fünfzig nimmst.«
»Okay.« Sie stand auf.
»Das Essen hier ist phantastisch«, sagte er.
»Auf Wiedersehen, David.«
»Sechs. Das ist mein letztes Wort.«
Sie setzte sich.
Er lächelte selbstzufrieden. »Nimm das Edelfisch-Sashimi. Es ist ein Genuss.«
Als sie fertig gegessen hatten, tupfte er sich den Mund mit der Leinenserviette ab, lehnte sich zurück und sah sie an. »Kannst du dich noch an den Tag in meinem Büro erinnern, als ich dir sagte, du solltest dich ausziehen?«
Sie sah ihn nur an.
»Eines an diesem Moment werde ich niemals vergessen. Deine Augen, kezele. Versteh mich nicht falsch, auch alles andere an dir war spektakulär. Aber deine Augen … Eine solche Intensität hatte ich noch nie gesehen. Eine so grenzenlose Wut. Das werde ich bis ans Ende meines Lebens nicht vergessen.«
11
Jeden vierten Tag zog sie in eine andere Airbnb-Wohnung in der Umgebung Pretorias um – Moreleta Park, Waverley, Lynnwood und Faerie Glen. Nur sie, ihr Rucksack und ihre Reisetasche. Sie fuhr mit Uber, DiDi oder Bolt.
Im Rucksack steckte alles, was sie zum Überleben brauchte; notfalls konnte sie ihn überwerfen und losrennen. Ganz unten, in einer versteckten, festgenähten kleinen Tasche waren drei Pässe und genügend ausländische Währung – Euros und Dollars –, um damit sechs Monate lang überleben zu können. Darüber, ordentlich und kompakt, befanden sich zwei Paar Strümpfe, eine aufgerollte Jogginghose, zwei T-Shirts, ein BH, zwei Unterhosen und eine dünne Windjacke, die in einer eigenen kleinen Tasche verstaut werden konnte. Ein Schminktäschchen, ein Reisenecessaire, eine Sonnenbrille mit Etui, eine normale Brille mit Etui, ein Päckchen Tampons, ihr Portemonnaie sowie ein Döschen mit extra Kopfhörern, einem Kabel und einem Ladegerät. Und das Handy, das sie hauptsächlich zum Musikhören benutzte.
In der Reisetasche war ihre übrige Kleidung verstaut.
Jede neue Wohnung, jede neue Umgebung machte ihr wieder bewusst, wie seltsam es war, hier zu sein. Sie hatte noch nie länger als ein paar Monate in einer Stadt oder an einem Ort gelebt. Ihre ersten beiden Lebensjahre gemeinsam mit ihrer Mutter auf Alldays zählten nicht; daran konnte sie sich nicht erinnern. Ihr Vater hatte zu der Zeit als Jagdguide in Botswana und Simbabwe gearbeitet.
An ihre Mutter konnte sie sich gar nicht mehr erinnern, und ihr Vater hatte sich stets geweigert, von ihr zu erzählen.
Egal.
Ihr Vater, Louis, hatte sie nach dem Tod der Mutter zu sich geholt. Christina war bei ihm im Busch aufgewachsen. Die Stadt war ihr fremd, und sie mochte sie nicht. Menschen hinter Mauern und Elektrozäunen, die Straßen abends verlassen, einsame Hunde, die unaufhörlich bellten.
In jeder neuen Wohnung holte sie sich zuerst etwas zu essen von Woolworths. Ohne Woolies Food ging gar nichts. Dann suchte sie sich das nächstgelegene Fitnessstudio, joggte auf dem Laufband und hörte dabei über Kopfhörer Schostakowitsch oder Tschaikowsky.
Abends las sie. Auch dabei hörte sie leise Musik, Vivaldi, Corelli oder Bach, bis der Schlaf sie übermannte.
Manchmal dachte sie an die Frau, die ihr diese Musik nahegebracht hatte. Inès Fournier, die französische Professorin, die Strandwölfe – auch als Schabrackenhyänen bekannt – in der Kalahari erforscht und Louis van Jaarsveld als Spurenleser engagiert hatte, sieben Monate lang.
Chrissie war damals elf Jahre alt gewesen. Ihr richtiger Name lautete Cornelia Johanna van Jaarsveld. Ihr Vater hatte sie Floh genannt, weil sie so klein war. Sie schämte sich für ihre langen dünnen Beine mit den knubbeligen Knien. Vormittags begleitete sie ihn draußen im Veld, nachmittags musste sie im großen Zelt am Fernunterricht teilnehmen. Abends saß sie mit ihren Büchern am Feuer, während die Musik der Französin lief. Die Professorin war klug. Sie zwang Floh die Musik nicht auf. Sie wartete, bis ihr das Kind vertraute und von sich aus neugierig wurde. Als Floh begann, sie auszufragen, über die Komponisten, die Stile und Epochen, hatte Fournier ihr mit Geschichten geantwortet. Über Edvard Grieg, der immer einen Spielzeugfrosch in der Tasche hatte, als Glücksbringer. Mozart, der die atemberaubende Ouvertüre für Don Giovanni in nur drei Stunden geschrieben hatte – am Morgen der Uraufführung der Oper, mit einem fürchterlichen Kater. Über Chopin, der mit einem Fläschchen polnischer Erde begraben wurde. Über Beethoven, der exakt 60 Bohnen abzählte, wenn er sich Kaffee kochte. Über Händel, der immer Speisen für drei Leute bestellt und alles selbst gegessen hatte. Über Dvořák und seine Liebe zu Zügen. Flohs Lieblingsgeschichte war die über die Begegnung zwischen Mozart und dem jungen Beethoven. Die Professorin hatte gesagt, wenn sie in der Zeit zurückreisen könnte, dann wolle sie gerne dorthin, um Mäuschen zu spielen.
Sie war die einzige Mutterfigur, die Chrissie je gehabt hatte. Ihre Liebe zur Musik und ihre Bewunderung für Strandwölfe hatte sie von ihr.
Im Menlyn-Park-Einkaufszentrum suchte sie sich ein Kleid, Schuhe und eine Handtasche für den Überfall aus. Sie sah junge Leute, die an ihren Handys klebten, und aufgebrezelte Frauen, die, mit Einkaufstüten beladen, hastig von einem Geschäft zum anderen trippelten. Geschäftsleute, die aßen und tranken und sie interessiert musterten. Leute, die umherirrten wie in einem Labyrinth. Musik aus der Konserve, Luft aus der Konserve und künstliches Licht – so würde sie niemals leben wollen.
Sie bezahlte ihre Einkäufe.
Unterwegs schaute sie im Buchladen vorbei und fragte nach, ob es einen neuen Azille Coetzee gab. Nein, noch nicht. Sie kaufte Schöne Welt, wo bist du von Sally Rooney und Mara von Marida Fitzpatrick. Mit Rooneys Buch und einem koffeinfreien Cappuccino setzte sie sich an einen Tisch vor der Seattle Coffee Company. Auf einmal bemerkte sie, dass jemand sie ansah. Es war eine Frau, die ihr gegenübersaß. Attraktiv, Ende vierzig. Schick angezogen, Kleid und hochhackige Schuhe. Ein Ehering am Finger. Chrissie schaute auf und sah ihr in die Augen. Sie las ein subtiles Verlangen darin, eine zarte Einladung. Einen Augenblick lang dachte sie darüber nach. Geriet in Versuchung. Umarmt zu werden. Hände auf ihrem Körper zu spüren. Haut auf Haut. Mund auf Mund. Zwei, drei Stunden langsamer, mitreißender Genuss. Es war elf Monate her, seitdem sie zum letzten Mal mit jemandem zusammen gewesen war.
Aber nicht jetzt.
Sie lächelte und schüttelte leicht den Kopf. Erntete ein kleines, enttäuschtes Lächeln.
Christina stand auf und ging.
Sie dachte über die Frau und ihre Einsamkeit nach.
Die Perücke kaufte sie im Zentrum, in der Strubenstraat. Die Straßen waren belebt, schmutzig und laut.
Zutiefst erleichtert floh sie in einem Uber zu ihrer Wohnung.
12
Zwei Wochen bis D-Day.
Sie trafen sich in Jericho Yons vorübergehender Wohnung in Lynnwood, tranken Instantkaffee und aßen Kekse.
Chrissie fühlte sich inzwischen weniger fremd und begegnete ihnen weniger distanziert.
Brenner begann: »Also gut, ich denke, Phase eins ist gut gelaufen. Wir sind auf dem Weg. In Phase zwei geht’s um das Verladen der Fracht. Das große Problem ist das Gewicht. Geldscheine sind wesentlich schwerer, als man meinen könnte. Wenn es nur Zwanzigerscheine wären, würden zwanzig Millionen Dollar etwa eine Vierteltonne wiegen. Das ist eine ganze Menge zu schleppen für vier Leute.«
»Wieso vier?«, fragte Themba Jola.
»Denk daran, dass Jer draußen im Hino sitzt. Er hält die Augen offen und überwacht den Funk«, erklärte Rousseau.
»Stimmt«, sagte Jola. »Das ergibt Sinn.«
»Okay«, sagte Brenner. »Wir nehmen vier Einkaufswagen im Lkw mit, einen für jeden. Arbeitet konzentriert und mit ganzer Kraft. Ihr ladet die Pakete ein, schiebt sie raus, werft sie hinten in den Lkw. So weit, wie ihr könnt. Haltet euch nicht damit auf, sie ordentlich zu stapeln. Zeit ist der entscheidende Faktor. Wer zuletzt rauskommt, sagt den anderen Bescheid. Wir schließen die Türen hinter uns. Nehmt eure Einkaufswagen mit. Wir dürfen sie nicht dalassen, sondern laden sie hinten in den Lkw. Themba und ich steigen mit ein, Igen und Chrissie nehmen ihren Atos.«