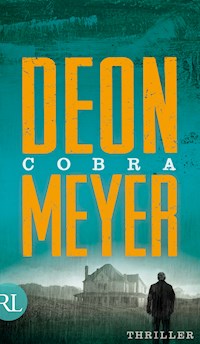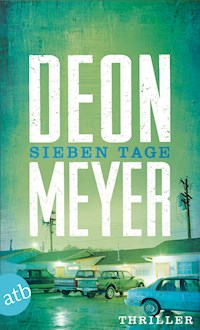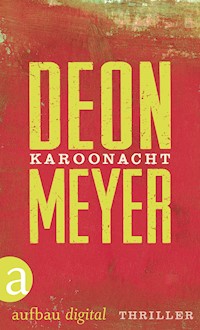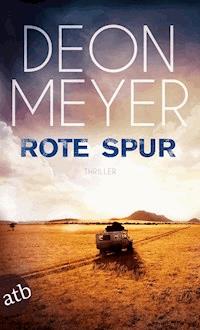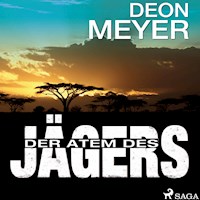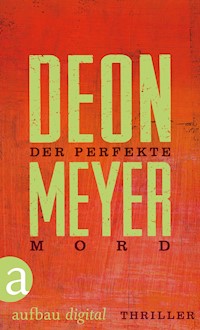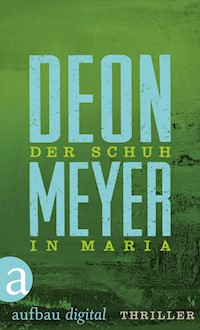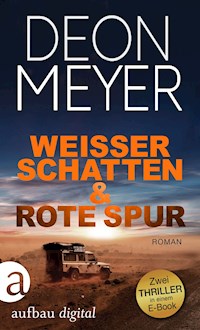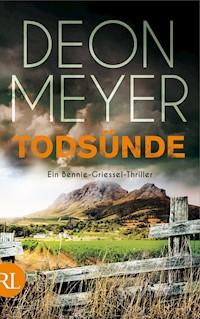
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Benny Griessel Romane
- Sprache: Deutsch
Gefährliche Gier.
Bennie Griessel und sein Partner Vaughn Cupido sind in Schwierigkeiten. Aus disziplinarischen Gründen werden sie auf einen Posten ins vermeintlich ruhige Städtchen Stellenbosch abgeschoben. Doch kaum angekommen halten sie zwei Fälle in Atem. Ein Student, der sich bei ihren Nachforschungen als genialer Hacker erweist, verschwindet spurlos. Wenig später wird ein zweiter Vermisstenfall gemeldet. Der skrupellose Geschäftsmann Jasper Boonstra, der viele Menschen um ihr Geld betrogen hat, ist ebenfalls verschwunden. Und dann wird auch noch ein hochrangiger Polizist in Kapstadt erschossen – und Bennie ahnt, dass die Fälle irgendwie zusammenhängen ...
Hochspannend und mit einem unverwechselbaren Ton – Deon Meyer schreibt raffinierte Thriller mit herausragenden Charakteren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Polizei-Unteroffizier Milo April wird an der Kapstädter Waterfront erschossen. Kaltblütig, am helllichten Tag – eine Hinrichtung. Könnte ein hochrangiger SAPD-Offizier dahinterstecken? Und hängt dieser Mord mit den geheimnisvollen Briefen zusammen, die die beiden geschassten Valke-Ermittler Bennie Griessel und Vaughn Cupido erhalten haben?
Die Hinweise auf einen neuen Fall von Staatskorruption in großem Stil enthalten? Wenn sie diesen Fall aufklären könnten, wäre ihre Karriere gerettet und ihre Ehre wieder hergestellt. Doch sie müssen insgeheim ermitteln, mit dem Risiko, endgültig ihre berufliche Zukunft zu verspielen, falls sie erwischt werden …
Noch dazu müssen sie ihre Zeit damit vergeuden, einen Studenten aus Stellenbosch aufzuspüren, der, scheinbar nach einem durchgefeierten Wochenende, spurlos verschwunden ist. Und was läuft zwischen Jasper Boonstra, dem steinreichen, berühmt-berüchtigten Betrüger, und der attraktiven, verzweifelten Maklerin Sandra Steenberg?
Griessel und Cupido halten sich an ihre bewährte Strategie: Mund halten, Kopf zusammenhalten, durchhalten. Während ihre Vorgesetzten toben und die Medien unmenschlichen Druck auf sie ausüben. Und sie allmählich erkennen, dass es der dunkelste Trieb ist, der hinter allem steckt – Habgier.
Über Deon Meyer
Deon Meyer wurde 1958 in Paarl, Südafrika geboren. Seine Romane wurden bisher in 27 Sprachen übersetzt. Er lebt mit seiner Stellenbosch, in der Nähe von Kapstadt.
Im Aufbau Taschenbuch Verlag liegen seine Thriller „Tod vor Morgengrauen“, „Der traurige Polizist“, „Das Herz des Jägers“, „Der Atem des Jägers“, „Weißer Schatten“, „Dreizehn Stunden“, „Rote Spur“, „Sieben Tage“, „Cobra“, „Icarus“, „Fever“, „Die Amerikanerin“ und „Beute“ sowie der Storyband „Schwarz. Weiß. Tot“ vor.
Mehr zum Autor unter www.deonmeyer.com
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Deon Meyer
Todsünde
Ein Bennie-Griessel-Thriller
Aus dem Afrikaans von Stefanie Schäfer
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
JULI
1
2
3
4
19. September
5
6
7
8
9
10
11
20. September
21. September
12
22. September
23. September
24. September
13
25. September
26. September
14
27. September
15
28. September
29. September
16
30. September
17
18
OKTOBER
19
1. Oktober
20
2. Oktober
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3. Oktober
31
32
33
34
35
36
4. Oktober
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
5. Oktober
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
13:34
66
14:40
15:00
67
15:32
17:49
68
18:27
18:53
19:05
19:10
19:11
19:24
19:27
19:30
69
70
71
6. Oktober
72
7. Oktober
73
8. Oktober
Danksagung
Erläuterungen
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne...
Für Marianne In Liebe
»Wir riskieren, uns durch unsere Gier und Dummheit selbst zu zerstören.«
Stephen Hawking
Habgier (…) ist das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz, unabhängig von dessen Nutzen.
Wikipedia
JULI
1
Kaptein Bennie Griessel hörte die eiligen Schritte und die lauten Stimmen; Vusi Ndabeni rief alle Kollegen der Ermittlungseinheit zusammen. Los, schnell, Überfall auf einen Geldtransporter, Beeilung!
Es war an einem Dienstagvormittag im Juli, mitten im Winter.
Griessel ließ sofort die Akte auf den Schreibtisch fallen, holte die Z88 aus der Schublade und rannte los. Vusi war klein, der Stillste von ihnen, ruhig und besonnen. Aber nicht jetzt; er klang erregt, und deswegen zögerte Griessel keine Sekunde.
Auf dem Flur schnallte er sich im Laufen das Holster um die Hüften. Er sah Vaughn Cupido kommen, mit wehendem, langem Mantel, dem »Batman-Cape«, seinem Winteroutfit.
»Preiset den Herrn!«, rief Cupido. Bennie wusste, dass es vor Erleichterung war, weil sein Kollege den Verwaltungskram bei der Kripo hasste, mit dem sie sich gerade abplagten. Der Einsatz bot eine willkommene Abwechslung.
Frankie Fillander und Mooiwillem (»der schöne Willem«) Liebenberg traten aus ihrem gemeinsamen Büro. Ihre Schritte hallten auf dem nackten Fliesenboden des DPMO – des Direktorats für Schwerverbrechen – in Bellville wider, ein Trupp von Polizeikommissaren, der zur Waffenkammer im ersten Stock stürmte.
Ndabeni war schon da; er gab R5-Sturmgewehre und zusätzliche Magazine aus, während Polizei-Unteroffizier Bossie Bossert hastig alles ins Inventar eintrug.
»Ich will ein Stompie«, sagte Cupido. Vusi gab ihm die RS200-Schrotflinte mit Pistolengriff und einen Munitionsgürtel. Die Waffe hatte keine große Reichweite; wegen ihrer Kürze wurde sie »Stummel« genannt.
»Du und deine Extrawürste«, bemerkte Fillander. »Das ist ein Überfall auf einen Geldtransporter, kein Bankraub.«
»Mein Wahnsinn hat Methode, uncle«, erwiderte Cupido. »Wart’s nur ab.«
»Und schön wieder zurückbringen!«, rief ihnen Bossert hinterher.
Seit fünf Monaten verfolgten sie bei ihren morgendlichen Meetings Vusis Ermittlungen. Er arbeitete an den sogenannten »Transit-Raubüberfällen«, die am Westkap zunehmend zum Problem wurden. Es war immer wieder dieselbe Bande, immer wieder derselbe Modus Operandi; zehn Leute in vier gestohlenen Autos, die einen Transporter zum Anhalten zwangen und ausraubten. Mit einem alten, schweren Fahrzeug rammten sie den Transporter und brachten ihn zum Stoppen. Mit den anderen Autos umzingelten sie ihre Beute und eröffneten das Feuer, laut der ballistischen Untersuchungen mit AK47-Gewehren sowie einer exotischen Ansammlung anderer Handfeuerwaffen. Solange, bis sich die Wachleute ergaben. Falls sie sich weigerten, sprengten die Wegelagerer die Heckklappen. Auf diese Art und Weise hatten sie bereits schätzungsweise vierzehn Millionen Rand erbeutet.
Die Täter waren bisher unbekannt; sie hinterließen keinerlei Spuren. Ndabeni war mit seinem Latein am Ende, und ihre gemeinsame direkte Vorgesetzte, Kolonel Mbali Kaleni, machte ihm richtig Feuer unter dem Hintern.
Deswegen rasten die fünf Ermittler jetzt mit Tempo hundertfünfzig in ihren ungekennzeichneten Fahrzeugen, dem BMW X3 voraus und dem Ford Everest hinterher, auf die N1 in östlicher Richtung.
Griessels Handy klingelte. Es war Vusi, aus den BMW, den Fillander fuhr.
»Vusi?«
Ndabeni, der als Einziger von ihnen Englisch sprach, musste laut reden, um das Heulen der Sirenen zu übertönen: »Ich glaube, dass die Täter den Polizeifunk abhören, deswegen Kommunikation nur über Handy! Ein heißer Tipp von meinem neuen Informanten, absolut glaubwürdig. Sie sind hinter einem Pride-Security-Transporter her, auf der R45 zwischen Malmesbury und Paarl.«
Griessel wiederholte die Information für Cupido, der fuhr, und Liebenberg.
»Ich habe Paarl benachrichtigt, sie schicken das Spezialeinsatzkommando«, sagte Ndabeni.
In Paarl befanden sich das Hauptquartier der Polizeibehörde Boland sowie der Sitz des Spezialeinsatzkommandos der SAPD, im Volksmund S. W. A. T. genannt.
Griessel gab das an seine Kollegen weiter.
»Auch das noch!«, jammerte Cupido, der die Fähigkeiten der Kollegen von der Landespolizei nicht besonders hoch einschätzte.
»Ich habe bei Pride Security angerufen. Sie leiten den Transporter um«, sagte Vusi. »Wir hoffen, die Gang zu erwischen, während sie ihm auflauert.«
»Wissen wir, wo das ist?«, fragte Griessel.
»An der Kreuzung R45 – Agter-Paarl-Road«, antwortete Vusi. Und fügte hinzu: »Der Hubschrauber ist auch unterwegs.«
Sie rasten weiter. Vor ihnen ragten majestätisch die blauen Berge auf; das Boland umgab sie idyllisch und klar an jenem kalten Tag.
Es war, wie Cupido es später ausdrückte, ein »chaotischer Scheißhaufen von gigantischem Ausmaß«. Von Anfang an.
Denn die Täter hatten ein Funkgerät, das auf die Frequenz von Pride Security eingestellt war. Dadurch erfuhren sie von der neuen Strecke, auf die der Transporter umgeleitet wurde.
Denn Vusi nahm die R44, weil er zu Recht argumentierte, sie wären viel langsamer, wenn sie durch Paarl führen, trotz der Sirenen.
Denn Mevrou Barbara van Aswegen, Bäuerin auf der Farm, die nur sechzig Meter vom Schauplatz des Überfalls entfernt lag, hörte den Aufprall und die Schüsse und rief sofort die SAPD in Paarl an, die ihrerseits das SEK alarmierte. Anschließend holte die Farmerin die Kaliber.308 Winchester-Jagdbüchse ihres Mannes aus dem Waffenschrank.
Zunächst hatten die Gangster den Transporter überholt. Sie schlugen kurz hinter dem Windmeul-Weinkeller zu, wo die zwei Spuren der Straße wie zwei Flüsse zu einer einzigen Spur zusammenflossen. Sie benutzten diesmal einen schweren alten 1995er Mercedes S500, der mit dumpfem Knall gegen den hinteren rechten Kotflügel des gepanzerten Security-Fahrzeugs prallte. Der Pride-Fahrer, getrieben von Adrenalin, Angst und Entschlossenheit, fuhr zu schnell und übersteuerte als Gegenreaktion. Er riss das Lenkrad nach rechts, doch der Mercedes hatte in diesem Augenblick keinen Kontakt, und der Transporter kippte um. Er überschlug sich zwei, drei, vier Mal und rutschte dann über den Asphalt. Funken sprühten, Metall schleifte, schrill und ohrenbetäubend. Der Transporter blieb auf der linken Seite liegen, mitten auf der Straße.
Die Täter umzingelten ihn mit ihren vier Fahrzeugen – der Mercedes vorne, um entgegenkommenden Verkehr aufzuhalten, eins rechts, eins links und eins hinten. Die Gangster sprangen heraus und begannen, auf den Geldtransporter zu schießen. Ihre übliche Strategie. Sie wussten, dass sowohl die Karosserie als auch die Scheiben kugelsicher waren, aber das Sperrfeuer der Einschläge wirkte normalerweise so furchteinflößend, dass sich die Wachleute ergaben. Daher feuerten die Männer ihre Magazine leer und gaben, während sie nachluden, den Pride-Angestellten die Gelegenheit, mit erhobenen Händen auszusteigen, so dass sie die Heckklappen nur noch aufzuschließen brauchten.
Doch nicht diesmal. Die Bewacher blieben in ihren Sicherheitsgurten hängen, verletzt, unter Schock und starr vor Angst.
Da griffen die Täter zu Plan B. Zwei sprangen aus dem hinteren Auto und rannten mit dem Sprengstoff zum Transporter. Sie pressten ihn routiniert in die Fugen der Heckklappen, rannten zurück, gingen hinter dem Fahrzeug in Deckung und brachten den Sprengstoff zur Explosion. Der Knall donnerte über die kahlen, winterlichen Weingärten, so laut, dass die Kinder der nahe gelegenen Grundschule mit großen Augen ihre Lehrerin ansahen.
Flammen und dichter, schwarzer Rauch stiegen auf. Den Tätern klingelten die Ohren von der Detonation, so dass sie die Sirenen der sich nähernden Valke nicht sofort hörten.
Vusi Ndabeni sah den Explosionsqualm als Erster. Er rief »Ndiyoika!«, und zeigte Fillander die Wolke.
»Verdammt!«, sagte Frankie, der alte Veteran. Er drehte sich zum Rücksitz um, wo sein Gewehr lag.
Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Fillander trat instinktiv auf die Bremse.
Vusi rief Griessel an. »Siehst du den Rauch?«
»Ja«, sagte Bennie und wies die anderen im Everest darauf hin.
»Fokkit!«, stieß Cupido hervor. »Party time!«
Griessel spürte sofort das intensive Bedürfnis nach der beruhigenden Wirkung eines Jack Daniel’s. Er war trockener Alkoholiker; kein Tropfen, seit über zweihundert Tagen.
Er und Liebenberg klappten die Griffe ihrer R5-Gewehre aus und luden, die Daumen auf den großen Sicherheitsmechanismen. Cupido bremste, um den Abstand zum BMW zu halten.
Die beiden Straßenräuber, die vorne am Mercedes Ausschau nach herannahendem Verkehr hielten, sahen und hörten die Valke gleichzeitig. Sie riefen den anderen acht, die dabei waren, die Kisten mit dem Geld hinten aus dem Pride Transporter zu holen, eine Warnung zu, aber es war zu spät. Als sie die ersten Schüsse auf die SAPD-Fahrzeuge abfeuerten, hatten der BMW und der Everest bereits mit quietschenden Reifen angehalten – quer zur Fahrbahn. Die Fahnder stiegen auf der sicheren Seite aus, gingen in Deckung und erwiderten das Feuer. Cupido, dessen »Stompie« nicht für diese Distanz gebaut war, hielt seine Glock 17 in beiden Händen.
Gewehrfeuer ratterte, Geschosse prallten gegen alle drei Fahrzeuge und auf den Asphalt, Kugeln pfiffen vorbei, manche ganz dicht, der chemische Qualm der Treibladungen reizte die Schleimhäute.
Die acht Geldkistenträger mussten sich schnell entscheiden: Sollten sie ebenfalls das Feuer erwidern, oder sollten sie die Beute so schnell wie möglich in die Fluchtfahrzeuge verladen? Schließlich war der Weg nach Paarl hinter ihnen noch frei. Der Anführer mit der orangefarbenen Mütze, sehnig, schlau und furchtlos, wusste aus Erfahrung, dass seine Kumpels die Polizei in der Regel lange genug ablenken konnten. Er befahl den anderen, die Kisten in die Autos zu laden.
Doch er ahnte nichts von Frankie Fillanders Talenten.
Fillander war einer der drei besten Schützen des DPMO am Kap – besser bekannt als die Valke. Und seine Erlebnisse als junger Polizist in der Township Mitchells Plain hatten ihn gelehrt, ruhig zu bleiben, wenn auf ihn geschossen wurde. Deswegen hatte er seine R5 auf Einzelschuss eingestellt und lag hinter dem Heck des BMW auf dem Bauch. Seine Kollegen gaben ihm Feuerschutz. Er wartete auf eine günstige Gelegenheit und zielte durch das große vordere Ringvisier des Gewehrs auf den ersten Mann am Mercedes. Fillander traf ihn in die rechte Schulter. Der Mann zuckte und ließ seine AK fallen.
Fillander schwenkte den Lauf nach links. Von dem anderen bewaffneten Straßenräuber hinter dem Mercedes konnte er nur den Ellbogen erkennen. Er zielte, berechnete die Armbewegung seines Ziels und schoss. Die 5.56×45-Kugel zerschmetterte den Knochen. Der Mann schrie auf vor Schmerz und zuckte zurück.
Keiner der Gangster erwiderte jetzt noch das Feuer. Das war der Augenblick, in dem Bennie Griessel glaubte, sie hätten die Sache unter Kontrolle und heute würden die Guten gewinnen.
Dann rückte die Kavallerie an.
2
Das SEK Boland kam aus der Richtung Paarl. Von Osten.
Die Valke waren aus der Richtung Butterfly World gekommen. Von Westen. Eine perfekte Zangenformation, wenn sie sie im Voraus abgesprochen hätten, eine tödliche Flankenstrategie, um die Verbrecher ins Kreuzfeuer zu nehmen.
Aber nichts war vorher abgesprochen. Durch die Funkstille, den Explosionsqualm, den Geschützrauch und die Gangster, die hin und her liefen, um Kisten zu verladen, und dabei zwischendurch ins Blaue Schüsse abgaben, ahnte der SEK-Chef, Oberstleutnant Phila Zamisa, zunächst nicht, dass sich auf der anderen Seite die Valke verschanzt hatten.
Er und seine Truppe, ausgerüstet mit kugelsicheren, schwarzen Kampfanzügen, Heckler-&-Koch-MP5N-Maschinenpistolen, R5-Gewehren und einem McMillan-TAC-50-Scharfschützengewehr, hielten an, sprangen heraus und eröffneten das Feuer. Die acht Gangster, die noch auf den Beinen waren, duckten sich hinter ihre Fahrzeuge, und die meisten Schüsse des SEK schlugen in die Autos der Valke auf der anderen Seite ein.
Einer traf den schönen Willem Liebenberg, der Mann, der wegen seiner umwerfenden Wirkung auf Frauen als die »Massenverführungswaffe« der Valke bekannt war. Zum Glück für sein Aussehen streifte die Kugel nur leicht seine Wange neben dem linken Ohr. Und das SEK schoss immer weiter.
Die Valke hatten das Feuer eingestellt, weil sie die Kollegen sehen konnten.
»Was habe ich gesagt? Auch das noch!«, schrie Vaughn Cupido.
»Scheiße!«, fluchte Griessel.
»Ich ruf sie an!«, rief Vusi, der die Nummer von Lieutenant-Kolonel Zamisa hatte. Er lag knapp hinter der Schnauze des BMW und grub sein Handy aus der Jackentasche.
Es dauerte einen Moment, bevor sich der Offizier meldete. Ndabeni schrie so laut er konnte über das Knattern und Knallen hinweg, und endlich begriff Zamisa, was er ihm sagen wollte.
Stille legte sich über die Szenerie.
Im Farmgebäude rechts neben der Straße hatte die Farmerin Barbara van Aswegen das Feuergefecht längst gehört. Sie war allein zu Hause, aber kampfbereit, das Jagdgewehr in den Händen. Sie beschloss, dass es jetzt an der Zeit war, zu schießen, um Haus und Hof zu beschützen. Sie feuerte auf die ungekennzeichneten Fahrzeuge der Valke, die sie deutlich im Visier hatte, weil sie glaubte, sie gehörten den Tätern.
Bennie Griessel hörte den Schuss, der irgendwo von links kam. Die Kugel schlug genau über ihm in den Everest ein. Er fluchte und ging in die Hocke.
Noch ein Schuss. Wieder traf die Kugel den Ford.
»Oh, mein Gott!«, sagte Cupido.
Frankie Fillander konnte Barbara van Aswegen sehen. »Das ist eine Frau!«, rief er und dann, an sie gewandt: »Antie, wir sind von der Polizei!«
Doch sie schoss einfach weiter.
Griessel hörte Vusis Handy klingeln. Bestimmt Zamisa von der anderen Seite, der wissen wollte, was jetzt los war. Dann sah er, wie die Täter die Situation ausnutzten und flüchteten. In südlicher Richtung, weg von der Farmersfrau, über den Zaun, in den Weinberg. »Vaughn, Willem, kommt mit!«, sagte Griessel, lud seine R5 nach, sprang auf und rannte ihnen hinterher.
Die Täter waren jünger und flinker. Griessel war ein trainierter Fahrradfahrer, aber er war noch nie ein guter Sprinter oder Über-den-Zaun-Springer gewesen. Cupido war wesentlich athletischer, doch er hatte im Laufe des vergangenen Jahres sechzehn Kilo zugenommen. Der schöne Willem Liebenberg wollte helfen, aber in dem Augenblick zerschoss Barbara van Aswegen die Scheibe auf der Beifahrerseite genau neben seinem Kopf, so dass die Glasscherben über ihn spritzten und er sich zu Boden werfen musste.
Bennie war als Erster über den Zaun und rannte an der langen Reihe von Pappeln entlang, welche die schmale Straße säumten. Er sah die acht Gangster, die oben auf der Anhöhe an dem weiß verputzten Außengebäude der Farm vorbeirannten. Aus den Augenwinkeln heraus bemerkte er, dass sich von links auch einige SEKs näherten. Er blickte sich um. Vaughn Cupidos langer, schicker Mantel hatte sich im Drahtzaun verfangen; die Schrotflinte mit dem Pistolengriff hielt er in einer Hand.
»Ich komme, Benna!«
Griessel rannte weiter. Der Boden war durchweicht vom letzten Regen, der Matsch glitschig. Oben am Außengebäude wollte er anhalten, in Deckung gehen und vorsichtig Ausschau halten. Doch er rutschte aus und fiel hin. Als er wieder aufsprang, klebte Matsch an Hose und Ellbogen.
Er sah die Täter, die in vollem Lauf flüchteten. Er wollte schon die R5 anlegen und schießen, doch dann erkannte er, dass eine Reihe kleiner Arbeiterhäuschen im Weg war. Die vier SEKs näherten sich schnell über die Farmstraße, aber sie waren noch zu weit weg, um die Täter stoppen zu können.
Griessel rannte weiter. Er keuchte jetzt; seine Brust brannte.
Bei den Häuschen musste er wieder innehalten und sich umsehen. Die Flüchtigen waren hinunter in die Ebene hinter dem Wasserreservoir gelaufen, immer noch mit hoher Geschwindigkeit. Er legte das Gewehr an und schoss dreimal. Aber es hatte keinen Zweck.
Irgendetwas stimmte nicht. Er zählte die rennenden Gestalten – es waren jetzt nur noch sieben zwischen den langen Reihen winterkahler Weinstöcke. Und sie teilten sich auf. Eine Vierergruppe schwenkte nach rechts, die anderen drei liefen geradeaus weiter. Dann erreichten ihn die SEKs. Er erkannte Oberstleutnant Zamisa.
»Ach, hi, Bennie«, sagte Zamisa. »Komm mit, wir schnappen uns die drei!« Er bedeutete seiner Mannschaft, die Vierergruppe zu verfolgen.
Griessel schaute sich um. Cupido war dreißig Meter hinter ihm. »Vaughn, einer von ihnen ist hier in einem der Arbeiterhäuser!«, rief er.
»Überlass den Dreckskerl mir!«, rief Cupido heftig keuchend zurück.
Zamisa sprintete los. Er war schon über vierzig, aber durchtrainiert und schnell. Griessel musste sich anstrengen, um mitzuhalten.
»Da hinten ist eine Grundschule«, sagte Zamisa im Laufen und deutete nach Osten.
»Mist!«, fluchte Bennie Griessel, denn damit bestand die Gefahr einer Geiselnahme. Eine Katastrophe!
Doch die drei Flüchtigen bogen plötzlich nach Norden ab, in Richtung einer Gruppe von Tannen.
»Sie wollen zurück zu ihren Fahrzeugen«, sagte Zamisa.
Griessel bekam nicht genug Luft, um zu antworten.
Cupido stand rechts neben dem obersten Arbeiterhaus, mit einer Hand gegen die Mauer gestützt, um zu Atem zu kommen. Er musste wirklich abnehmen, er war schon lange nicht mehr so dick und untrainiert gewesen, aber was sollte er machen? Seine Banting-Diät schlug einfach nicht an. Es lag an seiner Freundin, Desiree Coetzee. Sie kochte gerne und ging auch gerne essen. Außerdem waren immer reichlich Süßigkeiten im Haus, denen er nicht widerstehen konnte.
Er sah sie durch die grüne Landschaft rennen, seinen Kollegen und die SEKs.
Von jenseits der Straße hörte er immer noch die Schüsse, die die Farmerin auf Vusi und die anderen abgab.
Er schüttelte den Kopf.
Was für ein Chaos!
Er spähte um die Ecke und blickte den Weg entlang, der zwischen den vier kleinen Häusern und einer Baumreihe hindurchführte.
Stille.
Eine Bewegung zwischen den Bäumen. Er legte die Schrotflinte an, obwohl er wusste, dass die Distanz zu groß für sie war.
Es war ein Kind – ein farbiger Junge, vielleicht fünf Jahre alt, der den Kopf heraussteckte und ihn ängstlich ansah.
Cupido schlich um die Ecke, dicht an der Mauer entlang, und bewegte sich auf den Kleinen zu.
Schüsse knallten, von Süden her, weit weg. Das Kind erschrak.
Cupido versuchte, die Tür des ersten Hauses zu öffnen. Sie war geschlossen. Aber der Täter konnte sie von innen abgeschlossen haben.
Das Kind gab ihm ein Zeichen. Cupido deutete in die Richtung, in die es zeigte. Auf das dritte Haus.
Cupido rannte so leichtfüßig er konnte zu dem kleinen Jungen hinüber.
Flüsternd fragte er: »Ist er da drin?«
Der Kleine nickte.
»Ist noch jemand im Haus?«
»Das Baby.«
»Das Baby? Wo ist seine Mutter?«
Wieder zeigte das Kind mit dem Finger, diesmal in die Richtung des Farmgebäudes. Es flüsterte: »Sie ist Holz holen gegangen, uncle. Es ist kalt.«
Cupido nickte. »Bleib hinter dem Baum. Leg dich flach auf den Boden.«
Der Kleine nickte ernsthaft, legte sich hin und hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu.
Vaughn ging über die kleine Veranda zur Tür. Er legte die Schrotflinte auf den Betonboden, zog den Mantel aus und legte ihn neben die Waffe. Er wollte nicht, dass er seine Bewegungsfreiheit einschränkte. Dann hob er die RS200 wieder auf und stellte sich mit dem Rücken gegen die Wand neben die Tür.
»Komm raus, und ich erschieße dich nicht!«, rief er.
Von drinnen kamen Schüsse, eine AK47 auf Automatik. Die Holztür zersplitterte. Das Baby fing an zu schreien.
Cupido wartete, bis das Magazin leer war. Dann trat er die Tür ein und hechtete durch die Öffnung. Er rollte sich ab und zielte im Liegen mit der Schrotflinte auf den Gangster. Der Innenraum war klein. Der Mann stand hinter einem Sofa. Auf dem Sofa lag das weinende Baby, dessen schrilles Geschrei einem durch Mark und Bein ging. Der Gangster hatte eine Pistole in der Hand und hielt den Lauf gegen die Wange des Kindes.
»Ich töte das Baby«, sagte er zu Cupido, den Wahnsinn in den Augen.
Vaughn musste Fillander im Stillen recht geben. Das Stompie war die falsche Wahl gewesen. Denn wenn er jetzt schoss, würde er auch das Baby treffen.
3
Ganz ruhig, brother«, sagte Cupido.
Er hob die linke Hand, löste die Finger der anderen in einer Geste der Ergebung von der Flinte und stand langsam auf.
»Lass die Waffe fallen«, forderte der Gangster. Der Pistolenlauf an der Wange des Babys zitterte. Das Kind schrie.
»Okay«, sagte Cupido. »Ganz ruhig.« Er wechselte die Flinte langsam in die linke Hand, während er sich bückte, ohne den Blick von dem Mann abzuwenden. Er ließ die Schrotflinte langsam zu Boden sinken, immer langsamer, tiefer und tiefer. Er wusste, dass der Mann in dem Augenblick, in dem er sie losließ, die Pistole heben und ihn erschießen würde.
»Schau, ich lege sie ganz vorsichtig hin.« Er wollte, dass der Täter seine Aufmerksamkeit auf die Schrotflinte richtete, so dass er mit der rechten Hand hinten in seinen Gürtel greifen konnte.
Er wartete nur auf den richtigen Augenblick.
»Willst du, dass ich sie dir mit dem Fuß rüberschiebe?«, fragte er, kurz bevor er den Stummel hinlegte.
Das Baby schrie. Ohrenbetäubend.
Er fragte noch einmal, lauter: »Willst du, dass ich sie dir mit dem Fuß rüberschiebe?«
Der Mann antwortete nicht. Er war gespannt wie eine Feder, den Blick fest auf die RS200 geheftet.
Von draußen hörte Cupido eine verängstigte Frauenstimme. »Mein Kind, mein Kind!«
Vaughn ließ die Flinte fallen, die letzten paar Zentimeter, in der rechten Hand bereits den Kolben der Glock 17 hinter seinem Rücken. Mit einem Ruck zog er sie heraus. Der Mann hob die Pistole. Cupido ließ sich fallen und schoss. Die beiden Schüsse knallten gleichzeitig.
Oberstleutnant Zamisa erreichte sieben Schritte vor Bennie die lange Steinmauer. Die Tannen waren noch ein Stück weit entfernt.
Griessels Brust brannte, und er musste sich kurz gegen die kalten Steine lehnen. Seine Haare, die wie üblich nach einem Friseur schrien, standen noch wirrer als sonst vom Kopf ab. Seine mandelförmigen Augen, die gelegentlich als »slawisch« beschrieben wurden, hatte er gegen die Sonne zusammengekniffen. Ich bin zu alt für solche Eskapaden, dachte er, sechsundvierzig, aber er hatte weiß Gott mehr Kilometer auf dem Tacho.
»Das Schießen hat aufgehört«, stellte Zamisa fest.
Griessel nickte. Die Farmerin war wohl zur Vernunft gekommen.
»Das ist ein Friedhof«, sagte Zamisa, der sich auf die Zehenspitzen stellen musste, um über die Mauer und zwischen ein paar Zypressen hindurch zu spähen.
Griessel tat es ihm nach.
Die Umgrenzung des Friedhofs von Paarl war ungefähr hundert Meter lang und fünfzig breit. Die Mauer zog sich ganz herum, mit einem Tor auf der entgegengesetzten Seite ihres Standorts. Ein paar Hundert Grabsteine.
Griessel sah eine Bewegung. Der Lauf des russischen Sturmgewehrs war gerade so hinter einem großen Marmorgrabstein zu sehen. Einer der Täter versteckte sich dort.
»Sie sind da drin!«, sagte er.
Zamisa zögerte nur einen Wimpernschlag lang. »Bennie, geh du außen herum zum Tor. Ich warte, bis du mir Feuerschutz geben kannst. Sobald du anfängst zu schießen, springe ich über die Mauer und überrumpele sie.«
»Alles klar«, sagte Griessel. Er rannte los, leicht gebückt im Schutz der Mauer. Er lief auf dem Weg zurück, den sie gekommen waren, der der kürzere zu sein schien, um zum Tor zu gelangen. Er versuchte, so leise wie möglich aufzutreten, was auf dem nassen, weichen Boden und dem Gras relativ leicht war.
Um die erste Ecke. Er rannte an der kurzen Seite der Friedhofsmauer entlang. Er hörte nichts außer den Tauben, die in den Zypressen gurrten. Eine Eidechse huschte über die ockerfarbenen Steine.
Um die letzte Ecke.
Einer der Täter hockte am Tor, wachsam, die AK in den Händen. Aber er schaute nach Norden, in die andere Richtung. Doch dann hörte er Bennie und drehte sich um. Griessel ließ sich zu Boden fallen, so dass er das kleinstmögliche Ziel bot, zielte und schoss, zweimal schnell hintereinander.
Der Mann fiel rückwärts um.
Schüsse kamen von innen; sie schlugen ohne Schaden anzurichten auf der anderen Seite in die Mauer ein.
Bennie wurde klar, dass Zamisa denken musste, er würde ihm Feuerschutz geben. In diesem Moment musste der Oberstleutnant über die Mauer hechten. Griessel sprang auf und rannte auf das Tor zu.
Auf der anderen Seite der Mauer hörte er wiederum Schüsse, diesmal die R5 des SEK-Chefs.
Draußen vor dem Arbeiterhaus schrie die Mutter des Babys, ein schrilles Wehklagen, das das Weinen des Kindes übertönte.
Cupido hörte sie über die Betonveranda rennen. »Draußen bleiben!«, rief er, denn er wollte nicht, dass sie den Gangster sah, in dessen Kopf eine gähnende Wunde klaffte, dort, wo sein rechtes Auge gewesen war. Er sprang auf, schob die Glock zurück in den Gürtel, nahm das Baby vorsichtig auf den Arm und drehte sich um. Sie stand in der Tür, eine kleine zarte Frau, kaum über zwanzig. Sie jammerte hoch und anhaltend und streckte die Arme nach ihrem Baby aus.
Er gab ihr das Kind. Das Baby weinte unaufhörlich. »Kommen Sie«, sagte er, »alles ist gut.« Er kehrte ins Haus zurück, hob die Stompie auf und schickte die Frau nach draußen. Er sah sich das Einschussloch in der Mauer an, wo die Kugel des Gangsters eingeschlagen war. Sie hatte ihn nur um wenige Millimeter verfehlt.
Verdammt!
Er ging hinaus, um sich bei dem kleinen Jungen draußen zu bedanken.
Griessel rannte durch das Friedhofstor.
Eine Kugel schlug in die Mauer direkt neben ihm ein; Gesteinssplitter und Staub flogen ihm ins rechte Auge. Er ließ sich hinter ein Grab fallen. Weitere Schüsse knallten, rings um ihn. Er konnte nicht richtig sehen; das Auge tränte. Er ließ die R5 los und versuchte, den Dreck herauszureiben.
Für einen Augenblick herrschte Stille. Niemand schoss.
Gerade noch rechtzeitig hörte er die Schritte. Der Gangster glaubte wohl, er wäre angeschossen, so vermutete Griessel, und wollte ihm den Todesschuss versetzen. Er packte das Gewehr, rollte sich auf den Rücken, legte die R5 an, wartete. Alles war verschwommen; seine Sicht war noch immer getrübt.
Der Mann erschien auf dem Weg, tödlich entschlossen, aber er schoss übereilt und riss das Gewehr nach unten weg, so dass die knatternde Salve aus der AK das Tor und die Mauer traf.
Griessels Herz galoppierte, und der Impuls, den Abzug zu drücken, war überwältigend, doch er wartete, berechnete die Bewegungen des Mannes, schoss ein-, zweimal, und der Mann stürzte auf ihn, den Finger noch am Abzug, bis die russische Waffe leer war. Bennie stieß den Räuber mit Gewalt von sich weg, den Lauf auf seiner Brust. Noch einmal schoss er. Der Mann regte sich nicht mehr.
Ringsum herrschte Stille.
Griessel richtete sich auf den Knien auf, zitternd vor Adrenalin. Er hob den Kopf über den Grabstein. Da sah er Zamisa, sechzig Meter von ihm entfernt. Hilflos, die R5 in den Händen, das Magazin offensichtlich leer. Vor ihm der sehnige Mann mit der orangefarbenen Mütze, der – mit dem Rücken zu Griessel – auf den SEK-Chef zuging, die Pistole in der Hand.
Er hatte nur eine Chance, wusste Griessel. Es ging um Sekunden.
Sein rechtes Auge tränte, aber ihm blieb keine Zeit, jetzt noch daran zu reiben. Er stützte den Ellbogen auf dem Grabstein ab, zielte durch den Nebel in seinen Augen und schoss.
Der schmale Anführer der Bande lag stöhnend auf dem Boden. Die Wunde hoch oben in seinem Schulterblatt blutete, die Hände waren hinter seinem Rücken gefesselt. Er sprach kein Wort.
Griessel und Zamisa sahen zu, wie sich die SEK-Fahrzeuge näherten.
»Schickes Gewehr«, sagte der Oberstleutnant und stieß mit der Stiefelspitze gegen die AK47, die jetzt aufrecht an der Mauer lehnte. »Ich nehme an – und hoffe –, dass ihr den Buddie Falk macht?«
Von einer Waffe »den Buddie Falk zu machen« bedeutete, dass der betreffende Ermittler die umfangreiche Schusswaffendokumentation für den Beschlagnahmeerklärungszauber der SAPD vorbereitete, oben in Silverton, etwas außerhalb von Tshwane, wo Kolonel »Blink« Buddie Falk das Kommando hatte. Falk war ein akribischer, ein wenig despotischer Herrscher in seinem kleinen Königreich, nicht besonders beliebt unter den Polizisten im Land, weil er gerne die Dokumentation mit ein paar gepfefferten Bemerkungen zur Korrektur zurückschickte. Seinen Spitznamen hatte er erhalten, weil seine Uniformknöpfe – genau wie sein Auto – immer glänzten und perfekt poliert waren.
»Bleibt mir wohl nichts anderes übrig«, sagte Griessel und betrachtete das Sturmgewehr. Der Pistolengriff hinter dem Abzug war durch einen Elfenbeingriff ersetzt worden. Ein Wort war darin eingekerbt: Ukufa.
»Das ist Xhosa«, erklärte Zamisa. »Es bedeutet ›Tod‹.«
4
19. September
Der Frühling hielt Einzug.
Im September breitete sich an der Westküste eine Blütendecke in leuchtendem Weiß, Orange und Violett über die Landschaft aus, vom Bloubergstrand bis weit hinter Springbok. In den Radiostationen am Kap spielten die Radio-DJs heiße Rhythmen und scheuchten ihre Hörerinnen und Hörer raus ins Freie, um das Ende des Winters zu feiern und den kristallklaren, sonnigen Tag ausgiebig zu genießen, mit beschwingtem Schritt und einem Lied auf den Lippen.
Frühmorgens, in der Paradyskloof in Stellenbosch, hätte man von Weitem meinen können, dass auch Sandra Steenberg frühlingshaft-beschwingt unterwegs war.
Ihre Absätze klackerten über den Fliesenboden des Kindergartens, und die dunkelgraue Handtasche schwang an ihrer Schulter. Auf den ersten Blick war sie eine von vielen eiligen, resoluten Müttern, die ihre Kinder abgeliefert hatten und sich nun sputen mussten, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Mit ihrem grau karierten Rock und dem dünnen, marineblauen Pulli über der weißen Bluse war sie der Inbegriff einer Karrierefrau.
Sie war für kühlere Temperaturen gekleidet, als teile sie aus Erfahrung den Optimismus der Wetterfrösche nicht. Ihr Business-Outfit konnte nicht verbergen, wie attraktiv sie war: zierliche Knöchel, wohlgeformte Waden, volle, geschwungene Lippen und dunkles, dichtes Haar, das ihr lang und offen über die Schultern fiel. Sie wirkte wie knapp über dreißig, lebenslustig, dynamisch und voller Selbstvertrauen.
Doch der Schein trog.
Sandra war auf der Flucht. Gehetzt verlängerte sie ihre Schritte so weit, wie ihre Würde es gerade noch erlaubte, um so schnell wie möglich das rettende Auto zu erreichen. Sie versuchte, der Leiterin des Kindergartens zu entgehen, aus Angst, dass diese sie auf die ausstehenden Gebühren ansprechen könnte. Sie war drei Monate mit den Zahlungen im Rückstand.
Sieben Meter noch bis zum Auto, sechs, fünf, vier. Erleichtert hoffte sie, auch an diesem Morgen noch einmal ungeschoren davonzukommen.
Doch dann rief ihr eine Frauenstimme zu: »Mevrou Steenberg, einen Augenblick bitte!«, in dem typischen Stellenbosch-Tonfall höflicher Entschlossenheit.
Sandra blieb stehen und verzog den Mund zu einem Lächeln, bevor sie sich umdrehte, bereit, ihre vorgestanzten Entschuldigungen und leeren Versprechungen mit beherrschter, defensiver Aggression vorzubringen.
Da klingelte ihr Handy. Sie griff danach wie nach einem Rettungsanker und zog es aus dem Seitenfach ihrer Handtasche hervor. Eine unbekannte Nummer. Sie runzelte die Stirn und warf der Leiterin, die sie schon fast erreicht hatte, einen entschuldigenden Blick zu.
»Sandra«, meldete sie sich.
»Die Maklerin.« Eine Männerstimme. Sachlich. Keine Frage, sondern eine Feststellung.
»Richtig.«
»Jasper Boonstra«, sagte er. Dann schwieg er, als wolle er ihr die Gelegenheit geben, die ganze Wucht der Bedeutung seines Namens zu erfassen.
Sie brauchte einen Augenblick, um ihn einzuordnen, da die Leiterin genau vor ihr stand, bereit, ihrer Empörung Luft zu machen.
Dann begriff Sandra, dass es sich um den Jasper Boonstra handelte. Den Kriminellen. Aufgrund der Umstände – die Leiterin so dicht vor ihr, ihr Drang, zu fliehen – kam ihr keinen Moment in den Sinn, dass ihr jemand einen Streich spielen könnte. Sie spürte, wie ihr Adrenalinspiegel in die Höhe schnellte.
»Hallo«, sagte sie. »Was kann ich für Sie tun?«
»Ich möchte, dass Sie zu mir kommen. Und zwar unverzüglich.«
Sie wusste, dass sie Ja sagen würde. Sie hatte keine andere Wahl.
»In Ordnung«, sagte sie.
Dies war der Augenblick, in dem das Leben von Sandra Steenberg eine unwiderrufliche Wendung nahm.
Im Schlafzimmer des prächtigen alten, viktorianischen Hauses in der Brownlowstraat 47 am Hang des Seinheuwels herrschte keine Frühlingsstimmung. Bennie Griessel war besorgt und niedergeschlagen. Er hatte kaum geschlafen, seine Nerven lagen blank.
Er zog den einzigen Anzug an, den er besaß, den schwarzen, dazu ein weißes Hemd und eine graue Krawatte.
Seine zukünftige Ehefrau Alexa Barnard sorgte sich um ihn. Sie zupfte an seinem Kragen und strich ihm das Haar glatt.
»Du siehst gut aus, Bennie.«
Er wusste, wie er aussah. Müde und abgespannt. Aber er beherrschte sich. Er wollte nicht, dass an ihm herumgezupft wurde. Nicht heute. Und ein gutes Aussehen würde ihm nicht im Geringsten helfen.
»Komm, ich mach dir ein leckeres Omelette. Und eine Tasse Kaffee dazu.«
Aber ihm stand der Sinn nicht nach Kaffee, sondern nach etwas ganz anderem. Er wollte auch kein Omelette, denn er hatte überhaupt keinen Hunger. Außerdem gehörte das Kochen nicht zu Alexas größten Talenten. Und er wollte jetzt auch nicht mit ihr in der Küche zusammensitzen. Er kannte Alexa; sie würde noch einmal auf das heikle Gespräch von gestern Abend zurückkommen. Um ihn zu beruhigen. Ihm Mut einzuflößen. Doch es gab nichts, was ihn beruhigen oder ihm Hoffnung machen konnte.
Er folgte ihr die Treppe hinunter in die Küche. Zähneknirschend, denn er würde sich mit ihr wegen dieses Themas auseinandersetzen müssen.
Er griff nach der Kaffeekanne, aber sie hielt ihn auf. »Setz dich, lass dich ein bisschen verwöhnen.«
Alexa im Muttermodus. Nichts konnte sie davon abbringen, wenn sie so war.
Er setzte sich an den Tisch. Sie schenkte ihm Kaffee ein und reichte ihm die Tasse. »Danke«, sagte er und schaute auf seine Armbanduhr.
Noch siebzig Minuten bis zur Anhörung.
»Die werden doch keinen Superermittler entlassen, du wirst schon sehen«, sagte sie aufmunternd, während sie Eier aus dem Kühlschrank holte.
Er würde ihr nicht wieder dieselben Antworten geben wie gestern Abend. Er liebte diese Frau. Mehr, als er ausdrücken konnte. Doch sie konnte hartnäckig sein, weiß Gott. Und erstens hatte sie keine Ahnung davon, wie es bei der Polizei zuging, und zweitens machte ihr überwältigender Optimismus sie manchmal blind für den Mist, der in diesem Land vorging. Vor zwei Wochen hatte er in einem schicken Weingut-Restaurant um ihre Hand angehalten, und zu seiner unbeschreiblichen Erleichterung hatte sie Ja gesagt. Gestern Abend hatte er sie gebeten, sich zu ihm aufs Sofa zu setzen, und ernsthaft mit ihr geredet. Wenn er seine Arbeit verlöre, hatte er gesagt, würden sie ihre Heiratspläne erst einmal aufschieben müssen. Bis er einen anderen Job gefunden habe. Egal, wie lang das dauere. Er würde nicht heiraten, solange er arbeitslos sei.
Sie hatte erwidert, er sei zu pessimistisch und mache sich umsonst so große Sorgen. Und sie hatte sich strikt geweigert, den Heiratstermin im Dezember zu verschieben. »Nein, Bennie, ich habe schon die Kirche reserviert und werde nicht absagen.« Sie liebte die Hochzeitsplanung, war aufgeregt wie ein Kind. Er gönnte es ihr, aber sie musste doch verstehen, dass …
Er sah zu, wie sie die Eier schlug.
»Ich habe lange nachgedacht, Bennie, über gestern Abend …«
Genau, wie er vermutet hatte.
»Und ich habe mir da etwas überlegt. Wenn es wirklich zum Äußersten kommt, wobei ich sicher bin, dass das nicht passieren wird, hast du doch immer noch deine Musik. Und gute Bassisten … davon gibt es nie genug.«
Er seufzte. Alexa war die Besitzerin des Musiklabels AfriSound, das sie von ihrem verstorbenen Mann geerbt hatte. Sie hatten sich vor ein paar Jahren kennengelernt, als Bennie den Mord an ihrem damaligen Gatten untersucht hatte. Alexa hatte sich von der Tragödie erholt, ihren Alkoholismus besiegt und die Firma zu einem Riesenerfolg gemacht. Sie war eine wohlhabende Frau.
Was sie nun offenbar vorhatte, war, ihm einen Job als Studiomusiker anzubieten. Doch Tatsache war, dass sein Können dafür nicht ausreichte. Er war nie gut genug gewesen und würde es nie sein. Er war nur mittelmäßig. Es reichte, um freitag- oder samstagabends auf Hochzeiten und Partys mit seiner Band Roes alte Hits zu spielen, aber zu mehr nicht. Als Studiomusiker wäre er eine Katastrophe. Es wäre ein Almosen. Aus Mitleid. Und das wollte er auf keinen Fall. So viel Stolz besaß er noch.
»Bestimmt finde ich eine Anstellung als Privatdetektiv«, sagte er. Ohne große Überzeugung. Denn die Wirtschaft lag am Boden, und welche private Detektei oder Security-Firma würde einen alten, ehemaligen Säufer einstellen, wenn sie in diesen Zeiten die breite Auswahl hatte?
»Das weiß ich doch. Und deswegen möchte ich das Hochzeitsdatum keinesfalls ändern. Möchtest du Schinkenspeck auf deinem Omelette?«
»Lieber Käse, bitte«, antwortete er.
Dabei konnte weniger schiefgehen.
Das Hauptquartier der südafrikanischen Polizei am Westkap lag in der Alfredstraat 25 in Groenpunt. Es war ein hässliches altes Gebäude, das an einen kommunistisch inspirierten Wohnblock erinnerte; sieben Etagen weiß verputzte Mauern, Reihe um Reihe kleiner, vergitterter Fenster, verrostete Klimaanlagen und sonnengebleichte Jalousien unterschiedlicher Machart.
Der Konferenzsaal, in dem die Anhörung stattfinden sollte, befand sich ganz oben, nur ein paar Schritte den Flur runter vom Büro des Provincial Commissioners entfernt. Griessel wartete im kleinen Büro nebenan darauf, dass er aufgerufen wurde. Der Raum war trostlos.
Seine Hände schwitzten. Er wischte sie an der Hose ab und befühlte noch einmal die Innentasche seines Sakkos. Dort steckte sein Polizeiausweis, in seinem Portemonnaie. So dass er ihn zurückgeben konnte, wenn sie ihn auf die Straße setzten. Und dort steckte auch seine Erklärung, die er vorlesen würde. Ohne große Hoffnungen hineinzusetzen.
Seine Z88 hatte er gestern Nachmittag bei Unteroffizier Bossie Bossert in der Waffenkammer der Valke abgegeben.
Sein Handy vibrierte immer wieder – WhatsApp-Nachrichten seiner Kollegen, die ihm alles Gute wünschten: Vusi Ndabeni, Mooiwillem Liebenberg, Frankie Fillander und sogar Major Benedict »Bones« Boshigo von der Abteilung für Wirtschaftskriminalität sowie Pressesprecher John Cloete.
Er hatte einen Kloß im Hals. Mein Gott, wie er sie vermissen würde, diese Bruderschaft, aufgebaut im Laufe vieler Jahre, in denen sie zusammen tiefe Täler durchquert hatten.
Vaughn Cupido war noch nicht da. Seine Anhörung war erst um zehn. Danach würden sie hier gemeinsam sitzen und auf das Ergebnis warten müssen.
In Griessels Anklageschrift hatte gestanden, dass das Komitee aus fünf Mitgliedern bestehen würde. Er wusste, dass Brigadier Musad Manie, Chef des DPMO West-Kap, dabei sein würde. Dazu der Provincial Commissioner und der Brigadier von der Personalabteilung sowie ein Offizier aus der Rechtsabteilung. Und noch ein weiteres Mitglied der Polizei. Ein Dolmetscher würde bereitstehen.
Bei Musad Manie konnte er mit Verständnis rechnen. Mit Milde. Manie kannte ihn, und er war ein guter Mann. Der Commissioner dagegen, Generalleutnant Mandla Khaba, würde ihm die Hölle heißmachen. Khaba verdankte seine Stelle seiner politischen Gesinnung; er war ein Unterstützer des Präsidenten. Des korrupten, die Staatskasse plündernden Präsidenten dieses Landes. Khaba würde Griessels Kopf fordern, so viel war sicher. Vielleicht auch der Personalchef. Vom Offizier der Rechtsabteilung konnte er zumindest Gerechtigkeit erwarten.
Sein Schicksal würde in hohem Maße davon abhängen, wer das fünfte Komiteemitglied war.
Er zog seine Erklärung aus der Tasche. Zwei Wochen lang hatte er daran gesessen und sie immer wieder überarbeitet, eine Version nach der anderen. Vaughn hatte sie lesen wollen. Aber er hatte es nicht erlaubt. Aus gutem Grund.
Jetzt las er sie noch ein letztes Mal.
5
Ich bin Kaptein Benjamin Griessel, Angehöriger der Einheit für Mord und Schwerbrechen beim Direktorat für Gewaltverbrechen mit Sitz in der Markstraat, Bellville.
Gegen mich wurde ein Disziplinarverfahren aufgrund von Artikel 24(1) des südafrikanischen Polizeigesetzes aus dem Jahr 1995, Beilage vom 1. November 2016, insbesondere Art. 5(3) eröffnet, nach dem folgende Verstöße zu ahnden sind:
(b) jegliche ausgeführte Handlung oder ein Versäumnis zu handeln um:
(i) Schaden oder Nachteil für die Interessen der Polizeibehörde, sei es finanzieller oder anderer Art, zu verursachen;
(ii) die Behörde in ihren Verwaltungsaufgaben zu behindern; oder
(iii) seinen oder ihren Pflichten oder Verantwortlichkeiten nachzukommen. Ferner aufgrund von Art. 5(3):
(j) die Missachtung eines offiziellen Befehls oder einer Routineinstruktion ohne triftigen Grund.
Ich verstehe, warum dieses Verfahren gegen mich eröffnet wurde. Ich habe mich entschlossen, weder die Unterstützung der Gewerkschaft noch die eines Verteidigers in Anspruch zu nehmen. Ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. Zum Zwecke der Strafmilderung möchte ich Folgendes aussagen:
Ich habe zusammen mit mehreren Kolleginnen und Kollegen meiner Einheit am 29. August dieses Jahres den Tod von Meneer Menzi Dikela in seinem Haus in der Nutallstraat im Stadtteil Observatory untersucht. Auf den ersten Blick sah es wie ein Selbstmord aus. In meiner Laufbahn als Ermittler habe ich in den vergangenen ca. 26 Jahren über 70 Fälle von Selbstmord untersucht. Aufgrund dieser Erfahrungen und der spezifischen Umstände am Tatort in der Nutallstraat habe ich gewisse Schlüsse gezogen, die mich zu der Vermutung brachten, dass ein Fremdverschulden vorlag. Mir ist aufgefallen, dass die Patronenhülse aus der Pistole fehlte, mit der Meneer Dikela erschossen wurde, und im Wohnzimmer und in der Küche des Hauses waren verdächtige Fußabdrücke und Erdspuren gefunden worden.1
Aussagen von Angehörigen und Nachbarn sowie Aufnahmen der Verkehrsüberwachungskameras der Kapstädter Verkehrsbehörde bestärkten mich in meinem Verdacht. Daraufhin beschloss ich, ohne einen meiner Kollegen mit einzubeziehen, den Fall als Mord zu betrachten und dahingehend zu ermitteln.
Ich bestätige hiermit, dass meine direkte Vorgesetzte, Oberstleutnant Mbali Kaleni, mir zwei Tage später befohlen hat, die Ermittlungen einzustellen, da der staatliche Rechtsmediziner keinerlei Beweise gefunden hatte, die meine Theorie, dass es sich um Mord handelte, bestätigte. Ich gebe zu, dass ich mich der Befehlsverweigerung schuldig gemacht habe, indem ich die Ermittlungen dennoch fortsetzte. Der Grund dafür waren neue Beweise, dass es sich nicht um eine Selbsttötung handeln konnte. Zu diesen Beweisen zählen unter anderem ein versteckter Raum in Meneer Dikelas Gartenhaus, gestohlene Computer sowie die forensischen Ergebnisse bei der Analyse der oben genannten Erdproben.
Am Sonntag, den 3. September dieses Jahres, erhielt ich nähere Informationen über einen BMW X5, der am Tag von Meneer Dikelas Tor vor seinem Haus gesehen wurde. Zudem bekam ich Informationen über die Herkunft der Bodenproben, die darauf hinwiesen, dass sich die identifizierten Verdächtigen auf der Farm Kleingeluk zwischen Philadelphia und Malmesbury aufhielten.
Ich erkläre, dass ich aus eigenem Antrieb und ohne das Mitwissen von Oberstleutnant Kaleni oder dem Einfluss meines Kollegen Kaptein Vaughn Cupido beschlossen habe, die Verdächtigen zur Rede zu stellen.
Ich erkläre, dass ich Kaptein Vaughn Cupido stark bedrängt habe, mich zu begleiten. Außerdem möchte ich aussagen, dass ich keinen Grund zu der Vermutung hatte, dass es sich bei den Verdächtigen um Mitglieder der State Security Agency (SSA) handelte. Ich erkläre, dass ich im Laufe meiner Ermittlungen nicht wusste und wissen konnte, dass die Mitglieder der SSA eine offizielle Operation durchführten.
Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich nicht die Absicht hatte, durch die Verhaftung der SSA-Agenten deren Operation zu gefährden. Das Ganze war ein unglücklicher Zufall.
Kaptein Vaughn Cupido und ich haben drei Mitglieder der SSA im Farmhaus zur Rede gestellt. Sie haben zugegeben, dass sie direkt oder indirekt den Tod von Meneer Dikela verschuldet hatten. Dies hatte großen Einfluss auf meine darauffolgenden Handlungen. Mir wurde klar, dass auf dem gängigen Weg keine Gerechtigkeit geschehen würde, und aus Frustration beschloss ich, die SSA-Agenten mit Handschellen an ihr Fahrzeug zu fesseln. Sie hatten uns angegriffen, und ich wollte sichergehen, dass sie keine Feuerwaffen gegen uns benutzen konnten. Das war einzig und allein meine Entscheidung. Mein Kollege Kaptein Vaughn Cupido hatte daran keinen Anteil.
Hiermit erkläre ich, dass ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass die SSA-Agenten für den Tod von Meneer Menzi Dikela zur Rechenschaft gezogen werden müssten.
Ich habe meine gesamte Laufbahn dem Kampf gegen das Verbrechen gewidmet. Bei den Hunderten Fällen, die ich im Laufe der Jahre untersucht habe, war es stets mein einziges Ziel, Kriminelle zu überführen und vor Gericht zu bringen. Ich gebe zu, dass ich mich bei meiner Arbeit nicht immer an die Befehle meiner Vorgesetzten oder die polizeilichen Vorschriften gehalten habe. Aber ich habe bei jeder schwierigen Entscheidung gründlich überlegt, auf welche Art und Weise der Gerechtigkeit Genüge getan werden konnte.
Dies habe ich auch im Fall Dikela getan, weil ich es für meine Pflicht hielt.
Ich möchte Sie bitten, bei der Festsetzung des Strafmaßes meine bisherige Arbeit als Ermittler, meine Verhaftungserfolge und meine Dienstjahre zu berücksichtigen. Außerdem bitte ich Sie, meinen Kollegen Kaptein Vaughn Cupido in allen Punkten der Anklage freizusprechen. Ich war aufgrund meiner Dienstjahre Leiter der Ermittlungen. Ich habe ihn ungebührlich beeinflusst und übernehme die volle Verantwortung dafür.
Ich danke Ihnen.
Zum wiederholten Mal fragte sich Griessel, ob er nicht auch um Verständnis bitten sollte, weil er das teure Studium seines Sohnes Fritz an der NAFTA-Filmhochschule finanzieren musste, oder vielleicht einfach nur, weil er noch Kinder hatte, für die er sorgen musste. Aber das hätte ihm das Gefühl gegeben, zu katzbuckeln und die Jury emotional zu beeinflussen. Und so etwas konnte er nicht leiden.
Er hörte Schritte. Er holte tief Luft. Seine Karriere, fast dreißig Jahre als Gesetzeshüter, würde hier und heute enden.
Der Konstabel öffnete ihm die Tür. Griessel trat ein.
Die Jalousien waren zugezogen, und eine Neonröhre an der Decke funktionierte nicht. Der Raum war düster. Sie saßen in einer Reihe nebeneinander an einem langen Tisch, in der Mitte Commissioner Mandla Khaba, ein Mann wie ein feister Ochsenfrosch. Musad Manie saß links außen; er nickte Griessel aufmunternd zu. Doch es war der Mann ganz rechts, der Griessel Mut einflößte und ihn wieder hoffen ließ – es war Oberstleutnant Phila Zamisa, Chef des SEK Boland. Der Mann, dessen Leben Bennie vor zwei Monaten gerettet hatte.
Zamisa vermied Blickkontakt mit ihm und hielt die Augen auf die Dokumente vor ihm gerichtet. Kein gutes Zeichen.
»Guten Morgen«, sagte Griessel und stellte sich an den einzelnen Tisch dem Komitee gegenüber.
Keine Reaktion. Der Oberst von der Rechtsabteilung stand auf. Er fragte Griessel, ob er sicher sei, dass er keinen Rechtsbeistand wolle.
»Ich bin sicher. Vielen Dank.«
»Sie verstehen, weshalb dieses Verfahren gegen Sie eröffnet wurde?«
»Ja.«
»Sie können sich setzen.«
Griessel nickte und nahm Platz.
»Kaptein, Sie haben angekündigt, dass Sie eine Erklärung vorlesen möchten.«
»Ja.« Er zog das Dokument aus der Tasche.
»Bitte fahren Sie fort.«
Griessel räusperte sich, faltete das Blatt Papier auseinander und begann, vorzulesen.
Sandra brachte gegenüber der Kindergartenleiterin ihre Entschuldigungen und Versprechungen vor, hastig, glatt und routiniert. Die Frau hörte ihr aufmerksam und mitfühlend zu und legte ihr dann sanft die Hand auf den Unterarm. »Bitte denken Sie daran, Mevrou Steenberg, ich habe auch Kinder. Und Rechnungen zu bezahlen. Und Sie sind nicht die Einzige, die mit den Zahlungen im Rückstand ist.«
Als Sandra wegfuhr, erfüllten sie brennende Scham und Schuldgefühle. Die Chancen, die ausstehenden Beiträge bezahlen zu können, schrumpften zusehends. Die Lüge dagegen blähte sich immer weiter auf und floss ihr immer leichter über die Lippen. Hinzu kam jetzt noch die Erkenntnis, dass ihr Versäumnis auch andere belastete. Das war nicht ihre Art, so wollte sie nicht sein! Sie war nicht wie ihr Vater.
… Sie sind nicht die Einzige, die mit den Zahlungen im Rückstand ist.
Sie war in den letzten Monaten so ausschließlich auf ihre eigene große, wachsende Not fixiert gewesen. Ihre tickende Schuldenzeitbombe. Dabei gab es überall in der Stadt Leute, die in Schwierigkeiten geraten waren. Was sie an Boonstras Anruf erinnerte. Den möglichen Rettungsanker. Den Deus ex Machina, wie ihr Mann Josef ihn genannt hätte.
Sie holte ihr Handy aus der Tasche und rief ihren Chef an.
»Ja, Darling?«, antwortete Charlie Benson, als wäre er jedes Mal erfreut und dankbar über ihren Anruf. Restlos übertrieben. Aber so war Charlie nun mal.
»Ich bin unterwegs zu Jasper Boonstra«, erklärte sie.
Er schwieg, eine Ewigkeit lang. Sie genoss es, denn das passierte nur selten.
»Heiliger Nikolaus«, sagte er schließlich, so ungefähr der schlimmste Fluch, zu dem Charlie fähig war. Dann erwiderte er vorwurfsvoll: »Du veräppelst einen alten Mann.«
»Du bist zweiundsechzig, Charlie. Noch blutjung.«
»Aber der Schein trügt, das weißt du doch. Du veräppelst mich.«
»Nein. Er hat mich wirklich angerufen. Vor fünf Minuten.«
»Dich persönlich? Auf dem Handy?«
»Unter meiner Nummer.«
»Du weißt, was das bedeutet, Sandy.«
Charlie hatte für sie eine breite Palette von Spitz- und Kosenamen, aber er sagte nie »Sandra«. Manche seiner Namen grenzten an Belästigung, etwa »Süße« oder »Püppchen« oder, was sie am meisten hasste, »Sexy Hexi«. Anfangs hatte sie ihn zurechtgewiesen, aber sein achselzuckender Refrain lautete: »Ich bin harmlos, Schnuckelchen. Und ich bin zu alt, um mich noch zu ändern.«
Was ihn immer wieder rettete, war ihre Vermutung, dass Charlies Flirterei nur Tarnung war. Denn seine Sexualität war nebulös, obwohl er eine Ehefrau hatte. Außerdem hatte es Sandra sich bisher nicht leisten können, diesen Job zu verlieren, und zurzeit war es ganz und gar ausgeschlossen.
»Ja«, antwortete sie. »Ich weiß.« Auf der Website von Benson International Realtors waren die Kontaktdaten von Charlie und seinen fünf Angestellten veröffentlicht, inklusive Fotos. Alle fünf Angestellten waren Frauen. Vier waren deutlich über fünfzig; Sandra dagegen erst dreiunddreißig. Wenn Charlie fragte, ob sie wusste, was es bedeutete, dass Boonstra sie persönlich angerufen hatte, meinte er damit, dass er sie wahrscheinlich zielgerichtet aus der Gruppe herausgepickt hatte.
»Bitte sei vorsichtig. Du kennst seinen Ruf. Er hat eine Vorliebe für jüngere Frauen.«
»Unter anderem.«
Wieder schwieg er. Dann sagte er noch einmal: »Heiliger Nikolaus!« Er hatte sich immer noch nicht von seiner Überraschung erholt.
»Da staunst du, was?«
»Das … Das haut mich um, Longoria. Das haut mich völlig um.« Noch so ein Kosename. Nach Eva Longoria. Charlie fand, sie sähe ihr ähnlich. Aber nur, wenn er etwas von ihr wollte oder mit ihr zufrieden war. »Wäre das nicht eine Ironie des Schicksals? Wo triffst du ihn?«, fragte er. »Auf Baronsberg?«
»Ja.«
»Vielleicht will er verkaufen. Die Immobilie ist achtzig Millionen wert, Schnucki. Mindestens.«
»Diesmal will ich fünfundsiebzig Prozent, Charlie.« Das Maklerbüro erhielt vier Prozent Provision. 3,2 Millionen. Normalerweise wäre ihr Anteil daran fünfzig Prozent gewesen, den Rest bekam Charlie.
Aber Boonstra hatte sie angerufen. Persönlich. Und sie brauchte dieses Geld wirklich unbedingt.
»Wir werden darüber reden, Schätzchen. Hör dir erst mal an, was er zu sagen hat.«
Nein, dachte sie. Diesmal nicht, du manipulativer alter Sack.
6
Der Eingang zum Weingut Baronsberg befand sich gleich hinter dem Stark-Condé-Gut, vom Jonkershoekpad aus links ab. Sandra blieb vor dem beeindruckenden Tor stehen; der Name des Gutes prangte in eleganten Sans-Serif-Lettern am Steinpfosten, das Wort »Baron« ein wenig hervorgehoben.
Sandra hatte fast damit gerechnet, dass die Pressemeute schon lauerte. Aber es war keiner da.
Sie drückte auf den Knopf der Sprechanlage knapp unterhalb des Auges der Überwachungskamera. Nichts passierte.
Sie dachte, dass sogar der Name des Weingutes eine Täuschung war ebenso wie das ganze Leben von Jasper Boonstra, das nach seinem Sturz in den Medien breitgetreten worden war: Er hatte hier in Stellenbosch studiert, erst seinen BCom in Betriebswirtschaft und Jura gemacht und dann noch einen MBA hinterher, der begabte Sohn eines Lagerarbeiters bei der Landwirtschaftskooperation in Dordrecht. Seine erste Anstellung hatte er als Vizechef einer kleinen Autoersatzteile-Kette in Gauteng. Von Ehrgeiz getrieben und mit großer Überzeugungskraft gesegnet, besaß er einen Riecher für Marktlücken, Transaktionen und Fusionen. Das erstaunliche Talent für die Manipulation und Tarnung verzwickter Bilanzen hatte er offenbar erst später entwickelt. Sein Aufstieg war beeindruckend. Er begann mit dem Aufbau eines Geschäftskonglomerats in Südafrika, zwei kometenhafte Jahrzehnte lang, wonach auch der große internationale Durchbruch folgte – die Fusion mit dem niederländischen Handelsriesen Schneider-König.
Den Hauptsitz der so entstandenen Firma hatte er nach Stellenbosch verlagert, wo die großen Afrikaaner-Businesswölfe ihr Revier hatten. Und er wollte, so hieß es, so wahnsinnig gerne mit ihnen heulen.
Boonstra hatte im Laufe von acht Jahren drei angrenzende Weinbaugrundstücke an den Hängen des Botmaskop gekauft, eines nach dem anderen, in dem Maße, wie sein Vermögen wuchs. Genau wie die großen Wölfe. Er hatte diese Grundstücke zusammengefügt und umgetauft und als neues Weingut mit neuem Namen vom Stapel gelassen. Mit großem Tamtam und Bohei. Der Emporkömmling, so behaupteten böse Zungen, wollte so unbedingt Teil der Stellenbosch-Elite werden, dass er sogar die Geschichte manipuliert hatte: Die Broschüren und die Website von Baronsberg hatten behauptet, das Gut sei nach dem Verwalter der Vereinigten Ostindischen Kompanie benannt, Baron Hendrik Adriaan van Rheede, der 1683 den Auftrag zur Gründung einer Niederlassung gegeben habe, die Vorläuferin des heutigen Stellenbosch gewesen sei. Van Rhede war, laut Boonstras Propaganda, angeblich an diesem Hang – wo sich jetzt das Gut befand – entlanggeritten, hatte das Tal überblickt und die Gründung des Ortes beschlossen.
Doch kurz darauf sandte ein Geschichtsprofessor der Universität einen lakonischen Leserbrief an die Zeitung Eikestadnuus, in dem er erklärte, dass diese Behauptung reine Fiktion sei.
Das war vor fünf Jahren gewesen. Als Jasper Boonstra noch übers Wasser gelaufen war. Als der Aktienkurs von Schneider-König wöchentlich neue Gipfel erklommen hatte. Damals hatten alle den Professor ignoriert, während sie die Dividenden untereinander aufgeteilt hatten.
Das Tor öffnete sich plötzlich, ohne dass die Sprechanlage einen Laut von sich gegeben hatte.
Sandra fuhr durch und folgte dem kurvigen, gepflasterten Weg zum großen Haus hügelaufwärts, das von üppigen Weingärten umgeben war. Dahinter thronten die Jonkershoekberge; die laubgrünen Hänge, die zu den grauen Felsformationen des Botmaskop auf der linken und den Square-Tower- und den Tweeling-Gipfeln rechts emporklommen, großartig und drohend. Sie passierte ein kleines Wachhaus, von wo aus ihr zwei Sicherheitsleute zuwinkten. Sie winkte zurück. Wieder merkte sie, wie angespannt sie war, obwohl es gar keinen Grund dafür gab. Er war doch bloß ein Kunde.
Andererseits wiederum nicht.
Er war Jasper Boonstra. Rand-Milliardär. Dreihundertfünfzig Millionen schwer. Noch immer, trotz allem.
Er war Jasper Boonstra, der ehemalige CEO von Schneider-König. Er war der größte Wirtschaftsbetrüger in der Geschichte dieses Landes. So wurde jedenfalls behauptet. Denn bisher war seine Schuld noch nicht bewiesen, ja, er war noch nicht einmal angeklagt worden. Sein Betrug war so kompliziert, so verschachtelt in zahllose Transaktionen und geschickt verwobene Spinnennetze von Tochter- und Schattengesellschaften sowie geheimen Bankkonten, dass es vermutlich in ganz Südafrika keine Staatsanwälte oder Polizeibeamten gab, die das nötige Wissen und die Erfahrung besaßen, um das alles zu entwirren.
Er war Jasper Boonstra, der meistgehasste Geschäftsmann im Land. Denn hunderttausend Anleger hatten insgesamt Billionen Rand verloren, als der Aktienkurs von Schneider-König an einem einzigen Tag von vierundfünfzig auf zwei Rand vierzig gesunken war. Jener Tag, als die Bombe geplatzt war und externe Prüfer »Ungereimtheiten« entdeckt und veröffentlicht hatten. Anlagefonds, Rentenfonds, private Anleger, Arbeitnehmer, alle hatten geblutet. Der meistgehasste Mann der Stadt. Denn der Hauptsitz von Schneider-König befand sich in Stellenbosch. Mehrere Hundert der höchst bezahlten Top- und Senior-Manager hatten mit ihren Familien hier gewohnt, hier gelebt. Und viel Geld ausgegeben, in Boutiquen, Restaurants, bei Kunst- und Autohändlern. In Dekoläden und bei Firmen, die phantastische Küchen und luxuriöse Badezimmer einbauten. Sie hatten die Immobilienpreise der Stadt durch die wachsende Nachfrage und das schrumpfende Angebot in die Stratosphäre geschickt. Sie hatten riesige Kredite auf sündhaft teure Häuser aufgenommen, mit den Schneider-König-Aktien als einziger Sicherheit. Freitags hatten am frühen Abend reihenweise Porsches und Ferraris Parkplätze für das traditionelle Schaulaufen und Essen in der Kerkstraat gesucht; manchmal machte es geradezu den Eindruck eines organisierten Autokorsos.
Und dann stürzte alles in sich zusammen. Über Nacht. Buchstäblich.
Den größten Schaden hatte der Immobilienmarkt erlitten. Die Banken verlangten neue Sicherheiten, und die Hausbesitzer konnten sie nicht bieten.
Boonstra war der Grund, warum das Kindergartengeld für die Zwillinge von Sandra und Josef Steenberg, die niedliche fünfjährige Anke und ihre Schwester Bianca, seit drei Monaten nicht bezahlt worden war. Doch das waren nur die kleinen Ohren des ganzen Nilpferds. Denn in Stellenbosch waren die Häuser zu Ladenhütern geworden. Niemand kaufte mehr eines. Die Kräfte des Marktes hatten sich umgekehrt: Dem Überangebot von exklusiven Immobilen stand eine praktisch nicht vorhandene Nachfrage gegenüber. Drei kleinere Maklerbüros hatten kurz darauf ihre Türen schließen müssen. Bei Benson International Realtors hatte Charlie seine beiden ältesten Mitarbeiter ermuntert, in Frührente zu gehen. Und die anderen lebten alle in der Angst, dass sie als Nächste würden gehen müssen. Sandra bildete keine Ausnahme.
Und jetzt würde sie gleich der Ursache für das ganze Elend von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Diesem Schwindler, diesem dreisten Hochstapler, diesem Rätsel. Diesem Mann, der sich nach seinem spektakulären Fall in seinem märchenhaften Haus auf Baronsberg vor den Medien verschanzte. Oder in seinem Milliardärsstrandhaus in Clifton. Oder manchmal, besagten die Gerüchte, im luxuriösen Liebesnest seiner wesentlich jüngeren, super-sexy Geliebten in Franschhoek. Von der seine Frau offenbar wusste, obwohl sie nichts unternahm.
Gegen Jasper Boonstra war bisher offiziell noch kein Verfahren eröffnet worden, aber Schneider-König und mindestens sechs weitere Gesellschaften und Instanzen hatten bereits zivile Anklagen und Forderungen gegen ihn gestellt. Gerichtsverfahren, die sich jahrelang hinziehen würden.
Wäre das nicht eine Ironie des Schicksals?, hatte Charlie gefragt, und Sandra hatte sofort gewusst, was er meinte. Dass sie möglicherweise Profit aus dem Mann schlagen konnten, der ihnen so viel Schaden zugefügt hatte.
Tja. Das wäre mal eine erfreuliche Ironie des Schicksals.
Griessel fand Cupido in dem Büro vor, das als Wartezimmer diente. Sein Kollege trug seinen anthrazitfarbenen Nadelstreifenanzug mit einer optimistischen, blutroten Krawatte dazu. Aber er war unglaublich angespannt. Für Vaughn bedeuteten die Valke alles, das wusste Griessel, und seine größte Angst war es, entlassen zu werden.
»Wie ist es gelaufen, Benna?«
»Ganz okay«, sagte Griessel. Eine Notlüge, um seinen Kollegen zu schonen. »Das fünfte Jurymitglied ist Zamisa.«
Cupido war für einen Moment erleichtert, als er an das Transit-Fiasko dachte. »Dann haben wir eine Chance.«
»Sie können jetzt kommen«, sagte der Konstabel zu Vaughn. »Die Herren sind jetzt bereit für Sie.«
»Schön ruhig bleiben!«, mahnte Griessel.
»Bin ich das nicht immer?«, erwiderte Cupido im Hinausgehen.
Griessel setzte sich. Er konnte nur hoffen, dass der Commissioner Vaughn gegenüber nicht zu hart war. Denn ihm gegenüber war der Mann erbarmungslos gewesen. »Sie gehören nicht in meine Polizeitruppe!«, hatte er gesagt, bevor er Bennie aufgefordert hatte, den Raum zu verlassen.
Sandra drückte auf den Klingelknopf neben der Eingangstür. Sie hörte, wie tief im Inneren des Hauses ein melodiöses Glockenspiel ertönte.
Sie erwartete, dass ihr ein Bediensteter die Tür öffnete, womöglich gekleidet wie ein Lakai aus Kolonialzeiten. Sie grinste über ihre absurde Vorstellung, aber bei den Superreichen wusste man nie. Womöglich geleitete sie der Butler gleich in einen üppig dekorierten Salon und passte auf, dass sie keine Ming-Vase oder ein Pierneef-Gemälde in ihrer Handtasche verschwinden ließ. Dann würde er ihr exotischen Tee in einem güldenen Tässchen servieren, während sie eine Dreiviertelstunde darauf wartete, dass sie der Bwana in wallendem Umhang mit seinem königlichen Erscheinen beehrte.
Sie versuchte, sich daran zu erinnern, was sie bisher an Fotos von diesem beeindruckenden Anwesen gesehen hatte, diesem architektonischen Meisterwerk, das schon in so vielen Zeitschriften abgebildet gewesen war.
Sie hörte keine Schritte und wollte gerade noch einmal klingeln, als die Tür aufschwang und Jasper Boonstra vor ihr stand. Sie erschrak. Sie wusste, dass er es ihr ansah, und ärgerte sich darüber.
Er trug eine Jeans und ein hellblaues Hemd, das über seinen leichten Bauchansatz fiel. Er war barfuß und hatte einen Dreitagebart. Von der Figur her wirkte er schmaler als auf den Paparazzi-Schnappschüssen der letzten Schmutzkampagne und etwas kleiner, als sie erwartet hatte. Doch es handelte sich unverkennbar um den berüchtigten Jasper Boonstra höchstpersönlich.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: