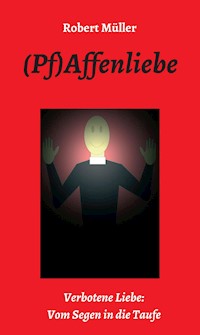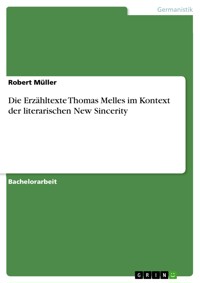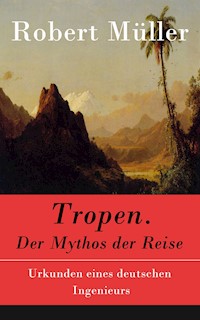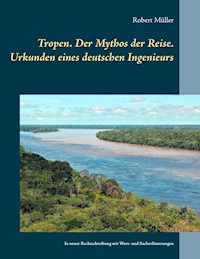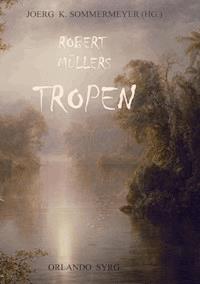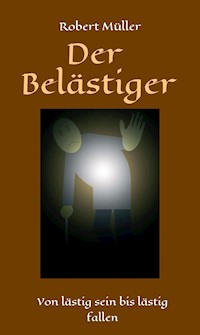
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: #MeToo
- Sprache: Deutsch
Ein gleichermaßen emotional aufwühlender wie nachdenklich stimmender Roman, der in seiner tabulosen realistischen Darstellung und seinen grundsätzlichen Fragestellungen zu Liebe und Moral, zu Vertrauen und familiärer Bindung nicht wenige Menschen zu Tränen gerührt hat. Ein Buch, das mit seinen beiden Handlungssträngen einerseits ein Beziehungsroman, andererseits ein Kriminalroman ist. Erzählt werden die (fiktiven) Erlebnisse und Empfindungen eines alten Mannes in seinen letzten Lebensmonaten, in denen sich mit dem Tod seiner Frau für ihn und seine Umgebung alles ändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Make love, not war!
© 2019 Robert Müller
Neuauflage
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN 978-3-7497-7757-0 (Paperback)
ISBN 978-3-7497-7758-7 (Hardcover)
ISBN 978-3-7497-7759-4 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Robert Müller
DerBelästiger
Von lästig sein bis lästig fallen
Ein #MeToo-Roman
Ein berührender, gesellschaftskritischerRoman über menschliche Leidenschaftenund kriminelle Machenschaften an einemewig topaktuellen Thema – dem Altwerden
Personen und Handlung sind frei erfunden. Allfällige Bezüge zu aktuellen oder früheren politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sind gewollt, nicht aber eine Bezugnahme auf bestimmte Personen, Parteien oder Institutionen.
Ich danke meiner Frau für die gewohnt gewissenhafte Korrektur und die Unterstützung und Zeit, dieses Werk verfassen zu können.
Text und Grafik: R. v. M.
Eigenverlag, Wien 2018
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt und weitere Bestellwünsche siehe letzteSeite sowie www.buecher-rvm.at
Vorwort
Täglich verbreiten die Boulevard-Medien Vorwürfe wegen (angeblicher) sexueller und wirtschaftlicher Verfehlungen. Bad news are good news. Es ist das (immer weniger erfolgreiche) Geschäftsmodell dieser Medien, das zu deren (monetärem) Glück neuerdings durch die #MeToo-Bewegung befeuert wird. Weniger zum Glück der meist ‚honorigen‘ Personen, die zum medialen Scheiterhaufen geführt werden. Ob zu Recht oder zu Unrecht, bleibt vielfach offen.
Aber warum ist #MeToo allein darauf beschränkt? Gibt es nicht Ereignisse sogar in Ihrer eigenen Biographie, wo Sie #Ich-Auch sagten, Leid erfuhren – oder auch Leid zufügten? Situationen in Beruf und Familie, die Ihnen heute peinlich sind, die Sie und andere ins Zwielicht bringen könnten?
Dieser gesellschaftskritische Roman sinniert anders als die (bei Drucklegung vier) anderen Bände der #MeToo-Reihe nicht über die rücksichtslose Gier nach Sex, Geld und Macht, sondern anhand der letzten Monate im Leben eines alten Mannes über das Phänomen sexueller wie sozialer Belästigung als innerfamiliäres #Ich-Auch.
Viel Vergnügen beim Lesen und darüber Nachdenken!
R. v. M.
Kap_1 Prolog: Ich
Hallo. Darf ich mich vorstellen? Werner Fuchs ist mein Name. Dieser Name sagt aber nur wenig über mich aus, da ich ihn mir ja nicht ausgesucht habe. Vielmehr wurde er mir von meinen Eltern gegeben.
Rückblickend gesehen war es aber keine schlechte Wahl. Immerhin bezeichnet Werner – wenn man sich der sprachlichen Wurzeln im Althochdeutschen besinnt, wo ‚warjan‘ wehren, schützen, verteidigen bedeutet – einen Menschen, der auf sich achtet, der warnt, der sich nötigenfalls wehrt, sich verteidigt. Dazu gab es in meinem Leben genug Anlässe und Gelegenheiten. Und mein Familienname bezeugt, dass ich das oftmals mit der sprichwörtlichen Schlauheit des Fuchses tat.
Vielleicht wäre statt Schlauheit Klugheit zutreffender. Mit Schlauheit ist auch ein wenig die Verschlagenheit konnotiert. Und das kann, besser will ich nicht über mich gesagt haben. So sehe ich mich nicht. Jedenfalls war mein geschäftlicher Erfolg im Leben nicht derart, dass man mir Verschlagenheit attestieren könnte. Im Gegenteil. Immer habe ich versucht mit offenem Visier zu kämpfen, was möglicherweise gegen die eben postulierte Klugheit spricht.
Meinen Erfolg im Privatleben und noch mehr im Berufsleben machte meine Hartnäckigkeit aus, die nicht wenige als Belästigung empfanden. Aber wie soll man sonst als Außendienstmitarbeiter eines Großhändlers seine Waren an den Mann bringen, wenn nicht durch dauerndes Anrufen und Vorsprechen bei den Kleinhändlern. Heute tun das die Newsletter der Versandhäuser, die einen fast täglich mit Sonderangeboten locken, mit Sommerschlussverkäufen, die das ganze Jahr dauern oder Weihnachtsangeboten, die es schon ab August zu kaufen gibt. Heute erhält man individuell auf sich zugeschnittene Angebote, an denen man sieht, wie gläsern wir alle dank Google&Co bereits wurden. Zu meiner Zeit war ich es, der um die wahren oder vermeintlichen Bedürfnisse und Begehren meiner Kundschaft Bescheid wusste, war ich der, der ihnen mit meinen dauernden Angeboten und nie mehr wieder so günstigen Sonderangeboten lästig wurde. Damals gab es den Begriff Stalking noch nicht, sonst hätte man mich wohl nicht mit dem Etikett ‚Der Belästiger‘ punziert, sondern als ‚Stalker‘ bezeichnet.
Vielleicht ist es auch nicht klug, dass ich nun wenige Tage vor Weihnachten hier sitze und meinen Abschiedsbrief mit dem Titel „Bevor ich euch lästig werde“ schreibe. Aber Augenblicke wie der jetzige werden nicht von Klugheit getragen, sondern von Gefühlen. Und diese brauchen ein Ventil! Sie brauchen ein Gegenüber, auf dessen Seele sie sich gleich Wasserdampf auf einer kalten Fensterscheibe kondensierend niederschlagen, um sich zu immer größeren Tropfen zu sammeln, die sich schließlich in kleinen Wasserläufen unbeirrbar nach unten in Bewegung setzen. Ja, bewegen. Gefühle bewegen, sollen bewegen!
Was wird mein Sohn Wolfgang sich wohl denken, wenn er diesen Brief liest? Wird dieser ihn bewegen? Oder wird er nicht wie öfters schon überheblich und besserwisserisch sagen: ‚Papa, was du da tatest, war nicht klug!‘ Oder wird er, wie es seine Art ist, den Brief gar nicht lesen. Ich meine wirklich lesen – nachdenklich, emphatisch, mit dem Versuch des Verstehens? Wird er wohl nicht. Als Arzt ist er abgehärtet, erlebt tagtäglich Menschen in höchster Not und nimmt deren Tod als das, was er ja tatsächlich auch ist: als das Natürlichste der Welt.
Soll ich in meinem Brief nun all meine Bitterkeit über den Gang der Welt – auch über ihn und sein Verhalten – quasi als Endabrechnung ohne Reklamationsmöglichkeit hineinpacken? Das wäre zu einseitig und würde die positiven Entwicklungen der letzten Wochen nicht angemessen honorieren. Aber soll man nur diese werten? Ende gut, alles gut? Würden Sie das, liebe Leserin, lieber Leser?
Ich will es nicht. Lassen Sie mich also Ihnen die letzten Monate meines Lebens erzählen. Machen Sie sich selbst ein Bild, wie oft ich – in vielfach ganz anderer Art als von den Initiatorinnen der #MeToo-Bewegung thematisiert – mein #MeToo, MEIN ICH-AUCH, erleben musste.
Kap_2 Amalie
Es war ein schon ungewöhnlich heißer Frühsommertags-Morgen. Meine Frau Amalie lag neben mir im Ehebett. Beide waren wir nur mit einem großen dünnen Bettlaken bedeckt – darunter splitterfasernackt. Nicht, was Sie sich jetzt wahrscheinlich denken. Amalie war so wie ich bereits von der Generation 70 plus. Sex, richtigen Sex gab es nur mehr sehr selten. Aus meiner Sicht – #MeToo – zu selten. Aber bekanntlich gehören zum Sex (mindestens) zwei, sieht man von dem – bei weitem nicht so befriedigenden – einsamen Sex in Form von Masturbation ab.
Was es noch immer gab, vielleicht sogar mehr als früher, war intensiver Hautkontakt. Natürlich entstand dabei nicht mehr jenes lustvolle Prickeln der ersten zarten Hautkontakte, wie wir es beide in unserer Jugend verspürt hatten, als sich unsere Hände zuerst zufällig, dann gespielt zufällig, schließlich ganz und gar nicht mehr zufällig trafen und umfassten. Ganz zu schweigen von den Hautkontakten in jenen Regionen, die man die intimsten nennt. Aber auch ohne dieses Prickeln war der innige Hautkontakt wunderschön: Er brachte Nähe, Wärme, Zusammengehörigkeit.
Ich betrachtete die mir so vertraute Frau nachdenklich. Wie hatte sie sich in all den Jahrzehnten des gemeinsamen Lebens verändert. Durch das Objektiv eines Fotoapparates gesehen, also objektiv, sehr. Viele Falten, ein Goderl, Brüste, denen man die Schwere der Jahre im ursprünglichsten Sinn des Wortes ansieht. Dicke Beine, die langes Stehen, ja selbst Gehen durch den Lymphstau oft zur Qual machen. Der Bewegungsmangel führte wiederum zu Übergewicht und noch mehr Lymphstau. Ein Teufelskreis, der zu einer ungesunden Rundlichkeit geführt hatte. Aber nicht nur bei ihr, sondern bei sehr vielen Frauen ihres Alters.
Manchmal erkannte sich Amalie auf alten Bildern selber kaum mehr. Mir ging es nicht anders. Subjektiv gesehen hatte Amalie sich aber für mich so langsam verändert, dass mein Gehirn das gespeicherte Bild sukzessive adaptiert hatte. So gesehen war Amalie nach wie vor die, um die ich vor Jahrzehnten mit großer Hartnäckigkeit, ja Lästigkeit geworben und deren Bild sich im Laufe der Jahrzehnte in meine Erinnerung eingebrannt hatte.
Damals wurde – ich verallgemeinere hoffentlich nicht zu sehr – das hartnäckige ‚Anbraten‘ von den jungen Mädchen und Frauen noch nicht als sexuelle Belästigung empfunden und gebrandmarkt. Junge Mädchen, denen man auf der Straße nachpfiff oder die man in der Schule oder am Arbeitsplatz bewusst unübersehbar mit Blicken verschlang, fühlten sich begehrt und genossen dieses Begehrt-Werden. Harmlose Witze wurden als harmlose Witze gewertet, mit denen man vorab gegenseitig abtestete, wie man zu Sex&Co steht. Blondinen konnten über Blondinen-Witze lachen, Männer über männerfeindliche Anzüglichkeiten.
Und heute? Heute hat es eine kleine Gilde von verklemmten Weltverbesserern geschafft, dass solche harmlosen Verhaltensweisen als Unziemlichkeiten, als sexistische Herabwürdigungen gelten, für die man seinen Arbeitsplatz verlieren oder sogar vor Gericht stehen kann. Weit haben wir es gebracht!
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, liebe Leserin und lieber Leser. Wirkliche Übergriffe gehören unter Strafandrohung verhindert. Der unvermittelte Griff an den Busen oder Po einer wildfremden Frau in der U-Bahn ist, wie schon das Wort impliziert, ein Über-Griff. Leider hat aber die Gilde der selbsternannten Sittenwächterinnen und Sittenwächter die Grenzen des Anstands und der Sittlichkeit ins Absurde verschoben, mimt in Missachtung unleugbarer biologischer und anthropologischer Gegebenheiten humanistische Rechtlichkeit und Fortschrittlichkeit, katapultiert damit die Gesellschaft aber in eine Vergangenheit zurück, in welcher der Walzertanz als unsittlich eng galt und verboten war.
Jawohl: Nein muss Nein heißen. Aber Nein-Sagen kann man nur zu etwas, was einem mehr oder weniger konkret angeboten oder von einem direkt verlangt wird. Nicht schon generell vorher! Kennenlernen-Wollen bedeutet Offenheit für mögliche Grenzüberschreitungen des körperlichen Abstands und des moralischen Anstands.
Ich etwa habe Amalie damals natürlich nicht vorher um Erlaubnis gefragt, als ich beim Tanzen meine Hand von ihrem Rücken immer tiefer bis zum Po rutschen ließ, um Amalie dann dort so fest an mich zu drücken, dass ihr die Kraft meiner aufgeheizten Männlichkeit nicht verborgen bleiben konnte. Sie schmunzelte nur sphinxhaft und gab dennoch – oder vielleicht genau deswegen? – meiner Aufforderung zu einem weiteren Tanz keinen Korb.
Vielleicht werde ich sehr bald nur mehr solche innigsten Erinnerungen an meine Amalie besitzen, sagte ich mir bitter. Denn in wenigen Minuten werden wir aufstehen müssen, um rechtzeitig ins Spital zu kommen, wo Amalie eine schwere Unterleibsoperation erwartet. Mit Krebs ist nicht zu spaßen!
Früher hatte ich noch unbedacht gewitzelt, wenn jemand das englische Wort cancer für Krebs verwendete, indem ich cancer zu cancel mutieren ließ, zum englischen Wort für annullieren. Und nun stand auch hier die Möglichkeit im Raum, dass das Leben meiner Amalie demnächst annulliert werden könnte. Schwer auszudenken, schwer zu ertragen – aber durchaus realistisch!
Was wohl Amalie gerade denkt? Ob auch ihr die gleichen Gedanken durch den Kopf gehen?
Bevor ich nachfragen konnte, befreite sich Amalie aus unserer Umschlingung und wurde ihrem aus dem Arabischen abgeleiteten Namen als die Tapfere, die Tüchtige, die Hoffnungsfrohe gerecht.
Wortlos zog sie sich nach einer kurzen kalten Dusche an und verschwand in der Küche, um die Henkersmahlzeit zuzubereiten. Vielleicht ist die Bezeichnung Henkersmahlzeit für eine Tasse Tee samt einem Stück Toastbrot mit Butter und Honig angesichts der Kargheit unpassend. Nach Meinung der Ärzte war selbst so ein karges Frühstück vor einer Operation zuviel. Aber Amalie weigerte sich, völlig auf ihre Henkersmahlzeit zu verzichten. „So wenig kann wohl nicht schaden“, sagte sie. „Basta!“
Und so saßen wir Minuten später wie tausende Male davor in gelebter Zweisamkeit beim gemeinsamen Frühstück. Diesmal aber wortlos. Was sollten wir auch sagen? Wir wussten beide, worum es ging und hingen den düsteren Gedanken nach.
Kap_3 Im Spital
Eine knappe Stunde später erreichten wir mit der U-Bahn das Krankenhaus, wo wir bereits erwartet wurden. Die Stationsschwester schüttelte uns freundlich die Hand und bat uns zum Pult.
„Haben Sie alle Befunde abgegeben? Oder haben Sie noch irgendwelche anderen mit?“, fragte sie meine Frau.
„Nein, es gibt nichts Neues. Sie haben alles hier. Beim letzten Gespräch hat die Oberärztin bereits alles kontrolliert und in meinen Akt eingescannt.“
„Sind Sie nüchtern?“, fragte die Stationsschwester.
„Wenn Sie meinen, ob ich auf meinen gewohnten morgendlichen Slibowitz verzichtet habe, dann ja“, konnte sich Amalie nicht eines gewissen Galgenhumors enthalten, um dann ausweichend, ohne zu lügen, zu antworten: „Aber ja, ich habe die Anweisungen der Narkoseärztin berücksichtigt.“
„Gut so. Als zu verständigende Angehörige habe ich hier Ihren Mann Werner Fuchs stehen“, las die Stationsschwester vor, wobei sie mich mit einem kurzen Seitenblick taxierte, „sowie Ihren Sohn Dr. Wolfgang Fuchs. Stimmt das?“
„Stimmt.“
„Oh, ein Doktor. Ist Ihr Sohn vielleicht auch Arzt?“, bohrte die Stationsschwester nach.
„Ja – allerdings ist er selbständig. Er praktiziert als Allgemeinmediziner.“
„Sehr gut. Endlich ein kompetenter Ansprechpartner. Gibt es sonst noch Kinder oder jemanden, den wir benachrichtigen oder im Fall des Falles fragen sollen?“
„Nein“, war die knappe Antwort meiner Frau, die auf die ungeschickte Wortwahl ‚endlich‘ und ‚im Fall des Falles‘ sowie auf den unübersehbar abschätzigen, vielleicht sogar vorwurfsvollen Blick der Schwester bei der Frage nach weiteren Kindern bewusst nicht einging. Sie war jetzt wirklich nicht in der Stimmung über den Sinn und Zweck des Lebens zu diskutieren oder gar zu streiten.
Ein zweites Kind hatten wir nicht bekommen, weil ja für meine – nomen est omen – ‚tüchtige‘ Amalie Beruf und Geld wichtiger waren als ein weiteres Kind. Sie hatte einmal ausprobiert, wie es ist, die biologische Funktion und die soziale Rolle als Mutter auszufüllen. Dabei war sie zu dem Schluss gekommen, dass sie keiner weiteren Kinder bedürfe. Der recht gut bezahlte Beruf war weniger anstrengend, weniger frustrierend, brachte mehr soziale Anerkennung und mehr Geld, im Moment und später in der Pension.
Das müsse man – gemeint war natürlich nicht ‚man‘, sondern ich – doch verstehen, sagte sie. Widerspruch wäre zwecklos gewesen. Und so verstand ich es eben. Sowohl als Staatsbürger, weil die Gesetze ja tatsächlich Mütter krass benachteiligen, als auch als folgsamer Ehemann. Dabei hätte ich durchaus einem zweiten Kind, insbesondere einer kleinen Tochter, viel abgewinnen können.
Die Stationsschwester riss mich abrupt aus meinen Erinnerungen, als sie uns bat, ihr in das vorgesehene Zimmer zu folgen.
Es war ein in freundlichen Orange- und Ockertönen ausgemaltes Dreibettzimmer mit bunten Vorhängen, das allein durch seine Farben Frohsinn und Gelassenheit ausstrahlen sollte. Das hätte wohl auch trotz des unerfreulichen Anlasses wie gewünscht funktioniert, hätten dort nicht schon am Nachtkästchen eine Beruhigungspille und das auf dem Bett liegende Operations-Nachthemd auf meine Frau gewartet.
Als Amalie anfing sich zu entkleiden, um sich im Bad vorsorglich mit Octenisept-Shampoo zu waschen, besser: zu desinfizieren, verließ ich den Raum und setzte ich mich auf eine der Sitzbänke neben dem Schwesternpult. Dort wurde ich sogleich wieder von düsteren Gedanken gequält. Die Befunde verhießen ja schließlich nichts Gutes.
Nur Minuten später wurde Amalie in der sprichwörtlichen PERSIL-Frische von einem Pfleger in ihrem Bett an mir vorbei Richtung Aufzug geschoben. Hastig war ich aufgestanden und hatte ihr noch schnell mit einem festen Händedruck und einem zarten Kuss alles Gute gewünscht.
Kap_4 Banges Warten
Kaum war Amalie im Lift verschwunden, sank ich, wie nach einem langen Arbeitstag ermattet, auf die Holzbank. Deren unbequeme Härte ließ mich wie auf einer Anklagebank sitzend fühlen. Damit nicht genug: Starrten mich nicht alle Vorübergehenden an? Aus Mitleid, aus Neugier, oder einfach nur deswegen, weil sie ja doch irgendwohin sehen mussten? Sahen sie mir an, welch düstere Gedanken sich unter dem schon schütteren Haarwuchs verbargen? Wohl kaum! Niemand fragte mich, niemand zeigte besonderes Interesse an mir und meinen Problemen. Warum auch? Sie hatten ihre eigenen, mit denen sie an diesem Ort wohl ebenso wie ich mehr als ausgelastet waren.
Ich blickte auf die Uhr, die im kühlen Bahnhofsdesign meiner verbleibenden Lebenszeit gnadenlos Minute um Minute abzwackte. Nach 10 Minuten hielt ich es nicht mehr aus und ging zur Stationsschwester.
„Schwester, wie lange wird die Operation wohl dauern?“
„Die hat noch nicht einmal begonnen. Sie sollten nicht hier sitzen und dauernd auf die Uhr starren. Das hilft Ihnen und Ihrer Frau in keiner Weise. Gehen Sie einen Kaffee trinken, oder besser doch einen Beruhigungstee. Ich kann Ihre Unruhe verstehen, aber so machen Sie die Situation auch nicht besser. Also: Fahren Sie hinunter ins Erdgeschoß. Dort ist eine Cafeteria.“
Unschlüssig sah ich die Stationsschwester an.
„Na gehen Sie schon“, forderte sie mit eindringlicher Stimme.
Die will mich nur loswerden, dachte ich ein wenig wütend. Meine Unruhe ist ihr zuwider, ja steckt sie vielleicht an. Glaubt sie wirklich, dass ich nun gemütlich Kaffee trinken und womöglich noch dabei die Tageszeitung lesen könne? Nein! Das kann ich nicht!
„Das ist sicher ein Vorschlag, den viele andere schon angenommen haben und annehmen werden. Aber ich kann das nicht. Ich möchte hier warten. Das bin ich meinem Namen schuldig.“
„Was soll das heißen ‚meinem Namen schuldig‘?“, fragte die Stationsschwester überrascht und strich sich ein widerborstiges Haarbüschel aus dem Gesicht.
„Das soll heißen, dass Werner eben ‚Warner‘, ‚Verteidiger‘ bedeutet. Ich halte hier die Stellung, bis die Entwarnung von Ihrer Seite kommt. Bis ich weiß, dass alles gut gegangen ist.“
„Das kann aber lange dauern.“
„Wieso? Meiner Frau hat man gesagt, dass die Operation rund zwei Stunden dauern wird.“
„Mag sein. Aber hat man ihr auch gesagt, dass Notfälle vorgezogen werden? Dass ihre Operation vielleicht erst in einigen Stunden beginnt? Nein? Dann wissen Sie es jetzt!“
Ich sah die Schwester unschlüssig an, worauf diese fortfuhr.
„Daher nochmals mein Vorschlag: Gehen Sie in die Cafeteria, oder noch besser, fahren Sie nach Hause und lenken Sie sich dort ab. Hier können Sie nicht helfen. Ihre Frau ist in guten, was sage ich, in den besten Händen. Wir benachrichtigen Sie verlässlich, wenn alles vorbei ist.“
Das klang ja ganz gut, sagte ich mir. Aber nein. Was konnte ich zu Hause tun, was ich hier nicht konnte? Dort wie da würde ich ja doch nur tonnenschwere Gedanken wälzen.
„Nein – ich bleibe. Alles andere käme mir als Im-Stichlassen, als Verrat vor.“
„Wie Sie wollen. Aber gehen Sie mir und dem anderen Personal nicht im Weg herum oder gar mit andauernder Fragerei auf die Nerven. So etwas kommt leider immer wieder vor. Ersparen Sie bitte sich und uns den Ärger!“
Ich ging also wieder zur Bank zurück und setzte mich. Wieder vergingen 10 Minuten. Jetzt müsste Amalie eigentlich schon eingeschläfert worden sein – na ja, nicht so, wie man das manchmal meint. Ob man ihr diesmal die besseren Narkosemittel gegeben hatte? Die, auf die man nicht beim Erwachen erbricht? Ach so, die kosten mehr. Die gibt es dann natürlich nur für die Privatpatienten, zu denen Amalie aber nicht zählt.
„Schwester, noch eine Frage“, meldete ich mich diesmal gleich von der Bank, damit sie sich am Pult nicht wieder bedrängt fühlte. „Welches Narkotikum wird eigentlich verwendet? Meine Frau ist sehr empfindlich und hat bisher immer im Aufwachraum erbrochen.“
Die Stationsschwester reagierte nicht.
„Schwester! Ich habe Sie gefragt, ob Sie wissen, welches Narkotikum meine Frau bekommt. Wird sie intubiert? Wissen die Ärzte, dass sie – wie in unserem Alter üblich – lockere Zähne hat, mit denen es zu Problemen kommen kann?“
Die Stationsschwester blickte nicht einmal vom Akt hoch, wo sie irgendwelche Eintragungen vornahm.
„Schwester!“, sagte ich mit nun sehr viel lauterer Stimme und erhob mich demonstrativ von der Bank. „Vielleicht haben Sie mich nicht gehört. Ich fragte Sie gerade, womit meine Frau narkotisiert wird, ob sie intubiert wird und ob man Bescheid weiß über ihre Zahnprobleme.“
Diesmal blickte die Stationsschwester auf. Aber ihr Blick verhieß nichts Gutes. „Ich bin nicht taub und habe Sie daher sehr gut gehört. Sie brauchen nicht zu schreien. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass wir hier Arbeit haben und dass Sie uns dabei nicht stören, ja nerven sollen, während Sie hier warten. Bitte halten Sie sich daran und werden Sie nicht lästig!“
„Aber das mit den Zähnen ist doch wichtig“, versuchte ich argumentativ zu widersprechen.
„Eben, und deswegen ist all das, von den Zähnen bis zum Erbrechen, wohl in der Vorbesprechung mit der Anästhesistin geklärt worden. Jetzt wäre es sowieso zu spät.“
„Wäre es nicht“, widersprach ich mit einer sogar für mich, den Belästiger, unüblichen Widerborstigkeit und Vehemenz, die wohl der nervlichen Ausnahmesituation geschuldet war. „Denn immerhin könnten Sie ja die Freundlichkeit haben, den Telefonhörer zu nehmen und diese Information an das Operationsteam weiterleiten.“
„Und wenn ich diese Freundlichkeit nicht habe?“, kam es ähnlich widerborstig zurück. „Was dann?“
„Dann, dann, … dann würde ich mich beschweren, nein, noch besser, dann würde ich es eben selber tun. Einen Telefonhörer abzuheben und mich von der Vermittlung mit dem Operationssaal verbinden zu lassen, kann ja wohl nicht so schwer sein.“
„Das würde ich Ihnen nicht raten.“
„Und wie wollen Sie das verhindern?“
„Das werde ich Ihnen gleich zeigen.“
Die Stationsschwester griff zum Diensthandy und wählte eine Nummer. Nach kurzer Zeit flüsterte sie einige Worte in das Mikrofon.
Na also, dachte ich zufrieden. Man muss nur ein wenig heftig werden und lästig sein, dann tun die Leute doch das, was man von ihnen will. Doch diesmal hatte ich mich getäuscht, gewaltig getäuscht.
Wenig später stand ein etwa 30-jähriger uniformierter Hüne vor mir, an dessen Seite unübersehbar ein Schlagstock und am Gürtel Handschellen baumelten.
„Ist er das?“, fragte er in Richtung der Stationsschwester.
„Ja“, war die knappe Antwort.
Daraufhin hakte sich der Hüne bei mir ein und bat mich mit unwiderstehlicher, körperbetonter Höflichkeit, mit ihm gemeinsam den Ort meines Disputes mit der Stationsschwester zu verlassen.
Am Ausgang des Krankenhauses gab er mir noch einen sanften Schubs und sagte: „Opa, geh heim und komm erst wieder, wenn du weißt, wie man sich in einem Krankenhaus benimmt.“
Kap_5 Im Park
Ich ging aber nicht wie geheißen nach Hause. Was sollte ich dort? Das Frühstücksgeschirr in den Geschirrspüler räumen? Nicht nötig! Amalie hatte wie üblich alles picobello hinterlassen. Das war ihre Art. Daran konnte auch ein Anlass wie dieser nichts ändern.
Zudem würde ich dort wie im sprichwörtlichen Raubtierkäfig auf- und ablaufen, keine Luft bekommen. Luft, ja, frische Luft war jetzt das Wichtigste.
Ich lenkte daher meine Schritte in den Park vor dem Krankenhaus und ließ mich auf einer der Bänke nieder. Obgleich auch diese eine harte Holzbank war, fühlte ich mich nun nicht mehr wie auf der Anklagebank. Vielleicht weil ich nicht in einem engen Raum war, in dem jemand anders – sei es der Wärter oder die Stationsschwester – das uneingeschränkte Sagen hat? Oder war es der strahlend blaue Himmel, in dessen unendlichen Weiten einige wenige weiße Wölkchen wie Schafe auf der Weide friedlich dösten? Anders als hinter den Mauern des Krankenhauses herrschte hier nicht geschäftige Betriebsamkeit, sondern Ruhe und Frieden.
Ich ließ meinen Blick schweifen.
In der Sandkiste spielten zwei Kinder friedlich miteinander, ohne das oft nervenaufreibende Geschrei und Gezänk. Der kleine Bub half dem offensichtlich etwas jüngeren Mädchen beim Backen von Sandkuchen, indem er vom nahen Trinkbrunnen immer wieder Wasser zum Anrühren des Sandbreis herbeischaffte. Mein Wolfgang hatte das auch oft gemacht. Wo ist nur die Zeit geblieben?
Auf der dort nächstgelegenen Bank saß eine alte Frau, wohl die Oma. Denn immer wieder sprach sie kurz mit den beiden Kindern. Ob aufmunternd oder ermahnend, konnte ich wegen der großen Entfernung nicht hören.
Was sage ich: alte Frau? Ja damals, als ich mit dem kleinen Wolfgang als junger Vater bei der Sandkiste saß, erschienen mir die Omis alle alt, sogar oft steinalt.