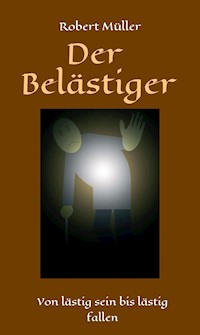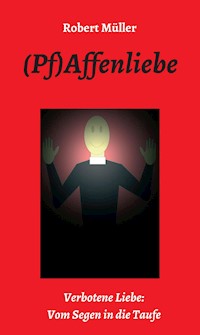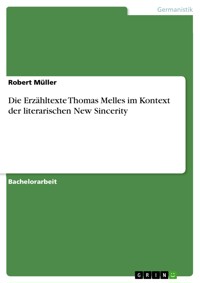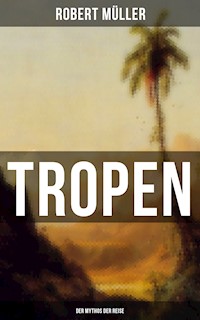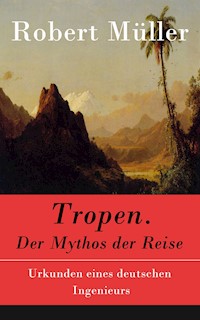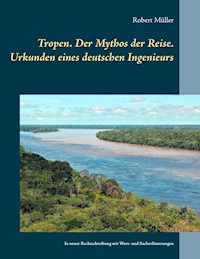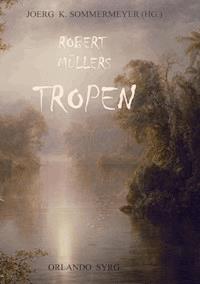3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Welt in jenem Sommer – das ist das Deutschland im Olympiajahr 1936. Einer von Millionen Jungen, die sich für das Sportereignis begeistern, ist der Hamburger Hannes Hacker, Gymnasiast, Mitglied im Jungvolk – und Halbjude. Dank glücklicher Umstände ist seine nicht-arische Abkunft bisher unentdeckt geblieben. Er versucht, das Leben eines ganz normalen deutschen Jungen zu führen. Nach außen spielt Hannes den hundertprozentigen Pimpf, innerlich lebt er in der ständigen Furcht, daß seine Umgebung das Geheimnis entdecken könnte. Das Netz zieht sich allmählich zu … (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Ähnliche
Robert Muller
Die Welt in jenem Sommer
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
1
Lang und schwül schleppte sich der Nachmittag dahin. Rolf Sandmann saß auf seinem Fahrrad, spielte mit der Klingel. Der linke Fuß stand auf dem Pedal, der rechte scharrte am Boden. Er summte den Schlager Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau’n … vor sich hin.
Er unterbrach sich, was ein anderer nie gewagt hätte: «Jesse Owens wird den Weitsprung nie gewinnen. Und die 200 Meter schafft er auch nich’. Den 100-Meter-Sieg, den kann sich Mister Ofens mal an’n Hut stecken. Das war reinste Schiebung. Sagt mein Vater auch. Das wird er noch mal bereuen, der Neger.»
Hannes Hacker wußte, daß man den Namen des schwarzen Sprinters anders aussprach, aber er hielt sich zurück.
Die hohe Hauswand am Lehmweg, übermalt mit übergroßer, verblichener Persil- und Imi-Reklame, warf Schatten über den staubigen Hof des Straßenbahndepots. Die Jungen hockten in der Sonne. So richtig heiß war es gar nicht. In der Schule mußten es 27 Grad sein, bevor es hitzefrei gab. Aber die Ferien fingen ja sowieso gleich an.
Rolf blinzelte in die Sonne. Fähnleinführer Hinrichs blinzelte auch immer so, wenn er nachdachte. Nur deswegen, dachte Hannes, tut es Rolfie auch.
«Die längsten Beine hat er ja», kreischte der kleine Uwe Schmitt, spuckte dabei auf sein verschrammtes Knie und rieb es mit dreckigen Fingerspitzen. «Aber die Silberne kriegt er deswegen noch lange nich’. Kommt gar nich’ in die Tüte.»
Schmitt hatte einen runden Kopf, kurzgeschorenes Haar, einen aufgekratzten Pickel am Mundwinkel. Man kam ihm ungern zu nahe: Schmitt hatte einen unangenehm säuerlichen Geruch. Hannes glaubte, daß er nach weißen Mäusen roch.
«Die Neger, die schwitzen immer so», verkündete Rolf. «Das weiß jeder.»
«Deswegen sind die auch alle ganz schön schnell müde», ergänzte Werner Schemel mit verängstigtem Seitenblick auf Rolf. «Die anneren Neger, die kommen da gar nich’ mit. Die besiegen wir alle, oder? Haushoch gewinnen wir die Olympiade, stimmt’s, Rolfie?»
«Blöder Krüppel», quittierte Rolf Werner Schemels Unterwürfigkeit. «Kommalher.»
Er griff nach dem Kopf des durch Kinderlähmung Behinderten und nahm ihn in den Schwitzkasten. Die klobige Schiene an Werner Schemels Bein klirrte gegen Rolfs Hinterrad.
«Ach, Rolfie, jetzt laß doch den Quatsch», reagierte Schemel halb ängstlich, halb entzückt. So viel Beachtung hatte ihm Rolf Sandmann schon lange nicht mehr geschenkt.
«Ach, Rolfie, jetzt laß doch den Quatsch», äffte Schmitt ihn nach.
«Mensch», sagte Hannes, «gleich renkst du ihm den Arm aus.»
«Na und?» fragte Rolf. «Würde doch gut zu ihm passen, nich’?»
Der Behinderte kämpfte sich frei, sah sich dabei aber vor, seinem Peiniger nicht weh zu tun. Er riß die Arme hoch wie Eimsbüttels Stürmer Rohwedder, wenn er ein Tor geschossen hatte.
«Rache is’ Blutwurst», schrie er, «Leberwurst is’ Zeuge.»
«Mensch, ist das ’n Arschloch.» Schmitt schüttelte seinen geschorenen Kopf, betupfte sein Knie und sang vor sich hin:
Hans spielt abends so schön
auf dem Schifferklavier,
auf dem Schifferklavier
seine Lieder …
«Unterm Schlüpfer bei ihr», verbesserte ihn Rolf Sandmann.
«Und was kriegt er dafür?» setzte Schmitt das Duett fort.
«Blutige Finger!» grölten die anderen, sogar Jürgen Kloth schrie mit. Ganz hatte Hannes die Pointe der gängigen Straßenbahndepot-Fassung des Schlagers nie verstanden. Wovon kriegte man blutige Finger? Wieso war das komisch? Warum wußten Rolfie und Schmitt über gewisse Dinge Bescheid und er nicht?
Nun fing Rolf Sandmann an zu pfeifen. Erst spitzte er den Mund, dann füllte er die Backen mit Luft, als wollte er Trompete blasen. Dann kamen stoßartig Töne, eigentlich nur eine Mischung von Zischen und Prusten.
Rolf Sandmann hatte ein frisches, fröhliches Gesicht, glattes gelbes Haar und große Unschuldsaugen. Er erinnerte Hannes an Jungvolk-Werbeplakate, die es längst nicht mehr gab; fürs Jungvolk brauchte man nicht mehr zu werben.
«Dem sein Bein hätt’st du eben beinah in die Speichen geklemmt», sagte Jürgen Kloth, die Sache herunterspielend, wie er meinte. Er lehnte an der Mauer der Mietskaserne und sah verdrossen zu, wie Rolf erneut begann, den Behinderten zu piesacken.
Jürgen Kloth war zierlich, hatte eine wachsbleiche Haut, braune, erschrocken wirkende Augen. Sein seidiges dunkles Haar fiel ihm in die Stirn. Er war im selben Alter wie die anderen vom Straßenbahndepot – zwölf oder dreizehn –, sah aber jünger aus. Wie Hannes Hacker ging auch Kloth in die Oberrealschule Eppendorf, das große rote Gebäude Ecke Hegestieg und Hegestraße. Hannes hatte deswegen oft Bedenken: Kloth im Straßenbahndepot und in der Quinta B – das war gefährlich. Sollte sein Geheimnis in der Schule aufgedeckt werden, dann wäre es auch im Depot für ihn vorbei. Rolfs Meute hatte für Kloth nicht viel übrig; sie mißtrauten ihm, weil er vornehm schnackte und teuer angezogen war, kein Wunder, seine Eltern hatten eine piekfeine Konditorei am Eppendorfer Baum.
«Paßt dir was nich’, Asthma?» wollte Rolf wissen. «Bei mir hat sich der Krüppel nich’ beschwert. Oder hast du was zu meckern, Werner?»
«Loslassen», grunzte Schemel, den Rolf wieder im Schwitzkasten hielt. «Bitte, Rolfie, loslassen.»
Hannes dribbelte seinen Tennisball auf eine Mauer zu. Dort hatte jemand mit Ölfarbe ein Fußballtor gemalt.
«Ich geh mal ins Tor», sagte er in der Hoffnung, mit einem Spiel von der Situation abzulenken.
«Mir zu heiß», entschied Rolf und sah einer leeren Linie 13 nach, die über den Hof rasselte. «Keine Lust, mich mit Nieten abzugeben.»
Da mußte ihm Hannes recht geben. Es war ihm ein Rätsel, warum eine Führernatur wie Rolf Sandmann sich mit derartigen Flaschen abgab: Schmitt roch nach Mäusen und hatte Eiterpickel am Mund; Schemel wäre damals beinahe an seiner Kinderlähmung gestorben und taugte nur noch zu Quälerei; «Asthma»-Kloth war auch kaum zu gebrauchen; und er, Hannes Hacker …
Nun ja. Warum Rolfie ausgerechnet ihn duldete, darüber hatte er oft nachgegrübelt. Rolf hatte keine Ahnung, er wußte nichts von dem Geheimnis seiner Abstammung. Oder vielleicht doch?
Kloth zog eine spitze Tüte aus seiner Hosentasche und bot sie Rolf versöhnend an.
«Mensch, knorke!» sagte Rolf. «Hat die Tasche rammelvoll von Lakritz und Salmis und sagt kein Wort!»
Kloth wollte den Schatz schon herumreichen, aber Rolf legte seine Hand über die offene Tüte.
«Willste gleich wieder alles loswerden?» fragte er. «Doof bleibt doof.»
Ein dicker Straßenbahnschaffner, in seiner schweren schwarz-roten Uniform schwitzend, trabte über den Hof.
«Da kommt ja Hering in Tomatensoße!»johlte Rolf.
«Da kommt ja Hering in Tomatensoße», wieherte Werner Schemel. Er humpelte über die Straßenbahnschienen; der Schaffner versuchte, sich so schnell wie möglich zu verdrücken.
«Hering in Tomatensoße!» riefen nun alle. «Hering in Tomatensoße!»
«Wer will aufs Tor schießen?» fragte Hannes ungeduldig.
«Eins kann ich euch versichern …» Rolf klebte sich gerade Salmiakpastillen auf den Handrücken. «Bei den Reitturnieren ist Deutschland unschlagbar. Sagt mein Vater auch.»
«Die Schweden sollte man aber nicht unterschätzen», meinte Jürgen Kloth wichtigtuerisch.
Warum konnte sich der Idiot nicht zurückhalten? Immer diese hochgestochenen Töne …
«Die Schweden sollte man aber nicht unterschätzen», piepste Schmitt.
«Quatsch nich’, Krause», knurrte Rolf.
«Sollte man auch nich’», beharrte Jürgen.
«Sollte man auch nich’», schrien Schemel und Schmitt im Chor.
«Dann unterhalten wir uns eben über was anderes!»
Mensch, dachte Hannes, dem Kloth ist wirklich nicht zu helfen. Der ist ja geradezu peinlich.
«Dann unterhalten wir uns eben über was anderes!» quietschte Uwe Schmitt. Er lag am Boden, hielt sich den Bauch mit schmuddeligen Händen, strampelte mit den Beinen, rollte über Schienen und Steine. Seine grauen Turnschuhe waren durchlöchert.
«Mensch, gleich macht der sich die Hose voll», frohlockte Werner Schemel. Endlich war nicht mehr er das Opfer. Jemand anderes war dran. Ob Kloth oder Schmitt war ihm egal.
Bei Schmitt war noch nie jemand zu Hause gewesen; keiner wußte, in welcher Mietskaserne im Falkenried er mit seinen Eltern hauste. Man sah ihn eigentlich nur im Straßenbahndepot; dort tauchte er wie ein räudiger Köter auf und verschwand ebenso schnell wieder. Die Schmitts waren Proleten. Im Straßenbahndepot munkelten sie von scheußlichen Geschichten, in die Frau Schmitt und ihre Untermieter verwickelt waren. Vater Schmitt war arbeitslos, bekam Geld von der Wohlfahrt, das er in Sandmanns Kneipe vertrank. Schmitt leugnete derartige Behauptungen. In Deutschland gab es schließlich keine Arbeitslosigkeit mehr; das wußten doch alle, das stand ja auch im Hamburger Tageblatt. Wie konnte sein Vater also von der Wohlfahrt leben?
«Na ja, ich muß wohl mal nach Hause», sagte jetzt Kloth. Er vergrub die Hände tief in den Hosentaschen, konnte sich aber noch nicht entschließen, den Weg über den Hof anzutreten.
«Na ja, ich muß wohl mal nach Hause», veräppelten Werner und Rolf ihn. Hannes wandte sich ab. Irgendwie tat ihm Jürgen Kloth leid.
Rolf Sandmann war von seinem Fahrrad abgestiegen. Werner Schemel hielt es für ihn, während Rolf in Boxerstellung ging und gegen seinen Schatten an der Hauswand antrat.
Jetzt hat er sich endlich genug gelangweilt, dachte Hannes.
«Und die Goldmedaille fürs Boxen kriegen wir auch! Wie Maxe machen wir’s. Wie Maxe Schmeling.»
«Jaja.» Jürgen Kloth erlaubte sich für seinen Abgang eine Geste der Auflehnung und schnitt eine Grimasse. «Wie Maxe Schmeling.»
«Das wirst du bereuen, Kloth!» Rolf kniff die Augen zusammen.
Bereuen? Wie und wann würde Kloth bereuen? Hannes stand mit dem Rücken zur Hauswand, während er überlegte, warum Rolf Sandmann eigentlich solche Macht über sie alle hatte. Was war an Rolfie Sandmann so ausgefallen, fragte er sich. Viel Grips hatte er nicht; er behauptete, die Schule sei die reinste Zeitverschwendung, noch zwei Jahre durchmogeln, dann könne ihm die Schule gestohlen bleiben. Er wollte die Kneipe seines Vaters übernehmen.
Nein, überlegte Hannes, es gab nur einen einzigen Grund für Rolfs Stellung im Straßenbahndepot: Er besaß das Fahrtenmesser. Seit er die Pimpfenprobe bestanden hatte, durfte Rolf das scharf geschliffene Messer tragen. «Blut und Ehre» stand darauf. Am Holzgriff blinkte das Hakenkreuz. Das war das Geheimnis: Rolf Sandmann hatte das Messer, die anderen nicht. Sie durften es nur bewundern, wenn er sich damit die Fingernägel sauber machte.
«Mensch, das wär prima, wenn die uns nach Berlin zur Olympiade fahren ließen.» Uwe Schmitt kratzte an seinem Pickel. «Unser Fähnlein fährt immer nur ins Lager.»
«Für uns sehe ich noch Chancen», sagte Rolf. «Fähnleinführer Hinrichs hat schon mal so was angedeutet.»
«Morgen fangen die Sommerferien an, und wir bleiben hier», klagte Schemel.
«Wir fahren nach Travemünde», sagte Kloth.
«Wir sind hier nich’ alle Schieber», fuhr Rolf ihn an. «Wir fahren ins Lager, in die Lüneburger Heide. Mir genügt das.»
«Mir auch», meinte Schmitt.
«Was hast du denn vor, Hacker?» wollte Jürgen Kloth wissen.
«Wie Rolfie, wir sind doch im selben Fähnlein.»
«Die lassen mich einfach nich’ rein», klagte Jürgen Kloth. «Hab’s immer wieder versucht.» Er sah Rolf von der Seite an, als hoffe er, sein Los könnte bei ihm Mitgefühl auslösen.
«Wissen wir ja längst.» Rolf unterdrückte ein Gähnen. «Hast Asthma, jaja. Mir fällt dein Asthma langsam auf die Nerven.» Er blinzelte über die Köpfe der anderen hinweg. «Werner hier ist verkrüppelt. Der gibt auch nicht dauernd damit an.» Plötzlich hatte er einen Einfall: «Wer von euch will ‹Verräter› spielen?»
«Verräter?» fragte Schmitt. «Mensch, Klasse! Wie geht denn das?»
«Man braucht nur die richtigen Leute», erwiderte Rolf. War er dabei, ein neues Spiel zu erfinden? Meistens entpuppten sich seine Einfälle als Variationen eines einzigen Themas: Ein Feind, Spion oder Verräter wurde «gefaßt», «verhört» und «entlarvt» – durch Informationen, die nur Rolf zugänglich waren.
Bei ähnlichen Anlässen hatten Rolf und Hannes einen Geheimcode entwickelt, mit dem man unsichtbare Feinde unschädlich machen konnte. Ein anderes Mal hatte Rolf «Beobachten!» erfunden, ein Spiel, das verlangte, gleichaltrigen Mädchen in Eppendorf nachzuspionieren und über deren verdächtige Beziehungen und Verabredungen «Akten» anzulegen.
Das neue Spiel kam heute aber nicht an, denn die Gruppe hatte sich plötzlich mit einer Gefahr zu befassen.
«Dicke Luft», rief Rolf. «Die von der Hoheluftchaussee kommen, Dorn an der Spitze.»
«Was hat der denn wieder mal vor?» fragte Schmitt ängstlich, als die drei Jungen den Hof überquerten. «Schnell! Durch die große Halle …»
«Immer gleich kneifen, was», höhnte Rolf Sandmann. «Hau ruhig ab. Wir bleiben hier. Vor verkappten Nichtariern hab ich keine Angst.»
«Was für Nichtarier?» fragte Hannes höchst alarmiert.
«Die gibt’s in der Hoheluftchaussee in rauhen Mengen, sagt mein Vater.»
Die drei Jungen kamen im Gleichschritt auf die Gruppe zu. Dorn, den blonden Anführer mit dem Rattengesicht, hatte man schon oft in Eppendorf gesichtet. Er trug HJ-Uniform; seine beiden Kumpane waren in Zivil, bis auf die schwarzen JV-Mützen, die sie sich angeberisch verkehrt herum aufgesetzt hatten.
Dorn war schon sechzehn, sagte man, angeblich hatte man ihn schon mit Mädchen gesehen. «Der rudert mit denen auf der Isebek und knutscht sie im Boot ab», hatte Schmitt einmal verlauten lassen. «Der ist durch und durch verdorben.»
Dorn hatte sich vor Rolf aufgepflanzt und ihn damit als Führer der Straßenbahndepot-Bande anerkannt. Er klimperte mit Münzen in der Hosentasche und grinste breit. Warum der wohl auf seine gräßlichen gelben Zähne so stolz ist, fragte sich Hannes. Um Dorn zu zeigen, wie gleichgültig er ihm war, zog Hannes seine Mundharmonika aus der Hosentasche und saugte nachdenklich an ihr herum.
«Wir brauchen euch hier nicht», motzte Schmitt. «Haut ab in die Hoheluftchaussee, da gehört ihr hin!»
«Jawoll, haut ab!» sagte auch Rolf Sandmann, während er sich auf sein Fahrrad schwang und die Gruppe in immer größeren Bogen umkreiste. Dann trat er trotzig in die Pedale und verließ laut pfeifend den Hof. Dorn sah ihm hämisch grinsend nach.
«Euer Anführer hat euch ja ganz schön schnell im Stich gelassen», sagte er. Dann fing er plötzlich an im Kasernenton zu brüllen: «So ’n Schlappschwanz! So ’ne Niete! So ’ne Judenschule! Ihr werdet alle gemeldet!»
«Wieso?» fragte Schmitt. «Haben doch gar nichts getan!»
«Doch gar nichts getan? Ihr Zwerge habt im Jungvolk wohl nichts gelernt!»
«Rolfies Vater ist Blockwart», meinte Werner Schemel treuherzig. «Der hat vor euch keine Angst.»
«Schnauze!» Dorn nahm seinen Kasernenton wieder auf. «Antreten!»
Die vier vom Straßenbahndepot versuchten, eine Reihe zu bilden.
«Steck das Ding weg, Hacker!»
Hannes verstaute seine Mundharmonika in der Hosentasche. Dorn musterte ihn aufmerksam.
«Wo war denn deine Schwester gestern abend?» wollte er wissen.
«Die is’ zu alt für dich», erwiderte Hannes frech.
«Schnauze!» blaffte Dorn. «Oder man wird euch mit ’m Krankenwagen wegfahren, ihr Shirley Temples, ihr! Was dich betrifft, bestell deiner Schwester mal ’nen schönen Gruß von mir, und wenn sie sich noch mal mit ihrem Kerl aus Altona sehen läßt, diesem Georg Koch, dann kriegt sie meine Grüße von mir höchstpersönlich unter die Nase gerieben, verstanden? Und Koch machen wir zu Appelmus! Alles klar?»
«Alles klar», versprach Hannes.
«Wetten, der weiß mehr, als er zugibt, der Schlaumeier», sagte Dorn und zeigte seine gelben Zähne. «Weißte schon, was Beischlaf bedeutet?»
Hannes nickte.
«Was denn?»
Hannes hörte Schmitt hinter seinem Rücken kichern.
«Das bedeutet, na ja, wenn sich Menschen, na ja, zusammentun …»
«Zusammentun?» fragte Dorn wiehernd. Dann fing er wieder an zu brüllen. «Die soll gefälligst nich’ ’nen dicken Bauch kriegen vor lauter ‹Zusammentun›. Verstanden, Hacker?»
Jetzt brachen sie alle in befreiendes Gelächter aus, die Straßenbahndepot-Jungen wie auch die Veteranen von der Hoheluftchaussee. Schemel gluckste vor Vergnügen. Dabei, dachte Hannes, wußte der noch weniger als er selbst über derartigen Schweinkram.
«Bestell ihr doch mal von mir – Erika heißt sie, nich’? –, daß wir über ihren roten Süßen Bescheid wissen.» Wieder fletschte er die Zähne. «Ihr Zwerge! Ihr Pißpötte! Gebt mal ’n deutschen Gruß!»
Verunsichert durch Rolfies Abwesenheit, sahen sich die vier fragend an.
«Wenn euch jemand von der HJ Befehle gibt, habt ihr sie auszuführen, und zwar schleunigst!»
Dorn schlug die Hacken zusammen, legte die linke Hand auf die Gürtelschnalle und erhob seinen rechten Arm.
«Heil Hitler!» brüllte er.
«Heil Hitler!» brüllten die vier Kleineren zurück.
«Lauter, ihr Dösbaddels, ihr!»
«Heil Hitler!»
«Die sollen euch in der Hoheluftchaussee hören!» schrie Dorn. Sein Rattengesicht war hochrot angelaufen. Seine Lippen hielt er fest zusammengepreßt.
«Heil Hitler!» brüllten die Eingeschüchterten.
«Euch wird man nie nach Nürnberg zum Parteitag schicken. Worauf ihr euch verlassen könnt.»
Der Straßenbahnschaffner «Hering in Tomatensoße» schleppte sich über den Hof zu seiner Straßenbahn.
«Büschen Disziplin kann den Bengels nich’ schaden», meinte er im Vorbeigehen. «Ab und zu.»
«Nächstesmal kriegt ihr eure Ärsche windelweich geklopft, ihr Flaschen», wütete Dorn. «Das kann ja gar nich’ wahr sein, was sich hier tut. Rührt euch! Wegtreten! Das kann ja gar nich’ wahr sein!»
Kopfschüttelnd wandte er sich um, gab ein lässiges Signal und verließ den Hof. Seine Trabanten folgten in gebührendem Abstand.
«Das wird mal ’n hohes Tier bei der HJ», flüsterte Schmitt bewundernd, «’n Rottenführer oder so was.»
«Sacht Rolfie auch», sagte Werner Schemel.
«Rolfie is’ ja schnell abgehauen, wie’s brenzlich wurde», wagte Jürgen Kloth einzuwenden.
«Ja, mecker du nur mal immer wieder an Rolfie rum», protestierte Werner. «Das wird gemeldet, was, Uwe? Von deinem ewigen Gemecker haben wir langsam die Nase voll, Kloth.»
So ein Kriecher, dachte Hannes, sagte aber: «Wann lernst du endlich, die Klappe zu halten, Kloth?»
«Ich hab doch nur …»
«Ja, du hast doch nur … Menschenskind!»
Während Hannes langsam über den Hof schlenderte, schob er einen dicken Kieselstein auf die nächste Straßenbahnschiene, ließ ihn in der Rille liegen. Dann trabte er weiter, blieb stehen, kam noch einmal zurück und hob den Stein wieder auf. Dabei schaute er verstohlen zu Uwe Schmitt hinüber. Der Junge, der nach Mäusen roch, hatte ihn – wie erwartet – bei seinem Sabotage-Versuch aufmerksam beobachtet.
2
Auf dem Heimweg ließ sich Hannes Zeit. Er trödelte mit seinem Ball im zugigen Torweg, der zum Hinterhof führte. Die grauen Wände waren mit Parolen und Kritzeleien beschmiert: «Deutschland erwache!»; die verbotenen drei Pfeile der Sozis; «Lore liebt Karl-Heinz».
Die Hackers wohnten im vierten Stock einer verfallenen Mietskaserne am Falkenried. Von dort konnte man den Hof des Straßenbahndepots nicht sehen. Das erleichterte für Hannes vieles. Werner Schemels Mutter lungerte da zum Beispiel manchmal herum, unter dem Vorwand in die Waschküche zu müssen oder einen Teppich im Nachbarhof auszuklopfen. In Wirklichkeit wollte sie ihren geplagten Werner beschützen.
Die Wohnung war klein und schummrig, aber sie roch wenigstens nicht nach abgestandenem Kohl wie die meisten, die Hannes kannte. Die Hackers hatten zwei Zimmer, ein Schlafzimmer für die Eltern und ein Wohnzimmer, tagsüber kaum benutzt, wo der Bücherschrank des Vaters stand und wo man die schmalen Betten von Hannes und seiner Schweser Erika aufklappen konnte. Erika war siebzehn und Stenotypistin. Sie beklagte sich oft über die Einteilung der Wohnung, aber in der Küche wollte sie auch nicht schlafen, denn dort fand das tägliche Leben statt.
Hannes konnte sich an frühere Wohnungen erinnern, aus denen sie ausziehen mußten, an helle Zimmer, hohe Decken und Parkettböden, morgens von der Sonne durchflutet, abends hell beleuchtet. Damals hatten beide Kinder eigene Schlafzimmer, und die Eltern verbrachten nicht Tag und Abend in der Küche. In der Erinnerung sah er Mama auf einer Chaiselongue ausgestreckt liegen; sie trug ein weißes Kleid ohne Taille mit langer Perlenkette, und ihr Haar war mit einer grünen Schleife gebunden. Ihre Hände waren weiß, sie trug Ringe und unterhielt sich angeregt mit Freunden, Leuten aus Papas Büro, denen sie dünne blaue Teetassen reichte.
Jetzt sah die Mutter ganz anders aus. Schlimm, wie sie zu einem Bestandteil dieser miefigen Mietskaserne geworden war – wie ein Tier, dachte Hannes, das die Farben der Umwelt annimmt, um sich zu tarnen. Sie hatte sich den Umständen anzupassen, das wußte Hannes nur zu gut. Aber was war aus ihr dabei geworden?
Weil sie äußerlich so heruntergekommen war, hegte Hannes den Wunsch, sie zu beschützen und zu trösten, sie zu verwandeln. Leider schien sie das nicht zu wollen. Vielleicht kam er auch deshalb nicht mehr zu ihr, wenn er Rat oder Trost brauchte. Aber das hatte noch einen anderen Grund: Wenn er etwas mit seiner Mutter besprechen wollte, hatte sie jetzt immer Dringliches im Haushalt zu tun, die Küche mußte gescheuert oder der Flur gebohnert werden, oder sie mußte sich unbedingt hinlegen, um die Wirkung ihrer Kopfschmerztabletten auszuschlafen. Zunächst dachte Hannes, daß man Mama zu viel abverlangte, aber wenn er ihr jetzt helfen wollte, schien sie das als aufdringlich zu empfinden. Dabei brauchte sie ihn doch!
Erika war tagsüber im Büro, die Abende verbrachte sie mit ihrem Freund Georg. Auch Papa konnte Mama nicht helfen. Wenn er nicht in Sandmanns Kneipe hockte, verkündete er, als wär’s ein Witz, wie ungeschickt er im häuslichen Bereich war. Freunden gegenüber prahlte er, daß er noch nie im Leben ein Ei gekocht hatte oder einen Teller abgewaschen, ohne daß es Scherben gab. Fühlte sich Papa geschmeichelt, weil Mama ihn einen «Bohemien» nannte? Hannes fiel bei diesem Wort nur die Oper La Bohème ein, die er mit seiner Oma gesehen hatte. Er konnte sich Papa gut in einer Dachkammer vorstellen, mit Samtjackett und Baskenmütze, oder in Övelgönner Terrassencafés, wo er Reden schwingen und Mädchen anhimmeln konnte. Früher, als er noch Redakteur beim Anzeiger war, hatte Hannes ihn manchmal mit einem eleganten Spazierstock herumfuchteln sehen. Und wenn die Familie sonntags mit dem Paddelboot auf der Isebek oder Außenalster unterwegs war, trug er sogar einen Strohhut, der gar nicht zu seinem buschigen roten Haar paßte und manchmal ins Wasser fiel.
Nun saß man beim Abendbrot, und Hannes sah Papa und Mama wie durch Omas Opernglas, als säßen sie alle ganz weit entfernt von ihm, Menschen auf einer Bühne. Mamas Veränderung hatte seit geraumer Zeit auch Papa angesteckt. Er hatte seinen schäbigen lila Bademantel um sich gewickelt und den frottierten Kragen hochgestellt, als trüge er einen eleganten Morgenrock. In Wirklichkeit wollte er seinen letzten Anzug schonen, den er brauchte, um nicht seine Stellung bei Tietz zu verlieren. Dort verkaufte er jetzt Handschuhe. Seine Schnurrbartspitzen, die er früher elegant nach oben zwirbelte, hingen nun schlaff herunter; ab und zu zupfte er mit den Fingerspitzen daran, als wollte er sich überzeugen, daß sie noch da waren.
Daß Papa noch schneller alterte als Mama, freute Hannes. Aber er brauchte sie nur genauer anzusehen, schon kam wieder Wut. Die stellte sich immer ein, wenn er glaubte, sich wegen seiner Mutter schämen zu müssen. Die Haut unter ihren Augen war schlaff, er entdeckte Mitesser neben den Nasenflügeln und in der Nähe der Haarwurzeln. Sie war vier Jahre älter als Papa. Das war nun mal Tatsache, und in Zukunft würde sich das immer deutlicher zeigen.
«In Lüneburg hat man einen Schneider wegen Rassenschande angezeigt», sagte Erika, ohne von ihrem Koralle-Heft aufzublicken. «Hat man gestern im Büro erzählt.»
An Erika war nichts auszusetzen. Kein Wunder, dachte Hannes, daß sich Dorn bei ihr ins Zeug legte. Weder am Falkenried noch am Lehmweg hatte Hannes jemals ein flotteres Mädchen gesehen. Sie hatte die unruhigen grünen Augen ihres Vaters, die ehemals feinen, vogelartigen Züge der Mutter. Mit ihrer Haut war alles in bester Ordnung; ihr kastanienbraunes Haar trug sie lang, so daß es beim Lesen über ihre Augen fiel.
Niemand reagierte auf Erikas Bemerkung. Mama wandte sich Hannes zu, wollte wissen, was er denn nachmittags angestellt hatte.
«Angestellt?» Er biß in sein Käsebrot. «Nichts. Weißte doch.»
«Was weiß ich?»
«Wo der sich tagsüber rumtreibt, weiß doch jeder.» Erikas Gesicht blieb hinter ihrer Koralle versteckt.
«Wo denn?» wollte Hannes wissen.
«Im Straßenbahndepot – mit Lümmeln wie Rolf Sandmann und Uwe Schmitt.»
«Wenigstens poussier ich nich’ die ganze Zeit rum.»
«Was soll denn das wieder heißen?»
Jetzt standen zwei senkrechte Furchen zwischen Erikas Augenbrauen. Hannes verglich Menschen gerne mit Tieren. Seine Schwester sah wie ein Teddybär aus, wenn sie sich ärgerte, was sie oft tat.
«Was man über dich im Straßenbahndepot erzählt, das mach ich gar nich’ sagen», erwiderte er.
«Jetzt ist aber genug, Junge», fuhr Papa dazwischen und steckte einen Zigarettenstummel in seine Elfenbeinspitze, eine Trophäe aus seiner Blütezeit als Feuilletonredakteur.
Warum er wohl ihn und Erika nie mehr bei ihren Vornamen nannte, fragte sich Hannes. Ihn nannte er immer nur «Junge», Erika «mein Fräulein». Vielleicht tat er es, um nicht ständig daran erinnert zu werden, daß er in dieser schwierigen Zeit Verantwortung für eine siebzehnjährige Tochter und einen zwölfjährigen Sohn zu tragen hatte. Als die Kinder noch klein gewesen waren und man keine pekuniären Probleme gehabt hatte, wie Papa es nannte, ging das alles noch. Da konnte er sie abwechselnd auf seinen Schoß setzen und mit seinem im Anzeiger gedruckten Namen angeben. Jetzt, so glaubte Hannes zu wissen, waren ihm die «Kinder» nur noch lästig.
«Einfach nicht zu fassen», zischte Papa plötzlich und warf seine Zeitung hin. «Dieser Dreikäsehoch! Das kann doch nicht wahr sein. Hat mir früher jeden Morgen Kaffee gebracht! Schlechten Kaffee! Dieser Trottel macht sich jetzt im Feuilleton breit! Hat mich ernsthaft mal gefragt: Sagen Sie mal, Herr Dr. Hacker, von wem ist eigentlich Wilhelm Tell? Von Schiller oder von Goethe? Und ich hab nur geschmunzelt …»
«… und Rossini gesagt», unterbrach ihn sein Sohn.
Hannes kaute weiter und bückte sich nach der heruntergefallenen Sportseite.
«Natürlich», fuhr der Vater fort, als hätte er die Bemerkung nicht gehört. «Mit der Karriere geht’s steil bergauf, wenn man sich als Parteigenosse wichtig machen kann. Früher haben wir ihn gehänselt und ‹Fips› genannt, weil er so ’n Zwerg ist. Jetzt rächt er sich! Nicht zu fassen!»
«Rache ist Blutwurst, und Leberwurst ist Zeuge», brummte Hannes mit vollem Mund, während er die letzten Sportresultate aus Berlin suchte. Es sah schlecht aus. Deutschland gewann wieder mal alles.
«Den Quatsch, den sie jetzt drucken, hätten sie auch von mir kriegen können. Unter einem Pseudonym wäre ich schon bereit …» fing der Vater wieder an.
«Es nützt doch nichts, dich immer wieder drüber aufzu …» meinte die Mutter.
«Ich reg mich auf, wenn’s mir paßt. Oder will man mir das etwa auch verbieten?»
Papa stand ostentativ auf, aber die Geste wurde kaum wahrgenommen.
«Ich soll dir übrigens was von Dorn bestellen», sagte Hannes zu seiner Schwester.
«Mir?» fragte Erika. «Ich kenn keinen Dorn.»
«Der sagt, die wissen über euch Bescheid. Über dich und Georg.»
«Die? Welche die?»
«Keine Ahnung.»
«Sagt mal, könnt ihr dem Bengel nicht mal verbieten, sich da unten mit solchen Halbstarken rumzutreiben?» beschwerte Erika sich.
«Wo soll er denn sonst spielen?» fragte die Mutter.
«Von wegen spielen», sagte Erika. Sie wandte sich wieder an Hannes. «Du gehörst da überhaupt nich’ hin. Merk dir das.»
«Die kochen auch nur mit Wasser», meinte der Vater, aus dem Fenster blickend. «Der Junge muß sich ja irgendwie arrangieren. Ewig kann der faule Zauber ja nicht dauern. Drei Jahre haben die mit Ach und Krach geschafft. Ich geb der Bande noch zwei. Höchstens! Dann haben die Nazis ihr Pulver verschossen.»
Hannes versuchte, sich auf die Sportseite zu konzentrieren. In der Tabelle der Olympiamedaillen standen die USA und Deutschland jetzt punktgleich.
«Daß er überhaupt im Jungvolk ist», regte Erika sich auf, «das ist doch nur peinlich. Skandalös ist das.»
«Ach, so schlimm find ich das gar nicht», hörte er Papa sagen. «Pfadfinder, Wandervögel, Jungvolk, wie das Zeugs auch immer heißen mag – ist doch alles dasselbe in Grün. Besser, als daß er sich dauernd auf der Straße rumtreibt.»
Jetzt quatschen die, als wär ich gar nicht mehr dabei, dachte Hannes.
«Auch wenn der Junge eine jüdische Mutter hat?» fragte Erika. «Das werden wir noch mal bitter bereuen.»
«Mir jagen Dorn und sein Haufen von der Hoheluftchaussee keine Angst ein», sagte Hannes.
«Sei lieber vorsichtig, Hannes.» Mama hatte seinen Arm leicht berührt. Hannes kam nicht umhin, sich über ihre geschwollenen, geröteten Finger zu ärgern. «Denk immer erst nach, bevor du denen was sagst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie raffiniert die sind. Daß du nie eine Silbe rausläßt von dem, was du hier zu hören bekommst! Und komm nie jemandem zu nahe. In unserer Lage können wir’s uns nicht leisten aufzufallen.»
«Nanananana», hörte er seinen Vater. Der blies gerade einen perfekten Rauchring in die Luft und beobachtete konzentriert, wie er sich in der stickigen Küchenluft auflöste. «Nicht immer gleich in eine Angstpsychose verfallen. Der Junge geht doch in eine höhere Schule! Die beste in Eppendorf! Tut er das, oder tut er das nicht? Was mich betrifft, ich kann denen jederzeit meinen Stammbaum zeigen. Ich war im Weltkrieg Frontsoldat! Meine Vorfahren haben unterm Alten Fritz gekämpft. So was imponiert denen doch! Sind doch alle miese Kleinbürger …»
«Versuch nur nicht, Typen wie diesen Dorn mit deinen Maßstäben zu messen, Papa», sagte Erika. «Dich konnten die PGs vom Anzeiger auch nicht schnell genug loswerden.»
Ludwig Hacker nagte an seiner Unterlippe.
«Du verstehst nicht immer alle – äh – Zusammenhänge, mein Fräulein. Was weißt du schon von dem Labyrinth der Eifersuchten in einer großen Zeitung? Für viele Leute beim Anzeiger war ich einfach zu – zu anspruchsvoll! Daß der neue Chef sich dran erinnerte, daß deine Großmutter mütterlicherseits Rosenteich heißt, war doch nur ein Vorwand. Meine Entlassung ist übrigens nach wie vor juristisch anfechtbar …» Er wedelte mit seiner Zigarettenspitze. «Nur abwarten! Die werden mich noch mal anflehen. Auf Knien werden die mich bitten wiederzukommen. Kriechen werden die, wenn ihnen erst einmal klar wird, welch lächerlichen Nieten sie ihr Feuilleton anvertraut haben.»
Jetzt geht das schon wieder los, dachte Hannes. Aber sein Vater hatte es sich anders überlegt; er stellte das Radio an. Schlagermelodien erklangen. «Regentropfen, die an dein Fenster klopfen …» brummelte Hannes vor sich hin.
Der Vater suchte nach anderen Sendern. Aus dem Knistern und Knattern drangen allmählich die Klänge der Internationale heraus.
«Moskau!» verkündete Ludwig Hacker mit einer diskreten Verbeugung und drehte lauter.
Die Melodie hat was echt Feierliches, dachte Hannes.
«Um Gottes willen, nicht so laut», flehte Mama. «Die Rohdes von nebenan …»
«Was soll der Quatsch?» fauchte seine Tochter ihn an. «Den Kommunisten glaubst du ja auch kein Wort.»
«Tu ich auch nicht.»
Erika sprang wütend auf. Bevor Papa es verhindern konnte, hatte sie den Stecker des Radios herausgerissen.
«Sei gefälligst in eigener Sache mutig», warf sie ihrem Vater vor.
Hannes erschrak; gleich würde Papa ihr eine langen. So gingen Familienauseinandersetzungen meistens zu Ende. Doch dieses Mal wagte sich Erika noch etwas weiter vor:
«Ist dir denn immer noch nicht klar, Papa, daß es hier von Spitzeln wimmelt? Für ein Freibier bei Sandmann würden die ihre eigene Mutter denunzieren. Was du eigentlich wissen solltest. Bist ja oft genug da unten.»
Papa gab Erika keine Ohrfeige. Er drehte sich schlicht um, legte seinen Bademantel ab, bürstete sein Jackett mit großer Sorgfalt, bevor er es anzog. Dann, mit gespielter Gelassenheit, verließ er die Küche. Kaum war die Wohnungstür hinter ihm zugefallen, beschwerte sich Mama:
«Wie kannst du dich deinem Vater gegenüber so benehmen, Erika? Wie, glaubst du, fühle ich mich dabei?»
«Ach, der hat doch nur ’nen guten Abgang gesucht, um unten einen zu heben.» Erika hatte sich wieder beruhigt. «Der muß es nicht ausbaden, wenn uns jemand anzeigt. Mehr wollte ich nicht sagen.»
Mühsam stand Mama auf, stützte ihre Hände auf den Küchentisch. Mensch, dachte er, wie ’ne Olle sieht die wieder aus, und wußte nicht, warum ihn das so wütend machte.
Als Erika kurz vor Mitternacht nach Hause kam, lag Hannes noch hellwach im Bett.
«Wo warst du denn wieder?» fragte er im Flüsterton.
«Du solltest längst schlafen.»
«Warst du mit Georg zusammen?»
«Ja.»
«Wo wart ihr?»
«Geht dich nichts an.»
«Was macht ihr eigentlich, wenn ihr zusammen seid?»
Sie antwortete nicht. Er hörte, wie sie sich am anderen Ende des kleinen Zimmers auszog und in ihr Nachthemd schlüpfte. Dann zog sie die Schublade auf und zog ihre Steppdecke heraus.
«Papa ist stinksauer auf dich.»
«Nicht meine Schuld.»
«Papa hat mal so viele Freunde und Bekannte gehabt. Jetzt wollen die alle nix mehr von ihm wissen. Is’ eigentlich gemein.»
«Auf solche Freunde und Bekannte pfeif ich.»
«Jedenfalls brüllt er nich’ nur rum, wie’s manche Väter tun, das mußt du zugeben. Und das mit Georg und dir läßt er ja auch zu.»
Er hörte, wie sie barfuß über das Linoleum huschte, ins Bett kroch und die Steppdecke bis ans Kinn hinaufzog.
«Knutschst du mit Georg rum?» wollte er wissen.
«Geht dich ’n Dreck an. Denk an was Schönes und schlaf gefälligst ein.»
Ihr Bett knarrte, als sie sich umdrehte. Dann hörte er sie gleichmäßig atmen, als wäre sie schon eingeschlafen. Das bedeutete, er sollte endlich mit der Fragerei aufhören. Er dachte an die geheimnisvollen Doppelsilhouetten, die man oft abends im Torweg sah, so weit wie möglich vom Licht der Laterne entfernt …
«Erika?»
«Was is’ denn –»
«Wart ihr im Kino?»
«Ja.»
«Alte oder Neue Blumenburg?»
«Herrgott noch mal – ich muß früh zur Arbeit. Ich krieg keine Schulferien.»
«Was wurde gezeigt?»
«Königin Christine. Greta Garbo.»
«Liebestragödie?»
«Mehr historisch.»
«War auch ’n Beiprogramm? Dick und Doof, Mickymaus, Eulen im deutschen Wald und so?»
«Ach so, nee, nur ’ne Wochenschau.»
«War Olympiade dabei? Jesse Owens?»
«Nee.»
Unten auf der Straße hörte er zwei Betrunkene grölen:
Mein Sohn der fährt zur See –
Mit ’m Kinderwagen
auf der Elbchaussee.
Er dachte an die Sportseite. Deutschland hatte Ungarn doch wahrhaftig 23:0 geschlagen! Im Handball. Da war sicher Schummelei im Spiel. Den Organisatoren in Berlin konnte man alles zutrauen. Hoffentlich hatte Rolf Sandmann das Resultat nicht mitgekriegt. Der würde nie aufhören zu jubeln. Hannes schloß die Augen. Weiß der Teufel, warum er heute nicht einschlafen konnte.
«Erika … was Georg betrifft … ich wollte mal … macht der wirklich Geheimkram?»
Er hörte sie aufseufzen.
«Frag lieber nicht.»
«Ich finde, ich müßte auch so was tun.»
«Das ist nichts für Kinder.»
«Versammelt ihr euch irgendwo, im Keller oder so?»
«Quatsch.» Plötzlich war sie ganz wach. «Paß mal auf. Dieser HJ-Lümmel, was hat der wirklich über Georg gesagt?»
«Dorn? Ach, das ist doch alles bloß Angabe, von wegen daß sie Bescheid wissen.»
«Wen meint er denn mit ‹sie›?»
«Keine Ahnung. Die von der Hoheluftchaussee wohl.»
«Weißt du wirklich nicht mehr?»
«Nee. Wirklich nicht. An deiner Stelle würde ich mich nich’ drum kümmern, Erika. Dieser Dorn, der will auch nur mal bei dir ran.»
«Jetzt hör aber mal auf. Wo hörst du solche Schweinereien?»
Er kicherte schuldbewußt.
«Mit Dorn würde ich mich an deiner Stelle allerdings nich’ einlassen. Der hat grüne Zähne und ’nen verdammt schlechten Ruf, was Mädchen betrifft.»
Sie gab ein gereiztes Grunzen von sich.
«Bist kaum besser als die anderen Bengel, mit denen du dich da unten rumtreibst. Morgen bist du vielleicht auch mit dabei, wenn die wieder mal ’nem jüdischen Geschäft die Fenster einschlagen.»
Er drehte sich zur Wand um und streckte sich. Jetzt war sie ihm böse. Dabei hatte er doch gar nichts gesagt! Ich hoffe, wir verlieren alles bei der Olympiade, dachte er und wickelte sich in seine Steppdecke. Ich hoffe, von jetzt ab gewinnen nur noch Neger. Dann ärgert sich Hitler wieder.
Über der Isestraße, zwischen Eppendorfer Baum und Hoheluftbrücke, rollte eine späte Hochbahn. Er dachte an das Haus in der Haynstraße, wo seine Oma wohnte. Von ihrer Wohnung aus konnte man die schwarz-gelben Wagen der Hochbahn nicht nur hören, sondern auch sehen. Weit weg, weit weg war das …, dabei war es um die Ecke …
Dann schlief er ein.
3
«Wir befassen uns hier», erklärte Herr Waldmeister der Quinta B im langsamen Diktierton, «mit dem unabänderlichen Naturgesetz der Rassenhierarchie. Auf dem Gipfel: wir, die deutschen und skandinavischen Rassen, die Erben Siegfrieds. Je tiefer wir jedoch herabsteigen, desto minderwertiger wird die Zucht, die uns begegnet, bis wir uns ganz unten, im primären Schlamm befinden …»
«Wie bidde?» piepste eine hohe Stimme.
«Primären Schlamm», wiederholte Herr Waldmeister geduldig, während die Federn seiner Schüler über die Seiten der Hefte kratzten. «P – r – i – m – ä – r.»
Er räusperte sich und fuhr fort: «… im primären Schlamm befinden, wo sich der Abschaum der Menschheit wälzt-Juden, Neger, Zigeuner-wie auch immer …»
Hannes schrieb und dachte an Jesse Owens und seinen 10,3-Sekunden-Rekord im 100-m-Lauf. Sonnenschein strömte durch die hohen Fenster des Klassenzimmers und bildete helle Lichtbalken, in denen der Staub tanzte. Hannes saß neben einem pausbackigen Jungen namens Hauff, der heimlich kleine Kugeln aus den Resten seines Brötchens rollte.
Professor Waldmeister blickte auf seine Armbanduhr, seine Oberlippe zitterte. Voller Vorfreude glänzten seine Augen hinter dicken, randlosen Brillengläsern.
«Bevor ich fortfahre, hätte ich mich doch lieber versichert, daß ich mit meinen Erläuterungen niemandem zu nahe trete. Es melden sich alle Zigeuner, Juden und Neger der Quinta B.»
Erst einmal mußte das Gelächter verstummen. Herr Waldmeister verließ sich gerne auf eine Mischung von Rassentheorie, Latrinenwitz und aktuellem Allerlei, die ihm zugleich Beliebtheit und Disziplin verschaffte und inzwischen so gut ankam, daß seine Methode von älteren Lehrern nachgeahmt wurde. Jetzt, als sich kein Arm erhob, spielte der Professor den Erstaunten.
«Nun gut. Dann brauchen wir ja auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Hat sich vielleicht einer der Herren mit dem gestrigen Leitartikel im Fremdenblatt befaßt?»
Ohne eine Antwort abzuwarten, begann Herr Waldmeister die neuen Enteignungsverordnungen zu kommentieren.
«Natürlich sind nicht alle Juden wohlhabend», stellte er fest. «Es gibt auch bettelarme, die sich nur im Schmutz und Gestank ihrer Ghettos wohl fühlen. Dort geht’s bekanntlich noch wie im Mittelalter zu. Die Abneigung dieser Herrschaften gegen Wasser und Seife ermöglicht uns, ihre Anwesenheit auch am gegenüberliegenden Alsterufer wahrzunehmen.»
Den Schülern war nicht klar, wohl auch egal, an welchem Alsterufer diese Pesthöhle angesiedelt war, aber das so erzeugte Lokalkolorit brachte das erwartete dankbare Gelächter der Quintaner.
«Eins dürfen wir allerdings nicht vergessen. Reich oder arm, Juden sind in unserem Vaterland nur zu Gast, und Hausgästen gestattet man bekanntlich nicht, die silbernen Bestecke wegzuschleppen – oder? Oder, Hacker?»
Herr Waldmeister zeigte einen gesunden Instinkt für schwindende Aufmerksamkeit in seiner Klasse.
«Nein, Herr Waldmeister», sagte Hannes und stand auf.
«Nein, Herr Waldmeister», äffte ihn der Lehrer nach. «Nein, was?»
«Man gestattet Hausgästen nicht, die silbernen Bestecke wegzuschleppen.»
«Was fasziniert dich eigentlich so da draußen am Hegestieg? Oder beschäftigen dich die Wolkenformationen?»
Hannes wurde rot, als er sich das erneute Gelächter seiner Mitschüler gefallen lassen mußte.
«’n bißchen schlafmützig in letzter Zeit, Hacker, nicht?» fragte der Lehrer, wobei seine Brillengläser gefährlich aufblitzten. «Gehst vielleicht ’n bißchen zu oft in die Oper, nicht? In die Oper mit der Oma. Setz dich.»
Wie betäubt fiel Hannes auf seine Bank zurück. Noch hallte die Waldmeisterstimme in seinem Ohr; sie dröhnte immer weiter; die Gestalt am Fenster wurde zum verschwommenen Schatten. Nachdenken. Konzentrieren. Nichts anmerken lassen. Daß diese Schießbudenfigur («Pfingstochse» hätte ihn Oma genannt) ausgerechnet ihm nahelegte, die Bemerkung über das weggeschleppte Silber zu wiederholen, war schlimm genug, aber erklärbar. Aber der gezielte Hinweis, was die Oper und Oma betraf, grenzte ans Unheimliche.
Er war sicher gewesen, in der Oper in der Dammtorstraße nie Freunden vom Falkenried zu begegnen. An einen Lehrer hatte er jedoch nicht gedacht. Nun waren Oma und er doch ertappt worden. Verzweifelt suchte er nach einer harmlosen Erklärung für die gefährlichen Anspielungen des Lehrers. Hannes’ Blick konzentrierte sich auf sein Schreibpult, auf die tiefen, mit blauer Tinte nachgezogenen Rillen und Kratzer und das Federhalterfach, auf dem sein Nachbar Hauff die Brotkügelchen in Reih und Glied geordnet hatte. Seine Panik wuchs. Es gab keine harmlose Erklärung! Herr Waldmeister hatte ihn in der Oper belauert; er wollte ihn wissen lassen: Man hatte sein Geheimnis aufgedeckt! Vielleicht hatte Herr Waldmeister inzwischen Erkundigungen eingezogen …
Der Vorhang hob sich – eine grauenhafte Szene war im Gange, ein Alptraum: Herr Waldmeister verhörte ihn, um den Rest der Klasse zu amüsieren.
Mit wem warst du denn in der Oper, Hacker? Mit meiner Oma, Herr Waldmeister. (Gelächter.) Mit wem? Mit meiner Oma. Und wie heißt deine Oma? Wie sie heißt, Herr Waldmeister? Ja, wir sind so gespannt auf den Namen deiner Großmutter, Hacker! Den Namen, Herr Professor? Ja, den Namen deiner Großmutter, verdammt noch mal! … Rosa Rosenteich, Herr Waldmeister. (Gelächter.) Wie bitte? Gib das doch noch mal zum besten, Hacker! Rosa Rosenteich, Herr Waldmeister. Wie bitte? Wir haben den Namen immer noch nicht ganz mitgekriegt. Rosa Rosenteich, Herr Waldmeister. Rosa Rosenteich. Rosa Rosenteich …
Während der Name – Verbrechen und Geständnis zugleich – durch sein Bewußtsein hallte, mußte er an das Gespräch denken, das er vor seinem Eintritt mit Dr. Gilbrecht, dem Direktor der Oberrealschule Eppendorf, geführt hatte. Der Mann hatte ein grüblerisches, vertrocknetes Gesicht; sein schütteres Haar war mit äußerster Sorgfalt über die fleckige Kopfhaut gekämmt. Er saß hinter einem übergroßen Schreibtisch in einem Zimmer mit getäfelten Wänden; unablässig rieb er seine Fingerspitzen gegeneinander. Obwohl sein wässeriger Blick auf Hannes gerichtet war, schien er mit seinen Gedanken woanders zu sein. Seine trockene, brüchige Stimme konnte sich nur schwer gegen das Stimmengewirr von draußen behaupten. Das Gebrüll und Gejohle im Schulhof drang durch die geöffnete Fensterklappe.
«Dem Brief deines Vaters entnehme ich, daß er Verständnis für meine Schwierigkeiten zeigen möchte. Er hat dir sicherlich erzählt, daß wir uns kennen. Der Anzeiger und die Schule haben bei gewissen musikalischen Anlässen zusammen …» Seine Stimme verlor sich, er mußte neu anfangen: «Tatsache ist, dein Vater ist – äh – Arier, und die bestandene Prüfung, die du im Wilhelmgymnasium …»Er holte nochmals aus. «Zweifelsohne hast du dich damit für die höhere Schule qualifiziert, nur …»
Er beugte sich über den Schreibtisch, preßte die Lippen zusammen, zuckte mit den Augenlidern – oder sollte das vielleicht ein Zuzwinkern sein?
«Wir sind doch ein strammer deutscher Junge. Das sollten wir uns merken und stolz darauf sein. Stimmt doch, oder?»