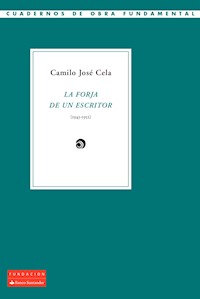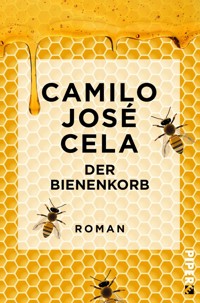
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Roman entfaltet Literaturnobelpreisträger Camilo José Cela das Panoptikum des Allzumenschlichen - die Liebe, die Eifersucht, der Ehebruch vor dem Hintergrund des Franco Regimes. Der Bienenkorb - das ist Madrid im Zweiten Weltkrieg, das ist das Cafe der Dona Rosa. Spiegel eines durch den Bürgerkrieg entwurzelten Kleinbürgertums und Drehpunkt vieler Lebensgeschichten. Von hier führen die Fäden in die Hinterhöfe, Parkanlagen und Absteigen Madrids, zu den Szenen von Liebe, Ehebruch und Eifersucht. So wird dieser beste Roman des Nobelpreisträgers zu einem eindrucksvollen Panoptikum aus dem Alltag einer faschistischen Gesellschaft. Der nach diesem Roman gedrehte Film von Mario Camus gewann 1983 den »Goldenen Bären« bei der Berlinale.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Spanischen von Gerda Theile-Bruhns
ISBN 978-3-492-98398-3
© für diese Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2018
© 1951 Camilo José Cela
© Heirs of Camilo José Cela, 2002
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »La Colmena « bei Editorial Noguer, S.A. Barcelona 1963
Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 1988/1998
Covergestaltung: zeromedia.net
Covermotiv: FinePic, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
1 – Man darf nie den Überblick …
2 – »Los, weg!« »Adieu und vielen …
3 – Mittags nach dem Essen geht …
4 – Der Schutzmann Julio García Morrazo …
5 – So gegen halb neun Uhr …
6 – Am Morgen. Noch halb im …
Schluß
1
Man darf nie den Überblick verlieren. Das hab’ ich schon immer gesagt. Es ist das Wichtigste.
Doña Rosa quetscht ihr enormes Hinterteil an den Gästen des Cafés vorbei. Doña Rosa sagt häufig: »Labberzeug« und »es hängt einem zum Hals heraus!«
Ihr Café und seine nächste Umgebung ist Doña Rosas Welt. Manche behaupten, wenn es Frühling werde und die jungen Mädchen die ersten Kleider ohne Ärmel tragen, dann käme ein gewisser Glanz in Doña Rosas Schweinsäuglein. Ich glaube, das ist alles nur Geschwätz. Doña Rosa wird niemals einen guten silbernen Amadeustaler aus der Hand lassen, um nichts in der Welt. Auch für den Frühling nicht! Immer wieder ihr beachtliches Gewicht zwischen den Tischen hindurchzuschieben, nur das macht Doña Rosa wirklich Spaß!
Wenn sie allein ist, raucht sie sehr starken Tabak, und sie trinkt Ojén-Schnaps, das Glas ordentlich voll geschenkt, gleich nach dem Aufstehen und bis zum späten Abend. Dann hustet sie und lacht. Bei guter Laune hockt sie sich in die Küche auf einen Schemel und liest Schundromane, je blutrünstiger, desto besser: Das ist nahrhaft! Später scherzt sie mit den Gästen und erzählt ihnen von dem Verbrechen in der Calle de Bordadores oder von dem Mord im Schnellzug nach Andalusien.
Der Vater von Navarrete war ein Freund vom General Don Miguel Primo de Rivera. Er ging zu ihm, warf sich vor ihm auf die Knie und bat: »Herr General, begnadigen Sie doch meinen Sohn, um Gottes willen.«
Und Don Miguel, der eigentlich ein Herz von Gold hatte, antwortete: »Es ist mir nicht möglich, Freund Navarrete. Ihr Sohn muß seine Sünden am Galgen büßen…«
»Was sind das alles für Kerls«, denkt Doña Rosa, »da muß man schon hartgesotten sein!«
Doña Rosa hat das Gesicht voller Flecken. Wie eine Eidechse, die sich häutet, sieht sie aus. Wenn sie denkt, zieht sie sich zerstreut Hautfetzen vom Gesicht, manchmal so lange wie Luftschlangen. Dann kehrt sie in die Wirklichkeit zurück, spaziert wieder im Café auf und ab und lächelt den Gästen mit ihren schmutzigen schwärzlichen Zähnen zu. Im Grunde haßt sie ihre Kundschaft.
Don Leonardo Meléndez schuldet dem Schuhputzer Segundo Segura sechstausend Duros[1].
Der Schuhputzer ist ein Schafskopf, eine rachitische, steife Schindmähre. Seit unzähligen Jahren spart er und borgt dann Don Leonardo alle seine Ersparnisse. Recht geschieht ihm! Don Leonardo ist ein Hochstapler, der immer auf Pump lebt und Geschäfte plant, die nie zustande kommen. Nicht etwa, daß sie schiefgehen, sie laufen ganz einfach nicht, weder gut noch schlecht. Don Leonardo trägt farbenprächtige Schlipse und schmiert sich Pomade ins Haar, eine sehr stark parfümierte Pomade, die man schon von weitem riecht. Er gibt sich wie ein vornehmer Herr mit dem Auftreten eines ungeheuer erfolgreichen Mannes. Mir kommt’s allerdings so vor, als sei es mit seinem Erfolg nicht allzu weit her. Aber er tut so wie einer, dem es nie an Kleingeld in der Tasche fehlt. Seine Gläubiger behandelt er mit Fußtritten. Und seine Gläubiger lächeln dazu und bewundern ihn. Jedenfalls tun sie so. Es gibt auch welche, die daran gedacht haben, ihn vor Gericht zu bringen. Aber bisher hat noch keiner das Feuer eröffnet. Don Leonardo liebt es, französische Wörter zu benutzen, wie zum Beispiel »madame«, »rue« und »cravatte«, und außerdem sagt er sehr häufig: »Wir, die Meléndez«. Don Leonardo ist ein gebildeter Mann, der gern zu verstehen gibt, was er alles weiß. Im Café spielt er ein paar Partien Dame und trinkt nie etwas anderes als Milchkaffee. Wenn sich am Nebentisch jemand Zigaretten aus blondem Tabak dreht, sagt er sehr höflich: »Würden Sie vielleicht so freundlich sein, mir ein Zigarettenpapier zu geben? Ich möchte mir gern eine Zigarette aus schwarzem Tabak drehen, hab’ aber zufälligerweise kein Papier mehr.«
Dann sagt der andere meistens: »Sparen Sie sich doch die Mühe, darf ich Ihnen eine bereits Gedrehte anbieten…« Don Leonardo scheint unschlüssig und zögert ein paar Sekunden mit der Antwort: »Na ja, zur Abwechslung könnten wir mal Blonde rauchen. Ich mag die Sorte nicht sehr, wissen Sie.«
Manchmal sagt der am Nebentisch nur: »Nein, ich hab’ leider kein Zigarettenpapier. Bedaure, Ihnen nicht dienen zu können!«
Und dann kann Don Leonardo nicht rauchen.
Die Gäste stützen die Ellbogen auf den alten, den verkrusteten Marmor der einfüßigen Tischchen und sehen die Wirtin vorübergehen, fast ohne sie zu bemerken. Währenddessen denken sie flüchtig über diese Welt nach, die leider nicht so ist, wie sie sein könnte, diese Welt, in der langsam eigentlich alles schiefgeht, ohne daß man sich erklären kann, warum. Vielleicht nur wegen einer unbedeutenden Kleinigkeit. Die meisten der marmornen Tischplatten sind alte Grabsteine vom Friedhof. An einigen sind noch die Inschriften erhalten. Und ein Blinder kann sie lesen, wenn er mit den Fingerspitzen unter dem Tisch entlangfährt: »Hier ruht die sterbliche Hülle von Fräulein Esperanza Redondo, dahingegangen in der Blüte ihrer Jugend.« Oder auch: »R.I.P. Seine Exzellenz Don Ramiro López Puente, Unterstaatssekretär im Wirtschaftsministerium.«
Die Kaffeehausbesucher sind Leute, die der Ansicht sind, alles nehme sowieso seinen Lauf, und es lohne sich nicht, irgend etwas ändern zu wollen. In Doña Rosas Café rauchen alle Gäste, und die meisten sinnieren für sich allein über die armseligen, die angenehmen, die geliebten Dinge nach, die ihr Leben ausfüllen oder auch nicht. Es gibt Leute, die geben ihrem Schweigen das verträumte Gehabe vager Gedankengänge. Es gibt andere, die sich mit abwesendem Gesichtsausdruck in Erinnerungen ergehen. Ihre Gesichter zeigen den Ausdruck erniedrigter Tiere, des zärtlichen, demütig bittenden, müde gewordenen Tieres. Die Hand an der Stirn, den Blick voller Bitterkeit, wie ein Meer bei Ebbe.
Es gibt Nachmittage, an denen die Unterhaltung von Tisch zu Tisch erstirbt. Keine Gespräche über werfende Katzen, über Lebensmittelrationen, über jenes tote Kind, an das einer der Gäste sich absolut nicht mehr erinnern kann… Das tote Kind – wissen Sie’s denn wirklich nicht mehr? – hatte blonde Haare, war besonders reizend und ziemlich mager, hatte immer einen beigen Pullover an und mochte fünf Jahre alt gewesen sein… An solchen Tagen schlägt das Herz des Kaffeehauses wie das eines Kranken. Es schlägt nicht regelmäßig. Die Luft erscheint verdichtet, scheint grauer. Und doch fährt manchmal ein lauer Luftzug durch den Raum, von dem man nicht weiß, woher er kommt. Ein Hauch voller Hoffnung, der einige Augenblicke lang jede Seele öffnet.
Don Jaime Arce macht sich trotz allem immer noch wichtig, obwohl man ihm einen geplatzten Wechsel nach dem andern vorlegt. Wenn’s auch nicht so scheint, so weiß man doch alles im Café. Don Jaime hatte eine Bank um Kredit gebeten. Er wurde ihm gewährt, und Don Jaime unterschrieb ein paar Wechsel. Dann kam es, wie es kommen mußte. Er ließ sich in Geschäfte ein, bei denen er betrogen wurde. Ihm blieb kein Pfennig. Man präsentierte ihm die Wechsel, und er sagte, er könne nicht zahlen. Don Jaime ist ganz sicher ein ehrlicher Mensch, nur hat er eben kein Glück, keine glückliche Hand bei Geldgeschäften. Ein ausgesprochener Liebhaber von Arbeit ist er allerdings auch nicht. Aber er hat wirklich kein Glück. Andere, die ebensolche Müßiggänger sind wie er oder sogar noch ärgere, ergattern durch glückliche Zufälle einige tausend Duros, können ihre Wechsel zahlen und stolzieren nun umher, rauchen teuren Tabak und fahren den lieben, langen Tag im Taxi umher. Don Jaime ist es nicht so ergangen, ganz im Gegenteil. Er sucht nun nach einem Wink des Schicksals, findet ihn aber nicht. Er hätte sich in jede Arbeit gestürzt, in die erste beste. Aber es bot sich gar nichts an, was der Mühe wert gewesen wäre. Und so verbrachte er seine Tage im Kaffeehaus, den Kopf an die samtene Rückenlehne des Sofas gebettet, und betrachtete die goldenen Verzierungen der Zimmerdecke. Manchmal summte er leise vor sich hin, irgendein Stückchen einer Zarzuela, während er mit den Füßen den Takt dazuwippte. Don Jaime dachte meistens nicht an sein Mißgeschick. Er pflegte überhaupt wenig zu denken. Er sah in den Spiegel und wunderte sich: »Wer mag wohl den Spiegel erfunden haben?« Dann starrte er irgendeinen Menschen lange, beinah unverschämt an: »Ob diese Frau wohl Kinder hat? Oder ist sie eine alte Jungfer? Wie viele Tuberkulosekranke sind wohl jetzt hier im Café?«
Don Jaime drehte sich eine ganz dünne Zigarette, ein Strohhälmchen von Zigarette, und zündete sie an.
»Es gibt Leute, die sind wahre Künstler im Bleistiftanspitzen, sie bringen eine Spitze wie eine Nadel zustande, und die bricht nicht einmal ab und wird nicht stumpf.«
Don Jaime wechselt seine Stellung, ein Bein war ihm eingeschlafen.
»Wie wunderbar ist doch das: Bum – bum – bum… und immer so weiter, das ganze Leben lang, Tag und Nacht, Winter und Sommer: das Herz.«
Eine schweigsame Frau setzte sich gewöhnlich ganz nach hinten neben die Treppe, die zu den Billardtischen hinaufführt. Vor kaum einem Monat war ihr Sohn gestorben. Der junge Mann hieß Paco und hatte die Laufbahn eines Postbeamten eingeschlagen. Zuerst meinte man, er habe einen Gehirnschlag, dann stellte sich aber eine Meningitis heraus. Es ging schnell; gleich anfangs verlor er das Bewußtsein. Und er hatte doch schon alle Ortschaften der Provinzen León, Altkastilien, Neukastilien, Teile von Valencia (Castellón und mehr oder weniger die Hälfte von Alicante) auswendig gelernt. Es war wirklich ein Jammer, daß er sterben mußte. Seit er als Kind einmal im Winter tüchtig naß geworden war, neigte Paco leicht zu Erkältungskrankheiten. Seine Mutter war nun allein zurückgeblieben. Der andere Sohn, der ältere, vagabundierte irgendwo in der Welt umher, niemand wußte recht, wo.
Nachmittags kam sie also ins Kaffeehaus von Doña Rosa, setzte sich an einen Tisch bei der Treppe, und dort blieb sie all die Stunden hindurch, in denen nicht soviel Betrieb herrscht, und wärmte sich auf. Seit dem Tod des Sohnes war Doña Rosa sehr liebevoll zu ihr. Es gibt Menschen, denen es gut tut, zu Trauernden nett zu sein, sie geben ihnen bei jeder Gelegenheit Ratschläge und ermahnen sie zur Demut und zur Seelenstärke. Das tut ihnen irgendwie gut. Doña Rosa sagte Pacos Mutter zum Trost, es sei doch besser, Gott habe ihn zu sich genommen, als daß er vielleicht schwachsinnig geworden wäre. Die Mutter blickte Doña Rosa mit verständnisvollem Lächeln an und antwortete, ja, sie habe vollkommen recht.
Pacos Mutter heißt Isabel, Doña Isabel Montes verwitwete Sanz. Sie ist eine leidlich gut aussehende Dame aus besserem Hause, mit einem leicht abgeschabten Mantel. Im Café achtet man im allgemeinen ihre Zurückhaltung. Nur ab und an bleibt irgend jemand an ihrem Tisch stehen, meistens eine Frau, die aus der Toilette kommt. Auf die Frage: »Wie geht’s, ist die Stimmung etwas besser?« lächelt Doña Isabel, antwortet jedoch selten. Ist sie einmal etwas munterer, so hebt sie den Kopf, blickt die Bekannte an und sagt: »Sie sehen ja blendend aus. Frau Soundso.«
Meistens jedoch sagt sie gar nichts. Eine Handbewegung zum Abschied und Schluß.
Doña Isabel weiß, daß sie aus besseren Kreisen stammt als die andern, sich jedenfalls von ihnen unterscheidet.
Ein nicht mehr junges Fräulein ruft nach dem Zigarettenverkäufer: »Padilla!«
»Ich komme gleich, Señorita Elvira!«
»Eine Triton-Zigarette!«
Die Frau wühlt in ihrer Handtasche, die vollgestopft ist mit rührseligen, anstößigen alten Briefen. Sie legt fünfunddreißig Centimos auf den Tisch.
»Dankeschön.«
»Keine Ursache.«
Sie zündet die Zigarette an und stößt mit abwesendem Blick eine lange Rauchwolke aus. Nach einer Weile ruft das Fräulein wieder: »Padilla!«
»Gleich, Señorita Elvira!«
»Hast du dem bewußten Herrn den Brief gegeben?«
»Jawohl, Señorita.«
»Was hat er gesagt?«
»Nichts. Er war nicht zu Hause. Das Dienstmädchen hat mir gesagt, ich brauche mich nicht weiter drum zu kümmern. Sie werde ihm den Brief bestimmt abgeben, wenn er zum Abendessen heimkomme.«
Señorita Elvira schweigt und raucht weiter. Sie fühlt sich nicht wohl, fühlt sich fiebrig, und alles dreht sich ihr vor den Augen. Señorita Elvira führt ein Hundeleben, ein Leben, das genaugenommen nicht lebenswert ist. Es ist wahr, sie arbeitet nicht. Aber da sie nicht arbeitet, hat sie auch nichts zu essen. Sie liest Romane, geht ins Kaffeehaus, raucht ein paar Triton-Zigaretten und wartet auf das, was ihr zufällt. Dumm ist nur, daß das, was ihr zufällt, sehr dürftig ist. Fast immer sind es mehrmals aussortierte Abfälle, kaum mehr zu gebrauchen.
Don José Rodríguez de Madrid gewann bei der letzten Ziehung. Seine Freunde sagten zu ihm: »Hast du aber Schwein gehabt.« Don José antwortet immer das gleiche. Er hat den Satz wohl auswendig gelernt.
»Na ja, acht lumpige, dreckige Duros!«
»Mensch, du brauchst dich gar nicht herauszureden. Wir wollen ja gar nichts abhaben!«
Don José ist Schreiber beim Gericht, und er scheint einiges gespart zu haben. Man munkelt, er habe eine reiche Frau geheiratet, ein Mädchen aus der Mancha, das bald starb und ihm alles hinterließ. Don José hatte nichts Eiligeres zu tun, als die vier Weinberge und die zwei Olivenhaine, die er geerbt hatte, zu verkaufen. Er behauptete, die Landluft sei nicht gut für die Lungen, und das Wichtigste sei immer noch, auf die Gesundheit zu achten.
Im Café von Doña Rosa trinkt Don José stets sein Gläschen. Er ist kein Geck und auch kein armer Teufel von der Sorte, die sich an Milchkaffee halten muß. Die Wirtin begegnet ihm mit einiger Sympathie wegen der gemeinsamen Vorliebe für den Ojén-Schnaps. »Ojén ist das beste von der Welt. Er tut dem Magen gut, ist harntreibend und kräftigend. Er reinigt das Blut und vertreibt das Gespenst der Impotenz.«
Don José drückt sich sehr gewählt aus.
Einmal, vor ein paar Jahren, kurz nach Ende des Bürgerkrieges, hatte er einen Wortwechsel mit dem Geiger. Fast alle Anwesenden beteuerten, der Geiger sei im Recht. Don José jedoch rief nach der Besitzerin und sagte: »Wenn Sie den da nicht mit Fußtritten hinausjagen, diesen unverschämten Kommunisten, so betrete ich Ihr Lokal nicht mehr!«
Doña Rosa setzte den Geiger daraufhin vor die Tür, und man hörte nie mehr etwas von ihm. Die Gäste, die zuerst auf der Seite des Violinisten gestanden hatten, änderten ihre Meinung. Schließlich sagte jedermann, Doña Rosa habe recht getan, und es sei dringend nötig gewesen, mit harter Hand durchzugreifen und zu zeigen, wer Herr im Haus war.
»Jeder kann sich ausmalen, wohin wir kommen mit solchen dreisten Lümmeln!«
Die Leute schauten ernst und gleichmütig drein und sagten das etwas geniert. An den Tischen kommentierte man: »Wenn es keine Disziplin mehr gibt, dann wird auch nichts Gutes mehr geschaffen, nichts, was irgendwelchen Wert hat!«
Ein Mann, der schon in die Jahre gekommen ist, erzählt schreiend von dem Spaß, den er sich vor beinah einem halben Jahrhundert mit Madame Pimentón erlaubt hatte.
»Die Blöde, da hat sie doch geglaubt, sie könne es mit mir versuchen. Das hat sie sich so gedacht! Ich lud sie zu ein paar Gläschen Weißwein ein, und beim Hinausgehen stieß sie sich an der Tür das Gesicht kaputt. Haha. Sie blutete wie ein geschlachtetes Kalb. Sie sagte nur: oh, lala, oh, lala! Und ging ab und hustete sich die Seele aus dem Leib, das Unglückswurm! Sie war immer betrunken. Es war zum Totlachen!«
Einige Köpfe von den Nachbartischen drehen sich ihm zu und betrachten ihn beinah mit Neid. Es sind die Gesichter der Leute, die glücklich vor sich hin lächeln, wenn sie, ohne es zu merken, es schaffen, an überhaupt nichts zu denken. Die Menschen sind Schmeichler aus Dummheit und lächeln manchmal, obwohl sie im Grunde ihrer Seele einen ungeheuren Ekel empfinden, einen Abscheu, den sie kaum unterdrücken können.
Aus Schmeichelei kann man zum Mörder werden; sicherlich ist mehr als einer nur zum Verbrecher geworden, um anzugeben, um jemandem zu gefallen.
»So muß man das Bettelvolk behandeln! Wir Anständigen müssen aufpassen, daß sie uns nicht über den Kopf wachsen. Mein Vater sagte immer: Willst du Trauben, so grapsch’ sie dir selbst! – Haha, diese Hure ist nie wieder aufgekreuzt!«
Zwischen den Tischen schleicht eine Katze umher, dick und mit glänzendem Fell. Eine Katze, die vor Gesundheit und Wohlleben strotzt, eine selbstzufriedene, eingebildete Katze. Sie gerät einer Frau zwischen die Beine. Die Frau schrickt zusammen.
»Teufelsbiest, scher dich weg!«
Der Mann, der eben die Geschichte erzählt hat, lächelt süßlich: »Aber meine Dame, die arme Katze! Was hat sie Ihnen denn getan?«
Ein Jüngling mit Künstlermähne schmiedet Verse inmitten all des Lärms. Er ist entrückt und merkt nichts von dem, was um ihn herum vor sich geht. Das ist die einzig mögliche Art, schöne Gedichte zu machen. Wenn er rechts und links gucken würde, dann würde ihm die Inspiration entfliehen. Die Inspiration ist wohl so etwas wie ein blinder und tauber Schmetterling, der aber herrliche Farben hat. Wenn’s nicht so wäre, könnte man vieles nicht erklären.
Der junge Dichter ist dabei, ein langes Gedicht zu verfassen. Er hat es Schicksal benannt. Er war nicht sicher, ob er es nicht besser Das Schicksal betiteln sollte. Aber schließlich, nachdem er mit mehreren Poeten, die größere Erfahrung besaßen, darüber diskutiert hatte, kam er zu dem Schluß, es sei besser, ganz einfach Schicksal als Titel zu nehmen. Das war kürzer, eindringlicher und geheimnisvoller. Außerdem, wenn man einfach »Schicksal« sagte, war es suggestiver und – wie soll man sagen – unbestimmter, poetischer. So konnte man nicht mit Bestimmtheit sagen, ob »das Schicksal« gemeint war oder »ein Schicksal«, ob »ungewisses Schicksal«, »verhängnisvolles Schicksal«, »glückliches Schicksal«, »blaues Schicksal« oder vielleicht gar»veilchenblaues Schicksal«. Das Schicksal war verpflichtender, ließ weniger Spielraum für die Phantasie, die keine Schranken, keine Fesseln duldet.
Der junge Poet arbeitete schon mehrere Monate an seinem Gedicht. Er hatte bereits dreihundert und einige Verse fertig und einen sorgfältig gezeichneten Entwurf für den späteren Druck, eine Liste der möglichen Subskribenten, denen er zu gegebener Zeit ein Formular zuschicken würde, das sie nur auszufüllen hätten. Er hatte auch schon die Drucktypen ausgesucht; eine einfache, klare, klassische Type, eine Type, die man in aller Ruhe lesen kann. Sagen wir eine Bodoni. Er hatte bereits die beabsichtigte Auflagenhöhe festgelegt. Zwei Dinge jedoch beunruhigten den jungen Dichter noch: Ob er das Laus Deo am Ende des Kolophons setzen sollte oder gar nicht. Und zweitens: ob er selbst die biographische Notiz für den Klappentext schreiben sollte.
Doña Rosa war ganz sicherlich nicht das, was man eine »empfindsame Seele« nennt.
»Ich hab’ das ja schon hundertmal gesagt: Was Gauner betrifft, hab’ ich genug an meinem Schwager. Schmeißfliege Sie! Sie sind ja immer noch nicht trocken hinter den Ohren! Kapiert! Haben Sie jemals gesehen, daß ein Mann ohne Kultur und Herkunft so umherstolziert ist, wie Sie hier herumhusten. Sie treten auf wie ein feiner Herr? Ich schwöre Ihnen, das werde ich mir nicht länger ansehen!«
Die Schweißtropfen hingen Doña Rosa im Schnurrbart und perlten auf der Stirn.
»Bist du nun zur Salzsäule erstarrt? Kannst nicht mal die Zeitung holen! Hier hat niemand mehr Respekt, niemand Anstand! Soweit ist’s gekommen! Ich würde euch alle zusammenstauchen, wenn ich erst mal anfinge! Hat man so was schon erlebt?«
Doña Rosa stiert mit ihren Rattenäuglein auf Pepe, den alten Kellner, der vor vierzig oder fünfundvierzig Jahren aus Mondoñedo kam. Hinter den dicken Brillengläsern gleichen die kleinen Augen Doña Rosas den starren Augen eines ausgestopften Vogels.
»Was glotzt du so, Dummkopf! Du bist noch genauso blöd wie am Tag, wo du ankamst! Für Leute wie euch gibt es keinen Gott, der euch die Stecknadel im Heuhaufen suchen würde! Los, machen wir endlich Schluß! Dann ist wohl Friede! Wenn du ein richtiger Mann wärst, hätte ich dich längst an die Luft gesetzt, kapiert? Es hängt einem alles zum Hals heraus!«
Doña Rosa klopft sich auf den Bauch und redet ihn wieder mit Sie an. »Los, los. Wie man sich bettet, so liegt man. Sie wissen ja selbst, man darf den Überblick nicht verlieren. Zum Teufel, auch den Respekt nicht! Verstehen Sie, auch den Respekt nicht!«
Doña Rosa reckte den Kopf und atmete tief. Die Härchen ihres Schnurrbarts sträubten sich herausfordernd, anmutig und würdevoll, wie die Fühler einer verliebten, selbstbewußten Grille.
Eine drückende Last scheint die Luft zu beschweren und legt sich auf die Herzen. Die Herzen schmerzen nicht. Sie können Stunde um Stunde leiden, ein ganzes Leben lang, ohne daß nur irgendeiner mit Sicherheit feststellen kann, was eigentlich los ist.
Ein Herr mit weißem Bärtchen hat einen dunkelhäutigen Knaben auf dem Schoß und steckt ihm Stückchen von Schweizer Milchbrötchen, in Milchkaffee getaucht, in den Mund. Der Herr heißt Don Trinidad García Sobrino und ist Geldverleiher.
Don Trinidad hatte eine sehr bewegte Jugend, voller Verwicklungen und Schicksalsschläge. Als aber dann sein Vater starb, sagte sich Don Trinidad: Von jetzt ab mußt du dich in acht nehmen, sonst wirst du ausgeschmiert, Trinidad! – Und er widmete sich den Geschäften, gewöhnte sich an Ordnung und wurde reich. Der Traum seines Lebens war immer gewesen, Abgeordneter zu werden. Er dachte sich, es sei nicht schlecht, einer von fünfhundert Abgeordneten unter fünfundzwanzig Millionen Menschen zu sein. Mehrere Jahre lang hatte Don Trinidad einigen drittrangigen Persönlichkeiten aus der Partei von Gil Robles schöngetan, hatte gehofft, daß sie ihn zum Abgeordneten machten. Ihm war es ganz gleich, bei welcher Partei. Er bevorzugte keine politische Richtung. Einiges Geld gab er für Einladungen aus, etwas für die Propaganda, und er hörte sich viele große Worte an. Aber schließlich und endlich schlug keine Seite seine Kandidatur vor, und man nahm ihn nicht einmal mit zu der offiziellen Einladung beim Parteichef. Don Trinidad machte schwere Augenblicke durch, ernste Seelenkrisen. Zum Schluß wurde er Anhänger von Lerroux. In der radikalen Partei schien es ihm recht gutzugehen. Aber dann kam der Krieg und mit ihm das Ende seiner wenig glorreichen und nicht sehr dauerhaften politischen Karriere. Jetzt lebte Don Trinidad fern vom »politischen Zeugs«, wie sich an jenem denkwürdigen Tage Don Alejandro ausgedrückt hatte. Don Trinidad begnügte sich nun damit, froh zu sein, wenn man ihn in Frieden dahinleben ließ und ihn nicht mehr an vergangene Zeiten erinnerte. Er widmete sich weiterhin dem einträglichen Geschäft des Verleihens von Geld gegen Zinsen.
Gegen Abend pflegte er mit seinem kleinen Enkel in Doña Rosas Café zu gehen, gab dem Kleinen dort seine Vesper und blieb selbst ganz schweigsam, hörte der Musik zu, las Zeitungen und kümmerte sich um niemanden.
Doña Rosa lehnt sich über einen Tisch und lächelt. »Was gibt’s Neues, Elvirita?«
»Ach Señora Rosa, sehr wenig!«
Señorita Elvira zieht an ihrer Zigarette und schüttelt leicht den Kopf. Sie hat verblühte Wangen und rote Lider, als seien ihre Augen sehr empfindlich.
»Ist’s in Ordnung gekommen?«
»Was?«
»Das von…«
»Nein. Das ist schiefgegangen. Er war drei Tage mit mir zusammen, und dann schenkte er mir eine Flasche Haarfestiger!«
Señorita Elvira lächelt. Doña Rosa blickt kummervoll in die Runde: »Es gibt eben gewissenlose Menschen, mein Kind.«
»Pah, was macht’s schon aus!«
Doña Rosa beugt sich weiter vor und flüstert ihr beinah ins Ohr: »Warum bringen Sie nicht das mit Don Pablo wieder ins reine?«
»Weil ich nicht will. Unsereiner hat auch seinen Stolz, Doña Rosa.«
»Es hängt einem alles zum Hals heraus! Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Aber was ich Ihnen raten würde, Elvirita, und Sie wissen ja, daß ich nur Ihr Bestes will: Mit Don Pablo ist es Ihnen schließlich doch am besten gegangen?«
»Nicht so sehr! Er ist ein anspruchsvoller Kerl. Und außerdem sabbelt er so. Zum Schluß war er mir richtig eklig. Was wollen Sie? Es ist mir manchmal richtig schlecht geworden!«
Doña Rosa wechselt in ihre süße Stimme, die überredende Stimme der guten Ratschläge: »Man muß mehr Geduld haben, Elvirita. Sie sind immer noch wie ein kleines Mädchen!«
»Meinen Sie?«
Señorita Elvira spuckt unter den Tisch und trocknet sich den Mund mit der Innenseite ihres Handschuhs.
Ein reich gewordener Drucker namens Vega, Don Mario de la Vega, raucht eine ungeheuer dicke Zigarre, die wie eine Reklamezigarre aussieht. Jemand am Nebentisch versucht sich anzubiedern.
»Eine feine Zigarre rauchen Sie da, lieber Freund.«
Vega antwortet würdevoll und ohne ihn anzublicken: »Sie ist nicht schlecht, allerdings! Hat mich auch einen Duro gekostet!«
Der vom Nebentisch, ein rachitischer, ewig lächelnder Mensch, hätte ihm am liebsten gesagt: »Wer’s so gut hätte wie Sie!«, aber wagte es dann doch nicht; zum Glück bremste ihn sein Schamgefühl noch rechtzeitig. Er blickte den Drucker an, lächelte wieder ergeben und sagte: »Nicht mehr als fünf Peseten? Man würde denken, die Zigarre habe mindestens sieben Peseten gekostet!«
»Nein, wahrhaftig nicht! Fünf Peseten und dreißig Centimos Trinkgeld. Damit gebe ich mich schon zufrieden!«
»Das glaube ich!«
»Mensch, man braucht kein Millionär wie Romanones zu sein, um diese Zigarren zu rauchen!«
»Nein, ein Romanones vielleicht nicht. Aber sehen Sie, ich kann mir das nicht leisten, und ebenso geht es den meisten, die hier im Café sind!«
»Möchten Sie vielleicht eine rauchen?«
»Mensch…«
Vega lächelt, als schäme er sich für das, was er jetzt sagen will: »Na also, dann arbeiten Sie so, wie ich arbeiten muß!«
Der Drucker brach in ein ungeheures, ungestümes Gelächter aus.
Der rachitische, ewig lächelnde Mann am Nebentisch hörte auf zu lächeln. Er wurde ganz rot und spürte, wie ihm eine Hitzewelle bis zu den Ohren stieg und die Augen ihm anfingen zu stechen. Er fühlte, wie das ganze Café ihn anstarrte und senkte den Blick, um die Leute nicht zu sehen; zumindest meinte er, daß ihn das ganze Café anstarrte.
Don Pablo ist ein gräßlicher Mensch, der alles von der verkehrten Seite betrachtet. Während er das von der Madame Pimentón erzählt, läßt Señorita Elvira ihren Zigarettenstummel fallen und tritt ihn aus. Señorita Elvira benimmt sich manchmal wie eine echte Prinzessin.
»Was hat Ihnen denn das Kätzchen getan? Muschi, Muschi, komm, komm…«
Don Pablo schaut die Frau an.
»Wie klug Katzen doch sind! Findiger als Menschen. Es sind Tierchen, die alles verstehen… Muschi, Muschi, komm, komm mal her…«
Die Katze entfernt sich, ohne den Kopf zu drehen, und verschwindet in der Küche.
»Ich hab’ einen Freund, ein Mann mit viel Geld und Einfluß. Sie brauchen nicht zu glauben, er sei irgend so ein Habenichts. Dieser Mann hat eine Angorakatze, die auf den Namen Sultan hört. Sie ist ein wahres Wunder…«
»So?«
»Ja wirklich! Sagt man: Sultan, komm her, so kommt die Katze und bewegt ihren herrlichen Schweif, der wie ein Staubwedel aussieht. Sagt man: Sultan, geh weg, läuft Sultan fort wieein vornehmer Herr. Die Katze hat einen herrlichen Gang und ein Fell wie Seide. Ich glaube kaum, daß es viele derartige Katzen gibt. Diese ist unter den Katzen etwas ähnliches wie unter den Menschen der Herzog von Alba. Mein Freund liebt das Tier wie sein eigenes Kind. Natürlich ist es auch eine Katze, die sich überall beliebt zu machen versteht.«
Don Pablo sieht sich im Café um; einen Augenblick kreuzt sich sein Blick mit dem von Señorita Elvira. Don Pablo runzelt die Stirn und dreht den Kopf weg.
»Und wie zärtlich so eine Katze ist! Haben Sie je gemerkt, wie zärtlich diese Tiere sind? Wenn sie jemanden gern mögen, so bleibt das fürs ganze Leben.«
Don Pablo räuspert sich und verleiht seiner Stimme Ernst und Würde: »Daran könnten sich viele Menschen ein Beispiel nehmen!«
»Allerdings!«
Don Pablo seufzt tief auf. Er ist zufrieden mit sich. Wirklich, der Satz mit dem Beispielnehmen ist ihm vorzüglich gelungen!
Pepe, der Kellner, kehrt wortlos in seinen Winkel zurück. Als er wieder in seinem Reich ist, legt er die Hand auf die Lehne eines Stuhls und betrachtet sich in den Spiegeln, als ob er etwas sehr Eigenartiges, Seltsames dort sähe. In dem Spiegel, der ihm am nächsten ist, sieht er sich von vorne. Von hinten in dem, der sich im Hintergrund befindet, und im Profil in den Spiegeln, die in den Ecken angebracht sind.
»Dieses Hexenweib! Es wird ihr bald passieren, daß man sie vierteilt, alte Sau, Füchsin!«
Pepe ist ein Mann, bei dem der Zorn rasch verraucht. Es genügt ihm, halblaut ein Sätzchen zu sagen, das ihm nie mit lauter Stimme über die Lippen gekommen wäre.
»Wucherin, Sauvieh! Mögest du doch bald am Hungertuch nagen!«
Pepe liebt es, sich kurz und bündig auszudrücken, wenn er schlechter Laune ist. Dann kommt er allmählich wieder auf andere Gedanken, und schließlich vergißt er die ganze Sache.
Zwei Knaben von vier oder fünf Jahren spielen zwischen den Tischen Eisenbahn, gelangweilt und ohne rechte Lust. Wenn sie nach hinten in den Raum laufen, ist einer die Lokomotive und der andere der Waggon. Wenn sie umdrehen, auf die Tür zu, wechseln sie. Niemand kümmert sich um sie, und sie fahren in ihrem Spiel fort, völlig unerschütterlich und ohne Begeisterung laufen sie schrecklich ernst hin und her. Es sind zwei pedantische, konsequente Kinder, die Eisenbahn spielen, obgleich sie sich tödlich langweilen. Sie haben sich nun einmal vorgenommen, sich zu vergnügen. Und um sich die Zeit zu vertreiben, haben sie sich vorgenommen, komme was wolle, den ganzen Nachmittag Eisenbahn zu spielen. Wenn’s ihnen nicht gelingt, sich dabei zu unterhalten, welche Schuld trifft sie? Sie geben sich jedenfalls die größte Mühe.
Pepe sieht ihnen zu und sagt: »Ihr werdet stürzen!«
Obwohl Pepe schon ein halbes Jahrhundert in Kastilien lebt, spricht er ein aus dem Galicischen übersetztes Kastilisch.
Die Kinder antworten ihm: »Nein, Señor!« und spielen weiter Eisenbahn, ohne jeglichen Glauben an ihr Spiel, ohne Hoffnung und ohne Mitleid, so als erfüllten sie eine schwere Pflicht.
Doña Rosa geht in die Küche.
»Wieviel Gramm Schokolade hast du genommen, Gabriel?«
»Sechzig, Señora!«
»Was? Unerhört! Da sieht man’s! Das ist nicht mehr zum Aushalten! Und dann von Grundlöhnen reden und die Heilige Jungfrau beschwören! Hab’ ich dir nicht klar und deutlich gesagt, du sollst nicht mehr als fünfundvierzig nehmen? Mit euch kann man wohl nicht mehr spanisch sprechen. Ihr hört nicht einmal zu!«
Doña Rosa atmet tief, sie nimmt ihre Pflicht ernst. Sie schnauft wie eine Maschine, die keucht, weil sie viel zu schnell läuft. Ihr ganzer Körper zittert, und aus der Brust entringt sich ihr ein pfeifendes Geräusch.
»Und wenn er Don Pablo zu dünn ist, soll er mit seiner Alten hingehen, wo er Besseren kriegt! Das fehlt ja gerade noch! Hatman je so etwas gesehen? Was diese jämmerlichen Stockfische offenbar nicht wissen: wir haben Gott sei Dank mehr als genug Kunden. Hast du’s kapiert? Wem’s hier nicht gefällt, der kann gehen. Wir sind immer noch im Vorteil. Als wären sie vielleicht Könige! Seine Frau ist eine falsche Schlange, von der ich die Nase voll habe. Mehr als genug hab’ ich von dieser Doña Pura!«
Gabriel warnt sie wie jeden Tag: »Man wird Sie hören, Señora!«
»Sollen sie mich ruhig hören, wenn sie wollen! Deshalb red’ ich ja! Ich hab’ nichts zu verbergen! Ich verstehe überhaupt nicht, wie dieser Schafskopf es wagen konnte, die Elvirita abzuschieben. Die ist ein Engel und hat nur dafür gelebt, ihm Freude zu machen. Wie ein Lamm erträgt sie die Schwindeleien dieser Doña Pura, der alten Giftschlange, die sich dann ins Fäustchen lacht. Na ja, meine selige Mutter sagte immer: Leb, um dich umzuschauen!«
Gabriel versucht, das Malheur wieder gutzumachen.
»Soll ich wieder was rausnehmen?«
»Du mußt selbst wissen, was ein anständiger Mann zu tun hat! Ein Mann, der seine fünf Sinne beieinander hat und kein Dieb ist! Wenn du nur willst, so weißt du ganz genau, was dir am besten nutzt!«
Padilla, der Zigarettenverkäufer, spricht mit einem neuen Gast, der ihm ein ganzes Paket Tabak abgekauft hat.
»Ist die immer so?«
»Ja, immer. Aber sie meint es nicht bös. Sie hat ein ziemlich heftiges Temperament, aber letztlich ist sie nicht weiter bös.«
»Aber sie hat den Kellner einen Dummkopf genannt!«
»Ach je, das macht doch nichts! Manchmal nennt sie uns Schwule und Kommunisten.«
Der neue Gast kann’s nicht glauben, was er hört: »Und das lassen sie sich alle gefallen?«
»Ja, mein Herr. Wir bleiben ruhig.«
Der Gast zuckt die Achseln.
»Bitte, wie Sie wollen…«
Der Zigarettenverkäufer macht wieder seine Runde durchs Lokal.
Der Gast bleibt gedankenversunken zurück.
»Ich weiß nicht, wer verachtungswürdiger ist: diese schmierige, jämmerlich aussehende Seekuh oder diese Schar dummer Affen! Wenn die sie einmal angriffen und ihr eine Tracht Prügel verpaßten, käme die Frau vielleicht zur Vernunft. Aber – pah – die wagen’s ja nicht! Innerlich schimpfen sie auf die Wirtin alle Tage. Aber nach außen hin… das haben wir ja vernommen. ›Dummkopf, mach Platz! Widerlicher Spitzbube!‹ Und sie sind entzückt. ›Ja, mein Herr, wir bleiben ruhig.‹Das glaub’ ich! Verdammt, diese Leute! So ist’s recht…!«
Der Gast raucht weiter. Er heißt Mauricio Segovia und ist bei der Telephongesellschaft angestellt. Ich erzähle das, weil es sein kann, daß der Mann später wieder auftaucht. Er ist achtunddreißig oder vierzig Jahre alt, hat rotes Haar und das Gesicht voller Pickel. Er wohnt ziemlich weit weg vom Kaffeehaus, in Atocha. Ganz zufällig ist er in dieses Stadtviertel geraten. Er war hinter einem Mädchen her; aber ehe Mauricio sich entschlossen hatte, sie nicht anzusprechen, war sie um eine Ecke in der ersten Haustür verschwunden.
Segundo, der Schuhputzer, schreit durchs Lokal: »Señor Suárez, Señor Suárez!«
Señor Suárez ist auch kein Stammgast. Er steht von seinem Platz auf und geht ans Telephon. Er hinkt, aber nicht wegen eines Fußleidens, sondern aus der Hüfte heraus. Er trägt einen modischen Anzug aus hellem Stoff und einen Kneifer. Er sieht aus, als sei er in den Fünfzigern und vielleicht Zahnarzt oder Friseur. Wenn man ihn länger beobachtet, könnte ihn mancher auch für einen Vertreter für chemische Produkte halten. Señor Suárez hat ganz das Gebaren eines sehr beschäftigten Mannes, wie einer von denen, die gleichzeitig sagen: »Herr Ober! Einen Espresso; den Schuhputzer; ein Taxi!« Wenn diese überbeschäftigten Herren zum Friseur gehen, lassen sie sich gleichzeitig rasieren, die Haare schneiden, die Nägel maniküren, die Schuheputzen und lesen dabei noch die Zeitung. Und manchmal, wenn sie sich von einem Freund verabschieden, teilen sie ihm mit: »Um die und die Zeit bin ich im Café, dann sehe ich eben mal ins Büro rein. Gegen Abend muß ich kurz zu meinem Schwager. Die Telephonnummern stehen alle im Buch. Jetzt muß ich fort. Hab’ noch eine Unmenge von Kleinigkeiten zu erledigen.« Solchen Männern merkt man sofort an, daß sie Herren, daß sie Auserwählte der Menschheit sind, gewohnt zu befehlen.
Herr Suárez spricht mit leiser Stimme ins Telephon, spricht mit einer hohen, einer dümmlichen Stimme, ein wenig affektiert.
Sein Jackett ist ihm etwas zu kurz und die Hosen sind etwas zu eng, wie bei einem Torero.
»Bist du’s?«
»Du bist aber frech! Du bist ein Schlingel!«
»Ja, ja… wie du willst!«
»Verstanden! Gut, sei unbesorgt, ich werde da sein.«
»Adieu, Liebling!«
»Hihi, was du nicht sagst! Wiedersehn, Süßer, ich hol’ dich gleich ab!«
Señor Suárez kehrt zu seinem Tisch zurück. Er lächelt. Jetzt ist sein Hinken irgendwie zittrig, hüpfend. Er hinkt jetzt beinah lüstern, kokett, leichtsinnig. Er zahlt seinen Kaffee, verlangt nach einem Taxi. Und als es kommt, steht er auf und geht. Er trägt den Kopf hoch wie ein römischer Gladiator. Er geht strotzend vor Zufriedenheit, strahlend vor Glück davon.
Jemand folgt ihm mit den Augen, bis die Drehtür ihn verschluckt.
Ohne Zweifel gibt es Menschen, die mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als andere. Man erkennt diese Sorte sofort. Sie tragen so etwas wie ein Sternchen auf der Stirn.
Die Wirtin macht eine halbe Drehung und geht zur Theke. Die vernickelte Kaffeemaschine sprudelt ohne Unterlaß Espresso in die Tassen, während die Registrierkasse, die altmodisch kupfern ist, andauernd klingelt.
Ein paar Kellner mit schlaffen Gesichtszügen, traurig und gelb, in übernächtigte Smokings gezwängt, stehen wartend herum, die Kante ihres Tabletts auf den Marmor gestützt, bis der Kassierer ihnen die bestellten Sachen und die goldenen oder silbernen Münzen des Wechselgelds aushändigt. Der Kassierer hängt den Hörer auf und verteilt, was bestellt wurde.
»Natürlich! Da wird wieder herumgequatscht! Als ob sonst nichts zu tun wäre!«
»Ich habe mehr Milch bestellen müssen, Señora.«
»So, mehr Milch! Wieviel Liter hat man heute früh gebracht?«
»Wie immer, Señora, sechzig.«
»Und das war nicht genug?«
»Nein. Es scheint nicht zu reichen.«
»Mein Sohn, wir sind doch schließlich keine Entbindungsstation! Wieviel hast du nachbestellt?«
»Zwanzig!«
»Bleibt da nicht zuviel übrig?«
»Glaub’s nicht!«
»Was heißt; glaub’s nicht? Schöne Schweinerei! Es hängt einem alles zum Hals heraus! Und wenn was übrigbleibt, was dann?«
»Nein, nein, da bleibt nichts übrig. Jedenfalls glaube ich das nicht.«
»Natürlich: glaube ich! Immer das gleiche! Glaube ich… das ist sehr einfach! Und wenn doch was übrigbleibt?«
»Nein. Sie werden schon sehen, es bleibt bestimmt nichts übrig. Schauen Sie doch selbst, wie voll das Café ist.«
»Klar, wie voll das Café ist! Das kann man leicht so sagen! Das ist, weil ich eine ehrliche Haut bin und immer was Gutes biete. Sonst könntest du sehen, wie sie alle wegbleiben. Schäbig sind sie ja doch allesamt!«
Die Kellner blicken zu Boden und versuchen, nicht aufzufallen.
»Und ihr da? Los, los, sputet euch! Da sind viel zuviel einzelne Kaffees auf den Tabletts. Wissen denn die Leute nicht, daß es Milchbrötchen gibt, Marzipanküchlein und Biskuits? Nein? – Klar, ich kann mir’s denken! Ihr seid wahrhaftig in der Lage, nichts davon zu sagen! Ihr wünscht euch ja bloß, daß ich in den Ruin getrieben werde und auf der Straße Lose verkaufen muß… Aber da seid ihr schief gewickelt! Ich weiß genau, was hier gespielt wird! Mit wem ich am gleichen Strang ziehe! …Das fehlte gerade noch! Los, los, bewegt die Beine und betet zur Heiligen Jungfrau, daß mir nicht der Zorn zu Kopf steigt.«
Wie von einem plötzlichen Regenguß verscheucht, marschieren die Kellner mit den vollen Tabletts von der Theke. Keiner von ihnen blickt Doña Rosa an; keiner verschwendet auch nur einen Gedanken an sie.
Die Männer stützen – wie wir schon erfahren haben – die Ellbogen auf die Tischplatte. Einer von ihnen birgt die bleiche Stirn in die Handflächen. Sein Blick ist traurig und bitter, sorgenvoll und zerquält sein Ausdruck. Er spricht mit dem Kellner. Er versucht, besonders süß zu lächeln, gleich einem verlassenen Kind, das in einem Haus am Weg um Wasser bittet. Der Kellner macht mit dem Kopf Zeichen zum Büfettier hin.
Luis, der Büfettier, tritt an die Wirtin heran.
»Señora, Pepe sagt, der Herr dort will nicht zahlen!«
»Na, dann soll Pepe sehen, wie er’s schafft, dem die Kröten aus der Tasche zu ziehen! Das ist seine Sache! Sag ihm, wenn er das Geld nicht bekommt, muß er’s aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Soweit sind wir schon gekommen!«
Die Wirtin setzt sich die Brille zurecht und sieht sich um.
»Welcher ist’s denn?«
»Der dort mit der Stahlbrille.«
»Puh, was für ein Typ! Das ist ja großartig! Und mit dem Gesicht! Hör mal, aufgrund welcher mathematischen Regel will der denn nicht zahlen?«
»Nun, er sagt, er habe sein Geld vergessen.«
»So, das hat gerade noch gefehlt! Hierzulande gibt’s mehr als genug Gauner!«
Der Büfettier blickt Doña Rosa nicht an und spricht mit kaum hörbarer Stimme: »Er sagt, wenn er Geld hat, kommt er bezahlen.«
Die Worte, die Doña Rosa jetzt entfahren, klingen hart wie Metall. »Das sagen sie alle. Und für einen, der wiederkommt, gibt’s hundert, die sich so davonmachen und sich später an nichts mehr erinnern wollen. Kommt gar nicht in Frage! Züchte Raben, und sie hacken dir die Augen aus! Sag Pepe, er wisse ja Bescheid. Ganz sanft auf die Straße und auf dem Bürgersteig noch zwei wohlgezielte Fußtritte! Was für eine Schweinerei! Es hängt einem wirklich zum Hals raus!«
Der Büfettier will schon gehen, als ihn Doña Rosa noch mal zurückruft.
»Und sag Pepe, er soll sich das Gesicht merken.«
»Jawohl, Señora!«
Doña Rosa beobachtet die Szene. Luis geht zu Pepe, seine Milchkännchen noch immer in der Hand, und flüstert ihm ins Ohr.
»Das ist alles, was sie gesagt hat! Ich für meinen Teil… Gott weiß es!«
Pepe nähert sich dem Gast, und der erhebt sich langsam. Es ist ein abgezehrtes Männchen, bleich, schwächlich und mit einer Brille aus billigem Metall auf der Nase. Seine Jacke ist fadenscheinig, die Hosenbeine ausgefranst. Er setzt sich einen weichen, dunkelgrauen Hut auf, dessen Rand voller Fettflecke ist. Unterm Arm trägt er ein Buch, in Zeitungspapier eingebunden.
»Wenn Sie wollen, lasse ich Ihnen das Buch als Pfand da!«
»Nein. Raus, auf die Straße! Reizen Sie mich nicht!«
Der Mann geht zur Tür, Pepe hintendrein. Beide verschwinden. Draußen ist es kalt, und die Leute eilen rasch vorbei. Die Zeitungsverkäufer schreien die Abendausgabe aus. Eine Straßenbahn fährt traurig, tragisch, ja beinah unheilvoll streitsüchtig die Calle de Fuencarral hinunter. Der Mann ist kein Irgendwer, kein x-beliebiger. Er ist kein ordinärer Mensch, kein Herdentier, kein gewöhnlicher Sterblicher. Er hat auf dem rechten Arm eine Tätowierung und eine Narbe in der Leistengegend. Er hat studiert und übersetzt aus dem Französischen. Mit Aufmerksamkeit hat er das Auf und Ab der intellektuellen und literarischen Welt verfolgt, und es gibt ein paar Feuilletons der Zeitschrift El Sol, die er immer noch auswendig kann. Als junger Mann hat er eine Schweizer Braut gehabt und schrieb avantgardistische Gedichte, die man dem Ultraismo zuordnen konnte.
Der Schuhputzer Segundo Segura unterhält sich mit Don Leonardo.
Don Leonardo erklärt ihm: »Wir, die Meléndez, sind eine uralte Familie und mit den ältesten Adelsgeschlechtern Kastiliens verwandt. Wir sind ehemals Herren über viele Seelen und Ländereien gewesen. Und heute beinah en la rue, Sie sehen es ja selbst.«
Segundo Segura bewundert Don Leonardo. Daß ihm Don Leonardo seine Ersparnisse gestohlen hat, ist seltsamerweise etwas, das ihn nur erstaunt und noch anhänglicher gemacht hat.
Heute ist Don Leonardo sehr redselig. Der Schuhputzer nutzt das aus und wuselt um ihn herum wie ein Schoßhündchen. Es gibt jedoch Tage, wo er weniger Glück hat, wo ihn Don Leonardo wie Dreck behandelt. An solchen Unglückstagen nähert sich der Schuhputzer sehr unterwürfig, fragt demütig und leise: »Was befehlen Sie?«
Don Leonardo würdigt ihn keiner Antwort. Segundo Segura ficht das nicht an, er drängt: »Ein kalter Tag ist das heute!«
»Ja.«
Jetzt lächelt der Schuhputzer. Er ist glücklich. Und weil er sich verstanden fühlt, gäbe er am liebsten nochmals sechstausend Duros her.
»Soll ich Ihre Schuhe wichsen?«
Segundo kniet sich hin und Don Leonardo, der ihn meistens nicht einmal anschaut, setzt verdrießlich den Fuß auf den Blechtritt des Kastens.
Heute ist es anders. Heute ist Don Leonardo zufrieden. Offenbar scheint sich sein Projekt für die Gründung einer wichtigen Aktiengesellschaft verwirklichen zu wollen.
»In früheren Zeiten – o mon dieu –, wenn da einer von uns bei der Börse erschien, kaufte oder verkaufte niemand, ehe er nicht gesehen hatte, was wir taten!«
»Wirklich? Kaum zu glauben!«
Don Leonardo verzieht geringschätzig den Mund und fährt mit der Hand durch die Luft.
»Haben Sie vielleicht Zigarettenpapier für mich?« fragt er einen vom Nebentisch. »Ich möchte gern ein bißchen rauchen und hab’ kein Papier bei mir.«
Der Schuhputzer Segundo Segura schweigt und tut, als sei er nicht vorhanden. Er weiß, was seine Pflicht ist.
Doña Rosa tritt an Elviras Tisch. Das Fräulein hat die Szene zwischen dem Kellner und dem Mann, der seinen Kaffee nicht hatte bezahlen können, genau beobachtet.
»Haben Sie das gesehen, Elvirita?«
Señorita Elvira zögert, ehe sie antwortet.
»Der arme Kerl! Vielleicht hat er den ganzen Tag nichts gegessen, Doña Rosa.«
»So, werden Sie auch romantisch? Damit ist niemandem gedient! Ich kann Ihnen schwören, keiner hat ein weicheres Herz als ich. Aber bei diesem Mißbrauch…«
Elvira weiß nicht, was sie sagen soll. Die Arme ist sehr sentimental. Sie ist nur Dirne geworden, weil sie nicht Hungers sterben wollte, jedenfalls nicht so schnell. Sie hat niemals etwas gelernt, und außerdem ist sie weder hübsch, noch hat sie gute Manieren. Als kleines Mädchen hat sie zu Hause nur Mißtrauen und Streit gesehen. Elvira stammt aus Burgos. Sie ist die Tochter eines fragwürdigen Kerls, der sich Fidel Hernández nannte. Fidel Hernández ermordete seine Frau Eudosia mit einer Schusterahle, und man verurteilte ihn zum Tode. Gregorio Mayoral vollstreckte die Hinrichtung durch das Halseisen im Jahre 1909. Zuletzt pflegte Fidel Hernández immer zu sagen: »Hätte ich sie bloß mit Schwefelsuppe vergiftet. Dann hätte sich nicht einmal Gott darum gekümmert.«
Elvira war elf oder zwölf Jahre alt, als sie Waise wurde und nach Villalón zog. Dort lebte sie bei ihrer Großmutter, die den Almosenkorb für den heiligen Antonius in der Kirche herumreichte. Die arme Alte lebte sehr kläglich. Und als man den Sohn hingerichtet hatte, schrumpfte sie völlig zusammen und starb bald darauf.
Die andern Mädchen des Dorfes hänselten Elvira, zeigten auf den Pranger und schrien: »An einen ähnlichen hat man deinen Vater gestellt, widerliches Ding du!«
Eines Tages, als es Elvira einfach nicht mehr aushalten konnte, verschwand sie aus dem Dorf mit einem Mann aus Asturien, der bei einem Fest gebrannte Mandeln verkauft hatte. Sie blieb zwei lange Jahre mit ihm zusammen. Er prügelte sie aber so, daß sie fast lahm wurde. Endlich – in Orense war es – schickte sie ihn zum Teufel und begab sich in die Lehre ins Freudenhaus der Pelona in der Calle del Villar. Dort lernte sie eine Tochter der Marraca kennen. Die Marraca war Holzsammlerin auf dem Stadtanger von Francelos bei Ribadiva. Sie hatte zwölf Töchter, alles Dirnen. Nun kam für Elvira eine Zeit von eitel Lust und Liebe, wenn man es so ausdrücken darf.
Jetzt ist sie etwas verbittert, aber nicht allzu sehr. Außerdem ist sie voller guter Vorsätze, und obschon sie sehr schüchtern ist, hat sie doch ihren Stolz.
Don Jaime Arce hat es satt, nichts zu tun, zur Decke zu blicken und an Albernheiten zu denken. Er hebt also den Kopf von der Stuhllehne und redet die schweigsame Dame mit dem toten Sohn an. Die Frau sitzt an ihrem Platz unter der Wendeltreppe, die zum Billardzimmer führt, und schaut zu, wie das Leben verrinnt.
Don Jaime erklärt: »Lügereien… schlecht organisiert… auch Fehler, ich leugne es nicht. Glauben Sie mir, nur das ist der Grund. Die Banken arbeiten schlecht, und die Advokaten mit ihrer Geschäftigkeit handeln vorschnell und stiften solchen Wirrwarr, daß niemand mehr etwas versteht…«
Don Jaime macht eine Bewegung allgemeiner Resignation.
»Nachher kommt’s wie’s kommen muß: Proteste, Durcheinander und schließlich Generalsäuberung!«