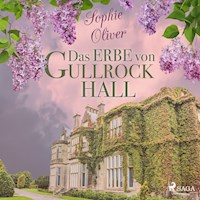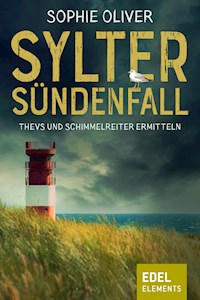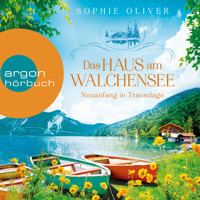Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Baker Street Bibliothek
- Sprache: Deutsch
London 1896: Eine berüchtigte Mörderin soll hingerichtet werden. Kurz vor ihrem Tod erzählt sie den Gentlemen vom Sebastian Club von einem antiken Duftbehälter, dem legendäre Heilkräfte nachgesagt werden. Gibt es ihn wirklich? Oder ist der blaue Pomander nur das Hirngespinst einer Geisteskranken? Um der Sache auf den Grund zu gehen, reisen die Ermittler nach Salzburg, ins Kaiserreich Österreich-Ungarn. Sie stellen rasch fest, dass sie auf der Suche nach der Kostbarkeit nicht allein sind, sondern von einem Konkurrenten verfolgt werden, der auch vor Mord nicht zurückschreckt. Als ihnen der geheimnisvolle Unbekannte immer näher kommt, wird die Lage brenzlig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophie Oliver
Der blauePomander
Ein viktorianischer Krimimit den Ermittlerndes Sebastian Club
Inhalt
Pomander
Verzeichnis der handelnden Personen
PROLOG
Im Club
Mayfair
Westminster
Greenwich
Im Club
Purley
Caversham
Greenwich
West End
Belgravia
Im Club
Salzburg
Rechte und linke Altstadt
Linke und rechte Altstadt
Flachau
Thurnhof
Belgravia
Im Club
Fleet Street
Greenwich
Limehouse
Im Club
Im Club
Belgravia
St. James
Epilog
GLOSSAR
DANKSAGUNG
Pomander
Das Wort Pomander stammtvom französischen pomme d’ambre,also Ambra-Apfel, zu Deutsch Bisamapfel.Es handelt sich dabei um ein Schmuckgefäß,meist in Ball- oder Kugelform (Apfel),in das Duftstoffe eingebracht werden.Ihre Blütezeit erlebten die Pomanderwährend des Mittelalters und der Renaissance.Man trug sie zum Beispiel an einer Kette um den Halsoder hielt sie an einem Stab in der Hand wie eine Blume,um daran zu schnuppern.Beliebte Parfumstoffe damals warenAmber, Moschus (Bisam) oder Zibet.
Eingesetzt wurden die wohlriechenden Schmuckstückegegen üble Gerüche. In Zeiten der Pestilenz glaubteman – irrtümlicherweise – sogar, sich damit vorInfektionen schützen zu können.
Moderne Pomander bestehen heute zumeistaus einer kunstvoll mit Nelken gespickten Orange,die Wohlgeruch verbreitet.
Verzeichnis der handelnden Personen
Professor Aristotle Brown, 63, Vorsitzender des Sebastian Club
Lord Philip Dabinott, 34, Ermittler im Sebastian Club
Freddie Westbrook, 22, Ermittler im Sebastian Club, gleichzeitig The Honourable Frederique Westbrook, Lord Philips Nichte
Doktor Wallace Pebsworth, 57, Ermittler im Sebastian Club
Crispin Fox, 26, Ermittler im Sebastian Club
Annabel Arnholtz, 38
Freda, 47, Mrs Arnholtz’ Hausangestellte
Chief Inspector Alwin Woodard, 49
Lord Ernest Fitzroy, 50
Viola Fitzroy, 45, seine Frau
Bernard Spilsbury, 19, Student
Professor Martin Edwards, 40
Sr. Benita, 33, eine Nonne
Ignatius (Iggy) Hegan, 14, ein Straßenjunge
Nigel Thompkins, 50, Nachbar von Amelia Dyer
Amelia Dyer, 60, Massenmörderin
Mary Ann (Polly) Palmer, 23, Mrs Dyers Tochter
Albert, 57, ein chinesischer Arzt und Pebsworths Freund
Clifford Fowl, 43, Journalist
PROLOG
Kalter Novemberregen prasselte auf das Dach des Hansom Cabs, während sein pitschnasser Kutscher eine Lücke im Verkehr auf der Old Bailey Street nutzte und geschickt an einem überfüllten Wagen der London Central Omnibus Company vorbeimanövrierte.
Der Tag war derart düster, dass die Öllampe des Cabs brannte, obwohl es noch nicht einmal drei Uhr war. Chief Inspector Alwin Woodard hielt sich links und rechts am Sitz fest, wurde aber nichtsdestotrotz ordentlich durchgerüttelt, als sein Fahrer auf dem rutschigen Kopfsteinpflaster einer entgegenkommenden Kutsche auswich.
Vor ihm schälte sich Stück für Stück die roh behauene Steinfassade des Newgate-Gefängnisses aus dem Nachmittagsgrau. Normalerweise ragte dahinter die Kuppel der St. Paul’s Cathedral in den Himmel, was den Anblick etwas erträglicher machte, heute war sie jedoch wegen des Wetters nicht zu sehen. Die wuchtige und durchweg unansehnliche Optik des Zuchthauses sollte der Abschreckung dienen. Woodard war allerdings davon überzeugt, dass sich kein einziger Verbrecher jemals von einer Untat hatte abhalten lassen, bloß weil das Gebäude, in dem er deswegen eingesperrt wurde, unschön war. Wahrscheinlich hatte Justitia aus ebendiesem Grund zugelassen, dass sich Newgate zu einem Ort entwickelt hatte, der an Elend und Grauen nur von wenigen Einrichtungen im Königreich übertroffen wurde. Bedlam mochte noch schlimmer sein, Newgate lag dicht dahinter.
Ein Wächter begrüßte den Inspektor höflich und ließ ihn durch die schwer gesicherte Tür ins Innere der Haftanstalt. Sie durchquerten die sogenannte Galerie, einen lang gezogenen, dreistöckigen Trakt voller Tristesse, der aus Treppen und Stahl bestand. Licht fiel durch ein spitz zulaufendes Glasdach ein, dessen scheibentragende Metallstreben ein Spiegelbild der umlaufenden Geländer waren. Unzählige Türen lagen auf den einzelnen Etagen nebeneinander, sie führten zu den Zellen der Gefangenen. Seit der Gebäuderenovierung vor etwa vierzig Jahren war man dazu übergegangen, die Insassen in Einzelzellen unterzubringen, um Krankheiten und Ungeziefer besser kontrollieren zu können. Und natürlich, um die Haftbedingungen zu verbessern. Aber Woodard kannte die Arrestzellen, sie waren nach wie vor armselig. Er zog die Nase kraus. Es stank. Ein vornehmeres Wort für die Mischung aus ungewaschenen Menschen, schlechtem Essen und Verzweiflung fiel ihm nicht ein. Wenigstens ist es hier drin trocken, dachte er. Allerdings änderte sich das gleich darauf wieder, nämlich als der Wächter eine weitere Tür mit Metallbeschlägen aufschloss und ihm bedeutete, auf den Frauen-Gefängnishof hinauszutreten, ein ödes gepflastertes Rechteck, das mittels einer hohen Mauer vom Hof der Männer abgetrennt wurde. Messerscharfe Eisenspitzen saßen in dichtem Abstand obenauf wie Bajonette einer Armee.
Schwere Tropfen prasselten auf Woodard hernieder, drangen durch Hut und Mantel und ließen ihn erschaudern. Sein Ziel war die Visiting Box, ein kleines Kabuff, in dem die weiblichen Gefangenen Besucher empfangen konnten.
»Box« war der korrekte Ausdruck für den Verschlag, eine an die Hauswand gesetzte Metallstangenzelle mit Dach. Durch die offenen Wände trieb der Wind schonungslos Regen herein, der Kommissar fröstelte noch mehr und versicherte sich, dass sein Tweedmantel auch wirklich bis obenhin geschlossen war.
Nachdem der Wärter die Tür zum Hof verriegelt hatte, wurde der zweite Zugang an der Granitwand geöffnet, und heraus trat ein weiterer Gefängnismitarbeiter, zusammen mit einer grauhaarigen Frau in Handschellen. Ihre verkniffenen, zu Strichen ausgedünnten Lippen waren umrahmt von Falten, die senkrecht zu einer dominanten Nase liefen. Tief liegende Augen mit Tränensäcken darunter vervollständigten den verbitterten Eindruck. Chief Inspector Woodard hatte in seiner langen Karriere abscheuliche Verbrechen gesehen und war Tätern begegnet, deren Grausamkeit manchem Polizisten Albträume beschert hätte. Das alles steckte er gut weg, wohl auch wegen der häuslichen Fürsorge von Mrs Woodard. Amelia Dyer hingegen, die kleine Frau um die sechzig, die mehr wie ein verhärmtes Mütterchen als eine Massenmörderin wirkte, erweckte in ihm nie gekanntes Grauen. Nur widerstrebend war er der Anordnung seines Vorgesetzten gefolgt, Mrs Dyer in Newgate aufzusuchen, denn anscheinend wollte die Alte noch etwas loswerden, bevor man sie am Galgen aufknüpfte.
»Sie ist überführt und zum Tode verurteilt. Weshalb ihr überhaupt weiteres Gehör schenken?«, hatte sich Woodard bei den Kollegen beschwert. Er kannte die Antwort. Dyer war eine Kindsmörderin, hatte Baby Farming in großem Stil betrieben, unzählige Pflegekinder aufgenommen, sie auf grausamste Weise getötet und entsorgt wie Abfall. Die Metropolitan Police wollte konkret wissen, wie viele. Nachweisen konnte man ihr nur wenige Morde, doch das reichte für den Galgen. In Woodards Augen war Dyer Abschaum, und je rascher man sie hängte, desto besser. Wem sollte es nützen, ein paar weitere Opfernamen aus ihr herauszukitzeln? Frauen hatten ihre ungewollten Babys bei ihr abgegeben, anstatt ihnen Mütter zu sein. Sie hatten das Recht verwirkt, sich über deren Schicksal zu entrüsten. Angemessener wäre es, der Mörderin keinerlei Aufmerksamkeit zu schenken, sondern sie schnellstmöglich zu exekutieren. Wobei der Galgen für sie noch zu milde war.
Woodard musste sich zur Räson rufen. Er wollte einen souveränen Eindruck vermitteln. Langsam zählte er im Geiste bis zehn, räusperte sich und nickte der Gefangenen knapp zu, um sie zum Sprechen aufzufordern.
Sie musterte ihn mit gerunzelter Stirn, die dunklen Augen stechend, dann spuckte sie vor Woodard aus, drehte sich zu ihrem Wärter um und herrschte ihn an: »Das ist nicht der Richtige! Warum schicken Sie mir einen Copper? Danach habe ich nicht verlangt, mit dem rede ich nicht.«
»Mein Name ist Chief Inspector Woodard. Meine Anwesenheit wird wohl für einen alten Galgenvogel wie dich reichen«, polterte er.
Ein meckerndes Lachen war die Antwort. »Geh nach Hause, du Schreibtischhengst, das hier is ’ne Nummer zu groß für dich.«
Sie stammte aus Bristol und redete mit starkem Akzent. Bisher hatte er jene Sprechweise mit den rollenden »r«s, runden »o«s und verschluckten Endungen gemocht, erinnerte sie ihn stets an angenehme Aufenthalte im West Country mit Mrs Woodard, doch von nun an würde sie für ihn einen schalen Beigeschmack haben.
»Soll mir recht sein.« Er gab dem Wärter einen Wink. »Sperren Sie sie wieder weg.« Den Kragen hochschlagend wandte er sich zum Gehen. Auch ohne hinzusehen verriet ihm das Rasseln der Handschellenkette, dass Dyer abgeführt wurde.
»Es waren ganz schön viele«, hörte er ihre für eine Frau reichlich tiefe Stimme hinter sich.
Langsam drehte er sich um und begegnete erneut dem mitleidslosen Blick, der sich jahrelang am Leid Unschuldiger ergötzt hatte. »Es waren ganz schön viele armselige Bälger, die ich in Engel verwandelt habe und die es nun besser haben als bei ihren Hurenmüttern, die sie nicht behalten wollten. Deshalb bist du doch hier, oder? Weil du rausfinden musst, wie viele genau? Aber ich werde dir Anzahl und Namen nicht sagen, Bursche.«
»Möchtest du nicht dein Gewissen erleichtern, bevor du vor deinen Schöpfer trittst?« Er spulte die abgedroschene Phrase ab, von der er wusste, dass sie bei ihr auf taube Ohren stoßen würde. Weil er nicht mit ihr diskutieren wollte, sondern fort aus ihrer bedrückenden Gegenwart. Tatsächlich würdigte sie die Banalität keines Kommentars.
»Ich will Brown.«
»Wie bitte?«
»Professor Aristotle Brown vom Sebastian Club. Ihm werde ich erzählen, wie viele Kinder ich getötet habe und wie sie hießen. Ihm und niemandem sonst. Unser Gespräch ist beendet.«
Auf ein Nicken von Woodard hin wurde die Tür zum Gebäude geöffnet und Amelia Dyer abgeführt. Erst als von innen hörbar verriegelt worden war, durfte er die Visiting Box verlassen und ebenso Newgate auf schnellstem Wege, einen bitteren Geschmack auf der Zunge, als hätte er Gestank mit offenem Mund eingeatmet.
Er musste nicht mit seinen Oberen Rücksprache halten, die Anweisung war eindeutig gewesen. Finden Sie heraus, wie viele arme Seelchen auf das Konto der Kindsmörderin gehen, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, es zu erfahren. Das sind wir den Bürgern unseres Landes schuldig. Nun ja, wenn es dafür des Sebastian Club bedurfte und er selbst dieser widerlichen Irren nie wieder unter die Augen treten musste, sollte das für ihn in Ordnung sein.
Durch den strömenden Regen ging es zurück ins Zentrum von London, an den Berkeley Square. Als die Kutsche vor dem vornehmen Stadthaus mit der schwarz lackierten Tür und dem dezenten Messingschild hielt, fiel Woodard ein, dass er zwar schon oft am Sebastian Club vorbeigegangen war, jedoch noch nie geklingelt hatte. Es war ja auch eigentlich peinlich, als Inspektor ein paar Privatschnüffler um Hilfe bitten zu müssen, aber dieser Fall stellte eine Ausnahme dar. Je zügiger er zu den Akten gelegt werden konnte, desto besser. Woodard schluckte seinen Stolz hinunter und betätigte den Türklopfer.
»Der Herr wünschen?« Ein fast zwei Meter großer Hüne mit unverkennbar schottisch gefärbter Aussprache öffnete ihm und blickte freundlich, aber distanziert auf ihn herunter.
»Guten Tag. Mein Name ist Chief Inspector Woodard von Scotland Yard. Ich würde gerne Professor Brown sprechen.«
»Haben Sie einen Termin?«
»Ist schon gut, Archie, der Inspektor braucht keine Voranmeldung, bitten Sie ihn ruhig herein.«
Es war mehr als angenehm, aus der nassen Kälte in die wohltemperierte Eingangshalle treten zu dürfen. Hocherfreut schüttelte Woodard die Hand von Professor Brown, der eilig hinzugekommen war, seine Brille von der Nase nahm und sie in die Brusttasche des Jacketts steckte.
»Vielen Dank, dass Sie mich empfangen.«
Der Vorsitzende des Sebastian Club zwinkerte ihm unter buschigen weißen Brauen amüsiert zu. »Gerne, ich bitte Sie. Es kommt nicht alle Tage vor, dass die Polizei uns aufsucht, und ich nehme an, Sie haben ein dringliches Anliegen, mein Guter? Kommen Sie mit in den Besuchersalon, dann können Sie mir davon erzählen.«
Brown klang gut gelaunt, Woodard entdeckte darin keinen Hinweis auf Schadenfreude, daher folgte er dem älteren Herrn und sah sich dabei unauffällig um. Die Lobby des Clubs war ein großer, quadratischer Raum mit hoher Stuckdecke und Marmorboden. Die dominierenden Farben, Weiß und ein neutraler mittlerer Grauton, wirkten frisch. Eine breite Treppe führte ins Obergeschoss. Der Professor wendete sich nach links, und Woodard folgte ihm tiefer hinein ins Haus. Durch einen fensterlosen Flur mit gelb gestrichenen Wänden, an denen Stillleben hingen, zumeist Obst oder Gemüse, gelangten sie an eine weitere Tür.
»Wie Sie wissen, sind wir ein Mitgliederclub. Besucher haben bei uns in der Regel lediglich Zutritt zu den öffentlichen Bereichen wie diesem Empfangsraum hier.« Damit traten sie in ein großes Zimmer, in dem ein offener Kamin mollige Wärme verbreitete. Außer ihnen war niemand anwesend, Woodard atmete erleichtert durch. Auf dem alten Parkett lagen Teppiche, die Vorhänge in dunklem Grün mit safranfarbenem Paisleymuster und die Stühle und Sessel mit farblich passender Polsterung wirkten gemütlich. Hier ließ es sich aushalten. Woodard konnte sich durchaus vorstellen, entspannt eine Zigarre zu rauchen, während er in der Times schmökerte und einen Whisky dazu trank. Aber deswegen war er nicht hier. Dies war die Spielwiese der reichen Herren, eine Welt, zu der er für gewöhnlich keinen Zugang hatte. Und auch nicht wünschte. Der schottische Butler nahm ihm den tropfnassen Hut und den Mantel ab und fragte ihn nach seinen Getränkewünschen. Der Inspektor lehnte höflich ab.
»Nehmen Sie doch Platz.« Brown wies auf eine Sitzgruppe bestehend aus zwei schlanken Sesseln und einem runden Holztischchen und setzte sich ebenfalls. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
Im Club
Professor Aristotle Brown hatte lange über das Gespräch mit Chief Inspector Woodard nachgedacht und dann beschlossen, die Sache vor seine Ermittler zu bringen. Am liebsten hätte er rundheraus abgelehnt, doch das stand ihm nicht zu, die anderen mussten mitentscheiden.
Neben sämtlichen Annehmlichkeiten eines typisch englischen Herrenclubs war der Sebastian Club nämlich für seine Handvoll cleverer Detektive bekannt. Obwohl sie stets diskret ermittelten und sich aus den Klatschblättern heraushielten, hatte sich ihr Ruf herumgesprochen. Normalerweise lösten sie Fälle, an denen Scotland Yard scheiterte, zum Verdruss der Metropolitan Police, die den Club als lästige Konkurrenz betrachtete. Noch nie war es vorgekommen, dass die Polizei sie konkret um Hilfe bat. Allein deswegen durfte Brown nicht einfach Nein zu Woodard sagen, sondern musste die Kollegen um ihre Meinung bitten. Diese hatten sich auf seine Nachricht hin vollzählig eingefunden und saßen im kreisrunden Besprechungszimmer um den ebenso dimensionierten Tisch. Von den Wänden blickten Browns Vorgänger sowie einige verdiente Clubmitglieder wohlwollend, wie er sich gerne vorstellte, von ihren Porträts auf sie herab.
Lord Philip Dabinott, ein junger Adeliger Anfang dreißig mit messerscharfem Verstand und einer bisweilen arrogant anmutenden Jovialität, die über seine tiefgründige Seele hinwegtäuschen sollte, verschränkte die langen Finger ineinander und blickte ihn aufmerksam aus blauen Augen an. Neben ihm saß Freddie Westbrook, Lord Philips Neffe, von dem die Detektive wussten, dass er eigentlich seine Nichte war, gekleidet in einen modernen dreiteiligen Straßenanzug mit Bügelfalten auf der Hose und einer Kurzhaarperücke auf dem Kopf. Obwohl erst zweiundzwanzig Jahre alt, verfügte Freddie über eine hervorragende Kombinationsgabe, welche die Tiefschläge des Lebens noch nicht durch Unsicherheit verwässert hatten. Als geschätztes Mitglied der Detektivriege musste sie über ihr großes Manko, das weibliche Geschlecht, mittels maskuliner Verkleidung hinwegtäuschen, sonst hätte sie freilich keinen Zugang zum Club oder jedweden Ermittlungen. Irgendwann, so hoffte der Professor, würde es lediglich darauf ankommen, was in den Köpfen der Menschen steckte und nicht unter ihren Kleidern. Gleichzeitig wusste er allerdings, dass Freddie die Gesellschaft bis dahin mit grotesken Kostümierungen austricksen musste, wenn sie als Frau mehr im Leben wollte als das, was ihr die Männer freiwillig zugestanden.
Crispin Fox, ebenfalls ein junges Mitglied der Sebastian-Club-Detektive und seines Zeichens Anwalt, hochbegabt und mit natürlichem Charme ausgestattet, klappte den mitgebrachten Notizblock auf. Der letzte Fall lag einige Monate zurück, und der Eifer stand Crispin ins Gesicht geschrieben. Er würde sich freuen, der väterlichen Kanzlei für eine Weile zu entfliehen, um sich in Ermittlungsaufgaben zu stürzen, wusste Brown. Allein, ob es dazu kommen würde, war noch unsicher.
Vervollständigt wurde die Riege von Doktor Wallace Pebsworth, einem altgedienten Clubmitglied. Mitte fünfzig, untersetzt und mit walrossartigem Bart machte er einen gemütlichen Eindruck, wodurch er schon von so manchem Kriminellen unterschätzt worden war. Der Doktor kannte Gott und die Welt, seine verzweigten Beziehungen durchwucherten alle Gesellschaftsschichten wie Pilzmyzel, und er konnte durchaus agil sein, wenn es darauf ankam.
Professor Brown war stolz auf seine Detektive. Sie leisteten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, für die Sicherheit der Menschen und für die Gerechtigkeit an sich. Daher war es nur recht und billig, ihnen Woodards Bitte vorzutragen.
»Gentlemen«, begann er, »ich habe Sie heute hierhergebeten, weil Scotland Yard konkret auf uns zugekommen ist und uns um Hilfe ansucht.«
»Hört, hört! So etwas gab es noch nie.«
»Ganz richtig, Doktor. Es handelt sich auch um ein Anliegen, das, wie soll ich sagen, Fingerspitzengefühl verlangt. Zudem ist Eile geboten. Wir müssen heute entscheiden, ob wir einspringen wollen. In wenigen Tagen findet im Newgate-Gefängnis die Hinrichtung von Amelia Dyer statt.«
»Und das ist gut so«, sagte Lord Philip bestimmt.
»Gewiss. Jedoch will die Metropolitan Police keine Chance ungenutzt lassen, um herauszufinden, wie viele Morde Mrs Dyer begangen hat.«
»Ist die überwältigende Anzahl an Kinderkleidung, die in ihrer Wohnung gefunden wurde, nicht ein Anhaltspunkt? Für eine Hochrechnung wenigstens?«
»So ist es, Mister Fox. Und gerade aus diesem Grund, weil die geschätzte Zahl derart erschreckend hoch liegt, soll die Verurteilte vor ihrer Hinrichtung dazu gebracht werden, eine verbindliche Opferzahl zu nennen.«
»Und wir sollen die aus ihr herauskitzeln?«
»Genau genommen verlangt Mrs Dyer, mich persönlich zu sprechen. Es stellt sich nun die Frage, ob wir ihrem Wunsch nachgeben und ich sie im Gefängnis besuche, oder ob wir ablehnen.«
Stille legte sich über die Gruppe. Bis Crispin Fox seinen Notizblock vernehmlich zuklappte. »Ich bin dagegen, dieser Person Gehör zu schenken«, verkündete er. »Damit würden wir ihr gewissermaßen eine Lobby geben, um sich vor ihrem Tod wichtig zu machen. Wer weiß, womöglich möchte sie Zeit herausschlagen, die Hinrichtung verschieben lassen. Worum sonst sollte es ihr gehen? Jahrzehntelang hat sie sich nicht um ihre Opfer geschert. Wieso jetzt? Und weshalb will sie mit Ihnen reden? Kennen Sie Mrs Dyer?«
Brown schüttelte den Kopf. »Persönlich nicht, aber sie hat wohl vom Sebastian Club gehört.«
Nun entbrannte eine lebhafte Debatte, in der Befürworter und Gegner eines derartigen Treffens ihre Ansichten diskutierten, Meinungen vehement vertraten, sich vom Gegenteil überzeugen ließen, und nach einer Weile wurde es erneut still im Raum.
»Im Sinne der unschuldigen Opfer sollten wir nichts unversucht lassen, darin sind wir uns also einig«, fasste Doktor Pebsworth zusammen. »Aber der Professor wird nicht allein gehen, ich begleite ihn. Gibt es Gegenstimmen?«
Die anderen schüttelten die Köpfe, auch Crispin Fox, und Brown blickte mit gemischten Gefühlen in die Runde. »So sei es.«
Das Wetter war noch immer denkbar unwirtlich, als er tags drauf mit seinem Kollegen in derselben Box stand wie zuvor der Inspektor, und ebenso unangenehm empfand er die Begegnung mit der Mörderin.
»Sie sind also der schlaue Professor von diesem Club«, stellte sie fest.
»Aristotle Brown. Sie wünschen mich zu sprechen, um mir die Anzahl Ihrer Opfer mitzuteilen? Ich bin ganz Ohr.«
»Mal langsam. Wer ist er?«
»Gestatten, Doktor Pebsworth, ebenfalls Mitglied im Sebastian Club.«
»Er soll verschwinden, ich will nur mit Ihnen reden.«
Die beiden Detektive sahen einander an, dann nickte Brown unmerklich, und der Doktor trat hinaus auf den Gefängnishof und entfernte sich ein paar Meter.
»Sprechen Sie. Ich werde meinen Kollegen nicht länger als nötig draußen im Regen stehen lassen.«
Ein kaltes Lächeln verzog die Lippen der Alten zu einem bleistiftdünnen Strich, während ihr Blick ernst und forschend blieb. Sie zog sich in die hinterste Ecke der Besucherzelle zurück, möglichst weit weg von den Wächtern, und begann zu flüstern. Der Professor trat näher an sie heran, er hatte keine andere Wahl, wenn er verstehen wollte, was sie von sich gab.
»Hören Sie mir genau zu, und unterbrechen Sie mich nicht. Am Ende werde ich Ihnen verraten, was Sie wissen möchten, aber zuerst lassen Sie mich reden.« Sie sah klein aus in der viel zu großen Gefängniskluft, die sie beinahe verschluckte. Ihre Haut war schmutzig, die meisten Zähne ausgefallen.
Er nickte.
»Diese Frauen, die mir ihre Kinder brachten – die wollten, dass ich sie loswerde. Das sind die eigentlichen Mörderinnen, die mich zu ihrem Instrument gemacht haben. Jede einzelne von ihnen wusste, was ich mit den Blagen tue. Die Mütter sollten am Galgen baumeln, nicht ich. Ich habe ihnen lediglich einen Dienst erwiesen.«
Innerlich schrie Brown auf. Er wollte widersprechen oder wenigstens nicht länger zuhören müssen, doch dann traf ihn der aufmunternde Blick von Doktor Pebsworth aus der Ferne, und er nahm sich zusammen und schwieg.
»Sie und Ihre einflussreichen Freunde vom Sebastian Club werden verhindern, dass man mich hängt. Ich weiß, dass Sie das können. Dafür gebe ich Ihnen etwas, was mehr wert ist als ein paar tote Kinder, viel mehr wert.« Sie lachte auf, bekam einen Hustenanfall und spuckte gelben Schleim durch die Gitterstäbe nach draußen, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte.
»Sobald ich begnadigt wurde, verrate ich Ihnen, wo Sie den blauen Pomander finden.« Mit weit aufgerissenen Augen, in denen Wahnsinn stand, starrte sie ihn erwartungsvoll an. »Sie wissen doch, was das ist? Der blaue Pomander?«, setzte sie ungeduldig hinzu.
Er nickte wiederum stumm.
»Und damit Sie nicht meinen, ich will Sie austricksen, nenne ich Ihnen schon mal einen Ort, an dem Sie einen Hinweis auf das Versteck finden. Sehen Sie dort nach und kommen Sie dann wieder – mit einer königlichen Begnadigung –, und ich sage Ihnen, wo er ist.« Mit dürren Fingern winkte sie ihn zu sich.
Es widerstrebte Professor Brown, sich der Frau zu nähern. Sie roch nach Erbrochenem, und auf ihrer Haut lag ein abstoßender Schmierfilm. Der Gedanke, dass dieses erbarmungslos kalte Gesicht das letzte gewesen war, das unzählige Kinder gesehen hatten, bevor sie unter Schmerzen die Augen für immer geschlossen hatten, wühlte ihn zutiefst auf. Er hatte die Berichterstattung über Amelia Dyer verfolgt, wusste, dass sie dem Alkohol verfallen war, versucht hatte, sich mit Laudanum das Leben zu nehmen, aber aufgrund ihrer Abhängigkeit von Rauschmitteln sogar eine hohe Dosis überlebt hatte. Sie war in einer Irrenanstalt gewesen. Zu Recht oder nicht? War sie geisteskrank? Oder einfach nur ein grausames Biest, durchtrieben und böse, das sich am Leid Hilfloser ergötzte und bereicherte?
»Meine Opfer erkennen Sie am Band um den Hals«, hatte sie der Polizei stolz mitgeteilt, als diese zahlreiche tote Babys aus der Themse gefischt hatte. Sie war es überdrüssig geworden, ihr überlassene Kinder durch Hunger oder Krankheit sterben zu lassen. Durch Erwürgen konnte sie sich ihrer lästigen Pflicht viel rascher entledigen. Dazu verwendete sie Nahtband, um den Hals geschlungen und zweimal verknotet, jedoch nicht so fest, als dass die Erlösung hätte schnell eintreten können. Sie sah ihren Opfern gern beim Todeskampf zu, das hatte sie der Polizei erzählt. Ein grausiges Detail, das die Zeitungen nicht herausgefunden, Woodard aber Brown mitgeteilt hatte und an das er nun dachte, als die Kindsmörderin ihm mit stinkendem Atem zuflüsterte: »Suchen Sie dort, wo vormals der Teufel das Land beackerte, unter der schwarzen Erde, hinter dem Zeichen der Acht.«
Der Professor wich einen Schritt zurück. »Ich denke nicht, dass Sie in Ihrer Situation Zeit für Rätsel haben.«
Sie runzelte die Stirn, kniff die Augen zusammen und gab ein Grunzen von sich. »Und ich dachte, Sie und Ihre Kumpane sind bekannt dafür, schlauer zu sein als die Polizei.«
Langsam entfernte er sich ein weiteres Stück von ihr. »Verstehe«, sagte er. »Hoch gepokert, Mrs Dyer, zieht man in Betracht, dass Sie gerne den Eindruck einer Irren erwecken – geschickt überlegt. Sie wissen nicht mehr darüber, nicht wahr? Sonst hätten Sie sich den Hinweis längst selbst geholt. Wahrscheinlich haben Sie irgendwo eine alte Legende aufgeschnappt, aber keine Ahnung, was sie bedeutet, und nun, als letzten Akt der Verzweiflung, soll Sie ein Ammenmärchen vor dem Galgen retten. Ein vager Tipp bezüglich etwas, von dem wir nicht einmal mit Sicherheit wissen, dass es überhaupt existiert. Sie dachten, wenn Sie es mir sagen, wäre meine Neugier geweckt. Bedauerlicherweise täuschen Sie sich. Das Einzige, was ich von Ihnen erfahren möchte, ist: Wie viele Kinder haben Sie ermordet?«
»Woher soll ich das wissen? Ich habe sie nicht gezählt!«
Er gab dem Wärter einen Wink, und dieser trat zur Gefangenen, kettete sie an eine der Eisenstangen, die den Besucherkäfig bildeten, und öffnete dann die Tür für den Professor. Doktor Pebsworth kam herbei, nahm ihn auf dem Hof in Empfang, dessen triste Beschränktheit Brown mit einem Schlag viel weitläufiger vorkam als vorhin. Froh, der Gegenwart Amelia Dyers entkommen zu sein, atmete er erst einmal tief durch und hielt sein Gesicht in den Regen. Die prasselnden Tropfen auf seiner Haut brachten ihn zurück zu sich.
»Was ist nun?«, keifte sie und rüttelte an der Kette. »Brennen Sie nicht darauf, den blauen Pomander zu finden? Näher als durch mich werden Sie ihm nie kommen. Sie brauchen mich!« Nach einem letzten Blick auf die verabscheuungswürdige Person und ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und ging weg. »Sie dürfen nicht zulassen, dass man mich hängt! Sie brauchen mich!« Ihre schrillen Schreie hallten noch lange in seinen Ohren, aber Professor Brown und der Doktor hielten nicht an. Zügig schritten sie zurück zum Hauptgebäude und bestiegen draußen auf der Straße ihre wartende Kutsche. Inspektor Woodard würde enttäuscht sein. Amelia Dyer hatte niemals vorgehabt, ihnen die genaue Zahl ihrer abscheulichen Verbrechen zu nennen. Alles, was sie wollte, war, um ihren Hals zu pokern, an dem ihr bald ebenso die Luft abgeschnürt werden würde, wie sie es bei ihren Opfern getan hatte. Und der Sebastian Club würde keinen Finger rühren, um dies zu verhindern.
Zurück am Berkeley Square warteten Lord Philip, Freddie und Crispin Fox auf die beiden und ließen sich Bericht erstatten.
»Das hatte ich befürchtet«, meinte Crispin kopfschüttelnd, »dass alles nur ein Vorwand ist. Die meisten Mörder, selbst wenn sie noch so viel auf dem Kerbholz haben, mutieren zu Feiglingen, die ihre eigene Mutter an den Teufel verhökern würden, sobald es ans Sterben geht.«
»Was ist ein blauer Pomander?«, fragte Freddie.
Ein Lächeln stahl sich auf Professor Browns Züge. Er konnte nicht verhindern, ein wenig ins Schwärmen zu geraten, wie immer, wenn es um historische Artefakte ging.
»Dabei handelt es sich um ein Behältnis für Duftstoffe. Der blaue Pomander hat die Form einer Kugel, etwa so groß wie ein kleiner Apfel. Er besteht aus Gold, wird an einer Kette um den Hals getragen und ist über und über mit Saphiren besetzt. Der Legende nach befindet sich eine besondere Duftpaste in ihm, die der berühmte Paracelsus höchstpersönlich zusammengestellt hat und die seinen Träger von jeglicher Krankheit heilen kann.«
»Unsinn«, brummte der Doktor. »So etwas gibt es nicht. Absoluter Humbug.«
»Darüber gehen die Meinungen auseinander. Paracelsus war ein Arzt und Alchemist, ein brillanter Gelehrter, der um 1500 lebte, und angeblich ist es ihm gelungen, durch seine Duftkomposition sämtliche Übel und Pestilenz abzuwenden. Leider ging das Rezept verloren, lediglich im blauen Pomander soll sich ein letzter Rest der Salbe befinden. Würde man diesen analysieren, könnte man seine Mischung reproduzieren. Und damit einen Beweis der Heilkraft antreten.«
»Das glauben Sie doch selber nicht!«
Professor Brown grinste in die Runde. »Ziemlich unwahrscheinlich, einem fast vierhundert Jahre alten eingetrockneten Salbenbröckchen seine Geheimnisse entlocken zu können. Zumal nicht sicher ist, dass ihm überhaupt irgendeine gesundheitsförderliche Wirkung innewohnt.«
»Hingegen das Schmuckstück an sich …«
»Genau, geschätzter Lord Philip. Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Das Juwel wäre ein Vermögen wert, welches sich durch die damit verbundene Legende bestimmt noch erhöhen ließe. Stellen Sie sich nur einmal vor, was geschehen würde, wenn Detektive des Sebastian Club den blauen Pomander fänden? Es würde das Ansehen unseres Hauses international steigern, und wir könnten durch seine anschließende Veräußerung eine große Summe für einen wohltätigen Zweck spenden, was dann wiederum nochmals unserer Reputation zugutekäme.«
Freddie rümpfte die Nase. »Wir sind aber keine Schatzjäger, Gentlemen.«
»Absolut korrekt, Mr Westbrook. Daher schlage ich vor, wir vergessen das Ganze und lassen die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen.« Crispin Fox verschränkte die Arme vor der Brust und blickte abwartend in die Runde.
Es gab keinerlei Widerspruch, auch wenn Professor Brown deswegen ein wenig enttäuscht aussah.
Mayfair
Ende November lud Sir James MacWill, der Viscount of Ucksfird, zum alljährlichen St. Andrew’s Ball in sein Palais in der Nähe der Bond Street.
Der Viscount war Mitglied im Sebastian Club und die Feier der Andreasnacht für jeden Schotten der Londoner Upperclass ein beliebter Pflichttermin. Freddie und ihre Kollegen konnten zwar nur auf den ein oder anderen schottischen Vorfahren zurückblicken, nahmen aber trotzdem gerne an der geselligen Veranstaltung teil.
Es gab deftiges Essen, recht kartoffellastig, dazu viel Fleisch. Allenthalben hörte Freddie, wie über die Kindsmörderin getuschelt wurde. Amelia Dyers Hinrichtung vor zwei Tagen war nach wie vor Tagesgespräch in London.
»Ein viel zu barmherziger Tod für diese verabscheuungswürdige Person!«, schimpfte Lady Fitzroy, die warmen braunen Augen, die denselben Farbton hatten wie ihr Haar, weit aufgerissen.
Ihr Gatte legte besänftigend eine Hand auf ihren Arm. Ganz offensichtlich war dem etwas steif wirkenden Lord Ernest Fitzroy der emotionale Ausbruch seiner Gattin unangenehm. Die beiden waren Bekannte des Professors, Freddie hatte sie erst an diesem Abend kennengelernt und Viola Fitzroy auf Anhieb sympathisch gefunden. Die kleine, zarte Person mit Apfelbäckchen und geschwungenen Lippen wirkte mädchenhaft, obwohl sie die vierzig sicherlich überschritten hatte. Ihr Mann sah neben ihr schlaksig, groß und ungelenk aus und erinnerte Freddie in seiner gesamten Körperhaltung an einen Reiher, der über eine Wiese stakste. Rotbraunes Haar und Sommersprossen hätten auch ihn ansprechend erscheinen lassen können, wäre da nicht der kleine verkniffene Mund gewesen, dem ein orangefarbener Bart Strenge verlieh, welche sein Träger gewiss ausstrahlen wollte. Seitdem Freddie für den Sebastian Club tätig war, hatte sie es sich zur Angewohnheit gemacht, Menschen, denen sie begegnete, mit zwei Schlagworten in ihrem Gedächtnis zu verankern. Bei Viola Fitzroy waren dies »warm« und »lebhaft« und bei Lord Fitzroy »verkrampft« und »kühl«.
»Ich stimme Ihnen zu, Mylady«, sagte Crispin nachdrücklich, woraufhin er ein Stirnrunzeln ihres Gatten erntete. Unbeirrt fuhr er fort. »Es mag in der Tat unverhältnismäßig erscheinen, dass jemand, der so vielen Unschuldigen Leid zugefügt hat, einen raschen Tod erhält. Doch wir vertrauen auf unser Rechtssystem, das eine Mörderin ihrer Strafe zugeführt hat.«
»Haben Sie sie nicht kurz vorher noch besucht, Brown?« Lord Fitzroy blickte den Professor an.
»Das stimmt. Woher wissen Sie davon?«
Ein dünnes Lächeln schenkte dem kleinen Mund vorübergehend ein wenig Breite. Leider nicht dauerhaft. Bevor er weitersprach, presste er die Lippen kurz aufeinander. »Ich bin mit dem Commissioner befreundet. Er meinte, Sie wären nicht erfolgreich damit gewesen, der Alten Informationen zu entlocken.«
»Nicht die von ihm gewünschten, leider. Stattdessen wollte sie mir die Legende vom blauen Pomander als bare Münze andrehen. Angeblich wusste sie, wo er zu finden ist – und hätte es mir verraten im Gegenzug für eine Begnadigung.«
»Wie absurd! Der blaue Pomander existiert ebenso wenig wie der Heilige Gral oder die Quelle der ewigen Jugend.«
»Und dennoch gibt es auf der ganzen Welt Menschen, die danach suchen.«
»Professor Brown, Sie wollen nicht wirklich behaupten, dass Sie an die Existenz eines duftenden Allheilmittels gegen sämtliche Unbill glauben?«
»Nein, Lord Fitzroy, meiner Meinung nach gibt es so etwas nicht. Aber ich denke, Amelia Dyer sah das anders.«
»Dann war sie irrer als angenommen.«
Brown zuckte die Schultern. »War sie das? Irre? Oder eine eiskalt kalkulierende Person? Das werden wir nie erfahren. In ihren Augen stand jedenfalls keinerlei Reue. Es wäre faszinierend gewesen zu wissen, was tatsächlich in ihrem Kopf vorging.«
»Dazu müsste man ihr Gehirn sezieren«, ertönte eine Stimme neben ihnen. Ein junger Mann hatte offenbar der Unterhaltung der Gruppe gelauscht und leistete nun einen gewissermaßen abstrusen Beitrag.
»Wie bitte?«, entfuhr es Lady Fitzroy entsetzt. Doktor Pebsworth aber rief begeistert aus: »Mister Spilsbury! Ich hatte gehört, Sie wären ebenfalls heute eingeladen. Wie schön, dass wir uns treffen. Darf ich vorstellen«, er blickte in die Runde, »Bernard Spilsbury, Absolvent des Magdalen College in Oxford und derzeit Medizinstudent an der University of London. Sein Vater und ich sind gute Freunde, und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, Mister Spilsburys akademische Karriere zu verfolgen.«
»Sie meinen wohl, Papa hat Sie darum gebeten, ein Auge auf mich zu haben.« Der junge Mann grinste.
»Aus Ihnen wird einmal ein hervorragender Mediziner werden. Ein Arzt der neuen Generation.«
»Nicht wenn er die Gehirne von toten Verbrechern zu zerpflücken gedenkt. Das ist gegen jede Sitte«, bemerkte Lord Fitzroy spitz.
Pebsworth tätschelte seinem Freund väterlich den Rücken. »Gestatten Sie, dass ich widerspreche, Mylord. Gerade die Leichenschau kann uns vieles verraten, obwohl diese Wissenschaft noch immer in den Kinderschuhen steckt. Ich bin selbst leider schon zu alt dafür, als dass sie jemals mehr als ein Steckenpferd für mich werden könnte, doch Mister Spilsbury hier stehen alle Türen offen.«
Während die Fitzroys weiter über Amelia Dyer und das sagenhafte Juwel diskutierten, setzte nebenan im Tanzsaal die Musik ein.
Freddie sah Crispin auf sich zukommen. »Darf ich bitten, Miss Westbrook?«, fragte er.
»Mister Fox wirkte überaus angetan von dir. Wie immer. Ich musste euch praktisch von der Tanzfläche zerren, sonst wärt ihr bis zur Erschöpfung zu dieser schottischen Musik herumgehüpft. Es wundert mich, dass du nicht in Ohnmacht gefallen bist, immerhin beschwerst du dich allenthalben über dein Korsett. Oder hat dich Mister Fox’ Gegenwart jegliche Kurzatmigkeit vergessen lassen?«, stichelte Lord Philip auf der Heimfahrt.
»Wir verstehen uns eben gut.« Freddie war trotz frostiger Temperaturen immer noch erhitzt und froh darüber, in der kalten Kutsche zu sitzen. Die Fahrt zum heimischen Stadthaus am Wilton Crescent war ohnehin kurz.
»Ein Glas Port in meinem Zimmer vor dem Zubettgehen?«, fragte Lord Philip, und Freddie stimmte gerne zu.
Seitdem sie Mitglied im Sebastian Club war, hatte sich das Verhältnis zu ihrem Onkel grundlegend verändert – oder vielmehr seine Einstellung ihr gegenüber. In der Anfangsphase hatte er erst lernen müssen, damit umzugehen, dass seine Nichte sich in Männerkleidung auf Verbrecherjagd begab und nicht länger nur zu Hause herumsaß und Tee trank. Doch mittlerweile betrachtete er sie weder als seine kleine Verwandte noch als sittsame Lady, sondern als gleichwertigen Menschen, was Freddie in Momenten wie diesem mit Freude erfüllte. Niemals hätte er sie früher auf einen Drink und ein Gespräch in sein gemütliches Arbeitszimmer gebeten.
Sie saßen einander gegenüber in Ledersesseln vor dem Kamin und wärmten sich die Füße am Feuer. Ansonsten gab es im Raum nur noch einen Schreibtisch und zahllose Bücher in Regalen an allen Wänden sowie eine doppelflügelige Glastür, die auf die Veranda führte. Einem Betrachter wäre auf Anhieb die Ähnlichkeit der beiden aufgefallen, blondes Haar, leuchtend blaue Augen, und Onkel wie Nichte waren auffallend groß. Freddie musste schmunzeln, als sie bemerkte, dass sie sogar die gleiche Sitzposition eingenommen hatten.
»Du weißt, dass er sich nicht ewig von einem Antrag abhalten lassen wird, und was dann? Dann must du ihm eine Antwort geben.«
Es war ihr unangenehm, dass Philip das Thema nicht fallen ließ. Hauptsächlich deswegen, weil sie sich ohnehin selbst ständig den Kopf darüber zerbrach und noch zu keinem Ergebnis gekommen war. »Ich weiß.«
»Crispin Fox ist bis über beide Ohren in dich verliebt. Und wenn ich meine Nichte kenne, dann sind die Gefühle auf ihrer Seite nicht gleichwertig stark ausgeprägt.«
Freddie seufzte. »Ist es nicht immer so, dass einer mehr liebt als der andere? Ich mag Crispin, sehr sogar. Aber ich werde mich in absehbarer Zeit nicht an einen Mann binden.«
»Wegen des Clubs?«
Sie nickte. »Eine Ehe würde das Ende meiner Ermittlertätigkeit bedeuten.«
»Nicht, wenn du Crispin heiratest. Sicherlich wäre er der einzige Ehemann auf der Welt, der dir eine Fortsetzung deiner Mitarbeit gestatten würde.«
»Ich werde mich nicht sehenden Auges in eine Situation begeben, in der ich mir erlauben oder verbieten lassen muss, was ich tun darf.«
»Frederique, wie aufbrausend! Und wie sinnlos, sich darüber aufzuregen, denn so stehen nun einmal die Dinge in unserer Gesellschaft.«
Sie knallte das leere Glas zurück auf den kleinen Holztisch, der zwischen ihren Stühlen stand, und rang um Fassung. Aufschreien hätte sie mögen, dass es ungerecht war. Dass sie ebenso schlau und fähig war wie jeder Mann. Und dass sie sich nun, wo sie beide Seiten des Lebens gesehen hatte, niemals wieder mit dem beschränken würde, was sich schickte, sondern machen würde, was sie wollte.
Stattdessen biss sie sich auf die Lippe und wechselte das Thema, während er ihr nachschenkte.
»Da wir von der Liebe sprechen, Onkel, und davon, dass sie manche mehr und manche weniger trifft – was ist mit Mabel? Schuldest du ihr nicht langsam eine Erklärung? Die Ärmste macht sich noch immer Hoffnungen auf dich. Sinnloserweise, wie wir beide wissen.«
Er lächelte sie an. »Touché. Dir wird sicher nicht entgangen sein, dass Miss Shrewsbury heute Abend nicht anwesend war, genauso wenig wie ihre Eltern.«
Mabel Shrewsbury war Freddies Freundin. Die ebenso reizende wie gut situierte junge Dame hatte es sich in den Kopf gesetzt, Lord Philip zu ehelichen, doch hatte Freddie ein deutliches Abkühlen seiner Gefühle beobachtet. Mabel ebenfalls, sie hatte der Freundin gegenüber mehrfach verlauten lassen, sich demnächst einen anderen potenziellen Ehemann zu suchen, immerhin war sie bereits Mitte zwanzig und konnte nicht noch mehr Zeit verlieren. Ein komisches Gefühl breitete sich in Freddie aus, und sie bereute es, Mabel erwähnt zu haben, denn nun musste sie sich anhören, was Philip zu sagen hatte. Er drehte sein Glas in den langen Fingern. Der Flammenschein des Kaminfeuers ließ die Flüssigkeit darin schimmern wie einen blutroten Edelstein.
»Als ich heute Morgen unterwegs war, habe ich Miss Shrewsbury besucht. Ich wollte ihr mitteilen, dass es für uns keine gemeinsame Zukunft geben kann.«
»Das hast du nicht getan!« Sie schnappte nach Luft.
»Korrekt. Dazu kam es nämlich nicht. Sie teilte mir knapp mit, dass es sich nicht schicken würde, wenn ich sie weiterhin aufsuche, da sie in wenigen Tagen ihre Verlobung mit einem Mister Carlson bekannt geben würde.«
»Bitte?« Das saß. Freddie stand auf, stemmte die Hände in die Hüften, schüttelte den Kopf und ließ sich dann ganz undamenhaft wieder in den Sessel plumpsen. »Hat sie sonst noch etwas gesagt?«
»Nur dass sie bedauert, es dir nicht persönlich erzählt zu haben, doch sie baut auf dein Verständnis und wird dir bei eurem nächsten Treffen alles berichten.«
Ob es überhaupt dazu kommen würde, ob sich die Freundschaft nicht ohnehin erledigt hatte, nun, da ihr Onkel nicht mehr Mabels erklärter Heiratskandidat war, stellte Freddie infrage. Außerdem betrachtete sie die Freundin, für deren vermeintlich gebrochenes Herz sie eben noch hatte Mitleid empfinden wollen, schlagartig mit wachsender Distanz. Dieser ekelerregende Heiratsmarkt, auf dem sich junge Frauen ihres Alters und Kalibers zu tummeln hatten, stieß sie zusehends ab. Und bestätigte sie in ihrem Bestreben, ungebunden zu bleiben.
Aus zusammengekniffenen Augen betrachtete sie Philip. »Du bist erleichtert, fein raus zu sein, nicht wahr? Aber du hättest sie ohnehin verlassen – für Annabel Arnholtz.«
Ein gequälter Ausdruck stahl sich auf sein hübsches Antlitz. »Ist das derart offensichtlich?«
»Keine Sorge, lieber Onkel. Ich bin davon überzeugt, dass niemand etwas ahnt. Außer mir und unseren Kollegen, und das auch nur, weil wir dich mittlerweile einfach zu gut kennen. Seitdem Mrs Arnholtz ihre anrüchigen Etablissements im East End abgestoßen hat, ist sie eine gemachte Frau, und du könntest dich um sie bemühen.« Im Geiste fügte sie hinzu: Wenn man die Tatsachen außer Acht lässt, dass sie mit einem zwielichtigen Verbrecher verheiratet war, der ein gewaltsames Ende gefunden hat, höchstpersönlich als Geschäftsführerin zahlreicher Halbweltkaschemmen fungiert hat und eine geheimnisvolle Vergangenheit besitzt, von der niemand etwas Genaues weiß, was zumeist kein gutes Zeichen ist.
»Annabels sozialer Status war mir schon immer einerlei«, sagte er dumpf. »Sie macht sich darüber mehr Sorgen als ich.«
Freddie dachte an ihre erste Begegnung mit Mrs Arnholtz. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hatte sie die damals noch mit Cassius Arnholtz verheiratete Dame im Familienbetrieb, einem Bordell im East End, aufgesucht. Sie war eine schöne Frau, ein paar Jahre älter als Lord Philip, mit Alabasterhaut, schwarzem Haar und veilchenfarbenen Augen. Mehr noch als ihr Aussehen hatte Freddie allerdings ihre ungewöhnliche Anmut und Würde beeindruckt. Eine Haltung, die in der Welt, in der Annabel Arnholtz lebte, extrem außergewöhnlich war. Sie verstand, weshalb ihr Onkel sie faszinierend fand. Doch auch wenn sie ihn eben ermutigt hatte, den nächsten Schritt zu gehen, stand fest, dass eine Ehe mit einer solchen Frau für Lord Philip Dabinott indiskutabel wäre.
Ein paar Minuten lang versanken sie in ihren Gedanken, starrten stumm in die Flammen des Kaminfeuers und lauschten dem Knistern brennenden Holzes.
»Was denkst du über die Konversation mit den Fitzroys heute Abend?«, fragte er schließlich leise.
Freddie blickte auf. »Lady Fitzroy scheint mir eine nette Dame zu sein, sehr elegant. Bei ihrem Gatten tue ich mich ein wenig schwer. Er ist bemüht, einen konservativen Eindruck zu vermitteln, gibt sich steif und beherrscht. Aber irgendetwas an ihm passt nicht dazu.«
»Der Professor kennt ihn seit Jahren, allerdings nur oberflächlich. Damals wollte Fitzroy in den Sebastian Club eintreten, wurde jedoch abgelehnt. Trotzdem versuchte er bei jeder Gelegenheit, sich bei Brown lieb Kind zu machen, lud ihn zum Essen ein und dergleichen. Es dauerte eine Weile, bis sein Enthusiasmus verebbte. Wenn sie sich heute auf Veranstaltungen treffen, ist es aber noch immer so, dass Lord Fitzroy ihm nicht von der Seite weicht.«
»Weshalb?«
Philip zuckte die Schultern. »Er bewundert ihn eben.«