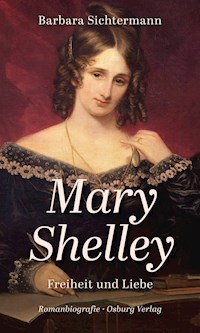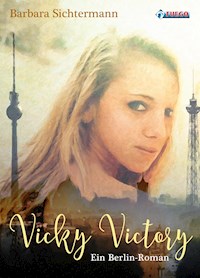Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Osburg Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Ära der Avantgarde an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war eine Zeit des Aufbruchs in allen Künsten und doch gaben immer noch die Männer den Ton an. Da betrat Anfang des 20. Jahrhunderts die Amerikanerin Isadora Duncan (1877 – 1927) die Bühnen der Welt. Sie war eine der Vorkämpferinnen für eine völlig neue Bewegungskunst. In Europa, wo das Ballett mit seiner übertriebenen Künstlichkeit bereits begann, sich Sympathien zu verspielen, empfing man sie mit offenen Armen. Duncan machte als Solotänzerin eine beispiellose Karriere. Ihre Auftritte hypnotisierten das Publikum, sie tanzte als Erste barfuß und in losem Gewand. Mit ihren Ideen stand Duncan nicht allein da. Sie lagen im Zug der Zeit, die sich zunehmend für Freikörperkultur, Wandern, Turnen und ähnliche Reformideen begeisterte. Sie verstand sich als Feministin. Als Duncan ihre Tochter Deirdre geboren hatte, kam es für sie nicht in Frage, mit deren Vater Gordon Craig die Ehe einzugehen. Wegen dieses für die damalige Zeit skandalösen Lebenswandels entzogen ihr empörte Berliner Gönner die Zuwendungen für ihre dortige Tanzschule. In Paris, wo nicht selten tausende Zuschauer ihren Darbietungen folgten, konnte sie freier leben. Sichtermann und Rose beschreiben die ganz und gar einzigartige Lebensgeschichte der "Göttlichen" in Form einer Romanbiografie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Sichtermann · Ingo Rose
Der blaue Vorhang
Isadora Duncan. Ihr Leben, ihr Tanz
Romanbiografie
Erste Auflage 2021© Osburg Verlag Hamburg 2021www.osburgverlag.deAlle Rechte vorbehalten,insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortragssowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen,auch einzelner Teile.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziertoder unter Verwendung elektronischer Systemeverarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.Lektorat: Bernd Henninger, HeidelbergKorrektorat: Mandy Kirchner, WeidaUmschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, HamburgSatz: Hans-Jürgen Paasch, OesteDruck und Bindung: CPI books GmbH, LeckPrinted in GermanyISBN 978-3-95510-260-9eISBN 978-3-95510-266-1
Inhalt
IDie Eroberung des großen Publikums
IIDie Quellen der Kunst
IIIDie Schule und die Begegnung mit Craig
IVAuf Tournee und die Begegnung mit Singer
VEin Eheversuch und ein furchtbarer Unfall
VIDer Krieg und die Marseillaise
VIIRussland und die Begegnung mit Jessenin
VIIIDie Botschafterin der Revolution
IXDie letzten Jahre
Epilog
Editorische Notiz
Literatur
Abbildungsnachweis
IDie Eroberung des großen Publikums
Die Pariser Weltausstellung im Sommer 1900 bot viele grandiose Neuheiten, von denen etliche im zwanzigsten Jahrhundert ganz selbstverständlich zum Alltag gehören würden, darunter die Rolltreppe, der Dieselmotor und die Untergrundbahn. Mit der großen Industrie- und Kulturenschau sollte zum Höhepunkt der Belle Époque eine Bilanz des Jahrhunderts gezogen werden. Auf einem Fahrsteig aus Holz konnten die Besucher das gesamte Ausstellungsgelände umrunden, ein typisches Schweizer Dorf war aufgebaut worden und auch eine kambodschanische Grotte, chinesische Pagoden und tunesische Bazare. Eine komplett neue Brücke über die Seine wurde eingeweiht. Und ein Riesenrad mit hundert Metern Durchmesser stand auch noch da.
Auf dem Marsfeld und der Place du Trocadéro, im Bois de Vincennes und auf der Esplanade des Invalides waren nicht nur technische, sondern auch künstlerische Sensationen zu bewundern. Die Brüder Lumière führten die ersten bewegten Bilder vor, der Bildhauer Auguste Rodin hatte seinen eigenen Pavillon, in dem erstmals fast alle seine Werke gezeigt wurden, und eine amerikanische Performerin namens Loïe Fuller faszinierte durch eigenartige »Lichttänze«. Es gab nun noch eine Persönlichkeit, die als Verwandlerin, Neuerin, ja Revolutionärin einer erstarrten Kunstform auftreten sollte – sie war auf der Weltausstellung allerdings nur im Publikum anwesend. Die 23-jährige junge Frau stammte aus Kalifornien, sie war über London nach Paris gereist, um die Welt kennenzulernen. Und die Kunstform, die sie ganz und gar neu erfinden und bekannt machen sollte, war der Tanz. Sie hieß Isadora Duncan.
Zeitgleich mit der Weltausstellung und in ihrem Rahmen fanden die Olympischen Spiele statt. Es waren die zweiten der Neuzeit. Allerdings nahm niemand sie gebührend zur Kenntnis, ja, sie sind im Trubel der Exposition Universelle regelrecht untergegangen. Nicht einmal Isadora Duncan, die es während der Sommermonate fast täglich zum Areal der Ausstellung zog, nahm von den Sportereignissen Notiz. Das verwunderte ihren Begleiter Charles Edward Hallé, einen englischen Maler, den Isadora von London her kannte und der zur Weltausstellung nach Paris gereist war. Er traf seine Freundin im Pavillon Rodin und küsste ihr erfreut die Hände.
»Ich habe Sie im Sportstadion vermutet«, sagte er. »Aber wie ich sehe, ziehen Sie die Skulptur dem lebendigen Körper vor.«
Isadora lachte. »Darüber müssen wir reden. Schauen Sie sich die Halslinie dieser Plastik an, lieber Charles, ist sie etwa nicht lebendig? Und schön dazu? Die schwitzenden Körper der Athleten, die um die Wette rennen und aus ihrer Muskulatur Werkzeuge machen, die ihnen irgendeinen Sieg bescheren sollen, interessieren mich überhaupt nicht …«
»Aber die Olympiade«, unterbrach Hallé, »ist doch eine griechische Idee! Die muss Sie doch begeistern. Haben Sie mir nicht in London immer wieder erklärt, dass es die alten Griechen seien, die mit ihrer Demokratie, ihrer Philosophie und ihren Künsten schlichtweg als Vorläufer unserer Zivilisation gelten müssen – sogar der amerikanischen?«
»Ach, Charles«, Isadora legte eine Hand auf Hallés Schulter, »Sie haben völlig recht und auch wieder nicht. Die Alten haben gewusst, was Schönheit ist und wie man sie hervorbringt, weil sie wussten, was Natürlichkeit ist. Ich war im Frühjahr Tag für Tag im Louvre und habe mir die griechischen Vasen mit den Abbildungen tanzender menschlicher Körper angesehen. Was für eine Vollendung der Form! Welch einfache Eleganz! Aber wir heute? Schauen Sie sich um, lesen Sie die Zeitungen. Überall wird gewetteifert, es geht nur um Preise, um Titel, um den ersten Platz. Um schnöden Mammon! Um Banalitäten. Wäre das im Sinne der Griechen? Ich glaube nicht.«
Hallé nickte. »So kenne ich Sie, Isadora, immer in Grübeleien versunken: Wie nur finden wir zurück zu den Griechen …«
»Auf keinen Fall durch solche Fetische wie Medaillen und Siegertreppchen.«
»Kann es sein, dass Sie die Antike idealisieren?«
»Ja, das kann sein. Aber ich brauche dieses Ideal für meine Kunst. Sie müssten das doch verstehen – mit Ihrer Loyalität zu den Präraffaeliten! Übrigens: Haben Sie Winckelmann gelesen?«
Mit Hallé konnte Isadora über all das reden, was ihr tagein, tagaus durch den Kopf ging, was ihre Gedanken beherrschte und sie unablässig ebenso quälte wie beseelte. Sie war eine Tänzerin. So sagte man, und so sagte sie auch selbst, vor allem, wenn sie sich um Auftritte bewarb, weil sie Geld brauchte. Aber immer wieder hat sie sich auch entschieden dagegen verwahrt, als Tänzerin bezeichnet zu werden. Denn dadurch, fand sie, würden falsche Assoziationen geweckt. Ein junges Mädchen in leichtem Gewand, das sich hin und her wiegt und den Umriss seines Körpers sehen lässt, das die Beine wirft und dann womöglich noch Kusshände ins Publikum – mit solchen frivolen Gesten wollte sie rein gar nichts zu tun haben. Ihr ging es um ganz etwas anderes: um den persönlichen Ausdruck des inneren Erlebens eines Menschen durch den Körper. Sie wollte das Leben selbst durch Bewegung zur Kunst erhöhen. Nein, darunter machte sie es nicht. Sie hatte schon als Kind getanzt, und immer weiter ihre ganze Jugend hindurch. Sie hatte sich angesehen, was Tanz zu ihrer Zeit in Amerika und anderwärts bedeutete und war entsetzt: das Ballett und auch der Gesellschaftstanz, alles fußte auf eingelernten, stets sich wiederholenden Bewegungen, die äußerlich, einfallslos und rigide waren, und waren sie weich, dann lasch und passiv. Letztlich beruhten sie auf Drill, auf Zwang, auf Beherrschung; vor allem das Ballett züchtete Körper, die funktionierten wie Marionetten. Der Spitzentanz beruhte auf der Vision eines von der Schwerkraft befreiten Körpers – aber war nicht in Wahrheit der Körper der Schwerkraft anheimgegeben, ihr ebenso überantwortet wie der Luft, die ihn durchatmete und musste nicht neben der Lust zu fliegen erst recht die Lust zu fallen und das eigene Gewicht zu fühlen, in den Tanz eingehen? Wo waren die natürliche Anmut, die Isadora hätte bewundern wollen, wo die edle Einfalt und stille Größe, die der deutsche Archäologe Winckelmann den alten Griechen zuschrieb? Was der Tanz der Gegenwart schuldig blieb, war, fand Isadora, der Fluss, die Zeitlichkeit, das Wissen und Zeigen, dass jede Bewegung einen Grund, eine Quelle, eine Herkunft hat und zu einer neuen Bewegung führt und von da zur Einheit, zur Höhe, zum Wesen, zur zweiten Natur. Was der Tanz zu ihrer Zeit schuldig blieb, war die Einsicht, dass sich überraschende, überwältigende, erhabene Gestalten ergeben, wenn nur der tanzende Mensch seine Seele ganz in den Körperausdruck fließen lässt. »Unter den tausenden von Figuren«, so notiert es Isadora später in ihren Memoiren, »die uns auf den griechischen Vasen und Reliefs überliefert sind, findet sich nicht eine, deren Bewegung nicht bereits eine andere Bewegung voraussetzte. Die Griechen waren eben außerordentliche Beobachter der Natur, in der alles der Ausdruck nie endender, ewig sich steigernder Entwicklung ist, in der es nie ein Ende, nie ein Einhalten gibt.« Einen solchen humanistischen Tanz, der wie eine Meereswelle sich aus sich selbst unentwegt entwickelt, wollte Duncan kreieren und lehren, sie hatte schon bei sich damit begonnen. Auch die Erscheinung der Tänzerin musste sich unbedingt ändern. Die Seidenschläppchen der Ballerinen lehnte Duncan als geziert ab, ebenso den Tüllrock und die Schnürbrust. Sie tanzte barfuß in einem losen Überwurf, ging es ihr doch um die größtmögliche Freiheit auch und gerade des Körpers. In den Londoner Zirkeln und Salons der Bohème und der Aristokratie hatte sie ihre Kunst im privaten Rahmen ein- und vorgeführt und auf Schauspielerinnen, Kunsthistoriker, Mäzeninnen und interessierte Laien tiefen Eindruck gemacht. Die ersten Kritiken waren erschienen, die meisten äußerten sich lobend. Künstler wie Hallé sahen in Isadoras Tanz einen avantgardistischen Ausdruck und feuerten sie an. Sie war, wie es schien, auf einem guten Weg – aber doch noch weit davon entfernt, ihre künstlerischen Ambitionen sozusagen in Großbuchstaben an den Horizont ihres Lebens schreiben zu können. Sie war immer noch eine Suchende, sie zermarterte sich das Hirn: Was ist es, das ich der Welt geben kann, geben muss? Wie kann ich das große Ziel fassen und einfach erläutern? Es genügte ihr nicht, tanzend etwas Neues zu erschaffen, sie musste auch die dazu passende Philosophie entwerfen. »So bin ich nun mal – cérébrale (= intellektuell)!«, sagte sie halb lachend aber doch ernst zu Hallé. Was sie nicht wollte, wusste sie genau. Und ihre Visionen, ihr Ehrgeiz – die gingen noch viel weiter als alles, was sie einstweilen tänzerisch oder mit Worten auszudrücken vermochte. Im Grunde wollte sie die ganze Welt aus Korsetts, Konventionen und starren Formen erlösen, wollte wie der deutsche Philosoph Karl Marx, den sie in London gelesen hatte, »die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen zwingen«. Um darüber nachzudenken, war die Weltausstellung in Paris genau der richtige Ort und Charles Hallé der richtige Gesprächspartner. Sie trafen sich täglich und umwanderten nach und nach die gesamte Exposition Universelle.
Hallé war ein Mann in den Fünfzigern, als Maler im Stile der Präraffaeliten erfolgreich und wie die meisten Männer, denen sich Isadora in ihrem Ringen um das Besondere ihrer Kunst anvertraute und mit denen sie eine Art Gesprächsbeziehung (»cérébrale«) begann und durchhielt, von väterlichen Gefühlen für die attraktive Amerikanerin erfüllt. Zugleich aber war er darauf bedacht, ihr klarzumachen, dass nicht alle Männer in der Welt so ritterlich und zurückhaltend waren wie er.
»Das Erotische werden Sie aus Ihrer Tanzdarbietung nie heraushalten können, zumal Sie …«, und er verschluckte ein Kompliment.
»Das will ich ja auch gar nicht. Das Erotische ist das Göttliche, das Dionysische, und natürlich soll es sich vermitteln. Aber nicht in der billigen Version einer Hupfdohle, die Ausschnitt zeigt, damit die Männer in der ersten Reihe einen Geldschein reinstecken. Das wäre mir zutiefst zuwider. Sie verstehen …«
Hallé verstand sie genau, wusste aber auch, wie schwer es sein würde, das Publikum, zumal das männliche, dazu zu bringen, ihre Shows nicht nur wegen der Schönheit der Performerin zu besuchen, denn dieses Mädchen hatte einen wahrhaft vollkommenen Körper und ein Gesicht wie ein Engel. Ihr langer, biegsamer Hals betonte ihre Zartheit, die kräftigen Schenkel ihre Erdverbundenheit. Natürlich kamen die Männer, um dieses Wunderwesen umherspringen zu sehen – und die Frauen auch, wollten sich vielleicht etwas abgucken, diese Gebärde oder jene Frisur. So waren die Menschen nun mal, die meisten nicht zu Höherem berufen.
»Doch!«, beharrte Isadora. »Alle sind zu Höherem berufen. Könnte ich die Welt nur tanzen lehren … Was meinen Sie, Charles, wäre wohl Auguste Rodin bereit, mich persönlich zu empfangen? Können Sie sich das vorstellen?«
Fast hätte Hallé gesagt: ›Aber sicher, meine Liebe‹, doch er biss sich auf die Lippen und murmelte nur:
»Erfreuen Sie sich an seiner Kunst. Der Mann ist ein ziemlich alter Knochen. Älter noch als ich. Und sein Umgang mit Damen –«
Isadora machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Das ist mir egal. In seinen Plastiken erkenne ich alles wieder, was mir lieb und teuer ist – das Schönheitsideal der Griechen, Leidenschaft und Ekstase. Schon beim ersten Anblick seiner Kunst war ich überwältigt. Sagen Sie: Könnte es nicht sein, dass ich für ihn ein interessantes Modell wäre? In einer meiner besten Posen, so etwa …« Und sie reckte die Arme himmelwärts und ließ den Kopf ganz tief in den Nacken fallen.
»Ja, wahrscheinlich«, knurrte Hallé und nestelte an seiner Brieftasche. »Warten Sie, Isadora, ich gebe Ihnen hier die Karte meines Neffen Charles Noufflard. Wenn Sie einverstanden sind, bitte ich ihn, sich Ihrer hier ein wenig anzunehmen. Er heißt Charles wie ich, aber er ist jung und unternehmungslustig. Ich muss demnächst zurück nach London.«
Isadora nahm die Karte und las den Namen mit einem Gefühl der Dankbarkeit und Freude. Sie hatte es nicht offen zugeben mögen, aber einstweilen war es ihr noch nicht gelungen, in Paris als Künstlerin Fuß zu fassen. Jeder neue Kontakt war wichtig, denn er konnte zu einem Engagement führen. Miss Duncan lebte derzeit, zusammen mit ihrer Mutter, bei ihrem Bruder Raymond – in einem Atelier in der Avenue de Villiers. Wie auch zuvor schon in London wohnten die drei in einem einzigen Raum, der ihnen als Studio und Unterkunft diente, möbliert mit nichts als einem Klavier und drei Matratzen, die tagsüber an die Wand gelehnt wurden, damit Isadora Platz zum Tanzen hatte. Außerdem gab es noch ein paar Kisten mit Büchern, Kleidung, persönlichen Sachen und Isadoras Tuniken. Aufgebrochen war die ganze Familie, der ›Duncan-Clan‹, wie sie sich selber nannten: die Mutter mit Tochter Elizabeth, den Söhnen Augustin und Raymond sowie Nesthäkchen Isadora im Jahre 1895 aus ihrer Heimatstadt San Francisco. Isadora war am 26. Mai 1877 auf die Welt gekommen, achtzehn Jahre war sie alt, als sie Kalifornien verließ. Zunächst ging es nach Chicago und New York und drei Jahre später nach Europa. Was der Clan suchte, war die Kunst: Mutter Dora als Pianistin, Augustin als Schauspieler, Raymond als Rezitator und Performer, Elizabeth als Organisatorin und Isadora auf der Tanzbühne. Sie lebten und arbeiteten quasi als ›fahrendes Volk‹, immer von der Hand in den Mund, wobei Isadora bei Schauspiel- und Musicalproduktionen sowie bei Solo-Auftritten in Salons und auf Kleinkunstbühnen das meiste Geld verdiente. In New York gehörte sie sogar einer renommierten Truppe an, die Operetten, Tanzabende und Shakespeares Komödien herausbrachte, es gab Erfolge. Aber die Gagen waren bescheiden, es war nie etwas übrig geblieben, um einen Fonds anzulegen für knappe Zeiten. Und gerade jetzt wieder wussten die Duncans nicht, wie es weitergehen sollte.
Die Duncans – das waren im Jahre 1900 nur noch die Clanmutter Mrs Duncan, Sohn Raymond und Isadora. Die beiden anderen waren in die Staaten zurückgekehrt, Augustin, weil er drüben ein Mädchen hatte und heiraten wollte, und Elizabeth, weil sie eine Tanzschule führen und Geld verdienen konnte. Aber Isadora kannte keine Angst vor der Armut, und ihre Mutter war nichts anderes gewohnt. Raymond, Hobby-Philosoph und stets bereit, aus einem der Bücher, die er bei sich trug, zu rezitieren, machte aus dem Mangel eine Übung und wurde praktizierender Asket. Hin und wieder hungerten die Duncans tatsächlich. Wie Epikur konnten sie sich an einer einfachen Mahlzeit erfreuen, doch wenn sich ihnen ein üppig gedeckter Tisch bot, waren sie nicht weniger entzückt. Dasselbe Verhältnis pflegte die Familie zu Geld und dem Umgang damit. War es vorhanden, wurde es mit vollen Händen ausgegeben, auch wenn es hieß, dass übermorgen nichts zu essen da sein würde und die Miete nicht bezahlt werden konnte. Als dürfte das Geld nicht an ihnen haften bleiben. Hauptsache war immer, dass die geistige Nahrung nicht ausging. Und hätte jemand zu Isadora gesagt: Vom Geist allein kann man doch nicht leben, so hätte sie, den Kopf in den Nacken werfend, geantwortet: »Doch, ich schon! Auf das Frühstück kann ich verzichten, aber nicht auf meine Lektüre und meinen Tanz.«
Die Weltausstellung bot eine Attraktion, für die sich Isadora beruflich interessierte. Aber bis jetzt hatte sie sich noch nicht hingetraut, denn alles, was sie darüber zu hören bekam, schürte in ihr eine gewisse Furcht. Es könnte ja sein, dass sie, wenn sie Loïe Fuller tanzen sah, ihre eigene Kunst plötzlich nicht mehr wertschätzte und sich neben der Lichttänzerin, wie man sie nannte, klein und hässlich fühlte … Aber das war nur der eine, wenn auch letztlich wichtigste Grund, warum Isadora zu Loïe Fuller noch auf Abstand geblieben war. Es gab weitere Bedenken. Die ältere Kollegin, die wie sie aus den Staaten stammte, war Stargast bei den Folies Bergère, einem Varieté-Theater von der Art, wie Isadora es instinktiv ablehnte. Dass auch die berühmte Tänzerin Caroline Otéro, Kurtisane mehrerer gekrönter Häupter und großer Künstler, jahrelang dort aufgetreten war, sprach für sich. Es war kein Ort für Isadoras Kunst, so wie sie es sah: zu sehr Revue und grand spectacle und womöglich Can-Can, auch war das Etablissement als bester Liebesmarkt der Stadt bekannt, da die schönsten Prostituierten hier Freikarten erhielten. Was konnte ihr der Kontakt zu Fuller schon anderes bringen, als Auftritte auf so einer Bühne? Wollte sie das? Schließlich siegte die Neugier. Isadora ging in die Vorstellung. Und war begeistert.
»Was für ein außerordentlicher Genius!«, schrieb sie in ihren Erinnerungen. »Was sie macht, kann man nicht wiederholen, und man kann es nicht beschreiben. Sie war ganz Licht, ganz Farbe. Sie verwandelte sich vor den Augen ihres Publikums in tausend bunte Imaginationen, in vielfarbige leuchtende Orchideen, in eine wogende, fließende Seeanemone und schließlich zu einer spiralförmigen Lilie. Völlig verwirrt und überwältigt von dieser einzigartigen Künstlerin ging ich nach Hause.«
Wichtigstes Hilfsmittel für Fuller und ihren Tanz waren riesige Stoffbahnen, die derart am Körper der Tänzerin befestigt waren, dass sie sie hin und her bewegen und dabei in runde Wogen, spiralförmige Wellen oder kelchartige Aufbauschungen übersetzen konnte. Die Tänzerin war der äußerst gelenkige Impulsgeber; was den Raum ausfüllte und das Auge des Betrachters fesselte, war eine ganz neue Erscheinung: Massen sich überschlagender und ineinander verschlingender Draperien, die weit über das Dekorative hinaus einen Eindruck von elementarer Wandlung weckten – als solle ein Stern aus dem Chaos geboren werden. Für diese außerordentliche Wirkung benutzte Fuller zur Verlängerung ihrer Arme leichte, aber lange Aluminiumstäbe, die mit den Stoffen verbunden waren und den Schwungbefehl ihrer Hände weitergaben.
Eine ausgefeilte Lichtregie war die andere tragende Säule der Show. Vor allem mit Licht drückte sich Loïe Fuller künstlerisch aus, nicht so sehr mit ihrem Körper: »Je sculpte de la lumière (= Ich forme Licht).« Sie verzichtete auf Kulissen, tauchte den Zuschauerraum in tiefes Schwarz, ließ elektrische Blitze von oben auf ihre Seidenflügel prasseln und bestrich ihre Textilien mit fluoreszierenden Substanzen. So zauberte sie nicht nur nie gesehene Wellenbewegungen in den Bühnenraum, sondern auch unglaubliche Farben und Reflexe. Ihr Beiname fée d’électricité weckte im Publikum einen leichten Schauder, denn noch war die Elektrizität im alltäglichen Gebrauch eine junge Errungenschaft und nie ganz ungefährlich. Fuller umgab sich mit Spezialisten, wollte aber selbst alles wissen und korrespondierte mit dem Physiker-Ehepaar Marie und Pierre Curie. Es entwickelte sich eine Freundschaft und Zusammenarbeit, und Fuller tanzte zur Verleihung des Nobelpreises an das Forscherpaar ihren Radium Dance. Zwar konnte man sie, wie Isadora schrieb, nicht wiederholen, aber man konnte versuchen, sie nachzuahmen. Fuller meldete Patente auf ihre Erfindungen an und prozessierte gegen die Diebinnen ihrer Ideen. Man nannte sie die Meisterin des Lichts, der Dramatiker und Künstler Jean Cocteau meinte gar, sie hätte das Phantom eines Zeitalters erschaffen.
Und noch einmal sprang Isadora in diesem großen Pariser Sommer über ihren Schatten. Sie schrieb einen Brief an Auguste Rodin und bat, ihn besuchen zu dürfen. Die Antwort kam postwendend und war positiv. Isadora küsste den Brief, drehte sich einmal um sich selbst und zog los. Sie wurde sogleich vorgelassen. »Ich tanze«, sagte sie, als sie sich vorgestellt hatte, »und ich habe mein Bewegungsideal in Ihren Skulpturen wiederentdeckt.« Sie hatte sich genau überlegt, was sie sagen wollte, und es vorher geübt, denn ihr Französisch war noch unvollkommen. Rodin führte sie herum und zeigte ihr seine aktuellen Arbeiten, viele davon waren wegen der Wärme mit feuchten Tüchern bedeckt, es duftete dumpf nach Ton und Lehm. Der Meister stand in seinem sechzigsten Jahr; er war stets geneigt, eine schöne Gestalt zu zeichnen, wenn sie ihm erschien. Also holte er seinen Skizzenblock hervor, nahm einen Stift und bat seinen Gast zu tanzen. Isadora legte ihr Schultertuch ab, zog ihre Schuhe aus, positionierte sich in der Mitte des Raumes und kreuzte die Hände vor der Brust. »Es ist nicht so einfach ohne Musik«, sagte sie, »aber es geht.« Dann tat sie ein paar kleine und größere Schritte, holte mit den Armen aus, als wollte sie die Luft zusammenschieben und machte einen Sprung. Ihr Kopf trudelte auf dem Hals, sie fiel auf die Knie. Und hob den Blick, die Schultern, die Hände, riss sich hoch und höher und schien über dem Boden zu schweben. Rodin ließ den Skizzenblock sinken. Er hatte schon so manche junge Frau tanzen sehen, aber so etwas noch nie. »Das ist phantastisch«, murmelte er.
Nach ihrer Darbietung, noch außer Atem, wickelte Isadora sich wieder in ihr Tuch und nahm neben einer Statue auf einem Hocker Platz. Beide schwiegen eine Weile. Dann begann Isadora zu dozieren. Der Meister musste einsehen, dass diese Frau nicht nur gekommen war, um sein Werk zu bewundern, sondern um ihn mit ihrer eigenen Kunst bekannt zu machen. Beeindruckt hörte er ihr zu. Isadora tat, was sie immer tat, wenn sie mit verständigen Menschen zusammentraf: Sie erklärte ihre Kunst, um sie selber besser zu verstehen. In ihrem gebrochenen Französisch, doch mit Emphase trug sie vor: »Einst war der Tanz die Quelle, die Urform des Rhythmus und der Poesie, der Mysterien und aller religiösen Feier. In ihm fanden alle Inspiration, alle Rauschelemente, das gesteigerte die Schöpfung fühlende Leben, einen anmutigen oder wilden Ausdruck. Und was ist er bei uns geworden? Sie sehen selbst, eine tiefgreifende Erneuerung ist vonnöten.« Jetzt wollte sie eigentlich auf die deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche zu sprechen kommen, hielt aber inne, da ihr Gegenüber sich erhob. Wie es weiterging, erzählt sie in ihren Lebenserinnerungen so: »Sein Blick glühte, während er mit dem gleichen Ausdruck, den er vor seinen Werken zeigte, auf mich zukam. Seine Hände strichen über meinen Nacken und meine Brust, er liebkoste meine Arme, streichelte meine Hüften, meine nackten Beine und Füße und begann, meinen ganzen Leib zu kneten, als wäre er aus Ton, wobei ihm eine Glut entströmte, die mich zu versengen drohte. Alles in mir verlangte danach, mich ihm völlig hinzugeben, und ich hätte es auch getan, wäre ich nicht aufgrund meiner Erziehung in Panik geraten, sodass ich mich zurückzog, eilig mein Schultertuch überwarf und ihn in zittriger Verwirrung zurückließ.«
Und sie ergänzte später: »Wie sehr ich dies heute bedauere! Oft habe ich den kindischen Unverstand bereut, der mich um das göttliche Erlebnis gebracht hat, dem erhabenen Rodin – dem großen Pan selbst – meine Jungfräulichkeit zu schenken.« Auguste Rodin aber nahm nichts krumm. Er besuchte zwei Jahre später eine von Isadoras Vorstellungen, anerkannte sie als eine ihm ebenbürtige Künstlerin und schrieb über sie:
»Isadora Duncan ist scheinbar mühelos zur Skulptur, zum Gefühlsausdruck gelangt. Diese Kraft schöpft sie aus sich selbst, eine Kraft, die nicht Talent zu nennen ist, sondern Genie. Miss Duncan bringt das Leben an sich in den Tanz ein. Auf der Bühne ist sie natürlich, was man sonst selten erlebt. In ihrem Tanz hat sie Sinn für die Linie und ist schlicht wie alles Antike, das ein Synonym für die Schönheit ist. Gelenkigkeit und Gefühlsausdruck, sie besitzt diese großen Qualitäten, die das Wesen des Tanzes selbst ausmachen. Es ist die vollkommenste, die höchste Kunst.«
Erzogen wurde Isadora von ihrer Mutter – und den drei älteren Geschwistern. Als Kind nannte man sie Dorita. Die Atmosphäre im Hause Duncan war freimütig und freundlich, die Wohnung stets von Musik erfüllt, denn Mutter Dora, von Beruf Klavierlehrerin, spielte täglich lange Stunden Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms und Chopin. Der Vater hatte die Familie noch vor Doritas Geburt verlassen; von Beruf war er eine Art Glücksritter, mehr als ein Vermögen hatte er durch spekulative Anlagen gewonnen und wieder verspielt. Mrs Duncan etablierte in ihrem Zuhause ein mildes Matriarchat, sie bemühte sich unablässig, der Deklassierung, die ihre Familie infolge von Scheidung und Verarmung erlitten hatte, durch Übungen in kultureller Verfeinerung entgegenzuwirken. Kaum konnte die Jüngste lesen, traktierte Bruder Raymond sie mit den altgriechischen Dramatikern und später mit deutscher Philosophie. Innerhalb der Familie bemühte man sich um Grundkenntnisse der deutschen Sprache, mit sechzehn studierte Isadora das Original von Heinrich von Kleists Aufsatz Über das Marionettentheater. Schwester Elizabeth lehrte sie tanzen und brachte ihr die Ideen des Bewegungspädagogen François Delsarte nahe. Dessen oberstes Prinzip hieß ›Natürlichkeit‹! Bruder Raymond entwickelte eine dem täglichen Leben abgeschaute Bewegungstheorie (Kinematics), in die er Isadora einweihte. Pure Bildungsbeflissenheit war es nicht, die bei den Duncans herrschte, eher eine echte Liebe zum Guten, Schönen und Wahren. Aber der kleine Clan war meistens klamm; man schickte die niedliche Dorita zum Metzger, um Wurstzipfel gratis zu ergattern, auch zum Konditor, wo sie Altgebäck umsonst erhielt. Sie erfüllte solche Aufgaben mit Freude, sie schämte sich nicht, verkaufte auch auf der Straße Selbstgestricktes ihrer Mutter und bekam noch einen Extrapenny von gerührten Passanten. Die Schule schmiss sie mit elf. Zu Hause aber las sie viel und tanzte zu Mozart. So also wuchs Isadora ärmlich, aber mit lauter hehren Idealen auf; sie wurde nie gedrängt oder genötigt, sich künstlerisch und philosophisch zu bilden, sie tat es ganz von allein, wie die Geschwister auch. Ihrem Vater ist sie nur ein einziges Mal begegnet; die Mutter sprach nicht gut über ihn, auch eine Eheschließung empfahl sie ihren Kindern keineswegs. Bei Isadora verfing Kritik an jeder Art von Zwang und Kontrolle unmittelbar, sie war ein rebellisches Kind. Aber ihre Auflehnung galt den sozialen, religiösen und ästhetischen Normen ihrer Zeit, nicht der Familie. Im Gegenteil, ihre Angehörigen sahen die Welt wie sie, waren geschlossen kunstbesessen und antikirchlich, das Zuhause mit seinen beständigen Angeboten in Sachen Bildung stets ein sicherer Rückzugsort für alle. Früh schwor sich Isadora, niemals zu heiraten. Was hingegen die Sexualmoral betrifft, so kam selbst die unkonventionelle Mrs Duncan nicht gegen das puritanische Amerika an – man sprach nicht gern über »diese Dinge« und umschrieb sie auch im Hause Duncan mit allerlei Metaphern und Mehrdeutigkeiten. Eros war zwar eine beliebte Gottheit und auch Dionysos wurde gerne angerufen, aber nur als Idee, nicht als Praxis. So kam es, dass die zur Tanzrevolution entschlossene Isadora während ihrer ersten Jahre in Europa noch Jungfrau war.
Als sie an jenem denkwürdigen Abend nach dem Besuch bei Rodin zu Hause ankam, empfing Raymond sie mit einem gelinden Vorwurf. Sie solle sich doch bitte dazu entschließen, mal einen Tag daheimzubleiben, denn jetzt sei es schon das dritte Mal geschehen, dass ein gewisser Monsieur Noufflard erschienen sei und nach ihr gefragt habe. »Ach ja«, murmelte Isadora, »Hallés Neffe. Ich werde ihn morgen erwarten.« Und sie erzählte von Rodin. Seine erotische Attacke überging sie. »Er hat mich gezeichnet. Und er hat mich verstanden. Vielleicht werde ich als Skulptur von seiner Hand unsterblich.« Sie war sehr stolz. Raymond legte den Arm um sie. Und die Mutter brachte einen Teller mit Oliven und Brot. Heute Abend würde es nichts anderes mehr geben.
Charles Noufflard kam am nächsten Tag wieder; er brachte zwei Freunde mit, den jungen Maler Jacques Beaugnies und den angehenden Schriftsteller André Beaunier. Die drei wurden bald regelmäßige Gäste im Studio in der Avenue de Villiers, sie genossen die Atmosphäre der Freizügigkeit bei den Duncans, das Klavierspiel der Mutter und die Tänze Isadoras. Sie brachten Blumen, Obst, Brot und Quiches und sprachen viel über die Weltausstellung, die Kunst Rodins, die große japanische Schauspielerin Sada Yacco, die gerade Furore machte, über Richard Wagner und die Festspiele in Bayreuth, über die Affäre Dreyfus und den Symbolismus. Und schließlich geschah, was Isadora sich erhofft hatte und worauf auch Mrs Duncan und Raymond warteten: Jacques Beaugnies sprach eine Einladung aus. Seine Mutter führte einen prominenten Salon, und sie würde sich glücklich schätzen, wenn Isadora dort aufträte und für ihre Gäste eine Tanzvorstellung gäbe.
»Ich habe ihr geschildert, wie originell und großartig Sie sind, Isadora. Und sie vertraut meinem Urteil. Ein Pianist ist vorhanden, er spielt, was Sie brauchen. Und lässt fragen, ob Sie auch zu Debussy tanzen würden?«
»Ich fürchte, für eine neue Komposition müsste ich erst längere Zeit proben. Aber sagen Sie mir doch, lieber Jacques, werde ich die Gäste Ihrer Frau Mutter zufriedenstellen? Sie wissen ja wohl, was das für Leute sind und können sie einschätzen. Es gibt immer noch Personen von Stand, die es ungebührlich finden, wenn eine Frau barfuß tanzt. Zu schweigen von meiner kurzen Tunika …«
Beaugnies lachte. »Es kann durchaus sein, dass einige der Habitués von gestern sind und sich empören, insbesondere deren Gattinnen. Ich garantiere für nichts. Aber bitte, Isadora, Sie wollen die Revolution in und mit Ihrer Bewegungskunst, dann müssen Sie auch riskieren, dass man Sie verhaftet.«
Mrs Duncan machte große Augen, aber Jacques beschwichtigte sie. »Kommen Sie doch auch mit, verehrte Mrs Duncan, und Sie werden sehen, dass Ihre Tochter einen Triumph feiert.«
Und so geschah es. Isadora wurde als die umwerfendste Erscheinung seit Delacroix’ Marianne apostrophiert. Der Maler Eugène Carrière nannte sie ein Wunder, auf das die Welt gewartet habe, er schrieb über sie: »Sie denkt an die Griechen und gehorcht ihrem inneren Selbst.« Der Dramatiker Victorien Sardou schloss sie in die Arme und flüsterte: »Nehmen Sie sich in Acht! Sie fordern die Götter heraus …«, und der Komponist André Messager, der sie am Klavier begleitete, sagte schlicht: »Du bist adorable (= anbetungswürdig).« Wie stets hielt Isadora im Anschluss an ihre Darbietung einen kleinen Vortrag: »Sie sagen, ich bewege mich natürlich. Aber wissen Sie auch, was das bedeutet? Es bedeutet, dass ich mein Instrument, den Körper, genauestens studiert habe, denn er ist die Basis von aller Natur, um die es im Tanze geht. Und weit darüber hinaus! Man kann kein Bewusstsein von Schönheit haben, kein Bewusstsein von der Schönheit unserer Erde und unserer Wahrnehmung von ihr, ausgedrückt in Architektur, Malerei, Skulptur und allen anderen Künsten, ohne ein Bewusstsein vom Körper zu besitzen, seiner Linien und Symmetrie, seiner Proportionen und edlen Formen …« Alle lauschten ergriffen, die nächste Einladung ließ nicht auf sich warten. Der Prinz Edmond de Polignac samt Frau, die Gräfin Greffulhe, die Herzogin d’Uzès erbaten sich den Vorzug, das waren die ganz großen Namen. Isadora zog, wie im Vorjahr in London, durch die Salons von Paris und gewann Herzen und Sinne eines verwöhnten und anspruchsvollen Publikums. Die Gagen waren bescheiden, obwohl ihre Gönner sehr reich waren – Madame de Polignac war die Mäzenin Winnaretta Singer, Tochter des millionenschweren Nähmaschinenkönigs –, aber es langte für die Miete und für das eine oder andere Festmahl. Mutter und Bruder waren zufrieden, und Isadora selbst war jetzt bereit, sich mehr zuzutrauen. Sie würde Privatvorstellungen in ihrem eigenen Studio geben, und sie würde Loïe Fuller aufsuchen, um sie zu bitten, ihre Beziehungen spielen zu lassen. Ihr schwebte die ganz große Bühne vor.
»Was meinen Sie?«, fragte sie Jacques. »Könnte ich auf der Opernbühne überzeugen? Ich denke da an einen Saal mit tausend Plätzen. Und ich allein auf den Brettern – mit nichts als einem Piano und meinen blauen Vorhängen, Sie wissen schon, die, die ich selbst genäht habe. Würde meine Kunst vor so einem Publikum bestehen können?«
Beaugnies runzelte die Stirn. »Das kann ich nicht sagen, man müsste es ausprobieren. Womöglich – ja! Sie sind eine Novität. Sie erregen die Gemüter. Ich glaube an Sie.«
Isadoras Blick schweifte durch das Studio und blieb an dem jungen Schriftsteller André Beaunier hängen, der am Fenster saß und las. »Kommen Sie«, rief Isadora, »lesen Sie uns vor!«
Beaunier blinzelte. »Interessieren Sie sich für Maupassant?«
»Aber ja, natürlich. Kommen Sie, André, ich möchte Ihre Stimme hören. Und wenn Sie mir einen ganz großen Gefallen tun wollen, geben Sie mir eine Französisch-Lektion.«
Unter ihren Verehrern Noufflard, Beaugnies und Beaunier wählte Isadora den unansehnlichsten, den klein gewachsenen, rundlichen, bebrillten André als ihren Favoriten aus, denn er war von allen dreien am meisten cérébrale. Lange Stunden las er ihr vor – Flaubert, Gautier und Maeterlinck und auch aus eigenen Werken. Streng als Sprachlehrer, hochkonzentriert als Zuhörer war er unermüdlich als Diskussionspartner, und Isadora freute sich über diese neue erfüllende Gesprächsbeziehung, die sie zunehmend korrekt auf Französisch führen konnte. Aber sie wunderte sich auch, dass der Freund auf ihre tastenden Versuche, ihn zu einer anderen Art von Beziehung aufzufordern, niemals einging. Sie nahm beim Spaziergang seine Hand, er zog sie bald zurück. Sie setzte sich nach der Vorführung einer neuen Tanzfigur neben ihn auf die Matratze – er erhob sich. Sie erlaubte sich zum Abschied einen Kuss auf seine Wange, er zuckte zurück. Was war da los? Gefiel sie ihm denn gar nicht? Er kam doch immer wieder. Eines Abends besorgte Isadora für Raymond und die Mutter Opernkarten, und als die beiden außer Haus waren, zog sie eine seidene Tunika an und arrangierte eine Kiste mit weißem Tischtuch, Blumenschmuck und allerlei Leckereien, dazu eine Flasche Veuve Clicquot. Wie abgemacht traf André ein, aber statt sich mit ihr zu Tisch zu begeben, trat er ans Fenster, holte ein Taschentuch hervor und begann zu schluchzen.
»Was in aller Welt ist geschehen?«, fragte Isadora.
André brauchte eine Weile, bis er sprechen konnte. »Oscar Wilde ist gestorben.«
»Oh. – Ich weiß, er ist ein herausragender Dichter. Das Bildnis des Dorian Gray. Aber ich wusste nicht, dass Sie ihn kannten –?«
André wandte sich um, erblickte die Kiste mit dem weißen Tuch, die Champagnerflasche und die Blumen im Haar seiner Freundin. »Adieu«, sagte er mit tränenerstickter Stimme und ging rasch hinaus.
Erst im Rückblick begriff Isadora. André kannte Oscar Wilde nicht persönlich, natürlich nicht, trauerte aber um ihn, weil er sich ihm nahe fühlte, denn er liebte wie der irische Dichter die Angehörigen seines eigenen Geschlechts. Er war ein »Uranier«, wie man damals sagte. Was ihn nicht daran hinderte, Freundschaften mit kultivierten Frauen zu pflegen, doch körperliche Nähe suchte er zu ihnen nicht. Isadora, die das nicht wusste, fühlte sich verschmäht und grollte. Die nächsten Abende ließ sie André links liegen und widmete sich dem gut aussehenden, liebenswürdigen Charles Noufflard. Diese Geschichte ging genauso enttäuschend aus wie die mit André, nur dass die Umstände sozusagen spiegelverkehrt gelagert waren. Charles, der sich zunehmend dazu ermuntert fühlte, führte Isadora in ein Etablissement mit Champagner-Souper und chambre séparée, und als er sie umarmte und küsste und den Gürtel ihres griechischen Gewandes löste, machte sie den Fehler, ihm zu gestehen, wie lange sie schon auf diesen Augenblick, auf die Liebe überhaupt, gewartet habe. Der Erste – nein, der wollte Charles nicht sein. Bestürzt hielt er inne und bat sie, sich wieder anzuziehen. Vielleicht dachte er auch an seinen Onkel, der bei seinem Ersuchen an ihn, sich Isadoras anzunehmen, sicher kein Séparée im Sinn gehabt hatte. »Du musst rein bleiben«, flüsterte er und half ihr mit den Schuhen. Isadora war den Tränen nahe. Sie zitterte am ganzen Leibe und verstand die Welt nicht mehr. Später, allein in der Nacht, dachte sie: ›Was die Männer mir verweigern, muss meine Kunst mir geben. Es soll wohl so sein, dass nur sie meine Liebe erwidert.‹ Tags darauf besuchte sie Loïe Fuller.
La Duncan wurde im Laufe des Jahres 1901 zu einem Geheimtipp unter den Pariser Freunden einer neuen Tanzkunst, Fuller hatte ihren Namen schon öfter gehört und war erfreut, sie zu treffen. Isadora tanzte für sie und überraschte sie. »Ich wusste nicht, dass so ein Tanz möglich ist«, sagte Loïe, »Sie sind formidable. Möchten Sie mich nicht auf meiner Tournee im nächsten Jahr begleiten? Wir könnten gemeinsam auftreten.« Und in der Tat, obschon ihre Darbietungen ganz unterschiedlich waren, gab es manches, was die beiden verband. Fuller gab Unterricht, und sie folgte dabei denselben Prinzipien wie Duncan. Beiden kam es auf die Eigenart, die Individualität des tanzenden Menschen an, und das war etwas völlig Neues im Vergleich zur traditionellen Tanzerziehung. Die gab einen festgelegten Kanon von Techniken weiter, in dem, schlicht gesagt, alle dasselbe machten. Aber die Zeit hatte sich gegen die Tradition gekehrt. Der neue Tanz hatte mit dem Ballett nichts mehr zu tun. Er suchte die Freiheit. Er suchte, so wie Duncan ihn vormachte, das bewegte Bild, das entsteht, wenn der Körper seinem persönlichen Ausdrucksverlangen folgt. Er suchte nach Fullers Beispiel den Wirbel, die Welle, den Feuerstoß, die entstehen, wenn Bewegung sich in beleuchteter Materie fortsetzt und zur phantastischen Erscheinung wird. Das war ein kühnes Programm, es war die Ouvertüre zum Ausdruckstanz und zum modern dance, und seine Vorankünderinnen kamen beide nicht zufällig aus Amerika, einem Land, in dem das klassische Ballett nie wirklich heimisch geworden war. Es fehlte ihm dort die kulturelle Wiege: der Königshof und seine Neigung zur subtilen Künstlichkeit in der Prachtentfaltung. Dafür hatte dieses Land immer etwas übrig für Wagemut und Experimentierfreude. Unterm Zeichen solcher hervorstechenden Charakterstärken hatte Amerika die beiden Pionierinnen einer neuen Tanzkunst nach Europa gesandt. Im Jahre 1900 kam aus den Staaten noch eine dritte Neuerin hinzu, die der Vollständigkeit halber erwähnt sein soll: die nach François Delsartes Lehre erzogene Tänzerin Ruth St. Denis.
Loïe Fuller versprach der Kollegin, sich bei ihrem Agenten für sie einzusetzen. Sie dachte daran, Duncans Darbietung in ihr Programm zu integrieren. Das war ein wichtiger Schritt vorwärts, denn bei den Duncans war nun lange schon Ebbe in der Kasse. Einiges Hin und Her gab es in Fragen der Musik. Würde auf einer großen Bühne Mrs Duncan oder jemand anderes am Piano zur Begleitung ausreichen oder brauchte man nicht gar ein ganzes Orchester? Das aber war kostspielig. Und immer wieder erhob sich die leidige Frage, was denn zu spielen sei. Es war seinerzeit unüblich, dass sich Tänzerinnen von einer Musik begleiten ließen, die nicht ausdrücklich als Ballett- oder Tanzmusik komponiert und gekennzeichnet worden war. Das aber taten sowohl Duncan als auch Fuller – sie tanzten nach großen Musikwerken der klassischen und romantischen Epoche, wobei Isadora es nicht richtig fand, zu sagen, sie tanze »nach Schuberts Ave Maria«, sondern darauf bestand, dass sie diese Klänge quasi verkörpere. Bei den Puristen unter den Verehrern von Brahms und Beethoven war indes eine solche Zweckentfremdung der Musik – wie sie es verstanden – irgendwie unerlaubt. Die Tänzerinnen mussten sich allerlei Vorwürfe anhören, etwa, dass sie Werke entweihten, die doch zum Hören mit geschlossenen Augen bestimmt seien. Aber das focht beide nicht an. Sie wussten, dass das, was sie mit ihren Körpern taten, nicht hinter der sublimen Ausdruckskraft zurückstand, die »ihre« großen Komponisten besessen hatten. Und Mrs Duncan ermunterte ihre Tochter, sich immer wieder neuen musikalischen Inspirationen für ihre Tänze auszusetzen. Raymond hatte einen interessanten Auftrag aus Amerika erhalten, er sollte dort eine Konzerttournee begleiten und packte seine Koffer. Jetzt wollte er aber noch schnell dafür sorgen, dass seine Schwester mit den neuesten musikalischen Meisterwerken vertraut würde. »Du musst zu Richard Wagner tanzen«, sagte er und brachte die Noten des Klavierauszugs vom Bacchanale aus dem Tannhäuser mit und dazu noch Isoldes Liebestod. »Wie für dich geschrieben«, sagte er zu seiner Schwester, bevor er sich verabschiedete.
Eines Tages im November klopfte es an die Tür des Ateliers, und herein trat ein Herr im Pelzmantel. Er stellte sich als deutscher Theateragent und Direktor »der größten Varietébühne Berlins« vor und bot Isadora einen Vertrag über 500 Mark pro Abend. Das war eine hohe Summe! Isadoras Augen glänzten, aber sie war vorsichtig.
»Berlin?«, fragte sie. »In welchem Rahmen würde ich dort auftreten?«
»Sie werden als die erste Barfußtänzerin der Welt annonciert werden«, sagte der Direktor und strahlte über das ganze Gesicht. Isadora sah an ihm vorbei.
»Mein Herr«, sagte sie streng, »von meiner Kunst machen Sie sich völlig falsche Vorstellungen. Niemals werde ich es zulassen, dass man mich als Barfußtänzerin bezeichnet, und ich werde auch auf keiner Varietébühne tanzen. Ich bin gekommen, um der Welt einen Begriff von der Schönheit –«
»Aber Mademoiselle«, unterbrach der Direktor, »was reden Sie denn da! An unserem Theater treten nur erste Größen auf!«
»Meinetwegen. Aber ohne mich. Ich tanze nicht zur Unterhaltung von Banausen. Meine Kunst ist für ein erlesenes Publikum gedacht.«
Der Direktor schob den Unterkiefer vor. Er dachte kurz nach und stieß dann hervor:
»Tausend?«
»Ich komme nicht einmal für zehntausend.«
»Aber Miss Duncan, der Vertrag ist schon fertig. Sie müssen nur hier unterschreiben.«
Da wurde Isadora böse. Sie scheuchte den Kerl hinaus und schrie dabei:
»Niemals! Was denken Sie sich! Mon Dieu!« und schlug die Türe zu. In ihren Memoiren erwähnt sie, dass dieser Herr sie zwei Jahre später in der Kroll-Oper zu Berlin tanzen sah und anschließend mit Blumen in ihrer Garderobe erschien. »Sie hatten recht«, hat er zu ihr gesagt, »in mein Varieté hätten Sie nicht gepasst.«
Zu jener Zeit machte Isadora die Bekanntschaft einer jungen Amerikanerin, mit der sie ihr Leben lang befreundet bleiben sollte: Mary Desti war sechs Jahre älter als Isadora, bereits geschieden, und einen kleinen Jungen hatte sie auch. Durch schieren Zufall traf Isadoras Mutter in einem Park auf Miss Desti, die dort mit ihrem Sohn Verstecken spielte. Mrs Duncan hörte ihre Muttersprache, sie rief erstaunt: »Hallo!« Was die junge Landsmännin denn hierher nach Paris verschlagen habe? »Ich will mehr als eine Hausfrau in Chicago sein«, antwortete Mary, »ich fühle es: in mir steckt eine Künstlerin.« Da konnte Dora nicht anders. Sie erzählte von ihrer jüngsten Tochter und lud Mary ins Studio ein.
»Ich habe gehört, dass Sie eine moderne Art der Tanzkunst pflegen«, sagte Mary zu Isadora, »ob ich wohl einmal zusehen darf, wenn Sie proben?«
»Das können wir gleich haben«, antwortete Isadora erfreut. »Warten Sie, ich bitte meine Mutter um einen Walzer.« Mrs Duncan erschien, sie spielte auf, und Isadora warf sich in die Klänge. Sie drehte sich, sie schwebte im Takt, aber sie war nicht kokett, stattdessen verwegen und ernst. Dann kam ein Nocturne von Chopin, die Tänzerin verwandelte sich, duckte sich, sie suchte etwas und schien zu verschwinden, um dann wie ein Vogel flatternd aufzusteigen. Mary blieb der Mund offen stehen. ›Das ist es‹, sagte sie zu sich, ›das ist Kunst. Schönheit und Größe, sie sind kein Trick und keine Meisterleistung, sie fließen vielmehr von selbst aus der menschlichen Seele, wenn nur ein Weg für den Körper gebahnt ist, auf dem sie sich mitteilen kann.‹
»Ich möchte Ihre Schülerin sein!«, rief Mary aus. »Bitte lehren Sie mich diese Bewegungen.«
Isadora musste erst einmal verpusten. Dann nickte sie.
»Sie möchten reguläre Stunden? Ich bin nicht billig.«
»Das ist kein Hindernis.«
»Gut. Kommen Sie morgen um die gleiche Zeit.«
Mary erwies sich als begabt, und Isadora sah ihre Schülerin fast täglich. Einmal, als sie die Rollen getauscht hatten und Isadora zusah, wie Mary einen Tanz zu einem Hirtengedicht von Theokrit improvisierte – Mrs Duncan trug es mit singender Stimme langsam vor –, rief die Lehrerin scharf:
»Stopp! So geht das nicht! Mary, Sie kopieren mich. Das dürfen Sie nicht tun, das ist ein Abweg. Ich will hier nicht La Duncan sehen, sondern Mary Desti!«
»Aber – ich möchte so tanzen wie Sie.«
»Hören Sie, Mary, wenn Sie so tanzen wollen wie ich, müssen Sie so tanzen, wie Sie – wie nur Sie selbst es können. Stellen Sie sich hierher. Schließen Sie die Augen und führen Sie Ihre Hände auf die Partie unterhalb des Brustbeins, ja, genau so. Dort sitzt der plexus solaris, das Sonnengeflecht, ein wichtiges Nervenzentrum. Von hier aus, von der Mitte kommen alle Gefühle, alle Regungen und Bewegungen. Spüren Sie es? Warten Sie, bis Ihre Mitte antwortet. Dann tun Sie einen Schritt oder einen Griff oder eine leichte Neigung des Kopfes. Beginnen Sie mit der Ruhe. Lassen Sie sich atmen. Horchen Sie in sich hinein. Schauen Sie in sich hinein.«
»Wenn ich in mich hineinschaue«, sagte Mary mit kleiner Stimme, »sehe ich – Sie!«
Isadora seufzte. »Kennen Sie den Essay des deutschen Romantikers Heinrich von Kleist ›Über das Marionettentheater‹? Wenn Sie den gelesen haben, werden Sie besser verstehen, worum es mir geht und worum es auch Ihnen als Bewegungskünstlerin gehen sollte. Kopieren ist immer ein Sich-nicht-Trauen und ein Sich-Zieren. ›Denn Ziererei erscheint, wenn sich die Seele in irgendeinem anderen Punkt befindet, als im Schwerpunkt der Bewegung‹, so Kleist. Wir sollten hier abbrechen und noch mal ganz von vorne anfangen. Was meinen Sie, Mary, haben Sie Lust auf einen Imbiss im Bistro an der Ecke?«
Wenn sie nicht Lehrerin und Schülerin waren, unterhielten sich Mary und Isadora ungezwungen, sie lachten viel und erzählten sich von früher. Isadora war ja auch in Chicago gewesen, und Mary kannte die Etablissements, in denen die 18-jährige Dorita damals aufgetreten war. Und beide konnten einfach drauflosreden, brauchten sich nicht mit der komplizierten französischen Sprache abzumühen.
»Wo ist der kleine Preston?«, fragte Isadora.
»Mit seiner Kinderfrau im Bois de Boulogne.«
»Sie sind well off genug, um eine Nurse zu bezahlen?«, fragte Isadora erstaunt.
»Oh, ja. Mein Exmann hat nichts getaugt, aber er zahlt.«
»Er akzeptiert, dass Sie mit dem Kind in Europa herumreisen und er den Kleinen nicht zu Gesicht kriegt?«
»Er hat nie Interesse an ihm gezeigt«, sagte Mary und kniff die Lippen zusammen, »aber lassen Sie uns das Thema wechseln.« Sie beugte sich vor und lächelte. »Kann es sein, dass ich Ihre erste Schülerin bin?«
»Oh, nein«, antwortete Isadora, »ich habe in San Francisco schon eine richtige kleine Tanzschule geführt. Hinter unserem Haus gab es einen Schuppen, und dort hat mein Bruder Augustin für uns ein winziges Theater gebaut. Wir gaben Vorführungen für Nachbarn und Freunde. Und die Nachbarskinder kamen zu mir, um tanzen zu lernen. Sie zahlten dreißig Cent pro Nase. So trug ich schon damals zum Familieneinkommen bei.«
»Was sagten denn Ihre Lehrerinnen dazu?«
»Gar nichts. Stumpfsinniger Drill, diese Elementarschule. Mit elf Jahren habe ich beschlossen, nicht mehr hinzugehen.«
Mary staunte. »So früh schon? Aber Sie erscheinen mir doch recht bewandert, zum Beispiel in Kunsttheorie. Und in Musik …«
»Alles, was ich gelernt habe, verdanke ich meiner Mutter und meinen Geschwistern. Mein Leben als Kind war praktisch laufender Unterricht daheim. Mit zehn lernte ich Deutsch und las Kant – verstehen tat ich ihn erst später, zugegeben. Und mit zwölf schon durfte ich Tanzlehrerin sein. Die Kinder liebten mich, sie kamen gern. Eigentlich wünsche ich mir auch heute wieder eine Schule.«
»Immerhin haben Sie ja jetzt schon mich als Schülerin. Die Anfänge sind gemacht.«
»Was bedeutet der Name Desti, Mary? Destination?«
»Er ist meine Erfindung – haben Sie das geahnt? Eigentlich heiße ich Dempsey. Das klingt nach gar nichts. In Italien gibt es eine Adelsfamilie mit dem Namen d’Este. In dieses vornehme Geschlecht habe ich mich sozusagen seitlich reingeschlichen.«
»Hm. Meinen Sie wirklich, man wird Mary Desti den italienischen d’Estes zurechnen?«
»Warum nicht?«
»Richtig so. Wir Nordamerikanerinnen stammen doch alle aus Europa. Mein Name Duncan ist schottisch, er kommt bei Shakespeare vor. Und was waren die Duncans? Könige! Meine Mutter kommt aus einer irischen Familie, meine Großmutter ist noch in einem Planwagen auf der Reise nach Westen geboren – und zwar mitten in einem Kampf mit den Indianern. Wir alle, meine Brüder, meine Schwester und meine Mutter haben den berüchtigten irischen Dickschädel.«
Nun war es also abgemacht: Isadora sollte mit Loïe Fuller auf Tournee gehen und im Rahmen ihres Programms auftreten. Sie fühlte sich am rechten Platz, denn die fée d’électricité zog genau das Publikum an, das Isadora vorschwebte. Loïe startete ihre Europatournee mit einem Dutzend ihrer besten Schülerinnen im Frühjahr 1902, erste Station war Berlin. Standesgemäß logierte das Ensemble im Hotel Bristol, Unter den Linden. Das vornehme Haus hatte erst vor Kurzem die erste Automobilausstellung Deutschlands beherbergt. Isadora zog allein durch die Straßen und Gassen der Reichshauptstadt, wie sie es gern tat, um das Gefühl für einen Ort zu bekommen. Sie hatte gehofft, ein nordisches Athen zu erblicken und war doch bald enttäuscht. Berlins preußischer Klassizismus bot die Antike als pedantische Kopie, steif und bedrückend. Zurück im Hotel beschied Isadora desillusioniert den Kellner auf Deutsch: »Geben Sie mir ein Bier, ich bin müde.« Sie brachte gern deutsche Ausdrücke und Redewendungen in ihren Sätzen unter.
Die Auftritte im Wintergarten waren erfolgreich, das Berliner Publikum applaudierte begeistert. Doch auch Loïe Fuller konnte nicht gut haushalten, zumal die Darbietungen der japanischen Tänzerin Sada Yacco, eine Protégée der Fuller, überhaupt nicht ankamen und viel Geld verloren ging. Das Hotel Bristol behielt, als die Truppe abzog, wegen unbeglichener Rechnungen das gesamte Gepäck als Pfand ein. So war es auch den Duncans einst in den USA und in London öfters ergangen, und Isadora begann zu zweifeln, ob sie es richtig gemacht hatte, als sie sich Fuller anschloss. Zumal sich während der Vorstellungen zeigte: Alles drehte sich um Loïe, sie selbst war Beiwerk. Über Leipzig und München ging die Tournee wie geplant nach Wien. Fuller lebte offen lesbisch, die jungen und ausgesprochen hübschen Mädchen des Ensembles, die als Walküren und Nereiden den Vordergrund der Bühne schmückten, waren ihr sehr zugetan. Ganz selbstverständlich streichelten sie die Hände und Brüste ihrer Angebeteten und küssten ihren Mund. Beflissen brachten sie Eisbeutel und Kräuterpackungen und verteilten Kissen im Rücken der Diva, die häufig unter Ischiasschmerzen litt. Isadora war zwar eingeweiht in die Lebensweise ihrer Kollegin, doch mit einer solchen Offenheit hatte sie nicht gerechnet. »Unsere Mutter hat uns bestimmt alle geliebt, aber selten liebkost. Und so war ich fast ein wenig erschrocken über diesen starken Ausdruck von wärmster erotischer Zuneigung. So etwas hatte ich noch nie erlebt.«
In Wien sollte Isadora eine befremdliche Erfahrung machen. Unter den Mädchen gab es eine Rothaarige, die alle nur Nursie nannten, denn tatsächlich war sie sehr rührig und kümmerte sich wie eine Krankenschwester um alle anderen – am meisten natürlich um La Fuller selbst – und sie trieb auch Geld für die Weiterreise auf. Dieses Mädchen hatte sich in Isadora verliebt, sie eines Abends vor aller Augen umarmt und geküsst. Isadora traute sich nicht, sich zu wehren, obschon sie sich überrumpelt fühlte. Es ergab sich dann, sicher nicht zufällig, dass Nursie im Hotel in Wien ihre Zimmergenossin war. »Eines Morgens gegen vier Uhr stand Nursie plötzlich auf, zündete eine Kerze an, trat an mein Bett und rief: ›Gott hat mir befohlen, dich zu erwürgen!‹«
Obwohl Isadora große Angst bekam, wusste sie doch instinktiv, dass man Menschen, die außer sich geraten, nicht widersprechen sollte und antwortete: »Ja, du hast vollkommen recht, ich bin bereit. Aber zuvor musst du mich noch ein Gebet sprechen lassen.«
Die List verfing, Nursie bekundete ihr Einverständnis und setzte sich brav auf einen Stuhl. Isadora aber sprang behände aus dem Bett und lief im Nachthemd und mit offenem Haar durch die langen Korridore, lauthals rufend »Lady gone mad!« (= Die Frau ist verrückt geworden!). Nursie blieb ihr dicht auf den Fersen, vier Angestellte des Hotels waren nötig, um die Furie zu stoppen und festzuhalten, bis ein Arzt kam. Isadora hatte nach diesem Vorfall endgültig genug. »Ich kann nicht mehr«, sagte sie zu Loïe. Und sie schickte ein Telegramm an ihre Mutter nach Paris: »Bitte komm sofort. Stop. Und hol mich ab.«
Isadora hatte allerdings in Wien auch eine ermutigende Erfahrung gemacht. Sie war nach einem Soloauftritt im Künstlerhaus am Karlsplatz bejubelt und mit Blumen überhäuft worden, und an diesem Abend kam der ungarische Theateragent Alexander Grosz in ihre Garderobe.
»Ihr Bacchanale war ein Traum, Sie sind einmalig! Wenn Sie Karriere machen wollen, kommen Sie mit mir nach Budapest.«
»Oh, ich danke Ihnen sehr. Ich bin zwar mit Loïe Fuller auf Tournee, wäre aber nur allzu bereit, auf eigenen Füßen zu stehen. Wann könnte es denn losgehen?«
»Sofort, wenn Sie möchten, ich besorge Ihnen eine Unterkunft in Budapest. Sie können in der wunderschönen venezianischen Urania auftreten, eines der besten Theater der Stadt.«
»Ich muss Sie aber warnen. Mein Tanz ist für die Elite, für Künstler, Bildhauer, Maler und Musiker geeignet, nicht für das breite Publikum.«
»Ah, das passt schon. Künstler sind die strengsten Kritiker, denen wird Ihre Art zu tanzen sehr gefallen, da bin ich sicher. Beim großen Publikum werden Sie dann erst recht Erfolg haben. Vertrauen Sie mir, ich habe viel Erfahrung in diesem Metier.«
Isadora zögerte ein wenig, denn es war das erste Mal, dass sie in einem Theater vor großem Publikum ihre Kunst darbieten sollte, und sie fürchtete sich sehr vor mangelndem Verständnis. Was, wenn die Zuschauer im Sperrsitz Münzen auf die Bühne würfen oder von ihr verlangten, die Tunika fallen zu lassen? Grosz redete ihr gut zu, und diesmal ließ sie sich überzeugen und unterzeichnete einen Vertrag. Ihre Mutter kam in Wien an, die beiden brachen sogleich mit Grosz nach Budapest auf. Isadora Duncans Debut dort im April 1902 bestand unter anderem aus Improvisationen zu Johann Strauss’ Donauwalzer, der inoffiziellen Landeshymne Wiens, und zu Franz Liszts Rákóczi-Marsch, der inoffiziellen Landeshymne Ungarns. Agent Grosz sollte recht behalten, die Menschen waren aus dem Häuschen. »Der erste Auftritt in der Urania wurde ein unbeschreiblicher Erfolg – ich tanzte dreißig Abende vor ausverkauftem Haus. Das temperamentvolle ungarische Publikum raste, die Menschen warfen ihre Hüte und Mützen auf die Bühne, alles sprang von den Sitzen auf und geriet in einen derartigen Rausch der Begeisterung, dass ich den Walzer viele Male wiederholen musste, bevor die Leute wieder halbwegs zur Vernunft kamen.«
Im Gegensatz zu Berlin machte Budapest mit seinen Bauten und seiner Atmosphäre einen tiefen Eindruck auf Isadora, die luxuriösen Gärten und breiten Boulevards, die Menschen in ihren farbenreichen Trachten und die Roma-Kapellen, die überall auf den Straßen und Plätzen aufspielten, gefielen ihr sehr. Deren Rubato, die Verlängerung oder Verkürzung von Tönen, die Beschleunigung oder Verlangsamung des Tempos, verbunden mit dem Versprechen, die ›geraubte Zeit‹ wieder zurückgegeben, beeindruckte sie.