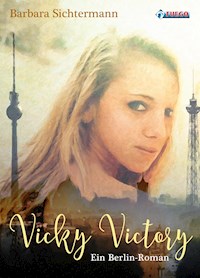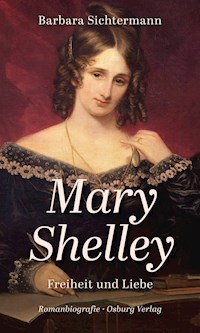
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Osburg Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dass der Roman Frankenstein das Werk eines jungen Mädchens von erst neunzehn Jahren war, hat die Öffentlichkeit fast zwei Jahrhunderte in aller Welt kaum zur Kenntnis genommen. Der Shootingstar war Frankensteins Kreatur, der künstliche Mensch, das Grauen erregende Monster. Dem Filmpublikum des 20. Jahrhunderts war das alles egal. Es ergötzte sich ein ums andre Mal an Horrorstreifen wie Frankenstein – klassisch 1931 mit Boris Karloff als Monster. 1994 kam ein Film mit Anspruch heraus. Kenneth Branagh spielte die Titelrolle und Robert de Niro die Kreatur. Der Film hieß: Mary Shelley's Frankenstein. Erst durch dieses Werk wurde Mary Shelleys Name nachhaltig in das Bewusstsein auch des Massenpublikums gepflanzt. Der Bann war gebrochen. Als sie ihren nachmaligen Geliebten, Gefährten und Gemahl 1814 kennen lernte, war sie sechzehn Jahre alt und wusste, dass der jugendliche Freund und Bewunderer ihres Vaters, der Dichter Percy Bysshe Shelley, verheiratet war. Sie brannte gleichwohl nur wenige Monate später mit ihm durch – die Reise ging auf den Kontinent, nach Frankreich, Italien und der Schweiz. Die acht Jahre, die Mary an Shelleys Seite verbrachte, waren geprägt durch drei große Reisen in den schönen Süden Europas, und all diese Exkursionen waren zugleich Fluchten: vor erzürnten Eltern, ungeduldigen Gläubigern und böswilligen Klatschmäulern. 1816 war das Jahr, in dem Byron vorschlug: »Lasst uns alle miteinander eine Gespenstergeschichte schreiben« und Mary diesen Wettstreit mit Frankenstein gewann. Schon 1822 verlor Mary ihren Mann wieder: Er ertrank vor der Küste von Viareggio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Sichtermann
Mary Shelley
Freiheit und Liebe
Romanbiografie
Frontispiz: Frankenstein observing the first stirrings of his creature(Frankenstein beobachtet die ersten Regungen seiner Kreatur),Illustration aus Frankenstein, or the Modern Prometheus (1831)
Erste Auflage der vollständig
neu bearbeiteten Ausgabe 2022
© Osburg Verlag Hamburg 2022
www.osburgverlag.de
Alle Rechte vorbehalten,
insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Bernd Henninger, Heidelberg
Korrektorat: Mandy Kirchner, Weida
Umschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, Hamburg
Satz: Hans-Jürgen Paasch, Oeste
ISBN 978-3-95510-277-7eISBN 978-3-95510-286-9
Inhalt
Prolog
I»Die Liebe muss frei sein, damit sie Liebe bleibt«
Erste Begegnungen
II»Zu glücklich, um zu schlafen«
Auf der Flucht
III»Und wir werden uns niemals mehr trennen«
Ein Platz in der Welt
IV»Lasst uns eine Gespenstergeschichte schreiben!«
Ein dunkler Sommer am See
V»Jetzt ist das Unglück zu mir gekommen«
Zwei Todesfälle und eine Hochzeit
VI»Treibsand, der unter meinen Füßen wegrieselt«
Schicksalsschläge
VII»Die Sterne mögen auf meine Tränen herabsehen«
Schiffbruch
VIII»Kein Auge schaut in meins zurück«
Am Rande der Gesellschaft
IX»So muss ich diese Stunden wohl glücklich und friedvoll nennen«
Freie Schriftstellerin
Nachwort
Anhang
Prolog
Die prachtvolle Villa Diodati, erbaut 1710, steht heute noch. Sie erhebt sich hinter dem Ufer des Genfer Sees, der Ort heißt Cologny und liegt bei Genf. Man hat von der Villa aus einen herrlichen Blick über den See und das Alpenpanorama.
Im Juni des Jahres 1816 fand sich auf diesem Landgut eine illustre Gesellschaft englischer Reisender ein. Die Menschen, die dort ihre Abende verbrachten, waren so berühmt und interessant, dass der Inhaber des Hotels d’Angleterre, das genau gegenüber gelegen war, Fernrohre gegen Entgelt anbot, damit seine in der Mehrzahl britischen Gäste einen besseren Einblick in das Treiben auf der anderen Seeseite hätten.
Mieter der Villa war der achtundzwanzigjährige Lord Byron, ein englischer Aristokrat und Dichter, dessen selbst von Goethe gerühmte Lyrik ihn in ganz Europa bekannt gemacht hatte. Byron war ein Exzentriker, er reiste nie ohne einen Tross Bediensteter, seine Bibliothek und eine Menagerie. In diesem Jahr hatte er außerdem den jungen Arzt und angehenden Schriftsteller John Polidori mitgenommen. Der Dichter Percy Bysshe Shelley, 23 Jahre alt, der in diesem Juni fast täglich Byrons Gast war, entstammte ebenfalls dem englischen Adel, war aber als Rebell und Atheist von seinem Vater verstoßen worden und musste mit einem bescheideneren Wohnsitz, zehn Gehminuten entfernt, vorliebnehmen. Auch Shelley reiste nicht allein. Es begleiteten ihn seine achtzehnjährige Lebensgefährtin Mary, Tochter des bekannten Philosophen William Godwin und der ebenfalls namhaften Schriftstellerin Mary Wollstonecraft, ferner Marys nur wenig jüngere Stiefschwester Claire und das Kind, das Shelley mit Mary hatte, Baby William mit seinem Schweizer Kindermädchen.
Die Begegnung mit Byron war geplant, man hatte sich außer zu Gesprächen im Salon zu Segeltouren und Wanderungen in der Umgebung verabredet. Es blieb aber dann doch meist bei Gesprächen, denn der Sommer 1816 war außerordentlich dunkel und kalt und völlig verregnet. Was die fünf Besucher nicht wissen konnten: der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im Jahr zuvor hatte eine derart gigantische Aschewolke in die Atmosphäre geschleudert, dass noch Monate später in Europa der Himmel grau blieb, wochenlang Regen fiel, unzählige Gewitter aufzogen und die Menschen im Juni ihre Kamine anzünden mussten. Ganze Ernten wurden durch Hagel vernichtet, in manchen Regionen herrschte Hungersnot. Die Meteorologie war noch nicht weit genug entwickelt, als dass die Menschen jener Zeit die Zusammenhänge hätten erkennen können. So glaubten sie an eine Strafe Gottes für ihr sündiges Erdenleben und schickten ihre Gebete um eine Rückkehr der Sonne an den Höchsten. In der Villa Diodati begnügte man sich notgedrungen mit spekulativen Diskursen und anregender Lektüre.
Was der Tourist des Hotels d’Angleterre zu erblicken hoffte, wenn er sein Fernrohr scharf stellte, kann man erahnen, wenn man weiß, wofür die Herren dort drüben in der Villa noch berühmt waren, außer für ihre Verse: für ein Liebesleben, das weder der Norm noch der Moral entsprach und über das ehrbare Zeitgenossen zumindest in der Öffentlichkeit eines Hotels nur im Flüsterton sprachen.
Es ist der 16. Juni, spätabends. Was erspäht der neugierige Hotelgast? Sieht er überhaupt etwas? Ja, der Salon der Villa ist hell erleuchtet, es flackert sogar ein Kaminfeuer. Neben dem Kamin hat sich Lord Byron in einem Sessel niedergelassen, in der Hand ein Buch, aus dem er augenscheinlich vorliest. Man erkennt den schönen Mann an seiner Haltung und an seinem dunklen Lockenhaar, auch an seinem verkrüppelten Fuß, den er entkleidet und auf einen Schemel hochgelegt hat. Auf dem Boden vor dem Kamin sitzt Shelley, er hält einen Schürhaken in der Hand, mit dem er in den Scheiten stochert, offenbar ganz begeistert von dem Funkenflug. Neben ihm steht an den Kaminsims gelehnt seine schlanke, graziöse Gefährtin Mary, ebenfalls mit einem Buch in der Hand – das sie aber geschlossen hält. Ihre brünette Stiefschwester Claire hat neben Byron Platz genommen, es sieht fast so aus, als wolle sie seinen Fuß mit einer Salbe kühlen. Ja, der englische Tourist hat davon gehört, dass diese kleine reizvolle Person die Geliebte Byrons sein soll. Ein Stück entfernt an einem Tischchen sitzt Mr Polidori und beobachtet die Szene, immer wieder wandert sein Blick zu Mary, die ihrerseits Shelley betrachtet. Was es für ein Text ist, den Byron da vorträgt, erfährt der spähende Landsmann natürlich nicht. Aber er hat so eine Ahnung: es ist höchstwahrscheinlich ein französisches Erotikon.
Aber nein, da hat er unrecht. Byron liest tatsächlich Französisch, aber es ist eine übersetzte deutsche Geistergeschichte – eine sogenannte gothic story, und seine Zuhörerschaft gibt ihm nach und nach durch Gesten zu verstehen, dass sie sich nicht wirklich gruselt und von dieser literarischen Kost genug hat. Der Voyeur interpretiert die Bewegung, die jetzt in die Bewohner der Villa fährt, als Aufforderung Byrons, nach der erotisierenden Lektüre zur Praxis überzugehen und sich in den Schlafräumen zu treffen. Der englische Tourist stellt das Fernrohr ab und schüttelt den Kopf. Für heute hat er genug von solcher Amoral.
Was Byron wirklich sagte, war allerdings etwas ganz anderes. Er klappte das Buch zu, blickte in die Runde, sah die Enttäuschung in den Mienen seines kleinen Publikums und lachte.
»Immer diese spukenden alten Rittersleut’«, seufzte Shelley. »Können wir das nicht besser?«
»Immer diese alten deutschen Burgen mit den Falltüren«, sagte Mary, »das wird doch allmählich langweilig.«
»Hey, ihr Lieben«, fiel Byron ein, »warum zeigen wir nicht, dass es anders geht? Lasst uns alle miteinander eine Gespenstergeschichte schreiben!«
Der Zuspruch war einhellig, man ging auseinander und fing sogleich an zu projektieren, zu fantasieren, zu assoziieren, zu spinnen. Fast alle machten mit und versuchten sich nach dieser historischen Nacht vom 16. auf den 17. Juni 1816 an einer gothic story. Polidori schrieb die Novelle Der Vampyr und lieferte damit den Startschuss des Dracula-Genres. Die beiden Poeten Shelley und Byron brachten es nur zu Fragmenten. Mary aber begann die Geschichte eines Studenten der Anatomie niederzuschreiben, der ein menschliches Wesen aus Leichenteilen zusammensetzt und es mit elektromagnetischen Impulsen zum Leben erweckt.
Sie sollte als Siegerin aus diesem Wettbewerb hervorgehen. Ihr Roman Frankenstein oder Der moderne Prometheus begründete nicht nur ein neues literarisches Genre, die science fiction, er ist bis heute auf dem Buchmarkt präsent, wird gekauft und gelesen und ein ums andere Mal verfilmt. Ob das Lese- und Kinopublikum sich wirklich immer noch gruselt, wenn es sich auf diesen Roman einlässt? Darauf kommt es inzwischen gar nicht mehr an. Denn Frankenstein ist weit mehr als eine Gespenstergeschichte, er ist ein moderner Mythos.
I»Die Liebe muss frei sein, damit sie Liebe bleibt«
Erste Begegnungen
»Er lebt noch!«, rief Shelley und schüttelte den Kopf – über sich selbst. Wie hatte er so unbedacht sein können! William Godwins großes Werk über Politische Gerechtigkeit war seit Jahren seine Bibel. Das Buch hatte gleich nach dem Erscheinen im Jahre 1793 – Shelley war damals gerade ein Jahr alt – für Aufsehen gesorgt, denn es entwarf eine Utopie, in der nichts mehr so sein würde wie derzeit im alten England. Und als der junge Dichter Percy Bysshe dieses Buch viele Jahre später zur Hand nahm, erschien es ihm wie ein Ruf aus einer verheißungsvollen Epoche: Revolution in Paris, Aufstand der Massen, Entmachtung des Klerus, Ende der Monarchie, Republik. Dabei nahm aber Godwin in seinem Werk Stellung gegen die Gewalt. Und er ging in der Theorie viel weiter als die Franzosen in der Praxis. Der Staat müsse überwunden werden, forderte er, und die Menschheit sich selbst regieren vermittels der ihr eingeborenen Vernunft. Seite für Seite zog der visionäre Philosoph Shelley in seine Gedankenwelt hinein, der Junge wurde sein eifriger Adept, trug das Buch stets bei sich und las sich selbst immer wieder laut daraus vor. Doch dann kam, abgesehen von einem Roman, einfach nichts Rechtes mehr von Godwin, jedenfalls nichts, was Shelley wahrgenommen hätte. Sein Lehrer war verstummt – seit nun schon über fünfzehn Jahren. Er ist wohl gestorben, hatte der Schüler bei sich gedacht, ich werde sein Andenken ehren. Und nun teilte ihm sein Freund, der Dichter Robert Southey, mit, dass Godwin in London eine Verlagsbuchhandlung betrieb, Schwerpunkt Kinderbücher. Es machte Shelley glücklich, sich vorzustellen, wie der Mann, dessen Werk ihn wie kaum ein anderes beeinflusst hatte, in einem Büro saß und eine Quartalsbilanz erstellte oder im Laden einem kleinen Jungen, der gerade lesen gelernt hatte, ein Buch empfahl. »Ich muss ihn treffen«, sagte Shelley zu sich selbst, »das Gespräch, das ich so lange in Gedanken mit ihm führe, muss weitergehen – im wirklichen Leben. Ich werde ihm schreiben.«
Das Schreiben von Briefen füllte einen großen Teil von Shelleys Zeit aus. Manchmal machte er den ganzen Tag nichts anderes – abgesehen vom Dichten natürlich. Und vom Lesen, das er ebenfalls mit ungeheuerlichem Eifer betrieb. Er las antike Autoren, französische Philosophen, deutsche Dichter, englische Klassiker, er las Platon und Lukrez, Rousseau und Condorcet, Goethe und Winckelmann, Shakespeare, Milton, Locke und immer wieder Godwin. Er las nicht nur in seinem Studierzimmer. Er las beim Spazierengehen, auf dem Lokus, in der Kutsche und beim Essen. Er hätte sehr gern noch im Schlaf gelesen, aber das gelang nicht. Immerhin las er des Nachts, wenn er aus einem Traum erwachte; lange lagen die Gedichte Robert Southeys neben seinem Bett. Dieser Schriftsteller war ihm durch sein Werk, das eine glühende Verteidigung der Französischen Revolution einschloss, ähnlich nahegekommen wie Godwin. Aber es gab auch immer wieder Ärger, denn Southey stand politisch aufseiten der Konservativen, der Torys, und das war für den Rebellen Shelley schwer zu ertragen. Southey seinerseits versuchte, den Atheisten Shelley davon zu überzeugen, dass der in Wahrheit sehr wohl an Gott glaube, dass er eben das Universum für Gott nehme. Woraufhin Shelley erwiderte, dass Gott nur eine Umschreibung für das Universum sei, man könne ihn ebenso gut weglassen. Wir, Du, ich, alle Menschen sind Teile eines unermesslichen Ganzen, schrieb er ihm. Southey war viel älter, er war erfahrener und vor allem vorsichtig geworden, was seine Sympathie für Revolutionen betraf. Shelley imponierte ihm wegen seiner Intelligenz, wegen der Wissensschätze, die er trotz seiner Jugend aufgehäuft hatte und wegen seines dichterischen Talentes, das außerordentlich schien. Und dann war dieser Knabe ein Freigeist, ein Freak, ein Radikaler. Das gefiel Southey, er sah sich vielleicht selbst in ihm, wie er früher einmal gewesen war und wollte ihn nicht wegen bloßer Meinungsverschiedenheiten als Freund verlieren. »Der einzige Unterschied zwischen uns beiden«, sagte er zu ihm, »ist, dass du neunzehn bist und ich siebenunddreißig.« Percy bewunderte Southey, er nannte ihn einen großen Mann, aber ihre politischen Differenzen führten schließlich zum Bruch. Zuvor jedoch hatte Southey seinen Freund auf die Spur eines anderen, für Shelley noch bedeutenderen Mentors gesetzt: William Godwin.
Der folgenreichste Brief, den Percy Bysshe Shelley im Jahre 1812 schrieb, ging an die Adresse einer Verlagsbuchhandlung in der Londoner Skinner Street.
Sie werden vielleicht überrascht sein, von einem gänzlich Fremden zu hören. Der Name Godwin erregt in meinem Innern Gefühle der Verehrung und Bewunderung, und gleich zu Beginn meiner Bekanntschaft mit Ihren Gedanken und Prinzipien hegte ich den glühenden Wunsch, auf der Basis persönlicher Nähe jenem Geist zu begegnen, der mir durch seine Entäußerung im Werk so hohen Genuss bereitet hat. Ich bin jung, ich brenne für die Sache der Menschheit und der Wahrheit. Glauben Sie nicht, dass es Eitelkeit sei, die mich dazu antreibt, mich selbst in dieser Art bei Ihnen einzuführen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich Ihrer Freundschaft nicht völlig unwürdig bin, und wenn das Glück der Menschheit und die Sehnsucht, es zu befördern, auch für Sie bei der Wahl Ihrer Freunde den Ausschlag gibt – dann antworten Sie mir bald.
William Godwin hatte seinerzeit fast alles in makelloser, wenngleich verschlungener Diktion niedergeschrieben, was den aufmüpfigen Schüler und Studenten Shelley umtrieb: Konnte denn der Mensch nicht in eigener Verantwortung sein Leben führen, warum mussten ihm vorgeblich unanfechtbare Autoritäten den Weg zum Glück versperren? Warum duldete das Machtwort des Vaters und der Verweis des Oberlehrers keine Widerrede? Warum war der Pfarrer befugt zu entscheiden, was sündhaft war und was süß? Warum konnten Richter einen Eierdieb ins Gefängnis werfen und einen Baron, der seinen Knecht fast zu Tode prügelte, unbehelligt lassen? Warum durften Regierungen sich anmaßen, gewaltsam Hand an den Urquell der Gesellschaft zu legen und dessen Lauf verhindern? Warum galten Frauen als Menschen zweiter Klasse, so gut wie rechtlos, eingehegt in patriarchalische Zwänge – wozu auch die Ehe gehörte, die unbedingt abzuschaffen war! Und dann über allem Gott der Herr, dessen Wille es angeblich war, dass die Hüter von Thron und Altar ein luxuriöses Leben führten, während die Massen in Stadt und Land verarmten. Godwin forderte direkte Demokratie, gerechte Verteilung aller Güter, Ächtung des Privateigentums und eine Erziehung nach Maßgabe der Vernunft. Es erschien Shelley höchst seltsam, dass dieses aufrührerische Buch Untersuchung über politische Gerechtigkeit und ihren Einfluss auf Moral und Glückseligkeit (An Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on Morals and Happiness) nicht von der Zensurbehörde verboten worden war. Der Grund war dieser: Godwin stellte an seine Leser hohe Ansprüche. Es war, meinten die Zensoren, vorauszusehen, dass sein Buch bloß innerhalb der akademischen Welt Aufnahme finden würde – wenn überhaupt. Als sich dann aber die Politische Gerechtigkeit vom Geheimtipp zum Verkaufsschlager entwickelt hatte und man überall den Namen Godwin raunte, war es zu spät, und die Zensoren mussten einsehen, dass sie sich verkalkuliert hatten. Das Thema Revolution eroberte auch außerhalb der Universitäten die Köpfe und sorgte selbst in Pubs und Salons für Debatten. Und so gelangte es – wenn auch mit einiger Verspätung – in die Hände des damals siebzehnjährigen Internatsschülers Percy Shelley. Und es eröffnete ihm eine Welt.
Godwin antwortete seinem Verehrer sogleich; es entspann sich ein Briefwechsel, der beiderseits mit Hingabe betrieben wurde. Shelley erzählte viel von sich selbst: dass er aus altem, begütertem Landadel stamme, sich aber mit seiner Familie überworfen habe, nachdem er als Student in Oxford eine Streitschrift mit dem Titel Die Notwendigkeit des Atheismus verfasst habe und daraufhin sofort von der Alma Mater relegiert worden sei. Dass er bereits zwei Romane geschrieben habe, inzwischen aber, dank Godwins Einfluss, mehr Interesse am wirklichen Leben, an der Geschichte und der Politik hege und ein weiserer und besserer Mann geworden sei.
Der Autor der Politischen Gerechtigkeit war seit seinem berühmten Erstling ein wenig in Vergessenheit geraten – dass Shelley gemutmaßt hatte, er sei gar nicht mehr unter den Lebenden, kam nicht von ungefähr. Über Godwins radikal-anarchistische Vorstellungen war die Zeit hinweggegangen – in Frankreich ebenso wie in England. Napoleon hatte ganz Europa in seine Kriegszüge verwickelt und sich zum Kaiser krönen lassen – was war aus der Revolution geworden? Und was aus mir?, fragte sich Godwin, denn seine Buchhandlung lief mehr schlecht als recht, und als Autor von Romanen erregte er kein Aufsehen mehr. Ein Bewunderer aus der jungen Generation kam da wie gerufen – ganz aus dem Gedächtnis der Zeit verschwunden war er also doch noch nicht. Wie es schien, hatte dieser Shelley wirklich was im Kopf. Und im Hintergrund war vielleicht sogar ein Vermögen! Ja, er würde sich bereit erklären, den jungen Herrn zu sich einzuladen.
Es verging noch einige Zeit, bis es zum ersehnten Treffen kam. Shelley war davon überzeugt, dass ein Revolutionär und Sozialreformer nicht nur theoretisieren darf, sondern praktisch tätig werden muss. Also reiste er als Agitator nach Dublin, um die aufständischen Iren zu unterstützen. Zurück in London dachte er dann nur diesen einen Gedanken: Godwin. Political Justice. Der Besuch steht an. Und er fragte nach, ob es genehm sei, wenn er in Begleitung seiner Frau erscheine. Denn mit Harriet, seiner siebzehnjährigen, ungewöhnlich schönen Ehegefährtin, teilte Percy die meisten seiner Unternehmungen. Sie war in Irland an seiner Seite gewesen, wusste, was ihm Godwin bedeutete, und sollte nun beim Kennenlernen dabei sein.
Der Abend im Herbst 1812, an dem Shelley erstmals mit seinem Idol in dessen Stube speiste, sollte allen Beteiligten lange im Gedächtnis bleiben. Erstaunt und erfreut blickte Shelley auf das Gewimmel junger Menschen um Godwin herum – sie nannten ihn »Papa«. Waren das alles seine Kinder? Ja und nein – und wieder ja, es dauerte seine Zeit, bis Percy und Harriet herausgefunden hatten, wie sich diese Patchworkfamilie zusammensetzte. Die Älteste, ein freundliches, schüchternes Mädchen von neunzehn Jahren namens Fanny, war die Tochter von Godwins erster Gemahlin, der berühmten Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft. Shelley hatte von dieser Schriftstellerin gehört, er wusste auch, dass sie nicht mehr am Leben war, und erfuhr später, dass Fanny ein Kind der Liebe aus Marys revolutionärer Zeit im Paris der 1790er-Jahre war, geboren vor ihrer Verbindung mit Godwin. Die Wollstonecraft hatte also diese nichteheliche Tochter mit in die Ehe gebracht. Dann war da noch ein weiteres Mädchen, ein vierzehnjähriger koketter Kobold mit schwarzen Locken; sie hieß Jane und war ebenfalls mit in die Ehe gebracht worden – und zwar von Godwins zweiter Ehefrau, einer geborenen Mary Jane Vial, die sich nach dem Vater ihrer Tochter Clairmont nannte. Jane warf lange Blicke auf die reizende Harriet und ihr elegantes Kleid. Sie hatte einen älteren Halbbruder, Sohn der Frau Clairmont, Charles geheißen, der ebenfalls zu der bunten Abendgesellschaft stieß. Ein kleiner William junior, neun Jahre alt, Sohn Godwins und seiner zweiten Frau, lief ferner im Zimmer herum. Sofort zog er Shelleys Aufmerksamkeit auf sich. Denn wenn es etwas gab, an dem der Dichter nicht vorbeigehen konnte, dann waren es Kinder. Am liebsten hätte er sich mit William auf den Boden gesetzt und ein Modellschiff aus Baumrinde mit ihm gebastelt. Aber die Höflichkeit verlangte eine gepflegte Konversation – zumal Mrs Clairmont Godwin, die umtriebige Herrin des Hauses, majestätisch am Kopf der Tafel stand und Anweisungen gab, William musste sich brav auf seinen Stuhl setzen. Und schließlich war da Godwin selbst, der Mastermind, um dessentwillen Shelley gekommen war. Ein wenig verlegen wartete der Gast darauf, dass der Philosoph das Gespräch eröffnete – was er bei der Suppe dann auch tat. »Erzählen Sie, lieber Shelley, was Sie in Irland erfahren haben. Zu welchen Gruppierungen hatten Sie Zutritt und wie ist Ihre Flugschrift aufgenommen worden?« Shelley hatte in Irland wenig bewegen können, das Thema war ihm also etwas unangenehm. Aber geschickt, wie er als Diskutant immer schon war, lenkte er das Gespräch auf die Dichtkunst, und die Familie hörte ihm gebannt zu.
»Welche sind Ihre neuesten dichterischen Projekte?«, fragte Mrs Godwin.
»Ich arbeite an einem Epos in Versen, ich nenne es ein philosophisches Gedicht. Es soll zeigen, dass eine Revolution, ein radikaler Wandel hier auf Erden alle Notwendigkeit auf seiner Seite hat und dass die Natur selbst diesen Wandel fordert.«
»Werden Sie aus diesem Gedicht vortragen?«
»Jetzt? Hier?«
»Wenn Sie es dabeihaben …«
Natürlich hatte Percy es dabei, er hatte gehofft, vor Godwin daraus lesen zu dürfen, und so warf er sich in Positur, schaute ernst in sein Publikum und sprach die Worte: »Der Titel der Dichtung lautet: Queen Mab, die Feenkönigin. Sie ist Harriet gewidmet.« Seine Frau legte den Kopf zurück und warf ihm eine Kusshand zu. Percy erhob seine helle Stimme:
»Wes ist die Liebe, die die Welt durchstrahlend,
Mich schützt vor ihres Hohnes giftgen Pfeilen?
Wes ist der liebevolle Preis,
Der Tugend schönster Lohn?
Wes Blicke machten meine Seele reifer
In Wahrheit und in kühnem Tugendstreben?
In wessen Auge schaut ich liebend
Und liebte mehr die Menschen?
Dein Auge war’s! – Du warst mein bessrer Geist;
Dein war die Begeistrung meines Lieds;
Dein sind die frühen Waldesblumen,
Die ich als Kranz dir wand.
Drück an das Herz denn diese Liebesgabe,
Und ob auch Zeiten wechseln, Jahre schwinden,
Wird jede Blume meines Herzens
Doch dir geheiligt sein.«
Zwischendurch zwinkerte er Fanny zu, die sofort rot wurde, dabei aber lächelte. Jane reichte ihm eine Tasse Tee. Und Godwin applaudierte.
»Sie werden es zu etwas bringen, mein Freund. Kommen Sie doch recht bald wieder.«
Als Percy und Harriet auf dem Heimweg waren, rekapitulierten sie, wer da in der Skinner Street von wem abstammte, und korrigierten einander mehrmals lachend.
»Nein, Percy, die Kleine mit den schwarzen Locken, die niedliche Jane, ist nicht Godwins leibliche Tochter; Mrs Clairmont Godwin hatte sie schon, als sie ihren jetzigen Mann kennenlernte, genau wie den älteren Charly.«
»Sie war demnach vor der Heirat eine Witwe?«
»War sie nicht. Von Fanny habe ich gehört, dass beide Kinder außerehelich geboren wurden – sie haben verschiedene Väter.«
Percy nickte anerkennend. »Aber der kleine Junior – dessen Eltern sind die Godwins.«
Harriet ergänzte: »In der Küche hat die Mutter mir erzählt, dass es noch eine weitere Tochter gibt, die zurzeit in Schottland lebt, Tochter aus ›Papas‹ erster Ehe, von ihm und Mary Wollstonecraft. Sie ist ein halbes Jahr älter als Jane und heißt auch Mary.«
»Drei Mädchen also hat Godwin zu versorgen, nur eines davon sein eigen Fleisch und Blut. Und zwei Knaben, einer davon sein leibliches Kind. Ein Sieben-Personen-Haushalt, und nun zähl noch die Dienstboten hinzu. Godwin hat schon in seinen Briefen angedeutet, die Verlagsbuchhandlung würfe nicht genug ab, er sei hoch verschuldet. Wir müssen überlegen, wie wir ihn unterstützen können.«
In Schottland hatte die junge Mary Godwin derweil eine gute Zeit. Zu dieser Landverschickung war es schon vor anderthalb Jahren gekommen; Mary war, wie man seinerzeit liebevoll und diskret formulierte, von zarter Gesundheit, und Besserung würde, so der Arzt, allein die Seeluft bringen. Wie die meisten Teenager hatte Mary große Lust zu reisen, aber sie fürchtete sich vor der Trennung von ihrem Vater – dem über alles geliebten. Außerdem wurde sie leicht seekrank, so sah sie der Schiffsfahrt mit gemischten Gefühlen entgegen. Aber als sie dort oben angekommen war, bei Familie Baxter, Bekannte Godwins, Nonkonformisten, wohnhaft nahe der Stadt Dundee am Fluss Tay, fühlte sie sich auf der Stelle wohl und aufgehoben. Bei ihrem ersten Besuch im Norden war sie vierzehn Jahre alt gewesen, »a bookish girl«, wie Zeitgenossen sie nannten, stets in Lektüre vertieft, aber auch selbst fabulierend und schreibend. Als ich ein Mädchen war, so drückte es die Schriftstellerin Jahrzehnte später in einem Vorwort aus, verbrachte ich viel Zeit in Schottland. Die Ufer des Flusses Tay waren mir ein freundlicher Ort, an dem ich ungestört mit den Geschöpfen meiner Fantasie verkehren konnte. Dort unter den Bäumen nahe unserem Haus oder auf den gebleichten Felsen der baumlosen nahen Berge wurden die luftigen Gestalten meiner Vorstellung geboren und aufgezogen. Ich machte nicht etwa mich selbst zur Heldin meiner Geschichten. Das Leben erschien mir, was mich selbst betraf, als eine banale Angelegenheit. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass romantische Leiden oder wunderbare Begebenheiten jemals mein eigenes Los werden könnten. Meine Fantasie war nicht auf meine Person beschränkt, ich konnte sie mit Geschöpfen bevölkern, die mir in jenem Alter weit interessanter erschienen als meine eigenen Gefühle.
Eine große Rolle in Marys schottischer Zeit spielte Isabel, eine der Töchter ihrer Gastfamilie, mit der sie sich blind verstand. Isabel war ein paar Jahre älter, mit ihr konnte Mary über alles reden – auch darüber, wie bedrückt sie zu Hause unter dem Regiment ihrer Stiefmutter gewesen war und für wie unwürdig sie diese dahergelaufene Person der Liebe ihres Vaters fand. »Wenn sie nicht eines von uns Kindern zur Schnecke machen kann, ist sie nicht zufrieden.«
Und manchmal, wenn Isabel und Mary am Flussufer einen Platz gefunden hatten, an dem sie sich niederlassen und übers Wasser blicken konnten, und wenn Isabel Mary bat, sich zu erinnern, was der Vater ihr so erzählt habe, holte Mary aus und berichtete von alten Zeiten, in denen ihre Mutter noch lebte. Eine Mutter, von der sie mit Ehrfurcht sprach, denn sie war eine Frau von großen Verdiensten. Mitten in den gefährlichen revolutionären Kämpfen hatte sie sich nach Paris getraut, dort an den Debatten um die Republik und die Frauenrechte teilgenommen, und sie war dabei ganz auf sich gestellt. Sie war Schriftstellerin geworden, die berühmte Mary Wollstonecraft, und als sie nach ihrer Rückkehr in die Heimat Marys Vater, den sie schon aus einem freigeistigen Verlegerzirkel kannte, wieder traf, da war es um beide geschehen, da wollten sie zusammenbleiben und füreinander da sein, alle Zeit. »Aber nicht so wie andere Paare«, sagte Mary, »an eine Eheschließung dachten meine Eltern nicht. Das war das Freigeistige an ihnen, das Revolutionäre. Sie fanden es nicht richtig, Gesetze über Gefühle zu stellen und aus der Liebe eine Pflicht zu machen.«
»Aber sie haben es getan. Sie haben geheiratet.«
»Ja, weil ich unterwegs war. Eine Frau, die ein Kind bekam ohne Ehemann – was hatte die zu leiden und sich anzuhören! Sie galt als Sünderin, als Hure, als verworfenes Geschöpf. Ist das heute anders? Nein. Mein Vater wollte nicht, dass meine Mutter verachtet würde, verstehst du, er wollte auch, dass sein Kind seinen Namen trägt. So sind sie dann doch ein Ehepaar geworden – einfach weil die anderen Menschen noch nicht so weit waren, anzuerkennen, dass freie Liebe etwas viel Großartigeres ist; dass die Liebe frei sein muss, damit sie … Liebe bleibt.«
»Der Pfarrer hat sich bestimmt gefreut.«
»Die Meinung des Pfarrers hat meinem Vater nicht viel bedeutet. Er ist kein religiöser Mensch. Er sieht in der Religion den Versuch, die Herzen und den Geist der Menschen zu unterwerfen. Gäbe es Gott, so wäre er entsetzt, was in seinem Namen alles geschieht.«
»Meinst du nicht, dass es sein könnte … dass Gott deinen Vater für seinen Unglauben gestraft hat, als er ihm deine Mutter nahm?«
»Es war das Kindbettfieber, Isabel. Viele Frauen leiden darunter. Und sterben daran. Ich glaube nicht, dass Gott seine Hand im Spiel hatte.«
»Manchmal ängstigt mich der Gedanken, dass ich ein Kind bekommen werde. Wie soll das gehen ohne Gottvertrauen? Und ohne Gebete? Ach Mary, wenn wir Jungen wären, würden wir jetzt griechische Gedichte übersetzen.«
»Ich sollte ein Junge werden. Meine Eltern hatten sogar schon einen Namen: William. Irgendwie bin ich wirklich ein Junge geworden, weißt du. Jedenfalls werde ich griechische Gedichte übersetzen.«
***
Eines Tages war es so weit, dass Mary nach London zurückkehren musste – aber daheim stellte sich heraus, dass ihre Gesundheit immer noch ziemlich zart war und dass die Highlands, der Tay und vor allem Isabel ihr schrecklich fehlten. So kam es zu einer zweiten Reise nach Schottland und zu einem weiteren längeren Aufenthalt Marys bei den Baxters. Ferien aber waren das durchaus nicht. In der Familie Baxter, die durch Tuchfabrikation wohlhabend geworden war, wurde viel gelesen und gelernt, Hauslehrer kamen zum Unterrichten, und der junge Gast war davon nicht ausgeschlossen. William Godwin legte außerordentlich großen Wert auf die Bildung seiner Kinder, auch und vor allem seiner Töchter – die Jungen besuchten öffentliche Schulen – und er hatte seine intelligente Mary mit viel Ehrgeiz selbst unterrichtet. Mary besaß gute Kenntnisse in den Fächern Geschichte, Literatur und Philosophie, sie war in die Anfangsgründe des Lateinischen eingeführt worden und konnte schon ziemlich gut Französisch. Außerdem hatte sie zeichnerisches Talent und dichterische Fantasie. Für Godwin war jeder Tag, an dem nicht gelesen, gebüffelt, geübt und referiert wurde, ein verlorener Tag. Mary dachte ebenso. Dennoch hatte der besorgte Vater vorab an die Baxters geschrieben: Ich bemühe mich, sie wie einen Philosophen, ja wie einen Kyniker zu erziehen. Das wird viel zu der Stärke und dem Wert ihres Charakters beitragen. Ich sollte überdies hinzufügen, dass sie keinerlei Hang zur Zerstreuung hat und mit ihren Wäldern und Bergen vollauf zufrieden sein wird. Ich wünschte außerdem, dass sie zu mehr Fleiß angetrieben würde. Gelegentlich verfügt sie über große Ausdauer. Aber manchmal muss man sie etwas aufrütteln. Hätte Godwin gewusst, dass seine Tochter in ihrer schottischen Zeit an schriftstellerischen Versuchen feilte und im Angesicht der Highlands und des Meeres ihrer Fantasie freien Lauf ließ, woraufhin die luftigen Gestalten ihrer Vorstellung geboren wurden, um sie von jetzt an treu zu umschweben – es hätte ihn bestimmt gefreut. Seit das Mädchen auf der Welt war, träumte er davon, dass aus ihr eine berühmte Schriftstellerin würde. Aber dafür, so meinte er, müsste sie nun bald unter seine Fittiche und seinen Einfluss zurückkehren; schließlich war sie inzwischen mit ihren sechzehn Jahren so gut wie erwachsen.
Ein weiteres Mal hieß es für Mary Abschied nehmen von den Baxters, eine große Familie, deren Mitglieder Mary allesamt ans Herz gewachsen waren. Es war im Mai des Jahres 1814. Sie stand mit ihren Gastgebern neben Isabel am Pier, die Koffer wurden aufs Schiff gehievt. Beide Mädchen versprachen einander Briefe, Briefe und noch mehr Briefe. Ein letzter Kuss auf Isabels Wange, ein Händedruck mit Mutter Baxter, und Mary ging an Bord. »Schreib mir was über den Dichter«, rief Isabel ihr nach, »diesen, du weißt schon, Shelley. Ich möchte wissen, ob er nur ein Wirrkopf ist oder ein echter Revolutionär.«
Aus Briefen von zu Hause wusste Mary, dass es seit Längerem außer den treuen Freunden William Hazlitt, einem Kritiker, und den Dichtern Samuel Coleridge und Charles Lamb, die oft vorbeischauten, noch einen weiteren Wahlverwandten in der Skinner Street gab: Percy Bysshe Shelley. Den hatte sie noch nicht kennengelernt; sie hatte ihn zwar vor zwei Jahren kurz in der elterlichen Wohnung gesehen, aber sie erinnerte sich nicht mehr an ihn. Isabel, die sich brennend für alles interessierte, was mit der Französischen Revolution zusammenhing, und gehört hatte, dass Shelley ein Parteigänger der Jakobiner war, hätte Mary am liebsten nach London begleitet, um diesen gerade mal einundzwanzigjährigen Dichter selbst kennenzulernen. Fanny berichtete, er rede viel und klug und meist über Politik, wenn nicht über Poesie. Alle waren von ihm eingenommen, denn er hatte nicht nur die Tischgespräche belebt und Fanny – so meinte Jane – beziehungsweise Jane – so meinte Fanny – den Kopf verdreht, sondern auch größere Summen als nicht rückzahlbare Dotationen in Aussicht gestellt, damit Godwin seine drückenden Schulden loswürde. Ein guter Geist war da also in die Familie gefahren, ein Retter, ein Wohltäter. Mary war sehr gespannt auf diesen jungen Mann und fest entschlossen, ihren eigenen Kopf hoch auf den Schultern zu behalten. Zumal Shelley mit einer Ehefrau lebte, die er entführt hatte, als sie sechzehn war und die bezaubernd schön sein sollte. Seit einem knappen Jahr hatten die beiden eine kleine Tochter.
Im Jahre 1814 war die politische und soziale Lage in England äußerst angespannt. Infolge Napoleons Politik der »Kontinentalsperre«, die nichts anderes war als ein Verbot für die Länder in Frankreichs Machtbereich, Waren aus Großbritannien einzuführen, hatte sich eine große Wirtschaftskrise ereignet; zugleich machten die Folgen der Industriellen Revolution, machten Maschinen – vor allem in der Textilindustrie – immer mehr Menschen arbeitslos. Die Politiker reagierten hilflos, sie beschränkten sich darauf, die Privilegien der Reichen in Stadt und Land zu sichern, und überantworteten die »labouring poor« ihrem Elend. Für Intellektuelle wie Shelley, Godwin und Hazlitt ergaben sich täglich neue Anlässe, in Gedanken auf die Barrikaden zu steigen, in Worten und Taten aber nach gewaltfreien Wegen zu suchen, um die Zustände zu ändern. Als Mary das erste Mal an einer abendlichen Gesprächsrunde im Wohnzimmer ihres Vaters teilnahm, in Gesellschaft der Familie und jenes Dichters Percy Shelley, saß sie scheu und verschlossen dabei. Sie hörte die Männer disputieren, es ging um Getreidezölle, und überlegte derweil, wie sie Isabel den jungen Mann schildern solle. Er war groß und dünn, trug sich nachlässig mit bunter Weste, engen Beinkleidern, das blonde wellige Haar ungetrimmt und fast schulterlang. Sah er nicht aus wie ein Mädchen – die großen Augen, die rosige Haut, kein Bartwuchs? Aber wie er dann lachte und fuchtelte und seine Meinung verteidigte, dabei glühten seine Blicke – das war doch männlich. Er zwinkerte Fanny zu, das entging Mary nicht. Als er sich verabschiedet hatte, nahm sie Jane beiseite.
»Warum hat er seine Frau nicht mitgebracht? Auf sie war ich fast noch neugieriger als auf ihn.«
»Die beiden haben sich gestritten. Der Haussegen hängt ziemlich schief.«
»Warum denn?«
»Percy will, dass Harriet das Baby selbst nährt, aber sie hat eine Amme engagiert.«
»Ach.«
»Percy sagt, das Ammenwesen sei ein übler Auswuchs, eine typische Erfindung der Aristokratie und der Anfang der Entfremdung von Mutter und Kind.«
»Aber warum holt sie eine Amme, wenn doch ihr Mann …«
»Harriet tut, was ihre Schwester Eliza sagt. Die ist um einiges älter und weiß alles besser.«
Nachdem Mary und Percy einander vorgestellt worden waren, kam der junge Mann erneut in die Skinner Street und traf Mary im Laden an, wo sie aushalf und Bücher sortierte. Er zog sie ohne viel Worte vor die Tür und lief mit ihr die Straße entlang.
»Ich muss dir sagen«, begann er, »dass ich förmlich erstarrt war, als ich dich gestern zum ersten Mal sah. Ich konnte nicht sprechen, ich konnte nur schauen. Denn du bist das Ebenbild deiner Mutter.«
Mary blieb stehen. Das Portrait ihrer Mutter hing im Arbeitszimmer des Vaters, es dominierte den gesamten Raum. Die zweite Mrs Godwin hatte schon mal den Vorschlag gemacht, es an einen weniger prominenten Ort zu hängen, weil, wie sie behauptete, es dort besser abzustauben wäre, aber darüber war mit Mr Godwin nicht zu reden. O ja, Mary Wollstonecraft war eine sehr hübsche Frau gewesen, und Mary, ihre Tochter, wusste, dass sie ihr glich. Es freute sie, dass Shelley das aufgefallen war. Sie wusste nicht, was sie hätte erwidern können und sagte deshalb nichts. Langsam gingen sie weiter.
»Die wiedergeborene Mary Wollstonecraft«, sagte Shelley andächtig und ergriff kurz ihre Hand. »Ich habe gehört, du schreibst Geschichten? Wie deine Mutter?«
»Wer hat das gesagt?«
»Fanny hat es gesagt. Und deine Stiefmutter. Sie hofft, dass du jetzt damit aufhörst und im Laden mit anpackst.«
Mary schnaufte. »Was die sich einbildet.«
»Ihr seid nicht gut aufeinander zu sprechen?«
»Sie kümmert mich nicht. Aber dass sie meinen Vater … dass sie ihn unmöglich glücklich machen kann, das quält mich.«
»Sie kocht gut.«
»Vater braucht noch andere Speise. Ich muss zurück in den Laden.«
Schweigend liefen die beiden nebeneinanderher. Mary war ganz ruhig. Sie hatte sich davor gefürchtet, zu Hause in den alten Trott zu fallen, sich mit ihrer Stiefmutter anzulegen und den ganzen Tag mit schlechter Laune rumzulaufen, aber jetzt erschienen ihr die Straße, das Haus und der Laden in hellen Farben. Sie verabschiedete sich von ihrem Begleiter und ging zurück zu ihren Büchern. Während sie die Bände ordnete und ins Regal stellte und sie wieder herausnahm, weil sie sich vertan hatte, dachte sie an Shelley. Er war anders zu ihr als die jungen Männer, die sie sonst kannte, zum Beispiel die Baxter-Jungen. Shelley flirtete nicht. Er war geradeaus und klar und ernst. Ein seltsamer Vogel, dachte sie.
Wann immer sie die Gelegenheit wahrnehmen und vor den Anweisungen der Stiefmutter flüchten konnte – es gab stets etwas zu tun im Laden und in der Küche, und Mrs Godwin liebte es, Befehle zu erteilen –, wann immer sie ein paar freie Minuten kommen sah, packte Mary Bücher, Stift und Notizheft in ihren Beutel, schlüpfte aus dem Haus und begab sich zum Friedhof St. Pancras, wo ihre Mutter begraben lag. Der Vater hatte ihr erzählt, dass sie, Mary, einst anhand der Buchstaben auf dem Grabstein lesen gelernt habe. Die Totengräber, der Friedhofsgärtner und so manche Witwe, sie kannten das zarte junge Mädchen mit dem wundervollen goldbraunen Haar, das so lange lesend neben dem Grab der Mary Wollstonecraft kauerte, und sie freuten sich, dass sie nach langer Pause jetzt zurückgekehrt war. Man wusste, wer sie war, und fand es gottwohlgefällig, dass die Waise auf diese Art die Nähe ihrer Mutter suchte. Niemand wagte sie zu stören, wie sie da vertieft schien in ihre Lektüre und ihre Notizen. Bis dann auf einmal jemand neben sie trat, ihr die Hand auf den Scheitel legte und »Guten Tag, Mary« sagte. Mary wusste gleich, wer es war, sie erschrak nur mäßig, schaute aber auf mit gerunzelter Stirn.
Mary Shelley, Gemälde von Samuel John Stump, 1831
»Ich bin dir gefolgt«, sagte Shelley und ließ sich neben ihr nieder. »Hast du nichts bemerkt?« Mary schüttelte den Kopf. »O ja, ich kann gut schleichen. Zeig, was du liest. Lukrez. Das ist gut. Er hat Epikur seinen Zeitgenossen vorgestellt und ihnen gesagt: ›Lebt hier und jetzt, die Götter sind fern und nicht imstande, euch zu helfen, auch nicht, euch zu verderben.‹ Die Seele ist sterblich, liebste Mary, und wie der Körper hier auf Erden des größten Glückes fähig.«
»Hat man ihn wegen seines Freidenkertums verfolgt? Hat man versucht, Lukrez den Mund zu verbieten?«
»Wir wissen nichts über sein Leben. Was wir von ihm haben, sind seine Worte, seine Gedanken. Er glaubte, dass alle Materie aus Atomen zusammengesetzt sei. Eine moderne Ansicht, nicht wahr? Er war ein beherzter Denker. Lies ihn, du machst es richtig.«
»Mein Latein ist noch dürftig. Ich muss immer wieder im Wörterbuch nachsehen. Aber es wird langsam besser.«
»Wenn ich bedenke, dass ein Mädchen wie du, dass ein Kopf wie du, ein Mensch mit Geist, mit Fantasie, irgendwann die Bücher stehen lässt und nichts anderes macht, als Kinder auszuzanken und Wäsche aufzuhängen und eifersüchtig nach dem Ehemann zu spähen, der irgendwo in einem Gasthaus hängen geblieben ist, nur, weil du ein Weib bist, vorgesehen angeblich von der Natur für häuslichen Krims und Krams …«
»Ha, wenn du das von mir glaubst, dann bist du in großem Irrtum, Percy Bysshe! Bookish girl, haben die Nachbarn und die Tanten gesagt, das war ich, und das werde ich immer sein, und ich werde selbst Bücher schreiben.« Sie nahm den Lukrez und schlug ihn einige Male gegen Shelleys Stirn, ordentlich heftig, und er ließ sie gewähren, hob die Arme im Spaß, als würde da ein schrecklicher Angriff gegen ihn gefahren.
Das war sogar so. Mary würde ihr Lebenskonzept vor ihm als unverhandelbar verteidigen. Was immer aus ihr würde, sie würde bookish bleiben.
Und wieder holte Shelley sie aus der Buchhandlung ab, und da er sehr gut wusste, dass die Nachbarn sie beobachteten und darüber reden würden, dass die mittlere Godwin-Tochter so oft Seite an Seite mit dem berüchtigten Dichter die Straße entlangwanderte, rief er Jane, und diese gesellte sich zu ihnen als eine Art Anstandswauwau. Man sprach über das Theater oder über die neuesten Geistergeschichten aus der Feder von Ann Radcliffe oder Matthew Gregory Lewis. Jane hatte nicht so viel gelesen wie Mary, sie war eigentlich gar nicht bookish, aber sie spürte, dass sie Shelley gefiel, wenn sie vor den beiden rückwärts lief und trotzdem nicht gegen den nächsten Baum prallte. Sie hatte Spaß daran, kleine Zettel mit Nachrichten zwischen Mary und Shelley hin- und herzutragen – sie las sie auch nicht, das versprach sie und das hielt sie. Shelley wohnte nicht weit entfernt, er war in eine Pension gezogen, ohne Harriet.
»Wenn du so darauf bestehst, dass deine Frau euer Baby selbst stillt, dann solltest du auch an ihrer Seite sein und das Kind wiegen, damit die Mutter mal Atem holen kann«, sagte Jane und baute sich vor ihm auf. Sie konnte sich noch gut daran erinnern, wie es zuging, als ihr kleiner Bruder William im Lauflernalter war. Irgendjemand schrie immer: der Kleine, seine Mutter, Godwin, der seine Ruhe wollte, oder Charly, dem Willy aufs Kissen gepinkelt hatte. Babys sind anstrengend, das hatte auch Shelley erfahren, und es hatte ihm zu schaffen gemacht. Er stimmte Jane zu, brachte aber zu seiner Verteidigung vor, dass er es aufgegeben habe, sich mit Eliza anzulegen, seiner Schwägerin, die seit der Flucht mit Harriet, damals vor drei Jahren, nicht von ihrer Schwester Seite gewichen war.
»Sie ist ein Drachen und absolut geistlos. Ich kann nicht mit ihr reden.«
»Warum schickst du sie nicht einfach fort?«
»Das wäre schwierig. Harriet scheint sie zu brauchen. Es ist, wie es ist.«
Jane machte ein paar Tanzschritte rückwärts und lief zur Skinner Street. Shelley und Mary zogen weiter zum nahe gelegenen Park und steuerten eine Bank unter Akazienbäumen an. Shelley sagte: »Wenn die Abendsonne so auf deinen Kopf scheint, verwandelt sich dein Haar in eine Aureole aus gesponnenem Kupfer. Und dazu deine Haut so weiß, weißer als Schnee.«
»Sag mir, wie es um dich und Harriet steht. Es kann doch nicht nur um das Baby gehen.«
»Ich habe sie damals befreit, weißt du, aus den Klauen von Lehrerinnen und Pfaffen und Eltern, die ihr Vorschriften machten und Befehle erteilten, denen sie nicht zu folgen vermochte, die sie eingezwängt hatten in enge Räume, Regeln und Doktrinen – ihren Körper, ihre Seele, ihren Verstand. Sie schien mir begabt und bildbar, reich beschenkt von der Natur mit Liebreiz und Sanftmut, beschränkt nicht durch sich selbst, sondern durch widrige Umstände, die stärker waren als sie, denen sie ohne äußere Hilfe keinen Widerstand entgegensetzen konnte. Diese äußere Hilfe wollte ich sein. An meiner Seite sollte sie zu sich selbst finden, ihrer Klugheit vertrauen, ihre Talente entwickeln, ihre Kraft fühlen und neuen Lebensmut schöpfen. Und so kam es auch. Aber dann …«
Mary wartete darauf, dass Shelley weiterspräche, aber als nichts mehr kam, ergriff sie das Wort: »Liebe ist das eine«, sagte sie, »Treue das andere. Musst du nicht zu ihr stehen, auch wenn sie nicht die Frau ist, die du einst in ihr gesehen hast?«
»Ich muss zu ihr stehen, keine Frage, sie hat unser Kind geboren und erwartet, so scheint es, ein zweites. Aber ein Zusammenleben ist nicht mehr möglich, das müsste sie selbst ebenso empfinden. Sie geht in einer Weise auf in den allerkleinsten Nichtigkeiten des Alltags, dass mir die Haare zu Berge stehen. Sie und Eliza bilden eine Front gegen mich – voller Verachtung für meine Kunst und voller Vorwurf gegen meine Lebensführung. Es ist zu Ende. Was ich Harriet geben wollte, hat sie nicht angenommen. Eine weitere Gabe für sie ist nicht in meinem seelischen Gepäck.«
»Sie kann dich verpflichten, Bysshe. Immerhin habt ihr die Ehe geschlossen.«
»Oh, komm mir nicht damit! Über die Ehe hat dein ehrwürdiger Vater alles Nötige gesagt. Er nannte sie das übelste aller Monopole, das bei Lichte besehen kein Mensch an einem anderen geltend machen dürfe. Wer wollte ihm widersprechen? Die Dinge liegen ganz einfach. Die Liebe ist frei. Zu versprechen, ewig dieselbe Frau zu lieben ist nicht weniger absurd als zu geloben, ewig demselben Glauben anzuhängen. So ein Schwur würde uns in beiden Fällen von jeglicher Erfahrung abschneiden. Die Sprache der Ehebefürworters und Pfaffen lautet so: Die Frau, die ich jetzt liebe, mag unendlich tief unter vielen anderen stehen; der Glaube, den ich jetzt bekenne, kann aus lauter Irrtümern und Wahnvorstellungen zusammengesetzt sein, aber ich schließe mich selbst von allen zukünftigen Erfahrungen in Sachen Liebe oder Glaube aus, und meiner tieferen Überzeugung zum Trotz entscheide ich mich: diese Frau und dieser Glaube, sie seien mein für alle Ewigkeit. Ist das die Sprache des Zartgefühls und der Vernunft? Ist die Liebe eines solchen fühllosen Herzens mehr wert als sein Glaube?«
»Es gehört Mut dazu, so gegen die Erwartungen und die Moral der Menschen anzugehen«, sagte Mary. »Denn schöne Worte reichen nicht. Man muss auch so leben, wie sie es verlangen.«
»Es reicht nie, nur zu reden. Auf das Tun kommt es an.«
»Freiheit und Liebe. Die Worte gehören zusammen. Sie sind beide so schön.«
»Liebe verkümmert unter Zwang. Ihr Wesen ist Freiheit. Sie geht weder mit Gehorsam zusammen noch mit Eifersucht oder Furcht. Sie ist da am reinsten, ist vollkommen und kennt kein Ende, wo die Menschen, die einander gewählt haben, in Vertrauen leben, in Gleichheit und Offenheit.«
Mary mochte es, wenn Shelley philosophisch wurde und sie, nicht immer nur ihr Vater, die Angesprochene war. Sie nahm seine Gedanken auf und führte sie fort: »Kein Gesetz kann derlei garantieren oder auch nur einfordern.«
»Das gilt auch für die körperliche Liebe«, sagte er. »Auch sie muss frei sein. Die sexuelle Verbindung sollte nur andauern, so lange zwei Menschen in Liebe zusammenkommen. Jedes Gesetz, das sie zum Beischlaf nötigt, nachdem ihre Gefühle füreinander erkaltet sind, wäre nichts als eine unerträgliche Tyrannei.«
»Aber die Menschen bezeichnen so ein Leben in freier Liebe als Promiskuität und Sittenlosigkeit und verdammen es.«
»Mary, es ist genau umgekehrt. Die Zwangsinstitution Ehe treibt die Männer ins Bordell und die Frauen in die Treulosigkeit. Beständigkeit als solche ist keine Tugend, und an einer Trennung ist nichts Unmoralisches.«