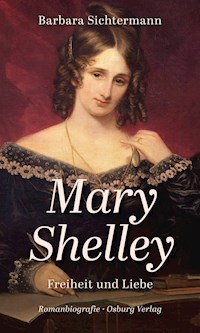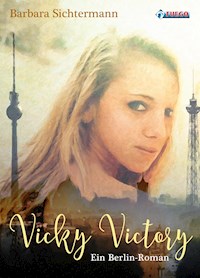17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: marix Sachbuch
- Sprache: Deutsch
Es sind Namen, die wiederholt durch die Medien gehen, große Namen, Namen engagierter, entschlossener junger Frauen, deren gesellschaftlicher Einsatz weltweite Aufmerksamkeit erlangt hat: Carola Rackete, Greta Thunberg, Malala Yousafzai und viele mehr. Sie repräsentieren eine weibliche Generation, die zu nachhaltigen und manchmal militanten Protestaktionen gegen Klimasünden und Menschenrechtsverletzungen entschlossen ist. Dabei ist es kein Zufall, dass es Fackelträgerinnen sind, die der Revolte vorangehen. Barbara Sichtermann beschreibt in fesselnden Porträts nicht nur die Lebensgeschichten dieser Weltenretterinnen, sondern widmet sich auch den Zuständen und Problemen im jeweiligen Land und Kulturraum, den Protestbewegungen, der Situation der jungen Menschen, den Formen der Auflehnung, der Politik der Machthaber. Nicht zuletzt wird die Bedeutung internationaler Vernetzung sichtbar, ebenso wie die Organisationen und spontanen Widerstandsbewegungen vor Ort.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
BARBARA SICHTERMANN
WELTEN-RETTERINNEN
ES GEHT UMS GANZE
INHALT
Vorwort
Menschenrechte, Frieden und humanitäre Hilfe
»Wenn ich es nicht tat« | Carola Rackete
»Wir sagen Bullshit!« | X (Emma) Gonzáles
»Sie alle sollen vor Gericht!« | Nadia Murad
»Wir kauten Wurzeln« | Yeonmi Park
»I am Kenyan« | Sophie Umazi Musimbi Mvurya, Memory Banda
Klima und Umwelt
»Wie könnt ihr es wagen!« | Greta Thunberg
»Das Gute ist machbar« | Luisa Neubauer
Rettet den Regenwald! | Helena Gualinga, Rayanne Cristine Maximo Franca
Demokratie und Selbstbestimmung
»Für eine anständige Slowakei« | Karolína Farská
»Einfach nur Selbstbestimmung« | Agnes Chow Ting
Vom Auslachen der Mächtigen | Nadeshda Tolokonnikowa
»Ich bin Femen« | Oksana Schatschko
»Prozess gewonnen!« | Shiori Itō
Frauenrechte und Bildung
»Eine von Vielen« | Malala Yousafzai
»Die Frau, die Auto fährt« | Loujain al-Hathloul
»Sein Leben in die Hand nehmen« | Hila und Wana Limar
»Die Frauen holen das Wasser« | Oladosu Adenike
»Das muss ein Ende nehmen« | Natasha Mwansa, Hadja Idrissa Bah
»Lach nicht so laut!« | Nancy Herz
#FreePeriods | Amika George, Ollie Bell
Die Weltenretterinnen in Kurzporträts
Literatur und Quellen
VORWORT
Helena Gualinga kam im ecuadorianischen Regenwald zur Welt und ging in Finnland zur Schule; ihre Mutter ist eine indigene Frau, die gegen die Zerstörung ihrer Heimat in Amazonien kämpft, ihr Vater ein Naturforscher aus Skandinavien. Und Helena setzt sich jetzt mit den Mitteln europäischer Wissenschaft für die Erkundung und Bewahrung indigener Kultur in Südamerika ein. Auch das ist ein Aspekt der Globalisierung: dass eine junge Generation heranwächst, die in beiden Hemisphären zu Hause und so in der Lage ist, das Verständnis der einen Hälfte der Erde für die andere und vice versa zu wecken. Die Familie der Nancy Herz kommt aus dem Libanon, das Kind wuchs in Oslo auf. Sie vermag ihren Mitschülerinnen zu beweisen, dass auch ein Mädchen mit Kopftuch etwas im Kopf hat, und sie hat ihre Eltern davon überzeugen können, dass es irgendwann besser für sie war, das Kopftuch abzulegen. Orient und Skandinavien begegnen sich in den Lebensentscheidungen einer jungen Frau, die keine der beiden Welten aufgeben will und so jede Welt aus ihrer Selbstgenügsamkeit herausreißen muss. Hila und Wana Limar sind in Afghanistan geboren, ihre zweite Heimat wurde Hamburg, von wo aus sie jetzt versuchen, in ihrem Geburtsland etwas zu verändern. Die Japanerin Shiori Itō hat ihren Vergewaltiger angezeigt, floh vor den Shitstorms ihres patriarchalischen Landes nach Großbritannien und kehrte mit der #MeToo-Bewegung im Gepäck nach Hause zurück. Die Nordkoreanerin Yeonmi Park war illegal in China und der Mongolei unterwegs, bis sie von den USA aus in Aktion treten konnte, um den Menschenhandel in Asien zu unterbinden. Rebellion, Aufstand, Aus-der-Rolle-Fallen und humanitäre Hilfe haben eine globale Dimension angenommen, was an sich nicht neu ist, aber dank des Internets heute sowohl schneller geht als auch besser auf Dauer gestellt werden kann – weil der Informationsfluss nicht so bald versiegt. Die Umweltbewegung, heute getragen von jungen Frauen wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer, ist von vornherein global angelegt: Hier richten die Aktivistinnen ihre schweren Vorwürfe und verzweifelten Aufrufe immer »an alle« und vornehmlich an die Mächtigen auf den fünf Kontinenten. Die Appelle für politische Freiheit und für den Frieden, wie ihn Sophie Mvurya, Nadja Tolokonnikowa, Oksana Schatschko und Agnes Chow formuliert haben, sollten nicht nur in ihren jeweiligen Ländern gehört werden, sondern waren immer schon an die ganze Welt gerichtet. Das Internet half bei diesem Ehrgeiz, eine Botschaft über die Erde zu tragen, ja, es war eine wichtige Bedingung dafür, den vielfältigen Revolten Bilder beizugeben, sie also visuell anzureichern und ihr Töne hinzuzufügen, sie also lautlich zu verstärken und ihren Sinn überallhin zu transportieren. Eine Frage aber bleibt: Warum eigentlich sind es vor allem Mädchen und junge Frauen, die auf der Weltbühne des Protests und der Solidarität nach vorne treten? Ist das nur eine optische Täuschung oder können wir wirklich sagen: Es ist die historische Stunde der girls?
Dass sich Frauen in der politischen Öffentlichkeit massenhaft und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit bewegen, ist in der Tat historisch neu. Und weil es neu ist, macht es Eindruck. Man hört hin. Im Lebensgefühl aller Menschen war bis vor etwa zwei Generationen die Vorstellung, dass Frauen ein häusliches Dasein führten und Männern die Politik vorbehalten war, so tief verankert, dass weibliche Opposition zu Weltlauf und Zeitgeist als Ding der Unmöglichkeit galt. Mächtige Frauen gab es als Ausnahmen immer wieder, aber sie waren zumeist Statthalterinnen, das heißt als Witwen oder Regentinnen für unmündige Söhne ins Amt gelangt. Solange sie die Männer nur vertraten, konnte das Weltbild von den unpolitischen Frauen und der Macht als Männersache durchaus intakt bleiben. Das galt auch für das Wirtschaftsleben, in dem Frauen ja als wichtige Macherinnen bis hin zum Fernhandel immer mal anzutreffen waren. Doch überall da, wo gesellschaftliche Subsysteme wie Militär, Klerus, Zünfte oder politische Parteien und Beamtenschaften hierarchisch gegliedert und vermachtet waren, gab es keine Frauen. Der Wandel hat, vom Beginn der ersten Gleichberechtigungsforderungen an, lange gedauert, in Europa und der Neuen Welt circa zweihundert Jahre. Aber jetzt ist es so weit, Frauen kommen vor und voran und wollen Vieles anders machen. Dieser Emanzipationsprozess springt vom Westen und Norden in den Süden und Osten der Erde, befördert und vervielfältigt von den neuen Kommunikationstechniken. So kommt dreierlei zusammen: Emanzipation der Frauen, Globalisierung und Digitalisierung, und das Wunder geschieht: Junge Frauen melden sich in aller Welt lautstark zu Wort. Ihre Stimmen werden nicht mehr als zu hoch und zu leise disqualifiziert und überhört, weil sie technisch jede Menge Verstärkung erfahren. Sie gelten nicht mehr als inhaltlich unerheblich, weil es jetzt so viel politische Erfahrung auf Seiten von Frauen gibt, dass man weibliche Gegenrede und Einlassung nicht mehr als nebensächlich abtun kann. Dass die Frauen, die in diesem Buch zu Wort kommen, fast alle jung oder sehr jung sind, hat mit diesen drei Bedingungen zu tun: Es ist, erstens, erst jetzt dank der Vorarbeit von Feministinnen seit dem 18. Jahrhundert möglich, Frauen und Macht als Begriffe und Praxisfelder zusammen zu denken, wobei, zweitens, die digitalen Vervielfältigungsmöglichkeiten, die diesen Prozess seit ein paar Jahrzehnten begleiten, erst der jetzt herangewachsenen Generation zur Verfügung stehen. Und die Globalisierung als dritte Bedingung nimmt erst in unserer Epoche des beschleunigten Welthandels und kulturellen Austausches so starke Fahrt auf, dass das Bedürfnis, als Frau aus Amazonien in Finnland gehört zu werden oder als Afrikanerin den Frieden im Innern durch ein Echo kenianischer Aufrufe in Amerika, Europa oder Indien zu befördern, erst heute wachsen kann. Nicht früher, hoffentlich aber auch künftig.
Unsere Welt, in der so viele junge Frauen aufbegehren, sich Gehör verschaffen und dabei zugleich Entwürfe vorbringen, wie die Welt zu retten oder wenigstens zu verbessern sei, ist nicht friedlich. Sie ist nicht tolerant und auch nicht bereit, den aufmüpfigen, wütenden, eine Veränderung einklagenden Mädchen das Steuerruder zu überlassen – zu dieser Einschätzung muss man kommen, wenn man die Mehrheitsund Machtverhältnisse in den Ländern der Erde nüchtern betrachtet und die Chancen abwägt, die freiheitlich und humanitär gesonnene Minoritäten haben, ihre jeweilige Agenda durchzusetzen. Es ist auch nicht so, dass Weiblichkeit per se eine angeborene Potenz in sich schließt, der Weltpolitik einen Weg aus ihren vielfältigen Krisen zu weisen. Was man nun aber doch sagen kann und darf, ist, dass die Stunde der rebellischen Mädchen geschlagen hat, dass dieser internationale kritische Chor beachtet und zur Kenntnis genommen wird. Große Gipfelkonferenzen kommen nicht mehr um die Mädchen herum, die manchmal noch Minderjährigen werden auf die Einladungslisten gesetzt, sie treten vor die Mikrofone, halten Reden, aus denen die Weltpresse zitiert, sie bauen eigene Netzwerke auf und werden mit Preisen von wichtigen Akademien und NGOs ausgezeichnet. Sie lernen dazu; einige wollen in die Politik gehen, andere Firmen gründen oder als Netzaktivistinnen weiter wirken. Dieses Buch soll ein weiterer Verstärker sein, der die Anklagen und Anliegen der Mädchen zu Gehör bringt und das Fundament ihrer Fundamentalopposition eine Spur stabiler macht. Weil die Globalisierung auch den Protest globalisiert, muss es ja keine weiteren zweihundert Jahre mehr dauern, bis basale Forderungen nach Gleichheit und Freiheit und körperlicher Unversehrtheit überall auf dem Planeten erfüllt sind. Die Welt wird leichter zu retten sein, wenn in allen Regionen Stimmen erschallen, die Änderung postulieren und dabei auf diejenigen hören, die auf der anderen Seite der Erdkugel etwas Ähnliches verlangen. Oder ganz etwas Anderes. Der Diskurs, der so entsteht, wird eine Kardinalbedingung für eine Neugeburt der Vernunft sein und damit für die Erfüllung der wichtigsten Forderungen der Mädchen: politische und persönliche Freiheit, Klimafreundlichkeit, Bildung und Wissen für alle. Und Frieden.
MENSCHENRECHTE, FRIEDEN UND HUMANITÄRE HILFE
»WENN ICH ES NICHT TAT«
CAROLA RACKETE (GEB. 1988)
Die »Kapitänin« und die Seenotrettung im Mittelmeer
Die Sea-Watch 3 ist ein Schiff von circa fünfzig Metern Länge und fast zwölf Metern Breite. Sie wird von Viertakt-Sechzehnzylinder-Dieselmotoren angetrieben und erreicht eine Geschwindigkeit von 10 Knoten. In den 1970er-Jahren wurde sie als Offshore-Versorgungsschiff für die Ölindustrie gebaut und dort genutzt. Ihr Heimathafen ist Amsterdam. Sie gehört heute der Organisation Sea-Watch mit Sitz in Berlin, die es mit Spendengeldern erworben hat und für die Seenotrettung einsetzt.
Die Kapitänin Carola Rackete mochte das Schiff nicht besonders. Zu alt, zu sperrig und keineswegs dazu bestimmt, eine größere Menschenmenge für längere Zeit aufzunehmen. Sie mochte auch den Beruf und erst recht das Wort »Kapitänin« nicht so sehr, wollte lieber hauptberuflich für den Naturschutz arbeiten. Und sie hatte gar nichts übrig für die Popularität, die sie im Juni 2019 fast über Nacht gewann: 53 Personen aus einem in Seenot geratenen Schlauchboot hat sie knapp 50 Seemeilen vor der libyschen Küste an Bord der Sea-Watch 3 aufgenommen. Der nächste sichere Hafen war die Insel Lampedusa, den steuerte sie an, aber sie erhielt keine Genehmigung, ihr Schiff in den Hafen zu bringen. Es wurde ihr sogar strikt untersagt. Aus Deutschland signalisierte man seitens einiger Länder und Städte die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen, aber das Innenministerium unter Horst Seehofer verlangte eine Registrierung nach dem Abkommen von Dublin III: Geflüchtete hätten dort um Asyl zu ersuchen, wo sie an Land gingen. Italien aber gab kein Einverständnis zur Aufnahme der Menschen. Die Sea-Watch 3 musste draußen auf See erst hin- und herfahren, schließlich ankern und warten. Und auf ihr die zwanzigköpfige Besatzung mit den Geretteten. 17 Tage lang. Es war eine Qual. Es gab an Bord nur drei Toiletten, die Trinkwasseraufbereitungsanlage arbeitete langsam, alle litten unter der Hitze. Es gab keine Betten für die Geflüchteten, pro Person stand nur eine Decke zur Verfügung, die an Bord genommenen Menschen konnten sich nachts entweder darauf legen und frieren oder sich zudecken und auf dem harten PVC Schmerzen dulden. Kurz: Es haperte mit der Grundversorgung. Das Schlimmste aber war die Ungewissheit. Wie würde es weitergehen? Die italienische Küstenwache kam, die Guardia di Finanza (der Zoll), und es hieß immer nur: Keine Genehmigung, an einer Lösung werde gearbeitet. Die drückende, beherrschende Angst war, dass alle Flüchtlinge nach Libyen zurückgeschickt würden. Immerhin nahm die Küstenwache dreizehn akut Schwerkranke, Kinder und Schwangere mit an Land, doch die verbliebenen 40 Geflüchteten aus Nordafrika waren alles andere als gesund, sie waren erschöpft, verletzt, dehydriert und völlig fertig, manche zusammengebrochen und phasenweise sogar bewusstlos. Die Crew und auch die Kapitänin fürchteten, dass einige von ihnen ins Wasser springen würden – um an Land zu schwimmen oder einfach, um ein Ende zu machen.
Carola Rackete war bei dieser Rettungsmission eingesprungen. Ein Kapitän war ausgefallen, und sie übernahm die Stelle. Als sie darum gebeten wurde, arbeitete sie gerade in Schottland als Trainee in einem Naturschutzprogramm. »Wir sammelten Daten über Schmetterlinge, setzten Wanderwege instand, topften zuletzt bei strömendem Regen im Gewächshaus drei Tage lang Waldkiefersetzlinge um. Im Grunde wollte ich nicht weg. Trotzdem, es war ein Aufruf, der an alle gerichtet war, die auf der Kontaktliste für Notfälle standen. Ich ahnte: Das wird schwer, so kurzfristig Ersatz zu finden. Und ein Telefonat mit dem Einsatzleiter ergab, dass wirklich niemand da war, der das Schiff hätte übernehmen können. Wenn ich es nicht tat, würde die Sea-Watch 3 trotz vollständiger Besatzung nicht auslaufen können. Ich sah mich in der Verantwortung zu handeln und packte meine Sachen.«
In ihrer Jugend wusste die spätere Kapitänin eine Zeit lang nicht, was sie werden wollte. Um irgendetwas Sinnvolles zu machen, studierte sie Nautik in Elsfleth; gleich das erste Praxissemester führte sie auf einem riesigen Containerschiff einmal rund um den Globus. Danach fuhr sie auf dem deutschen Forschungsschiff Meteor und lernte das Navigieren. Es folgten Fahrten auf der Ostseefähre MS Transrussia, einem Eisbrecher; die erste Stelle als Nautikerin nach dem Studienabschluss bekam sie auf der Polarstern, auf der sie eine Arktisexpedition unternahm. Hier sah sie selbst, dass das Eis in der Polarzone eben nicht ewig ist, denn es schmilzt immer weiter mit all den desaströsen Folgen für den Meeresspiegel und das Klima. An Bord wurde geforscht, das heißt gemessen und interpretiert und berichtet, es wurde bewiesen, dass Gefahren drohen, aber in der Politik bewegte sich nichts. Rackete war mit dem, was sie tat, erneut unzufrieden. »Es reichte mir nicht mehr, als eine Art Busfahrer für die Wissenschaft zu arbeiten. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Energie nicht an der richtigen Stelle einsetzte.« 2015 begann sie ein zweites Studium in England, Omskirk, das sie mit dem Master abschloss. Sie belegte Naturschutzmanagement und betätigte sich während der Semesterferien als Freiwillige in Naturparks und für Greenpeace. Es war eine Zeit, in der immer mehr Menschen aus ihrer Heimat flüchteten: aus Syrien wegen des Bürgerkrieges, aber auch aus Pakistan, Afghanistan und Nordafrika. Rackete bewarb sich bei der neu gegründeten NGO Sea-Watch, einem gemeinnützigen Verein, der sich der zivilen Seenotrettung widmet, und wurde bald mit einer ersten Mission auf der Sea-Watch 2 betraut. Sie verfügte also schon über einschlägige Erfahrungen, als sie auf der Sea-Watch 3 einsprang. Zwar hatte sie beschlossen, nicht mehr als Nautikerin zu arbeiten, sondern sich ganz dem Naturschutz zu widmen, aber da gab es etwas, das noch wichtiger war: Leben zu retten.
Als sie 2019 von Schottland aus ihre neue Aufgabe für die Sea-Watch 3 antrat, wusste Carola Rackete, dass es nicht einfach sein würde. Die Lage hatte sich verschärft, die Staaten in der Europäischen Union konnten sich in der Flüchtlingsfrage nicht einig werden. Rechte Politiker, die sich gegen jede Art von Zuzug stemmten, hatten an Einfluss gewonnen, und in Italien war Innenminister Matteo Salvini von der rechten Partei Lega Nord ein harter Gegner jeglicher wilden Immigration und Seenotrettung vor den Küsten seines Landes. Alle zuständigen Stellen in den seefahrenden europäischen Ländern versuchten mit immer neuen bürokratischen Regulierungen die Arbeit der Rettungsschiffe zu behindern, auch die Sea-Watch 3 musste sich allerlei speziellen technischen Inspektionen seitens der niederländischen Behörden unterziehen, ein Spiel auf Zeit, in der Menschen im Mittelmeer auf Schlauchbooten in den Tod fuhren. Die Strategie hieß Abschreckung – sowohl der privaten Rettungsboote als auch der Flüchtlinge selbst. »Es war uns klar, dass Seenotrettung kriminalisiert wird. Die öffentliche Stimmung schlug um, es gab den Vorwurf, Seenotretter steckten mit Schlepperbanden unter einer Decke.« So mussten die Kapitänin und auch die Crew mit einer Festnahme und Klage seitens der italienischen Staatsanwaltschaft rechnen – der Vorwurf: Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Ein entsprechendes Dekret hatte die regierende rechtsnationale Partei in Italien durchgebracht. Das untersagte privaten Rettungsschiffen das Einlaufen in die italienischen Hoheitsgewässer. Alle auf der Sea-Watch 3 wussten das, als sie losfuhren, als sie die Flüchtlinge an Bord nahmen, als sie den Hafen von Lampedusa ansteuerten. Wenn man die Situation auf Personen projizieren darf, kann man sagen: Der Innenminister Salvini und die Kapitänin Rackete standen sich vor der Küste Lampedusas Aug’ in Auge gegenüber. Auf der einen Seite der Minister, der verhindern will, dass – wie er es sieht – arme Teufel sein Land unsicher machen, auf der anderen Seite eine Menschenrechtsaktivistin, die es nicht zulassen kann, dass die aus dem fürchterlichen Elend libyscher Lager Geflüchteten auf See den Tod finden. Wer wird nachgeben?
Das Buch, das Carola Rackete noch im selben Jahr herausbrachte und in dem sie die Rettungsaktion vor Lampedusa in allen Einzelheiten schildert, heißt Handeln statt hoffen. Das ist genau die richtige Losung für die Situation vor Ort im Juni 2019. »Ich war davon überzeugt, dass wir als Zivilgesellschaft unsere europäische Außengrenze und die Definition der Menschenrechte nicht den Rechtsnationalen wie denen im damaligen italienischen Innenministerium überlassen konnten. Wir durften uns nicht einschüchtern lassen.« Was die Kapitänin der Sea-Watch 3 ihrer eigenen Devise folgend nach siebzehn Tagen und angesichts der leidenden und verzweifelnden Menschen auf ihrem Schiff zu tun hatte, war: den Notstand erklären. Denn der war eingetreten. Handeln statt hoffen. »Ich habe die Optionen lange abgewogen. Wir hatten alle politischen und juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Es gab keine Aussicht, dass uns kurzfristig doch noch jemand half. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte unserem Büro (das Büro der NGO Sea-Watch) kurz zuvor mitgeteilt, dass Italien aktuell die politische Lösung doch wieder blockiert. Wir standen mit dem Rücken zur Wand.« Sie beruft ein Crewmeeting ein. »Ich habe entschieden, in den Hafen zu fahren.«
Es ist kurz nach Mitternacht, 29. Juni. Der Anker wird gelichtet, die Sea-Watch 3 ruft den Hafen über Funk an, aber es kommt keine Reaktion, weil niemand vom regulären Dienst mehr dort ist. Das Schiff nähert sich dem Hafen, langsam, aber stetig. Alle wissen: Es wird beobachtet. Die Kapitänin hat die Hafenkarte genau studiert, sie weiß, wo ein Liegeplatz ist. »Als ich das Schiff drehe, um anzulegen, legt sich ein Zollboot zwischen den Pier und die Sea-Watch 3. Sie haben Anweisungen vom Innenministerium, uns zu blockieren, wie ich später herausfinde. Ich versetze das Schiff, um hinter sie zu fahren, aber sie bewegen sich ebenfalls zurück und blockieren uns erneut. Ich gehe raus auf den Brückenflügel, um sie im Blick zu behalten. Unser Schiff liegt fast vollständig gestoppt neben dem Pier, dazwischen das Zollboot. Die Zeit scheint einen Moment stillzustehen.« Die Sea-Watch 3 findet in diesem Hin und Her schließlich ihren Weg in den Hafen, sie touchiert dabei das Zollboot, eine nur leichte Berührung, eine bloße Sachbeschädigung, unvermeidbar. Dann sind die Geretteten und die Kapitänin mit ihrer Besatzung im Hafen von Lampedusa. Die Leinen werden geworfen, das Schiff wird festgemacht. Italienische Unterstützer sind am Pier, der Pfarrer des Ortes ist da. Es gibt Applaus, das Fernsehen kommt. Aber auch Gegner der Aktion finden sich ein, eine Frau ruft: »Menschenhändlerin, du musst verhaftet werden.« Und genau das geschieht. Die Polizei marschiert auf. Ein Zollbeamter begibt sich an Bord und führt die Kapitänin ab. »Am Ende hatte ich keine Wahl. Ich musste so entscheiden, um die Sicherheit der Menschen zu garantieren. Durch die Einfahrt in den Hafen habe ich ganz einfach meine Pflicht zur Rettung erfüllt. Es ist weder ein Verbrechen gewesen, noch eine Heldentat. Ich glaube, dass die meisten Kapitäne so entschieden hätten wie ich, wenn Menschenleben in Gefahr sind. Wahrscheinlich auch Menschen, die noch nie zur See gefahren sind.«
Was ihr viel ausmacht, ist, dass sie nicht sehen kann, wie die Flüchtlinge an Land kommen. Ein Beamter geleitet Rackete zu einem Wagen und fährt sie zur Zollstation. Dort hört sie, dass sie in Arrest genommen werden soll. Sie versucht, den auf Italienisch geführten Gesprächen der Männer zu entnehmen, was mit dem Schiff passieren wird und mit den Schutzsuchenden. Zwei Anwälte treffen ein. Das Schiff werde beschlagnahmt – von der italienischen Staatsanwaltschaft. Aber die Geflüchteten kommen an Land, Grazia a Dio! Deren nächste Station wird ein Auffanglager in Messina sein; sie sind jetzt in Europa, aber ob sie bleiben dürfen, kann niemand sagen. Angebote, sie aufzunehmen, gibt es außer von Deutschland noch von Frankreich und Portugal. Aber bis praktische Schritte getan werden können, wird Zeit vergehen. Es gibt ja keinen geregelten Prozess der Verteilung – alle reden immer nur von der »europäischen Lösung«, die eben aussteht. Und »Alleingänge« gelten als wenig förderlich, also geschieht nichts. Ein weiteres Spiel auf Zeit – auf Kosten vieler Menschenschicksale und Menschenleben.
Gefängniszellen gibt es auf der kleinen Insel Lampedusa nicht, also wird die unbotmäßige Kapitänin erst einmal in einem Privatquartier untergebracht. Hier darf sie keine Kontakte aufnehmen – außer zu ihren Anwälten. Zwei Tage später wird sie nach Agrigent auf Sizilien gefahren, wo eine Anhörung stattfindet. Eine Riege Journalisten ist vor Ort, sie zücken ihre Kameras. Rackete will keine Heldin sein, sie gibt zu Protokoll: »Es fühlt sich falsch an, dass die Medien mir die Aufmerksamkeit schenken, die sie den Menschen verweigern, um die es wirklich geht – den Geflüchteten der Sea-Watch 3.«
Ein Wochenende verstreicht, dann wird Carola Rackete am 2. Juli der Haftrichterin vorgeführt. Die Richterin Alessandra Vella entscheidet, dass die Kapitänin im Recht gewesen sei, als sie den Notstand erklärte und den Hafen von Lampedusa anfuhr, denn Libyen und Tunesien – deren Häfen näher lagen– – könnten nicht als sicher gelten. Sie argumentiert, dass die Pflicht zur Rettung auf See nach internationalem Seerecht höher zu gewichten sei, als die von Innenminister Salvini erst kürzlich verschärften gesetzlichen Regelungen in Italien. Es sei der Kapitänin zuzubilligen, dass sie »in Erfüllung einer Pflicht« gehandelt habe. Laut Artikel 98 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen muss jeder Kapitän Schiffbrüchigen Hilfe leisten, soweit das vernünftigerweise von ihm erwartet werden kann. Was den Zusammenstoß mit dem Zollboot betrifft, so befindet die Richterin, dass der Schaden übertrieben dargestellt worden und hinnehmbar sei. Racketes Haft war damit aufgehoben, sie war frei. Zwar hat die italienische Staatsanwaltschaft Einspruch eingelegt, der wurde aber zurückgewiesen. Eine Klage jedoch wegen der Beihilfe zur illegalen Einwanderung stand gleichwohl weiterhin ins Haus. Doch damit hatte es Weile. Die Kapitänin kehrte erst einmal Italien den Rücken und sagte den Reportern, die sie belagerten, sie sollten der Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU, also der berühmten »europäischen Lösung«, das Wort reden. »Es ist mir sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht um mich als Person geht, sondern um die Sache«, sagte sie nach ihrer Freilassung in Agrigent.
Wie alles Recht, so ist auch das internationale Seerecht im Konflikt mit nationalen Gesetzen letztlich Interpretationssache. In jenem Sommer 2019 hatten sich die Schiffe der Frontex, einer europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, die 2004 gegründet worden war, um den Mitgliedsstaaten beim Schutz der Außengrenzen des EU-Raums zu helfen, aus dem Mittelmeer zurückgezogen. Das galt ebenso für die italienische Küstenwache und die Marinemissionen der Europäischen Union. Die Konflikte, die aus den Migrationsbewegungen, den Flüchtlingsströmen, den Schlepperbanden, dem Seerecht und den jeweiligen nationalen Regelungen erwuchsen, waren unerträglich geworden. So blieb nur die private Seenotrettung übrig, NGOs wie die Sea-Watch und Boote wie die Sea-Watch 3. Die Kapitänin Rackete befuhr mit ihrem Schiff einen Raum, der in eine neue Rechtsunsicherheit geraten war. Mit ihrer eigenen Interpretation, derzufolge es in allererster Linie gelte, Leben zu retten, hat sie sich gegen den Minister Salvini, der allerdings mit seiner fremdenfeindlichen Politik nicht allein stand, durchgesetzt. Sie erhielt großen Applaus und wütende Schmähungen – wie übrigens auch die Haftrichterin Vella. Längst nicht alle Kommentatoren in der europäischen Presse gingen mit der Richterin konform, viele aber begrüßten ihren Spruch. In den Sozialen Medien gab es eine enorme Aufregung; Rackete erhielt begeisterten Zuspruch und entschiedene Ablehnung bis hin zu wüsten Drohungen.
Salvini hatte verloren, und es zeigte sich, dass er das schlecht vertrug. Er nannte seine Gegenspielerin eine »Angeberin« und eine »Kriminelle«, woraufhin Racketes Anwälte eine Verleumdungsklage gegen ihn anstrengten – die sie nun ihrerseits verloren. In Italien überwogen bei den überregionalen Medien kritische Stimmen, was die Rettungsaktion betraf, in Deutschland positive Voten. Die Partei der Grünen griff Innenminister Seehofer an, der die Bereitschaft einiger deutscher Städte, sich der Flüchtlinge anzunehmen, nicht politisch unterstützt hatte. Die AfD jedoch nannte Rackete eine Komplizin der Schlepper. Die Niederlande, deren Echo auf die Aktion insofern von Bedeutung ist, als ja die Sea-Watch 3 unter deren Flagge fährt, wandte sich kategorisch gegen die Entscheidung Racketes, den Notstand zu erklären. Sie habe der Erleichterung des Menschenhandels zugearbeitet. In Frankreich hingegen sympathisierte man mit der Kapitänin, ihr wurde die Médaille de la Ville de Paris zuerkannt.
Letztlich ging es um den alten Konflikt zwischen Realpolitikern, die sich davor fürchten, durch humanitäre Gesten die Ärmsten dieser Erde zur illegalen Einwanderung zu ermuntern (Pull-Effekt) und den Idealen von NGOs und linksliberalen Parteien und Organisationen, die ihre Hände ausstrecken, um genau diesen Ärmsten, an deren Lage sie bei sich selbst und in den Industrienationen eine Mitschuld erkennen, Hilfe zu gewähren. Realpolitiker weichen aus auf die ihrer Meinung nach vorrangige Strategie einer »Bekämpfung von Fluchtursachen«, während Hilfsorganisationen auf den humanitären Notstand verweisen, der Soforthilfe verlange, während ja Stabilität in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge aufbrechen, eine Sache von Jahrzehnten sei. Schließlich liegt es den Regierungen der europäischen Kernländer fern, »Fluchtanreize« zu liefern, indem sie beispielsweise Seenotretter ermutigen, im Mittelmeer zu kreuzen, während die Bevölkerung dieser Länder gespalten ist in Befürworter und Unterstützer der NGOs und deren Gegner, die sich vor »Überfremdung« fürchten und davon überzeugt sind, dass ein vermehrter Zuzug ihre Sicherheit und ihren Wohlstand gefährden würden. Was die offizielle Politik betrifft, so läuft deren Nichthandeln auf einen Totstellreflex hinaus: Wenn wir uns nicht bewegen, wird auch nichts passieren. Man könnte auch Vogel-Strauß-Politik dazu sagen, wobei der Kopf im Sand allmählich ziemlich lächerlich aussieht. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Die Flüchtlinge fliehen weiter, die »Festung Europa« verstärkt ihre Wälle, während gleichzeitig Hilfswillige sich daran machen, Tunnels zu bauen. Persönlichkeiten wie Rackete stehen für die europäische Bereitschaft zur Hilfeleistung, während Politiker wie Salvini auf die Überlegenheit der »Ersten Welt« in allen Angelegenheiten der Technologie, der Wirtschaft und der Politik pochen und ihren Status quo durch »Abschottung« sichern wollen. Eine Kapitänin wie Carola Rackete aus Deutschland, die aber ebenso aus Frankreich oder Finnland oder Luxemburg kommen könnte, wird noch lange einem Innenminister wie Salvini, der auch aus Österreich oder Schweden oder Polen stammen könnte, auf der Weltbühne Aug’ in Auge gegenüber stehen.
Die nach Deutschland heimgekehrte Kapitänin gab den Medien Interviews. Sie war und ist zwar erklärtermaßen publicity-scheu, aber sie möchte natürlich auch richtig verstanden werden. Es war nicht bloß trockene »Pflichterfüllung«, die sie dazu trieb, den Hafen trotz Verbots anzulaufen, sondern Pflichterfüllung in einem bestimmten historischen Augenblick, seitens einer Frau, die hier und heute in ihrer Funktion als Verantwortliche auf einem Rettungsschiff entschieden hat: »Ich habe eine weiße Hautfarbe, ich bin in ein reiches Land hineingeboren worden, ich habe den richtigen Reisepass, ich durfte drei Universitäten besuchen und hatte mit 23 Jahren meinen Abschluss. Ich spüre eine moralische Verpflichtung, denjenigen Menschen zu helfen, die nicht meine Voraussetzungen hatten.« Das Motto ihres Buches Handeln statt hoffen heißt: »Für alle Opfer des zivilen Gehorsams.«
Der Innenminister Salvini nannte die Sea-Watch 3 ein Piratenschiff. Das Boot wurde auf seine Anweisung hin »zur Beweissicherung« beschlagnahmt und erst im Dezember 2019 freigegeben. Seitdem ist es unter der Ägide der Sea-Watch e.V weiterhin auf dem Mittelmeer unterwegs.
Links
CaroRackete
seawatchcrew
seawatchcrew
https://sea-watch.org
»WIR SAGEN BULLSHIT!«
X (EMMA) GONZÁLES (GEB. 1999)
Die Schulmassaker-Überlebende und die Generation Columbine im Kampf gegen Waffengewalt und die NRA
Der Valentinstag im Jahre 2018, der 14. Februar, begann an der Marjory Stoneman Douglas Highschool (MSD) in Parkland, Florida, mit einem Feueralarm. Es war nur eine Probe. Auf das Heulen der Sirene hin liefen alle Jungen und Mädchen hinaus aus dem Gebäude vor den Eingang, genossen kurz die frische Luft, lachten und balgten sich ein bisschen und strömten, als es wieder still wurde, in ihre Klassenräume zurück. Sie kannten das, solche Übungen gab es immer wieder einmal. Schließlich mussten die Schüler und Schülerinnen wissen, was sie zu tun hatten, wenn es brannte. Ein paar Stunden später, um 14.20 Uhr, ertönte der Feueralarm erneut. Die Jugendlichen sahen einander erstaunt an, und auch die Lehrkräfte wunderten sich. Schon wieder eine Übung? Zwei an einem Tag? Das gab es sonst nicht. Aber sie taten, was sie gelernt hatten, sie verließen die Klassenräume und strebten über die Gänge zum Tor. Unterwegs konnten sie kaum etwas sehen. Rauchbomben waren gezündet worden. Und dann, plötzlich, ertönte das laute Geknatter von Schüssen aus einem Maschinengewehr. Schreie gellten. Menschen brachen zusammen. Immer mehr Schüsse fielen. Die Sirene, der Rauch, die Schüsse und die Schreie, es war ein blutiges, unbegreifliches Chaos. Sechseinhalb Minuten später, kurz vor halb drei, war alles vorüber. Die Sirene verstummte, der Rauch verzog sich, das Gewehr schwieg. Verwundete stöhnten. Die Polizei traf ein, Krankenwagen fuhren vor, Martinshörner ertönten. Die Verletzten wurden in Ambulanzen abtransportiert, die geschockten Überlebenden nach Hause begleitet. Die Polizei zählte am Ort des Geschehens siebzehn Todesopfer, vierzehn Schülerinnen und Schüler, drei Lehrer. Fünfzehn weitere Menschen waren verletzt worden, zum Teil schwer.
Diejenigen unter den Schülern, die es noch nicht raus auf die Gänge geschafft hatten, als die Schießerei losging, waren in die Klassenräume zurückgewichen und hatten sich in die Ecken gekauert oder in den Schränken versteckt. Sie waren zur falschen Zeit am richtigen Ort gewesen, so auch die achtzehnjährige Emma Gonzáles, die mit ihrer Klasse um 14.20 Uhr im Auditorium unterrichtet wurde; bevor sie und die anderen den großen Saal nach Erklingen der Sirene hätten verlassen können, vernahmen sie auch schon das Gewehrfeuer. Sie blieben stehen und duckten sich instinktiv zwischen die Stuhlreihen. Es kam niemand herein, Emma und ihre Klasse hatten Glück. Ein Amokläufer war mit einer Smith & Wesson-Sport-Semiautomatic durch die Flure der Schule gestürmt und hatte etwa zweihundert Schuss blind in die Gegend gefeuert. Zuvor hatte er den Alarm ausgelöst, um die Menschen dazu zu bewegen, die Klassenzimmer zu verlassen. Er hatte auch die Rauchbomben geworfen, um die Sicht zu trüben und sich selbst zu verbergen. Obendrein trug er eine Gasmaske, die nahm er ab, als der Rauch sich verzog. Er legte Maske und Gewehr im dritten Stock der Schule in einer Nische ab und lief mitten in der verstörten, schreienden, orientierungslosen Menge unerkannt aus dem Schulgebäude und -gelände heraus und verschwand.
Es handelte sich bei dem Täter um den neunzehnjährigen Nikolas Cruz, einen ehemaligen Schüler der Marjory MSD Highschool. Vor einem Jahr war dieser junge Mann »aus disziplinarischen Gründen«, wie es hieß, der Schule verwiesen worden. Nach seinem Amoklauf begab er sich erst einmal ins nahe Einkaufszentrum und trank eine Limonade. Inzwischen wurde auf allen Kanälen, im Radio, Fernsehen und im Internet über das Schulmassaker berichtet. Bei der Polizei waren kurz zuvor telefonisch einige Warnhinweise eingegangen, denn Cruz hatte in den Sozialen Medien über seinen Vorsatz einige Posts abgesetzt, er war auch bekannt als Waffennarr. Niemand hatte sich um diese Anrufe gekümmert, doch jetzt erinnerte man sich. Polizisten schwärmten aus, im Nachbarort Coral Springs, wohin Cruz inzwischen geflüchtet war, stellte sich ein Beamter dem jungen Mann in den Weg. Der ließ sich widerstandslos festnehmen und gestand seine Tat tags darauf.
Schießereien in Schulen geschehen immer wieder, aber nirgendwo so häufig wie in den USA. Ein Zusammenhang mit den lockeren Waffengesetzen, dem Fehlen von Lizenzen, Registern und Kontrollen und der Neigung der zivilen amerikanischen Welt, sich bis an die Zähne zu bewaffnen, wurde oft vermutet und immer wieder bestritten. Am lautesten verteidigen natürlich die Waffenhersteller und -verkäufer sowie ihr Dachverband, die National Rifle Association (NRA), das Recht eines jeden amerikanischen Bürgers, eine Waffe zu tragen und deswegen oder dabei nicht mit Begründungen oder Rechtfertigungen belästigt zu werden. Politisch steht die Republikanische Partei den Waffenliebhabern und der NRA am nächsten, es gibt aber auch so genannte Sportschützen bei der Demokratischen Partei. Und Kritiker des »Zweiten Verfassungszusatzes«, in dem das Recht eines jeden Menschen, sich zu bewaffnen, verankert ist, gibt es auch bei den Republikanern. Unter der jungen Generation jedoch, unter Schülern und Erstwählerinnen, wächst die Zahl derer, die sich wünschen, dass Amerika abrüstet. Und zwar sofort. Dieser Wunsch, ja, diese Forderung wurde nur wenige Tage nach der mörderischen Schießerei von Parkland unter dem Hashtag #NeverAgainMSD, veröffentlicht. Wer da sprach, drei Tage nach dem Massaker auf einer großen Demonstration im nahen Fort Lauderdale, war die Überlebende des Blutbads Emma Gonzáles, die gemeinsam mit ihren Klassenkameraden Cameron Kasky, Alex Wind, David Hogg und Jaclyn Corin den Hashtag #NeverAgainMSD ins Leben gerufen hatte. Und was da entstand, war die wohl kraftvollste Jugendrevolte gegen die amerikanischen Waffengesetze in neuerer Zeit.
Emma Gonzáles ging damals in die elfte Klasse an der MSD Highschool. Ihr Vater, ein Anwalt für Cybersicherheit, ist in den 1960er-Jahren aus Kuba in die USA gekommen, ihre Mutter, eine Amerikanerin, unterrichtet Mathematik. Emma möchte später Politik studieren, sie ist sportlich, fröhlich, ein Teenager wie viele im sunshine state Florida. Der wird von Spottlustigen auch »gunshine state« genannt, denn nirgendwo in dem ohnehin waffenstarrenden Amerika werden so viele Handfeuerwaffen gehandelt und erworben wie in Florida. Emma ist nach dem shooting für längere Zeit erstarrt vor Schreck und Schmerz, sie gehört auch nicht zu den Kids, die während des Gewehrfeuers imstande waren, auf ihren Smartphones herumzutippen, um Hilfe zu holen oder Aufschluss zu finden, was denn da los sei. Aber sie gewinnt, als sich der Rauch verzogen hat, sofort die Kraft, richtige Fragen und Forderungen zu stellen und mit ihnen an die Öffentlichkeit zu gehen. »Wenn der Präsident mir ins Gesicht sagt«, so Emma auf der Veranstaltung am 17. Februar in Fort Lauderdale, »dass das eine schreckliche Tragödie war und dass man nichts tun kann, frage ich ihn, wie viel Geld er von der NRA für seinen Wahlkampf bekommen hat. Ich weiß es: 30 Millionen Dollar.« Und sie fügt an die Adresse von Donald Trump und anderen Befürwortern einer schrankenlosen Freiheit des Waffenhandels und -gebrauchs hinzu: »Schämen Sie sich!«
Die Antwort der Jugendlichen auf das Argument der NRA, Waffen seien doch nur unschuldige Werkzeuge und führten zum Tode bloß in bösen Händen, lautet kurz und knapp: »Bullshit!« Und sie sagen: »Politiker, die die NRA unterstützen, sollen abgewählt werden!« Deshalb: »Geht zur Wahl und lasst euch morgen registrieren!« Die Idee des Präsidenten Trump, das Lehrpersonal an den Schulen doch mit Revolvern auszurüsten und ihnen Schießunterricht zu geben, kommentieren sie ebenfalls mit: »Bullshit!« Die immer gleichen Lippenbekenntnisse führender Politiker, sie seien mit Gedanken und Gebeten bei den Opfern, die immer gleiche äußerst kurzlebige Bereitschaft der Regierenden, Waffenbesitz mit mehr Kontrolle zu verknüpfen, die immer gleiche landesweit geübte Verharmlosung des schwunghaften Waffenhandels verfangen nicht mehr bei den Jugendlichen. Sie wollen Konsequenzen, und sie beschließen, sich zu organisieren, um eine Veränderung herbeizuführen. »Genug ist genug«, rufen sie, die Angehörigen der Generation Columbine. An jener Hochschule in Littleton, einem Vorort von Denver, waren 1999 zwölf Schüler und ein Lehrer erschossen worden, die beiden Attentäter, selbst Schüler der Columbine, brachten sich anschließend um. Auf diesen Amoklauf folgten weitere, jedes Mal hieß es, eine absolute Sicherheit könne es nicht geben, Gewehre seien doch nur Werkzeuge, und am Ende wurden die Waffengesetze sogar weiter liberalisiert. Damit müsse es ein Ende haben, fordern die Aktiven vom Hashtag #NeverAgainMSD. »Kämpft selbst um euer Leben«, rief ihnen Emma Gonzáles zu, »bevor andere es tun müssen.« Ihre Rede mit dem mehrfachen »bullshit«, gehalten nur wenige Tage nach dem Massaker, wurde von allen Rundfunk- und Fernsehsendern ausgestrahlt, Emmas Name war plötzlich berühmt. Auf ihrem neu eingerichteten Twitter-Account folgten ihr von jetzt auf gleich eine Million junger Menschen – mehr als dem Account der NRA.
Die Gruppe um Emma wollte nicht nur ihren Protest artikulieren, solange das Entsetzen über die Ereignisse von Parkland akut war und die Menschen alles darüber wissen wollten, um dann unter Tränen zu konstatieren, dass man nichts ändern könne. Sie wollten nicht auf das große Vergessen und das nächste shooting warten, sondern sicherstellen, dass ihr Aufbegehren Dauer erlange und Konsequenzen zeitige. Also gründeten sie eine echte Organisation mit Büro und Spendenkonto, die nannten sie March for our Lives, Bewegung für unser Leben. Auf dem Programm standen eine Reform der Waffengesetze und die Aufforderung an die junge Generation, wählen zu gehen, sprich diejenigen Politiker abzuwählen, die an der alten Waffenherrlichkeit festhielten. Nur Menschen unter zwanzig durften beitreten, der Feldzug gegen die Waffenlobby sollte eine genuine Sache der Jugend bleiben. Wer würde es wagen, diesen Schülern und Schülerinnen, dieser neuen Bewegung, deren Führungsstab einem Amoklauf schwer traumatisiert entkommen war, etwas abzuschlagen? Tatsächlich schwieg die NRA erst einmal still. Präsident Trump ließ verkünden, er wolle das Alter für den Waffenerwerb von achtzehn auf einundzwanzig Jahre heraufsetzen, nahm diesen Vorsatz aber nur zwei Wochen später zurück. In den Sozialen Medien wurden dann und wann Stimmen laut, die Emma und ihre Mitstreiter bedrohten, aber die befanden sich dem starken Zuspruch gegenüber in einer kleinen Minderheit.
Für den 14. März, vier Wochen nach dem Amoklauf an ihrer Schule, riefen die Aktiven von #NeverAgainMSD zu einem National School Walkout auf, zu in den gesamten Vereinigten Staaten stattfindenden Demonstrationen während der Schulzeit; es sollte ein Sternmarsch werden mit Ziel Washington. Die Bereitschaft war enorm, Gelder flossen, Unterstützer meldeten sich, darunter Filmstars wie George Clooney, Talk-Lady Oprah Winfrey und Regisseur Steven Spielberg. Der March for our Lives hatte sich formiert, und er würde überall im Land, und sogar im Ausland, ein vielfältiges Echo finden.
Erst einmal müssen Emma Gonzáles und alle, die mit ihr den Hashtag betreiben, eine Menge lernen. Sie müssen eine Rechtsform finden für ihre Initiative, müssen ein Büro einrichten und auf die vielen Fragen, Vorschläge, Angebote, die laufend online und am Telefon eingehen – auch auf Drohungen und Schmähungen – die passenden Antworten finden. Die Kerngruppe um Emma Gonzáles, Cameron Kasky, David Hogg, Alex Wind und Jaclyn Corin ist stabil. David will Journalist werden und hat es drauf, mit den Presseleuten und den TV-Teams zu reden. Jaclyn ist es als Schulsprecherin gewohnt, vor ein Mikrofon zu treten und organisatorische Probleme zu lösen; Waffengesetze waren ein Thema ihrer letzten Hausarbeit. Cameron und Alex haben den »Drama-Club« der Schule mitgegründet, sie verstehen sich auf Inszenierungen, wissen, worauf man achten muss, wenn man auf einer Großveranstaltung zu den Herzen der Menschen sprechen will oder vor einer TV-Kamera Informationen an den Mann und die Frau bringen muss. Wie eng Politik und Industrie in der Waffenbranche verbandelt sind, das möchten die Jugendlichen ihrem Land sagen und zugleich darauf bestehen, dass das nicht sein darf. Hier kommt Emma ins Spiel, deren Interesse an Politik schon lange ausgeprägt ist. Wenn sie das Argument hört, dass ja doch Verrückte nie aussterben und der Attentäter von Parkland sich doch auch mit einem Messer auf seine ehemaligen Mitschüler hätte stürzen können, entgegnet sie mit einfachen Überlegungen: Ein Amokläufer mit einem Dolch hätte niemals siebzehn Menschen töten können. Spätestens nach dem zweiten Opfer wäre er gestoppt worden. Und jetzt zur Politik und deren Eingriffsmöglichkeit: Es existiert ein Gerät, mittels dessen man ein halbautomatisches Gewehr in ein vollautomatisches hochrüsten kann, der so genannte bump stock. Schon lange wird darüber diskutiert, Produktion und Verkauf einer solchen Vorrichtung per Gesetz zu untersagen. Warum wurde dieser Plan nie umgesetzt? Ist es nicht besser für das Land, wenn die nächste Generation ohne Metalldetektoren an den Schultoren aufwachsen kann?
Jugendbewegungen für Frieden und so auch gegen den zivilen Waffengebrauch hat es immer schon gegeben. Das Neue bei #Never-AgainMSD war zweierlei: Zum Ersten die Existenz des Internets und der Sozialen Medien und die damit verbundene höhere Anzahl von Interessierten und Engagierten, zum zweiten das hohe Tempo, mit dem die Botschaft eines Hashtags viral gehen kann. Beide Schubkräfte haben den Ton verändert, mit dem sich die Sprecher und Aktivistinnen äußern: Sie sind ungeduldig geworden. Und sie reden nicht mehr drum herum. Die altehrwürdige Aufklärung über Zusammenhänge, die politischen Aktivismus seit jeher begleitet, wird weiter betrieben. Aber es wird dazu gesagt, dass jeder und jede alles Wissenswerte nachschlagen oder anklicken könne, wenn er oder sie nur wolle, ja dass die Dinge im Grunde klar seien. Ein Drama wie das von Columbine oder Parkland ließe sich durch Gesetze nicht verhindern? »Bullshit.« Es geht jetzt darum, wirklich etwas in Gang zu bringen, also zu handeln. Dieser Drang zur Aktion, gepaart mit der Bereitschaft, das harthörige Gegenüber, sprich den politischen Gegner, nicht nur höflich zum Gedankenaustausch aufzufordern, sondern ihn verbal anzuspringen und sogar zu beleidigen und damit kundzutun, dass die Periode der bloß verbalen Überzeugungsarbeit vorbei sei – das ist eine für die Generation Columbine typische Provokation. Im Fall von Emma Gonzáles steht dafür das Schmähwort »Bullshit«. Es heißt so viel wie: Machen wir Schluss damit, immer dieselben windelweichen Als-ob-Argumente durchzukauen und fangen wir mit der Arbeit an. Die Waffengesetze gehören reformiert. Die Waffenlobby gehört eingeschüchtert. Es darf nicht sein, dass ein frustrierter Neunzehnjähriger in den Laden gehen und sich ein Schnellfeuergewehr kaufen kann, ohne dass irgendjemand nachfragt. Die lebensbedrohlichen Implikationen der geltenden Waffengesetze bringen alle in Gefahr, aber nicht alle im gleichen Maße. Schüler und Schülerinnen laufen ein besonders hohes Risiko. Deshalb reden sie jetzt. Und deshalb hört ihr Alten und Älteren, Eltern und Politiker, ihnen jetzt zu. Und tut, was sie sagen!
Der nächste große Schritt für die Bewegung March for our Lives war die Vorbereitung des National School Walkout