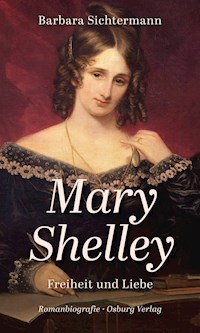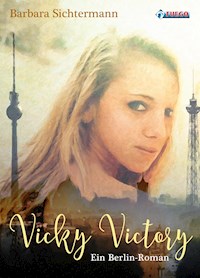Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: marixwissen
- Sprache: Deutsch
Bevor Frauen in der Neuzeit sich trauten, Gedichte oder gar Romane zu schreiben, waren sie erst einmal begeisterte Leserinnen. Der sich im 16. und 17. Jahrhundert entwickelnde Buchmarkt wäre nie in Schwung gekommen ohne das weibliche Lesepublikum. Dabei wurde den Damen und Mädchen das Lesen, abgesehen von der Bibel, anfangs nicht einmal erlaubt. Verse und Fiktionen könnten die Fantasie eines weiblichen Wesens angeblich in die falsche Richtung lenken. Doch die Moralwächter verloren die Schlacht. Bücher sind leicht transportierbar und Lesen macht kein Geräusch. Also kann es im Geheimen erfolgen. Schließlich änderte die Aufklärung das Klima: Mancher Pfarrer oder Gelehrte zeigte sich begeistert von der Intelligenz seiner Tochter und förderte sie durch Literaturangebote. Das Ergebnis: Frauen lasen sich so lange durch die Weltliteratur, bis sie Lust bekamen, die Freude, die sie beim Lesen empfanden, durch eigene Werke in anderen zu wecken. Das war am Anfang mühsam, der Ehrgeiz musste hinter Pseudonymen verborgen werden, schreibende Frauen galten als verirrte Wesen. Aber spätestens im 19. Jahrhundert welkte das Vorurteil dahin. Es gab einfach zu viele großartige Dichterinnen und wunderbare Erzählerinnen. In diesem Band findet sich eine wohlüberlegte Auswahl der bedeutendsten europäischen Schriftstellerinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Sichtermann
Schreiben gegen alle Widerstände
Barbara Sichtermann
SCHREIBEN GEGEN ALLE WIDERSTÄNDE
Aus dem Leben wagemutiger Schriftstellerinnen
marixwissen
INHALT
Vorwort:Sie kann schreiben. Und sie tut es auch noch.
Marie-Madeleine de La Fayette
Sophie von La Roche
Germaine de Staël
Jane Austen
Bettine von Arnim
Annette von Droste-Hülshoff
Mary Shelley
George Sand
Fanny Lewald
Harriet Beecher-Stowe
Die Schwestern Brontë
George Eliot
Johanna Spyri
Emily Dickinson
Marie von Ebner-Eschenbach
Selma Lagerlöf
Lou Andreas-Salomé
Else Lasker-Schüler
Grazia Deledda
Sidonie-Gabrielle Colette
Gertrude Stein
Virginia Woolf
Sigrid Undset
Karen Blixen
Katherine Mansfield
Vicki Baum
Gabriela Mistral
Anna Achmatowa
Agatha Christie
Nelly Sachs
Marina Zwetajewa
Pearl S. Buck
Djuna Barnes
Margaret Mitchell
Anna Seghers
Irmgard Keun
Patricia Highsmith
Ingeborg Bachmann
Sylvia Plath
VORWORT:
SIE KANN SCHREIBEN.UND SIE TUT ES AUCH NOCH.
Ach, die Kunst! Frauen waren immer ergebene Bewunderinnen von Werken der schönen Künste, sie stellten im Jahrhundert des Romans, dem 19., ein Großteil der hingebungsvollen Leserschaft. Unter den kreativen Geistern aber waren sie lange Zeit Ausnahmen, ja sie waren so selten, dass sich schließlich diese Erklärung anbot: schöpferische Kraft hängt mit dem Geschlecht zusammen, sie findet sich bei Frauen sozusagen nur mal aus Versehen. Die feministische Soziologie, Frucht des späten 20. Jahrhunderts, brachte es dann ans Tageslicht: Zur künstlerischen Karriere, egal ob in der Literatur oder in den anderen Künsten, gehört nicht nur Talent. Genauso wichtig ist die Bereitschaft der Mitwelt, ein Talent zu erkennen, zu fördern und die äußeren Bedingungen für seine Entfaltung bereitzustellen. Das Fehlen all dieser Voraussetzungen war es, das Frauen vom künstlerischen Schaffen fernhielt.
Die Geschichte der schreibenden Frauen ist mithin auch die Geschichte der Behinderung und Förderung ihrer Laufbahnen. Eine Germaine de Staël konnte im napoleonischen Zeitalter als namhafte Pariser Schriftstellerin hervortreten, weil die entscheidenden Ressourcen: Anregung, Erziehung, Bildung und eine Vielfalt von materiellen Möglichkeiten zur Verfügung standen. Eine Generation zuvor hatte es Sophie von La Roche in Deutschland schwerer, sich als Romanautorin durchzusetzen. Trotz des unerwarteten Erfolgs ihres Erstlings hielt der Ehemann nichts von Sophies Ambitionen, und es musste erst fühlbare Armut als Motiv hinzutreten, bis sich die Schriftstellerin so richtig ins Zeug legen durfte.
Einen interessanten Zugang zu dieser Problematik bietet die bizarre Geschichte der weiblichen Pseudonyme. Auch schreibende Männer haben sich stets gerne hinter einem nom de plume verborgen, die Angelegenheit hat ihre spielerische Seite. Für Frauen aber waren im 17., 18. bis weit ins 19. Jahrhundert hinein der Deckname, wenn nicht gar die Anonymität ernste Pflicht. Madame de La Fayette verschwieg ihre Autorschaft der Prinzessin von Clèves ganz und gar. Jane Austen zeichnete bescheiden mit »by a lady«, während Aurore Dupin alias George Sand es vorzog, dass ihr Publikum einen Mann am Werk wähnte. Man glaube indessen nicht, dass Pseudonyme nur ersonnen wurden, um etwa einem Roman durch den Anschein männlicher Urheberschaft besseren Absatz zu sichern. Der Hauptgrund für die vielen verschleierten Frauen, die seit Beginn der Moderne durch die Gärten der Literatur geistern, war – die Moral! Es schickte sich einfach nicht für eine Frau, als Schriftstellerin in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Was heute jedem Menschen, egal, ob Mann oder Frau, zur Ehre gereicht: ein Buch geschrieben zu haben, war seinerzeit für Frauen fast so etwas wie eine Schande.
So erwartete denn auch der Schwiegervater von Mary Shelley, dass sein Name nie und nimmer durch Platzierung auf einem Buchumschlag mit dem Titel Frankenstein entweiht würde. Und Fanny Lewalds jüngere Schwestern baten die gerade mit ihren ersten Romanen hervorgetretene Fanny inständig, sich doch einen Künstlernamen zuzulegen. Käme heraus, dass da eine Schriftstellerin zur Familie gehöre, würden ihre Chancen auf dem Heiratsmarkt dramatisch sinken. Den drei Schwestern Brontë wäre es gänzlich unpassend erschienen, mit den eigenen Namen in der Welt der Literatur aufzutauchen. Hinter »Currer, Acton und Ellis Bell« fühlten sie sich weit sicherer. Ihre Biographin Else-Marie Maletzke zitiert zum Thema Schriftstellerinnen einen Kritiker aus dem Jahre 1850:
»Meine Vorstellung von einer perfekten Frau ist die: Sie kann schreiben, aber sie tut es nicht.«
Sie tut es eben doch. Und sie tut es im 19. Jahrhundert immer öfter, bis sie im 20. aus der Literatur nicht mehr wegzudenken ist. Die Vorbehalte der Männer (und vieler Frauen) gegen Schriftstellerinnen schwinden aber langsamer, als neue Chancen für Autorinnen zunehmen. So kommt es, dass auch im späten 19. und im 20. Jahrhundert die Geschichte der Behinderung weiblicher Karrieren weitergeht. Colettes erster Band der Bestseller-Reihe Claudine erscheint noch im Jahre 1900 wie selbstverständlich unter dem Namen ihres Mannes. Grazia Deledda muss sich zeitweise hinter verschiedenen Pseudonymen verstecken, weil man ihr in der analphabetischen Heimat übelnimmt, dass sie überhaupt schreibt. Die Meinung, Mädchen brauchten nichts zu lernen (außer Haushalt), schlug zuweilen in manifeste Angst vor wissender Weiblichkeit um. Schönes Beispiel dafür ist der Ausspruch jener liebevollen Kinderfrau, die vor die Mutter ihres vierjährigen Schützlings hintritt, eines Mädchens, das später unter dem Namen Christie die berühmteste Krimiautorin der Welt werden sollte, und betreten beichtet: »Ich fürchte, Madam, Miss Agatha kann lesen.«
Die Bibliotheken der Eltern! Für viele Schriftstellerinnen waren sie das Tor zur Welt, zur Literatur und zur eigenen dichterischen Arbeit. Die Geschichte der schreibenden Frauen ist ja auch die Geschichte ihrer Förderung, und die fand erst mal im Elternhaus statt. So lasen die Schwestern Brontë sich kreuz und quer durch die Bibliothek des gebildeten Vaters, so wuchs Mary Shelley, das mutterlose »bookish girl«, statt mit mahnenden Worten mit Büchern auf, und die hochintelligente Fanny Lewald wurde vom stolzen Vater mit dem Wissen der Zeit vertraut gemacht. Virginia Woolf verbrachte ihre Jugend lesend, sie stellte sich das Paradies als Bibliothek vor.
Eine gut bestückte Bibliothek war nicht die einzige Voraussetzung, die Eltern bieten konnten, um gegen das allgemeine Vorurteil eine Tochter zur Schriftstellerin zu erziehen – die Ermutigung zur eigenen dichterischen Produktion war vielleicht noch wichtiger. Wer weiß, ob aus Marie von Ebner-Eschenbach eine Schriftstellerin geworden wäre, wenn nicht die freundliche Stiefmutter die Gedichte des Mädchens bewundert und Marie zum Weitermachen ermuntert hätte. Die hochbegabte Sigrid Undset hätte vielleicht nie zur Feder gegriffen, wenn der Papa sie nicht bewusst gefördert und inspiriert hätte.
Später werden dann die Ehemänner als Verhinderer oder Beförderer der Karrieren ihrer Frauen wichtig. Hier gab es Miesepeter und Neider oder Männer, die es schwer ertrugen, wenn die Frau mit ihrer Schreiberei auch noch Geld verdiente. Es gab indessen auch entschiedene Unterstützer ihrer Frauen; Ehemänner, die auch dann stolz darauf waren, eine Schriftstellerin geheiratet zu haben, wenn sie sich damit gegen den Zeitgeist stellen mussten. Lobend erwähnt sei der Theologe Calvin Stowe, der seine Frau Harriet, die immerhin sieben Kinder zu betreuen hatte, in ihrem Selbstverständnis als Schriftstellerin stets bestärkte. Auch Grazia Deledda hatte einen Gatten, der ihre Arbeit bewunderte und sie unterstützte. Und Margaret Mitchells Mann darf gar als der eigentliche Anstifter des Welterfolgs Vom Winde verweht gelten. Er hatte keine Lust mehr, seiner bettlägerigen Frau jede Woche neues Lesefutter aus der Leihbücherei zu besorgen und legte ihr stattdessen eine Schreibmaschine in den Schoß. »Nun schreib mal selbst!«
Die Gesamtheit der Bedingungen, die Frauen zum Schreiben treiben oder davon abhalten, ist in jedem Einzelfall anders gemischt. Ein Fazit aber lässt sich doch ziehen: Das Hervortreten von immer mehr Talenten seit etwa siebzig Jahren, von denen viele in diesem Band fehlen, weil wir den Pionierinnen angemessenen Raum geben wollten, beweist, dass die äußeren Bedingungen besser geworden sind und dass die Vorurteile schwinden. Ein Restbestand aber erschwerte manchen Frauen, die schreiben wollten oder damit angefangen hatten, ihre Arbeit bis vor kurzem immer noch. Dies zeigt beispielhaft das Schicksal der Ingeborg Bachmann. Sie hätte vielleicht heute, wo Diskriminierung von Frauen nicht mehr hingenommen wird, mehr Stabilität besessen und länger gelebt und gedichtet. Auch Sylvia Plath kam ein wenig zu früh auf eine Welt, die von Frauen nachdrücklich Häuslichkeit, Bescheidenheit und Unterdrückung der eigenen poetischen Impulse erwartete.
Für viele Schriftstellerinnen, die in diesem Band versammelt sind, gilt, dass sie lange brauchten, bis sie mit ihrer Arbeit richtig anfingen. Dazu gehörten Bettine von Arnim, Johanna Spyri, Karen Blixen. Aber den Gegentypus gab es auch: die Frau, die früh beginnt, alle Zweifel niederkämpft und nie etwas anderes will und macht als schreiben, so wie George Eliot, Agatha Christie, Irmgard Keun. Heute gibt es ihrer immer mehr. Weshalb wir uns darauf verlassen können, dass Schriftstellerin ein Beruf für Frauen geworden ist, der kein Versteckspiel mit Namen mehr erfordert, stattdessen selbstverständliche Ermunterung erfährt, sofern die Frau es mitbringt: das Talent, eine Geschichte so zu erzählen, dass alle sie lesen wollen.
MARIE-MADELEINE DE LA FAYETTE
(1634–1693)
Eine Frau eröffnet ihrem Gemahl, dass sie in leidenschaftlicher Liebe zu einem anderen Mann entbrannt sei. »Ich will Ihnen etwas gestehen, was noch keinem Ehemann gestanden worden ist.« Sie ersucht ihren Gatten allerdings nicht um die Freiheit, ihren Gefühlen folgen zu dürfen, sondern bittet ihn um Unterstützung bei ihrem Kampf gegen die illegitime Liebe. Sie wünscht sich, nicht mehr bei Hofe erscheinen zu müssen, wo der begehrte Herr sich meistens aufhält.
Dieses älteste Beziehungsgespräch der modernen Literatur stammt aus dem französischen Roman Die Prinzessin von Clèves und sorgte im Jahr von dessen Erscheinen 1678 für einen handfesten Skandal in der Pariser Gesellschaft. Wie die Prinzessin selbst sagt, hat es ein solches Geständnis nie zuvor gegeben – und sollte es auch, wie ein Großteil des Lesepublikums fand, in Zukunft nicht geben. Allerdings waren die Meinungen geteilt, es erhoben sich auch andere Stimmen. Etliche Kritiker, Gelehrte und Leserinnen waren entzückt von dem Mut der fiktiven Prinzessin und lobten ihre Wahrheitsliebe. Aber, so wurde ihnen erwidert, was könne nicht alles zerstört werden, wenn Ehepaare mit der Aufrichtigkeit Ernst machten. Die in der Oberschicht verbreitete »Konventionsehe«, aus Standesrücksichten und wirtschaftlichen Erwägungen geschlossen, bedurfte einer inoffiziellen, aber weithin akzeptierten Freiheit beider Partner, die Sehnsucht ihres Fleisches und ihres Herzens woanders zu stillen – ein Kompromiss, der voraussetzte, dass Geheimnisse und Fassaden gewahrt blieben. Sollte die Gattenliebe Offenheit einschließen, käme es zum Zusammenbruch der fragilen Konstruktionen, die das eheliche und das amouröse Leben der Aristokratie stützten. Richtig so, befand die Gegenpartei, soll doch der auf Lügen, Heuchelei und Maskeraden gebaute Umgang an den Höfen, in den Chateaus und Boudoirs zusammenbrechen! Und man empfahl als abschreckendes Beispiel oder Ermutigung zu einer neuen Moral das Buch Die Prinzessin von Clèves.
Wer hatte es geschrieben? Das war ein weiterer Grund, der die Gespräche um das Werk so spannend machte: Man wusste es nicht. Es erschien unter einem mehrdeutigen Pseudonym. Eingeweihte ahnten etwas, und alle fanden, dieser Roman könne nur von einer Frau stammen. Und so einigte man sich: Autorin sei gewiss die Madame de La Fayette, die schon mit Novellen hervorgetreten war. Die jedoch gab es nie zu.
Es machte ihr Spaß, sich zu verstecken. Außerdem empfand sie das Romaneschreiben als einer Gräfin letztlich unwürdig. Und es gab einen dritten Grund, mit ihrer Urheberschaft nicht vorlaut aufzutreten: Sie hatte Mitautoren. Wie auch schon bei den Vorläufern ihrer Prinzessin arbeitete Madame gerne im Team. Und diesmal hatte sie einen bedeutenden Berater und Co-Autor, den Offizier und Schriftsteller Herzog François de La Rochefoucauld. Die übrigen Mitarbeiter von Madame bei ihrer literarischen Produktion waren der Abbé und Dichter Gilles Ménage, der Schriftsteller und Sekretär Jean Regnault de Segrais, sowie die gelehrte Madame de Sévigné, Cousine ihres Stiefvaters, als Briefautorin berühmt und eine gute Freundin Madame de Lafayettes. Madeleine de Scudéry, ebenfalls Schriftstellerin, gehörte zu ihren Ratgeberinnen.
Marie-Madeleine Pioche de la Vergne kam 1634 in Paris zur Welt, sie war die älteste von drei Töchtern. Ihr Vater Marc, Offizier und Festungsbaumeister, führte ein offenes Haus, in dem Philosophen, Literaten, Geistliche verkehrten – ein Treffpunkt, zu dem die junge Marie-Madeleine früh Zugang erhielt. Ihre rege Intelligenz und ihre Formulierungskunst fielen auf, sie erfuhr vielseitige Förderung. Als sie fünfzehn Jahre alt war, starb der Vater; die Mutter führte den Salon weiter. Gäste kamen und gingen. Einer war darunter, der Marie-Madeleine besonders gut gefiel: das war der Chevalier de Sévigné, ein brillanter Weltmann, der im Hause de la Vergne aus- und einging, zu ungewöhnlichen Zeiten erschien und spürbar Absichten hegte. Allerdings galten die Maries schöner verwitweter Mutter; es war ein Schlag für das Mädchen, als sich die Lage klärte. Hinzu kam, dass der Chevalier in eine Verschwörung gegen König Ludwig und seinen Minister Mazarin verstrickt war – er wurde aus Paris ausgewiesen, als die Sache ans Licht kam. Auch die Mutter, inzwischen mit de Sévigné vermählt, galt als politisch belastet und musste die Hauptstadt verlassen, mitsamt ihren Töchtern. Da Marie inzwischen als Achtzehnjährige im heiratsfähigen Alter und wegen der Machenschaften ihres Stiefvaters in Schwierigkeiten war, musste lieber heute als morgen ein Mann für sie gefunden werden, der ihren Ruf schützen und an dessen Seite sie nach Paris zurückkehren konnte, sprich: eine »Konventionsehe« musste geschlossen werden. Der viele Jahre ältere Offizier und Landedelmann Motier de La Fayette war die Alternative zum Kloster. Marie erhörte ihn, schätzte ihn und schenkte ihm zwei Söhne. Aber die Liebe hatte nur einmal kurz in der reizvollen Gestalt des Chevaliers in ihr Leben hineingeleuchtet, um unerfüllt zu bleiben. Bis – ja, bis der Herzog de La Rochefoucauld in ihr Leben trat.
Dieser Mann war 21 Jahre älter als sie und ein beweglicher, freier Geist. Er war fasziniert von ihrem literarischen Talent und sie von seinem Esprit und seinem Wissen. Es entwickelte sich zwischen beiden eine Liaison im Medium des Geistes und der Schrift, der das Buch Die Prinzessin von Clèves und so manche Sentenz, manche Maxime entsprangen. Die beiden schienen einander verfallen. Tägliche Besuche waren selbstverständlich, und da sowohl Madame de La Rochefoucauld als auch Monsieur de La Fayette sich öfters zum Diner dazugesellten, hielt sich der Klatsch in Grenzen. Die Leser der Prinzessin … allerdings interpretierten die Situation anhand des »Geständnisses«. Für sie war die Fiktion der Madame de La Fayette, von ihr um das Jahr 1560 angesiedelt und reichlich mit historischen Anspielungen gespickt, ein Schlüsselroman und Gräfin und Herzog einander in unerfüllbarer Liebe verbunden. Andere wieder hielten alles für Spiegelfechterei, erkannten im Autorengespann ein Liebespaar und in den betrogenen Partnern Helden des Verzeihens. Niemand weiß, wie es wirklich gewesen ist. Das 16. Jahrhundert übrigens war als eine bewegte Zeit nicht zufällig die Epoche, die Madame de La Fayette als historische Bühne für ihren Roman wählte. Auch Friedrich Schiller wird später hier Dramenstoff suchen: Maria Stuart und Elisabeth von England kämpften um die Macht, und Philipp II., grimmiger König von Spanien, hielt Hochzeit mit der Braut seines Sohnes. Madame de La Fayette wob diese Geschehnisse in ihre Prinzessin … ein, um Distanz zu erzeugen und so die Idee vom »Schlüsselroman« zu konterkarieren.
Die Gräfin hat ein schmales Werk hinterlassen, aber es behauptet seinen Platz in der Literaturgeschichte zu Recht. Nicht nur wegen des exzeptionellen »Geständnisses«, das die Literarisierung der modernen, insbesondere der romantischen Liebesintimität vorwegnimmt, sondern auch wegen ihres lakonischen Stils – zu jener Zeit, die in das Dekor und die Ziererei verliebt war, ebenfalls eine fast schockierende Neuerung.
Nachdem ihre beiden sehr viel älteren Gefährten, der Gatte und der Geliebte, gestorben waren, vereinsamte Marie-Madeleine. Zwar konnte sie als Erbin ihrer Mutter und auch ihres Mannes eine großzügige Gastgeberin sein und auch wieder bei Hofe verkehren, aber der Geist, der den ihren so wunderbar herausfordern konnte, war mit dem Herzog dahingegangen. Sie schrieb nichts mehr, kümmerte sich um ihre in Klöstern lebenden jüngeren Schwestern, sorgte für die Karrieren ihrer Söhne bei der Kirche und in der Armee und öffnete ihr Herz den Tröstungen der (jansenistischen) Religion. In ihren Romanen aber fehlt der religiöse Konflikt, auch das macht sie so unglaublich modern. Dort geht es fast naturwissenschaftlich um den spannungsreichen Kosmos der menschlichen Gefühle.
Zum Weiterlesen
Marie-Madeleine de la Fayette: Die Prinzessin von Clèves, Frankfurt/M. 1984
Jean Firges: Madame de La Fayette: »Die Prinzessin von Clèves«.
Die Entdeckung des Individuums im französischen Roman des 17. Jh.
Exemplarische Reihe Literatur und Philosophie, Annweiler 2001
Hans-Jörg Neuschäfer:Cervantes und die Tradition der Ehebruchsgeschichte. Zur Wandlung der Tugendauffassung bei Marguerite de Navarre, Cervantes und Mme de Lafayette, in: Beiträge zur romanischen Philologie, Sonderheft, Norderstedt 1967
SOPHIE VON LA ROCHE
(1730–1807)
Die Dame des Hauses war beliebt wegen ihrer interessanten Konversation und ihrer herzerfrischenden Gastfreiheit – und sie wurde ehrfürchtig umschwärmt wegen ihres literarischen Ruhms. Mit dem Roman Geschichte des Fräuleins von Sternheim hatte Sophie von La Roche 1771 einen Sensationserfolg errungen, auch die Erzählungen, die gefolgt waren, hatte das lesende Publikum mit Interesse aufgenommen. Dabei war diese Schriftstellerin keineswegs die in sich gekehrte Klausnerin, für die man sie ihrer Produktivität wegen hätte halten können, sondern repräsentierende Ehefrau eines Staatsrates und Mutter einer großen Kinderschar. In Koblenz-Ehrenbreitstein führte sie ihr gastliches Haus, das namhafte Gelehrte und Schriftsteller frequentierten, so die Gebrüder Jacobi, Johann C. Lavater und auch der junge Goethe. Es wehte der Geist der Aufklärung. Für Sophie von La Roche, ihren Mann und ihre Gäste war es eine glanzvolle Zeit.
Dann kam das Jahr 1780. Sophies Ehemann Georg Michael Frank von La Roche, der zum Kanzler des Trierer Kurfürsten aufgestiegen war, wurde wegen kirchenkritischer Äußerungen aus dem Amt entfernt. Der Salon der Sophie von La Roche musste schließen. Ein hilfreicher Freund, der Speyerer Domherr von Hohenfeld, bot der Familie Unterstützung und Zuflucht. Einschränkung hieß aber jetzt das Gebot der Stunde. Sophie, inzwischen fünfzig Jahre alt und körperlich und geistig noch voller Spannkraft, stellt ihren »Schreibetisch« auf und fasst einen Entschluss. Sie will jetzt, wo nicht nur die rauschenden Soireen vorbei, sondern sogar die Mittel für einen bescheidenen Alltag knapp geworden sind, mit Schreiben Geld verdienen. Obwohl ihr Ehemann von diesen Plänen nicht gerade angetan ist, setzt Sophie sie um. Sie gründet die Frauenzeitschrift Pomona, für die sie Novellen und Essays verfasst, sie begibt sich auf Reisen – in die Schweiz, nach Frankreich, Holland und England – nicht ohne zuvor einen Verlagsvertrag über die zu liefernden Reisetagebücher abgeschlossen zu haben. Und sie schreibt weiter Romane. Ihre Werke verkaufen sich gut, der erst in Entwicklung begriffene Markt für schöne Literatur akzeptiert nach dem Fräulein von Sternheim auch die damals sehr beliebten Berichte aus fremden Ländern, ferner die Novellen und biographischen Skizzen aus der Feder von Sophie de La Roche. Und so ist sie – kraft jenes Entschlusses am »Schreibetisch«, aber auch durch die Not der Verhältnisse – zur ersten »richtigen« Berufsschriftstellerin Deutschlands geworden.
Maria Sophie Gutermann von Gutershofen wird 1730 in Kaufbeuren geboren. Der Vater ist Arzt, eine gehobene Stellung lockt ihn nach Augsburg, wo Sophie ihre Jugend verbringt. Die Eltern lehren das begabte Mädchen Geschichte, Musik und Sprachen, im Vordergrund aber steht die protestantische Religion. Als sich Sophie in einen Kollegen ihres Vaters verguckt, einen Italiener, der natürlich katholisch ist, hintertreibt Dr. Gutermann die Verbindung. Um die Tochter abzulenken, schickt er sie zu Verwandten nach Biberach. Dort wartet schon wieder die Liebe. Ihr siebzehnjähriger Cousin Christoph Martin Wieland ist es, der die Zwanzigjährige erobert. Das Paar verlobt sich, aber ihre Familien wollen von einer Heirat nichts wissen. Ein leidenschaftlicher Briefwechsel dokumentiert die Gefühle der Getrennten. Als Sophie drei Jahre später vom Sekretär des kurmainzischen Ministers, von Georg Michael Frank von La Roche um ihre Hand gebeten wird, sagt sie Ja, gesteht aber dem Bräutigam, dass ihr Herz vergeben sei. Der nimmt sie trotzdem. Es wird eine gute Ehe. Sophie bringt acht Kinder zur Welt, von denen fünf aufwachsen.
Ihre Söhne und Töchter werden, einer nach der anderen, wie damals üblich, auf Internate und Klosterschulen geschickt, wo ihre Erziehung vervollkommnet werden soll. Sophie vermisst ihre Kinder, besonders die Töchter. Zum Trost erfindet sie »ein papiernes Mädchen«, dessen Geschicke sie lenken kann, »weil ich meine eigenen nicht hier hatte«. Sie schreibt die Geschichte des Fräuleins von Sternheim, einen der meistgelesenen Romane des 18. Jahrhunderts, zugleich ein Buch, das Frauen mit Phantasie Mut macht, zur Feder zu greifen.
Das Fräulein heißt Sophie wie seine Erfinderin, gerät als unschuldige Waise in die Irrgärten des Hoflebens, soll dem Herzog als Mätresse zugeführt, in eine Scheinehe gedrängt, im Kerker zugrunde gerichtet werden, widersteht jedoch mit Tugend und Charakterstärke allen Anfechtungen und findet am Ende die wahre Liebe.
Es war gar nicht mal die spannende Geschichte als solche, die auf eine so enorme Resonanz stieß, es waren Form und Sprache: Im Briefroman konnte die Autorin einen intimen Ton anschlagen, der jene ästhetische Qualität transportierte, die als »Empfindsamkeit« in die Literaturgeschichte einging. Die beobachtende, ja sezierende Klugheit der Aufklärung verband sich hier mit dem gefühlvollen Vibrato tieflotender Seelenkunde – es entstand eine Lebensfülle der Darstellung, die eine ganze Generation begeisterter Leser und Leserinnen in Bann schlug. Wie manche schreibende Frau vor und nach ihr hat Sophie von La Roche mit dem Pseudonym geliebäugelt. Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim erschien 1771 mit dem Untertitel: »von einer Freundin derselben aus Originalpapieren und anderen zuverlässigen Quellen gezogen«. Herausgegeben wurde das Buch von La Roches Cousin Christoph Martin Wieland, der auch lektorierend tätig gewesen war und dem man das Werk sogleich zuschrieb, obwohl er im Vorwort bekannt gegeben hatte, dass der Roman von einer Verfasserin stamme.
Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim hatte ihre Vorläufer. Ohne Samuel Richardsons Pamela und Jean-Jacques Rousseaus Die neue Heloise ist sie nicht zu denken. Beide Werke waren ebenfalls Briefromane und bezogen ihren Zauber aus der Wirkung intimpersönlicher Offenbarungen. Pamela hat zudem die Moral vorformuliert, um die es auch in de La Roches Geschichte geht: die Aristokraten sollen nicht glauben, sie könnten jede Frau haben, nur weil sie gesellschaftlich oben stehen. Auch in Pamela versucht es der Verführer mit einer fingierten Hochzeit, um die widerspenstige Dienstmagd in sein Bett zu zwingen – und scheitert. Aber Sophies Geschichte … hatte nicht nur Vorläufer, sondern auch Nachfolger, der berühmteste ist Goethes Leiden des jungen Werther. Die Handlung läuft auf anderen Pfaden, La Roches »empfindsamer« Einfluss indes ist verbürgt. Auch privat blieb Goethe der Familie La Roche / Brentano verbunden. Um Sophies Tochter Maximiliane hatte er sich einst vergeblich bemüht. Die Mutter, obwohl ja selbst erfolgreich schriftstellerisch tätig, wollte keinen Dichter als Schwiegersohn. Mit deren kapriziöser Enkelin Bettine hat Goethe dann immerhin ausgiebig geflirtet. Und das Mädchen machte daraus ganz selbstbewusst Literatur.
Mit dem starken Fräulein von Sternheim betrat auch ein neues Frauenideal die soziale Bühne. Aus eigener Kraft findet Sophie ihren Weg, und souverän beteiligt sie sich an der Formulierung einer neuen Moral: gegen den Sittenverfall und das Parasitentum des Adels, für den Anstand und die Leistungen des Bürgertums – auch und gerade seiner Frauen.
Sophie von la Roche hat ihr Sternheim-Ideal selbst umgesetzt; mit ihrer schriftstellerischen Arbeit brachte sie in kritischen Zeiten und später als Witwe sich und ihre große Familie durch – Jammern galt nicht, obwohl es Anlässe gegeben hätte. Ihre älteste Tochter Maximiliane, die der junge Goethe nicht gewinnen konnte, heiratete achtzehnjährig den Kaufmann Peter Anton Brentano, einen betuchten Witwer, der fünf Kinder mit in die Ehe brachte. Maximiliane Brentano stirbt nach der Geburt ihres zwölften Kindes im Wochenbett. Sophie übernimmt noch einmal Mutterpflichten, sie holt einige der Enkel zu sich; Bettine und Clemens Brentano werden später das berühmteste Geschwisterpaar der Romantik. Sie bleiben ihrer großmütterlichen Erzieherin stets verbunden, auch mit Wieland tauscht sich Sophie von La Roche lebenslang brieflich aus.
Als alte Dame reist sie 1799 nach Thüringen, um ihre Jugendliebe Wieland und auch Goethe noch einmal zu sehen. Aus deren Korrespondenz wissen wir, dass sie Sophie nur aus Höflichkeit empfingen. Über Literatur konnten sie mit ihr nicht mehr reden. Sie hatte keinen Sinn für den Vorrang der Wirklichkeit vor der Einbildungskraft, wie Goethe ihn proklamierte. Als Schriftstellerin sei sie, wie die Kollegen monierten, bei der »Empfindsamkeit« ihres Fräuleins von Sternheim stehen geblieben – vielleicht kein schlechter Ort, wenn man bedenkt, wie nachhaltig dieses Werk deutsche Autorinnen beeinflusst hat.
77-jährig starb Sophie de La Roche in Offenbach am Main. Goethe erwähnte im Rückblick ihre bis ins Alter bewahrte »gewisse Eleganz«.
Zum Weiterlesen
Sophie von La Roche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim, München 2007
Armin Strohmeyr: »Sie war die wunderbarste Frau«. Das Leben der Sophie von La Roche, Konstanz 2019
Barbara Becker-Cantarino: Meine Liebe zu Büchern. Sophie von La Roche als professionelle Schriftstellerin, Heidelberg 2008
GERMAINE DE STAËL
(1766–1817)
Die Französische Revolution hatte den Terror entbunden und deshalb bei Zeitgenossen und Nachgeborenen Ängste und Verwünschungen ausgelöst. Aber es gab ja auch die Losungen der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit. Die standen nun am Horizont der Menschheitsgeschichte und weckten Hoffnungen in aller Welt. Als die Franzosen die Guillotine abgebaut hatten und sich nach innerem Frieden sehnten, erschien Napoleon und gab ihnen ihr Selbstbewusstsein als Grande Nation zurück. Aber er forderte einen Preis. Die Ideale der Freiheit und Gleichheit und der Traum von der Republik sollten neben das Fallbeil ins Museum wandern. Er machte aus Frankreich einen modernen Militärstaat, aber keine Demokratie. Von den Franzosen verlangte er Gehorsam. Die meisten waren auch dazu bereit. Die Anarchie hatte sie bis ins Mark erschreckt. Jetzt priesen sie die Ordnung. Und brachten gern jedes Opfer dafür.
Eine Minderheit verteidigte jedoch die Ideale der Revolution und versuchte sogar, Bonaparte auf sie einzuschwören. Zu ihnen gehörte Madame Germaine de Staël. Diese außergewöhnlich kluge, gebildete und tapfere Frau wollte die Republik nicht aufgeben, und sie glaubte an den Geist der Aufklärung. Napoleons kriegerische Gelüste schienen ihr unvereinbar mit dem Selbstbestimmungsrecht der benachbarten Nationen, und seine kaiserlichen Ambitionen verletzten ihren Sinn für republikanische Freiheiten. Also versuchte sie, Einfluss auf den Emporkömmling zu nehmen. Doch dieser erkannte in ihr eine gefährliche Widersacherin und ging mit drakonischen Maßnahmen gegen sie vor. Wer war diese schwierige Dame eigentlich?
Sie wurde als Anne-Louise-Germaine Necker 1766 geboren; ihr Vater Jacques Necker war ein vermögender Bankier und Finanzminister Ludwigs XVI. In seinem Haus und unter der Ägide seiner gebildeten Gattin verkehrten die illustren Geister der Zeit, und die kleine Germaine soll schon im zarten Alter zu Jean-Baptiste d’Alembert und Denis Diderot auf den Schoß gekrabbelt sein und den großen Aufklärern schwierige Fragen gestellt haben. Sie wurde eine eifrige Leserin. Stark beeindruckt von den Schriften Jean-Jacques Rousseaus, widmete sie diesem ihre erste literaturkritische Arbeit von 1788: Lettres sur les écrits et le caractère de Jean-Jacques Rousseau (= Über Rousseaus Charakter und Schriften). Ihre Klugheit verblüffte alle. Eine Schönheit wurde sie nicht. Porträts zeigen ein eher grob geschnittenes Gesicht, und sie neigte später zu Fülle und Schwerfälligkeit. Aber ihre übergroßen Augen sollen einen magischen Glanz ausgestrahlt haben. Mit ihnen lockte sie Männer und Frauen in ihren Bann, und mit ihrer ungeheuer intensiven und interessanten Konversation band sie ihre Mitmenschen an sich – viele für immer.
Wie die meisten Frauen ihres Standes ging auch Germaine Necker eine sogenannte konventionelle Ehe ein – sie heiratete 1786 den Mann, den man ihr zuführte, einen gewissen Erik Magnus Staël von Holstein. Der schwedische König hatte den Baron zu seinem Botschafter in Paris ernannt. Also hatte er immerhin einen interessanten Posten. Und Germaine konnte sich »Gesandtin« nennen. Aber darüber hinaus bedeutete dieser Mann ihr nichts. Sie kam jedoch mit ihm aus. Immerhin gab er ihr, was sie brauchte, um all die schriftstellerischen und politischen Aktivitäten zu entfalten, zu denen es sie drängte: den Schutz und die Würde des Ehestandes.
Germaine de Staël war nicht nur klug und schriftstellerisch begabt, sie war auch eine sehr leidenschaftliche Frau. Es war in der damaligen Zeit trotz des vorübergehenden Tugendterrors durchaus normal, dass Eheleute in den gehobenen Ständen einander ignorierten. Heirat bedeutete nicht Liebe, bedeutete aber auch nicht Verzicht auf Liebe. Ehefrauen, sofern hochstehend, durften flirten. Wenn sie fremdgingen, mussten sie darauf achten, dass es nicht auffiel. Ehemänner hatten sowieso alle Freiheiten. Madame de Staël nun war reich – und zwar sehr, sie war ja eine Necker-Erbin. Also wagten ihre Freunde nur hinter vorgehaltener Hand über sie zu lästern – wussten sie doch nicht, ob sie die einflussreiche Frau nicht noch einmal brauchen würden. Und Germaine nutzte die Lage aus. Wahrscheinlich ist keins ihrer Kinder von ihrem Mann. Ihre erste große Liebe hieß Louis de Narbonne; der Mann war ein romantischer Traumprinz und mutmaßlich der Vater ihrer Söhne Auguste und Albert. Dann traf sie Benjamin Constant, einen Schriftsteller, der ihr geistig gewachsen war. Sie hielt ihn für »einen der hervorragenden Köpfe Europas«, und er sagte von ihr, sie verfüge über eine seltene Vereinigung von »Brillanz und Scharfsinn.« Lange Zeit waren die beiden ein Paar, die gemeinsame Tochter Albertine war bekannt für ihren Vorwitz und rothaarig wie ihr Vater. Nachdem Monsieur de Staël gestorben war, hätte Germaine ihren Benjamin heiraten können, was dieser auch gewünscht zu haben schien. Aber sie zog es vor, verwitwete Baronin zu bleiben und ihr Vermögen selbst zu verwalten.
Madame de Staël erregte nicht nur durch ihre Lebensführung Aufsehen, sondern auch durch ihr Werk. Als 1802 ihr gesellschaftskritischer Roman Delphine erschienen war, hielt Paris den Atem an. Ging sie jetzt nicht zu weit, die Wortgewaltige? Forderte sie doch freies Ausleben der Leidenschaften für beide Geschlechter – und eine Ermöglichung der Ehescheidung! Bonaparte schäumte. Er hatte genug von dieser ewig protestierenden Protestantin, die der Pariser Gesellschaft den Geschmack an der Restitution aristokratischer Werte verdarb und in deren Salon an der Rue de Bac alle möglichen Opponenten zusammenkamen. Kurzerhand verbannte er sie aus der Hauptstadt. Madame zog sich auf das väterliche Schloss Coppet am Genfer See zurück und hielt dort Hof. Freunde, Bewunderer, Liebhaber saßen ihr zu Füßen, aber die verstoßene Gesandtin verzehrte sich vor Sehnsucht nach Paris. Auch ihre daheim gebliebenen Freunde litten unter der Trennung. Juliette Récamier, Herzensfreundin der Madame de Staël und ebenfalls eine namhafte Salonière, schrieb ihr, dass jemand, der das Glück gehabt habe, in ihrer Nähe zu leben, sich kaum daran gewöhnen könne, sie nicht mehr zu sehen.
Die Verbannte ist rastlos – jetzt kann, ja muss sie reisen. In Deutschland ist die Gegnerin Napoleons nur zu willkommen; in Weimar und Berlin wird sie von mächtigen Gelehrten und Politikern empfangen. Goethe lädt sie gemeinsam mit dem Ehepaar Schiller ein. Und noch eine Eroberung macht Madame de Staël in Deutschland, und diese heißt August Wilhelm Schlegel. Der Gelehrte ist so begeistert von ihr, dass er nicht von ihrer Seite weicht, und auch sie schätzt sein Wissen und seine inspirierende Unterhaltung ungemein. Als Lehrer ihrer Kinder begleitet er sie zurück in die Schweiz. Sie nimmt Eindrücke mit nach Hause, die sie später zu ihrem viel diskutierten Deutschlandbuch De l’Allemagne zusammenfassen wird.
Das Schweizer Schloss der liberalen Dame wird nachgerade zu einer Hochburg des Widerstandes gegen Napoleon. Dieser schlägt jetzt noch einmal zu. Er verbannt de Staël nicht nur aus Paris, sondern ganz aus ihrem Heimatland. Und er verbietet den Druck ihres Deutschlandbuchs. Das komfortable Exil in Coppet wird für Germaine de Staël immer drückender. Was sie tröstet, ist die Schriftstellerei. In ihrem zweiten großen Roman: Corinne ou l’Italie (= Corinna oder Italien) von 1807 setzt sie sich erneut für die Emanzipation der Frau ein. Doch bald meldet sich wieder ihre Reiselust. Sie fährt nach Italien, England, Schweden und Russland, spricht in Sankt Petersburg mit Zar Alexander und wird so eine, wenn auch inoffizielle, Gesandtin des republikanischen Frankreich.
Man schätzt sie hoch, schließt von der Gefahr, die sie für den Kaiser der Franzosen darstellt, auf ihre Bedeutung. Und in der Tat hat der freie kritische Geist, der in Germaine de Staël wohnte, seine Spur auf nicht minder nachhaltige Weise durch Europa gezogen als das napoleonische Militär mit seinen Verwüstungen. Germaine de Staël konnte erst nach Napoleons Niederlage, 1814, heimkehren. Ihr blieben nur noch wenige Jahre. Vom Opium zerstört starb sie 1817 in Paris.