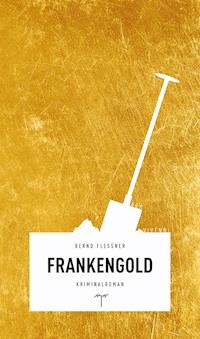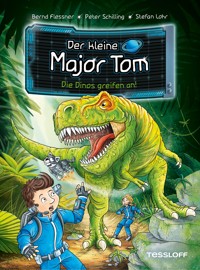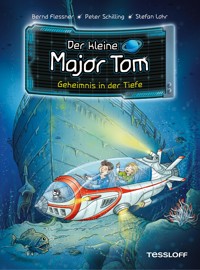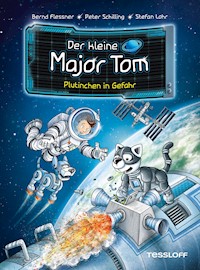Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Biberbach im Aischgrund: Schrebergärtner Hans Bertram liegt ermordet im Blaukrautbeet seines Nachbarn Winfried Kehrer, mit dem er sich seit Langem im Streit befand. Die Polizei hält Kehrer für tatverdächtig, worauf dieser seinen Bekannten Walter Dollinger um Hilfe bittet – immerhin hat der Amateurdetektiv bereits mehrfach seinen Spürsinn unter Beweis gestellt. Dollinger erfährt viel über die kleinen und großen Konflikte der Laubenkolonie und stößt dank seines Gärtnerwissens auf Spuren, die der ermittelnde Kommissar übersehen hat: Welsches Weidelgras in der Parzelle des Opfers! Dollinger steht kurz vor der Lösung des Mordfalls, doch dann wird seine Frau entführt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Flessner
Hannah Fleßner
Der Blaukrautmörder
Ein fränkischer Gartenkrimi
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage Juli 2020)
© 2020 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Stephan Naguschewski
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: © Hanne Beinhofer
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-7472-0162-6
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Die Autoren
1
In der Klinge des Messers spiegelte sich sein Gesicht. Trotz der glänzenden, polierten Oberfläche war es sonderbar verzerrt, da die Klinge aus Damaszener Stahl bestand. Die Anzahl der Lagen ließ sich allenfalls schätzen, es waren mindestens hundert. Die Länge der Klinge brauchte dagegen nicht geschätzt zu werden, sie stand für dieses Modell fest: dreiundzwanzig Zentimeter. Sie besaß die klassische Form des Santoku und gehörte zu einem aus Japan stammenden Allzweckmesser. Santoku bōchō war Japanisch und bedeutete »Messer der drei Tugenden«. Weniger prätentiös formuliert war es eben ein Allzweckmesser. Ein ausgesprochen scharfes Allzweckmesser, das mühelos in so ziemlich alles eindrang, was nicht selbst aus Stahl war oder zumindest aus Stein.
Die Klinge folgte dem Druck, der auf den Griff ausgeübt wurde, und stieß nur auf geringen Widerstand. Immer wieder verschwand sie, wurde für einen kurzen Moment unsichtbar, um gleich darauf einen Rückzieher zu machen und erneut einzudringen.
Der kurze Schrei war im ganzen Haus zu hören. Die Klinge hatte ihr Werk vollendet. Vorerst zumindest. Blut rann an der Schneide entlang, folgte der Schwerkraft. Einige Tropfen landeten auf den Fliesen, andere erreichten das Baumwollhemd und breiteten sich umgehend in den saugkräftigen Fasern aus. Die Hand löste den festen Griff und ließ das Messer auf das Bambusbrett gleiten, wo es sich schnell beruhigte.
»Was ist passiert?«, rief Karin Dollinger von oben.
»Ich habe mich geschnitten!«, antwortete Walter Dollinger laut. »So ein Mist!«
»Schlimm?«
»Ich glaube nicht. Ich muss erst die Blutung stillen.«
Karin kam die Treppe herunter und ging in die Küche zu ihrem Mann. Sie war Anfang fünfzig, aber das sah man ihr nicht an. Das lag vor allem an ihrer schlanken Figur und den langen, immer noch schokoladenbraunen Haaren. Dollingers Frau sah auf dem Küchentisch einen schon fast zerkleinerten Blaukrautkopf, daneben die Tatwaffe. Walter machte ein finsteres Gesicht und hielt mit der rechten Hand den Daumen der linken umklammert. Er war etwas älter als seine Frau, hatte bereits einen kleinen Bauch, aber auch seine Haare waren immer noch dunkelbraun. Nur an den Schläfen hatten sich ein paar graue Strähnen breitgemacht. Zwischen seinen Fingern sickerte Blut hindurch und tropfte auf den Boden. Karin machte auf dem Absatz kehrt und verschwand, kam aber gleich wieder zurück in die Küche.
»Hier«, sagte sie und reichte ihm ein frisch gewaschenes Küchenhandtuch. »Ich hole den Verbandskasten.«
Dollinger ließ seinen Daumen los und vertraute ihn dem Handtuch an, das sich umgehend rot färbte.
»Mist!«, wiederholte er.
»Wie oft habe ich dir gesagt, dass du mit diesem Sudoku vorsichtig sein sollst«, rief sie aus dem Flur.
»Santoku!«, entgegnete er.
»Trotzdem. Es ist einfach zu scharf.«
»Ein Messer kann gar nicht zu scharf sein«, bellte er mehr den Schmerz in seinem Daumen an als seine Frau, die nun mit dem Verbandskasten in der Hand wieder die Küche betrat.
»Weniger scharf ist doch auch in Ordnung.«
»Weniger scharf ist stumpf.«
»Aber doch nicht für so einen blöden Krautkopf!«
»Vor allem für einen Krautkopf!«
»Halt endlich still!«
Sie zog das Handtuch vom Daumen, tupfte damit die Schnittwunde ab, sprühte eine gelbliche Flüssigkeit auf die Wunde und schloss sie mit einem breiten Pflaster.
»Halb so schlimm.«
»Danke.«
»Ihr Männer mit euren Messern«, kommentierte sie kopfschüttelnd. »Im Krieg sind sie sinnlos geworden, auf die Jagd geht ihr damit auch nicht mehr. Also fuchtelt ihr jetzt in der Küche damit herum. Blut muss fließen, egal wo.«
»Aber Karin«, verteidigte er sich, den Daumen wieder in der rechten Hand. »Ein Messer ist nichts Maskulines.«
»Natürlich ist es das. Oder kennst du eine Frau, die sich derart teure und scharfe Messer kauft? Kennst du eine Frau, die diese Messer auch noch mit auf Reisen nimmt?«
»Mache ich ja gar nicht.«
»Das fehlte gerade noch. Aber Thomas und Andreas, die fahren ihre japanischen Messer kreuz und quer durch Deutschland. Als hätten wir eine Messerkrise. Als besäßen nur sie halbwegs scharfe Messer.«
»Zugegeben. Das sind aber Ausnahmen.«
»Das glaube ich nicht«, widersprach sie energisch und wischte das Blut zunächst von dem Schneidbrett und dann von den Fliesen. »Es geht um den alten Hahnenkampf. Wer hat den schärfsten Faustkeil, wer hat das schärfste Schwert, wer hat das schärfste Messer? Und heutzutage kommt noch hinzu: Wer hat das teuerste Messer?«
»Mein Santoku hat nur zweihundert Euro gekostet. Das ist wirklich kein teures Messer. Das von Thomas, das war richtig teuer. Das hat fast das Zehnfache gekostet.«
»Siehst du? Genau das meine ich. Und jetzt halte den Daumen ruhig. Ich muss den Krautkopf zu Ende schneiden und Blaukraut kochen.«
2
In der Klinge des Messers spiegelte sich ein Gesicht. Trotz der glänzenden und polierten Oberfläche war es sonderbar verzerrt, da die Klinge aus Damaszener Stahl bestand. Mühelos drang das ebenso spitze wie scharfe Messer in den Körper ein, der dünne Baumwollpullover und das Unterhemd leisteten keinen nennenswerten Widerstand. Reflexhaft bewegte sich der Körper nach hinten, um vielleicht dem Stich in letzter Hundertstelsekunde doch zu entgehen, aber dafür war es längst zu spät.
Der lang gezogene Schrei war im ganzen Haus zu hören, bevor er abrupt verstummte. Die Klinge hatte ihr Werk vollendet. Blut rann an der Schneide entlang und folgte der Schwerkraft. Rinnsale breiteten sich über den Körper des Sterbenden aus, dem auch das Messer eines Chirurgen nicht mehr hätte helfen können. Die große hatte bereits über die kleine Klinge triumphiert, das Rennen war gelaufen, lange bevor ein Arzt den Körper zu Gesicht bekam. Dort würden dann nur noch zerfetzte Adern und Herzmuskeln festzustellen sein, verursacht von einer Klinge, deren Schärfe mit der eines Skalpells mühelos konkurrieren konnte.
Das aus seiner Bahn geratene Blut erreichte auch das Baumwollhemd des Klingenführers und breitete sich umgehend in den saugkräftigen Fasern aus. Das aber störte den Mann nicht weiter, der damit beschäftigt war, den nunmehr Toten langsam zu Boden gleiten zu lassen. Das Messer legte er auf den kleinen Tisch in der Mitte des Raumes. Statt den Tatort zu verlassen oder die Leiche zu beseitigen, schaltete der Mann das Licht aus und ging zum vorderen Fenster, das einen Blick auf einige der anderen Häuser gewährte. Längst kroch die Dämmerung durch die Gärten und vereinigte sich mit den Schatten der wenigen Bäume. Die Wolken am Himmel konnten sich auf keine leicht definierbare Farbe einigen.
Der Mann hatte ein Haus im Visier, ein Haus, in dem noch Licht brannte. Er brauchte nicht viel Geduld, schon nach einer knappen halben Stunde war seine Wartezeit beendet. Was nun geschah, war nicht zu erkennen. Der Mann wartete noch ein paar Minuten, dann ging er zur Tür und öffnete sie. Die Gärten schwiegen, in einiger Entfernung war ein Auto zu hören. Als wäre dieses Geräusch sein Startsignal, drehte er sich um und kehrte kurz darauf mit dem Toten zurück, den er auf seine Schulter geladen hatte. Die Füße voran trug er ihn aus der Tür und anschließend durch einen gepflegten Garten. Doch nicht dieser Garten war als Zwischenlager für den Toten vorgesehen, sondern ein ganz anderer. Die Reise ging also weiter, über den Hauptweg, bevor sie den richtigen Ort erreichten. Dort fand der Tote vorübergehend Ruhe. Sein Kopf wurde fast liebevoll zwischen anderen Köpfen platziert, zwischen mindestens ebenso großen Krautköpfen. Kopf an Kopf lagen sie nun da. In der spätsommerlichen Dunkelheit waren sie nur schwer voneinander zu unterscheiden. Lediglich der menschliche Körper lieferte einen eindeutigen Hinweis darauf, dass einer der Köpfe nicht in diesem Garten gewachsen war.
Der Lieferant des Toten verließ noch immer nicht den Schauplatz, sondern kehrte lautlos zum Tatort zurück und machte sich in der Küche zu schaffen. Als die Nacht triumphierte und man nur noch Silhouetten erkennen konnte, verließ er das Haus und suchte wieder den Toten auf. Das war nur dank einer Taschenlampe möglich, deren Lichtkegel immer wieder sonderbare Bewegungen vollzog. Und das nicht nur im Garten, sondern bald auch im dazugehörigen Haus. Es war Tatort-Zeit, als der Mann das Haus wieder verließ, die Taschenlampe dorthin steckte, wo sie ihrem Namen nach hingehörte, und in der Dunkelheit verschwand. Die Köpfe im Garten waren jetzt nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Auf allen krochen Schnecken herum. Auch einige Asseln kamen vorbei, ohne den Unterschied zu beachten.
3
»Wie finden Sie das, Chef?«, fragte Meier.
»Was soll ich wie finden?«, schnaubte Hauptkommissar Schwerdtfeger. Er war um die sechzig, riesig, breitschultrig, leicht übergewichtig und zum jetzigen Zeitpunkt hochrot im Gesicht.
»Na, die Lage des Kopfes. In einer Reihe mit den Krautköpfen. Das ist doch irgendwie komisch.«
»So? Finden Sie?«, brummte Schwerdtfeger, ohne seinen Assistenten anzusehen.
»Irgendwie schon.«
»Und wenn es Ihr Kopf wäre?«, fragte der Hauptkommissar grantig. »Wäre das auch komisch? Oder sogar noch komischer, wenn ich mir Ihren Kopf so ansehe. Bestimmt sogar.«
Meier lag die Entgegnung auf der Zunge, aber er behielt sie für sich, denn er kannte seinen Chef. Zu spät hatte er bemerkt, wieder einmal ein Fettnäpfchen erwischt zu haben, das sein schwarzer Humor bereitgestellt hatte.
»Sagen Sie mir lieber, was das zu bedeuten hat«, überging Schwerdtfeger den Fehltritt. »Falls es überhaupt etwas zu bedeuten hat.«
»Was genau meinen Sie?«, fragte Meier vorsichtig.
»Die Lage natürlich«, raunte Schwerdtfeger. »Die Lage von dem Kopf zwischen den Krautköpfen. Was ist unter dem Kopf?«
Meier ging in die Knie, warf dem dabeistehenden Rechtsmediziner einen fragenden Blick zu und näherte sich dem Kopf bis auf wenige Zentimeter.
»Nichts«, erklärte er, nachdem er wieder aufgetaucht war. »Soweit sich das erkennen lässt, wurde der ursprüngliche Kopf, also der Krautkopf, also … der wurde entfernt. Ich meine, der wurde geerntet.«
»Sieht nicht nach einem Zufall aus«, urteilte Schwerdtfeger laut und starrte auf den Toten. »Jemand hat seinen Kopf gezielt in die Lücke gelegt. Weiß der Teufel, warum. Vielleicht hat es auch gar nichts zu bedeuten. Ein schlechter Scherz oder so etwas in der Art. Hätte von Ihnen sein können, Meier. Entspricht Ihrem kruden Humor. Egal, lassen Sie ein paar Fotos mehr machen. Von oben wäre gut. Der Fotograf soll erst mal alles dokumentieren.«
Während Meier seine Aufträge ausführte, inspizierte der Hauptkommissar die Beete vor der Gartenlaube. Eine ordentliche Parzelle, die sich in einer überschaubaren, aber dafür umso gepflegteren Schrebergartenkolonie befand. Selbst im Spätsommer. Zwar fehlten ihm gartenbauliche Kenntnisse, aber die ersetzte er durch ästhetische Kriterien. Es war ein Garten, den er als ordentlich bezeichnen würde. Ein Garten, in dem alles seinen festen Platz besaß. Ästhetische Ordnung. Nur die Leiche störte das Gesamtbild. Daran konnte auch der Kopf nichts ändern, der die unterbrochene Reihe der Krautköpfe wieder zu einer geschlossenen Reihe machte. Ihm schoss die Frage durch den Kopf, wer den fehlenden Krautkopf entfernt hatte, der Besitzer der Gartenlaube oder der Täter. Sofern es sich überhaupt um verschiedene Personen handelte.
In diesem Augenblick stellte sich ihm ein Mitglied der Spurensicherung in den Weg, ein langes Messer in den spitzen, behandschuhten Fingern.
»Die Tatwaffe?«, fragte der Hauptkommissar.
»Sehr wahrscheinlich«, antwortete der Mann in Weiß.
»Wo haben Sie es gefunden?«
»In der Wassertonne hinterm Haus.«
»Fingerabdrücke?«
»Nein, leider nicht. Aber Blutspuren.«
»Immerhin«, sagte der Hauptkommissar und wandte sich ab. Er machte ein paar Schritte, um seinen wuchtigen Körper zum Zaun der stattlichen Laubenparzelle zu bewegen. Dort drehte er sich um und betrachtete die Szene, die aus einem Kriminalfilm hätte stammen können. Im Zentrum lag die Leiche, umschwirrt von mehreren Frauen und Männern in weißen Overalls, denen selbst Hautschuppen und winzige Körperhärchen nicht entgingen. Im Hintergrund stand die Gartenlaube. Eigentlich ein richtiges Haus, und ein relativ neues noch dazu. Das reguläre Haus seiner Großeltern war nicht wesentlich größer gewesen.
Die Gartenlaube war auch der mutmaßliche Tatort. Die Blutspuren ließen kaum Zweifel aufkommen. Dort war Hans Bertram am Abend des vergangenen Tages ermordet worden. In der Gartenlaube von Winfried Kehrer. Natürlich hatten sie sich auch Bertrams Laube angesehen, die nicht weit entfernt lag, aber dort hatten sie weder Anzeichen eines Kampfes noch Blutspuren gefunden. Nein, Bertram war in Kehrers Laube erstochen worden. Mit dem Messer aus der Wassertonne. Davon war Schwerdtfeger überzeugt. Es hatte einen kurzen Kampf gegeben, dem wahrscheinlich der übliche Streit unter Nachbarn vorausgegangen war, dann hatte Kehrer zugestochen. So jedenfalls stellte sich der Hauptkommissar den Tathergang vor. Und er hoffte, genügend Beweise für seine These finden zu können. Für ihn lag der Fall klar. Das einzige Haar in der Suppe war die Platzierung der Leiche inmitten der Krautköpfe. Warum hatte der Täter die Leiche nicht verschwinden lassen? Keine hundert Meter floss die Aisch vorbei. Es wäre nicht die erste Leiche gewesen, die dem Fluss anvertraut worden wäre. Ein paar Tage nur, und die Forensik hätte es schwer gehabt. Mit einem Stein an den Füßen wäre noch mehr Zeit ins Land gegangen. So etwas dauerte nicht lange. Aber der Täter hatte sich anders entschieden, hatte sich für etwas Repräsentatives, für etwas weithin Sichtbares entschieden.
Der Kopf inmitten der Köpfe. Das gefiel Schwerdtfeger ganz und gar nicht. Es passte in kein Muster. Jedenfalls in keines, das ihm vertraut war. Also wählte er ein vertrautes Muster. Der Kopf inmitten der Köpfe war ein Zeichen, eine Botschaft, eine Warnung.
»Zu offensichtlich«, murmelte er mit tiefer, bäriger Stimme. »Eine Warnung, die zugleich den Täter preisgibt? Mist, verfluchter!«
Schwerdtfeger stapfte zurück zur Leiche.
»Mist, verfluchter!«
»Was meinten Sie, Chef?«, fragte Meier.
»Mist, verfluchter!«
»Na klar«, nickte Meier und trat den Rückzug an.
Schwerdtfeger fixierte die Leiche. Das Opfer war Anfang fünfzig, schlank, etwa eins fünfundsiebzig groß und kahl wie die Krautköpfe. Die Kleidung war unauffällig, Jeans, blauer Baumwollpullover, braune Schuhe. Auffällig war lediglich der große Blutfleck auf der Brust. Und natürlich die Platzierung des Kopfes.
»Mist, verfluchter!«, rief Schwerdtfeger und ließ das gesamte Team für einen kurzen Augenblick erstarren.
Meier war längst im Haus in Deckung gegangen. Auch dort machte sich das Team von der Spurensicherung an die Arbeit. Von besonderem Interesse waren der Blutfleck auf den Fliesen und die wenigen Blutspritzer an der schmalen Theke und den Wänden.
»Etwas Neues?«, fragte Meier verlegen.
»Die Spritzer hier an der Wand sind ungewöhnlich«, antwortete eine der weißen Gestalten. »Die Richtung, aus der sie gekommen sind, lässt sich schwer bestimmen. Außerdem sind es sehr wenige. Aber jeder Mord ist ein bisschen anders. Mal sehen.«
»Aber es ist doch der Tatort?«
»Wir haben das Messer in der Wassertonne, Blutspritzer in der Laube und eine Leiche im Garten. Sieht so aus«, antwortete der Mann in Weiß.
Meier sah sich um. Das Interieur war einfach. Ein alter Schrank aus Weichholz, ein Tisch, zwei Stühle, ein altes, ausgemustertes Sofa. Eine eingebaute Theke war noch da, eine Art Hausbar mit zwei Barhockern. Ein kleines Wandregal mit wenigen Flaschen, darunter eine kleine Küchenzeile. Nichts Außergewöhnliches, soweit er sehen konnte. Abgesehen natürlich von dem Blutfleck auf den Fliesen. Die auf dem Boden liegenden Barhocker ließen auf einen Kampf schließen.
»Habt ihr euch schon die Tür angesehen?«
Meier zuckte kurz zusammen. Dass sein Chef das Haus betreten hatte, war ihm entgangen.
Einer der Spurensicherer antwortete umgehend: »Nichts, Herr Schwerdtfeger. Sie wurde nicht gewaltsam geöffnet. Entweder hatte der Täter einen Schlüssel oder das Opfer hat dem Täter die Tür geöffnet. Die Fenster sind alle intakt.«
Da ein Dank nicht zu erwarten war, wandte sich der Spurensicherer wieder den Blutspritzern zu.
»Was meinen Sie, Meier?«, fragte der Erlanger Hauptkommissar gereizt.
»Dass es richtig ist, diesen Kehrer zu holen. Die Kollegen müssten allerdings längst wieder zurück sein. Vielleicht hat er sich ja schon aus dem Staub gemacht?«
»Hm«, brummte Schwerdtfeger nachdenklich, der fast die gesamte Tür ausfüllte. Die Frau, die hinter ihm auftauchte, war von drinnen allenfalls zu erahnen.
»Wir sind fertig. Brauchen Sie die Leiche noch?«
Schwerdtfeger antwortete, ohne sich umzudrehen: »Nein … das heißt, warten Sie mal damit.«
»Okay«, sagte die Frau und ging zurück in den Garten, ohne im Haus sichtbar gewesen zu sein.
»Meier? Rufen Sie Harland an. Ich will wissen, wann er mit diesem Kehrer hier ist. Ich dachte, der wohnt in Biberbach und nicht in München.«
Meier zückte sein Smartphone und erreichte auf Anhieb seinen Kollegen.
»Sind gleich hier, Chef.«
»Also. Sehen wir uns diesen Kehrer an«, nickte Schwerdtfeger und gab die Tür wieder frei. Mit langsamen Schritten ging er zum Gartentor und wartete dort auf den Wagen, der nicht vor der Parzelle parken konnte, da bereits andere Einsatzfahrzeuge auf dem schmalen Weg standen. Der Hauptkommissar ließ seinen Blick durch das herbstlich verfärbte Laub wandern. Dass sich Menschen mehr oder weniger auf ein zweites Leben in einer Schrebergartenkolonie einließen, war ihm ein Rätsel. Einen Krautkopf pflanzte man nicht an, den kaufte man auf dem Wochenmarkt in Erlangen. Ein Krautkopf wurde von einem Landwirt angepflanzt, dessen Beruf das Anpflanzen von Krautköpfen war. Noch weniger Verständnis hatte er für die Liebe zu den Lauben, den Zweithäusern, die ihn an Puppenhäuser erinnerten. Warum sollte man hier wertvolle Stunden seines Lebens verbringen? Außerhalb der urbanen Komfortzone? Er schüttelte noch immer abwesend den Kopf, als Harland mit dem Besitzer der Parzelle eintraf.
Kehrer war ein schlanker Mann Anfang vierzig mit vollem Haar. Ein durchtrainierter Mann, ein fast schon fanatischer Radfahrer, wie Schwerdtfeger erfahren hatte. Und noch ein Wort war ihm zu Ohren gekommen: Ökoaktivist. Was auch immer das zu bedeuten hatte. Kehrers Parzelle passte jedenfalls zu diesem Klischee. Hier schien alles ökologisch korrekt zu sein. Außer dem Toten natürlich.
»Winfried Kehrer«, stellte sich der selbstbewusst wirkende Mann vor.
»Schwerdtfeger, Hauptkommissar. Wann waren Sie zum letzten Mal hier?«
»Gestern Abend«, antwortete Kehrer ohne Zögern.
»Uhrzeit?«
»Ich bin so gegen fünf, halb sechs gegangen. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut.«
»Was haben Sie hier gemacht?«
»Ich war im Garten und habe dann in der Laube aufgeräumt. In gut zwei Wochen ist unser offizielles Laubenjubiläum. Achtzig Jahre Laubenkolonie Hasenhügel«, antwortete Kehrer. »Wir erwarten viele Gäste.«
»Kommen Sie«, befahl Schwerdtfeger, drehte sich um und ging voran in den Garten. Vor dem Toten blieb er stehen und wandte sich um.
»Sie kennen diesen Mann?«
Kehrer wurde blass und begann, am Revers seiner Jacke herumzufummeln. Das gerade noch spürbare Selbstbewusstsein schien sich in Luft aufgelöst zu haben.
»Das ist der Hans. Seine Laube liegt dort drüben.«
»Waren Sie das, Kehrer?«, fragte der Hauptkommissar mit provokantem Tonfall. »Haben Sie Hans Bertram ermordet?«
Der Mann zögerte kurz und blickte Schwerdtfeger irritiert an. »Nein! Das war ich nicht! Wieso sollte ich den Hans umbringen?«
»Gute Frage. Die beschäftigt mich schon den ganzen Morgen.«
Kehrer zögerte wieder, sah auf die Leiche, sah Schwerdtfeger an. »Ich habe ihn nicht umgebracht. Bestimmt nicht!«
»Sicher?«
»Ganz sicher!«
»Was glauben Sie, warum Bertram in Ihrer Laube ermordet wurde?«, fragte Schwerdtfeger und entließ den Mann nicht aus seinem Blick.
»Ich … ich weiß es nicht«, antwortete Kehrer. »In meiner Laube? Sie meinen, er wurde im Haus …?«
»Ja, in Ihrem Haus«, sagte Schwerdtfeger betont langsam. »Im Garten wurde er nur abgelegt. Ermordet wurde er in Ihrem Gartenhaus.«
»Aber wie …?«
»Durch die Tür. Aber sie wurde nicht aufgebrochen«, antwortete der Hauptkommissar. »Haben Sie ihm die Tür geöffnet?«
»Nein. Er war auch gestern gar nicht in der Kolonie. Ich habe ihn jedenfalls nicht gesehen.«
»Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen?«
»Am … am Donnerstag«, antwortete Kehrer vorsichtig. »Hier auf dem Hasenhügel.«
»Am Donnerstag«, wiederholte Schwerdtfeger, als sei diese Angabe besonders relevant. Der Hauptkommissar betrachtete den Parzellenbesitzer von oben bis unten, sah ihm in die Augen, betrachtete seine Sportkleidung, vergaß auch seine Gartenhände nicht. Unter seinen Fingernägeln klebte Dreck. Nicht viel, aber genug für seine Spurensucher.
»Gut. Das reicht für heute«, blaffte der Kommissar und wandte sich Harland zu. »Das Labor soll sich seine Fingernägel ansehen. Dann können Sie ihn gehen lassen. Aber er bleibt zu unserer Verfügung. Haben Sie das verstanden, Herr Kehrer? Sie bleiben morgen zu Hause und sind für uns erreichbar.«
Kehrer nickte verunsichert, ratlos, hilflos und folgte dann Harland. Schwerdtfeger wiederum folgte ihm mit seinen Blicken, bevor er zurück in den Garten marschierte. Dort stimmte er mit einem Nicken dem Abtransport der Leiche zu und ging noch einmal ins Haus.
»Etwas Neues, Meier?«, fragte er mürrisch.
»Nur die Blutspritzer. Die entsprechen nicht dem üblichen Muster. An der Wand gegenüber gibt es nur zwei.«
»Gut, dann holen wir einen von diesen neumodischen Blutsommeliers«, sagte er mit spöttischem Ton. »Denen reichen zwei Spritzer, um zu wissen, wo das Messer geschmiedet worden ist. Haben wir so was im Angebot?«
»Messer?«, rutschte es Meier aus dem Mund.
»Blutsommeliers!«
»Blood-Spatter-Analysten«, korrigierte der Assistent.
»Sage ich ja. Haben wir so was?«
»Ich kümmere mich darum.«
»Tun Sie das. Ach ja, und noch etwas.«
Meier hob seine Augenbrauen und sah seinen Chef fragend an.
»Heute noch!«
4
Dollinger pulte an dem aufgeweichten, schmutzigen Pflaster, das nicht mehr richtig auf der Wunde am Daumen kleben wollte. Nur auf dem Pflaster selbst klebte das Pflaster und bildete so einen unkonventionellen Ring, den er sich schließlich vom Daumen zog.
»Alles in Ordnung?«, fragte seine Frau.
Dollinger blieb die Antwort schuldig, denn er musste sich erst einmal selbst ein Bild der Lage machen.
»Lass sehen!«
Sie rückte ihre Brille zurecht und packte seinen Unterarm. Er versuchte noch, sich zur Seite zu drehen, doch es war bereits zu spät. Karin brachte den Daumen in eine passende Untersuchungsposition und kniff die Augen zusammen.
»Komisch. Ich hatte die Wunde doch gleich desinfiziert?«
»Und ordentlich geblutet hat sie auch«, fügte Dollinger hinzu, als müsse er sich für den Zustand der Wunde rechtfertigen. »Ich habe vorhin sogar noch einen Blutspritzer hinter der Küchenmaschine gefunden.«
»Hinter der Küchenmaschine? Und was ist mit der Küchenmaschine? Die ist doch rot. Blutrot. Da sieht man keinen Spritzer.«
»Daran habe ich noch gar nicht gedacht«, gestand Dollinger. »Ich habe vorhin nicht nur den Blutspritzer entdeckt, sondern auch den Brotteig geknetet.«
»Mit der Küchenmaschine natürlich.«
»Natürlich.«
Karin beäugte die Wunde, die ihr gar nicht gefiel.
»Als ob sich da was entzündet hat. Sieht wirklich komisch aus. Ich glaube, du solltest damit zum Arzt gehen. Mit einer Sepsis ist nicht zu spaßen. Erst vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass sie zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland zählt. Du musst zum Werner.«
»Zum Werner?«, fauchte Dollinger und versuchte erfolglos, seine Hand dem Zugriff seiner Frau zu entziehen.
»Ja, zu Werner. Auch wenn du sonst einen großen Bogen um Ärzte machst. Das ist auch wieder so ein Männerding.«
»Ist es nicht«, entgegnete er.
»Was dann?«
»Werner ist mit dem Skalpell schneller als Brad Dexter mit dem Messer.«
»Das war James Coburn.«
»Sicher?«
»Ganz sicher«, murrte sie leise. »James Coburn war Brett. Das berühmte Duell Messer gegen Colt. Das war James Coburn.«
»Egal. Jedenfalls traue ich Werner alles zu. Der amputiert mir glatt den Daumen. Denk an den Zehennagel.«
»Das war aber nur ein Nagel. Vom kleinen Zeh. Und der musste nun wirklich weg, so giftig, wie der ausgesehen hat.«
Endlich löste Karin ihren Klammergriff und ließ von ihm ab. Jedoch nur, um wenig später mit einer Salbe und einem frischen Pflaster in die Küche zurückzukehren.
»Halt still!«
Während sie ihren Mann verarztete, keimte ein neues Thema auf, das den Blutspritzern zu verdanken war.
»Ach ja, ich habe gerade Moni im Edeka getroffen«, begann Karin.
»Auch das noch.«
»Die Polizei hat den Kehrer verhaftet. Er soll den Bertram erstochen haben.«
»Sagt die Moni.«
»Der Kehrer. Ein Choleriker«, sinnierte sie. »Aber das hätte ich ihm trotzdem nicht zugetraut. Und stell dir vor, mit einem Sudoku soll er ihn erstochen haben.«
»Santoku«, verbesserte Dollinger.
»Die Polizei war wirklich schnell«, fuhr sie unbeeindruckt fort. »Einen Tag nur haben sie gebraucht. So schnell …«
Es klingelte an der Haustür.
»Bestimmt die Post. Ich geh schon«, sagte Karin, während ihr Mann den frisch gesalbten und verklebten Daumen kritisch betrachtete. Er quälte sich mit dem Gedanken, doch noch zum Arzt zu müssen, zu Werner, mit dem sie zu allem Übel auch noch lose befreundet waren. Werner traf keine Schuld. Seine Aversion gegenüber Ärzten hatte Dollinger während seiner Leidenszeit in der Erlanger Universitätsklinik entwickelt. Nach seiner überraschenden gesundheitlichen Krise hatten sie vergeblich versucht, herauszufinden, welche Stoffe seinen Körper derart in Rage versetzten, dass er zu kollabieren drohte. Es waren eben keine alltäglichen und zudem auch noch sehr viele und unterschiedliche Substanzen, denen er beruflich bei Meyer-Chemie nicht aus dem Weg hatte gehen können. Die Ärzte konnten lediglich diagnostizieren, was er längst wusste, nämlich dass sein Immunsystem großen Gefallen an Atemnot und Hautreaktionen gefunden hatte. Als er endlich mit einem Koffer voller Antiallergika und Cortison wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, hatte Meyer-Chemie seine Nachfolge längst geklärt. Ein anderer flog nun um die Welt, um Rohstoffe und Chemikalien zu begutachten und für die Firma einzukaufen. Dollinger war unfreiwillig zum Frührentner mutiert.
Seine Frau stand plötzlich mit blassen Wangen in der Tür und riss ihn aus seinen Gedanken.
»Der Kehrer.«
»Was? Ich dachte, der ist …?«
Hinter Karin erschien Winfried Kehrer in der Küchentür, fast ebenso blass im Gesicht wie sie. Er wirkte gehetzt, wirkte, auch ohne psychologische Kenntnisse bemühen zu müssen, aus der Bahn geworfen. Es war nicht mehr der Mann, den Dollinger flüchtig aus dem Biberbacher Obst- und Gartenbauverein kannte.
»Kann ich Sie kurz sprechen, Herr Dollinger?«, sagte der Mann, ohne einen Gruß zu entrichten.
»Ja, natürlich«, antwortete Dollinger. »Am besten, wir gehen ins Wohnzimmer. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Einen Espresso vielleicht?«
»Gerne. Danke.«
Dollinger ging voraus und wies ihm den alten Ledersessel als Sitzplatz zu. Kehrer fiel hinein und versank in der Polsterung. In der Küche summte die Kaffeemaschine. Er hatte sie letztes Jahr von Karin zum Geburtstag bekommen. Er liebte guten Kaffee und ganz besonders Espresso.
»Was gibt es?«, fragte Dollinger mit bemühtem Lächeln.
»Das können Sie sich doch denken«, antwortete der verstörte Mann. »Die Polizei glaubt offenbar, ich habe den Hans getötet. Aber ich war es nicht.«
»Das mag ja sein«, entgegnete Dollinger vom Sofa aus. »Aber was hat das mit mir zu tun?«
»Sie müssen mir helfen, Herr Dollinger«, sagte Kehrer, den Tränen nahe. »Die bringen es fertig und sperren mich ein. In so einer Lage war ich noch nie. Ich, ein Mordverdächtiger? Sie wissen nicht, was das für einer ist, dieser Schwerdtfeger. Wenn der so vor einem steht. Das ist kein Mensch, das ist ein Ungetüm.«
»Schwerdtfeger?«, wiederholte Karin und stellte zwei Espressi auf den Tisch.
»Schwerdtfeger«, wiederholte auch Dollinger. »Ich weiß genau, was Sie meinen. Er ist wirklich ein Ungetüm.«
»Dann helfen Sie mir?«, fragte Kehrer, immer noch fahl wie eine Wand und tief im Sessel versunken.
»Wie soll ich Ihnen denn helfen?«
»Das wissen Sie doch genau. Finden Sie den Mörder. Wie Sie es bei dieser Radieschengeschichte gemacht haben«, flehte Kehrer. »Den Radieschenmörder. Den haben Sie doch zur Strecke gebracht.«
Dollinger und seine Frau tauschten Blicke. Karin schüttelte, für Kehrer nicht sichtbar, den Kopf.
»Herr Kehrer.« Dollinger beugte sich vor und blickte seinem Überraschungsgast direkt in die Augen. »Das war damals mehr oder weniger ein Glückstreffer. Und auch ich selbst hatte Glück, denn fast hätte mich der Mörder auch noch erwischt. Ich bin nun mal kein Privatdetektiv.«
»Außerdem ist mein Mann verletzt«, warf Karin in den Ring. »Er muss dringend zum Arzt. Wir befürchten sogar, dass der Daumen amputiert werden muss. Eine tiefe Schnittverletzung, die einfach nicht heilen will.«
Dollinger hob die Hand und präsentierte seinen Daumen wie eine gerade gewonnene Trophäe. Ein verhaltenes, fast stolzes Lächeln huschte über sein Gesicht.
»Noch dazu fehlt mir die Zeit«, fügte er hinzu. »Wir wollen am Wochenende nach München zu unserer Tochter.«
Kehrer schwieg und nickte sanft.
»Na, trinken Sie erst mal Ihren Espresso. Dieser Schwerdtfeger ist kein Dummkopf. Wenn Sie unschuldig sind, wird er den wahren Täter schon finden«, versuchte Karin ihn zu beruhigen.
Kehrer richtete seinen Blick auf den Teppich, ihre Worte zeigten keine Wirkung. Wie in Zeitlupe führte er die Hand zur Tasse und verschüttete dabei fast seinen Espresso. Dollinger hatte geglaubt, Kehrer sei von jener Sorte, die nicht so leicht umzuhauen ist. Aber er hatte sich anscheinend getäuscht. Nicht einmal nach der Biozertifizierung seiner Espressobohnen hatte er ihn gefragt. Gleichzeitig flogen Bilder durch seinen Kopf. Bilder von Radieschen, die in offene Münder gestopft waren, Bilder von Baumstämmen, die auf ihn zurollten.
Kehrer starrte wieder auf den Teppich. Karin Dollinger zuckte ratlos mit den Schultern und tauschte erneut Blicke mit ihrem Mann.
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagte Dollinger unvermittelt. »Ich gehe mit Ihnen zum Tatort und sehe mich dort ein bisschen um. Sie erzählen mir Ihre Geschichte, und wenn das alles einen Sinn ergibt, rede ich mal mit Schwerdtfeger. Mehr kann ich nicht tun.«
Karin nickte zustimmend, zeigte aber keinerlei Begeisterung.
Kehrer hob seinen Kopf und lächelte Dollinger an. Es war kein breites Lächeln, es war ein kleines, verhaltenes Lächeln. »Wann gehen wir?«
»Jetzt«, beantwortete Karin die Frage. »Um zwölf gibt es Essen.«
»Um eins«, widersprach Dollinger.
»Von mir aus.«
Dollinger und Kehrer gingen zu Fuß an der Aisch entlang. Sie wählten also einen Umweg, der gab Kehrer jedoch mehr Zeit für seine Geschichte. Weit entfernt war die Laubenkolonie Hasenhügel allerdings auch nicht. In Biberbach mit seinen gut zweitausendfünfhundert Einwohnern war nichts weit entfernt. Selbst bis zu den Nachbardörfern war es nicht weit. Unterwegs begegneten ihnen gleich mehrere Biberbacher, die unterschiedlich reagierten. Die einen entboten einen rudimentären Gruß, wie er typisch für viele Franken war, die anderen machten große Augen und steckten dann ihre Köpfe zusammen. Hilde Sauer, die Frau eines Spediteurs, wandte ihren Blick demonstrativ von den beiden ab. Dollinger wusste, dass der gemeinsame Spaziergang mit Kehrer Folgen haben würde. Das war eine Steilvorlage für die sozialen Giftmischer, die seit jeher in jedem Dorf auf der Lauer lagen. Ihnen genügte ein kleiner Funke, um einen Waldbrand zu entfachen. Die Fake News, dachte Dollinger schmunzelnd, wurden bestimmt in Biberbach erfunden. Irgendwann im Neolithikum.
Als sie über die kleine Brücke gingen, begann Kehrer mit seinem Bericht. Er brauchte nur wenige Sätze, um den Tatabend zu schildern, an dem aus seiner Sicht kaum etwas passiert war. Ein paar Arbeiten im Garten, ein paar Arbeiten in der Laube, dann zurück nach Hause. Ein ereignisloser Spätnachmittag. Ein Routinenachmittag mit zwei, drei kurzen Nachbarschaftsgesprächen über das Wetter und die Bauerndemonstrationen in Berlin und Nürnberg. Das war alles.
»Sonst ist Ihnen nichts aufgefallen?«, fragte Dollinger enttäuscht. »Denken Sie nach, Herr Kehrer. Etwas, dem Sie keine besondere Bedeutung beimessen.«
Kehrer sah ihn achselzuckend an.
»Und Sie waren den ganzen Nachmittag alleine in Ihrer Laube?«, wiederholte Dollinger.
»Leider«, antwortete Kehrer. »Sonst wäre ich ja aus dem Schneider.«
Kurz vor der Wassermühle von Alice und Frank Schnitzerlein bogen sie nach Osten ab und erreichten die Laubenkolonie. In der ersten Parzelle auf der linken Seite stand Steffi Geismann, einen Rechen in der Hand, und verfolgte sie mit einem mehr als skeptischen Blick. Die anderen Parzellen waren leer und würden sich erst am Nachmittag füllen.