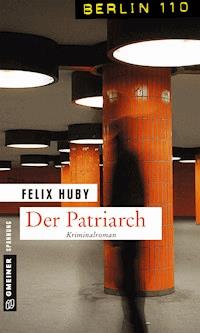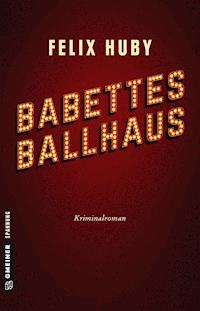8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Peter Heiland ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Wie Tausende anderer wartet auch der Unternehmer Frederic Mende auf ein Herztransplantat. Als er bei einer Veranstaltung zusammenbricht, ist überraschend das geeignete Organ vorhanden. Doch zwischen Entnahme und Implantation wird die Kühlung unterbrochen. Das neue Herz ist zerstört. Eine raffinierte Methode, jemanden zu ermorden. Peter Heiland tritt mit seinen ersten Recherchen eine Lawine los. Woher kommen die Ersatzorgane, die Professor Schultes erstaunlich oft zum exakt richtigen Zeitpunkt parat hat? Müssen Menschen sterben, damit andere überleben können? Wer sind die unfreiwilligen Spender und wer die bevorzugten Empfänger? Kommissar Peter Heiland muss ein Geflecht unvorstellbarer Verbrechen entwirren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Ähnliche
Felix Huby
Der Bluthändler
Krimi
FISCHER E-Books
Inhalt
Wenn man schreibt: Das ist in gewisser Weise wie im Kino, man begibt sich in einen dunklen abgeschlossenen Raum. Die anderen Menschen sind nicht wirklich da. Man ist alleine mit etwas Irrealem. Auch wenn ich vor meiner Schreibmaschine sitze, bin ich alleine in einer Phantasiewelt. Ich erfinde falsche Ärzte oder falsche Cowboys. Ich erschaffe eine Welt für mich selbst, in der mich niemand stört. Dann muss ich mich nicht mit der wirklichen Welt auseinandersetzen. Die einzigen Fragen sind: Kann ich diesen Trick lernen? Kann ich diese Melodie spielen? Das sind überschaubare kleine Aufgaben.
Woody Allen
1
Joseph Sabri verließ das ›Bilbao‹ kurz nach neunzehn Uhr. Trotz des frühen Abends waren nur wenige Menschen unterwegs. Der Wind pfiff durch die schmale Straße und peitschte ihm den Regen als kalte Gischt ins Gesicht. Der junge Mann fröstelte. Er sah zu den Laternen hinauf, die vor dem dunklen Himmel schwankten. Nach dem Kalender war es zwar Ende Juli, aber es schien, als habe sich der Sommer schon verabschiedet. Für die Jahreszeit war es viel zu kalt. Sabri beugte den Oberkörper weit nach vorne und beschleunigte seine Schritte. Aus dem Hauseingang eines schmucklosen Gebäudes trat ein Schatten und folgte ihm.
Der junge Afrikaner war nun schon seit anderthalb Jahren in dieser fremden Stadt in diesem fremden Land. Josephs Familie hatte ihm diese Reise ermöglicht. Sie hatten alle viel von dem gegeben, was sie gespart hatten. Ein Vetter sollte ihn am Flughafen Tegel erwarten. Aber der Cousin war nicht erschienen, und Joseph Sabri hatte ihn bis heute nicht gefunden. Dabei war er von seinen ugandischen Landsleuten und auch von anderen Afrikanern nach besten Kräften unterstützt worden. Man traf sich in den Telefonshops, wo man zu günstigen Tarifen mit zu Hause telefonierte. Dort konnte man auch Arbeit finden – schwarz, für geringen Lohn und ohne jede Sicherheit. Am liebsten arbeitete Joseph Sabri als Möbelträger. Er war stark und geschickt und verfügte über ein sehr gutes Raumgefühl. Selbst durch die engsten Treppenhäuser dirigierte er die unhandlichsten Möbelstücke mit geradezu traumwandlerischer Sicherheit.
Abends ging man ins ›Bilbao‹.
Vor fünf Wochen war sein kleiner Bruder Togo nachgekommen. Sabri hatte noch versucht, die Familie zu erreichen, um Togo von seinem Plan abzubringen. Hier war alles anders, als sie es sich zu Hause ausgemalt hatten. Seitdem ein Nachbarsjunge ein Foto geschickt hatte, auf dem eine hübsche Frau, ein schickes Auto und ein kleines Hotel zu erkennen waren und die Aufschrift ›Meine Freundin, mein Haus, mein Auto‹, war für sie bewiesen, dass man es sehr schnell zu etwas bringen konnte in diesem fernen Land. Und hatte nicht auch er von seinem gelegentlichen Verdienst so viel wie möglich an seine Familie geschickt?
Sabri erreichte eine Kreuzung. Er versuchte, sich zu orientieren. Am Nachmittag hatte ihm Kim Olala, mit dem er sich in den letzten Tagen angefreundet hatte, eine Abkürzung beschrieben. Man musste durch eine Einfahrt, durchquerte fünf Höfe und gelangte am Ende an ein Gittertor, das meistens offen war und auf die nächste Straße führte. War es verschlossen, konnte man ohne Mühe darüberklettern. So sparte man sich den Weg um einen mächtigen, langgezogenen Häuserblock. Und zudem war man ein wenig vor den widrigen Wetterverhältnissen geschützt.
Sabri blieb stehen, drehte sich unter der Jacke eine Zigarette und zündete sie an. Im Licht der Feuerzeugflamme glänzte sein nasses schwarzes Gesicht. Hier, zwischen den Häuserwänden, hatte der Wind ein wenig von seiner Kraft verloren. Der Regen kam steil von oben. Tropfen rannen in Sabris Hemdkragen. Der Afrikaner nahm seinen Weg wieder auf.
Er war erst seit drei Tagen aus dem Krankenhaus heraus. Er war dort eingeliefert worden, weil er an einem Stand auf dem Rummelplatz eine Portion Pommes frites gegessen hatte. Kurz darauf war ihm so schlecht geworden, dass er sich mehrfach hatte übergeben müssen. Mit einem Mal hatte er alles nur noch wie durch einen Schleier gesehen, und schließlich war er bewusstlos zusammengebrochen.
Im Krankenhaus war er dann wieder zu sich gekommen. Da hatten sie ihm schon den Magen ausgepumpt, und ein Doktor hatte ihm auf Englisch erklärt, dass er eine Lebensmittelvergiftung gehabt habe. Wahrscheinlich durch Salmonellen oder schlechtes Fett hervorgerufen. Er musste schildern, wo er die Pommes gegessen hatte. Dann schob ihn eine hübsche Schwester, die vermutlich aus Thailand stammte, in ein helles Einzelzimmer. Sie tupfte ihm den Schweiß von der Stirn und sagte ein paar Worte in einer Sprache, die er nicht verstand. Ein wohliges Gefühl überkam ihn. Ein paar Augenblicke später schlief er ein.
In den zwei darauf folgenden Tagen wurde er gründlich untersucht. Sie nahmen ihm Blut ab, und er musste eine Urinprobe abgeben. Ein ernster Arzt schickte ihn auf das Ergometerfahrrad. Ja selbst eine Gewebeprobe entnahmen sie ihm. Alles wurde sorgfältig protokolliert. Eine junge Ärztin befragte ihn nach Alter, Herkunft, Beruf. Sie wollte wissen, welche Krankheiten es in seiner Familie gegeben habe, woran seine Großeltern gestorben waren, ob irgendwann bei einem Verwandten chronische Krankheiten aufgetreten seien und hundert andere Sachen. Es interessierte sie auch, ob er sich schon angemeldet habe, wo er untergebracht sei, ob er Verwandte in Deutschland habe. Mit schlechtem Gewissen gestand er, dass er noch kein Asyl beantragt habe. Untergekommen sei er in einer Baracke am Rande eines stillgelegten Fabrikareals in Moabit, wo auch andere Ausländer hausten. Er sagte, die Adresse kenne er nicht. Er wisse nur, wie er hinfinde. Die Ärztin lächelte ihn an und sagte: »Ich würde Sie nicht verraten.« Aber das verstand er nicht.
Zwei Jungs, die er auf sechzehn Jahre schätzte, rasten auf ihren Mountainbikes auf ihn zu, bremsten, stellten ihre Fahrräder quer und stoppten so knapp vor seinen Füßen, dass die Reifen seine Fußspitzen berührten. »Wo willste hin, Nigger?«, fragte einer. Sabri sagte höflich: »Gutten Tack« und schlug einen Bogen um die beiden. Sie lachten und fuhren hinter seinem Rücken durch das Tor auf die Straße hinaus.
Joseph Sabri erreichte das Gittertor. Heute war es verschlossen. Der Afrikaner warf seine Kippe auf den Boden, trat sie aus und fasste mit beiden Händen nach dem oberen Rand des Tors. Im gleichen Augenblick verspürte er einen heftigen Schlag in der Kniekehle. Er knickte ein, wollte sich umdrehen, aber da spürte er plötzlich einen Stich in der Brust. In seinem Mund breitete sich der Geschmack von Blut aus. Dann umfing ihn finstere Nacht.
Die Scheibenwischer hatten Mühe, die Wassermengen von der Windschutzscheibe zu schieben. Der Regen war plötzlich wieder stärker geworden. Die Straße lag vor dem dahinrasenden Fahrzeug wie ein dunkler Fluss.
»Fahr langsamer«, sagte der Mann auf dem Beifahrersitz.
»Du weißt genau, was passiert, wenn der uns auf dem Weg krepiert!«, antwortete der Fahrer.
»Dann ist es deine Schuld. Zu stark zugestochen!«
»Leck mich doch!«
Von da an wurde nichts weiter gesprochen, bis der Kastenwagen die geschwungene Auffahrt zu einem schlossartigen Gebäude hinauffuhr, das tief in einem parkähnlichen Garten lag. Der Mann hinterm Steuer stoppte das Fahrzeug direkt vor der Tür mit der beleuchteten Aufschrift ›NOTAUFNAHME‹.
Die beiden Männer sprangen heraus, rissen die Tür am Heck des Transporters auf und zogen den bewusstlosen Schwarzen aus dem Wagen. Vorsichtig legten sie ihn auf die Treppe und kehrten ins Führerhaus zurück. Der Fahrer drückte anhaltend auf die Hupe, und als die ersten Männer in weißen Anzügen hinter der Glastür erschienen, brauste das Fahrzeug davon.
Die Pfleger entdeckten den bewusstlosen Joseph Sabri. Behutsam legten sie den Mann auf eine fahrbare Trage und karrten ihn zur Notaufnahme. Dort hatte ein junger Arzt namens Assmann Dienst. »Verkehrsunfall?«, fragte er, während die beiden Pfleger Sabri entkleideten.
»Sieht so aus«, sagte einer der Pfleger.
»Was heißt: Sieht so aus? Wo sind die Leute, die den Mann hergebracht haben?«
»Das ist das Problem. Die sind spurlos verschwunden.«
»Haben wir wenigstens seine Personalien?«, fragte der junge Arzt. Plötzlich standen Schweißperlen auf seiner Stirn.
»Nichts, der Mann hat keine Papiere bei sich.«
Dr. Assmann schaute den Pfleger einen Augenblick verständnislos an. Dann beugte er sich über den Bewusstlosen, der nun nackt auf der Untersuchungsliege lag. »Unfall, dass ich nicht lache! Sieht aus, als hätte ihn jemand abgestochen.« Er tastete vorsichtig den Brustkorb ab. »Vermutlich Lungendurchstich. Der muss sofort in den OP.«
Einer der Pfleger eilte hinaus. Unter der Tür begegnete er einem hochgewachsenen Mann Mitte fünfzig. Er trug einen dunklen Anzug, dazu eine silberne Krawatte. Über seiner hohen Stirn türmte sich ein dichter weißer Haarschopf. Seine Brille trug er an einem goldenen Bändchen um den Hals.
»Ich bin dann weg«, sagte er. »Wir haben heute das Stiftungsfest unserer Verbindung.«
Dr. Assmann sagte mit leicht belegter Stimme: »Könnten Sie sich den Notfall da bitte mal ansehen, Herr Professor Schultes? Perforierter Thorax, sieht aus wie Stichwunden …«
»Muss das sein?« Schultes reagierte ungnädig. »Ich sage doch, ich will zu der Veranstaltung unserer Verbindung.« Aber dann setzte er doch seine Brille auf und beugte sich über den Verletzten. »Sieht nicht gut aus. So wie die Stiche liegen, sollten Sie keine Zeit verlieren … wahrscheinlich ist der Herzbeutel verletzt. Am besten schicken Sie ihn gleich hoch in die Herzchirurgie. Dr. Heuer hat Dienst. Vielleicht schaue ich nochmal vorbei.«
Etwa um die gleiche Zeit bereiteten sich Reinhold und Heike Mende auf ihre Teilnahme an dem Stiftungsfest vor. Mende, ein Mann um die fünfzig, fühlte sich nicht gut. »War doch ein anstrengender Tag. Ich wäre froh, ich hätte nicht zugesagt.« Mende legte ein dreifarbiges Band um die Schulter und klickte den Bierzipfel seiner Verbindung an den Hosenbund. Dann streifte er sein Jackett über. Heike kontrollierte zum wiederholten Mal den Sitz ihrer Strümpfe. Ihr Mann runzelte die Stirn. Die Aktion seiner Frau hatte etwas Selbstgefälliges, so als bekäme sie nicht genug davon, ihre langen, schlanken Beine zu bewundern. Endlich stand sie auf und ließ sich in den Mantel helfen. Erst danach sagte sie: »Wenn du natürlich müde bist, können wir auch zu Hause bleiben. Dann sage ich ab.«
»Du kennst den Wahlspruch unserer Burschenschaft: ›Vigor, fides, patria‹ – ›Mit Kraft in Treue fürs Vaterland‹. Und außerdem hab ich ja meine eigene Ärztin dabei.«
»Ärzte gibt es bei dem Fest genug, und im Unterschied zu mir sind die alle noch in Übung! Hast du die Kamera?«
Ihr Mann hob eine kleine Ledertasche hoch. »Sag mal, diese Videodinger sind doch eigentlich out!«
»Stimmt«, gab Heike zurück, »aber du hast ja nicht die Zeit, dich mit den neuen Entwicklungen zu beschäftigen. Außerdem: Sie funktioniert ja.«
Mende setzte ein Cerevice auf, das bestickte Käppchen seiner Verbindung in den gleichen Farben wie das Schulterband und der Bierzipfel. »Gehen wir!«
Sabri war in einen Untersuchungsraum der Herzchirurgie gebracht worden. Er war bereits intubiert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Im Operationssaal trafen zwei Schwestern und ein Pfleger fieberhafte Vorbereitungen für die Notoperation. Oberarzt Dr. Friedrich Heuer stand mit dem Aufnahmearzt Dr. Assmann, der ihm als Assistent zur Hand gehen sollte, vor der Lichtwand mit den Röntgenbildern. Wortlos drehte sich Heuer dem Ultraschallgerät zu, auf dessen Bildschirm eine Ultraschallaufnahme des Herzens zu sehen war.
Assmann sagte: »Zweifacher Lungendurchstich auf alle Fälle.«
Heuer nickte. »Zweimal satt rein. So präzise muss auch Jack the Ripper zugestochen haben! Ob das Herz auch was abgekriegt hat, kann man nicht genau erkennen.«
Assmann beugte sich weit vor. »Schauen Sie, hier. Da vielleicht? Aber sehr schlecht zu erkennen …«
In diesem Augenblick kam Professor Schultes herein. Er trat sofort vor den Bildschirm. »Wie sieht es aus?«
Heuer studierte weiter die Aufnahme und sagte über die Schulter: »Thorax mehrfach perforiert. Pneumothorax. Aber vielleicht hat er Glück. Wie die Stiche geführt sind, könnte es sein, dass der Herzbeutel intakt geblieben ist.«
Schultes nickte. »Ich muss leider los. Kommen Sie zurecht?«
»Ich bin seit neunundzwanzig Stunden im Dienst«, sagte Dr. Heuer.
»Ja, ich weiß, es ist schwer.« Schultes war schon an der Tür. »Aber glauben Sie nicht, dass es früher bei uns anders war.« Damit ging er vollends hinaus.
Heuer drehte sich zu einer der beiden Schwestern um. »Fangen wir an!«
»Können Sie denn überhaupt noch?«, fragte die junge Frau.
»Muss ja wohl!«
2
Peter Heiland war als Kommissar vom Dienst eingeteilt. Er saß im Bereitschaftsraum und las Gedichte. Schwäbische Gedichte von Helmut Pfisterer. Das Bändchen war schon ganz zerfleddert wie auch seine anderen Bücher des Stuttgarter Poeten.
»Wenn ’s soweit ischt«, schrieb der Dichter übers Sterben, »schtell i mir vor, isches womöglich wie damals ame sechse, siebene obends, wo de dei Mueder von dr Gass rei g’hold ond ens Bett g’steckt hod. Und älle andere, wo so groß gwä send wie du, aber au a paar kleinere, hend no drauße bleibe ond weiterspiele dürfe.«
Ein Kollege kam herein. Heiland klappte schnell den schmalen Gedichtband zu. »Können Sie mit der Frau reden?«, fragte der uniformierte Beamte.
»Worum geht’s denn?«
Eine füllige Blondine, die er auf etwa fünfunddreißig Jahre schätzte, schob sich an dem Schutzpolizisten vorbei. »Wir vermissen nun schon zum dritten Mal in diesem Vierteljahr einen Menschen.«
Peter Heiland erhob sich von seinem Stuhl. Er überragte die Besucherin mindestens um fünfunddreißig Zentimeter. »Wir? Wer ist wir?«
»Die Mitarbeiter von Pro Asyl.«
»Aha. Bitte nehmen Sie doch Platz.«
Die Frau setzte sich, der Kommissar ging zum Kaffeeautomaten. »Kaffee? Milchkaffee? Einen Cappuccino?«, rief er über die Schulter.
»Milchkaffee, wenn’s Ihnen nichts ausmacht.«
Heiland servierte der Frau den Kaffee. »Sie müssen sich an die Vermisstenstelle wenden.«
Sie ging nicht darauf ein. »Zum ersten Mal gibt es Zeugen.«
»Trotzdem!«
»Sabri ist niedergestochen worden. Danach wurde er in einem Kastenwagen weggebracht. Das ist doch ein Fall für die Mordkommission!«
»Er heißt also Sabri. Ist das sein Vor- oder Nachname?«
»Mit Vornamen heißt er Joseph. Er hatte einen Vetter, Hassan Sabri, aber der ist schon seit längerer Zeit verschwunden.«
Heiland notierte sich die beiden Namen auf einem zerkrumpelten Zettel, den er aus der Hosentasche zog und auf dem schon andere Notizen standen.
»Wer sind die Zeugen?«, fragte er, ohne aufzuschauen.
»Zwei Jungs aus Moabit.«
»Sind Sie denn mit denen nicht gleich zur nächsten Polizeiwache?«
»Die kriegen Sie eher in die Kirche als zur Polizei!«
Heiland setzte sich der Frau gegenüber. »Die Personalien Ihres Schützlings.«
»Ja, das ist nicht so einfach.«
Heiland nickte. »Illegal hier. Nicht angemeldet?«
»Wir sind nicht mehr dazu gekommen.«
»Und wie war es bei den anderen, die verschwunden sind?«
Die Frau rutschte unruhig auf dem Stuhl hin und her. »Sie wissen doch, wie das ist.«
»Darf ich mal Ihren Ausweis sehen?«
Sie hieß Iris Bechthold, war 1978 in Leipzig geboren, wohnte in der Müllerstraße im Wedding und war von Beruf Erzieherin. Frau Bechthold trank ihren Kaffee aus und stellte ihre Tasse hart ab. »Helfen Sie mir nun, oder helfen Sie mir nicht?«
»Haben Sie irgendeinen Verdacht?«
»Sie meinen, wer die Täter gewesen sein könnten? Nein. Aber sicher hat die Tat einen fremdenfeindlichen Hintergrund, wie man heute so schön sagt.«
Peter Heiland verzog das Gesicht. »Wir nehmen Ihre Anzeige auf. Ein Kollege macht das.«
»Und Sie? Was machen Sie?«
»Ich habe morgen einen freien Tag. Das ist so, wenn man ein paar Mal hintereinander Nachtschicht geschoben hat. Meinen Sie, Sie könnten mich mit den beiden Zeugen zusammenbringen?«
Iris Bechthold sah ihn mit großen Augen an. »Ist das Ihr Ernst?«
»Ja, warum denn nicht?«
»Da könnte man ja glatt meinen, Sie wollen sich engagieren.«
Peter Heiland ging nicht darauf ein. »Also? Wann und wo? Ich bringe vielleicht einen Freund mit.«
»Sie meinen, einen Kollegen?«
»Nein, ich meine einen Freund.«
»Ich fürchte, wir haben wenig Zeit, um Sabri zu finden«, sagte sie.
»Wir tun, was wir können.« Peter Heiland stand auf. »Ich bringe Sie hinaus!«
3
Dr. Friedrich Heuer und Schwester Inge Schneider verließen den Operationssaal. »Das haben Sie wieder mal wunderbar hingekriegt«, sagte die Schwester.
»Trotzdem ist es verantwortungslos.« Heuer fingerte nach einer Zigarette.
Inge beobachtete ihn. »Sie wollten doch nicht mehr rauchen!«
Heuer sah sie wütend an. »Den Ton hasse ich, seitdem ich vierzehn war!«
»Entschuldigung. Die Zigaretten liegen im Dienstzimmer.«
»Sie haben ja recht.« Es klang versöhnlich. »Aber der Stress. Jetzt sind es zweiunddreißig Stunden.«
Am anderen Ende des Korridors erschien Dr. Miriam Sell, die Heuer ablösen sollte. »Das wird aber auch Zeit, dass du kommst«, rief ihr Heuer entgegen.
Miriam schaute auf ihre Uhr. »Friedrich, hör mal, ich bin keine Minute zu spät!«
»’tschuldige, Miriam, so war das nicht gemeint. Ich bin nur total am Ende.«
»Er ist jetzt zweiunddreißig Stunden im Dienst!«, sagte Schwester Inge.
Heuers Kollegin nickte nur. Das war in dieser Klinik der Alltag der Ärzte. »Was muss ich wissen?«
»Eigenartige Situation, dieser Notfall. Kommt hier an wie eine Fundsache, keiner weiß, wer er ist und wer ihn gebracht hat. Ein schwarzer Kaspar Hauser mit zwei Stichen durch die Lungen. Aber seine Kondition ist okay. Er sollte dir keine Probleme machen.«
»Schultes nicht da?«, fragte Miriam Sell.
»Nein, der hat wieder mal ein Fest bei seiner Verbindung. Der Himmel weiß, was daran so wichtig ist.«
»Na, die Kontaktpflege«, meinte Miriam. »Er ist nun mal nicht nur Arzt, sondern auch Unternehmer.«
»Fragt sich nur, was er mehr ist«, warf Schwester Inge ein.
Heuer lachte. »Also wenn wir ihn daran messen wollen, wie er seine Mitarbeiter ausbeutet, dann ist er entschieden mehr Unternehmer!«
Das Verbindungshaus lag im Sandwerder am Wannsee. Ein imponierendes Jugendstilgebäude mit zwei achteckigen Türmchen an jeder Flanke und einer ausladenden Terrasse zum See hin. Direkt hinter der Terrasse befand sich hinter hohen, bunt verglasten Fenstern der Festsaal. Hier strömten die Gäste zusammen, die sich bisher im ganzen Haus verteilt und dem üppigen Büfett zugesprochen hatten. Stühle wurden von den Studenten hereingetragen und für die alten Herren und ihre Damen in Reihen aufgestellt. Ein Pianist setzte sich an den Flügel und rückte den Klavierhocker zurecht, ehe er die Noten aufschlug. Als er ein paar erste Akkorde anspielte, verebbte das Stimmengewirr. Reinhold Mende, der erkennbar nervös war, entschuldigte sich: »Einen Augenblick noch« und eilte zur Toilette. Seine Frau Heike sah Schultes entschuldigend an. »Das sind die nervösen Pfützchen. So ist das bei Künstlern.«
Schultes machte eine bedenkliche Miene. »Ich weiß nicht, ob das gut für ihn ist. Aufregungen jeglicher Art sollten wir ihm ersparen.«
Heike lachte: »Lässt er sich von dir etwas sagen?«
Schultes wiegte den Kopf hin und her. »Manchmal!«
»Könntest du ihm dann nicht mal klarmachen, dass er weniger arbeiten soll?«
»Na, bei dem Thema hört er bestimmt nicht auf mich. Außerdem: Er ist Chef der größten Bank. So einer kann die Arbeit nicht nach Lust und Laune dosieren.«
Reinhold Mende kam zurück. Er räusperte sich, machte ein paar Mal »Mimimimimi« und eilte zum Podium. Heike machte ihre Videokamera bereit. Professor Schultes trat nun neben Reinhold Mende.
»Meine Damen und Herren, zu den Höhepunkten unserer Stiftungsfeste gehören immer die Auftritte unseres Bundesbruders Reinhold Mende. Sie alle wissen, er ist zwar ein ausgebildeter Sänger, doch dieser Profession geht er seit zwanzig Jahren nur noch ›ehrenamtlich‹ nach, wenn ich das mal so sagen darf. Aber Sie werden es gleich erleben: Wenn er einmal als Banker nicht mehr erfolgreich sein sollte, was Gott verhüten möge, kann er sofort wieder auf die Bühne zurückkehren. Es wäre ein umjubeltes Comeback, glauben Sie mir. Ach was, glauben Sie mir: Erleben Sie es. Bitte, Reinhold!«
Beifall rauschte auf. Mende holte ein paar Mal tief Atem und gab dem Pianisten ein Zeichen. Es erklang das Vorspiel zu dem Schubertlied ›Die Forelle‹. Dann begann Mende mit einer erstaunlich klaren und zugleich weichen Stimme:
»In einem Bächlein helle,
da schoss in froher Eil
die launische Forelle
vorüber wie ein Pfeil …«
Hatte zu Beginn auf manchen Gesichtern noch ein spöttisches Lächeln gelegen, so wich das nach und nach einem erstaunten Ausdruck. Was der Bundesbruder auf dem Podium bot, das war durchaus konzertreif.
Seine Frau hatte sich in die erste Reihe gesetzt und hielt das Objektiv ihrer Kamera auf den Sänger gerichtet.
»Doch plötzlich war dem Diebe
die Zeit zu lang,
er macht das Wasser tückisch trübe …«
Mende hielt kurz inne, nur den Bruchteil einer Sekunde, aber der Pianist warf ihm sofort einen irritierten Blick zu. Auf der Stirn des Sängers standen plötzlich dicke Schweißtropfen. Es schien, als zwinge er sich zu einem tiefen Atemzug, ehe er fortfuhr:
»… und eh ich es gedacht,
das Fischlein, das Fischlein …
zappelt dran …«
Mende fasste sich ans Herz, stöhnte auf und brach zusammen. Im Publikum war es einen Moment ganz still. Lähmendes Entsetzen hatte die meisten Zuhörer erfasst. Doch dann sprangen auch schon ein paar von ihnen auf. Heike ließ die Kamera fallen und rannte zu ihrem Mann. Schultes bahnte sich einen Weg zum Podium. Er schob Heike, die versuchte, Mendes Krawatte zu lösen, zur Seite. Er holte aus einer Arzttasche eine Spritze und eine Ampulle heraus. Gleichzeitig rief er: »Den Rettungsdienst, schnell!« Er zog die Spritze auf, band Mendes Arm ab und stieß die Nadel in die Armbeuge des Sängers.
Fünf Minuten später raste ein Notarztwagen in den Sandwerder. Zwei Sanitäter stürzten mit einer Trage in das Verbindungshaus und kamen wenige Augenblicke später mit dem bewusstlosen Reinhold Mende wieder heraus. Schultes und Heike begleiteten sie. Der Notarzt beugte sich über den Patienten.
Schultes trat zu ihm. »Wir bringen ihn in meine Klinik.«
»Ach, Herr Professor Schultes! Aber die Sportklinik wäre viel näher.«
»Er ist mein Patient. Ich will ihn bei mir haben!«
Der Notarzt zuckte die Achseln. » Auf Ihre Verantwortung, Herr Professor!«
»Ja natürlich! Was denn sonst?!«
4
Peter Heiland verließ kurz nach sechs Uhr am Morgen das Landeskriminalamt in der Keithstraße und ging zu Fuß bis zur U-Bahn-Haltestelle Wittenbergplatz.
Seltsamerweise fühlte er sich nicht müde. Er sah sich in der Bahn um. Die meisten der Fahrgäste waren auf dem Weg zur Arbeit. Viele von ihnen kämpften noch mit dem Schlaf. Einige lasen. Das war Peter Heiland schon in seinen ersten Berliner Tagen aufgefallen, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Hauptstadt sehr viel gelesen wurde. Nicht nur die ›BILD-Zeitung‹ oder die bunte ›BZ‹, sondern auch Bücher. Und jedes Mal versuchte er herauszubekommen, was die Menschen lasen. Manchmal musste er dazu in die Hocke gehen, um den Titel erkennen zu können. Die verwunderten Blicke der anderen Fahrgäste genierten ihn nicht. Gerade hatte er festgestellt, dass eine junge Frau, deren hübsches Gesicht grau war vor Müdigkeit, ein Buch mit dem Titel ›Männer sind zum Abgewöhnen‹ las.
»Ha, des find ich jetzt aber übertriebe«, entfuhr es ihm.
Die Frau schaute auf. »Wie bitte?«
Peter deutete auf den Titel.
»Finden Sie nicht, dass das stimmt?«, fragte die Leserin.
»Noi, gwieß net!« Unwillkürlich war er in sein heimatliches Idiom verfallen.
»Aber ich!« Damit wandte sie sich wieder ihrer Lektüre zu.
Heiland zog sein Handy aus der Hosentasche und verstreute dabei ein halbes Dutzend Zettel, die mit dem Telefon herausgerutscht waren. Während er sie wieder zusammenklaubte, wählte er. »Ja, ich bin’s, Manuel. Was heißt denn da ›Mitten in der Nacht‹? Ich hab grad Feierabend g’macht!«
Sie verabredeten sich zum Frühstück in einem kleinen Café an der Stargarder Straße, schräg gegenüber von Peter Heilands Wohnung.
»Sag mal, ich bin kein Afrikaner! Ick bin een einjeborener Berliner.« Manuel rührte in seinem doppelten Espresso und biss in ein Croissant, das er dick mit Himbeermarmelade bestrichen, besser gesagt, gefüllt hatte.
»Ich denke, du kommst aus Nigeria, oder war es Simbabwe?«
»Hab ich das erzählt? Dann wird’s auch stimmen.« Auf Manuels dunkelbraunem Gesicht breitete sich ein fröhliches Grinsen aus. Peter Heiland blieb ernst. »Das muss dich doch eigentlich interessieren, wenn hier, mitten in Berlin, Afrikaner spurlos verschwinden und keiner weiß, wo die geblieben sind. Von Übergriffen hat man ja immer wieder gehört, aber dass die sich in Luft auflösen …«
»Mein Gott, die werden sich irgendwo verstecken, um nicht abgeschoben zu werden.«
»Ne, du. Die hatten hier schon ein ganz gutes Versteck.«
»Sagt wer?«
»Iris Bechthold.«
»Und wer ist das?«
»Ich bin das«, sagte eine weibliche Stimme.
Der Schwarze fuhr herum. Peter erklärte: »Ich habe sie angerufen, kurz nachdem ich dich zum Frühstück eingeladen habe.«
»Ach, wir sind eingeladen?«, krähte Manuel. »Na, dann setzen Sie sich mal, Gnädigste!« Dann rief er zum Tresen hin: »Luigi, mir noch eine Portion Rühreier mit Schinken und ein Glas Prosecco. Das brauch ich jetzt für meinen Kreislauf!«
Iris Bechthold hatte sich inzwischen gesetzt. Sie sah Peter Heiland in die Augen. »Ich denke, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet?«
»Hab ich auch.«
»Aber so sehen Sie gar nicht aus.«
»Der ist von ’nem besonderen Schlag«, meldete sich Manuel wieder. »Er stammt nämlich von der Schwäbischen Alb!«
Luigi, der Besitzer des Cafés, stellte ein Glas Prosecco auf den Tisch, und Iris trank ohne Umstände daraus.
»Na, du bist gut!«, rief Manuel.
»Da hast du recht!«, gab sie fröhlich zurück. »Ich mag es, wenn ein Tag so anfängt!«
5
Reinhold Mendes Zustand hatte sich in der Nacht ein wenig stabilisiert. Er war kurz nach seiner Einlieferung zu sich gekommen. Sein erster Blick hatte der Uhr über der Tür gegolten. Es war kurz nach Mitternacht. Heike und Schultes standen an seinem Bett.
»Was ist passiert?«, fragte Mende.
Schultes ging nicht darauf ein. »Wir werden dich jetzt gründlich untersuchen, und dann treffen wir die erforderlichen Maßnahmen«, und zu Heike gewandt, fuhr er fort: » Möchtest du dabei sein?«
»Nein, lieber nicht«, sagte die Frau des Patienten. »Ich kann ja hier nicht helfen.«
Schultes fasste ihre Hände. »Ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, aber wir … wir werden alles tun, was in unserer Macht steht.«
»Danke.« Heike wendete sich abrupt ab, ging zur Tür. Dort begegnete sie Miriam Sell, die gerade hereinkam. »Hallo, Miriam!«
Frau Dr. Sell nickte nur und begab sich sofort zu Mende, um die Untersuchung zu beginnen. Professor Schultes stand am Fußende des Bettes und beobachtete seine junge Kollegin bei der Arbeit. Mende hatte wieder das Bewusstsein verloren. Schultes versenkte die Hände in den Hosentaschen und pfiff fast tonlos vor sich hin. Miriam warf ab und zu einen genervten Blick zu ihm hinüber, aber das schien ihn nicht zu stören.
»Schauen Sie!« Miriam deutete auf den Bildschirm am Kopfende des Bettes.
Schultes nickte. Das Herz produzierte nur ganz schwache Kurven.
»Schwere Myokarditis!«
»Da hat er ja wirklich Schwein gehabt, dass Sie dabei waren. – Stimulation mit Elektroschocks?«
Schultes schüttelte den Kopf. »Nein, das geht nicht. Er hat einen Herzschrittmacher. – Das ist eine lange Vorgeschichte, mit Herzklappenfehler und allem, was dazugehört.«
»Die deutschen Eichen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren.«
Schultes warf ihr einen bösen Blick zu, sagte aber nichts. Miriam schloss den Patienten an das Sauerstoffgerät an. »Haben Sie schon mal an eine Transplantation gedacht?«
»Die hatten wir fest vor. Ich hab schon alles mit ihm besprochen. Ich fürchte, jetzt ist sie zwingend notwendig. Und zwar schnell! Wir müssen versuchen, ihm innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden ein neues Herz einzusetzen.«
Miriam sah ihn verständnislos an. »Das ist doch gar nicht möglich – wo sollen wir denn so schnell das passende Implantat auftreiben?«
»Es ist seine einzige Chance.«
In diesem Augenblick hörte man plötzlich das Alarmsignal aus dem übernächsten Raum der Intensivstation. »Was ist denn da los?«, rief Schultes herrisch. Er eilte aus dem Zimmer, und Miriam folgte ihm, nachdem sie der Schwester rasch gesagt hatte, sie solle Mende nicht aus den Augen lassen.
Nur zwanzig Schritte von Mende entfernt lag Sabri in einem anderen Teil der Intensivstation. Schultes war als Erster an das Bett des Schwarzen getreten. »Verdammt, was ist mit dem Sauerstoff?«
»Was ist denn?«, fragte Miriam Sell atemlos.
»Das Gehirn kriegt keinen Sauerstoff mehr.«
Die Oberschwester kam herein. »Ich war drüben bei dem letzten Bypass von gestern Abend.«
»Das Beatmungsgerät ist abgestellt«, schrie Miriam. Sie stellte es sofort wieder an und untersuchte dann, ob irgendwelche Anschlüsse oder Schalter defekt waren. »Hier hat jemand die Schläuche herausgezogen. Rufen Sie sofort den Techniker, Schwester Clara!«
Professor Schultes trat einen Schritt vor und beugte sich tief über den Patienten. »Da ist nichts mehr zu machen.«
Miriam war verzweifelt. »Wie kann denn so etwas passieren? Ich verstehe das nicht!«
»Das Gehirn ist tot. Ist er Organspender?«, fragte der Klinikchef.
»Wir haben nichts bei ihm gefunden«, antwortete Oberschwester Clara.
»Abgleichen, ob wir einen Empfänger haben, zu dem die Werte passen«, kommandierte der Professor. »Kontakt zu Eurotransplant aufnehmen und die Werte durchgeben.«
»Aber sein Herz schlägt noch gut.«
»Na hoffentlich«, gab Schultes barsch zurück.
Miriam schaute ihn befremdet an, der Professor fing den Blick auf und belehrte seine Mitarbeiterin: »In solchen Fällen kann man sich keine Sentimentalitäten erlauben, Frau Kollegin! – Bringt den Patienten in den OP7. Wir gehen das sofort an!«
Schwester Clara wendete ein: »Wir wissen nicht, ob er mit einer Organentnahme einverstanden wäre. Und es gibt keine Familie, die wir fragen können.«
»Eben!«, sagte Schultes. »Schluss der Diskussion. Wir entnehmen die Organe!«
6
Der Bolzplatz lag zwischen zwei renovierungsbedürftigen Mietshäusern, die sich mit ihren fensterlosen Giebeln gegenüberstanden. Zwischen den Gebäuden war ein etwa vier Meter hoher Drahtzaun gezogen. Rechts und links standen zwei Fußballtore mit durchlöcherten Netzen. Die Schläge gegen den Ball hallten laut zwischen den Häusern. Wenn ein Schuss gegen eine der Hauswände flog, knallte es noch lauter, und manchmal bröckelte dabei ein wenig Putz ab. An vielen Stellen waren längst die rotbraunen Ziegel zu sehen.
Peter Heiland stieß das Tor auf, das exakt in der Mitte zwischen den beiden Hausgiebeln in den Zaun eingelassen war. Der Ball rollte vor seine Füße. Gekonnt hob er ihn mit der Schuhspitze an, balancierte ihn kurz auf Knie und Schenkel und schoss ihn schließlich zurück.
»Nicht schlecht, Herr Specht«, rief einer der Jungen.
Die sieben oder acht Fußballer waren zwischen fünfzehn und siebzehn Jahre alt, schätzte Peter Heiland. Iris Bechthold war außerhalb des Zauns geblieben. Doch Manuel folgte nun Peter Heiland auf den Platz.
»Hey, Nigger«, grölte einer der Jungs, »pass auf!« Er schoss den Ball aus kurzer Distanz mit voller Wucht in Richtung Manuel. Aber der stoppte ihn geschickt mit der Brust, ließ ihn abtropfen und begann auf das Tor zuzudribbeln. Nacheinander stellten sich ihm alle außer Peter Heiland in den Weg und versuchten, ihm den Ball abzujagen. Aber er umspielte sie, als wären sie Slalomstangen auf einer Skipiste, und donnerte den Ball schließlich ins Tor. »Profi, was?«, rief der Junge, der ihn zuvor ›Nigger‹ genannt hatte.
»Begabter Amateur!«, gab Manuel grinsend zurück. »Und sag nicht nochmal Nigger zu mir!«
Jetzt nahm Peter Heiland das Wort. »Hört mal, zwei von euch haben gestern Abend gesehen, wie ein Afrikaner überfallen wurde.«
»Wer will das wissen?«, fragte einer der Jungen.
»Ich!«
»Und wer bist du?«
»Einer, der rauskriegen will, was mit dem Mann passiert ist.«
»Den hat einer abgestochen, und dann haben sie ihn in ’nem kleinen Lastwagen entsorgt«, sagte ein anderer Junge.
»Was für ein Lastwagen?«, fragte Manuel.
»War det einer, den du kennst?«, wollte der Junge wissen.
»Möglicherweise. Ein guter Freund von mir fehlt seit gestern, und er muss genau hier in der Gegend unterwegs gewesen sein.«
»Kann schon sein.«
Jetzt meldete sich Peter Heiland wieder: »Weiß einer von euch, was das für ein Fahrzeug war? Die Marke, meine ich, und habt ihr vielleicht das Kennzeichen erkannt?«
»Ein Fiat. Typ kenn ich nicht. ’ne Berliner Nummer. B – KL …, Zahlen weeß ick nich.«
»Du hast dir die Buchstaben gemerkt?«
»Klaro. Ick heeß Kevin Leitner. KL, vastehste?«
»Vastehe«, sagte Peter Heiland und grinste den Jungen an. »Ich geb ’ne Runde Cola aus!«
»Du kannst ’ne Runde ausgeben, aber wat wir denn saufen, ist unser Ding!«
Peter zog einen Zehneuroschein aus der Hosentasche und steckte ihn dem Jungen ins Hemdentäschchen. »Na, dann prost«, sagte er und verließ zusammen mit Manuel den Bolzplatz.
7
Joseph Sabri lag auf dem Operationstisch. Schultes trug jetzt den grünen OP-Mantel, eine Atemmaske vor dem Gesicht und Gummihandschuhe. Ihm stand ein Team aus vier Ärzten zur Seite, zu denen ein Anästhesist gehörte, dazu zwei Schwestern, zwei Pfleger und ein Kardiotechniker, der die Herz-Lungen-Maschine bediente.
»Also, legen wir los«, sagte Schultes gut gelaunt. »Skalpell, bitte!«
Der Professor trennte in Sabris Brust die Naht vom Abend zuvor wieder auf und setzte den Einschnitt fort bis hinunter zum Schambein. Dann zog er quer dazu in der Mitte einen Schnitt von einer Seite zur anderen, sodass die Eingeweide vollständig freilagen. »Drahtzange bitte!«
Ein Assistent reichte ihm die Zange. Schultes bog die beiden Hälften des Brustkorbs mit einem großen mechanischen Instrument auseinander. Das pulsiernde Herz kam zum Vorschein.
Auf der obersten Anzeige des Turms aus Bildschirmen, mit deren Hilfe Sabris Vitalzeichen überwacht wurden, schlug die Amplitude regelmäßig aus. »Herzfrequenz 62 pro Minute«, meldete der Anästhesist.
»Ausgezeichnet!« Schultes wirkte ruhig und souverän. »Kanülen legen. An Herz-Lungen-Maschine anschließen.«
Eine Schwester schob eine Kanüle in die Aorta. Ein Assistent führte eine andere in die Hohlvene ein. Beide Kanülen wurden an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen.
»Kochsalzlösung!«, befahl Schultes.
Er goss die kalte Kochsalzlösung über das Herz. »Aorta abklemmen«, kam die nächste Anweisung. »Konservierungsprozess einleiten. Kaliumlösung … In die Herzkammern infundieren bitte.«
Sobald die Kaliumlösung eingeführt war, wurden die Amplituden auf dem Bildschirm zu flachen Linien. Sabris Herz hatte aufgehört zu schlagen. Noch einige wenige Schnitte, und Schultes konnte das Organ vorsichtig mit beiden Händen aus dem Brustkorb heben. In seinen Händen war es nicht mehr als ein unansehnlicher, schlaffer, graurosafarbener Klumpen.
Schultes zog die Gummihandschuhe aus, nahm den Atemschutz vom Mund und ließ sich von einer Schwester den Schweiß von der Stirn tupfen.
Als der Professor in sein Arbeitszimmer kam, saß Heike Mende auf seiner Besuchercouch. »Ich hab’s zu Hause nicht ausgehalten«, sagte sie.
Schultes ließ sich in einen tiefen Ledersessel sinken. Er wirkte jetzt erschöpft. »Wir können ihn retten. Zum Glück haben wir ja die ganzen notwendigen Voruntersuchungen schon in den letzten Wochen gemacht.«
»Du willst mich nur trösten, stimmt’s?«
Kühl antwortete der Professor: »Nein. Es geht mir nur um Reinhold. Er ist einer meiner besten Freunde und ein so wertvoller Mensch. Ich würde alles für ihn tun!«
»Ja, wenn’s von deinem guten Willen abhängen würde …«