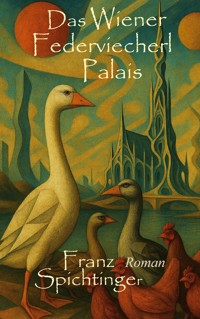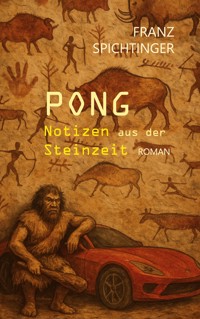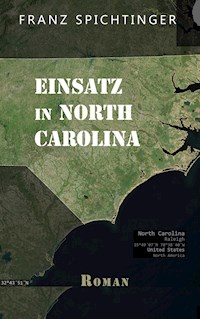Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»A wenig a Tristesse, a wenig a Schmäh, oba ane Kultur«: So ließen sich die Lebensumstände wie der Seelenzustand der kaiserlichen Untertanen im Habsburger Reich beschreiben. Die morbid-charmante Historie der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie bildet den zeitlichen Hintergrund des neuen Romans von Franz Spichtinger. Ferdinand Polschitz, den sie im südböhmischen Prachatitz achtungsvoll den böhmischen Herrn Ferdinand nennen, ist der Hauptprotagonist der facettenreichen Romanerzählung. Das österreichische Linz und das prunkvolle, ausgelassene Wien der Jahrhundertwende mit seiner spezifischen Lebensqualität, aber auch das böhmische Juwel Prag an der Moldau, vor allem aber der Böhmische Wald sind Stationen dieses an Metaphern und literarischen Miniaturen reichen Romans. Aus dem Reigen der Figuren stechen Anna Anzengruber, ein Gewächs aus dem »Mödlinger Pflanzgarten«, und die neureiche Jarmilla hervor, Witwe des früh verstorbenen Rittmeisters von Wesowitz, »ane ägyptische Potifar«, welche aus einfachen Verhältnissen in den niederen Adelsstand aufstieg. Der Autor legt einmal mehr einen erfrischenden, authentischen und sprachlich überzeugenden Roman vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANZ SPICHTINGER wurde 1941 in Plöss, einem Dorf an der böhmisch-bayerischen Grenze, geboren. Nach der Vertreibung und Flucht aus der angestammten Heimat ließ sich die Familie in der benachbarten Oberpfalz nieder. Der Neuanfang, der Aufbau neuer Beziehungen und Lebensverhältnisse und die Vielfalt persönlicher Ereignisse in den Wirren der Nachkriegszeit haben sich auch in seinem Leben niedergeschlagen. Der Autor studierte Erziehungswissenschaften und Religionspädagogik an der Katholischen Pädagogischen Hochschule Eichstätt. Danach war er als Volksschullehrer und schließlich als Schulleiter tätig. Ein Schwerpunkt ist seit Jahrzehnten im Rahmen der Erwachsenenbildung die Auseinandersetzung mit Fragen der Gesellschaftspolitik und der Religionen. Franz Spichtinger ist verheiratet und hat zwei Töchter.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Kapitel 123
Kapitel 124
Kapitel 125
Kapitel 126
Kapitel 127
Kapitel 128
Kapitel 129
Kapitel 130
Kapitel 131
Kapitel 132
Kapitel 133
Kapitel 134
Kapitel 135
1.
Der böhmische Herr Ferdinand hat nicht immer schon der böhmische Herr Ferdinand geheißen. Dass er zu diesem doch etwas ungewöhnlichen Namen gekommen ist, hatte seine besondere Bewandtnis. Der Ferdinand Polschitz war das dritte Kind des Bürstenbinders von Nebahovy, Wenzel Polschitz und seiner Marie, wobei der Erstgeborene, der Gustl, noch im Kindbett gestorben war und die Barbara, ein Wildfang, wie man so sagte, das Dorf unsicher machte und mit Hund und Katz’ auf Du stand. Dass ihnen allen einmal die kleine Bertl, der »süaße Tropfn«, wie der Pap’ sie nannte, das Herz brechen möcht, konnten sie nicht ahnen.
Dieses Nebahovy, das die deutschen Böhmen in der Ortschaft lange schon ihr Nebahau nannten, war ein hölzernes Dorf nahe Prachatitz. Vom Dorf bis in die Stadt hinein war man zu Fuß eine gute halbe Stunde unterwegs, auch nach Žernovice hinauf streckte sich der Weg ebenso lang und wer denn in Chroboly zu tun hatte, nutze eine gute Stunde den Feldweg über die wunderschönen Auen.
Jeder Bauer in Nebahovy besaß seinen Holzstadel neben dem steinernen Stall und einen hölzernen Abort hinter dem Haus. Die Dorfhunde lebten in angemalten hölzernen Hütten und die Dörfler gingen schon seit langen Jahren auf sauber gefegten hölzernen Bürgersteigen, die an den beiden Seiten entlang der Dorfstraße, die breit wie die Prachatitzer Allee war, durch das schöne Nebahovy führte. Sie brauchten keinen Kanal unter dem Bürgersteig, denn in der schmalen, stets sauber gereinigten, irdenen, braun glänzend gebrannten Rinne unter dem hölzernen Gehweg floss nur das restliche Regenwasser, das nicht im Sand der Straße versickert war, aus dem Dorf in den Bach, der sich seinen Weg in den Živný potok suchte.
Auf einer Wiese zwischen dem kleinen Rinnsal und dem Živný potok hatte der Herr Bezirksrichter von Prachatitz eine kleine Holzhütte hingestellt und er verbrachte dort im heißen böhmischen Sommer bis hinein in die letzten Septembertage seinen freien Sonntag. Die Magdalena, seine Frau, die er in Rokyzany gefunden hatte, badete ihre Füße im Bach und die blonde Mischa lag auf einer Decke, schaute in den blauen Himmel und träumte sich in ihre eigene Welt.
Im Sommer war die Straße staubtrocken, im Winter beinhart gefroren und im Frühjahr und im Herbst von der dicken, grundigen Sanddecke braun eingefärbt. In der Früh um sechs Uhr, da hatten die Hähne schon ihr erstes Konzert in den jungfräulichen Himmel gekräht, pünktlich zum Mittag und abends um sieben zog der Wenzel Polschitz die Glocke der kleinen Kapelle am hanfernen Glockenseil, dass sie zuverlässig ihren jammervollen, scheppernden, doch so wohl gelittenen Klang durchs Dorf bellte und die Leute zum Beten aufforderte. Mit dem ersten Hahnenschrei krochen die Leute von Nebahovy aus den Federn und wenn es abends dunkel wurde, schlüpften sie wieder unter die Decke. In jedem Bauernhaus lebte eine Herde Kinder, die es durchs Leben zu bringen galt.
In Nebahovy, wo also auch der kleine Ferdinand das Licht der Welt erblickt hatte, haben gerade zwölf Häuser gestanden. Neben dem Polschitz hatte der wortkarge Josef Bolech, ein grauschädeliger, robuster Mann, ein kleines, sauberes Gehöft hingestellt, er hatte die Gänse im Dorf gehütet und war noch dazu ein angesehener Schuster. Seine Kinder brauchten einen Herrn und Meister, weil sie sonst kaum zu bändigen gewesen wären.
Das andere erwähnenswerte Anwesen neben dem Bolech gehörte der einschichtigen, jungen Lenka Hejda, vor deren Gartenzaun der Dorfbrunnen stand, ein für die örtlichen Verhältnisse stattlicher, sehr gediegener Granitblock, in den ein quadratisches Becken eingemeißelt war und aus dem massiven Granitklotz ragte die schmiedeeiserne Schwengelpumpe. Vor dem Brunnen trafen sich allmorgendlich die Frauen des Dorfes und frönten lachend einem Tratsch.
Dann wohnte auf der anderen Straßenseite der Miloslav Janik mit seiner Elena, ein rothaariges, lebenslustiges Geschöpf, die jedes Jahr zuverlässig nach der Ernte im September ein neues Kind in die Welt setzte. Daneben hauste der Jiří Kratochvil, ein umgänglicher Witwer, ein Holzhauer, welcher der erwähnten Lenka, deren Mann in Wien ein Fleischer war und nur alle heilige Zeit heimkam, das Wesentliche besorgte. »Lebst noch?«, begrüßte der Jiří Fremde wie die einheimischen Dörfler, denn in seinem Denken existierten keine Standesunterschiede. Er tat keinem weh und lebte aus der Souveränität des einfachen, armen Mannes, dem das Hemd und die Hose und ein Paar Schuhe fürs Leben genügten. In der kleinen Hütte neben dem Haus der Lenka wartete der biedere Hufschmied Jan Tomanek täglich, oft genug vergeblich, vor seiner Esse auf Kundschaft. Aber er hatte noch einen kleinen Ausschank angemeldet, und in den Abendstunden saßen die Männer des Dorfes gerne beim Tomanek, kartelten und tranken das dünne Bier.
Der Lukas Zwerenz war der Einzige, der aus der Reihe tanzte und immer wieder einen Zwist ins Dorf brachte, ein unguter Geselle, wie es schien. In den ersten Monaten, er hatte das leere Haus der verstorbenen Eva Silbermannova gekauft, war ihm am frühen Morgen das Glöckerl vom Polschitz zu laut, das ihn ins Gebet bringen sollte. Dann stänkerte er über den Rauch, den der Ostwind ab und an vom Bursik herübertrieb, der sich nur über sein Gehöft lege, wie er sagte. Der Kinderlärm auf der Dorfstraße ärgerte ihn, das Bier vom Tomanek war ihm zu dünn und schließlich sagte ihm der Bursik aufs Gesicht zu, dass sie noch keinen solchen Querkopf im Dorf gehabt hätten und er würde alles durcheinander bringen und wenn es ihm im Dorf nicht passe, solle er dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst. Da wurde der Zwerenz leidlicher und auf der Herbstkirchweih in Prachatitz saß er unvermittelt neben dem Tomanek und dem Bursik und langsam fand er sich mit den dörflichen Gegebenheiten in Nebahovy ab.
Dann waren noch vier tschechische Holzhauer da in Nebahovy, in vier frisch gestrichenen Hütten, der langarmige Václav Brožík, der mit dem linken Fuß lahmte, aber die Geige so schön spielte, der Jan Kosárek, der immer flotte Sprüche klopfte, der schweigsame František Procházka, der mit seinen Gedanken mehr in der weiten Welt als in Nebahovy lebte, und noch der gescheite Bedřich Wiesner, den sie alle den Doktor nannten. Die vier haben im Wald und im nahe gelegenen Sägewerk gearbeitet und ein fünfter, der Vojtěch Holub, der weiß Gott was getrieben hat, lebte in Nebahovy sein bescheidenes Leben, hatte aber seine Familie auch gut durchgebracht. Schließlich wäre vom einzigen größeren Bauern in der tschechische Gemeinschaft zu berichten, der seinen steinernen Hof an das Ortsende hingestellt hatte, der Martin Bursik also.
Er hatte tatsächlich einen größeren Viehbestand, sechs Schweine dazu im Koben, die er das ganze Jahr über fett fütterte und sie dann an einen befreundeten Metzger in Prachatitz verkaufte. Dreizehn Milchkühe und ein Bummel, »mein Milan«, wie er ihn nannte, standen im Stall, und der Milan brachte dem Bursik zusätzliches gutes Geld, dazu meckerte eine Herde Ziegen den Sommer über auf der Brache hinter dem Dorf, ein paar Schafe labten sich am Gras auf der Oberwiese und eine Handvoll Hühner legten täglich ihre Eier.
An milden Sommerabenden trafen sich die Dörfler beim Bursik im Hof, sangen ihre heimischen Lieder und tanzten die Polka und in den stillen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr saßen sie einträchtig in der guten Stube beim Martin Bursik und der Václav Brožík spielte auf seiner Geige besinnliche Weihnachtslieder und weil die Leute aus Nebahovy eines wie das andere tschechisch und deutsch redeten, fiel es ihnen leicht, ihr »Stille Nacht, heilige Nacht« auch auf Tschechisch zu singen. »Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie dôverný pár, stráži Dietatko, nebeský dar. Sladký Ježiško spí, sní, nebesky tíško spí, sní.« – »Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht.« Danach war es still und die Leute aßen ein paar Plätzchen und tranken den Punsch, den die Bursikova gebraut hatte.
Beim Bursik lärmte eine Horde kräftiger, nimmermüder Buben und ein schönes Mädel, ein blondes, langhaariges und spindeldürres Gewächs, das so geschliffen deutsch wie der Ferdinand Polschitz tschechisch sprach. Die Bozena war schon als kleiner Wildfang in den Ferdinand verliebt und versprach ihm, da führte er sie an der Hand nach Prachatitz hinüber in die erste Klasse der Volksschule, dass sie ihn und nur ihn heiraten würde. »Tancuj, tancuj vykrúcaj, vykrúcaj, Len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj, Dobrá piecka na zimu, na zimu, Nemá každý perinu, perinu. Trá-la-la-la, trá-la-la-la, La-la-la-la la-la-la la-la-la, Trá-la-la-la, trá-la-la-la, La-la-la-la la-la-la la-la-la«, trällerte sie und tanzte an seiner Hand durch ihre jungen Tage.
2.
Einen Steinwurf außerhalb von Nebahovy, wo der Weg nach Žernovice abbiegt, hatte seinerzeit der Bohumil Blecha seine Familie durchs Leben gebracht, hatte den Prachatitzern die Straßen gekehrt und beim Bursik in Nebahovy hatte er gemacht, was so anfiel. Sie hatten den kleinen Pavel in die Welt gesetzt, der nicht stehen und gehen konnte und erst in Jünglingsjahren auf die Beine kam. So hinkte er durchs Leben, ging Tag für Tag in aller Herrgottsfrüh nach Prachatitz hinüber in die Frühmesse und hatte, nach dem Tod der Eltern, den Prachatitzern auch die Straßen gefegt, im Winter den Schnee von den Bürgersteigen geräumt und das Abwasser aus den Häusern entsorgt. Er stand bei mehreren Bauern in Diensten und hatte, wie seinerzeit der Vater, für geringes Entgelt die Schweineställe ausgemistet, die Kühe auf die Wiesen geführt und den Bäuerinnen den Garten umgegraben. Der Pavel hatte nie geklagt und seine Unbilden ohne Murren getragen. »Dein Kreuz tragst fürs Leiden Christi, Bua«, hatte seine Mutter ihm von Kindesbeinen an mitgegeben. An den Maiabenden ließ er sich’s nicht nehmen, die Maiandachten in Sankt Jakob zu besuchen. Mit seiner schönen Stimme sang er die böhmischen Marienlieder und in der österlichen Zeit betete er den Kreuzweg mit den Prachatitzer Frauen.
An einem heißen Augusttag fanden sie den Pavel vor seiner Hütte, ein blecherner Milcheimer lag neben ihm. »Den Pavel hat der Blitz gstreift«, brachte einer der Bursikbuben ins Dorf. Der Blitz hatte dem Pavel den rechten Arm verbrannt, aber er hatte ihn auch um den Verstand gebracht. Der Bursik legte den Pavel ins Austragshäusl, das seit dem Tod der Bursik-Großeltern leer stand und versorgte ihn. Nach einem halben Jahr ließ sich die Schwester des Pavel sehen. Sie fuhr mit einem Schlittengespann im Hof der Bursik vor. In Babice drüben hatte sie mit ihrem Mann einen Hof bewirtschaftet. Ihr Emil sei vor ein paar Wochen gestorben, sagte sie zum Bursik, der hätte den Pavel nach dem Blitzschlag nicht auf den Hof gelassen, sie nähme den Bruder jetzt mit nach Babice. Wenn sie nicht fertig würde mit der Arbeit, müsst er halt ins Armenhaus nach Pištín rüber, der Pavel. »Da geht’s den Leuten recht gut«, und sie würde schon für ihn aufkommen, sagte sie beim Abschied. In Nebahovy hatten die Dörfler den Pavel Blecha einen Gottesknecht genannt, kein anderer hätte so viel Elend aufgeladen bekommen.
3.
Wo der Weg nach Lhenice rüberbiegt, das in einer guten Stunde von Nebahovy aus zu erreichen ist, liegt auf der halben Strecke Mičovice. Nur einen Steinwurf vor Mičovice, zur linken Hand einem schönen Waldstück vorgelagert, bestellte der Jankov sein Anwesen, ein schönes Gütl mit etlichen Tagwerk Acker und Wiesen, dazu hatte er ein Dutzend Kühe im Stall. Dieses Gehöft zählte zu Nebahovy und der Jankov hörte zur festgesetzten Stunde das Läuten der Glocke vom Wenzel Polschitz herüberwimmern. Bauer und Gesinde schlugen andächtig das Kreuz und beteten am Feierabend den Engel des Herrn.
Bedřich Jankov selber stammte aus Chvalovice, war der siebte, der letzte einer Reihe Buben, sollte den heruntergewirtschafteten, verarmten elterlichen Hof übernehmen, weil die Brüder alle schon das Heil in der weiten Welt gesucht hatten. »Daheim verhungern wir alle gemeinsam«, sagten die Brüder, die von Kind auf schmale Kost auf dem Tisch hatten. Aber wo der Dung fehlt, wird auch nichts wachsen, sagten die Eltern und das traurige Gehöft würde auch den Bedřich nicht ernähren können.
So hatte der Bedřich in den Seiberthof bei Mičovice eingeheiratet, die Lena Seibert hatte er beim Tanz in Mičovice kennen gelernt. Dann kamen recht bald nach der Hochzeit die Wally, der Emil, die Rita, der Jan und die Herta zur Welt und schließlich meldete sich acht Jahre später noch unvermutet der kleine Bedřich. Eines Tages hatte die Mutter die Wäsche auf der Wiese ausgelegt, rief die Herta und gab ihr auf nach dem schreienden Bedřich zu schauen. »Steck ihm den Sauger in den Mund«, rief sie ihr nach, »dann gibt er a Ruah’.« Aber nach geraumer Zeit fing der Bedřich wieder zu schreien an und die Herta ließ sich nicht mehr blicken. Auf dem Weg von der Wiese ins Haus musste die Herta am Brunnenloch vorbei. Die Herta wird da hineingeschaut haben und die Mutter hat nach vergeblicher Suche ihre Herta zwei Meter unten im Schacht entdeckt. Das war ein Elend im Haus und der Bedřich Jankov hat seiner Lena Vorwürfe gemacht und ihr die Schuld gegeben, sie habe den Deckel nicht über den Brunnenschacht gelegt und auch an der Maßlosigkeit seiner Anschuldigungen ist der Lena das Herz endgültig zerbrochen. Übers Jahr hatte man sie dann zu ihrer Herta auf den Friedhof gelegt. Der Bedřich Jankov zog seine Kinder allein groß und alle sind sie gut geraten. Eines Tages erschien der Herr Prälat von der Jakobskirche und meinte, dass der Jan so ein Gescheiter wäre und der Familie wäre doch geholfen, wenn der Bub auf Priester studiert und er würde ihn nach Budweis ins Seminar schicken.
Ein Esser weniger, dachte der Bedřich, kann nur gut tun und der Bub wird ja alle heilige Zeit heimkommen. Die Wally fand dann eine Anstellung beim Magister Borwitz in Prachatitz, in den elterlichen Hof hat ein einschichtiger Taglöhner eingeheiratet und die Rita glücklich gemacht. Er hat recht ordentlich seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Der Emil ist ins Amerika ausgewandert, hat als Zimmerer gearbeitet und man hat nichts mehr von ihm gehört.
4.
Als der Ferdinand Polschitz die Bürgerschule in Prachatitz hinter sich gelassen hatte, richtete ihm seine Mutter ein ledernes Säckel, steckte das schöne Hemd und eine zweite Unterhose hinein und für den Winter dicke, gestrickte Strümpfe. »Geh zum Onkel Karl nach Prachatitz, auf den bist ja mit deinem Zweitnamen getauft, der wird dich durchbringen. Das ist er mir schuldig. Er durfte damals auf die Bürgerschule gehen und was Gscheites lernen, an mir haben die Eltern gespart.«
Der Ferdinand war ein gehorsamer Jüngling, er fragte nicht lange und machte sich auf den Weg. Die Mutter sagte zum Vater: »Wenn’s a weng a Gerechtigkeit gibt, dann wird er einmal der Herr.« Das Schicksal meinte es also mit dem Bub besser als mit den Eltern, die ja noch ein Mäderl, wohl ein halbes Dutzend Jahre jünger als der Ferdinand, durchzubringen hatten und mit der Bürstenbinderei auf keinen grünen Zweig kamen. Der Onkel Karl, der es drüben in Prachatitz mit Fleiß und einem Haufen Glück, wie er selber sagte, zu Ansehen und einem beträchtlichen Vermögen gebracht hatte, nahm den Ferdinand in seinem Haus auf und wollte aus ihm einen echten Prachatitzer Kaufmann machen, der sich in der Welt bewährt.
»Streng dich an, Ferdinand, ich hab bloß dich als Erben.«
»Ich rechne nicht mit einem Geschenk, einem großen Erbe, Onkel, deswegen bin ich nicht da. Ich bau mir selber was auf. Der Papa hat immer gsagt, mir san nix, mir ham nix, also müasst’s ihr was tua – ich tu was.«
»Respekt«, dachte sich der Onkel Karl, »Respekt, der is’ wie seine Mutter, die Marie«, und er schob den Ferdinand ins große Wohnzimmer.
Er solle am Samstag wieder heimkommen, hatte ihm die Mama mit auf den Weg gegeben, das Fest des heiligen Franz möchte man im Dorf feiern. Da ging er nach den ersten vier Wochen wieder hinüber nach Nebahovy, schüttelte den Staub der geschäftigen Stadt von den Füßen.
Die Blätter der Birken, die beidseitig den sandigen Weg säumten, glänzten in der Abendsonne, der Herbst stand vor der Tür, hatten doch die dieses Jahr noch milden Septembertage schon Abschied genommen, die erste Oktoberwoche war kühler und leichte Schatten lagen über dem Weg nach Nebahovy. Ferdinand griff fester nach dem ledernen Säckel, der ihm über die linke Schulter hing, ein Schinken lag da drinnen, von der Tante Roserl eingepackt in Fettpapier und ein halber Laib Brot dazu im Leinentuch. »Das gibst deiner Mama«, lachte der Onkel Karl, »weil ich sie so mag.«
Diese herbstliche Jahreszeit war die Seine, dem heißen Sommer hatte er noch nie viel abgewinnen können, schon in den Kindertagen lag er vom späten Juni bis hinein in die Wochen nach Maria Himmelfahrt gerne im Schatten der beiden Buchen, die im Garten hinter dem Haus in Nebahovy ihr gewaltiges Blätterdach schützend über den Buben ausstreckten.
Er berichtete dem Vater und der Mutter, was er die Wochen über gelernt, wen er getroffen, mit wem er geredet, was er gegessen hatte. Die Tante Roserl sei eine ganz Liebe und der Onkel Karl würde mit den Leuten, die ins Geschäft kämen, scherzen und hätte eine Gaudi, aber er hätte ihn kaum zu Gesicht bekommen. Der Onkel Karl wäre viel außer Haus, weil ihn das Geschäft eben braucht. Er wäre eine Woche in Krumau gewesen und gleich danach in Budweis und der Onkel meinte, als er wieder gut aufgelegt aus Budweis zurück war, über kurz oder lang würde er ihn dorthin schicken oder auch nach Krumau, dass er die Buchhaltung lerne.
Von Nebahovy bis zum Ringplatz mitten im schönen Prachatitz war es nur eine halbe Stunde Weges, wo der Onkel Karl seine Seilerei hatte und auch noch blechernes Geschirr und feines Porzellan für das Haus verkaufte und elegante Kleider und Mäntel, Anzüge für den einfachen wie den wohlhabenden Käufer, Hüte und Schals für die begüterten Damen der Stadt und Strümpfe und Socken nach Belieben, Dirndl und Jancker für die mit einem gefüllten Geldbeutel wie für die kleinen Leute. Beim Herrn Magister, der ein halbes Dutzend Angestellte führte, lag alles zur Auswahl, was das Herz begehrte, war feil. Allerlei wichtige und unwichtige Dinge standen dazu in den Regalen, auch Nägel und Feilen und Zangen, Hämmer, Schuhe, Stiefel und Schürzen und tagaus, tagein fanden sich die Frauen vom Ringplatz zum Schwätzen vor dem Geschäft des Herrn Magister Karl Borwitz.
Der Herr Magister handelte auch in Brünn und in Pilsen, überdies im österreichischen Linz, und machte seine vielfältigen Geschäfte zudem in Wien und Prag. In Prachatitz gehörte er zu den Fleißigen, den Wohlsituierten, der sein einfaches Herkommen mit Bedacht und feiner Lebensart trug und nur Eingeweihte wussten, dass der Herr Karl Borwitz seine Geschäfte in der halben Welt machte. Ein Großer war er geworden, der Herr Magister Karl Borwitz.
Die Frauen aus der Klostergasse kamen eine um die andere auf den neu gepflasterten Vorplatz an der Borwitzhandlung und die Finkin und die Hoderer Fanny aus der Horni-Straße gesellten sich regelmäßig dazu und auch die jungen und alten Weiber vom Kirchplatz, g’schnappige Mägde vom Salzlager am schönen Hauptplatz, die von der Herrschaft zum Einkaufen delegiert waren und die grad Zeit genug zum Ratschen übrig hatten. Im Sommer schenkte der Borwitz ein Haferl Kaffee aus, ganz umsonst und die Prachatitzer sagten am Anfang, dass der Herr Magister nun italienische Zustände einführt in Prachatitz, Sitten von anderen Ländern und er bräuchte bloß noch ein paar Salzburger Nockerln spendieren, dann wär’s was. Aber die Leute gewöhnten sich an die Zustände vor dem Borwitzladen, wie sie sich an alle Umstände gewöhnten, wenn nur genug Wasser die Moldau runterlaufen würde.
5.
Die Geige hatte ihm der Onkel geschenkt, »zum Einstand, Ferdinand«, sagte er wohlgelaunt, »und dass halt a wenig a Musik gspielt wird in meinem Haus, und dem Roserl gefällt es auch.« In Krumau beim Meister Seybold hätte er sie erstanden, ein Künstler wäre der Meister Seybold und der hätte schon in Linz gespielt und in Salzburg, wo der Herr Wolfgang Amade seinerzeit ein Großer gewesen wäre. »Die Geige, mit der du das Spielen gelernt hast, daheim in Nebahovy beim Brožík, musst halt in Ehren aufbewahren«, lachte der Onkel Karl und der Ferdinand hätte alles erwartet, aber dass ihm der Onkel eine so schöne Geige zum Einstand, wie er gesagt hatte, in die Hand drücken würde, hätte er nicht angenommen.
Der langarmige Václav Brožík aus Nebahovy, der mit dem linken Fuß lahmte, war ein übers Dorf hinaus bekannter und gern gesehener Musikant, das Jahr über eingeladen zu Hochzeiten und Beerdigungen, und auf der Kirmes spielte er in Prachatitz und von Vimperk bis Vodňany war er gern gesehen.
Der Václav spielte neben der Geige die Bratsche und könnte für die Musik sterben, wie er oft genug anklingen ließ, und wenn er einmal draußn läg am Friedhof, dann sollen sie den Slatzik Thomas aus Žernovice einholen mit seiner Diatonischen und den Stammler Willi dazu, der so schön auf der Geige spielt, schöner gar wie er selber und der wär in Husinec daheim, wär ein Knecht und hätte Finger wie eine feine Mamsell.
Im Dorf lernten die Kinder beim Brožík auf der Geige spielen und zupfen und der Ferdinand war ganz anstellig, wie der Václav der Marie Polschitz sagte und wenn er, der Václav nicht mehr greifen könnte, dann bräuchten die Leute einen solchen Musikanten wie den Ferdinand, dem läg des Musizieren im Blut und die Maria Polschitz erinnerte sich an die Pauliner Herta aus Mitschowitz drüben, die die Geige so schön gespielt hatte wie der Herr Stradivari persönlich und eine Stimme hätte die gehabt wie ein Zeiserl. »Vielleicht hast es von der Tante Herta aus Mitschowitz, des Talent für die Geign«, lachte die Mama und spornte ihren Ferdinand an und er solle ja fest üben, dass er ihr beim Brožík keine Schande machen würde.
»Mit dem Wolfgangerl, dem Herrn Mozart, wird er oft genug zu tun haben«, sagte der Václav Brožík, weil die Mama fragte, was der Ferdinand denn da alles spielen würde, wenn er könnte, »und mit dem Herrn Vivaldi auch, aber erst soll er die böhmische Volksmusik kennen lernen.«
Der Brožík fertigte die Geigen selber, hatte fichtenes Holz für die Decke in der Hütte getrocknet, gehütet wie ein Goldschatz. Im Winter holte er sich das Fichtenholz aus den böhmischen Bergen. Der Leimberger, ein Bauer nahe Kašperské Hory, wartete in den ersten Dezembertagen auf ihn, wenn der Stamm wenig Saft führte. Für den Boden nutzte er feinen Ahorn und den Knochenleim bereitete er selber auf. Wenn er dann die Decke und den Boden mit den Zargen verleimte, durften die Kinder des Dorfes zuschauen und so manch einer der Buben aus Nebahovy lernte das Geigenbauerhandwerk vom Brožík und schnitzte sich in Jünglingsjahren auch die Schnecke selber, die oft genug die Gesichtszüge der Angebeteten trug. Nur die Kinnhalter ließ sich der Václav aus Krumau mit der Post schicken.
»Wage wohl«, sagte der Václav, wenn er die Kinder nach den ersten Fingerübungen entließ, »wage wohl, Ferdinand«, und der Ferdinand sah weit und breit keine Waage. Eine solche hatte der Bursik im Stadel, aber was diese Waage mit dem Geigenspielen zu tun hat, blieb ihm verborgen. So übte er fest und der Václav lobte ihn und sagte immer nur »wage wohl, Ferdinand«.
Die wäre was wert, ließ der Onkel Karl anklingen, die habe der Meister aus Linz mitgebracht und die Woche drauf klopfte der Ferdinand an die Haustür seines Lehrers, des Václav Brožík, und der meinte auch, dass das schon ein besonders Stück wäre. »Wage wohl, Ferdinand«, sagte der Václav, »das ist ein Prachtstück.«
Die Geige vom Onkel Karl sollte ihn durchs Leben begleiten.
6.
Neben dem stattlichen Haus des Onkel Karl, der es zu Geld und Ansehen in der Stadt gebracht hatte und der also einen emsigen und einträglichen Handel bis hinunter nach Krumau und seit Neuestem bis Oberplan trieb, hinüber nach Budweis auch, wo er eine Freundin, »ein Gspusi«, hätte, wie die Mama manchmal beiläufig erwähnte und somit der Tante Roserl einen heftigen Kummer machte, neben dem Anwesen also stand das ehemalige Stadthaus derer von Iglatz. Verarmt, wie sie waren, die Iglatzer, hatten sie das recht ansehnliche Haus an einen früh pensionierten österreichischen Rittmeister verkaufen müssen, der im Böhmischen Ländereien hatte, unterhalb der Moldauschleife bis nahe an die österreichische Grenze, in Wien mit einem gewinnbringenden Spirituosengeschäft gutes Geld machte und eine junge, fesche, böhmische Bauerstochter, die noch im besten Alter blühte, geheiratet hatte.
Sein Regiment war seinerzeit nahe Krems gelegen und bei einem Manöver, dem Kaiser war ja daran gelegen, die Böhmischen und die Österreichischen zu fraternisieren, hatte er in Krumau herüben in einer Schänke, dort, wo der Fluss seine Schleife windet, diese charmante, herzliche Jarmilla kennen gelernt, ein Bauernmädchen vom unverdorbenen Schlag, wie er meinte. Er hatte sie dann mit nach Wien genommen und sozusagen stante pede geheiratet.
Die Aussicht auf die Heirat mit dem Herrn Rittmeister Baron Jakob von Wesowitz, der Eintritt in die wenn auch niedere Aristokratie, das herrschaftliche Stadthaus in Prachatitz, der Gutshof unterhalb von Prachatitz, nahe Krumau, der Wiener Spirituosenhandel direkt in der Leopoldstadt ließen die Jarmilla alles schlichtweg vergessen, was den Herrn Baron in den Augen so vieler ihrer Vorgängerinnen wenig erstrebenswert gemacht hatte. Die zehn Gehminuten vom Palais in der Leopoldstadt hinunter an die Gestade der blauen Donau waren für die stolzige Jarmilla eine tägliche Einladung zum Flanieren, zum Schauen, zum Kennenlernen neuer Freundinnen, zum Begutachten der Modetrends und zum Reden über dies und das, wie sie am Abend dem Herrn Gemahl beim gemeinsamen Tete-a-tete zuraunte. »Ich vermisse dich, Jakob«, seufzte sie, »du gehst halt in der Arbeit auf, das macht dir keiner nach.« Aber die Wiener Zeit war kurz, ging bald dem Ende zu und das schöne Anwesen in diesem Prachatitz, das der Herr Rittmeister so günstig erworben hatte, tröstete sie recht bald darüber hinweg, dass sie, wie sie meinte, eigentlich für die große Stadt geboren war.
Der Herr Baron brachte ins Prachatitzer Stadthaus auch seine Wiener Köchin mit und er überließ es seiner Jarmilla, einen Hausmeister und die weiteren Angestellten zu rekrutieren. Neben dem üblichen Personal für Küche und Haus brachte die schicke Frau Baronin einen jungen, kräftigen Bauernburschen, wie sie sagte, aus ihrer Heimat in die Position des Haus-und Hofmeisters. »Ferdinand Wosizek heißt er«, sagte sie, »und er ist a Nachbarsbua aus Blanice.«
Der Nachbarsbua kam aus dem Nachbarland, ein Oberösterreicher war er eigentlich, ein Neumarkter aus dem Mühlkreis, in jungen Jahren nach Blanice zur Oma ins Böhmische hinaufgeschickt, weil die Eltern das Leben verloren hatten. Er kannte die Jarmilla seit langen Jahren, sie waren einander so gut wie versprochen und der Ferdinand Wosizek hatte auch wenig dagegenzuhalten, als die Jarmilla seinerzeit nach Wien verzog und den Herrn Baron ehelichte. Als die Wesowitz’schen dann die Stadtwohnung in Prachatitz bezogen, hatte er seine Jarmilla wieder nahe bei sich und ausgesorgt hatte er von nun an auch.
7.
Der Ferdinand Polschitz hatte seine Lehrjahre beim Herrn Onkel Karl im Kontor zu Ende gebracht und er solle, wie der Herr Onkel meinte, nun auch Neues kennen lernen, sich anderwärts die Hörner abstoßen, dazu lernen und reifen, vor allen Dingen reifen solle er.
Die Baronin von nebenan, der Ferdinand kannte die adelige Dame ja vom Grüßen, suche noch einen Herrn fürs Bureau, sagte der Onkel, für die Bücher vornehmlich, und aufs Reisen müsse er sich auch einstellen. Er würde ihn, den Ferdinand, an die Baronin ausleihen, eine Zeitlang nur, weit habe er ja nicht zu gehen und wenn er ihn hier im Haus brauche, wär es eh kein Malheur, von einer Tür raus, in die andere rein zu gehen.
Die Köchin Anna Anzengruber, die den Herrn Baron über die Maßen verwöhnte und seit Jahren mit besten Mahlzeiten und guten Weinen versorgt hatte, konnte die junge Frau Jarmilla nicht ausstehen und würde sie liebend gerne vergiften, dass sie langsam und gräulich verrecken müsste, wie sie nach Hause zu ihrer Mama schrieb, »das Luder, das elendige«.
So gingen die Jahre ins Land. Ein Tag wie der andere plätscherte im Haus der Baronin und des Herrn Rittmeisters von Wesowitz gleich dahin. Man redete tagaus, tagein das Gleiche, übers Wetter, die Gesundheit und die Probleme im Geschäft und er ließ sie seine Korrespondenz lesen und fragte sie nach ihrem Rat, was ihr gut tat und wenn der Herr Rittmeister unterwegs war, tröstete sie sich in den Armen ihres Ferdinand Wosizek.
Die Anzengruberin lebte nun neben der Jarmilla und dem Herrn Rittmeister, mit dem sie mehr als ein kurzzeitges Pantscherl verbunden hatte, der sie seinerzeit zugunsten dieses böhmischen, schaßfreundlichen Veigerl, verstoßen hatte, ihre besten Jahr ab. Sie meinte zu der alten Demolenzerin, die sie oft genug am Hauptplatz oder beim Milchholen traf, deren Aufrichtigkeit sie zudem sehr schätzte: »Dös oide Graffl, de Wesowitz’sche Burg kannst an da Abendkassa vakaufn, so oid is es. Oba an neimodischn Abort hot sie sich von Pilsen drent eina kauft, dass’d moanst, bu bist bei aner Durchlaucht persönlich und a boudoir ziert das herrschaftliche Gemach, wos früha de Speisenkammer war, beim Vorgänger, dem Baron von Iglatz. Hot sie an Mahagoni an der Wand und an einem Sekretär schreibt die gnädige Frau ihre Post in die Wölt hinaus, dös bamstige Hirnederl, dös. Ane Schubladn um de andere hot sie sich einbaun lassn und an oide Uhr hot sie an de Wand ghängt, ane Comtoise, nennt sie sie, mit anen Haufen Figuren mit Knaben und Mädchen, »aus der antiken Welt«, wie sie sagt. Auf ana Tacken hot sie an ersten Schnauferer gmocht. Aus einfachen Verhältnisse käme sie und wär stolz drauf, stamme sie doch aus kleinem Bauernadel. Wos hot er denn ghabt, der Herr Vater, Henna hot er ghabt, Henna und an Goaßbock und da Regn is von oben durchglafa bis in de Kuchl, do hab’n sie sich alle miteinander drinnen gebadet, omal im Johr. Man is ja informiert, hab mich umgehört.«
Bei einem seiner abendlichen Ausritte mit der weißen Stute, die er aus Wien mitgebracht hatte und als lammfromm einschätzte, stürzte der Herr Rittmeister vom Pferd und brach sich das Genick. Hatte ihn der Schlag im Sattel getroffen oder hatte die Stute vor einem streunenden Hund gescheut, hatte er zu viel vom roten Wein im Blut, war er übermüdet vom weiten Ritt vom Libin nach Hause oder einfach mit den Gedanken bei seiner Jarmilla gewesen, wer wollte das wissen?
Der Herr Baron hatte ein großes Begräbnis, der Bürgermeister lobte ihn über den grünen Klee. Der Herr Rittmeister wäre ein sozial eingestellter Mann gewesen, seiner Zeit weit voraus, und der Graf von Selbsess, ehemaliger Regimentskommandeur des nun so früh verblichenen Rittmeisters von Wesowitz, hielt eine aufrechte, aber auch doch recht melancholische Rede auf den Kameraden Rittmeister, die Kapelle intonierte den Kaisermarsch, Jarmilla weinte ein um das andere Taschentuch nass und die Köchin Anna Anzengruber dachte sich: »De Pritschn soll der Teifl holn.«
8.
Mit der einen oder anderen von den Prachatitzer Frauen pflegte die Anna Anzengruber eine gewisse Vertraulichkeit, vergab ihre Sympathie jedoch nicht so mir nichts, dir nichts. Eine gewisse Seelenverwandtschaft sei da schon vonnöten, wie sie sagte. Der Hotinka hat sie die Freundschaft aufgekündigt, hat ihr brühwarm ins Gesicht gesagt, was sie von ihr halte, dass sie so ane sei, die Geheimnisse nicht bei sich behalten könne, dass ihr a Watschn g’hörat. Die Hotinka hatte nach der Sonntagskirche der frommen Klara vom Hanitzer, die vor einem guten Jahr beinahe in der Moldau ertrunken wäre, vom Wesowitzer Verdruss erzählt, was die Klara gleich der Anna hinterbringen musste, hätte ihre tugendhafte Seele doch keinen Frieden mehr gefunden. Aber diesen Weibsbildern fehlte eben der Adel der Herzensbildung, auf den ihr verstorbener Liebhaber, der Herr Rittmeister, der Vater ihres Buben, der ein Pfarrer ist, immer hingewiesen hatte. »Noblesse oblige«, pflegte der Herr Baron zu sagen, »Adel verpflichtet«, wenn sie das eine oder andere Mal nach einer frohen Nacht anfragte, ob er sie heiraten würde, wär doch jetzt der Bub, sein Jakob, auf der Welt. »Noblesse oblige«, sagte der Herr Rittmeister und sie solle doch verstehen, dass er aus seinem Stand in praxi nicht ausbrechen könne, aber der Bub sei kein Bankert, er halte immer seine schützende Hand über ihn.
Nur wenige der Frauen in ihrem Umfeld dachten weiter als von gerade heut auf morgen. Die wären kein Umgang für sie, resümierte die Anna.
»Ane Lusch is sie, die angeheiratete Strawanzerin«, weinte sie und schlug die Hände vor das gerötete Gesicht, »ane ägyptische Potifar, ane Suleika dazua, ane sündige, de hots mit an Wosizek Ferdinand ghabt, eahran fadisierten Haberer, wann der Herr Rittmeister ausgeritten war, hinauf zum Aussichtsturm am Libin«, sagte die Anna zu der alten Demolenzerin, die unten am Ringplatz in einer dürftigen Kellerbleibe hauste, war sie doch zuvor ein langes Leben am Unteren Tor in an Gschäftl angestellt, wo der junge Herr Besitzer, der Radecz Kurtl, sie recht gut gehalten hat, solange sie in der weiblichen Blüte gestanden hat, von einer Heirat aber schließlich nichts wissen wollte, »und dann war i auf amal allan und er hat se mit ana Jüngeren, ana geldernen Wittib verlustiert«, setzte die Demolenzerin, aus der Melker Gegend nach Prachatitz zugezogen, melancholisch hinzu. »A Bissgurn wär i, sagt er zu mir, der Falott, der schlechte, der Deschek der, dös hinterfotzige Gfras des und i hob den deppatn Demolenzer gnommen, der hintn und vorn nix ghabt hot, der grausliche Hadernflechter, der bräsige. So a nasches Luder war i und etzat bin i an oide Wabn.
Wia eahm na die Frau Gemahlin weg gstorbn is, a feine Bauerntochter war sie, de an kloana Hosenscheißa mitbracht hat in dös neie Verhältnis, war er wieder kemma. I sollt eahm den Haushalt führn, hot er gmant, eahm den Haushalt führn und die vier Kinder aufziagn, hot er gsagt, der Herr Kramladlbesitzer. Na ja, den Herrn hot as Unglück a net auslassn. Wos sog i, im Schnaps hot er sei Kreiz dasuffa. I sollt eahm den Haushalt führn, sagt er.« Sie wandte sich wieder der unter ihrer Last ächzenden Anna zu.
»Wos, mit an Herrn Ferdinand hot sie’s?«, fragte die Demolenzerin die Anzengruberin. »Der is oba noch so jung, der hübsche Bursch aus Nebahovy drübn, wo de Mama de Schwester vom Herrn Magister Karl Borwitz is, der gleich neben der Rittmeisterin den großen Laden hat.«
»Net der, des is doch der böhmische Herr Ferdinand, den andern man i, den Ferdinand Wosizek aus Blanice, den hat sie sich gholt, an depperten Bauernproletn. Schaut er doch aus wia da Wiena Kalafati, abgfieselt wia a, wia a dürra Zauk, sog i, a dürra. De machn jede Nacht an Drahra, in da Fruah hot er na anen Fetzn und ko net arbeitn, der Haftlmacha. I bin hoit unglücklich, Demolenzerin, bin wia a Ganserl boananda, muaß hoam zu da Mama af Mödling. Oba dös nimmt amol a gachs End, sog i, mit dera Jarmillamadam und dem Wappler, dem dasign Sandler, dem ghört ane pickt, jedan Tag.«
Es gab noch so viel zu reden, denn im rittmeisterlichen Haus ging es nach dem Ableben des allseits geachteten Herrn Baron drunter und drüber, und was da so ablief, ging der Frau Anzengruber gehörig gegen den Strich. Selber hatte sie nur beste Erinnerungen an den Herrn Rittmeister, nicht dass sie sich in früheren Jahren wirklich eingebildet hätte, einmal eine Frau Rittmeister zu werden, na ja, in ihren besten Zeiten, in jungen Jahren, als sie fesch und rank in seine Dienste trat, hatte der Herr Baron sie jeder adeligen Dame vorgezogen.
Den Bub von ihm, den Jakoberl, hat sie gegen regelmäßiges Entgelt einer ihrer Schwestern zur Aufzucht gegeben. Nachdem er schließlich mit Fleiß und Anstand das Seminar in Pölten absolviert hatte, hatte ihn der Herr Bischof mit noch dreißig anderen blassen, meist recht dicklichen jungen Burschen geweiht und der junge Herr Jakob ist dann ein Herr Kaplan geworden, dann ein Herr Pfarrer drüben in Sankt Pölten an der Domkirche. Respektiert wäre er dort, »und ich werd ane Karrier machen«, schrieb der Bub der Mama ins Böhmische. Dafür hatte der ledige Papa von Wesowitz schon gesorgt, und »es wird amal a Domkapitular aus ihm werden«, sagte der Herr Baron der oft besorgten Mama.
So war es die Anna Anzengruber zufrieden, wenn sie dem Herrn Baron das Wammerl braten durfte, diesen frischen, geräucherten Schweinebauch, den ihr in der Leopoldstraße der Metzger Upseder persönlich frisch über die Theke langte und ihre Böhmische Kartoffelsuppn hat ihm geschmeckt und ihre Mehlspeisen würden ihm unvergesslich bleiben, wie er ihr oft genug sagte, solange sie noch jung war und er nicht im Traum daran gedacht hätte, gar eine Böhmische zum Altar zu führen und das Ehebett mit ihr teilen würde, eine Jarmilla noch dazu.
»De Mess am Sonntag in das Fruah z’Jakob drübn is eahra zu wenig, es muss das Hochamt sei für die Madam, da hot sie as Gschau, dös passt eahra, an Weihrauch brauchat sie, sagt sie. Aber daher kommt sie, auftacklt wia ane Halbseidene und des in da Kirche. Sie is eben ane Gestrauchelte, ›ane überreife Zwetschgn is sie‹, möcht der Lederer Jackl sagn, Gott hab ihn selig, den Jackl. Der war a Gebildeter, war scho als a Junga in Salzburg, hot dir de Dichter aufgsagt, wia koa anderer, der Jackl.«
Sie müsse nun wieder in ihre Küche. »As Essen kocht sich ja nicht von selber«, verabschiedete die Anna die Demolenzerin, nachdem sie das ganze Repertoire an verbalen Hässlichkeiten an die Frau gebracht, einfach das Ungute rausgeredet hatte, was die Seele sonst vergiften möchte, und machte sich auf den Heimweg. »Net dass ich etzat der Madam was Unrechts nachsagen hab wolln, bei meiner Söl, ma red ja bloß, lass mir nix zuschulden kommen, es is eben a Kreiz auf dera Wölt.«
Da war ihr seelisches Gleichgewicht wieder hergestellt und sie widmete sich uneingeschränkt ihren Diensten in der herrschaftlichen Küche derer von Wesowitz. Sie neidete der drallen Jarmilla weiterhin das ehedem rittmeisterliche Ehebett, das nun der Ferdinand Wosizek mit der jungen Baronin teilte, mied das Gespräch mit »der Sumpftaum, dem Viertlhirn«, wie sie innerlich zum Ausdruck brachte, und reduzierte die Kontakte mit der Madam auf das Notwendige. »Mit aner solchen kann i lang no mithaltn«, sagte sie sich, »wos de sagt, de Kraumpn, des ged ma am Oasch vorbei. Ane wia de taugt a net amol für a Vaschiads.«
Von Zeit zu Zeit war so ein fulminanter Ausbruch, ein innerer Großputz dieser Mödlinger Tochter, wie sie ihn vor der Demolenzerin grad hingelegt hatte, notwendig. »Das reinigt des Gemüt«, sagte sie sich, »des muaß von Zeit zu Zeit sein, sonst dadruckt es mi.«
Ihre Mama, auch ein Mödlinger Gewächs aus altem Wiener Proletariat, war eine unschlagbare Großmeisterin solch inneren Großreinemachens gewesen, begehrt unter den Tratschweibern, gefürchtet auch in der Mödlinger Szenerie von der Kreuzung Goethegasse und Spechtgasse bis rüber zur Pfandlbrunngasse. Dort wohnte auch die Sibylle, Annas vergangene beste Freundin. Beide hatten in sehr jungen Jahren den Freund geteilt, den Lederer Jackl, dann hatte die Sybille den reschen Jackl geehelicht, der aber in jungen Jahren schon das Zeitliche gesegnet hatte. Aus dem schönen Mödlinger Pflanzgarten ist so manche liebreizende Blume herausgewachsen, hat es zu einem kleinen Wohlstand, oft auch zu gewissem, eher lokalen Ruhm gebracht.
Für die herrschaftliche Köchin Anna Anzengruber war der Zeitpunkt einer endgültigen Abrechnung mit dieser Jarmillabaronin, diesem vulgären Kasernfetzn, noch nicht gekommen, meinte sie, so etwas bedarf der gründlichen Vorbereitung und einer gewissen göttlichen Fügung. »Oba es is net aufz’haltn«, sagte sie sich, »in seiner Harpfn, sog i, in ana lenoška, möchte man so was net durchstehn.«
9.
Der Alltag holte auch die Jarmilla ein. Sie war nun froh, dass sie mit dem jungen Ferdinand Polschitz einen Menschen an der Seite hatte, der die Kassenlage hier in Prachatitz überblickte. Die städtischen Finanzer hatten ja ihrem Mann, dem Herrn Baron, trotz seiner noblen Abstammung grad im letzten Jahr eingeheizt. Nachzahlen müsse er, meinte der Herr Finanzrat Krobschlacht und gewissenhafter abrechnen, was ja eine reine Unterstellung war. Der Ferdinand Polschitz war ein gewiefter Buchhalter geworden, hatte in Budweis drüben im Kontor beim alten Bloch dazu gelernt, der ihm die ganze Palette merkantiler Raffinesse beigebracht hatte, ein stattlicher Jüngling war er zudem, mit breiten Schultern in der feschen Joppe, die ihm die schöne, vom Onkel Karl so vernachlässigte Tante Roserl zum siebzehnten Geburtstag auf den Tisch gelegt hatte. »Bei uns daheim feiert man nur den Namenstag«, sagte er, nahm aber das Geschenk mit Freude und rotem Kopf an, nicht gewohnt, dass ihm jemand einen Gefallen tut, gar eine Freude macht, aber ein Hochgefühl ergriff ihn und er schaute die Tante mit ganz großen Augen an.
Im Budweiser Stadtpark hatte er flaniert wie ein Kavalier, jung wie er war und dumm. Er war immer wieder am Samsonbrunnen am Ringplatz hängen geblieben, wo ein Dutzend Handlerer ihre Waren anboten, hatte den Mädchen ein bisserl nachgeschaut, dem Herrn Offizier, der sein Hunderl um das bronzene Standbild des Herrn Ritter Adalbert von Lanna, gleich an der Langen Brücke, führte. Ein guter Mensch müsste das gewesen sein, sagte ihm der Herr Bloch, der ihn an den Abenden durch die Stadt und in das eine oder andere Gasthaus gelotst hatte, und: »A Göld hat er auch ghabt, der Lanna, an Eisenbahner war er, damit hot er sein Vermögen gmacht.« Der Ferdinand Polschitz dachte an den Onkel Magister. In Budweis würde es ihm gefallen, sinnierte er, und er konnte sich vorstellen, die hiesige Dependance zu führen, das würde ihm gefallen und mehr bräuchte er nicht. Nur die Lage der Niederlassung wäre zu verändern. Wer nahe dem Rathaus residierte, hätte den Hauptgewinn gezogen, das müsste er dem Onkel Karl nahebringen.
10.
»Ferdinand, kommens nach dem Abendessen noch einmal rauf zu mir«, meinte die verwitwete Neubaronin Jarmilla von Wesowitz häufig genug an den Abenden nach dem gemeinsamen Mahl, »wir hätten da noch einiges abzuklären für morgen, tagsüber hat man kaum Zeit fürs Nötigste.« Das sagte sie ein um das andere Mal und schaute nur so beiläufig ihren Hausmeister, den Herrn Ferdinand an.
Einmal, es war schon gut gegen neun Uhr nach einem ereignisreichen Tag, der Baron Jakob von Wesowitz war nun schon Vergangenheit, hatte sich der Ferdinand, der Nachbarsbua aus Blanice, mit der Frau Anzengruber in der Küche um irgendeine Belanglosigkeit in die Haare gekriegt. Eine Kleinigkeit, wie so oft, war strittig zwischen den beiden. Da rief die Jarmilla vom ersten Stock über die Treppe in die Küche hinunter: »Ferdinand, wo bleiben Sie denn?« und fügte fordernd hinzu: »Gstritten wird net in dem Haus, das müssens schon anderswo hingehen, Anna.«
Der Ferdinand war derweil in den Keller hinabgestiegen, eine Flasche Wein zu holen, den vollmundigen St. Laurent, den der Herr Baron im Burgenland selber angebaut hatte, waren doch dort zwei Weinberge bei Eisenstadt, nahe dem Neusiedler See sein eigen. »Kleine Hügel sind das«, wie er sagte, »nur Hügel, aber ertragreich, weil von voller Sonne aufgewärmt.« Drüben im nahen Ungarn bei Szombathely gehörte ihm noch eine dieser lang gezogenen Anhöhen, auf der er einen Blaufränkischen, einen aromatischen Klassiker, den er für nichts in der Welt eingetauscht hätte, mit viel Liebe und eigener Hand kultiviert hatte. Ein Erbhof war ihm dieses Stück Land im Ungarischen gewesen. Im herrlichen Bistum Szombathely hatte einer seiner Verwandten mütterlicherseits die Kirche im westlichsten Teil des ungarischen Königreiches regiert, war Bischof gewesen, der Ferenc Szenczy, der Bruder seiner geliebten Großmama, einer aus dem Gutsherrengeschlecht der Szenczy aus dem Bagoder Land.
»Ferdinand, kommens, ich habe nicht alle Zeit der Welt«, fügte sie an, als der sich nicht rührte.
Die Anna Anzengruber war noch mit dem Abräumen des abendlichen Tisches beschäftigt, brachte die geleerten Teller und Schüsseln in ihr Küchenreich, rief hinauf in die obere Etage, wo sich die Wohnräume der Baronin befanden: »Welcher Ferdinand soll es denn sein, gnä’ Frau, der österreichische Ferdinand aus Blanice oder der böhmische Herr Ferdinand von drüben?«
Von da an hatte der Ferdinand Polschitz seinen Namen weg, er hieß jetzt der böhmische Herr Ferdinand und die Wienerin Anna Anzengruber sollte von diesem Tag an in diesem herrschaftlichen Haus derer von Wesowitz wohl keine Zukunft auf Dauer haben.
11.
»A so ane Bisgurn, de Anna, dera geb i an Laufpass, da kann sa se valossn drauf, gleich morgen setz ich de Henna vor de Tür, frechs Luada, frechs.« Die Baronin war hoch echauffiert. »De setzt a no Gerüchte in da Stodt in Umlauf, über di und mi, de hau i davon, dass sie sich de Haxn bricht.«
Die Baronin hatte einen roten Kopf auf und redete sich ihren Frust von der Seele und schickte ihren Ferdinand aus Blanice wieder in sein Gemach zurück. »Morgen is a no a Tag, überleg dir des noch a mal«, wagte er sie dann beim pressanten Abschied zu beruhigen. »Red net Ferdinand, dös is mei Sach’ und ausbadn muaß ich de Sticheleien von der Wiener Brunzn. Und die corsage, die sie auftragt, is a Schand, es is einfach despektierlich, steht einem Dienstbotn gar net zua, aber der Jakob hat da nix gsagt, der Filou, es hat eahm passt.«
Der Ferdinand schickte sich an, das gemeinsame Gemach zu verlassen. »An Pfarrer hot sie, dös woaßt, an Pfarrer als Buam, in Pölten drübn, des wird scho a Gscheiter sei, bei dera Bixn als Mutta«, echauffierte sie sich aufs Neue. »Der Jakob hätt’ den Trampel scho lang ausseschmeißn solln. Sei frühere Gspusi in meinem Haus, stell dir des vor, des vergiss i eahm net, dem Jakob.«
»Geh, lass es guat sei, Jarmilla, überschlaf des Ganze, heit is heit, morgen is morgen.«
»Dös san deine gscheitn Redn, de helfa mir gar nixe«, fauchte sie und warf sich auf die andere Seite, »lass mir mei Ruah.« Wie immer, wenn sie sich ärgerte, sehnte sie sich zurück nach Wien und dem städtischen Leben im herrschaftlichen Wesowitzer Haus. In der Stadt das Leben zu genießen, die Luft am schönen Donaustrom zu atmen, wie sie sagte, im Prater sich zu ergehen, dafür hätt’ sie jetzt weiß Gott was gegeben. Mit der Suserl von Tollet, eine aus der ehrenwerten Familie derer von Tollet, kaisertreuer, alter Adel vom Feinsten, hatte sie dort im Prater, auch in dem einen oder anderen Kaffeehaus schöne Gespräche geführt, auch über Poesie und Malerei, delikate Konversationen zudem. Das Suserl hatte den alten Freiherrn Peter von Hatzendorf geehelicht, was über lange Wochen zum Stadtgespräch wurde. Aber die Leut könnten sie kreuzweiß, sagte das Suserl und schenkte dem Freiherrn dann sehr flott ein halbes Dutzend fesche Buben und Mäderl. Der Freiherr war dann im Herbst von seinem schwarzen Hengst, dem Harras, ins Kreuz getreten worden, laborierte noch eine Zeitlang dahin, bis er an Lichtmess, das Jahr drauf, ausgelitten hatte. Der Falk, sein Jüngster, hatte drei Tage zuvor das Licht der Welt erblickt. »Schau ihn an, den Bub, den herzigen«, sagte das Suserl, als die Jarmilla die Gelegenheit wahrnahm und ihr kondolierte. »Er ist dem Peter wie aus dem Gesicht geschnitten«, sagte das Suserl zur Jarmilla. Die Baronin besann sich, fand in die Gegenwart zurück. Es wäre Klarheit zu schaffen, man könne Unangenehmes nicht andauernd vor sich herschieben.
12.
»Zählen Sie nach«, sagte die Baronin nach dem Mittagessen, »es ist alles mit dem Herrn Advokat besprochen.« Sie hatte der Anna Anzengruber ein braunes, versiegeltes Kuvert überreicht. »Es sind Zeugen da, falls Sie meinen, übervorteilt zu werden. Öffnen Sie das Kuvert und zählen Sie nach. Angesichts Ihrer langjährigen Arbeit für meinen Mann, dem verstorbenen Herrn Baron, gebe ich Ihnen den Lohn fürs ganze Jahr, da können Sie zufrieden sein, dass macht nicht jede Herrschaft. Der Herr Sohn in Sankt Pölten ist bereits vom Herrn Baron zufriedenstellend bedacht worden. Schauns, dass Sie bis Mittag das Haus verlassen haben. Adieu dann.«
Der Ferdinand aus Blanice war als Zeuge anwesend, die zwei Bediensteten, für den Haushalt zuständig, waren hinzugezogen. »Machen Sie dergleichen Geschäfte nur unter Anwesenheit von mehreren Zeugen«, hatte ihr der Advokat mit auf den Weg gegeben.
Den Vormittag war sie in der Kanzlei ihres Advokaten, des Herrn Assessor von Rechensteiner, einem durchtriebenen Fuchs wie er im Buche stand, der einer alten Pilsener Advokatendynastie entstammte und dem Herrn Rittmeister zu Diensten stand, seit der in Prachatitz eingezogen war, gesessen. »Unangenehme Dinge sollte man wenigstens eine Nacht bedenken, gnädige Frau Baronin«, lächelte der Herr Advokat. »Hab ich, hab ich«, antwortete die Frau Baronin. »Die ganze letzte Nacht und viele Nächte vorher hab ich es erwogen, wie ich die Madam rausschmeißn kann, man ist ja ein Mensch, man macht ja so was nicht ohne es gründlich zu bedenken und es ist alles bedacht, Herr von Rechensteiner.«
Nachdem das einseitige Gespräch mit der Köchin beendet war, entschwand die Baronin in ihr Zimmer in der ersten Etage. Die Anna Anzengruber glich der berühmten Salzsäule. Da war buchstäblich ein Gottesgericht über sie herein gebrochen, dem sie nichts entgegen zu setzen hatte. So wünschte sie der Frau Baronin die Pest an den Hals, noch dazu allen Schwefel und das schlimmste Feuer, das auf Sodom seinerzeit niedergegangen war. Anna Anzengruber schwieg, steckte das Kuvert in ihre Handtasche, packte ihre Habseligkeiten in einen braunen Koffer und fuhr mit dem Zug am späten Nachmittag hinunter nach Linz, sie würde nach einer schlaflosen Nacht im Bahnhofsrestaurant in Linz nach Wien weiterfahren, nach Hause zu der Mama. Die Kapitel Prachatitz und Baronin Wesowitz schienen damit abgeschlossen zu sein und Anna Anzengruber, langjährige Muse, Mutter seines Sohnes und Köchin des verblichenen Herrn Rittmeisters Baron von Wesowitz ging einer sehr individuellen Zukunft entgegen.
13.
Der Ferdinand Polschitz, den die Anna Anzengruber den böhmischen Herrn Ferdinand genannt hatte, machte sich den frischen Geist seiner Mutter zunutze. Der starke Wille des Vaters, der sich in seinem Dorf wacker durchschlug, zeigte sich im Bub, wie die Mama ihren Ferdinand immer nannte, dass er nicht zu jenen gehörte, die zu früh klein beigegeben hätten. »Aus Ihrem Ferdinand wird einmal was«, erklärte seinerzeit schon der Dorfschullehrer, wenn die Mutter nachfragte, ob er denn anständig sei, der Bub. Der Ferdinand gab keine Ruhe, bis er nicht die Lösung gefunden hatte, wenn er den Kindern die kniffligsten Rechenaufgaben »zum Beißen«, wie er sagte, gab.
»Den Ferdinand müssen Sie zum Studieren nach Budweis schicken, der hat ein Hirn, wo andere einen Haufen Heu drin haben«, meinte der Lehrer Zwicknagel, aber er wusste, dass der Herr Magister und Stadtrat Borwitz der Onkel des Ferdinand Polschitz war und machte sich so seinen Reim drauf.
Der Ferdinand durfte sich den Zweispänner vom Onkel Karl ausleihen und fuhr damit, sobald am Samstagnachmittag die Woche abgehandelt war, hinaus zu den Eltern nach Nebahovy. Die Mutter ließ sich nicht sehen beim Onkel. Sie wäre keine feine Dame, sagte sie zum Bub, »und da soll sich die Tante Roserl nicht mit mir schämen müssen.«
Dann änderten sich von heute auf morgen die Fakten. Der Herr Magister Karl Borwitz hatte einen Bauernhof gekauft, auf den leichten Anhöhen hinauf zum Libin gelegen, die zwanzig Milchkühe verhießen viel Arbeit, ein Knecht, der Severin Weingart, war am Hof geblieben und der Onkel Karl suchte nun einen zuverlässigen Verwalter. »Das macht der Vater, musst ihn halt selber fragen, Onkel Karl, kennst ja seinen Stolz. Da kämen sie endlich raus aus dem Dorf und könnten was aufbauen, die zwei brauchen eine Chance, wie man heute sagt.«
Er bräuchte a wenig a Bedenkzeit, sagte der Vater, dem das Blut in den Kopf gestiegen war. Das war die einzige und letzte Möglichkeit, rauszukommen aus den Niederungen, in die er hineingeboren wurde. »Ich bin kein gelernter Bauer, Karl und ich möchte deinen Besitz nicht herunterwirtschaften, da hab ich meinen Stolz.«
»Wir machen das, Karl«, sagte schließlich seine Schwester, »dös werdn wir packn, wirst sehn.« Diese Geste würde sie dem Bruder nicht vergessen.
Der Bursik hat dann das Polschitz’sche Haus im Dorf gekauft. »Wenn du Hilfe oder einen Rat brauchst, sag mir Bescheid«, sagte der tschechische Freund beim Abschied. Wer würde jetzt die kleine Glocke läuten, früh, zur Mittagszeit und am Abend, wenn im Sommer die Dörfler auf der Bank vor dem Haus den arbeitsreichen Tag segneten? Der Ferdinand würde nun nie mehr wieder in sein Elternhaus nach Nebahovy kommen, der Zweispänner würde ausbleiben. »Unsere Bozena wird sich die Augen nach dem Ferdinand ausweinen. Schmerzhafte Jungfrau Maria von Budweis steh ihr bei«, betete die Mama Bursik. Im Stall schepperten die Milcheimer, ein paar Kühe blökten, eine Katze schlich aus dem angelehnten Stalltor.
»Wo ist denn die Bozena?«, fragte Ferdinand und stieg von seiner Kutsche. Es war wieder ein später Samstagnachmittag.
14.
In Prachatitz fuhr schon das eine oder andere Daimler-Automobil über die gepflasterten Straßen. Lederne Kappen auf den Köpfen und eine gewaltige Schutzbrille auf der Nase, so trotzten die zumeist noch recht jungen Fahrer den Winden und der vehementen Geschwindigkeit. Die Straßen waren nicht auf dergleichen Gefährte eingerichtet, noch beherrschten die Pferdefuhrwerke, Droschken und auch feinere Kutschen das Straßenbild. »Es wird seine Zeit brauchen, bis diese Fahrzeuge sich auch bei uns durchsetzen«, sagte der Onkel Karl eines Abends, »und wer kann sich so was schon leisten?« Es blieb still, denn alle wussten, die Tante wie der Ferdinand, dass da noch etwas nachkommen würde.
»Ich habe mir das überlegt, gründlich durch den Kopf gehen lassen. In Budweis und Pilsen und in den Städten drüben in Deutschland sind sie schon an der Tagesordnung. Mit so einem Automobil bin ich in einer Stunde in Budweis, mit der Kutsche brauche ich einen halben Tag, außerdem sind die Automobile kräftiger und billiger als Pferde, ich meine in der Haltung.«
»Da magst du recht haben, Onkel Karl«, der junge Ferdinand Polschitz nickte beifällig.
»Also dann fahren wir am Samstag nach Budweis und kaufen so ein Automobil.«
Da wäre aber doch einiges zu lernen, warf die Tante ein. »Na, das werden wir doch auch hinkriegen«, lachte der Onkel Karl. »Wir stehen bald in einem neuen Jahrhundert, da werden wir noch einige Überraschungen erleben.«
15.
Der Josef Bolech, der Jüngere, machte der Familie wenig Ehre, tanzte regelmäßig aus der Reihe. »Das schwarze Schaf eurer Familie ist der Josef, merk dir das, Maria«, sagte der Pfarrer, den die Maria Bolech um Rat fragte, weil der Josef ihr ganzes Unglück wäre. »Da kann man nicht raten, Maria, entweder er wird oder er wird nicht. Schön ist so was nicht.«
Der Josef blieb über seine dummen Jahre hinaus einer, der scheinbar nie ins Gleichgewicht kommen würde, es müsste schon ein Wunder geschehen, sein Charakter blieb unausgereift und wenn man ihn beschreiben müsste, wären die schlechten Eigenschaften prägend, aber Vater und Mutter ehrte er, wie er betonte.