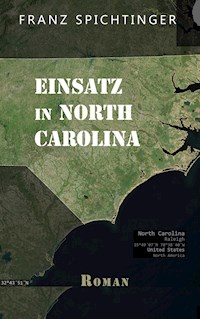Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
›Ins Amerika gehen‹ ist im böhmisch-bayerischen Raum des ausgehenden 19. Jahrhunderts das geflügelte Wort für einen großen Traum. Wenn es einer schafft, ihn zu verwirklichen, dann ›der Mane‹, so ist man sich einig. Doch woher soll ein einfacher Regensburger Handwerker wie Manfred Waldstein das Geld nehmen? Das Schicksal will es, dass er dem Kommandaten des Königlich Bayerischen Infanterieregiments begegnet und mit ihm in den Krieg gegen Frankreich zieht. Als er nach dem letzten schweren Gefecht in die Heimat zurückkehrt, ist er nicht mehr derselbe; nur sein Traum, eines Tages nach Amerika auszuwandern und sich dort eine Existenz als Farmer aufzubauen, brennt noch in ihm. Schon hat sich der Mane darauf eingerichtet, die nächsten Jahre durch harte Arbeit im heimatlichen Eisenbahnausbesserungswerk die Mittel für die Überfahrt zusammenzusparen, da kommt von ganz unerwarteter Seite Hilfe …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
1
»Schaug, Papa, da unten dasafft oana.« Der Girgerl vom Bachler hatte sich über die Brüstung auf der Steinernen Brücke gebeugt und in die Donau hinunter geschaut. Träge wälzte sich der mächtige Fluss durch sein breites Bett und er brachte allerlei mit sich, Strauch- und Astwerk und auch halbe Baumwipfel, die am Oberlauf in die reißende Flut gestürzt waren und jetzt ihren Weg suchten. »Der hängt im Baam drin, Papa, schaug obi.« Der Papa, der Bachler Schorsch, feilschte gerade mit einem Taubenhändler, der auf der Brücke stand und in einem an die Brust geschnallten Drahtkorb mehrere Tauben zum Verkauf anbot. Jeden Samstag hielt der Krexler Martl ein paar Haustauben zum Verkauf feil und kam so notdürftig über die Runden und der Schorsch Bachler hatte in Stadtamhof drüben hinter seinem Anwesen schon einen beträchtlichen Bestand an Tauben in seinem Taubenschlag, kräftige Kropftauben vor allem, weil der Krexler zumeist nur solche im Angebot hatte. In Altötting hatte der Bachler vergangenen Sommer nach einer Wallfahrt noch einen Amsterdamer Kröpfer und einen Altösterreichischen Tümmler erstanden, der Kauf hatte sein Erspartes aufgezehrt. Stolz war er auf seinen Bestand.
»I kumm glei, Girgerl, wart a weng, ich hob’s glei.«
»Oba, der dasafft g’wiss.«
Mittlerweile hatten sich schon etliche Fußgänger um den Girgerl versammelt und schauten dem vermeintlich Verunglückten nach, lachten, staunten, kommentierten den Vorgang im Wasser. »So a narrischer Gischpl«, kommentierte der Rutspitz Willi, der auch dem Krexler seine Tauben begutachtetet hatte, seinen Weg gleich fortsetzte, über die Brücke ging er weiter, zielte zum alten Scheberer, der an warmen Sommertagen in seinem Gartenhäusl hinterm Katharinenspital seine Freunde schon am hellen Vormittag zum Kartenspiel erwartete.
Der »narrische Gischpl« hing derweil im Geäst eines abgebrochenen Fichtenstammes und winkte zur Brücke hinauf.
»Dem passiert nix, Girgerl«, sagte der Bachler Schorsch zu seinem Buben, »bevor der dasafft, bricht de Stoanane Bruck’n z’amm, dös is da Mane.«
»Wos fir a Mane, Papa?«
»No, da Mane halt, da Ratisbona Mane, des is a ganz a G’würfelter, a wengerl a Nascha halt, der springt droben am Prüfeninger Schloss oder goar z’Sinzing scho in d’Donau und kimmt vor der Walhalla unten außa, a Lunga hot der wia a Ross.«
»Wia da Koaßerer, der oiwei zum Opa kimmt, dös is a ganz a G’würfelter«, bestätigte der Girgerl den Vater. Der Opa hatte dem Girgerl schon lange die Lebensumstände seiner Kartenbrüder erzählt und der Girgerl hatte sich so seine Meinung gebildet.
»Da Mane is scho a ganz a Wilder«, sagte der Papa, »a Unbandiger is er, mit am Kreiz wia a Büffl, der hot as ewige Leb’n, der war im Siebzig-Oanasiebz’ger Kriag a Schwoleschee g’wes’n und etzat is er wieder dahoam, aber wia lang halt.«
2
Der Ratisbona Mane war einstweilen mit seinem Fichtenstamm weiter die Donau abwärts getrieben, so wie er es in diesem heißen Sommer 1871 jeden Samstag zu seiner eigenen Freude und zum Gaudium der Zuschauer tat. Kaum war der Krieg im Mai zu Ende gewesen, hatte er sich in den Zug gesetzt und war zu seiner Mutter und zum Vater heimgefahren. »Herr Major, i muaß etzat erst hoam, mei Mutta und mei Vata tuan se arg viel ab«, hat er gesagt, dann war er fort.
Mit der rechten Hand hatte der Mane den Stamm gefasst und schwamm mit dem astigen Stück ans linke Donauufer hinüber. Holz, das er sich aus der Donau holte, gehörte niemand, er trocknete und zersägte es in meterlange Stücke, schichtete die Scheite auf einen runden Haufen und deckte das Ganze mit einem hölzernen Dach ab. Dem Mane hat noch keiner ein Stück Holz gestohlen, das er jahraus, jahrein an der Donaulände den ganzen Sommer hindurch trocknete und dann mit dem Fuhrwerk des Großvaters abholte.
Der Mane hatte beim Schiggerl in der Stadt drinnen das Schmiedehandwerk gelernt, weil der Vater meinte, Handwerk hätte goldenen Boden, und der Mane hätte eine Zukunft, setzte er hinzu und wenn in der Stadt eine Eisenfabrik aufmachen würde, könnte er dort auch anfangen oder gar »bei de Bahnerer«, wie er meinte. Der Mane hatte dann genug von den Prügeln gehabt, die es beim Schiggerl und seinen Gesellen drei lange Jahre gesetzt hatte.
»Von denen wenn ich einen erwisch, der kann sich freuen«, sagte der Mane zum Abschied seinem Meister ins Gesicht.
»Druck di«, antwortete ihm der ungehobelte Patron, »sonst schmier i dir no oane, bevorst gehst. Bei mir hot nu a jeda wos g’lernt, spater wirst fraouch sa drüba.« Ja, gelernt hatte er viel beim Schiggerl. Dann heuerte er bei »de Bahnerer«, beim Eisenbahnausbesserungswerk in der Stadt an und lernte jede Lokomotive von Grund auf kennen und wäre der Franzosenkrieg nicht dazwischen gekommen, hätte er schon lange seine Schmiedemeisterprüfung in der Tasche. »De Donnersberg leg i dir auseinander und bist schaugst, bau i de Maschin’ wieder z’samm a.« Die Donnersberg war ein echtes Prachtstück und keine andere Lokomotive kam ihr gleich. Er pflegte sie auch nach Feierabend, wenn die anderen Schweißer und Mechaniker schon lange nach Hause gegangen waren.
Die Bahnerer haben aber wenig bezahlt und haben den Mane ausgenutzt bis in den Samstagabend hinein. Er eignete sich viel Wissen bei einem Zimmerer an und setzte bald die Dachstühle »wie ein Gelernter«, wie der Meister Seilbinder lobend erwähnte. »Bleib bei mir, an sechtan wia di könnt’ ich brauch’n.« Er dachte an seine sich Jahr für Jahr vergrößernde Werkstatt und daran, dass er keinen Nachfolger hatte und dass das Pepperl, seine einzige Tochter, den Betrieb sicher nicht führen mochte. Einen solchen wie den Mane könnte er sich auch als Schwiegersohn vorstellen.
3
In Nürnberg in der Garnison, hatte er dann »als junger Spund«, wie der Meister lachend kommentierte, an der Garnisonserweiterung des Königlich Bayerischen 4. Infanterieregiments mitgearbeitet. Der Seilbinder hatte den Auftrag bekommen, war er doch über die Heimat hinaus als ausgewiesener Fachmann bekannt. Er hatte ein treffliches Angebot abgegeben und den Zuschlag erhalten. Anno neunundsechzig, die Herbsttage ließen schon grüßen, waren sie dann nach zweijähriger Bauzeit mit ihrer Arbeit fertig geworden und beim Richtfest lobte der Kommandant die Zimmerertruppe um den Meister Seilbinder über den Schellnkönig, wie der Meister meinte. Beim anschließenden Umtrunk hat der Kommandant dann den Mane überredet in der Garnison zu bleiben, er hätte da ein festes Einkommen, besser wie beim Seilbinder, ein schönes Zimmer in der Garnison dazu, wenn er nur wollte und genug Freizeit, da könnte er machen was er wolle, nur müsse er wissen, dass er dem Königlich Bayerischen Infanterieregiment angehöre, wenn auch nur als Handwerker.
Einen mit so viel technischem Verstand und handwerklichem Geschick, mit guten Umgangsformen, der dazu gelernter Schmied war und was vom Hausbau verstand, könnte man überall brauchen, der würde es überall zu etwas bringen.
»Solltest eine Freud’ am Soldatenberuf haben, na bleibst bei uns auf vier Jahr oder auf zwölf, wiast moanst«, sagte der Oberstleutnant, der im Zivilberuf ein Ingenieur gewesen war, dem der Schwiegervater, selber Altgedienter, dann eine Karriere beim Militär in Aussicht gestellt hatte. »Nach zwei Jahren schick ich dich auf die Feldwebelschule«, versprach der Herr Oberstleutnant dem Mane.
Da blieb der Mane in der Garnison und schrieb seinem Vater und der Mutter, dass er für die nächsten vier Jahre in Nürnberg bleiben möchte, er hätte ein gutes Auskommen hier und weil er ja Schmied sei, habe ihn der Kommandant, der ihn sehr schätze, auch noch mit der Hausmeisterei beauftragt.
»Heiraten darf ich die nächsten vier Jahr zwar nicht, aber ich kenne ja keine, die mir g’fallt.«
4
Dann wurde alles mit einem Mal anders, die Zeiten änderten sich. Was gestern gegolten hatte, war morgen nichts wert. Die Franzosen hatten dem Norddeutschen Bund den Krieg erklärt und die Bayern standen an der Seite der Preußen. Der Kommandant sagte zum Mane, dass sie einen wie ihn bei der Kavallerie brauchen könnten und ob er mitziehen möchte ins Feld.
»Da hau’n wir dem Franzosen eine drauf, dös geht schnell, Mane, bist schaust san mir wieder dahoam.«
»I ko guat reit’n, Herr Kommandant«, sagte der Mane, »wann Sie einen Reiter brauch’n, mi haut koa Franzmann oba vom Gaul.«
Der Kommandant betrachtete sich die muskulöse Figur seines Hausmeisters.
»I bin die Donau mit oan oder zwoa Atemzüg’ durchg’schwomma, mehr Luft hob i net braucht und na bin i no vom Kloster Weltenburg bis nach Schwabelweis zum Großvater g’schwomma, mit oan Aufwasch, wia ma so sagt.«
Der Oberstleutnant schätzte den Mane: »Geh’ zum Hauptmann Blöcker, der nimmt dich auf. Alles muss seine Ordnung haben, bist halt dann ein Soldat, kein Hausmeister mehr, kannst stolz sein, bist bei den Königlichen und nächste Woche darfst schon in den Krieg zieh’n, Mane.«
Der Mane schrieb noch einen Brief an die Mutter und den Vater, erzählte ihnen, dass er mit einem ganzen Haufen anderer Kameraden am Freitag in die Eisenbahn steigen und an die französische Grenze fahren würde.
»Ich komme bald wieder, der Hauptmann nimmt mich mit in die Kavallerie, ich werd’ scho net schiaß’n müss’n. Aber wir putz’n de Franzosen weg, dass de bloß a so schau’n. Des geht g’schwind, hot der Kommandant g’sagt. Und wenn ich wieder daheim bin, in Nürnberg in der Kaserne, dann schreib ich euch einen Brief, liebe Eltern und grüßt mir die Monika, mein liebes Schwesterl und die Großmutter und den Großvater und sie sollen sich nicht abtun und ich komm’ nach dem Krieg gleich bei euch vorbei.« So ist der Ratisbona Mane in seiner Unbedarftheit in den Krieg gezogen, weil ihn der Herr Oberstleutnant dazu eingeladen hatte.
Der Mutter hat es das Herz zerrissen und der Vater wurde krumm vor Kummer. »Der kimmt scho wieda, der Mane«, sagte tröstend der Opa, »der möcht’ sicher wieder in da Donau schwimma.« Aber insgeheim rannte er in die Emmeramskirche und betete zu allen Heiligen.
5
Den ersten Brief an die bekümmerten Eltern schrieb der Mane aus Wörth im Elsaß. Die französischen Kürassiere hätten ihnen zunächst ganz schön eingeheizt, aber dann hätte es g’scheit gekracht, sie hätten die verlotterten Haderlumpen zurückgeschlagen und wären ihnen hinterher gejagt, man habe nicht lange gefackelt und g’scheit hing’langt, bis die Franzosen auf und davon wären. Viele Tote hätte es gegeben, »nur so umgefallen sind sie, mehr bei den unsrigen als bei denen von der anderen Seite.«
Schon in den ersten Minuten hätte es den Herrn Oberleutnant von Strauß getroffen, vielleicht hätte ihn auch die eigene Infanterie von hinten erwischt, weil der Herr Oberleutnant sehr weit vorne geritten wäre und die meisten von den Soldaten mit ihren Gewehren gar nicht recht umgehen konnten. Er habe den tapferen Oberleutnant, der, ganz weiß im Gesicht, zurückgeritten kam und fast vom Pferd gefallen wäre, aufgefangen und aus dem Getümmel getragen. »Dem bleibt ein steifer Fuß, weil es ihm die Kniescheibe zertrümmert hat, aber er war mir ewig dankbar, weil ich ihn zu den Sanitätern geschleift habe, weil die Franzmänner ihn gar massakriert hätten, dann bin ich wieder zurück zu den Kameraden. Es war alles eine Mordssauerei, so einen Krieg möchte ich nimmer erleben. Aber mir ist gar nichts passiert. Ich bin schon aufgeregt, wohin es jetzt geht. ›Da misch’n wir wieder g’scheit mit‹, hat der Herr Oberstleutnant g’sagt. Aber dann hat er noch gesagt, dass wir alle recht fest beten sollten, dass uns keiner von den Franzosen erwischt.«
6
Dann, am späten Nachmittag des nächsten Tages, ein Mittwoch war es, der Jakobitag noch dazu, hat der Holter Max einen Koller bekommen und ist aus dem Graben gestürmt. Die französischen Scharfschützen haben nur darauf gewartet, dass einer der Kameraden den Kopf über den Grabenrand hebt und sie haben dem Max die Schädeldecke abrasiert.
Man müsse schon so hirnverbrannt wie der Gefreite Holter sein, dann wäre das Sterben eine Angelegenheit von einer Sekunde oder so unverantwortlich wie der Herr Adelige von Schießlegg, dann könne man im Sauseschritt eine ganze Kompanie verheizen. Das waren die einführenden Worte des Hauptmanns Schusterless, der aus dem Generalstab an die Front abkommandiert worden war, »um den Etappenhengsten die echte Lebensart an der Front beizubringen«, wie er sich ausdrückte. Überheblich und mit nicht zu überbietender Arroganz hatte sich der junge Offizier eingeführt und in die Brust geworfen und die Oberleutnants und Leutnants und die Feldwebel stramm stehen lassen, während die Salven über die Schützengräben orgelten. General von Kirchbach wäre überhaupt nicht zufrieden mit dieser Art von Stellungskrieg, schwadronierte er und der Herr General fordere zudem umgehend mehr substanziellen Einsatz der Herren Offiziere und der Feldwebel und lasse diese Order als ganz persönliche Weisung durch ihn, Hauptmann Schusterless, überbringen. Ferry von Strauß war zu der Zeit bereits im Lazarett und Manfred Waldstein erzählte ihm vom Amtsantritt des Hauptmanns Karl Schusterless.
»Der hat doch Dreck am Stecken«, entgegnete der junge Offizier, der noch kalkweiß von seinen jämmerlichen Schmerzen auf seinem Laken gelegen hatte, »jeder Offizier im Regiment weiß um Schusterless’ Allüren und dreckigen Geschäfte, von dem werden wir noch hören, geh ihm aus dem Weg, Mane.«
7
»Gespürt hat der nichts mehr«, resümierte der vom Dauerrausch umwölkte Major von Schießlegg, als der Oberfeldwebel Münchshof und der Zwiebelacker Hannes, mit dem der nunmehr Verstorbene aus einem Gau stammte, den Max Holter in den Graben zurückgezogen und den toten Kameraden mit einer grünen, feuchten Plane bedeckt hatten. Der Oberfeldwebel hatte dem Maxl dann noch die Erkennungsmarke mit der Kette vom Hals genommen und am Abend haben sie geschaut, dass sie den Max hinter die Linien gebracht haben.
Befehle zum Angriff oder für den Rückzug gaben in der Kompanie nur die Feldwebel, denn der Herr Major von Schießlegg war zu nichts mehr zu gebrauchen, torkelte besoffen durch den Graben und stürmte regelmäßig im Vollrausch ins Feld.
»Attacke«, schrie er, »Attacke«, und dass die Kameraden ringsherum zu Boden stürzten, ging an ihm vorbei, er verließ wankend den Gefechtsabschnitt, scheinbar gefeit gegen Säbel, Kugel und Bajonett, richtete sich dann irgendwohin aus, das Gewehr als Stütze in der Linken und der Herr Major hat den Krieg bis zum vorletzten Tag überstanden. Beim Angriff am späten Freitagnachmittag, der Kanonendonner hat ihm sein Nervenkostüm vollends gekostet, hat er sich wieder in die Hosen gemacht und wäre lieber heute als morgen gestorben oder heim zu seiner Frau gefahren.
Dann hat es am Tag darauf, an einem frischen Samstagabend, kurz vor Sonnenuntergang, einen ganz einsamen hellen Schuss gegeben und der Hauptmann von Schwerck meldete dem Herrn Oberst, dass der Herr Major nun doch noch das Zeitliche gesegnete hätte, es wäre ein sauberer Schuss in die Brust gewesen und der Herr Major hätte sich überhaupt nicht plagen müssen, zudem wäre er um diese Zeit schon randvoll abgefüllt gewesen.
»Schreiben Sie das seiner Frau«, befahl der Hauptmann von Schwerck auf Geheiß des Obristen von Sassewitz der Ordonanz, »und schreiben Sie ihr, dass ich nach dem Krieg vorbeikommen werde und ihr mein tiefes Beileid persönlich übermitteln möchte.« Der Herr Major von Schießlegg war nun Mitte der Vierzig geworden, mit einer vermögenden, hübschen Baronin verheiratet, die er nun kinderlos hinterließ und er, von Schwerck, könne sich wohl vorstellen, mit der Frau Major warm zu werden.
Die Kompanie hatte den letzten furiosen Auftritt des Herrn Major von Schießlegg, während der Franzose Salve um Salve über die Schützengräben schoss, noch in besonderer Erinnerung. Der Herr Major war eines Abends, knapp drei Wochen, bevor er den Heldentod erlitten hatte, in den Unterstand gestürmt und meinte, wie so oft nicht Herr seiner Sinne, es wäre da doch ständig eine miese Stimmung bei den Kameraden hier im Unterstand, das untergrabe die Moral der Truppe, man solle singen und ob denn keiner ein Instrument dabei habe, fragte er. Allgemeines verständnisloses Kopfschütteln, Murren, Gelächter und der Herr Major von Schießlegg befahl sodann unverzüglich dem Kompaniefeldwebel, er habe bis morgen Mittag ein Instrument aufzutreiben und wer denn sowas spielen könne, fragte er, in die Runde blickend, eine Geige vielleicht oder eine Harmonika oder eine Trompete, das würde dem Franzmann einen rechten Schrecken einjagen und man könne das wohl auch im ganzen Regiment einführen, das könne Standard werden, fügte er an. Nach langem Zögern meldete sich der Kürassier Mane Waldstein und meinte, er spiele eine Knopfziach.
Was denn das nun wieder sei, lachte der adelige Kumpan, eine Knopfziach und er hieb dem neben ihm stehenden Oberfeldwebel einen Schlag ins Genick. »Beschaffen Sie so eine Ziach«, grölte er, »konfiszieren Sie so eine Ziach und dann wird gespielt, aufgespielt zum Tanz«, krächzte er, verwirrt vom alltäglichen Rausch, wodurch er seine qualvolle Todesangst und elendige Kümmernis überspielte und verließ lachend, gequält hustend, den Schützengraben.
Noch am selben Abend war der Oberfeldwebel Münchshof hinter den Linien verschwunden und tauchte tatsächlich mit einer Ziehharmonika auf, noch dazu einer recht ordentlichen. »Ich habe den Leuten versprochen, dass du gut mit dem Ding umgehst, Mane, und jetzt spiel.« Zweimal hatte der Mane dann auf der Ziach gespielt, dann hatte der Franzose regelmäßig etwas dagegen. Vom Gefreiten bis zum Hauptmann lagen sie im Dreck des Schützengrabens und der Major schrie den Mane an, er solle doch seine Ziach spielen, er könne das Geschrei der Verletzten nicht mehr hören und er würde sich aufhängen oder sonst wie verrecken und der Scheißkrieg bringe ihn noch um den Verstand. Am nächsten Tag brachte der Mane mit dem Feldwebel die konfiszierte Knopfziach ins Nachbardorf zurück und schwor sich, nicht mehr auf der Ziach zu spielen, so lange er lebe.
»Mane, merk dir oans, man soll nia nia sog’n«, sagte der Feldwebel, »es kumma a wieder andere Zeiten, da wird dir de Musi guat tua.«
8
Als die Schlacht von Sedan dann am 1. September 1870 vorbei war und die französischen Linien zusammen gebrochen, ihre Verbände besiegt und auch die Deutschen wieder daheim waren, hörte man lange nichts vom Mane. Sedan habe ihm gereicht, er würde bald nach Hause kommen, schrieb er dann im Frühjahr 1871 an seine Eltern, der Kommandant habe einen Splitter im Kopf, er würde auf der rechten Seite nichts mehr hören und sicher zurück gehen ins normale Leben, »ins freie Leben«, wie der Obrist gesagt hat, aber er würde eine schöne Kriegerrente einstecken. Er, der Mane, habe eine Auszeichnung erhalten, weil er todesmutig und selbstlos einen Kameraden, den Herrn Oberleutnant von Strauß, vor den Kugeln und den Bajonetten des heranstürmenden Feindes, dem sich der Herr Oberleutnant von Strauß so heldenhaft entgegengeworfen hatte, gerettet habe, wie der General sagte.
Der Ratisbona Mane wäre ein echter Schwoleschee gewesen, ein Berittener bei den Kürassieren, der den Feinden das Fürchten gelehrt hatte, hieß es dann in der Heimat. Dann stellten sie in der Stadt ein Kriegerdenkmal auf und schrieben die Namen der Gefallenen drauf und der Mane machte einen weiten Bogen drum herum.
9
Der Girgerl stand mit dem Vater vor dem Taubenschlag und der hatte die zwei neuen Tauberer in den Verschlag geschoben. Die Vögel kamen immer gut miteinander aus und selten, dass eine Taube ausblieb, wenn sie vom Abflugort in den Heimatschlag zurückflogen. Aber die eine oder andere in der Umgebung hatte sich der Habicht geholt.
In Montabaur hatte der Bachler im Mai des letzten Jahres zwei serbische Hochflieger eingekauft. Der Alladin und der Omar entwickelten sich besonders gut und er eroberte sich schon im Spätsommer einen schönen ersten Preis.
Der Omar war der Liebling vom Girgerl. Als die Kropferten, wie er sie nannte, vom alten Hillwasser Bene, der seinen Taubenschlag nicht weit vom Girgerl aufgestellt hatte, einmal allesamt krank geworden waren, sagte der Papa zum Girgerl: »Mit ana Taub’n muaßt guat umgeh’, Girgerl, red’n muaßt mit eahna, wia mit an Menschen, sinst kennas drauf geh’, und der Stall muaß oiwei sauba sei, Bua, mirk da des.«
Das merkte sich der Girgerl und er behandelte die Tauben so gut wie seine zwei Stallhasen, die Weihnachten das Zeitliche segnen würden, weil sie auf das Fest hinlebten und nur die Aufgabe hatten, das Jahr über fest zu fressen, um dann am ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Mittagstisch zu landen, und die Mama verstand es, sie gut zuzubereiten. Ein ganzer Haufen Knödel dampften dann in der weißen Porzellanschüssel, die die Mama nur zu besonderen Festtagen auf den Tisch stellte und der Girgerl konnte kaum abwarten, bis der Vater nach dem Tischgebet das Fleisch schnitt, was seine Aufgabe war.
Er solle sich nur Zeit lassen, damit er sich nicht den Mund verbrenne, lachte die Mama, wenn der Girgerl dem Hasenbraten zu Leibe rückte. Aber noch war es lange nicht so weit und die zwei Hasen mussten noch viele Milchscheckeln fressen, bis sie dick genug waren, dann prüfte der Großvater in der adventlichen Zeit regelmäßig das Gewicht der zwei Hopser: »De zwoa kemma scho guat hi bis zum Christfest, Girgerl, gib eahna ner nu a paar Erdäpfel mehr zum Fressen, dass nachat as Fleisch recht saftig wird.«
Der Girgerl ging zum Opa in die Stube und der erzählte ihm von dem Ratisbona Mane. »Dös is a Sakrischer, a ganz a G’würfelter, wos der scho ois trieb’n hot, da kannt i dir vül verzöhln, Girgerl. A Schwoleschee war der, mei Liaba, a echter Schwoleschee. Wenn ma am Nachmittog ausg’schlofa ham alle zwoa, na kummst eina zu mir und nacha verzöhl i dir nu mehr vom Mane.«
»I schlaf net, Opa, i kumm glei nach’m Mittogess’n zu dir eina.«
10
Der Herr Oberstleutnant ist dann von einem Tag auf den anderen pensioniert worden. Das Bataillon hatte ihn mit einem feierlichen Zapfenstreich verabschiedet, dann war er mit seiner Frau in das Haus der Schwiegereltern ins Oberbayerische verzogen, war ein Direktor in einem Industrieunternehmen geworden und hatte ganz vergessen, den Mane ans Herz zu drücken. Der Ratisbona Mane saß nun in seinem Mansardenzimmer unter dem Dachboden der Kaserne, verrichtete gewissenhaft seine Hausmeisterdienste, hörte die Kommandos der Feldwebel und der Zugführer über den Kasernenhof schallen. Der Krieg mit den Franzosen lag schon geraume Zeit zurück. Die Zeitungen zogen ihr Resümee über den Krieg und seine Folgelasten, der Kanzler Bismarck machte ein paar neue Sozialgesetze, viele Kriegsinvaliden fristeten mit ihren Familien ein kärgliches Leben, im Volk war viel Streit und Aufbegehren, den Leuten ging es schlecht, in den Städten regte sich das Proletariat gegen die Obrigkeit. Das Dampfschiff löste die Segler ab, das die zumeist armen Leute nach Amerika ausschiffte, Hunderttausende zog es in die neue Welt, wo sie sich Arbeit, Land und Broterwerb versprachen, sie suchten ein besseres, sorgenfreies Leben. Die amerikanischen Eisenbahngesellschaften warben in ganz Europa um die Auswanderer. Nur einen Beruf sollten sie haben, solche Leute könnte man brauchen, schrieben sie auf vielen tausend Handzetteln, die ihre Agenten im ganzen Land verteilten.
Dann erreichte den Mane in seiner Dachkammer ein Paket von den Eltern. Dem Packerl war ein dicker Brief des Herrn von Strauß an seine Regensburger Adresse beigefügt und das Leben des ehemaligen Schwoleschees und derzeitigen Hausmeisters in der Ingolstädter Kaserne, Manfred Waldstein, den sie von Kindsbeinen an den Ratisbona Mane genannt hatten, nahm einen neuen, unvorhergesehenen Verlauf.
11
Oberleutnant von Strauß schrieb dem Mane, er habe gleich nach dem unseligen Gemetzel zwischen den Franzosen und den Deutschen und nachdem er seine schwere Verletzung auskuriert hatte, der Heimat Lebewohl gesagt und sei mit einem Dampfschiff nach Amerika. Er habe nie vergessen, dass er ihm, dem Mane, sein Leben verdanke und sollte er auch nach Amerika gehen, dann könne er dort mit seiner Unterstützung rechnen. Derzeit wohne er in Philadelphia bei einer bekannten Familie nur zweihundert Meilen südlich von New York, wo er von Bord gegangen wäre. Alte Bekannte seiner Familie hätten ihn in seiner neuen Heimat aufgefangen, auch begüterte Verwandte den Neuanfang leichter gemacht und die englische Sprache beherrsche er auch schon recht ordentlich und mit Fleiß und Anstrengung könne er, Strauß, es zu was bringen.
Da dachte der Mane lange und gründlich nach und verließ seine Mansarde. Er fuhr mit dem Dampfzug in die Heimat, querte die Steinerne Brücke nach Stadtamhof hinüber, sagte alten Freunden in der Stadt Grüß Gott, auch der Traudi aus der Kreuzgasse, die ihn mit seltsamen, nassen Augen anschaute, schwamm noch einmal nach Schwabelweis, winkte zur Steinernen Brücke hinauf und machte einen kleinen Bub, den Bachler Girgerl, glücklich.
12
Das Elternhaus in der Jakobstraße lag ganz nahe an der alten Schottenkirche und wenn er sich aus dem Fenster lehnte, konnte er den Kirchgängern, die ihre Sorgen Sonntag für Sonntag ins Gotteshaus trugen, bei ihrem Weg dorthin zuschauen, dem alten Wührgang, der sich am Stecken mühselig vorwärts bewegte, der immer seine Frotzeleien mit den Kindern hatte, der vornehmen Frau vom verstorbenen Kürschner Seiler, die ihren langen, schwarzen Rock mit beiden Händen hochzog, damit er vom Staub und Dreck auf der gepflasterten Jakobstraße verschont blieb und dem Herrn Prälat Stumvoll, der zu seinem Fenster heraufgrüßte, in der Hoffnung, dass er die Mama sehen würde.
»Ich warte noch auf einen Brief vom Zupfer Schorsch aus Bischofteinitz, dann schau ich weiter«, wandte er sich zurück zur Mutter. Er lehnte sich auf die Fensterbank, schaute hinüber zur Kirche. Die Mutter bereitete gerade das Mittagessen vor, Blut- und Leberwürste brachte sie heute auf den Tisch, weil der Onkel in Schwabelweis, ihr Bruder Josef, wieder einmal geschlachtet hatte. Am Sonntag hätten sie dann das Kesselfleisch und das übrig gebliebene Kraut würde sie mit einer Mehlschwitz binden und alle wären dankbar und froh, dass es der Herrgott gut mit ihnen meinte.
An der Treppe vor der Kirchentür packte ein hinkender, kräftiger, untersetzter Mann seine Ziehharmonika aus, auf den ersten Blick schon erkannte der Mane den typischen Kriegsinvaliden, das graue Kappl auf dem Kopf, ebenso grau die leinene Jacke und die lange Hose mit den schwarzen Streifen an den Seitennähten. Der Alte, Silberhaarige, strich sich den langen, struppigen Bart, fuhr mit der linken Hand über das strähnige, lange Haar, schob die beiden Arme unter die Gurte seiner Harmonika und phantasierte seine Melodien, auch einer, der den Krieg überstanden hatte, auf der Straße lebte, irgendwann in einem Armenhaus verkommen würde. Für das Militär war er nicht mehr tauglich, in Ehren entlassen, ausgedient hat er, seine Pflicht gegenüber dem Vaterland, dem Kaiser, hat er getan, hinkend und so lange er noch Gesundheit und genug Kraft hatte, würde er seine Straßen ziehen, nicht die Boulevards großer Städte entlang, nicht über die glitzernden Chausseen dieser Welt, auch nicht mehr die Heerstraßen müsste er entlang marschieren. Die gefurchten Wege und alten Landstraßen und die steinigen Gassen der alten Märkte und Städte waren seine Welt geworden, einer, den der Krieg das Fürchten gelehrt hatte, der mit dem Schicksal haderte, mit dem Alltag nicht zurecht gekommen war, ohne Beruf und Heimat und auf die Gaben und spärlichen Zuwendungen seiner Mitmenschen angewiesen.
»Solltest es genau überlegen, ob du ins Amerika gehst, Bub.« Der verhaltenen, leisen, besorgten Stimme der Mutter merkte er an, dass sie das Weinen unterdrückte. Schon jetzt brannte ihr Gemüt voller Kummer und Sorge um ihn, hatte ihr doch schon der Jammer um ihren Mane in den zwei unseligen Kriegsjahren das Herz entzwei gerissen.
»Die bauen im ganzen Land unentwegt ihr Eisenbahnnetz aus, Mam’, die brauchen ausgebildete Leute in Amerika und ich kenne jede Lok bei uns in- und auswendig. Dort drüben habe auch ich eine Zukunft und wenn es mir gut geht, dann kommt ihr alle nach, des is’ a Land, wo Milch und Honig fließt. Oder ich arbeit’ in einer Fabrik in New York oder sonst wo, bis ich’s Geld beisammen hab, um mir genug Land zu kaufen. Vielleicht werd’ ich ein Farmer oder ein Rancher mit einem Haufen Küh’ und Pferd’ in Montana oder in Arizona.«
»Oh mei Bua, du phantasierst, bleib dahoam und ernähr’ dich redlich, du bringst es überall zu wos, kannst ja alles, es macht dir koana wos vor, kannst sogar Häuser bauen von den Grundmauern bis zum Dachstuhl und deine Lokomotiven fahren a bei uns in der Hoamat. Bist ja da oanzige, der a Crampton-Lok von oana Long-Boiler unterscheiden kann. Wiast siehst, kenn’ i mi scho besser mit deine Lokomotiven aus wia in meiner Waschkuchl.«
Die Ziehharmonika des Kriegsinvaliden vor der Schottenkirche jammerte und beweinte das Elend der Welt, der Herr Prälat brachte ihm eine Münze, die Mutter packte dem »armen Teufel«, wie sie ihn nannte, eine Leberwurst und einen dampfenden Erdäpfel in ein Butterbrotpapier. Dann steckte der Alte seine Harmonika in den Sack, hängte sie über die Schulter, schaute zu den geöffneten Fenstern hoch, hob die Hand zum Gruß, zum Dank und zog seines Weges.
»Sorg dich nicht, Mutter, irgendwie ist das Glück auf meiner Seite, sonst wär ich nimmer heimgekommen aus dem Krieg, jetzt spar ich erst meinen Lohn, den ich im Ausbesserungswerk verdiene und übers Jahr denk ich dann weiter, ich bin ja noch jung und des Amerika läuft mir nicht davon. Der Schorsch aus dem Böhmischen hat Verwandte im amerikanischen Norden, oben an den Seen, in Milwaukee am Michigansee, die leben dort schon seit den Vierzigern und haben sich was aufgebaut, da hätte ich auch Platz, aber wer weiß, wie es kommt, ich bin noch jung und gesund. Aber der Zupfer Schorsch wird so schnell nicht schreiben.«
»Ich glaub nicht, Bub, dass ich den Vater noch nach Amerika bringen würd’, dem ist die schwere Arbeit in der Schmied’ bald zu viel und wenn er nicht mehr kann, ziehen wir runter ins Haus vom Schwabelweiser Opa, der macht es nimmer lang, ich möchte mich auf seine alten Tage mehr um ihn kümmern, in der Stadt herinnen bin ich zu weit weg.«
»Wenn der Vater heimkommt, reden wir weiter, Mutter.« Aus dem Keller turnte die kleine Schwester herauf, die Monika, die auch schon ausgewachsen war. Sie hatte die Wochenwäsche im Trog in der Waschküche geschrubbt und brauchte etwas Ruhe. »Willst immer noch ins Amerika geh’n, da nimmst mi mit, Mane, ohne mi gehst net.«
Der Vater hatte nicht viel zu sagen, er war müde nach der Arbeit, wollte noch zum Bachler nach Stadtamhof rübergehen, weil er eine schöne Taube kaufen wollte. »Bua«, sagte er »überleg dir’s genau, wennst drüben bist in Amerika, kummst so schnell nimmer hoam, aber ich steh’ dir nicht im Weg, des sollst wissen, es ist ja dein Leb’n. – As Geld wird neu, hoaßt’s, bald hama koane Gulden mehr, da gibt’s Mark im Königreich Bayern. Mit dem, was wir erspart ham, kummst net weit, für die Überfahrt wird es reichen und mit deinem Ersparten wirst die erste Zeit drüben net hungern müssen«, setzte er hinzu und die Mama und der Mane waren sprachlos.
Der Vater hatte also alles schon vorausbedacht, und was er sagte, hatte Hand und Fuß. »Geh zum Herrn Prälat Stumvoll, Bua, der woaß no mehr vo dera neia Welt.«
Mane wusste, dass die in den letzten zwanzig Jahren ersparten Gulden für die Eltern notwendig, lebenswichtig waren, um im Alter nicht verhungern zu müssen. Er würde das Geschenk der Eltern auf Heller und Pfennig zurückzahlen und noch viel mehr, das nahm er sich vor.
Briefe waren recht selten an die Familie Waldstein gerichtet, so war die Post aus dem Böhmischen ein Ereignis.
13
Der Georg Zupfer, Kriegskamerad, vom Unglück im Krieg mit den Franzosen ebenso verschont wie der Mane selber, einer der nicht Tod, nicht Teufel gefürchtet hatte, mit einer Geige im Sturmgepäck, zuständig fürs Aufmuntern, gar einen Scherz, wenn das Jammern der Verletzten, die Verzweiflung in der Heimsuchung und Bedrängnis zu übermächtig wurden, die ganz Jungen im Schützengraben nach der Mutter geschrien haben. Damals, als der Major Schießlegg die Soldaten im Rausch zum Musikmachen aufgefordert hatte, ließ der Georg seine Stradivari, wie er sie nannte, im Sack, da war er nicht so weit, um zu spielen, im Unterstand gar, wo das Elend und das Grauen sie oft genug übermannte. Zur rechten Zeit dann, bald nach Wörth, hatten ihn die Kameraden dazu überredet.
Der Georg Zupfer kündigte nunmehr seine Reise ins Amerika an, ein Onkel, lange schon in der neuen Welt, habe ihm dazu geraten, ihn eingeladen, er würde drüben auf ihn warten. Mane könne, wann immer er nachkommen wolle, seiner Unterstützung sicher sein, seine Adresse würde er beilegen und Milwaukee liege zwar etwas abseits von New York, man könne es jedoch gut und sicher mit der Eisenbahn oder einem Kutschendienst, wie er schrieb, erreichen.
»Schreib mir, bevor du das Schiff besteigst und wenn du etwas Geld fürs Erste gespart hast, kann das nicht schaden. Geh ja nicht nach Hamburg, solltest in Cuxhafen aufs Schiff gehen, dort ist der Andrang weniger stürmisch.«
Seine Verwandten seien in der alten Brady Street untergekommen, schrieb er in seinem Brief, würden dort schon in der zweiten Generation siedeln. Am Milwaukee River würde jedoch ein Verwandter einen Holzhandel, ein Sägewerk noch dazu betreiben, dorthin sei er eingeladen, zunächst zu leben und zu arbeiten. Für den Mane sei da sicher vorübergehend auch eine Unterkunft möglich, nachdem er vom Hausbau viel verstehe. Es müssten ja nicht nur Lokomotiven sein, setzte er feixend hinzu.
Die Wochen zogen ins Land, der Manfred sparte Pfennig um Pfennig, Mark um Mark, am Abend lernte er die neue Sprache und wenn er sich in Cuxhaven rechtzeitig anmelden würde, dürfte ihm ein Platz auf einem der modernen Dampfschiffe sicher sein, schrieb ihm die Hafenverwaltung der Nordseestadt auf seine Anfrage. In der Stadt traf man den Ratisbona Mane selten an, jeden Samstag jedoch, bis in den Herbst hinein, sah ihn der eine oder andere unter der Steinernen Brücke in der Donau seine Kreise ziehen.
14
Bei den Waldstein in der Jakobstraße hing der Haussegen schief. Was sollten die Leute, die Nachbarn, seine Freunde denken von ihrem Mane, der im Frühjahr Hals über Kopf, wie die Nachbarn annahmen, mit einem Dampfschiff nach Boston ausgereist war. »Hot er eich alloa lass’n, der Mane, auf eire alten Tag is es net guat, wenn ma alloa is und die Junga vadrucka se in de weite Welt«, hatte der Bichler Andres gemeint, einer der Nachbarn in der Jakobstraß’, nach dem Heiligen Amt am Sonntag, nachdem es sich herumgesprochen hatte, dass der Mane weg war. Die Mutter hatte einen hochroten Kopf und meinte, dass die Leut’ Grund genug hätten vor der eigenen Hautür zu kehren, und sie sollten auf sich schauen und der Mane könnt’ tun, was er für richtig hält und das ging’ keinem was an.
Nach New York habe er zunächst gewollt, schrieb er von Cuxhaven aus, aber der Frachter, auf dem er angeheuert habe, müsse seine Ladung erst in Boston oben löschen, dann wollte der Kapitän vor der Rückreise über den Atlantik nach Europa zunächst in New York einfahren, wollte Fracht suchen, bis dahin wollte er auf dem Schiff bleiben, habe er doch Logis und Überfahrt umsonst gehabt, nur im Maschinenraum habe er nach dem Rechten zu sehen, seien doch der erste Maschinist und noch weitere zwei Matrosen schon in Cuxhaven krank geworden. Den kranken Seeleuten habe er überhaupt zu verdanken, dass er habe ausreisen können. Auf seiner Reise mit dem Zug von Nürnberg nach Norddeutschland habe eine Lokomotive einen Achsenbruch gehabt, vor Kassel wär das Unglück gewesen und die Bahnarbeiter hätten zwei Tage gebraucht, bis sie die defekte Lok nach Kassel transportiert, eine neue Lok den Wägen vorspannt hätten, dann erst wäre die Weiterfahrt für die vielen Reisenden möglich gewesen. Er wäre aber dann zu spät in Cuxhaven angekommen und das Passagierschiff mit den Auswanderern war längst Richtung Amerika unterwegs gewesen.
Nun wartete seine Familie auf ein neues Lebenszeichen vom »verlorenen Sohn«, wie der Schwabelweiser Opa augenzwinkernd seine Tochter aufrichtete, wenn sie jammerte, dass der Bub doch nimmer in die Heimat zurück käme, »denn wer drüben ist, bleibt drüben.«
»Wir wissen ja, wo er ist, aber der Bua kann net schreiben, wenn er mit dem Schiff auf dem Atlantik fährt und im Maschinenraum zu arbeiten hat«, sagte der Vater, aber die Mama weinte sich die Augen aus. »Es könnte ihm ja auch was passiert sein«, warf sie ein um das andere Mal ein, »das Schiff ist vielleicht schon längst im Meer untergegangen.«
»Der schwimmt sogar übern Ozean, wenn’s sei müaßt«, redete der Schwabelweiser Opa drauflos, wollte die verhärmte Tochter trösten, konnte er sich doch die Größe des Ozean gar nicht vorstellen. »Je g’scheiter der Mensch is«, sagte er, »desto größer sind seine Sorgen, sind die Kümmernisse, um die seine Gedanken von früh bis spät kreisen. Also tua de net so ab, Madl.«
Am späten Vormittag dieses tristen Tages hatten sie einen unangemeldeten Besuch gehabt. Die Kermes Traudi war mit ihrer Mutter über die Treppe heraufgestürzt, sie hatten sich keine Zeit genommen, um an der Türe anzuklopfen, standen mitten in der Küche und fingen mit den Händen wild zu fuchteln an, schrien, der Mane habe ihr des Kind g’macht, koa anderer sonst, sie sei eine Anständige, immer schon, aber jetzt sei sie guter Hoffnung und er, der Mane, sei ins Amerika ausgerückt, davo wär er, ausgerissen, feig sei er, koa Ehrenmann, a Lump sei er, dabei flennten und keiften sie, was das Zeug hielt.
»Ohne zahl’n geht da nix«, sagte die Mutter Kermes und die Traudi nickte mit ihrem schönen Kopf und heulte Rotz und Wasser. »Davo is er, der Schlawiner«, weinte die junge Verlassene, »mitnehma hätt er sie alleweil kenna, as Kind hätt’ dann in Amerikka aufwachsen kenna«, fügte sie fordernd hinzu. »Aber ich mach’ rüber übers große Wasser, as Kind soll an Vater ham, mit so oan hab i mi eilass’n, a Krimineller is er, der Mane.«
»Na, tua ner halblang«, kürzte der Vater des Gespräch ab »es ist ja gar net erwies’n, dass der Mane war.«
Da keiften die zwei Frauen wie toll gewordene Furien. Die Traudi sei koa sechtane, die alle Tag lang an andern hätt’, sie sei so guat wia de Monika, die se allaweil drunten in der Kirchgass mit an Angerer Hans rumtreiben würd’, des wüsstn ja alle im Viertel.
Da hat sie der Vater Waldstein gebeten, das Haus zu verlassen.
»Mit der Polizei wer’n mir kemma, sobald des Kind da ist und zahl’n müasst etz«, schrie die alte Kermes von der Straße herauf, dann sind sie an der Schottenkirche vorbei abgerückt.
»Wenn des wahr wär’, dann war des a Schand«, sagte die Mama.
»Ja, wenn’s wahr war«, sagte der Papa, »erst muaß ma den Buam hörn.«
15
Der zweite Ingenieur zog den Manfred Waldstein unter Deck und im Maschinenraum empfing ihn das Rasseln, Hämmern und Zischen der Dampfmaschinen, ein Dröhnen und Fauchen, wie er es von der Arbeit im Ausbesserungswerk schon in abgeminderter Form kannte. Der Höllenlärm dröhnte seine Ohren zu, kaum dass er den Ingenieur verstehen konnte.
Der Gestank, der aus den Kohlebunkern in den Maschinenraum herüber drang, nahm ihm den Atem. Das sollte seine Heimat sein, seine Arbeitsstelle für mehrere Wochen? Im Kohlebunker schufteten die Arbeiter wie die Sklaven, verdreckte, schwarze Gesichter starrten ihn an. Er würde diese Tage überstehen und was die Heizer jeden Tag durchzustehen hatten, würde ihn in den kommenden Wochen nicht umbringen, sagte er sich.
Sie verließen Cuxhaven um die Mittagszeit. Gegen Abend, sie schipperten vor der englischen Südspitze, kam mächtiger Regen auf, wie er ihn bisher nicht erlebt hatte, der Wind drohte ihn von Bord zu wischen, so dass er sich wieder in den Maschinenraum verdrückte. Bleischwer lag er nachts in seiner Koje, von Träumen geplagt, schweißgebadet wachte er auf, schöpfte mit einer Kelle Wasser aus dem Eichenholzbottich und wartete müde bis in den Morgen hinein. Das Wetter heiterte in den Vormittagsstunden des nächsten Tages auf und die Tage der Weiterfahrt bis Boston waren einer schöner als der andere. Hätte er sich nicht zu dieser höllischen Arbeit unter Deck verpflichtet, könnte man das Ganze als Vergnügungsreise betrachten, meinte er zum Kapitän, der ihn väterlich tröstete. Am zehnten Tag sahen sie am frühen Morgen die Silhouette von Boston, ein Lotse brachte den Frachter in den Hafen. »Nun bin ich in der Neuen Welt angekommen, in meiner neuen Heimat, ich werde mich mit neuen Umständen, vielen Zufällen auseinander zu setzen haben, in Gottesnamen soll es weitergehen.«
Sie würden wohl gegen zwei Wochen benötigen, meinte Kapitän Ohlsen, ein Däne mit langer Erfahrung auf See, vielleicht auch einige Tage dazu geben müssen, um die Krupp’schen Eisenräder für die Eisenbahnwaggons und die Lokomotiven auszuladen, welche auf der Boston & Lowell Railroad ihren Weg noch zu den Städten des unermesslichen Kontinents suchten. Über Lowell und Indianapolis wollten die amerikanischen Eisenbahnmagnaten hinauf nach Chicago und Milwaukee ihre Routen ziehen, erzählte Ohlsen und den Mittelwesten mit den wertvollen Hölzern, mit Erzen und Kohle beliefern. »Im Norden durch New Hampshire und Vermont beabsichtigen sie die Trassen bis nach Montreal, Quebec und Toronto zu spannen, dazu sind die nahezu unzerbrechlichen Eisenbahnräder des Deutschen Krupp unersetzlich und konkurrenzlos. Es gilt die unerschlossenen Kohlereviere in den Appalachen zu nutzen und die Kohlen in die Industriereviere des Ostens zu transportieren.«
Manfred Waldstein dachte an seinen Freund Georg Zupfer, der mittlerweile im Umland von Milwaukee seinen Neuanfang gewagt hatte, dessen Adresse er in seiner Tasche hatte, wie jene des Herrn von Strauß, der in Philadelphia sein Auskommen gefunden hatte.
Tausende Kilometer Schiene wären da zu verlegen, sinnierte der Mane Waldstein, da läge vielleicht eine Zukunft für ihn, der sich in der alten Heimat mit der neuen Technologie vertraut gemacht hatte. In diesen ersten Wochen nach der Ankunft fuhr er mit einem Pferdegespann hinaus in das Bostoner Umland, mit der Bahn hinauf nach Lowell im Norden, kam bis Worcester im Westen und hinunter in den Süden bis Providence und Warwick. Das Land faszinierte ihn und er teilte seine Eindrücke seiner Familie in der Heimat mit, die wohl längst schon auf ein neues Lebenszeichen von ihm wartete. Er erzählte tausend Einzelheiten und Kleinigkeiten, die er für interessant hielt.
Dann hatte die Kopenhagen im Bostoner Hafen ein riesiges Arsenal an mächtigen Baumriesen in ihren unersättlichen Bauch geladen, Weizen dazu und eine Vielfalt von Dingen, die anscheinend für die New Yorker unersetzlich waren. Der Zweite Ingenieur, ein blonder Ire, Brian McOwen aus Galway an der irischen Westküste, einer, der das Leben auf See nicht missen mochte, aber von ständigem, unerbittlichem Heimweh geplagt wurde, würde ihn in New York mitnehmen zu seinem Cousin, einem irischen Polizisten, der irgendwo in Queens in der 164sten Straße seinen Dienst versieht. »Steck’ ihre Adresse ein, man kann nie wissen, ob du sie nicht brauchst.«
»Vor einem Jahr haben sie in Queens begonnen, Straßenbahngleise zu legen mit einem Vierergespann schwerer Pferde vorne dran, eine vortreffliche Erfindung«, McOwen war total begeistert.
16
So waren die Racheengel aus den alten heiligen Büchern des jüdischen Volkes anzuschauen gewesen, Uriel, der Wütende, der Grimmige mit dem Flammenschwert und Gabriel, der strahlende Seraphim. Zwei gertenschlanke, anscheinend junge Männer mit schwarzem, lockigem Haupthaar traten auf die Bühne. Waren es Jünglinge, waren es gar junge Frauen, Rachegöttinnen? Manfred Waldstein war müde, saß auf dem harten Stuhl an einem knorrigen Tisch in einem Winkel im Benedetto, einer der italienischen Kneipen nicht weit vom Hafen gelegen, die diesem freundlichen, lautstarken Italiener gehörte, der ihn nun schon seit seiner Ankunft vertröstete: »Morgen bekommst du Arbeit, immer wieder kommen die Anwerber aus den Wäldern, die kräftige Burschen wie dich suchen zum Holzschlagen und die Eisenbahnagenten reißen sich um Leute wie dich, um junge Leute, die mit den Lokomotiven in Deutschland vertraut, aufgewachsen sind, in deinen Adern rollt Eisenbahnerblut, mein Sohn.«
Alfredo Benedetto brüllte vom Tresen her ein lautes »Attenzione« in den überfüllten, von dickem Pfeifenrauch geschwängerten Raum, »Attenzione, hört her, die beiden Mädchen haben euch was zu sagen.«
Es dauerte, bis er sich durchgesetzt hatte gegen die schreiende und grölende Bande. Benedetto brachte nur Eier mit Schinken oder ein kräftiges Steak mit gerösteten Kartoffelringen zu essen auf den Tisch und dazu ein jedem guten Geschmack abholdes bierähnliches Getränk, an dem die Meute sich im wahrsten Sinne des Wortes berauschte. Aber wenn es Mitternacht schlug von der Valentinskirche gegenüber, räumte er rigoros den stickigen, verqualmten Raum und warf auch den letzten der Gäste auf die Straße.
»Wir brauchen einen kräftigen Burschen für unsere Farm«, rief der strahlende Gabriel in die Stille, »unser Vater hat sich das Bein gebrochen, die Mutter steht allein auf dem Feld und im Stall und wir ziehen die Kleinen nebenher auf.«
»Wer traut sich diese harte Bauernarbeit zu, ein halbes Jahr müsste genügen«, sprach Uriel, furchtlos, endgültig und fordernd in die grölende Menge hinein, »wir bräuchten einen ganzen Kerl.«
Die Bande redete, schrie, fuchtelte mit den Händen und lachte und brüllte durcheinander. Das wären die besten und schönsten Anwerberinnen, die man sich an einem solchen Abend noch vorstellen könne. »Sucht euch einen der Flachlandindianer oder einen Schwarzen, genug davon gibt es doch«, schrie einer, der Waldstein gegenübersaß, torkelte auf die Mädchen zu, packte Gabriel an der Schulter