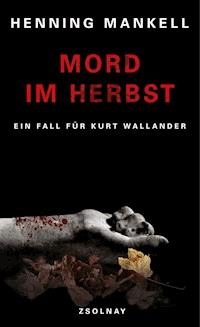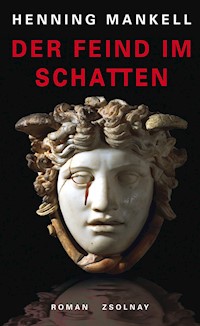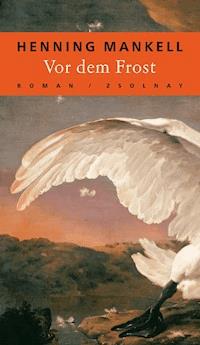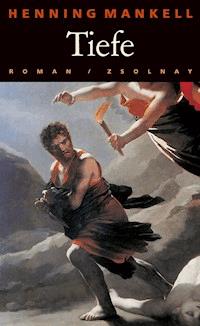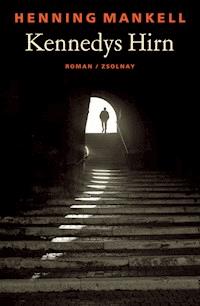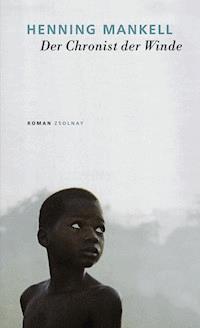
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nelio, ein zehnjähriges Straßenkind, erzählt um sein Leben. Er liegt mit einer Schusswunde auf dem Dach eines afrikanischen Hauses und weiß, dass er sterben wird, sobald seine Geschichte zu Ende ist. Er erzählt, wie die Banditen sein Dorf überfielen, seine Schwester massakrierten und ihn zwingen wollten, seine Verwandten zu töten. Wie er floh, den Weg in die große Stadt fand und Anführer einer Bande von Straßenkindern wurde. Vor allem aber erzählt er vom Leben dieser schwarzen Kinder.
Mankells Liebeserklärung an die Straßenkinder seiner afrikanischen Wahlheimat weicht der Wirklichkeit nicht aus und ist dennoch voller Hoffnung: ein Pakt der kindlichen und der poetischen Phantasie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zsolnay E-Book
HenningMankell
Der Chronist der Winde
Roman
Aus dem Schwedischen
von Verena Reichel
Paul Zsolnay Verlag
Die Originalausgabe erschien 1995 unter dem Titel Comédia infantil im Ordfront Verlag, Stockholm.
ISBN 978-3-552-05680-0
© Henning Mankell 1995
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2000
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
»Zwei Augen hat die Seel:
eins schauet in die Zeit,
Das andre richtet sich hin in die Ewigkeit.«
angelus silesius
»Wenn dies die beste aller Welten ist
wie müssen dann erst die anderen sein?«
voltaire: candide
»Da die Tiefen noch nicht waren,
da war ich schon geboren;
da die Brunnen noch nicht mit Wasser quollen …«
sprüche, 8, 24–25
José Antonio Maria Vaz
Auf einem Hausdach aus sonnengebranntem, rötlichem Lehm stehe ich, José Antonio Maria Vaz, in einer schwülen, feuchten Nacht und warte auf den Untergang der Erde. Ich bin schmutzig und fiebrig, meine Kleider hängen in Fetzen, als wären sie auf wilder Flucht vor meinem dürren Leib. In den Taschen habe ich Mehl, und das ist für mich kostbarer als Gold. Denn vor einem Jahr stellte ich noch etwas dar, ich war Bäcker, im Gegensatz zu heute, da ich nichts bin, ein Bettler, der tagsüber rastlos unter der sengenden Sonne umherstreift und die endlosen Nächte auf einem verlassenen Hausdach verbringt. Aber auch Bettler haben Zeichen, die ihnen eine Identität verleihen, sie von allen anderen unterscheiden, die ihre Hände an den Straßenecken feilbieten, als wollten sie sie weggeben oder ihre Finger verkaufen, einen um den andern. José Antonio Maria Vaz ist der zerlumpte Kerl, der bekannt wurde als Chronist der Winde. Tag und Nacht, ununterbrochen, bewegen sich meine Lippen, als würde ich eine Geschichte erzählen, die niemand je anzuhören bereit war. Es ist, als hätte ich schließlich akzeptiert, daß der Monsun, der vom Meer herantreibt, mein einziger Zuhörer ist, immer aufmerksam, geduldig wie ein alter Priester darauf wartend, daß das Bekenntnis schließlich zu einem Ende kommt.
In den Nächten nehme ich Zuflucht zu diesem verlassenen Dach, da ich meine, dort Überblick und Raum zu gewinnen. Die Sternbilder sind stumm, sie applaudieren mir nicht, aber ihre Augen funkeln, und ich habe das Gefühl, ich könnte direkt in das Ohr der Ewigkeit sprechen. Und wenn ich den Kopf neige, sehe ich, wie die Stadt sich ausbreitet, die Nachtstadt, wo unruhige Feuer flackern und tanzen, unsichtbare Hunde lachen, und ich staune über all die Menschen, die da schlafen, atmen und träumen und lieben, während ich auf meinem Dach stehe und von einem Menschen spreche, den es nicht mehr gibt.
Ich, José Antonio Maria Vaz, bin auch ein Teil dieser Stadt, die sich an den Steilhängen zur breiten Flußmündung hinab festklammert. Die Häuser klettern wie Affen an den Hängen empor, und mit jedem Tag scheinen sich die Menschen, die da wohnen, zu vermehren. Sie kommen aus dem unbekannten Inland, aus der Savanne und den fernen, abgestorbenen Wäldern zur Küste hinabgewandert, an der die Stadt liegt. Dort lassen sie sich nieder und bemerken scheinbar nicht all die feindseligen Blicke, die ihnen begegnen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wovon sie leben oder wo sie Unterschlupf finden. Sie werden von der Stadt verschluckt, werden ein Teil von ihr. Und jeden Tag kommen neue Fremde, alle mit ihren Bündeln und Körben, die hochgewachsenen schwarzen Frauen mit riesigen Stoffballen auf ihren majestätischen Köpfen, wie Reihen von kleinen schwarzen Punkten vor dem Horizont dahinwandernd. Mehr und mehr Kinder werden geboren, neue Häuser klettern die Hänge empor, um weggespült zu werden, wenn die Wolken schwarz sind und Orkane wie mörderische Banditen wüten. So geht es nun schon seit Menschengedenken, und viele Leute liegen nachts wach und grübeln, wie das wohl enden wird.
Wann wird die Stadt die Abhänge hinabstürzen und vom Meer verschlungen werden?
Wann wird das Gewicht all dieser Menschen zu schwer?
Wann wird die Erde untergehen?
Einst habe auch ich, José Antonio Maria Vaz, nachts grübelnd wach gelegen.
Aber jetzt nicht mehr. Nicht mehr, seit ich Nelio begegnet bin und ihn aufs Dach getragen habe und ihn sterben sah.
Die Unruhe, die mich früher manchmal überkam, ist jetzt vorbei. Besser gesagt, ich habe begriffen, daß es einen entscheidenden Unterschied macht, ob man Angst hat oder beunruhigt ist.
Auch das hat Nelio mir erklärt.
– Wenn man Angst hat, ist das, als würde man an einem unstillbaren Hunger leiden, sagte er. Ist man dagegen beunruhigt, leistet man der Unruhe Widerstand.
Ich erinnere mich an seine Worte, und heute weiß ich, daß er recht hatte. Mitunter stehe ich hier und schaue hinaus auf die nächtliche Stadt, die unruhig flackernden Feuer, und ich erinnere mich an alles, was er in den neun Nächten gesagt hat, die ich bei ihm war und ihn sterben sah.
Aber auch das Dach ist ein lebendiger Teil der Geschichte. Es ist, als befände ich mich auf dem Meeresgrund, ich bin gesunken und kann nicht tiefer kommen. Ich stehe auf dem Grund meiner eigenen Geschichte, hier, auf diesem Dach, hat alles angefangen, und hier hat es geendet.
Manchmal stelle ich mir genau das als meine Aufgabe vor: daß ich für immer auf dem Boden dieses Dachs herumwandere und meine Worte an die Sterne richte. Genau das ist meine Aufgabe, für immer.
Dies ist meine merkwürdige Geschichte, wie mir scheint, unmöglich zu vergessen.
Es war an jenem Abend, gegen Ende November, vor einem Jahr, als Vollmond war und der Himmel nach heftigen Regenfällen aufgeklart hatte, als ich Nelio auf die schmutzige Matratze legte, wo er neun Tage später, in der ersten Morgendämmerung, sterben sollte. Da hatte er bereits viel Blut verloren, der Verband, notdürftig hergestellt aus Stoffetzen, die ich aus meinen eigenen zerschlissenen Kleidern riß, half nicht viel. Lange vor mir wußte er, daß er bald nicht mehr dasein würde.
Damals hat auch alles von vorn angefangen, als wäre eine neue, besondere Zeitrechnung plötzlich in Kraft getreten. Das weiß ich noch ganz genau, obwohl seit diesem Abend über ein Jahr vergangen und viel passiert ist in meinem Leben.
Ich erinnere mich an den Mond am dunklen Himmel.
Ich erinnere mich an ihn als Widerschein von Nelios bleichem Gesicht, auf dem die salzigen Schweißtropfen glitzerten, während das Leben langsam, fast vorsichtig, als gelte es, einen Schlafenden nicht zu wecken, seinen Körper verließ.
An diesem frühen Morgen, nach der neunten Nacht, als Nelio starb, ist etwas Wichtiges zu Ende gegangen. Es fällt mir schwer zu erklären, was ich meine. Aber mitunter fühlt es sich in meinem Leben so an, als wäre ich von einer großen Leere umgeben. Als befände ich mich in einem riesigen Raum aus unsichtbarem Gewebe, aus dem ich mich nicht befreien kann.
So habe ich es an dem Morgen empfunden, als Nelio im Sterben lag, von allen verlassen, mit mir als einzigem Zeugen.
Später, als alles vorbei war, tat ich, worum er mich gebeten hatte.
Ich trug seinen Körper die Wendeltreppe hinab, in die Bäckerei, wo die Hitze so groß ist, daß ich mich nie daran gewöhnt habe.
Ich war allein dort in der Nacht, der große Ofen war heiß in Erwartung des Brotes, das bald für den hungrigen Tag gebacken werden sollte. Ich schob seinen Körper in den Ofen, schlug die Klappe zu und wartete genau eine Stunde. So lange würde es dauern, hatte er gesagt, bis sein Körper verschwunden wäre. Später, als ich die Klappe wieder öffnete, war nichts mehr übrig. Sein Geist wehte an mir vorbei, wie ein kühler Hauch aus der höllischen Hitze, und das war alles.
Ich ging zurück aufs Dach. Dort blieb ich, bis es wieder Nacht wurde. Und da, unter den Sternen und der kaum sichtbaren dünnen Mondsichel, während der milde Wind vom Indischen Ozean mir das Gesicht fächelte, inmitten der Trauer, wurde mir bewußt, daß ich es war, der Nelios Geschichte erzählen mußte.
Kein anderer könnte es tun.
Keiner außer mir. Niemand.
Und die Geschichte mußte erzählt werden. Sie durfte nicht einfach als abgelegtes und friedloses Erinnerungsbild in der Rumpelkammer liegenbleiben, die es in jedem menschlichen Gehirn gibt.
Denn es war ja so: Nelio war nicht nur ein armes, schmutziges Straßenkind gewesen. Er war vor allem ein bemerkenswerter Mensch, ungreifbar, vieldeutig, wie ein seltener Vogel, von dem alle reden, obwohl ihn nie jemand wirklich gesehen hat. Obwohl er erst zehn Jahre alt war, als er starb, verfügte er über eine Erfahrung und Lebensweisheit, als hätte er hundert Jahre gelebt. Nelio – wenn er denn tatsächlich so hieß, mitunter nannte er sich nämlich ganz anders – umgab sich mit einem unsichtbaren magnetischen Feld, das niemand durchdringen konnte. Von allen – sogar von den brutalen Polizisten und den unentwegt nervösen indischen Händlern – wurde er mit Ehrerbietung behandelt. Viele suchten seinen Rat oder hielten sich nur vorsorglich in seiner Nähe auf, in der Hoffnung, etwas von seinen geheimnisvollen Kräften würde sich auf sie übertragen.
Und jetzt war Nelio tot.
Tief im Fieber versunken hatte er mühsam seinen letzten Atemzug ausgeschwitzt.
Eine einsame Dünung hatte sich über die Weltmeere fortgepflanzt, dann war alles vorüber, und die Stille erschrekkend in ihrer Leere. Ich sah zum Firmament auf und dachte, nichts würde mehr so sein, wie es war.
Ich wußte, was viele dachten. Ich hatte es selbst gedacht. Daß Nelio eigentlich kein Mensch war. Sondern ein Gott. Einer der alten, vergessenen Götter, die trotzig oder vielleicht tollkühn auf die Erde zurückgekehrt waren und sich in Nelios mageren Körper geschlichen hatten. Oder, wenn schon kein Gott, so war er wenigstens ein Heiliger. Ein Straßenkindheiliger.
Und jetzt war er tot. Fort.
Der milde Wind vom Meer, der über mein Gesicht strich, fühlte sich plötzlich kalt und bedrohlich an. Ich sah hinaus auf die dunkle Stadt, die an den Hängen zum Meer hinabkletterte, sah die flackernden Feuer und die vereinzelten Straßenlaternen, von Faltern umtanzt, und dachte: Hier hat Nelio eine kurze Zeit gelebt, mitten unter uns. Und ich bin der einzige, der seine ganze Geschichte kennt. Mir hat er sich anvertraut, nachdem man auf ihn geschossen hatte und ich ihn aufs Dach getragen und auf die schmutzige Matratze gelegt hatte, von der er sich nicht mehr erheben sollte.
– Es ist nicht, weil ich Angst habe, man könnte mich vergessen, hatte er gesagt.
Es ist, damit ihr nicht vergeßt, wer ihr selber seid.
Nelio hat uns daran erinnert, wer wir eigentlich sind. Menschen, von denen ein jeder heimliche Kräfte besaß, die er nicht kannte. Nelio war ein bemerkenswerter Mensch. Seine Anwesenheit bewirkte, daß wir uns bemerkenswert fühlten.
Das war sein Geheimnis.
Es ist Nacht am Indischen Ozean.
Nelio ist tot.
Und wie unwahrscheinlich es auch klingen mag, mir schien, daß er nicht einmal Angst hatte beim Sterben.
Wie ist das möglich? Daß ein Zehnjähriger stirbt, ohne auch nur einen Funken Entsetzen darüber zu zeigen, daß er nicht mehr teilhaben kann am Leben?
Das verstehe ich nicht. Überhaupt nicht.
Ich, ein Erwachsener, kann nicht an den Tod denken, ohne eine eisige Hand an meiner Kehle zu spüren.
Aber Nelio lächelte nur. Offenbar hatte er doch ein Geheimnis, das er nicht mit uns anderen teilte. Das ist sonderbar, denn er war sehr freigebig mit den wenigen Dingen, die er besaß, ob es die schmutzigen Hemden aus indischer Baumwolle waren, die er immer trug, oder einer seiner immer wieder überraschenden Gedanken.
Daß es ihn nicht mehr gibt, nehme ich als Zeichen, daß die Erde bald untergehen wird.
Oder täusche ich mich?
Ich stehe auf dem Dach und denke an das erste Mal, als ich ihn sah, als er auf dem schmutzigen Boden lag, getroffen von den Kugeln des verwirrten Mörders.
Der sanfte Nachtwind, der vom Meer herantreibt, hilft mir, mich zu erinnern.
Nelio hat oft gefragt:
– Spürst du, wonach der Wind schmeckt?
Ich wußte nie, was ich antworten sollte. Kann der Wind wirklich einen Geschmack haben?
Nelio war davon überzeugt.
– Geheimnisvolle Gewürze, sagte er plötzlich, ich glaube, es war in der siebten Nacht. Sie erzählen uns von Ereignissen und Menschen in weiter Ferne. Die wir nicht sehen können. Aber wir können sie spüren, wenn wir den Wind tief in unseren Mund einsaugen und ihn dann essen.
So war Nelio. Er glaubte, der Wind ließe sich essen.
Der Wind könnte den Hunger betäuben.
Und wenn ich versuche, mir in Erinnerung zu rufen, was ich in den neun Nächten mit Nelio gehört habe, kann ich mir vorstellen, daß mein Gedächtnis weder besser noch schlechter ist als das von irgend jemand anders.
Aber ich weiß auch, daß ich in einer Zeit lebe, in der die Menschen öfter das Vergessen suchen als die Erinnerung. Daher verstehe ich auch meine eigene Furcht besser, daß es tatsächlich der Untergang der Erde ist, den ich erwarte. Der Mensch lebt, um etwas zu schaffen und seine guten Erinnerungen mit anderen zu teilen. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, sehen wir ein, daß die Zeit dunkel ist, genauso dunkel wie die Stadt zu meinen Füßen, die Sterne leuchten widerwillig über unserer verschandelten Erde, und die Erinnerungen an schöne Erlebnisse sind so rar, daß die großen Räume in unserem Gehirn, in denen ihr Gedächtnis bewahrt werden soll, leer und verriegelt sind.
Eigentlich komisch, daß ich das sage.
Ich bin kein Schwarzmaler. Ich lache viel öfter als ich weine.
Auch wenn ich heute ein Bettler in Lumpen bin, habe ich in meinem Leib das fröhliche Herz des Bäckers bewahrt.
Ich merke, daß es mir schwerfällt zu erklären, was ich meine. Hat man wie ich seit seinem sechsten Lebensjahr in einer heißen, stickigen Bäckerei Brot gebacken, ist es mit den Worten nicht so leicht.
Eine Schule habe ich nie besucht. Ich habe in alten, zerrissenen Zeitungen lesen gelernt. Oft so alt, daß die Stadt, von der da die Rede war, noch ihren früheren, heute abgeschafften Kolonialnamen trug. Ich lernte lesen, während wir darauf warteten, daß das Brot in den Öfen durchgebacken war. Es war der alte Meisterbäcker, Fernando, der es mir beigebracht hat. Ich kann mich noch ganz genau an all die Nächte erinnern, in denen er darüber schimpfte und fluchte, daß ich so faul sei.
– Die Buchstaben und Worte kommen nicht zu einem Menschen, seufzte er. Der Mensch muß zu ihnen kommen.
Aber schließlich habe ich es gelernt. Ich habe gelernt, mit Worten umzugehen, wenn auch auf Distanz und immer mit dem Gefühl, ihrer nicht ganz würdig zu sein.
Noch immer sind die Worte Fremde für mich. Zumindest, wenn ich erzählen will, was ich denke oder fühle. Aber ich muß es versuchen. Ich kann nicht länger warten. Ein Jahr ist bereits vergangen.
Noch habe ich nicht von dem blendend weißen Sand erzählt, den raschelnden Palmen und den Haien, die man mitunter dicht an der verwitterten Hafenmauer sehen kann.
Aber das werde ich später tun.
Jetzt will ich von Nelio sprechen, dem Bemerkenswerten. Er, der aus dem Nirgendwo in die Stadt kam. Er, der sich in einem Standbild einquartierte, das vergessen auf einem Platz in der Stadt thronte.
Und genau hier kann ich meine Geschichte beginnen lassen.
Alles beginnt mit dem Wind, dem geheimnisvollen, verlockenden, der vom ewig wandernden Indischen Ozean in unsere Stadt hineintreibt.
Ich, José Antonio Maria Vaz, ein einsamer Mann auf einem Dach, unter dem tropischen Sternenhimmel, habe eine Geschichte zu erzählen.
Die erste Nacht
Als in dieser verhängnisvollen Nacht die Schüsse fielen und ich Nelio in seinem eigenen Blut fand, hatte ich bereits viele Jahre in der Bäckerei der konfusen und wunderlichen Dona Esmeralda gearbeitet. Keiner hatte es so lange ausgehalten wie ich.
Dona Esmeralda war eine erstaunliche Frau, die jeder in der Stadt kannte und sie entweder insgeheim bewunderte oder für verrückt erklärte. Als Nelio ohne ihr Wissen auf dem Dach der Bäckerei im Sterben lag, war sie über neunzig Jahre alt. Manche behaupteten, sie wäre schon hundert, aber keiner konnte es mit Sicherheit sagen. Von Dona Esmeralda ließ sich einzig mit Gewißheit sagen, daß nichts sicher war. Es schien, als wäre sie schon immer dagewesen, untrennbar mit der Stadt und deren Gründung verbunden. Es konnte sich auch niemand daran erinnern, daß sie je jung gewesen wäre. Seit jeher hatte sie ihr altes Auto in hohem Tempo gefahren, mit offenem Verdeck, mal auf der einen, mal auf der anderen Straßenseite. Ihre Kleider waren seit eh und je aus flatternder Seide, ihre Hüte mit breiten Bändern unter dem runzligen Kinn festgebunden. Aber obwohl sie schon immer sehr alt gewesen war, erklärte man den Fremden, die sich gerade noch retten konnten, wenn sie in wilder Fahrt angerast kam, sie sei die jüngste Tochter des berüchtigten Gouverneurs Dom Joaquim Leonardo dos Santos, der während seines skandalumwitterten Lebens unter anderem die Plätze im Zentrum der Stadt mit einer Vielzahl von Reiterstandbildern bevölkert hatte. Über Dom Joaquim kursierten zahllose Geschichten, nicht zuletzt über die beachtliche Anzahl von unehelichen Kindern, die er hinterlassen hatte. Mit seiner Frau, der vogelartigen Dona Celestina, hatte er drei Töchter gehabt, wovon Esmeralda diejenige war, die ihm am meisten glich, wenn nicht im Aussehen, so doch in der Art. Dom Joaquim stammte aus einer der ältesten Kolonialfamilien, die Mitte des 19. Jahrhunderts von der anderen Seite des Meeres herüberkam. Seine Familie war innerhalb kürzester Zeit eine der mächtigsten im Land geworden. Dom Joaquims Brüder hatten sich wichtige Positionen verschafft, teils durch das Schürfen von Edelsteinen in den fernen Provinzen, teils als Großwildjäger, Prälaten und Militärs. Dom Joaquim selbst hatte sich bereits in jungen Jahren auf das unübersichtliche Terrain der lokalen Politik begeben. Da das Land als Provinz von einer Macht jenseits des Meeres regiert wurde, hatten die Gouverneure vor Ort mehr oder weniger freie Hand, es konnte ohnehin keiner kontrollieren, was sie trieben. In den wenigen Fällen, in denen das Mißtrauen überhand nahm, schickte man Regierungsbeamte über das Meer, um nachzuprüfen, was da in der kolonialen Verwaltung eigentlich vorging. Einmal hatte Dom Joaquim das Büro der Kontrolleure mit Schlangen gefüllt, ein andermal eine Gruppe von wilden Trommlern in einem benachbarten Haus einquartiert, worauf die Regierungsbeamten entweder durchdrehten oder in tiefes Schweigen versanken, um dann so schnell wie möglich das nächste Schiff zu besteigen, das gen Europa segelte. In ihren Berichten hieß es dann stets, in der Kolonie stehe alles zum Besten, und zur Bekräftigung hatte Dom Joaquim ihnen kleine Stoffbeutel mit Edelsteinen in die Taschen gesteckt, wenn er sie am Kai verabschiedete. Als Dom Joaquim zum erstenmal bei einer Regionalwahl zum Stadtgouverneur gemacht wurde, war er kaum älter als zwanzig Jahre. Sein Gegner, ein freundlicher, gutgläubiger alter Oberst, hatte sich aus dem Wahlkampf zurückgezogen, nachdem Dom Joaquim sehr geschickt das Gerücht in Umlauf gebracht hatte, der Mann sei in seiner Jugend, als er noch jenseits des Meeres lebte, für ein nicht näher benanntes Verbrechen bestraft worden. Obwohl die Anschuldigungen falsch waren, erkannte der Oberst, daß er gegen die Verleumdungen nicht ankommen würde, und gab auf. Wie bei allen anderen Wahlen war auch hier der Wahlbetrug die unabdingbare organisatorische Voraussetzung gewesen, und er war mit einer Mehrheit gewählt worden, die bei weitem die Gesamtzahl der damals registrierten Stimmberechtigten überschritt. Der wichtigste Bestandteil seines Wahlprogramms war das Versprechen gewesen, die lokalen arbeitsfreien Feiertage erheblich zu vermehren, was er dann auch sofort realisierte, nachdem er eingesetzt worden war und sich zum erstenmal auf der Treppe der Residenz zeigte, auf dem Kopf den dreieckigen, mit Federbusch geschmückten Hut, das höchste Zeichen seiner neuen, demokratisch erworbenen Würde. Dom Joaquims erste Maßnahme als frisch gewählter Gouverneur war, daß er an der Vorderfront der Residenz einen großen Balkon errichten ließ, von dem aus er bei geeigneten Gelegenheiten Reden an die Bevölkerung der Stadt halten konnte. Einmal gewählt, sorgte er umsichtig dafür, daß ihm niemand seine Gouverneurswürde streitig machte, und in den folgenden sechzig Jahren wurde er mit immer größeren Mehrheiten wiedergewählt, obwohl die Bevölkerung in dieser Zeit erheblich zurückging. Als er schließlich starb, hatte er sich jedoch lange nicht mehr öffentlich gezeigt. Da war er bereits so verwirrt und so tief im Dämmer des Alters versunken, daß er mitunter glaubte, er wäre schon gestorben, und nachts schlief er dann in einem Sarg, der neben dem breiten Bett im Gouverneurspalast aufgestellt war. Niemand hatte jedoch den Mut gehabt, ihn als Gouverneur in Frage zu stellen, alle hatten ihn gefürchtet, und als er endlich gestorben war, halb aus seinem Sarg hängend, als hätte er ein letztes Mal auf den Balkon kriechen wollen, um auf die Stadt hinauszusehen, die sich in den vielen Jahren seiner Macht bis zur Unkenntlichkeit verändert hatte, hatte niemand etwas zu unternehmen gewagt, bis er nach einigen Tagen in der großen Wärme zu riechen begann.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: