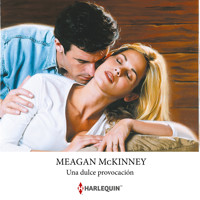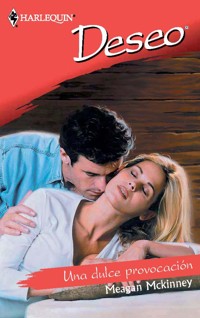4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
FBI-Spezialagent Liam Jameson stolpert in einer Zeitung über eine seltsame Anzeige. Offenbar sucht eine Frau namens Zoe einen Auftragskiller. Jamesons Nachforschungen führen ihn zu Claire Green. Die junge New Yorker Anwältin weiß, wer Zoe ist: Hinter dem Namen verbirgt sich eine selbsternannte Selbsthilfegruppe für Opfer ungesühnter Gewaltverbrechen. Frauen, die Rache wollen.
Claire ist entsetzt, als sie erfährt, dass diese Gruppe den Tod ihrer Schwester rächen will und in ihrem Namen einen Killer beauftragt hat. Claire bleibt nur eines, um den Wahnsinn zu stoppen: Sie muss den Mörder ihrer Schwester finden, bevor der Killer ihn aufspürt. Heimlich folgt Jameson ihr nach New Orleans - und bringt Claire damit in tödliche Gefahr ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Eine Vorbemerkung der Autorin
Danksagung
Vorwort
Tulsa, heute
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Epilog
Über dieses Buch
Gesucht: Ein Mann, der Drachen tötet
Zuschriften an Zoe, Postfach 5671
So lautet der Anzeigentext in einer Zeitung. Für FBI-Spezialagent Liam Jameson ist ganz klar: Wer immer Zoe ist, sie sucht einen Auftragskiller. Die Spur seiner Nachforschungen führt Jameson zu Claire Green, einer jungen New Yorker Anwältin. Claire weiß, wer – oder vielmehr was – Zoe ist: Eine Selbsthilfegruppe für Opfer ungesühnter Gewaltverbrechen, Frauen, die Rache wollen. Claire ist entsetzt, als sie erfährt, dass als nächstes der Tod ihrer Schwester gerächt werden soll. Der Killer ist beauftragt, in Claires Namen. Ihr bleibt nur eines, um den Wahnsinn zu stoppen: Sie muss den Mörder ihrer Schwester finden, bevor der Killer ihn aufspürt. Liam Jameson folgt Claire nach New Orleans, ohne zu ahnen, was die junge Frau plant und in welche Gefahr er sie und sich damit bringt …
Über die Autorin
Meagan McKinney hat ihre Karriere als Biologin aufgegeben, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Sie lebt mit ihrer Familie in New Orleans und schreibt nicht nur historische Liebesromane, sondern auch packende Thriller.
MEAGAN McKINNEY
Der Club der Rächerinnen
Aus dem Englischen von Hedda Pänke
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
© Copyright 1997 by Ruth GoodmanOriginaltitel: A MAN TO SLAY DRAGONSPublished by Arragement with Kensington Publishing Corp., 850 ThirdAvenue, New York, NY 10022
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Nattika | Lava 4 imageseBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3886-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Eine Vorbemerkung der Autorin
Dieses Buch wurde vor der Tragödie in Oklahoma City geschrieben. Meine Beschäftigung mit paramilitärischen Organisationen und »Überlebenskämpfern« brachten mich zu der Überzeugung, dass diese Gruppierungen eine ernste Gefahr darstellen – weniger wegen ihrer pathologischen Ideologien als vielmehr durch die Tatsache, dass die US-amerikanische Öffentlichkeit sie kaum zur Kenntnis nahm. Während der Arbeit an diesem Roman sah ich mich wieder und wieder gezwungen, Aufbau und Ziele dieser Gruppierungen zu erläutern, die ich so besorgniserregend fand, von denen sonst aber noch niemand etwas gehört hatte.
Inzwischen sind sie den Amerikanern bedauerlicherweise sehr bekannt. Ich fordere alle meine Leser dringend dazu auf, den US-Congress bei seinen Anstrengungen zu unterstützen, weitere terroristische Anschläge zu verhindern.
Meagan McKinneyNew Orleans
Danksagung
Meinen Dank allen, die dieses Buch ermöglicht haben: Pamela Ahearn, meine wunderbare Agentin, Denise Little, eine großartige und sehr geduldige Lektorin, sowie alle Juristen und Juristinnen neben Claire Green. Dank an Donna Green, Rose Marie Falcone, Barbara Bennett, Rick Schroeder und meinen Mann Tom. Sie alle beweisen, dass es da draußen Hüter der Gesetze gibt. (Und wir brauchen nicht einmal nach ZOE zu rufen.)
Für Richard John Lafayette Roberson– meinen kleinen Helden.Mögest du stets die Drachen töten.
Jeder, der sich nicht sorgt, möglicherweise ein Ungeheuerzu sein ...ist eines.
Robert Ruthven
Vorwort
Es gibt eine Million Wege, seine Kindheit wieder zu erleben. Liam Jameson erlebte sie in seinen Träumen wieder. Seligen Träumen mit glücklichem Ausgang. Revisionistischen Träumen. Schmerzlichen, bittersüßen Träumen. Träumen davon, wie es gewesen war und wie es hätte sein sollen. Niemals die Alpträume von dem, was war.
Stets kehrte er nach Oklahoma zurück. Dann war es für ihn wieder 1969, dieser außerordentliche Sommer, in dem Neil Armstrong den ersten Schritt auf den Mond getan hatte. Wieder und wieder träumte Liam von dieser Mondlandung. Genau wie alle anderen amerikanischen Jungen hatte er damals spontan beschlossen, Astronaut zu werden.
Armstrong war ein Held. Daran gab es nichts zu deuteln. Ein Astronaut, der den ersten Schritt auf dem Mond machte, war ein mutiger Mann. Ganz gleich, was man über die atemberaubenden Kosten eines Mondfluges und dessen letztendliche Sinnlosigkeit sagte, die später der NASA anhingen. In den Annalen der Geschichte war Neil Armstrong unantastbar. Er war, was jeder Junge werden wollte. Er war der Inbegriff des Guten, Hehren, Tapferen. Er war ein Held, und keiner, niemand auf der ganzen Welt, konnte das bestreiten.
»Ich bin ein Held, Liam.« Mit diesen Worten hatte ihn einmal der zwölfjährige Joey Ableman auf seinem funkelnagelneuen Stingray-Fahrrad umkreist, um sich dann genüsslich auf dem leuchtend orangefarbenen Bananensitz zurückzulehnen.
»Himmel, jeder hätte dieses Baby vor dem Ertrinken retten können. Das ist doch ein Kinderspiel. Ich hätte es auch getan, wenn ich dort gewesen wäre.« Liam wedelte den vom kreisenden Rad aufgewirbelten Staub fort und bedachte Joey mit einem wegwerfenden Schulterzucken. Aber Joey war tatsächlich ein Held, und er war ziemlich beeindruckt. Gestern hatten sich die Einwohner von Taylorville zu einer kleinen Feier für Joey versammelt, und der Bürgermeister hatte dem Jungen ein neues Fahrrad übergeben. Joeys Foto war auf Seite eins der heutigen Ausgabe der Town Talk. »Der vaterlose Joey Ableman ist der Held des Sunrise Trailer Park«, stand darunter, und in einem kleinen Bericht wurde der Heldenmut gerühmt, mit dem er in den Catmine Creek gesprungen war, um ein zweijähriges Mädchen aus dem Wasser zu ziehen, das heimlich den Wohnwagen verlassen hatte, während seine Mutter schlief.
Yep. Es ließ sich nicht leugnen. Sein bester Freund Joey Ableman war ein Held, das stand sogar in der Zeitung. Und so ungern es Liam auch zugab, er war beeindruckt. Verdammt beeindruckt. Er war nun schon fast dreizehn Jahre auf der Welt, aber noch nie einem Helden von Angesicht zu Angesicht begegnet.
»Lässt du mich auch mal darauf fahren?« Liams Stimme kiekste, der Fluch der Pubertät. Er starrte das Stingray an, auf dem Joey seine Runden drehte. Es war ein wirklich tolles Rad, aber Liam wusste, dass er es nicht so verdiente wie Joey. Er war kein Held, er war nur mit einem Helden befreundet. Aber vielleicht wäre diese Freundschaft für eine kleine Proberunde auf dem Rad gut.
»Kannst du das?« Joey trat in die Pedale und raste auf der Straße davon, die geradewegs nach Tulsa führt. In einiger Entfernung stoppte er ab, wendete, kam mit halsbrecherischer Geschwindigkeit wieder zurück, schnell genug, um über das riesige Schlagloch hinwegzusetzen, das den Eingang zum Sunset Trailer Park markierte.
»Vielleicht schaffe ich es, wenn du mir die Chance dazu gibst ...«
»Liam! Liam! Komm sofort her, Junge, und hilf deinem Pa! Er muss gleich zur Schicht.«
Liam blickte sich zu seiner Mutter um. Sie stand hinter der Gazetür ihres schäbigen, unkrautumwucherten mobilen Heims. Sie soll einmal sehr hübsch gewesen sein. Eine richtige irische Rose, hatte sein Vater gesagt – vor den sieben Kindern und den Sechzehn-Stunden-Tagen in der Fleischverarbeitungsfabrik. Jetzt konnte Liam an seiner Mutter nichts mehr von einer irischen Rose entdecken. Moira Jameson sah aus wie die meisten anderen Frauen im Sunset Trailer Park: mit einer schmuddeligen Kittelschürze, ständig irgendein Baby auf der Hüfte und mit erschöpftem, lustlosem Gesichtsausdruck.
»Ich muss los, Joey. Vielleicht können wir uns nach dem Abendessen beim Wasserloch treffen, wenn ich mich davonschleichen kann, ja?«
»Klar.« Joey stoppte das Rad und sah Liam fast bedauernd an. Vermutlich macht selbst ein neues Stingray-Rad keinen großen Spaß, wenn man damit nicht vor anderen protzen kann, nahm Liam an.
Folgsam ging Liam in den Wohnwagen. Die Vorwürfe seiner Mutter überfielen ihn wie das Krächzen einer gereizten Krähe. »Liam! Dieses Hemd habe ich gerade für dich gebügelt, Junge! Musstest du es dir denn sofort wieder zerknittern? Ihr Kinder seid noch mein Tod. Jetzt hilf endlich deinem Pa. Hol die Brotbüchse und sieh nach, ob noch etwas Spam in der Eisbox ist.«
Nach dem strahlenden Sonnenschein draußen war es im Trailer nahezu dunkel. Flüchtig sah Liam durch die Gazetür hinaus. Das helle Rechteck gab den Blick auf die grünen Maisfelder direkt hinter dem Trailer Park frei. Eine geteerte Straße durchschnitt die Landschaft, und an ihrem Ende radelte Joey auf seinem neuen Stingray.
Das Bild war wie eine Filmszene, betrachtet aus dem Dunkel eines Kinos. Liam fand es wunderschön. Später, als Erwachsener, würde es für ihn so ähnlich sein wie ein Titelblatt der Saturday Evening Post. Grüne Felder, ein Junge, ein neues Rad. Amerika.
Joey Ableman ist ein wirklicher Held, dachte er, als er durch den düsteren, überfüllten Wohnwagen lief. Er hat für sein heldenhaftes Verhalten ein nagelneues Rad und ein Foto in der Zeitung bekommen. Liam wünschte sich an Joeys Stelle. Er wusste, dass er das Johnson-Baby auch gerettet hätte, wäre er rechtzeitig dort gewesen. Dann wäre auch er ein Held gewesen. Aber da sich ihm diese Chance nicht geboten hatte, war er auf eins stolz: Der gefeierte Held von Taylorville, Joey Ableman, war sein allerbester Freund auf der Welt.
»Bist du ein Held, Pa?«, fragte er, während er nach dem Weißbrot und French’s Senf griff.
Neben der kleinen Küche stand sein Vater im winzigen Bad vor dem beschlagenen Spiegel und rasierte sich verschlafen das Kinn.
»War nie so ein Held wie Joey, Junge. Tut mir leid.«
Liam strich gelben Senf auf zwei Brotscheiben und runzelte nachdenklich die Stirn. Diese Heldengeschichte machte irgendwie keinen Sinn. Selbstverständlich war Patrick Jameson ein Held. Er war sein Dad. Der großartigste Mann, den er kannte. Irgendwann in seinem Leben musste er doch etwas Heroisches getan haben.
»Du hast niemals irgendjemanden gerettet?« Liam klappte die beiden Brotscheiben zusammen, wickelte sie in Wachspapier und stopfte sie in die angeschlagene Brotbüchse seines Vaters.
»Nope. Nie, Junge.« Jameson trocknete sich das Gesicht mit einem Handtuch ab und schlüpfte in das Hemd, das neben dem Bügelbrett hing, das die Küche blockierte. Im Trailer war es erstickend heiß, aber in dem frischgewaschenen, gestärkten Hemd wirkte sein Vater adrett und wie aus dem Ei gepellt. »Wenn du ein Held wie Joey sein willst, nur zu, Junge. Du kannst Polizist werden wie dein Onkel Kenny in Boston und jeden Tag Menschen retten.«
»Onkel Kenny war Polizist?«
»Yep.«
»Und ein Held?«
»Yep.«
Liam reichte seinem Vater die Brotbüchse. Die Kinder bauten sich in Reih und Glied auf, wie immer, wenn Dad zu seiner Nachtschicht ging.
»Und jetzt seid alle brav und helft eurer Ma. Ich habe euch sehr lieb«, sagte Jameson ernst. Er küsste sie der Reihe nach auf die Stirn und hob sich den letzten Kuss für seine Frau auf. »Ich werde ein paar Überstunden für diese Klimaanlage einlegen, also wird es Mittag werden, bis ich wieder da bin.«
Liams Mutter nickte resigniert.
Durch die Gazetür sah Liam zu, wie sein Vater in den alten Dodge-Pickup sprang, die Brotbüchse neben sich auf den abgewetzten Sitz legte und unter einer Staubwolke den Trailer Park verließ. Der Pickup bog nach links ab. Rechts drehte Joey auf seinem Stingray weiter seine Runden im schwülheißen Sommerabend von Oklahoma.
Tulsa, heute
Stöhnend wurde Special Agent Liam Jameson wach. Sein Oberkörper im Schlafsack war schweißüberströmt. Der tarnfarbene Stoff klebte an seiner Haut. Er rutschte hoch und setzte sich auf. Sein Atem ging in schnellen, unregelmäßigen Stößen.
Er sah sich in der Hütte irgendwo in den abgelegenen Weiten von Utah um. Überall um ihn herum schliefen Männer – auf Pritschen, in Schlafsäcken, manche auch, die Arme um ein Kissen geschlungen, auf dem nackten Boden. Wären da nicht die Tätowierungen und automatischen Waffen gewesen, hätte man die Unterkunft für ein Lager der Heilsarmee halten können. Diese Burschen waren nur Abschaum, und er hatte es weiß Gott satt, mit Abschaum zusammen zu sein und sich wie Abschaum zu verhalten. Nur gut, dass morgen die ATF-Razzia stattfand. Ein weiterer Fall von irregeleiteten Überlebenskämpfern, und er war sicher, dass er diesmal den Bastard einfach umbringen würde.
Das würde ihn nicht für alle zum Helden machen. Ganz sicher nicht beim FBI.
Er lehnte sich gegen die Wand und spürte den kühlen, rissigen Putz an der Haut. In einer Ecke des Raumes stöhnte ein Mann. Denny. Der Junge war ins Bein geschossen worden. Aber wenn man zum entscheidenden Gefecht zum Beweis der weißen Überlegenheit entschlossen war, brachte man keinen Mann mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus. So litt Denny in der Ecke vor sich hin, phantasierte im Fieber und war zu betrunken, um sich irgendwelche Sorgen um sein Bein zu machen. Wahrscheinlich würde er sterben, doch das scherte niemanden. Die Mistkerle machten unverdrossen weiter, verschanzten sich in ihrem Lager und planten den Untergang für alle Schwarzen, Latinos oder Koreaner. Es entbehrte nicht der Ironie, dass der einzige, der sich Gedanken darüber machte, ob der Bursche starb oder nicht, ausgerechnet der war, der ihn überhaupt in diese Lage gebracht hatte.
Er hätte nicht auf ihn schießen sollen. Noch immer konnte sich Liam nicht genau an den Zwischenfall erinnern. Denny hatte die .45er gezogen. Bei der Auseinandersetzung war es um die Frage gegangen, wohin die Kinder des Lagers im Fall eines Angriffs gebracht werden sollten. Vermutlich war alles nur das übliche Macho-Getue gewesen. Wahrscheinlich hatte sich Denny gar nichts dabei gedacht, als er die Waffe zog und auf ihn richtete. Aber angesichts der Mündung vor seinem Gesicht sah Liam rot. Er streckte die Hand nach der Waffe aus und drückte sie zur Seite. Denny machte einen Sprung vorwärts, und Liam schoss auf ihn. Er zog einfach den Abzug und sah zu, wie der Bastard zu seinen Füßen zusammenbrach.
Für einen Undercover-Agenten passte er sich den Gegebenheiten im Lager hervorragend an. Er konnte einen Durchgedrehten besser markieren als jeder andere, und manchmal beunruhigte es ihn schon, wie viel Befriedigung er bei diesen Leuten fand. Er gehörte zum FBI und hätte ein Held sein sollen. Stattdessen waren seine Leistungen am besten, wenn er sich verhielt wie ein Stück Dreck.
Heldentum ist ohnehin eine mehr als fragwürdige Sache, dachte er und ignorierte Dennys Stöhnen. Es brachte einem selten etwas ein. Anständige Jungs behielten nahezu nie die Oberhand. Er dachte an seinen Traum und seinen Vater. Patrick Jameson war an Koronarthrombose gestorben, lange bevor sein Sohn als Jahrgangsbester die FBI-Akademie in Quantico beendete, aber selbst jetzt noch erinnerte sich Liam an die Mühen, die sein Vater für die Familie auf sich nahm: Wie er nach einer langen Schicht todmüde nach Hause kam, aber seine nach rohem Fleisch riechenden Kleidungsstücke in einen besonderen Sack stopfte, damit sie seine Mutter so zum Waschsalon tragen konnte, ohne dass sie sich Maden holten, wie er sich stets sorgfältig duschte, bevor er ins Bett fiel. Liam erinnerte sich auch an die obligatorische Aufstellung der Kinder an der Trailer-Tür, wenn sein Vater zu einer neuen Schicht aufbrach, und dass es noch immer wehtat, an Patrick Jamesons knappes, aber unvermeidliches »Ich habe euch lieb« zu denken.
Liam wischte sich mit dem Arm den Schweiß von der Stirn. Er hatte wieder den alten Traum geträumt. Den von Joey und dem Stingray. Wie er sich danach sehnte, Kineson’s Müllhalde verlassen und ein Bier in seinen alten Stammkneipen trinken zu können, ohne sich um irgendwelche verrückten Überlebenskämpfer kümmern zu müssen, die sich für Rächer der angeblich bedrohten weißen Rasse hielten. Wenn sie herausbekamen, dass er ein Agent war, würden sie ihm mit einer M-16 den Schädel wegfetzen.
Es war mehr als absurd. Er befand sich als verdeckter Ermittler in einem paramilitärischen Lager, wartete auf die Morgendämmerung und darauf, dass ATF-Leute und der Rest seines FBI-Teams angreifen würden, aber er träumte von ’69 und Joey Ablemans neuem Stingray.
Liam atmete tief durch und lehnte den Kopf wieder gegen die Wand. Er verabscheute diesen Traum. Er endete stets damit, dass Joey in der Ferne radelte, die Sonne sank und sein Vater in die andere Richtung fuhr, zur Fleischfabrik.
Vermutlich musste er dankbar dafür sein, nie vom Rest des Tages zu träumen. Oder der Nacht, besser gesagt. Von dem Sirenengeheul gegen Mitternacht und davon, wie Mrs. Porter, die Eigentümerin des Trailer Parks, in ihre Schürze schluchzte. Oder vom folgenden Morgen und den schwarzen Leichensäcken, die aus dem Wohnwagen der Ablemans getragen wurden. Joey war tot, wie seine große Schwester und seine Mutter, und das alles nur, weil irgendein soziopathischer Streuner rechtzeitig in Taylorville erschienen war, um das Foto des Helden in der Zeitung zu sehen. Alles nur, weil die Zeitung die Adresse des Jungen veröffentlicht hatte. Alles nur, weil es da draußen beutegierige Menschen gab, die gern töteten.
Liam unterdrückte ein Aufstöhnen. Er sah Joey vor sich. Sah, wie er auf seinem nagelneuen Stingray seine Kreise zog, oben kurz vor der Steigung der Straße, wo ein Mann stand. Der Mann stand mit gespreizten Beinen da, mit einem Lächeln auf dem staubbedeckten Gesicht, und er lehnte sich auf eine Holzfälleraxt wie Fred Astaire auf seinen Spazierstock.
Natürlich war es so nicht geschehen. Dalton Lee Wayne hatte eine Pistole benutzt. Joey und seine Schwester waren vermutlich nicht einmal aufgewacht. Joeys Mutter hatte das Schlimmste abbekommen.
Nie würde Liam den Tag im Sommer 1969 vergessen, an dem sein Vater freimütig eingeräumt hatte, kein Held zu sein, und an dem Joey Ableman ermordet worden war. Es war so klar wie der Oklahoma-Himmel während einer Hitzeperiode, dass das Heldsein höchst kompliziert war. Ein wahrer Held ließ sich schwer definieren und war mitunter absolut nicht beneidenswert. Das hatte er bereits als Kind erkannt, als er gezwungen war, auf die drei geschlossenen Särge zu starren und – mit allen anderen Einwohnern von Taylorville – Joeys Heldentat zu betrauern.
Liam schloss die Augen. Jetzt gab es nichts anderes zu tun als sich bis zum Morgengrauen zu gedulden. Er musste verrückt sein, sich freiwillig in die Nähe dieser tickenden Zeitbombe zu begeben, und manchmal fragte er sich, was ihn eigentlich dazu bewog, derartige Risiken einzugehen. Auf keinen Fall war es das Bedürfnis, ein Held zu sein. Nach Joeys Tod verspürte er kein Verlangen mehr, einer zu werden. Stattdessen wurde er der Anti-Held, der »böse Junge« von Taylorville, der seine Sterblichkeit und seine Moral ständig auf die Probe stellte.
Er warf einen letzten Blick auf die schlafenden Männer. Denny war schließlich in einen trunkenen Schlaf gesunken.
Liam fragte sich, ob er begann, ihnen allzu sehr zu ähneln. Die Undercover-Arbeit war immer ein Kinderspiel gewesen, das Milieu instinktiv vertraut. Gewalt, Aufbegehren, Brutalität – damit kannte er sich aus. Vielleicht hatte es mit seinem Geschlecht zu tun; vielleicht waren es wirklich nur die Testosterone, die Männer zu dem trieben, was sie taten.
Doch an manchen Tagen sorgte er sich darum, sich der dunklen Seite seiner Seele allzu sehr hinzugeben.
Aber vielleicht war doch noch ein wenig von Patrick Jameson in ihm. Sein Vater war kein gefeierter Mann gewesen, dennoch kam er seinem Sohn überwältigend groß vor, so heroisch wie der irische Cop aus Boston, der eigentliche Held der Familie. Patrick Jameson war kein Held gewesen, aber Liam betrachtete ihn als solchen und haderte noch immer mit seinen Unzulänglichkeiten.
Er grinste. Himmel, Überlegungen über Heldentum waren besser bei Philosophen und Filmemachern aufgehoben, besser als bei Bundesangestellten, die zu Kamikaze-Missionen neigten. Aber eines wusste er sicher, als er sich in dem Raum voller schlafender Männer umblickte, dass sich eine Philosophie durchaus auf eine ganz einfache Formel bringen ließ. Das wusste er, weil er es für sich getan hatte.
Vielleicht war Patrick Jameson schließlich doch ein Held gewesen. Vielleicht bestand Heldentum einfach darin, dafür zu sorgen, dass man nie zu den bösen Jungs gehörte.
1
Special Agent Liam Jameson lehnte sich in seinem Naugahyde-Schreibtischsessel zurück und musterte das Durcheinander. Überall lagen und standen Plastiksäcke mit Beweisstücken des Kineson-Falles: Patronenhülsen, Waffen und Munitionsmagazine, Pamphlete der Separatistenbewegung aus Utah, original emaillierte Hakenkreuzanstecknadeln aus dem Dritten Reich. Der Schund hätte das Herz jedes KKK-Mitglieds höher schlagen lassen.
»Hey, Jameson, warum sind dreizehn Klansmänner nötig, um eine Glühbirne einzuschrauben?«
Jameson wandte sich McBride, seinem Partner, zu, der an seinem Schreibtisch bis zum Hals in Söldner-Magazinen vergraben war, die sie im Okie-Hauptquartier beschlagnahmt hatten. »Also gut, sag’s schon.«
»Ein Großmagier schraubt die Birne ein, und zwölf FBI-Agenten machen Notizen.«
Jameson verzog das Gesicht. Das hatte ihm heute gerade noch gefehlt. Das FBI hatte den Ku-Klux-Klan seit mehr als einem Jahrzehnt im Visier; kein Klanmitglied konnte auch nur die geringste Bewegung machen, ohne dass ihm fünf vom FBI dabei zusahen. Aber es war noch immer notwendig. Bedauerlicherweise noch immer. Tagtäglich splitterten sich potentielle Anhänger des althergebrachten Klans in Hunderte neuer Gruppierungen auf: Weißarischer Widerstand, Nationalsozialistische Befreiungsfront, Skinheads, NS-Punks, gestiefelte Billy Bobs, die nichts anderes waren als gute alte Schlägertrupps, die sich Patrioten und Milizionäre nannten. Sie waren da draußen, unter tausend verschiedenen Namen, mit tausend unterschiedlichen Methoden, aber mit einer einzigen Ideologie. Dabei war es völlig gleichgültig, wen sie hassten. Inzwischen waren sie eine Organisation des Hasses, darauf aus, nahezu alle und jeden zu vernichten. Sie hassten Demokraten und Republikaner, IRS, ATF, den Regierungsapparat, Baumschützer, Schwarze, Farrakhans, Juden, Frauen und Menschen namens Smith. Ihre Auswahl ähnelte einem Kaleidoskop. Aber auch wenn sich die Angriffsziele mitunter unterschieden, vereinte sie doch alle die Liebe zu Waffen und der Hass auf irgendjemanden – und das war eine brisante Mischung.
»Sieh dir das an ... Oh Mann, das fetzt mich.« Offensichtlich angewidert zeigte McBride in einer der Zeitschriften auf eine vollbusige, halbnackte Frau, die eine AK-47 umhalste. Er grinste. »Gott schütze Kineson. Ich liebe diese Rednecks. Sie haben so absolut kein Verlangen nach ein bisschen dezenter Zurückhaltung.«
»Ich bin ein Redneck, falls du es vergessen haben solltest. Das ist einer der Gründe, weshalb mir dieser Fall übertragen wurde.«
»Oh yeah. Glatt vergessen. Vermutlich ziehst du es vor, dass ich Kineson einen kulturell überforderten Nichtstädter nenne, oder?«, fügte McBride durchtrieben hinzu.
»Scher dich zum Teufel.« Jameson unterdrückte ein Lächeln.
Er warf einen Blick auf die Beweisstücke und hätte schwören können, dass sie sich vervielfältigten. Da waren sieben Säcke voller benutzter Patronenhülsen, drei abgesägte Schrotflinten und eine gewichtige Familienbibel, in die die Namen aller schwarzen Familien der Stadt mit Bleistift eingetragen waren – mit kleinen, brennenden Kreuzen hinter jedem Namen.
Gott, Hass und Waffen, dachte er. Die alte Bibel war der Höhepunkt dreijähriger harter Arbeit. Sie war der endgültige Beweis. So endgültig, dass er Kinesons Wut fast verstehen konnte, als sie sie aus seinem Haus geholt hatten. Wie weit war es eigentlich schon mit der Welt gekommen? Wenn nicht einmal mehr die Familienbibel vor dem FBI sicher war, was dann? Verdammt. Vielleicht bestand schließlich doch die Notwendigkeit für eine Miliz.
»Hör dir das an.« McBride rutschte mit seinem Sessel näher an Jameson heran.
Jameson ignorierte ihn.
»›Bobs Artikel zur Wiederherstellung der Gesetze. Wehren Sie sich gegen die Straße! Schützen Sie sich mit Körperrüstungen, Schlagstöcken, Holstern, Beobachtungsinstrumenten, Messern und Überlebensausrüstungen für Ihre Freizeit-Abenteuer.‹« McBride lachte. »Zu welcher Art von Freizeit-Abenteuern braucht man denn Körperrüstungen?«
Jameson zuckte mit den Schultern. Er blickte nicht einmal hoch.
»Und dann das hier. ›Ein Leitfaden für Terroristen, um das Phänomen des weltweiten Terrorismus besser zu verstehen. Die Studie enthält eine Anleitung zur Vorbereitung von Informationsvorträgen.‹« McBride ließ die Zeitschrift sinken. »Vorbereitung von Informationsvorträgen, dass ich nicht lache.« Er las weiter vor: »›Die Anleitung umfasst alle durchschlagenden Fakten auf diesem komplexen und gefährlichen Gebiet.‹« McBride blickte auf. »Was meinen sie wohl wirklich mit dem Wort ›durchschlagend‹?«
Jameson griff nach einem Beutel mit Patronenhülsen und wollte ihn McBride an den Kopf werfen. Er duckte sich behände weg und fuhr mit der Lektüre der Anzeigen fort.
»Zum Geier ...«
Jameson verdrehte die Augen. »Hör auf, diesen Mist zu lesen. Du sollst es sortieren, nicht verinnerlichen.«
McBride schien ihn nicht zu hören. Mit offenem Mund starrte er in die Zeitschrift. Jameson stand auf und schnappte ihm das Magazin fort.
»Das solltest du Gunnarson zeigen, Mann. Den Schund da links unten. Das Fettgedruckte. Es kann dir gar nicht entgehen.«
Jameson überflog die Anzeigen. Die Zeitschrift nannte sich High Risk und war ein Waffenmagazin, vielleicht eine Spur billiger als Soldier of Fortune. Sie behauptete, sich an die Angehörigen der Strafverfolgungsbehörden zu wenden, aber die meisten ihrer Leser waren beileibe keine Polizisten. Es waren Paramilitaristen, wenig gebildete Burschen, besessen von Waffen und Tod. Die Zeitschrift war ein Fanmagazin für Möchtegern-Polizisten. Sie bediente die Milizorganisationen, die vorgaben, die Verfassung zu schützen, und vermittelte genügend »Inside«-Informationen, um die Ängste krankhaft Paranoider weiter hochzuputschen. Die Bruderschaft der Paramilitaristen konnte vielleicht mit ein paar Jungen verglichen werden, die sich in Baumhäusern im Flüsterton über ihren Geheimclub unterhielten und sich Blutsbrüderschaftszeremonien unterzogen. Aber diese erwachsenen Jungen waren unvergleichlich gefährlicher als diese unbedarften Schuljungen. Söldner-Magazine redeten ihren Lesern ein, zu einer elitären Branche von Gesetzeshütern zu gehören, einer so eingeweihten Gruppierung, dass sie zu jedermanns Wachhund berufen war, jedermanns Ankläger, Richter und Vollstrecker. Sie verkauften die »Große Lüge«. Es war ein einziger großer Betrug, um Geld zu machen, genau wie der typische Playboy-Leser kein gutaussehender, welterfahrener Jetsetter war, sondern ein vierzehnjähriger, pubertierender Jüngling.
»Hast du es gefunden, Jameson?«
Jameson antwortete nicht. Wie gebannt starrte er auf die Anzeige.
»Was meinst du? Sollten wir das nicht dem Abteilungsleiter zeigen? Für mich ist das eine ziemlich unverblümte Killer-Anzeige.«
Stirnrunzelnd ließ Jameson die Zeitschrift sinken.
»Nun, was hältst du davon?«, fragte McBride ungeduldig.
»Ich denke, wir sollten es zur Sprache bringen.« James schlug die Zeitschrift zu und warf sie auf den Tisch. »Aber im Moment sollten wir diesen Mist durchforsten, damit es Avery ins Beweisarchiv bringen kann.«
»Mann, da wird nach einem Killer gesucht. Jemand sollte sich so schnell wie möglich darum kümmern«, beharrte McBride und blätterte weiter durch den Magazinstapel.
Jameson schlug die Zeitschrift wieder auf und las die Anzeige noch einmal:
GESUCHT: Ein Drachentöter.
Bewerbungen an ZOE, P.O.Box 5471,
Grand Central Station, NYC, NY 10036
Ein Drachentöter ... Jameson ließ die Formulierung nicht los. Sie erinnerte in gewisser Weise an Schwulensprache, aber Homos annoncierten nicht in Waffenmagazinen. Diese Publikationen waren den meisten von ihnen zutiefst zuwider. Die Anzeige war verschlüsselt, so viel schien klar. Und sie hörte sich tatsächlich an wie die Suche nach einem Killer. Der Abteilungsleiter würde entscheiden müssen, was sie unternahmen.
Jameson begann, die Plastiksäcke zu sortieren und verdrängte für den Moment Drache und Zoe aus seinen Gedanken.
»Was hat es Ihrer Meinung nach zu bedeuten?« Section Chief Gunnarson behandelte jeden Agenten, als wäre er Psychologe. Nie ließ er sich zu voreingenommenen Erklärungen hinreißen, stets war er höflich und fragte nach persönlichen Einschätzungen. Für Jameson war Frederick Gunnarson deshalb der Beste der Besten.
»Ich bin McBrides Ansicht. Es ist eine Killer-Anzeige. Ohne jeden Zweifel.« Jameson rutschte auf dem Sessel hin und her. In Gunnarsons Anwesenheit fühlte er sich stets wie der verdammte Okie-Redneck, der er ja auch war. Verglichen mit dem auf Harvard ausgebildeten Sechzigjährigen war er nichts als ein grüner Junge, der von einem weit Größeren zu lernen versuchte. Dabei blieb es völlig belanglos, dass er gerade den Fall Kineson zu Ende gebracht hatte – den Höhepunkt seiner Berufslaufbahn. Er hatte die drei Mordfälle von Taylorville nicht aufgeklärt. Nein, der Held in diesem Fall war Gunnarson gewesen. Er hatte Dalton Lee Wayne das Handwerk gelegt, einem der berüchtigtsten Serienmörder der siebziger Jahre.
»Wenn es sich tatsächlich um die Suchanzeige nach einem Killer handelt, sollten sich die New Yorker Behörden darum kümmern.« Gunnarson machte sich mit einem schwarzen MontBlanc auf einem sauberen Bogen Papier eine Notiz.
Jameson betrachtete seinen Chef auf der anderen Seite des Schreibtisches. Wie immer empfand er so etwas wie Ehrfurcht. Der Gegensatz zwischen ihnen konnte größer nicht sein, und erneut wurde er von den Selbstzweifeln gepeinigt, die ihn schon auf der FBI-Akademie verfolgt hatten. Inzwischen gehörte er diesem elitären Kreis an, mit Gunnarson als Sonne, um die alle anderen kreisten wie Planeten, aber obwohl ihm Gunnarson zwanzig Jahre voraus hatte, war es nicht das Alter, das Liam ihre Unterschiede so bewusst machte.
Während Liam zusah, wie der Chief seine Notizen machte, erkannte er plötzlich, wie er sich in dieser Elite-Einheit des FBI fühlte. Chief Gunnarson und seine auf Universitäten ausgebildeten FBI-Special Agents waren alle kostspielige Füllfederhalter, und Liam Jameson, der Junge aus dem Trailer Park in der Nähe von Tulsa, war nicht mehr als ein Bic zu neunundfünfzig Cents.
Das hätte Ressentiments auslösen können, aber so war es nicht. Dafür empfand er zuviel Respekt für den Mann, der ihm gegenübersaß. Wegen Gunnarson war Jameson zum FBI gegangen. Drei seiner Morde hatte Dalton Lee Wayne in Jamesons Heimatstadt verübt. Sein bester Freund Joey Ableman war von ihm ermordet worden. Er wollte so werden wie Gunnarson, weil Gunnarson der Mann war, der Joeys Mörder gefasst hatte.
Der »edle Ritter von Quantico«, wie Eingeweihte Gunnarson nannten, hatte den Mistkerl gefasst, der Joey Ableman, seine Familie und fünfundzwanzig weitere Menschen in einer Mordserie getötet hatte, die die Nation erschütterte. Gunnarsons Erfolg hatte den Ausschlag gegeben. Liam, der einfache Junge aus dem Süden von Tulsa, wollte genauso werden wie er.
Jetzt arbeitete er zwar tatsächlich für ihn, aber noch immer war es für Liam unvorstellbar, wie er es jemals schaffen sollte, sein Vorbild zu erreichen. Ganz gleich, wie viele Fälle er löste, ganz gleich, wie viele Schurken er hinter Gitter brachte, nie könnte er dieser edle Ritter werden. In seinem tiefsten Inneren betrachtete er sich nicht als Helden. Dafür war zuviel Dunkles in ihm, zuviel Gewaltpotential, das er nicht verstand. Das bewies auch der Schuss auf Denny Freeman in Kinesons Lager. Er schwankte zwischen Gut und Böse, schien das Richtige nie fest in den Griff bekommen zu können, während sich Gunnarson stets ganz sicher zu sein schien. Deshalb blickte er noch immer wie ein kleiner Junge mit großen, bewundernden Augen zu dem Mann auf. Sogar seine Kleiderwahl sprach von Selbstsicherheit. Der Mann trug Hickey-Freeman-Anzüge und seidene Rep-Krawatten. Seine grauen Haare waren kurz geschnitten und stets tadellos frisiert.
Und im Vergleich dazu Jameson. In Quantico hatte er sich nach Kräften bemüht, chic und elegant auszusehen, aber er konnte sich nur preiswerte Anzüge leisten, und seine Krawatten schienen nie ganz zu seinen Sakkos zu passen. In der Tulsa-Einheit arbeitete er hauptsächlich verdeckt, und wie man sich als Unterprivilegierter kleidete, wusste er genau. Im Büro fasste er seine dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen oder ließ sie sich einfach auf die Schultern fallen. Ironischerweise besaß er eine besondere Begabung für die FBI-Tätigkeit, über die Gunnarson nie verfügen würde. Liam Jameson konnte genau aussehen wie der Redneck, der zu sein er befürchtete.
»Nun, dann werde ich die zuständigen Behörden über die Anzeige in Kenntnis setzen, Sir. Ich glaubte nur, jemanden davon informieren zu sollen.« Jameson stand auf.
Gunnarson winkte ihn mit dem MontBlanc zurück. »Faxen Sie die Anzeige nach New York und lassen Sie mich wissen, was sie sagen. Ich möchte, dass Sie dranbleiben.«
»Ich mache es sofort.« Jameson nahm die Zeitschrift von Gunnarsons Schreibtisch.
»Und wann ist nun die Hochzeit, von der wir schon so lange hören?«
Die Frage traf Jameson unvorbereitet. Er spürte, wie er sich verspannte. »Wir haben sie abgesagt, Sir. Mary Elizabeth gefiel Tulsa nicht. Vermutlich waren drei Jahre Warten auf die Hochzeit zu lange.«
Gunnarson sah ihn an, als wäre er sein Sohn. Hinter all seiner tadellosen Haltung, hinter all seiner Professionalität war er also auch ein mitfühlendes Wesen. Jamesons Bewunderung nahm weiter zu. »Das tut mir leid. Sie könnten eine Frau gut gebrauchen. Immerhin könnte sie Ihnen beim Aussuchen Ihrer Krawatten helfen.«
Jameson blickte an sich herab und grinste. »Ja, Sir.«
»Wir hätten Sie versetzen können ...«
»Ich weiß, Sir. Aber dann hätte ich die Einheit verlassen müssen, und es war nicht zu übersehen, dass sie den Washington Beltway mehr mochte als mich. Sie war ohnehin nichts für mich. Mit diesem ganzen überspannten Georgetown-Getue. Eine verdammte Yankee, das ist sie. Gut, dass ich sie los bin.«
Gunnarson lachte.
»Ich werde das Fax unverzüglich nach New York schicken, Sir.«
»Achten Sie auf sich, Agent Jameson. Wie ich hörte, kommt eine Belobigung auf Sie zu.«
»Ja, Sir.«
»Sie haben sie verdient. Man sagte mir, dass Sie bei dem Einsatz fast getötet worden wären. Kineson hatte seine Waffe direkt auf Sie gerichtet.«
»Ja, Sir. ›Fast‹ ist richtig, sonst könnte ich jetzt nicht mit Ihnen sprechen. Es ist gut, wieder hier sein zu können.«
»Lassen Sie sich die Haare schneiden, Jameson.«
Jameson nickte. Er steckte sich die Zeitschrift unter den Arm und verließ Gunnarsons Zimmer.
Das Fax landete kurz vor sechs Uhr auf Jamesons Schreibtisch. Er wollte gerade das Büro verlassen, als ihm der Aktendeckel in seinen Eingangskorb gelegt wurde.
Jameson warf einen flüchtigen Blick auf das Fax. In ihm stand nichts, was ihn überrascht hätte. Die Polizei von Manhattan hatte noch nie etwas von einer Organisation oder einem Menschen Namens ZOE gehört. Sie sah in der Anzeige kein Verbrechen. Falls sich da doch eines ankündigen sollte, könnte ihre einzige Maßnahme darin bestehen, einen Polizisten zu finden, der sich auf die Anzeige meldete.
Liam schob das Fax wieder in den Aktendeckel zurück. Hinter ihm lag ein langer Tag, und er freute sich auf ein Bier und ein Steak, um den Abschluss seines jüngsten Falles zu feiern. Er griff nach seinem Sakko und zog es sich fluchend an. Er hasste diese Förmlichkeit, an die er nicht mehr gewöhnt war. In der Julihitze von Tulsa schaffte er es kaum bis zu seinem Auto, wo er es wieder ausziehen konnte.
McBride hatte das Büro eine Stunde zuvor verlassen. Der Schlaukopf wollte sich mit seiner Freundin treffen. Die Flure waren leer und verlassen. Nach Abschluss des Kineson-Falles tat sich nicht viel. Aber Jameson stellte fest, dass in Gunnarsons Büro noch Licht brannte. Er steckte den Kopf durch die Tür. »Auf Wiedersehen und guten Abend, Sir.«
»Haben Sie etwas aus New York gehört?« Gunnarson blickte von den Unterlagen hoch, in denen er gerade las.
»Ja, Sir. Offenbar können sie nicht viel mehr tun als unter Umständen auf die Anzeige zu reagieren und abzuwarten, was sich tut.«
»Verstehe.«
»Nun ... dann guten Abend, Sir.«
»Jameson?«
»Ja, Sir?«
»Melden Sie sich auf die Anzeige. Eine Bewerbung aus Tulsa ist weniger verdächtig als eine aus Manhattan.«
Jameson klappte fast der Unterkiefer herunter. »Ich weiß nicht, ob ich mich dafür eigne, Sir. Das ist wirklich nicht mein Gebiet, Sir. Ich bin Miliz-Spezialist. Damit kenne ich mich aus, wie Sie wissen. Nicht mit Killer-Aufträgen.«
»Sie haben Ihre Fähigkeiten mit dem letzten Fall glänzend unter Beweis gestellt, aber es ist an der Zeit, dass Sie sich auch anderen Gebieten widmen. Sie kennen meine Einstellung. Ich möchte nicht, dass meine Agenten Spezialisten sind. Ich möchte, dass sie die Leonardo da Vincis der Verbrechensbekämpfung werden. Erweitern Sie Ihren Horizont, Jameson.«
Ein Drachentöter ... Noch immer ging Jameson diese Formulierung nicht aus dem Kopf. Er konnte nichts und niemanden töten – bis auf ein oder zwei Rehe vielleicht, früher, als Junge, aber nach Joey Ablemans Tod hatte Jameson nicht einmal die Jagd vor sich rechtfertigen können.
Abgesehen davon war er nicht der Held, oder besser der Anti-Held, den diese Leute suchten. Er war kein Attentäter. Dennoch ließ ihm die Frage, worum es dieser oder diesem merkwürdigen ZOE eigentlich ging, keine Ruhe.
»Antworten Sie auf die Anzeige, Jameson. Und halten Sie mich über Ihre Erkenntnisse auf dem Laufenden.«
Jameson sah seinen Helden an, seinen Gott, seine Nemesis. Er nickte.
2
Claire Green schloss die Nussbaumtür ihres Büros hinter sich und trat an ihren Schreibtisch. Mit bebenden Händen zog sie eine Fotokopie aus dem Umschlag, den sie in ihren schmalen Mark Cross-Aktenkoffer gestopft hatte. Sie las sie noch einmal, schüttelte ungläubig den Kopf und griff zum Telefon.
»Phyllis, hier Claire. Was ist das hier? Was soll diese Anzeige?«
Sie schwieg, wartete auf eine Antwort, erhielt aber keine.
»Sie wurde anonym an Fassbinder Hamilton geschickt, aber du weißt, dass meine Sekretärin häufig meine Post öffnet«, flüsterte Claire in die Muschel. »Und was hat das eigentlich zu bedeuten? Warum wurde ich nicht davon informiert? Du hast mich bewusst im Unklaren gelassen, und ich muss dir sagen, dass ich mir keinen Grund dafür denken kann. Ihr macht da doch nichts Illegales, oder?«
Erneutes Schweigen. »Ich verlange eine Antwort«, rief Claire schließlich energisch.
Die Frauenstimme am anderen Ende der Leitung klang so bedächtig, als überlege sie sich jedes Wort sehr genau. »Wir wollten dich schützen, Claire. Wir wollten dich damit nicht behelligen. Also leg auf, verbrenn die Anzeige und vergiss das Ganze.«
»Ihr wolltet mich schützen? Um Himmels willen, Phyllis, ich bin die Anwältin von ZOE. Ich soll die Gruppierung in allen rechtlichen Belangen vertreten, aber wie kann ich das, wenn ihr mich nicht ausreichend informiert?«
Claire wollte nach einem Notizblock greifen, fand aber keinen. Frustriert schnappte sie sich einen Briefbogen der Anwaltskanzlei. »Hör zu. Du sagst mir jetzt, wo und wann ich dich treffen kann, und dann wirst du mir alles erklären. Sehr genau und in allen Details, Phyllis.«
Sie schrieb sich den Namen eines Restaurants auf, verabschiedete sich schnell und legte den Hörer auf.
Nachdenklich faltete Claire den Bogen mit dem Briefkopf Fassbinder Hamilton zusammen. In winzigen Buchstaben stand da neben zig anderen auch der Name Claire Green. Sie war nur eine kleine Arbeitsbiene in Fassbinders renommiertem Bienenkorb an der Wall Street.
Das Surren des Intercom ließ sie fast an die Decke gehen. Sie atmete tief durch und drückte dann auf die Taste. »Ja?«
»Die Besprechung, Miss Green. Man wartet bereits im Konferenzraum auf Sie.«
Claire fuhr sich über die Haare, als könnte sie damit auch ihre Nerven glätten. »Okay. Vielen Dank, Karen. Ich komme sofort.«
Sie holte tief Luft, stand auf und nahm etliche dicke Aktenordner von ihrem Schreibtisch. Sie würde ihre ganze Konzentration benötigen, um der Besprechung folgen zu können, denn sie konnte an nichts anderes denken als an ZOE.
ZOE.
Für einen Sommerabend war das Café des Artistes gut besucht. Claire ließ die Hektik der Columbus Avenue hinter sich und nahm die lockere Atmosphäre des Restaurants in sich auf. Schon das Gelächter und das Eisklirren in den Highball-Gläsern begann sie zu entspannen.
Der Maître führte sie an den Tisch, an dem Phyllis bereits saß, mit dem Rücken zu einem der Gemälde nackter Nymphen, für die das Café berühmt war.
»Darling.« Phyllis stand auf, stützte sich auf ihren unvermeidlichen Stock und umarmte Claire. »So etwas sollten wir wirklich häufiger tun. Wie lange ist es her, seit wir zum letzten Mal einen Abend miteinander verbracht haben?«
»Sehr lange.« Claire half Phyllis, sich wieder zu setzen.
»Aber wir hätten uns einen anderen Treffpunkt aussuchen sollen.« Phyllis warf einen bezeichnenden Blick auf die zahllosen lebensgroßen Bilder. »Ich meine, wer bekommt angesichts dieser jugendlichen, straffen Schönheit schon einen Bissen über die Lippen?«
Claire lächelte. Der Kellner trat an den Tisch und fragte nach ihren Getränkewünschen. Phyllis bestellte einen Martini, Claire eine Weißweinschorle. Nachdem der Mann gegangen war, breitete sich sekundenlang angespanntes Schweigen aus.
»Erzähl mir von der Anzeige, Phyllis.« Claire konnte sie kaum ansehen. Sie hatte Phyllis sehr gern und fühlte sich durch die Annonce merkwürdig betrogen. Irgendetwas ging da vor sich, von dem man sie ausgeschlossen hatte. Mit Absicht. Und das verhieß nichts Gutes. Es könnte eine wertvolle Freundschaft zerstören. Die rothaarige Frau ihr gegenüber war für sie wie eine Mutter gewesen. Phyllis hatte ihre Tränen getrocknet, ihr am Telefon nachts Trost und Mut zugesprochen, wenn sie sich allein und verlassen fühlte. Bei den ZOE-Treffen hatten sie einander ihre qualvollsten Erlebnisse anvertraut, so auch den Moment, als Phyllis ihr Bein verloren hatte. Alles war mit erschreckender Schnelligkeit passiert. Der Mann tauchte am helllichten Tag vor ihr auf, verlangte ihr Geld, und dann lag sie auch schon auf dem Radweg im Central Park, das rechte Bein unterhalb des Knies durch die Salve aus einer Schrotflinte zerfetzt. Sie sah nur noch den Rücken eines Mannes, der gehetzt davonlief.
Es ist nicht leicht, ein Opfer zu sein, dachte Claire, aber noch schlimmer ist es, kriminell zu werden. Und sie konnte nicht tatenlos zusehen, wie Frauen, für die sie viel empfand, zu Kriminellen wurden.
»Du warst lange nicht mehr bei unseren Treffen«, begann Phyllis, nachdem ihnen der Kellner ihre Drinks gebracht hatte. »In letzter Zeit haben wir viel zu tun. Die Sache hat sich ganz hübsch ausgeweitet.«
»Was meinst du damit? Gibt es neue Mitglieder?«
»Nun, wir haben als Opferschutzgruppe angefangen, als Anlaufadresse für betroffene Frauen, die ihre schmerzlichen Erfahrungen mit anderen teilen wollten, die sie verstehen und unterstützen. Jetzt sind wir sehr viel mehr.« Fast geheimnisvoll fügte Phyllis hinzu: »Und sehr viel schlagkräftiger.«
»Meine Arbeit hielt mich davon ab, regelmäßiger zu den Treffen zu kommen, aber ich bin noch immer der Rechtsbeistand von ZOE, Phyllis. Und ich muss über alle Vorgänge informiert werden, wenn ich ZOE-Anwältin bleiben soll. Ich kann angesichts dieser Anzeige nicht einfach die Augen verschließen und ...«
»Wir machen wirklich große Fortschritte. Eine Psychotherapeutin ist zu uns gestoßen. Das Opfer einer Vergewaltigung.« Phyllis rührte mit der aufgespießten Olive in ihrem Glas. Die Frau wirkte so locker, als würden sie darüber diskutieren, ob Phyllis den teuren Jaguar wirklich kaufen sollte, auf den sie ein Auge geworfen hatte, und nicht darüber, ob ZOE dabei war, einen Zeh in die trüben Gewässer illegaler Selbstjustiz zu stecken. »In vier Monaten haben wir fast vierzig neue Mitglieder aufgenommen. Erinnerst du dich an den Tod von Alice Whitney? Sie hat uns ihr gesamtes Vermögen hinterlassen. Unser Bankkonto nimmt sich aus wie das der NRA. Wir haben die Millionengrenze weit überschritten.«
Claire starrte sie an. Phyllis benahm sich ausgesprochen merkwürdig. Irgendwie unvereinbar mit ihren Worten. Als hätte sie sich von einer Lüge überzeugt, als wäre die Realität für sie nicht mehr wirklich real.
Claire nahm einen tiefen Schluck und fragte sich unwillkürlich, warum sie sich nicht etwas Stärkeres bestellt hatte. Sie fürchtete, es nötig zu haben. »Erzähl mir, was da vor sich geht. Ich will es wissen. Ich muss es wissen oder ... oder ich ziehe mich von ZOE zurück.«
Phyllis sah sie an, als wäre sie überrascht. »Du hast ZOE gegründet, Claire. Du willst uns verlassen? Zu einem Zeitpunkt, an dem wir endlich weiterkommen? Zu einem Zeitpunkt, an dem wir endlich etwas bewirken können?«
»Phyllis, ich werde keine Organisation vertreten, die mich nicht umfassend über alles informiert. Meine Intuition sagt mir, dass es sich hier um etwas Ungesetzliches handeln könnte, und ich habe einen Berufseid abgelegt. Abgesehen davon möchte ich nachts ruhig schlafen können.«
Phyllis’ Lächeln war warm und aufrichtig. Die alte Phyllis. »Ethische Grundsätze sind entscheidend für dich, Claire, das wissen wir alle. Deshalb bedeutest du uns auch so viel. Deshalb schätzen wir dich so sehr.«
»Erzähl mir endlich mehr über den Hintergrund dieser Anzeige, Phyllis.«
Die ältere Frau trank einen Schluck Martini und wandte den Blick ab. »Vielleicht solltest du die Gruppe wirklich verlassen. Du bist die einzige gewissenhafte Anwältin in New York City, warum solltest du deinen Altruismus an einen Zusammenschluss hilfloser Opfer verschwenden, die aufbegehren und etwas von ihrer Menschenwürde zurückerobern wollen?«
Claire klopfte mit den Fingerknöcheln auf den Tisch. Eine nervöse Angewohnheit, etwas, was sie tat, wenn sie sich mit einem Problem herumschlug. »Warum treibst du dieses Spiel mit mir, Phyllis? Ich dachte, wir wären Freundinnen. Gute Freundinnen.«
Phyllis trank einen Schluck und stellte das Glas sehr bedachtsam wieder auf den Tisch. »Wenn ich es dir sage, steckst du mit drin. Also steh auf, geh und zieh dich für immer von ZOE zurück. Oder sei bereit, dich darauf einzulassen.«
»Erzähl es mir, dann kann ich selbst entscheiden.«
»Ich werde es dir sagen, und die Entscheidung wird sich von selbst ergeben.«
Claire seufzte tief. Aber sie stand nicht auf.
»Also gut«, begann Phyllis. »Du hast die Anzeige gesehen. Irgendjemand aus unserer Mitte hat sie dir geschickt, und du kannst sicher sein, dass wir herausfinden, wer diese Verräterin ist.«
»Fang einfach an, zu erzählen«, drängte Claire.
»Natürlich wirst du mit dieser Information zur Polizei gehen. Die Bestimmungen über das Verhältnis zwischen Anwalt und Klient sind eindeutig. Aber die Schweigepflicht des Anwalts endet dort, wo Gesetze übertreten werden. Und ich räume ein, dass wir Gesetze übertreten.« Phyllis sah ihr direkt in die Augen. Sie lächelte, aber es war das Lächeln einer Frau, die Claire nicht kannte.
»Die Gruppe hat ausführlich darüber debattiert, wie unser neues Vermögen eingesetzt werden soll.« Phyllis rührte in ihrem Drink. Ihre Gelassenheit war wirklich bemerkenswert. »Es bestand Übereinstimmung darüber, dass mit dem Geld etwas Gutes getan werden soll, aber wir konnten uns nicht recht vorstellen, es irgendeiner karitativen Organisation zu spenden, die drei Viertel der Summe für einen chicen Wohltätigkeitsball ausgibt und den Rest für ein Hightech-Telefonsystem, das E-Mail-Notrufe auf einem Anrufbeantworter speichert und das Ganze Sorgentelefon nennt.«
»Ich kann nicht begreifen ...«
»Wir wollten kontrollieren, wofür unser Geld ausgegeben wird. Verstehst du? Es ist schwer, keinen Einfluss auf den Lauf der Dinge zu haben. Einflussverlust ist das, was wir am meisten fürchten. Er ist es, der ein Opfer definiert. Buchstäblich.« Phyllis sah sie wieder an. Mit dem Blick einer Fremden. »Kannst du mir folgen, Claire?«
Claire schüttelte den Kopf. »Ich verstehe nicht, was du da sagst, Phyllis. Willst du ZOE allen Ernstes in eine Selbstschutzorganisation verwandeln?«
»Schon geschehen.«
»Als juristische Beraterin wäre ich verpflichtet ...« Abrupt brach Claire ab und starrte Phyllis fassungslos an. »Was hast du da gerade gesagt? Ist schon geschehen?«
»Wir wollten dich damit wirklich nicht belasten. Du warst nicht bei den Besprechungen dabei, und wir befürchteten, du könntest uns davon abhalten. Die Gruppe ist deine Gründung, Claire, aber ...«
»Es ist meine Gruppe, ich habe sie ins Leben gerufen. Großer Gott, sie hat den Namen meiner Schwester erhalten.« Claire konnte sich kaum noch beherrschen.
»Das ist uns bewusst. Aber du bist Anwältin. Uns ist auch bewusst, dass du in einem Dilemma steckst.«
»Verdammt richtig, ich stecke in einem Dilemma«, rief Claire.
Phyllis sah sich im Restaurant um. Etliche Leute reckten neugierig die Köpfe. »Wir haben abgestimmt, dich nicht einzuweihen. Ich verstoße gegen Absprachen, indem ich dir davon erzähle.« Phyllis trank ihren Martini aus. »Diese verdammte Caroline. Bestimmt hat sie dir die Anzeige geschickt. Sie war als einzige dagegen.«
»Nun, Gott sei Dank hat wenigstens eine Vernunft bewiesen.« Mit zitternden Fingern umklammerte Claire ihr Weinglas. »Ich kann es einfach nicht glauben. Was bezweckt ihr mit dieser Anzeige? Wie lange erscheint sie schon? Sag es mir. Gestehe. Was habt ihr getan?«
Phyllis schüttelte den Kopf. »Das ist nicht fair. Wir wollten nicht, dass du davon erfährst. Wir wollten dich nicht ... in diese Lage bringen.« Sie machte eine kurze Pause. »Bevor ich dir irgendetwas sage, glaube ich im Namen aller sprechen zu können, dass wir es dir nicht übel nehmen, wenn du deine Beziehungen zur Gruppe beenden willst. Hier ist deine Chance, Darling, also nutze sie. Noch weißt du nicht viel. Wenn du aussteigen möchtest, dann tue es jetzt. Denn wenn ich dich einweihe, wirst du Gründungsmitglied der neuen ZOE.«
»Aber es war meine Organisation«, erwiderte Claire leise. »Ich habe sie nach Zoe benannt, meiner Zwillingsschwester. Ich will sie nicht so einfach aufgeben. Ich will wissen, was ihr da vorhabt. Wie lange erscheint die Anzeige schon?«
Phyllis seufzte tief auf. »Seit vier Monaten.« Sie streckte versöhnlich die Hand aus. »Oh, Claire. Wir wollen dir nicht wehtun. Jeder einzelnen von uns geht es nur um Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit ist so verdammt kostspielig, so schwer fassbar.«
»Erzähl mir endlich Einzelheiten. Sonst wende ich mich an Caroline ...«
»Also gut, ich werde es dir sagen. Aber denk an meine Warnung. Damit übernimmst du Verantwortung – wie alle anderen auch. Und du wirst nicht davonlaufen können, Claire.«
»Lass mich das beurteilen, Phyllis.«
»ZOE hat beschlossen, eine Lotterie zu veranstalten.«
»Eine Lotterie?«
»Ja, aber keine gewöhnliche. Wenn dein Name gezogen wird, gewinnst du kein Geld. Du gewinnst Vergeltung.«
Claire starrte Phyllis so lange unverwandt an, dass ihre Augäpfel zu schmerzen begannen. »Habe ich dich wirklich richtig verstanden? Euch geht es um Mord?«
»Nein, Liebes. Um Exekution.«
Phyllis’ Worte verschlugen Claire den Atem.
Phillys winkte den Kellner heran und bestellte einen weiteren Martini. Keine von ihnen sagte ein Wort, bis der Drink gebracht wurde. Claire bemerkte, dass Phillys’ Hände absolut ruhig waren. Sie sah der anderen Frau in die Augen und fragte sich, ob sie dort eine Form von Wahnsinn sah.
»Erkläre«, ächzte Claire schließlich.
Ungerührt nahm Phyllis einen tiefen Schluck aus ihrem Glas. »Es ist doch ganz einfach. Wir wussten nicht, was wir mit dem ungeheuren Vermögen anfangen sollten. Wir wussten nur, dass wir damit unseren Mitgliedern helfen wollten, so direkt wie möglich. Also haben wir uns für eine Lotterie entschieden. Jeder Gewinnerin wird ein Prozentsatz unseres Vermögens zur Verfügung gestellt, und wir bestimmen einen Zeitraum, in dem die Mittel ausgegeben werden müssen. Wenn wir helfen können, tun wir alles, was möglich ist. Wenn nicht, gehen wir zur nächsten Gewinnerin über.«
»Und was meinst du mit ›helfen‹ genau?«
»Wenn wir den Kerl kennen, ist es sehr einfach und mit Sicherheit wenig kostenaufwendig. Wenn nicht, unternehmen wir alles, um ihn in dem zur Verfügung stehenden Zeitraum zu finden. Wir spüren ihn auf. Weißt du, Claire, es ist genauso, wie Malcolm X gesagt hat. Wenn du dein Recht nicht innerhalb der Gesetze findest, dann sind die Gesetze für dich nicht anwendbar. Davon bin ich inzwischen überzeugt. Ohne Gesetze können wir das tun, was die Polizei nicht tun kann oder will. Es ist erschreckend, wie viel in den Straßen über Verbrechen bekannt ist, was nie an die Cops weitergeleitet wurde.«
Claire starrte in das Gesicht, dass sie so gut zu kennen glaubte, und stellte fest, dass es die alte Phyllis tatsächlich nicht mehr gab. Die vernünftige, liebenswürdige Frau war verschwunden. An ihre Stelle war ein von Wahnvorstellungen zerrissenes Wesen getreten. »Ich glaube es nicht«, murmelte Claire. »Ich kann einfach nicht glauben, was ich da höre.« Der ganze Raum begann sich vor ihr zu drehen. Die Nymphen an den Wänden, die bei ihrem Eintritt so anmutig gewirkt hatten, kamen ihr nun geradezu bösartig vor, als wären sie nur darauf aus, junge Männer in den Tod zu locken.
»Sind Sie bereit, Ihr Essen zu bestellen?« Ein sympathischer, junger Kellner stand neben ihrem Tisch, ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht.
Claire blickte zu ihm auf. Am liebsten hätte sie ihn angeschrien, ihn gefragt, ob ihm bewusst war, dass er sich in der Gesellschaft von Mördern befand.
»Ich glaube, wir sind noch nicht ganz soweit«, hörte sie Phyllis aufgeräumt sagen. »Aber bringen Sie uns doch ein paar von den Baby-Zucchini. Für die könnte ich glatt sterben.«
»Sofort.« Der junge Mann lächelte und winkte dem Hilfskellner, ihre Wassergläser aufzufüllen.
Als der Hilfskellner wieder gegangen war, starrte Claire Phyllis fassungslos an. »Malcolm X hat das widerrufen«, flüsterte sie schließlich. »Wie auch Nathan Bedford Forrest. Sie haben eingesehen, dass Selbstjustiz nicht die Lösung sein kann. Das musst auch du begreifen.«
»Sie waren Männer. Sie haben in ihrem Leben weit mehr Gerechtigkeit erfahren als wir jemals erhoffen dürfen.«
Phyllis’ Zynismus war Claire bekannt, aber nie hätte sie geglaubt, dass die Freundin ihn so verinnerlichen könnte. »Malcolm X war schwarz. Er gehörte einer Minderheit an. Er hatte seine Erfahrungen mit Ungerechtigkeit.«
Phyllis stellte ihr Glas ab. »Willst du etwa behaupten, dass Malcolm X in seinem Leben während der Jim Crow-Ära mehr Leid, Ungerechtigkeit und Missachtung ertragen musste als jede x-beliebige schwarze Frau, die heute fünf vaterlose Kinder an der Lenox Avenue großziehen muss? Eine Frau, die öffentliche Klos schrubben muss, um überhaupt ein paar Cents zu verdienen?« Phyllis’ hübsches Gesicht wirkte fast hassverzerrt. »Das ist doch absurd. Wo bleibt ihre Gerechtigkeit, frage ich dich. Wo bleibt ihr Recht auf Eigenverantwortlichkeit? Und wo bleibt ihr gottgegebenes Recht auf die Mittel, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen? Die geht das Klo hinunter, das sie tagtäglich putzt, weil sie nur so sechs Menschen am Leben erhalten kann. Komm mir nicht mit Männerbeispielen. Männern geht es blendend.«
Innerlich musste Claire lächeln. Sie hatte aus ihren Freundschaften mit älteren Frauen eine Menge gelernt, vor allem aber eine Wertschätzung für ihre eigene Lebenszeit. Ältere Frauen waren entweder noch immer im sexistischen La-La-Land der fünfziger Jahre gefangen oder verbittert, weil sie zwar einen messerscharfen Verstand, aber keine dementsprechenden Chancen hatten. Phyllis gehört der letzteren Gruppe an. Das brachte Claire auf die Frage nach den Möglichkeiten ihrer Enkeltochter, und unwillkürlich empfand sie Neid. Claire Greens Enkelin würde sich nicht mit den Banalitäten ihrer Großmutter herumschlagen müssen.
»ZOE wurde nicht als Anti-Männer-Club gegründet«, erklärte Claire. »Es sollte eine Unterstützungsorganisation sein. Nur ein Forum für Opfer, die einander gegenseitig helfen. Ihr habt mehr für mich getan, als jedermann sonst. Ich hatte niemanden, und ihr habt mich davor bewahrt, mit meinem Schmerz allein zu sein. Dafür werde ich stets dankbar sein. Ich glaubte, es wäre gut, einander von gemachten Erfahrungen zu erzählen, dass das eine Art Katharsis sein könnte.« Ihre Stimme geriet ins Schwanken. »Nie hätte ich geglaubt, dass sich so etwas daraus entwickeln könnte.«
»Aber du bist lange nicht bei unseren Treffen gewesen, Claire. Du bist nicht mehr rundum informiert. Ich weiß, wie beschäftigt du bist, aber Menschen tun, was sie tun wollen. Du bist zu Hause geblieben, weil ZOE dich frustrierte. Man kann über ein Ereignis nicht ständig lamentieren. Nur Handeln ist therapeutisch. Das haben wir erkannt und daraufhin beschlossen, zur Tat zu schreiten.«
Claire schüttelte den Kopf. Sie wollte es nicht zugeben, aber Phyllis’ Analyse kam der Wahrheit recht nahe. »Nein, ich ...«
»Sind wir jetzt so weit, Ladys?« Der Kellner stand wieder neben ihrem Tisch.
Benommen schlug Claire die Speisekarte auf und bestellte das erste Gericht, das ihr unter die Augen kam. Phyllis ließ sich ein bisschen mehr Zeit. Als sie wieder allein waren, wusste Claire, dass sie das Bestellte nie über die Lippen bringen würde – besonders nicht nach der Antwort auf ihre nächste Frage.
»Und habt ihr schon jemanden ausfindig gemacht?«
»Das kann ich dir nicht sagen. Das wird von drei Leuten kontrolliert. Wir nennen sie die Dreieinigkeit: das ZOE-Mitglied, das in der Lotterie gewonnen hat, den Vollstrecker und den Richter.«
»Ich weiß, wie ihr das ZOE-Mitglied herausfindet«, sagte Claire mit bebender Stimme. »Und jetzt glaube ich auch zu wissen, wie ihr den Vollstrecker findet. Durch die Anzeige, stimmt’s?«
Phyllis schwieg.
»Okay«, fuhr Claire fort. »Dahinter bin ich selbst gekommen. Aber wer fungiert als Richter?«
Phyllis starrte die Nymphen an. »Du standest an der Spitze unserer Organisation, Claire. Du hast sie gegründet, du warst unser Rechtsbeistand. Aber du bist nicht mehr zu den Treffen gekommen. Wir konnten dich nicht dazu wählen. Du warst nicht mehr umfassend informiert.«
»Die nächste in der Reihe wärst du. Bist du die Richterin, Phyllis?«
»Als wir uns dazu entschlossen, war uns klar, dass wir nicht fünfzig Frauen in alle Einzelheiten einweihen konnten. Das wäre zu riskant. Mit Sicherheit würde eine Gewissensbisse bekommen und unter Umständen zur Polizei gehen. Nur Anonymität und Verschwiegenheit sichern uns effektives Handeln. Deshalb haben wir uns für die Dreieinigkeit entschieden. Deshalb wissen nur das ZOE-Opfer, der Vollstrecker und der Richter, was aus dem jeweiligen Lotteriegewinn wird.«
Claire glaubte, ihren Ohren nicht trauen zu dürfen. Der Tag hatte ganz normal begonnen – ein Bagel zum Frühstück und dann mit der Linie drei in die Kanzlei, doch nun hatte sie das Gefühl, dass sich der Erdboden unter ihr öffnete. »Caroline hat mir die Anzeige geschickt. Was werdet ihr mit Dissidenten machen?«
»Caroline kann nicht mehr sagen als in der Anzeige steht. Wegen der Dreieinigkeit kennt nur der Richter alle Einzelheiten. Ich wähle den Vollstrecker aus, Claire. Ein ZOE-Mitglied erfährt nur bei einem Lotteriegewinn, ob es zu einer Exekution kommt oder nicht. Also lass Caroline doch zur Polizei gehen. Auch du kannst zur Polizei gehen, aber die wird nie in der Lage sein, daraus einen Fall zu konstruieren. Dazu müssten sie drei Leute aufspüren und miteinander in Verbindung bringen, und das ist unmöglich, weil nur ich die drei kenne. Und du weißt hoffentlich ...« Sie blickte Claire intensiv an, und die sah den Wahn in Phyllis’ Augen flackern. »Ich werde der Polizei nie etwas sagen. Sie hat mir auch nicht geholfen, als ich mein Bein verlor.«
Nackte Verzweiflung überkam Claire. Das Verbrechen, das sie bereits ein Bein gekostet hatte, nahm ihr nun jede Vernunft. Phyllis konnte nicht mehr ertragen, Opfer zu sein, und nun war diese schreckliche Vergeltung ihr einziger Trost.
»Ich habe Angst, Phyl, ich habe große Angst«, hauchte Claire und hatte keine Ahnung, wie sie Phyllis in die Realität zurückholen sollte.
Phyllis griff über den Tisch und berührte ihre Hand. »Ich hatte auch Angst vor dem Kindergarten, obwohl ich wusste, dass er gut für mich war. Wenn du darüber nachdenkst, ist es die gleiche Angst.«
Phyllis konnte so weise sein, so stark. Claire begriff nicht, wie eine so überlegene Persönlichkeit sich derart verlieren konnte. »Du weißt, dass ich das verhindern muss. Ich muss es beenden«, sagte sie, fast zu sich selbst.
»Du wirst nie genug herausfinden. Ich werde es dir nie erzählen, Claire. Und du weißt, dass du damit nur deine Freundinnen verraten würdest. Deine Freundinnen, die deine Tränen getrocknet haben, als du um deine Schwester getrauert hast.«
Claire entzog ihre Hand Phyllis’ Griff. Ihr Essen wurde serviert. Sie wusste nicht, wie sie auch nur einen Bissen davon hinunterbekommen sollte. »Ich habe die Anzeige, Phyllis. Und lass dir von mir als Anwältin sagen, dass du dir mit derartigen Annoncen nur Schwierigkeiten einhandelst. Erinnere dich, was mit Soldier of Fortune geschehen ist, als sie so etwas veröffentlichten. Ich kann mir gar nicht erklären, wie du diese durchbekommen hast.«
»Niemand weiß, was es bedeutet. In dieser Zeitschrift bringe ich die Botschaft an die richtigen Leute. Wir lassen sie unter ›Persönliches‹ und unter einem Frauennamen veröffentlichen. Die meisten Leser werden sie für die verzweifelte Suche einer liebeskranken Frau nach ihrem ritterlichen Cowboy halten. Und genau das werden wir auch behaupten, falls man uns je auf die Spur kommt – was nicht der Fall sein wird. Vertrau mir, Claire. Die Behörden werden nie dahinter kommen.«
Claire schüttelte den Kopf. »Es ist doch mehr als offensichtlich, was die Anzeige bedeutet. Jedermann, der seine fünf Sinne beisammen hat, liest sie als das, was sie ist. Vermutlich lässt die New Yorker Polizei bereits das Postfach überwachen.«
»An dieser Sache arbeiten mehr Leute als die Polizei je darauf ansetzen könnte. Wir haben die Möglichkeit, jeden Bewerber zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass er kein Spitzel ist.«
»Für wen oder was sucht ihr diesmal? Ist er der erste, der zehnte oder was? Wer hat diesmal die Lotterie gewonnen?«