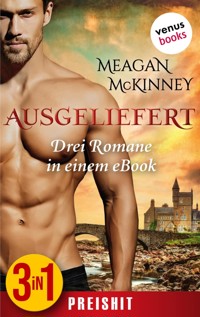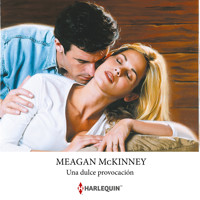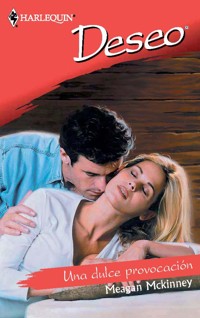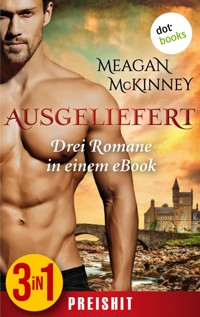Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er weckt das Feuer in ihrem Herzen: Der historische Liebesroman "Der Schurke und die Lady" von Meagan McKinney jetzt als eBook bei dotbooks. "Er hob ihr Kinn und ihre Blicke trafen sich wieder. Sie sehnte sich nach dem Gefühl seiner rauen Lippen auf ihrer zarten Haut …" Schon seit Jahren ist Christabel van Alen auf der Flucht. Zu Unrecht des Mordes verdächtigt, gibt es für sie keinen sicheren Ort mehr, niemanden, dem sie vertrauen kann. Ihr Schicksal scheint endgültig besiegelt zu sein, als ihre Postkutsche überfallen wird. Doch der Anführer der Bande, Macaulay Cain, behandelt sie erstaunlich sanft und weckt eine Begierde in Christabel, die sie beinahe alle Vorsicht vergessen lässt. Hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, ihm zu vertrauen und dem Drang, ihre wahre Identität zu verleugnen, ahnt sie nicht, dass der attraktive Outlaw selbst ein Geheimnis verbirgt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Romance-Highlight "Der Schurke und die Lady" von Meagan McKinney. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Er hob ihr Kinn und ihre Blicke trafen sich wieder. Sie sehnte sich nach dem Gefühl seiner rauen Lippen auf ihrer zarten Haut …«
Schon seit Jahren ist Christabel van Alen auf der Flucht. Zu Unrecht des Mordes verdächtigt, gibt es für sie keinen sicheren Ort mehr, niemanden, dem sie vertrauen kann. Ihr Schicksal scheint endgültig besiegelt zu sein, als ihre Postkutsche überfallen wird. Doch der Anführer der Bande, Macaulay Cain, behandelt sie erstaunlich sanft und weckt eine Begierde in Christabel, die sie beinahe alle Vorsicht vergessen lässt. Hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, ihm zu vertrauen und dem Drang, ihre wahre Identität zu verleugnen, ahnt sie nicht, dass der attraktive Outlaw selbst ein Geheimnis verbirgt …
Über die Autorin:
Meagan McKinney, geboren 1961, ist studierte Biologin. Diese Karriere ließ sie jedoch schon früh hinter sich, um sich voll und ganz dem Schreiben von historischen Liebesromanen zu widmen. Heute lebt sie mit ihren zwei Kindern in New Orleans.
Die Autorin veröffentlicht bei dotbooks die folgenden Titel:
»Die Leidenschaft des Piraten«
»Der Rebell und die Lady«
»Der Lord und die Schöne«
***
eBook-Neuausgabe November 2020
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »Fair is the Rose« bei Dell Publishing, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1994 unter dem Titel »Geheimnisvoll wie die Rose« bei Lübbe. Unter dem Titel »Der Outlaw und die Lady« erschien die Neuausgabe 2016 bei dotbooks.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1993 by Ruth Goodman
Published by Arrangement with Meagan McKinney
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1994 Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgaben 2016, 2020 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © period images; © shutterstock / Regien Paassen / benemale / Kathy SG / sea coast / RODINA OLENA / ivgroznii; © pixabay /Nathan_A_Wright
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-547-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Schurke und die Lady« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Meagan McKinney
Der Schurke und die Lady
Roman
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
dotbooks.
Für den, der jemandem lieb ist
Und für Tom und Tommy, die mir sehr lieb sind
Wearing of the Gray
The fearful struggle’s ended now,
And peace smiles an our land,
And though we’ve yielded,
We have proved ourselves a faithful band.
We fought them long, we fought them well
We fought them night and day.
And bravely struggled for our rights
While wearing off the Gray.
IM GRAUEN ROCK
Der schreckliche Kampf ist nun vorbei, Frieden herrscht wieder in unserem Land.
Und obwohl wir aufgeben mußten, Bewiesen wir Stärke in der Treue.
Wir bekämpften sie lange, wir kämpften gut,
Wir bekämpften sie Tag und Nacht. Wir kämpften tapfer für unsere Rechte und alles im grauen Rock.
Lagerlied der Konföderierten
Kapitel 1
Juni 1875
Es war eine unsaubere Hinrichtung gewesen.
Und wenn es etwas gab, das Doc Amoss wirklich verabscheute, dann war es eine schlechte Hinrichtung. Er überblickte die sieben in weiße Tücher eingewickelten Leichen, die in seinem kleinen Zimmer auf dem Boden lagen. Selbst diese Männer, die einst die berüchtigte Dover Gang darstellten, hatten den Respekt eines kurzen, schmerzlosen Genickbruchs durch den Strang und eine schnelle Beförderung zur Hölle verdient. Sie aber waren unsauber gehenkt worden. Jedenfalls war ihr Tod nicht schnell gewesen.
Der Doc schüttelte den Kopf, schob seine Brille hoch und machte sich wieder an die Arbeit. Er hatte schon den ganzen Tag mit der Dover Gang zugebracht. Zuerst hatte er zugesehen, wie sie gehenkt wurden, einer nach dem anderen, bis ihre Leichen von den Galgen reglos und feierlich im durch Pferde aufgewirbelten Staub herabhingen. Danach hatte er geholfen, sie herunterzuschneiden und sie in seine Arbeitsräume zu verfrachten. Landon war eine kleine Stadt und besaß keinen Totengräber, also war es die Aufgabe des Arztes, die Leichen für das Begräbnis vorzubereiten. Er hatte den ganzen Nachmittag gebraucht, fünf von ihnen in die Tücher zu wickeln. Jetzt kam Nummer sechs an die Reihe.
Doc zielte auf den Spucknapf, verfehlte ihn und hinterließ einen kleinen Krater im Staub der nackten Bodendielen. Er sah unter seinem Geschäftsschild ›Haareschneiden, Baden und Rasieren, 10 Cents – schnelle Behandlungen‹ hindurch zum Ausgang des Städtchens, wo sieben Männer sieben Gräber in der anonymen, braunen Erde des flachen Niemandslandes aushoben.
Die Schatten in seinem Büro wurden dunkler. Es war schon spät. Er zog dem sechsten Mann die Stiefel aus und untersuchte seine Mundhöhle, für den Fall, daß der Kerl einen Elfenbeinzahn besaß, den die Stadt verkaufen konnte, um die Hinrichtung zu bezahlen. Doc wickelte ihn ein, dann strich er den Namen auf der Liste aus.
Nun konnte er es nicht mehr länger hinauszögern. Er mußte sich um den letzten Mann kümmern. Den siebten und den übelsten.
Macaulay Cain. Allein die Nennung dieses Namens schickte Doc Amoss einen kalten Schauder über den Rücken. Er hatte den Namen auf genügend Wanted-Plakaten gesehen, um ihn vorwärts und rückwärts buchstabieren zu können. Er hatte sich immer gewünscht, niemals etwas mit diesem berüchtigten Revolverhelden und seinesgleichen zu tun haben zu müssen. Gott und sein Sinn für Gerechtigkeit! Einmal ging die Hinrichtung schief, und dann traf es Macaulay Cain.
Widerwillig sah Doc zu der siebten Gestalt unter dem weißen Tuch hinüber. In seinem ganzen Leben hatte er noch nie einen Mann gesehen, der soviel Schwierigkeiten machte, auf ein Pferd gesetzt zu werden und sich die Schlinge um den Hals legen zu lassen. Der Sheriff hatte all seine Männer einsetzen müssen und selbst als Cains Gesicht am Ende schon durch die schwarze Kapuze verhüllt gewesen war und die Männer bereit waren, dem Pferd die Peitsche zu geben, hatte er noch gekämpft und verlangt, daß sie auf das Telegramm warteten, das ihn freisprechen würde.
Das Telegramm, das niemals kam.
»Verfluchter Mist.« Doc verabscheute unsaubere Hinrichtungen. Es konnte einem schon den Magen umdrehen, wenn man an das steigende Pferd dachte und an Cain, der am Strick zappelte und sich wand, ohne daß ein Genickbruch ihn erlöste. Als schließlich alles vorbei war, hatten die Hilfssheriffs Cain in Docs Haus gebracht. Sie hatten die Fesseln seiner Hände zerschnitten und über seiner Brust in der Art der Geistlichen das Kreuz geschlagen. Doch Doc war derjenige, der ihm die schwarze Kapuze vom Kopf ziehen mußte. Kein anderer hätte es getan. Wenn beim Henken unsaubere Arbeit geleistet wurde, hing die Zunge des Verurteilten heraus und der Gesichtsausdruck war zu einer Maske puren Entsetzens verzerrt, weil der arme Bastard verzweifelt nach Luft schnappte, während sich das Seil um seinen Hals zuzog. Die Hilfssheriffs zuckten sichtlich zusammen, als Doc die Kapuze entfernte; weil sie sich vor dem Anblick fürchteten. Doch bevor das weiße Tuch über Cains Kopf gezogen wurde, konnten sie alle erleichtert aufatmen: Die Miene des Toten unter den struppigen Bartstoppeln war friedlich und gelöst.
Resigniert ging Doc zu dem letzten Körper hinüber. Der Sheriff würde bald kommen, um die Bande zu ihren Gräbern zu bringen. Er mußte sich beeilen.
Er bückte sich, um den Strick aufzuheben, der das Leichentuch zusammenbinden sollte. Es war still in dem Raum. Nur das Summen der grünen Fliegen an den Fensterläden und Docs Atem war zu hören. Er beugte sich mit ausgestreckten Armen über die Leiche, um das Tuch zu fassen.
Dann spürte er es.
Ein anderer hätte den kleinen Tropfen Blut, der auf Docs schwarzen Schuh fiel, vielleicht nicht bemerkt. Ein Mann, der in der Kunst der Medizin weniger geschult war, hätte dieser Kleinigkeit vielleicht keinerlei Beachtung geschenkt, doch John Edward Amoss hatte in den vierzig Jahren Berufserfahrung seines etwa sechzigjährigen Lebens vor allem eins gelernt: Tote Männer bluten nicht!
Natürlich gab es nach einer Hinrichtung durch den Strang leichte Verletzungen um den Hals, aber niemals genug, um einen Blutstropfen über den Tisch zu schicken und auf seine Füße hinuntertropfen zu lassen.
Docs Nackenhaare richteten sich auf. Seine Hand zuckte vor, um das Tuch wegzuziehen, doch instinktiv wich er zurück.
Zu spät.
Eine Hand schoß unter dem Leichentuch hervor und klammerte sich um seine Kehle. Doc quiekte wie ein Präriehund, der von einem Koyoten gebissen wird, doch niemand hörte ihn. Die Bewohner der Stadt hatten sich alle draußen auf dem Feld versammelt, um auf das Begräbnis zu warten.
Ein langer Augenblick verstrich, ohne daß sich einer der Männer bewegte. Doc und der berüchtigte Verbrecher waren wie zu einem seltsamen Standbild erstarrt. In der Stille hörte Doc das rasselnde, mühsame Atmen, als Cain seine Lungen zu füllen versuchte.
In Ermangelung einer klugen Bemerkung krächzte Doc: »Bist du gerade wieder zum Leben erwacht, Sohn?«
Der Outlaw zog das Tuch von seinem Gesicht. Er sah übel aus. Zu übel für ein Wunder. Seine Stimme klang heiser und schmerzverzerrt. »Ja. Sicher. Ich bin die Zweite Auferstehung.«
Doc nickte – nach Lachen war ihm nicht zumute.
»Das Telegramm. Wo ist das gottverdammte Telegramm?« brachte der Verbrecher hustend hervor. Seine Worte waren kaum zu verstehen.
»Niemand hat dich freigesprochen, Sohn. Es kam kein Telegramm.« Während er dies sagte, dachte Doc an die zwölf Morde, für die die Dover Gang verurteilt worden war, und überlegte, wie viele davon wohl auf das Konto dieses einen Mannes vor ihm gegangen waren. Und er fragte sich auch, ob das Endergebnis schließlich dreizehn lauten würde.
Cains Hand krampfte sich enger um seine Kehle. Doc konnte kaum noch schlucken.
»Du belügst mich doch?« Seine Gesichtszüge, die durch das Hängen bereits blaß und ausgezehrt wirkten, spannten sich an.
»In solch einem Moment lüge ich nicht, Sohn.«
Cain sah Doc direkt in die Augen. Dann lächelte er, doch das Lächeln erreichte die Augen nicht. »Ich fürchte, ich werde dich mit mir nehmen müssen, Doc. Ich bin wild entschlossen, aus dieser verdammten Stadt zu fliehen. Auf die eine oder andere Art.« Das Lächeln verschwand. Seine Handgelenke bluteten, die Haut am Hals blutete. Und bei Gott, dachte Doc, seine Augen sind eiskalt.
Doc schluckte, was nicht leicht war, solange dieser Mann ihn in seinem stahlharten Griff hielt. »Man wird dich nicht ein zweites Mal hängen. Das schulden sie dir. Sie haben verdammt schlechte Arbeit geleistet.«
»Das kann man wohl sagen«, hustete der Mann.
Doc gab keine Antwort. Sein Blick blieb am Hals des Mannes hängen. Der Strick hatte blutige Wunden gerissen.
»Hast du ein Pferd?«
Doc löste seinen Blick von den Wunden. »Ja. Hinterm Haus. Kräftiges Indianerpony. Nimm es.«
»Eine Waffe?«
»Hab’ ich nicht. Glaub’ nicht so recht an so was. Ein Doc hat so seine Prinzipien.«
»Dann wirst du wohl mitkommen müssen. Ich muß mich absichern.« Der Mann begann, seine Kehle zu massieren, dann schwang er die Beine über die Kante des Tisches, auf dem er lag. Der Saum seiner Lederchaps war fast ganz abgewetzt, für Doc ein sicheres Zeichen für einen Abtrünnigen. Männer, die vor dem Gesetz davonliefen, würden gewiß nicht in einer Stadt herumbummeln, während ihr Rüstzeug repariert wurde. Der Saum wurde stets abgeschnitten, um für alles mögliche zu dienen – von Ärmelhaltern bis zu Schnürsenkel.
Doc schluckte wieder. Er war sich überdeutlich der Hand an seiner Kehle bewußt, die ihm jeden Moment das Leben abdrücken konnte. Die Angst ließ ihm das Blut aus dem Gesicht weichen. »Was glaubst du denn, wie weit du kommst, wenn du mich hinter dir herschleifen mußt?«
Der Outlaw starrte ihn an. Seine eisigen Augen musterten Docs Wampe und seinen kahlwerdenden Schädel. »Ich brauche Zeit«, war alles, was er sagte. Doc begriff. »Ich werde nichts sagen. Jedenfalls eine ganze Weile nicht. Dann hast du Zeit. Nur verschwinde von hier!«
Die Augen verengten sich zu Schlitzen und erinnerten Doc an den Wolf, den er einmal mitten im Winter gesehen hatte. »Warum solltest du das für mich tun wollen?«
»Ich finde es einfach unsinnig, einen Mann zweimal zu hängen. Du hast das erste Mal überlebt. Muß ja ’n Grund haben. Ich will nicht Gott spielen.«
Der Mann hielt Doc mit seinem Blick fest, wie seine Hand Docs Kehle im Griff hatte. »Ich brauche fünf Minuten«, sagte er schließlich mit heiserer Stimme. »Wenn ich es nicht schaffe, wenn du mich belügst, dann komme ich noch aus meinem Grab zu dir, um mich zu rächen.«
»Ich schwöre, du wirst deine fünf Minuten bekommen. Und wenn ich die Hilfssheriffs einsperren muß.«
Doc nickte so überzeugend, wie er es konnte.
Vorsichtig glitt der Mann vom Tisch, ohne den Griff um Docs Hals zu lösen. Gemeinsam gingen sie zur Hintertür. Einen kurzen Augenblick sahen sich die beiden in einem seltsamen Gefühl des Einvernehmens an. Doc mußte wieder an den Wolf denken, daran, wie er das Gewehr gesenkt hatte, und der Wolf schließlich kehrt machte und fortlief und nur die Erinnerung an die eisigen Augen zurückließ.
Der Mann war mindestens einen Fuß größer als Doc, er war schmal, durchtrainiert und durch die Jahre im Sattel geschickt und agil. Doc hatte keinen Grund, es zu sagen, doch er konnte nicht anders, obwohl seine Kehle noch von dem Griff des Mannes schmerzte. »Viel Glück, Macaulay Cain.«
Verblüfft sah der Outlaw ihn an. Er sah ihn an, als wollte er sagen, er bräuchte keine guten Wünsche von jemandem, der versucht hatte, ihn zu henken. Statt dessen jedoch nahm er wie der Wolf die Gelegenheit wahr und rannte plötzlich und unvermittelt durch die Hintertür hinaus. Mit einem Satz sprang er auf den Rücken des erschreckten Appaloosa im Corral, gab ihm die Sporen und ritt in westlicher Richtung davon, gerade wie ein Indianer, der weder Sattel noch Zaumzeug brauchte, um das Pferd zu den Bergen dem blauen Horizont entgegenzutreiben.
Doc sah ihm nach. Und er empfand eine seltsame Genugtuung, ihn wie den Wolf frei und ungebunden zu sehen.
Red is the rose
That in yonder garden grows
Fair is the lily of the valley
Clear is the water that flows from the Boyne
But my love is fairer than any …
(Rot ist die Rose,
Die in den fernen Gärten blüht,
Rein ist die Lilie im Tal,
Klar das Wasser, das aus dem Boyne fließt.
Doch meine Liebe ist reiner als alles andere … )
Irisches Volkslied, geschrieben von Tommy Makem
August 1875
Sie trug stets schwarz, wenn sie auf Reisen war. Witwen wurden keine Fragen gestellt. Sie drückten alles, was zu sagen war, durch die Farbe ihrer Kleidung aus.
Und genau deswegen hatte Christal van Alen gelernt, schwarz zu tragen. Und sie hatte gelernt, schwarze, wollene Handschuh zu tragen, so daß niemand sehen konnte, daß sie keinen Ehering trug und daher auch keinen Gatten zu betrauern hatte. Und noch mehr: Sie hatte gelernt, den schwarzen Netzschleier über dem Gesicht zu tragen, der sie nicht nur als Witwe glaubwürdiger machte, sondern auch ihre Gesichtszüge verhüllte und ihr Alter unbestimmbar machte. In solcher Aufmachung wurde sie nur selten ausgefragt, wollte sich kaum jemand mit ihr unterhalten. Und so war sie sicherer. Man hätte denken können, daß eine alleinreisende Frau sich den Trost und Beistand der Mitfahrer wünschen würde, doch Christal hatte in der Zeit, die sie im Westen war, ebenfalls erfahren, daß es nur eins gab, was gefährlicher war als ein Trupp abtrünniger Pawnees: ein Fremder, der sich zu sehr für ihre Vergangenheit interessierte.
Die Overland Express-Kutsche krachte in eine Spur-Rinne in der Straße, und Christal wurde gegen etwas Kantiges geschleudert, das sich neben ihr auf dem Sitz befand. Sie warf einen Blick darauf. Es war eine Miniaturnachbildung einer Kommode, der ganze Stolz des untersetzten Möbelhändlers, der ebenfalls mitreiste.
Sie streckte sich wieder und beneidete den Händler fast um seinen Leibesumfang. Die Kutsche konnte sechs Passagiere befördern, doch der Mann neben ihr hatte doppelt lösen müssen, um mit seiner Körperfülle und seinen Möbelmustern im Fahrzeug Platz zu finden. Zwischen ihm und der Kutschenwand eingezwängt, konnte Christal kaum verhindern, daß ihre Röcke zerknautschten. Ihre zierliche Gestalt machte alles nur noch schlimmer. Während der Handelsmann so schwer war, daß ihm die Erschütterungen kaum etwas ausmachten, wurde Christal unablässig bei jeder kleinen Unebenheit der Straße gegen das kantige Werkstück geschleudert.
Sie umklammerte ihre gerippte kleine Tasche und setzte sich wieder gerade mit gekreuzten Fußknöcheln und brav in den Schoß gelegten Händen hin. Als die Straße ebener wurde, warf sie den anderen drei Passagieren, die in Burnt Station eingestiegen waren, einen verstohlenen Blick zu.
Einer davon war ein alter Mann mit einem sanften, großväterlichem Gesicht. Christal hielt ihn zunächst für einen Prediger, als er in seine Tasche griff und eine Bibel herauszog, doch als sie bemerkte, daß das Innere des Buches ausgehöhlt war, um einer kleinen Metallflasche Platz zu bieten, aus der sich der Mann unbekümmert bediente, war sie sich über seinen Beruf nicht mehr ganz so sicher.
Der junge Mann neben ihm, eigentlich noch ein Kind, sah unruhig aus dem Fenster, als würde er sich dafür schämen, bequem in der Kutsche zu reisen, statt, wie es sich für einen Mann gehörte, auf einem Pony nebenher zu reiten. Sein Reisebegleiter konnte durchaus sein Vater sein: eine ergraute Gestalt in einer verblichenen indigofarbenen Jacke und einem gewaltigen grauen, strähnigen Bart, der gut einen Schnitt vertragen konnte.
Niemand plauderte. Der »Prediger« trank, der Mann in der blauen Jacke döste. Der Händler starrte liebevoll auf seine Möbelmuster und dachte wahrscheinlich an seine nächsten Gewinne. Wieder machte die Kutsche einen Satz, der Christal gegen die spitze Kante der Kommode preßte. Diesmal rieb sie sich die Seite, als sie sich zurücksetzte.
»Heiße Henry Glassie, Ma’am.«
Sie sah auf und entdeckte, daß der Händler sie anlächelte. Er hatte ein ausgesprochen freundliches Gesicht, und sie konnte ihn sich gut als Begleitung für eine lange, staubige Reise wie diese durch die Prärie vorstellen. Doch sie wollte keine Begleitung. Sie zog das Schweigen vor. Im Schweigen konnte sie sich verstecken. Wenn auch nicht vor sich selbst.
Durch den Schutz ihres Schleiers starrte sie den Mann an. Mit Bitterkeit überlegte sie, ob die Freundlichkeit in seinen Augen wohl verschwinden würde, wenn sie ihm sagte, wer sie war. Daß Plakate mit ihrem Gesicht von Maine bis Missouri hingen. Daß die Handschuhe, die sie trug, nicht nur den fehlenden Ehering verbergen sollten, sondern auch die Narbe auf ihrer Handfläche, die auf jedem dieser Plakate nachgezeichnet war. Das letzte Plakat hatte sie in Chicago gesehen, und das war drei Jahre her gewesen. Das Gebiet hier in Wyoming schien weit genug davon entfernt, daß sie sich sicher fühlen konnte. Doch jeden Tag machte sie sich aufs neue Sorgen, daß sie sich vielleicht täuschte. In New York war sie in einem Alptraum gefangen gewesen. Nun rannte sie von diesem Alptraum und vor ihrem eigenen Gesicht davon. Und vor dem grausamen Mann, der sie umbringen würde, bevor sie die Wahrheit über ein Verbrechen verkündete, daß sie nicht begangen hatte.
»Madam, darf ich fragen, wie ich die Ehre habe, Sie ansprechen zu können?« Der Mann hob die Augenbrauen, als wollte er um ihren Namen flehen. Er schien wild entschlossen, mit ihr Konversation zu machen.
»Ich bin Mrs. Smith«, antwortete sie mit tiefer, höflicher Stimme.
Sein Lächeln wurde breiter. »Ein reizender Name, Smith. So demokratisch. Und leicht zu behalten.«
Nun hätte sie fast gelächelt. Er hatte ihr förmlich gesagt, wie gewöhnlich ihr Name war … und er hatte recht. Deswegen hatte sie ihn ja auch gewählt. Dennoch hatte Mr. Glassie es auch geschafft, daß sie sich geschmeichelt fühlte. Er besaß offensichtlich das Handwerkszeug eines brillanten Verkäufers: Er redete mit silberner Zunge, sah freundlich und ordentlich aus, und sein Auftreten in seinem modischen grüngrauen Anzug und der großen, perlenbesetzten Nadel in seiner passenden Krawatte ließ darauf schließen, daß er in seinem Beruf sehr erfolgreich war.
Doch arme Witwen kauften kaum neue Möbel, und so war die Unterhaltung zu ihrer großen Erleichterung bald erschöpft. Erneut konnte sie in Ruhe in die platte Prärielandschaft schauen. Gelegentlich zog sie ihr Taschentuch heraus, schob ihre Hand unter den dunklen Schleier und tupfte die Schweißperlen von ihrer Stirn. Die Sonne brannte über ihnen, und Staub drang durch das offene Fenster, um ihr Kleid mit einer schiefergrauen pudrigen Schicht zu bedecken. Sie waren eben erst losgefahren. Noble war eine lange Tagesreise entfernt. Christal war begierig darauf, endlich anzukommen.
In den letzten drei Jahren hatte sie viel über Noble gehört. All ihre Hoffnungen ruhten in dieser kleinen Stadt. Sie hatte es satt davonzulaufen, und sie hatte gehört, daß Noble ein gutes Versteck war. Viele Spieler, viele Frauen und niemand, der überflüssige Fragen stellte. Nicht einmal ein Sheriff. Seit Jahren hatten sie dort keinen mehr gehabt. Man sprach über Noble so wie man über South Pass und Miners Delight redete. Die Stadt war im Zuge des Goldrauschs aus dem Nichts entstanden und genauso schnell wieder untergegangen. Doch die unbekümmerte Art Nobles hatte die Stadt am Leben gehalten, die nun hauptsächlich von Cowboys und Männern bevölkert wurde, die mit der Union Pacific auf dem Weg nach Norden waren. Christal hoffte, dort eine Weile in Ruhe bleiben zu können und sich ihr Geld in einer Küche, beim Faro1 oder, wenn es sein mußte, mit Tanzen zu verdienen, da es keinen Mann des Gesetzes geben würde, der etwas dagegen haben könnte. Es war nicht gerade ihre Lieblingsbeschäftigung, Tänze zu verkaufen – die Männer waren meistens ungehobelt, und manchmal rochen sie schlecht. Aber wenn sie keine andere Wahl hätte, würde sie es tun … das Wichtigste war schließlich das Überleben. Und es gab sehr viel schlechtere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Gerade für eine Frau.
Christals Augen verdunkelten sich, als würde sie die Szenerie um sie herum ausschließen. Lasterhaft. Sie haßte es, über dieses Wort nachzudenken, doch es folgte ihr wie ein Schatten, der noch blieb, wenn die Sonne schon untergangen war. Vor langer, langer Zeit, als sie ein Leben lebte, an das sie sich kaum noch erinnern konnte, hätte ein Wort wie Laster niemals Platz in ihrem Vokabular gehabt. Wörter wie diese existierten im Familienwortschatz nicht. In jener Welt blieb das Laster stets unübersetzt und unerklärt. Für ein junges, wohlerzogenes Knickerbockermädchen2 war ein solcher Ausdruck so bedeutungslos und unverständlich wie etwas auf Gälisch – eine Sprache, die auf Miss Bailey’s Konservatorium für junge Damen ganz gewiß nicht gelehrt wurde. Diese exklusive Mädchenschule in der Fifth Avenue, die ihr vom Schicksal bestimmt gewesen war, hätte ihr derartige Begriffe nicht beigebracht.
Aber das Schicksal war plötzlich aus den Gleisen gesprungen, und nun war sie hier in Wyoming und führte ein Leben, wie sie es sich niemals hätte vorstellen können. Und sie verstand nur zu gut, das Laster bedeuten sollte. Sie hatte drei qualvolle Jahre damit verbracht, seinen Klauen zu entgehen.
»Wir sollten auch draußen auf den Gäulen reiten, Pa. Wegen der Sioux … man weiß nie, wann die angreifen!« Der Junge sah seinen Vater an, der versuchte, unter seinem tiefgezogenen Hut zu schlafen.
»Du bis’ jetzt ’n Gentleman. Pete. Wir ham Geld. Wir reiten nich’ mehr auf Gäulen nebenher. Wenn wir ers’ ma’ in St. Louie sind, kaufen wir uns Klamotten und benehmen uns wie echte feine Herr’n.«
»Wir ham aber keine Eskorte. Nur der Kutscher und ’n Kerl mit’m Gewehr. Was is’, wenn die Sioux uns anhalten? Das hier is’ ihr Gebiet. Und die Cheyenne – jeder weiß doch, wie stinkig die im Moment sind!«
»Noble is’ nur noch ’n Katzensprung entfernt. Die brauchen dich nich’. Pete. Dafür ham wir se ja teuer bezahlt. Und was willste machen, wenn wir in den Zug in St. Louie einsteigen? Willste schieben?«
»Ohhh, Pa!« stöhnte der Junge. Er warf einen verlegenen Blick in Christals Richtung, war offensichtlich glücklich über ihren Schleier und wandte sich dann dem Fenster zu, um seinen Beobachtungsposten wieder aufzunehmen.
Indianer. Jedesmal wenn jemand das Wort erwähnte, richteten sich ihre Nackenhaare auf. Auf ihren letzten Fahrten hatte sie grausige Geschichten über die Kootenai, die Flathead, die Shoshone und die Blackfoot Indianer gehört. Die Geschichten waren schrecklich genug, um ihr Alpträume zu verschaffen. Aber Alpträume waren nicht so schlimm, wenn man selbst in einem lebte. Sie hatte keine Angst vor Indianern.
In diesem Moment hielt die Kutsche an.
Im ersten Augenblick wußte keiner, was geschehen sein konnte. Es gab nichts außer Stille, eine Art schweigende Erstarrung, die nur den Geruch der Angst ausströmte. Dann war das Geräusch von Stiefeln auf dem Dach zu hören, doch Christal begriff, daß es nur der Mann mit dem Gewehr war, der sein Gewicht verlagerte.
»Warum haben wir angehalten?« fragte Mr. Glassie, umklammerte seine kleine Kommode und blickte sich um, als wüßte ein anderer in der Kutsche die Antwort.
»In Dry Fork soll’n wir gar nich’ halten.« Der grauhaarige Mann runzelte die Stirn und steckte dann seinen Kopf aus dem Fenster. Er öffnete den Mund, um dem Kutscher etwas zuzurufen, doch aus irgendeinem Grund blieben ihm die Worte im Halse stecken. Als er seinen Kopf wieder hineinzog, hatte er den Lauf einer Flinte direkt vor der Nase.
Christal packte ihre Börse so fest, daß die Knöchel weiß hervortraten. Plötzlich schoßen ihr all die Geschichten über Indianer und Outlaws in den Sinn, so daß sie wie gelähmt dasaß. Ihr Mund wurde trocken. Durch ihren Schleier hindurch sah sie den Prediger seine Bibel zuschlagen, während sein Gesicht vom ernüchterten Schock gekennzeichnet war. Der Junge wirkte, als wäre er verrückt genug, sich denjenigen vorzunehmen, der seinem Vater die Waffe unter die Nase hielt. Sie hörte, wie draußen die Pferde unruhig aufstampften. Eine Sekunde später ertönte über ihnen auf dem Kutschdach ein schlurfendes Geräusch. Dann knallte ein Gewehr zu Boden.
Eine Hand, kräftig, weiß und ganz und gar nicht indianisch griff in die Kutsche und öffnete den Riegel. Christal drückte sich ängstlich in ihren Sitz. Dann wurde ein abgenutzter Stiefel auf die Schwelle gestellt, und sein Besitzer lehnte sich hinein, wobei er sich auf dem Knie abstützte. »Schönen guten Tag, Leutchen.« Der Mann grinste und entblößte eine Reihe schlechter Zähne. Er war unrasiert und schmutzig, und seine kleinen, bösen Augen musterten blitzschnell die Passagiere. Als er sah, daß seine Drohung deutlich war, lachte er.
»Ist das ein Überfall?« fragte Mr. Glassie keuchend. Er hielt sein Miniaturmöbel wie einen Schild vor die Brust.
Christal betrachtete den Outlaw durch ihren schützenden Schleier hindurch, und sie spürte, wie ihr Herz so heftig klopfte, als würde es ihr Korsett sprengen wollen.
»Cain!« brüllte der Mann und senkte sein Gewehr. »Die wollen wissen, ob das ein Überfall ist!« Er lachte wieder und zog sein Tuch über Mund und Nase, um sich über sie lustig zu machen.
»Warten Sie!« sagte Mr. Glassie hastig, doch bevor er noch zu Ende gesprochen hatte, wurde der Mann an der Tür zur Seite gezogen, und ein anderer nahm seinen Platz ein.
Noch nie hatte Christal einen solchen Mann gesehen. Oberflächlich betrachtet wirkte er wie der andere, vielleicht etwas größer und breitschultriger.
Doch er war ebenfalls unrasiert, seine Bartstoppeln wiesen einige Tage Wachstum auf. Sein Hemd war verstaubt und abgenutzt und um seinen Hals hatte er ein verblichenes, scharlachrotes Tuch gebunden, mit dem er sich bei Bedarf maskieren konnte. Doch etwas war anders, bemerkenswerter. Er schien gefährlicher als der andere. Und seine Augen ließen ihr Herz aussetzen. Noch nie hatte sie solche stählernen Augen gesehen. Augen, die einen erfrieren ließen.
»Männer raus!« knurrte er. Die Augen bohrten sich in Christals Gestalt, und sie wand sich unter seinem eisigen Blick. Sie wußte, daß er sie unter dem Schleier nicht sehen konnte, doch es war nur ein kleiner Trost.
Christal hatte den Eindruck, als hätte er sie angegriffen, und als er sich zu ihrer Erleichterung abwandte, um die männlichen Mitreisenden zu mustern, sackten ihre Schultern nach vorne, und sie stieß den Atem aus, den sie, ohne es zu bemerken, angehalten hatte.
»Ist das ein Überfall?« wiederholte Mr. Glassie. Er schien nicht gewillt, sich aus der Kutsche zu bewegen, bevor die Situation nicht etwas klarer war. »Wie die Herren sicher sehen, haben wir eine Lady im Wagen. Wir können nicht einfach aus der Kutsche steigen und sie hier allein zurücklassen –«
»Ich sagte, die Männer raus!« Der Outlaw mit den kalten, grauen Augen warf Mr. Glassie einen Blick zu, der genügte, um den Händler endlich davon zu überzeugen, seine Möbelmuster im Stich zu lassen und auszusteigen.
Einer nach dem andere kletterte aus der Kutsche. Pete setzte eine trotzige Miene auf, die wohl besagen sollte, daß er keine Angst vor diesen Männern hatte. Sein Vater dagegen wirkte angstvoll, als befürchtete er, soweit gekommen zu sein, nur um seine Träume auf einmal durch einen Überfall zerschlagen zu sehen. Christal beobachtete den Prediger durch das Fenster. Seine Hände zitterten, als er sie über seinen Kopf hob. Ihre eigenen Hände, die sich an den Fensterrahmen klammerten, waren feucht vom kalten Schweiß.
Sie blickte in die Ferne und suchte den Horizont ohne Hoffnung nach Hilfe ab. Die Brücke von Dry Work hatte diesen Räubern augenscheinlich als Versteck gedient, während ihre Beute auf sie zugerollt kam. Christal konnte ihre Pferde unter der Brücke ausmachen. Es waren fünf.
»… ich bin ein Vertreter der Paterson Furniture Company in Paterson, New Jersey, und meine Firma wird von dieser unerhörten Behandlung zu hören bekommen, verlassen Sie sich darauf, meine Herren!« verkündete Mr. Glassie dem ersten Mann, der ihn auf Waffen durchsuchte. Der zweite, der Mann mit den Stahlaugen, tastete die blaue Jacke des alten Mannes ab, während Pete ihn zornig anstarrte.
»Ich bin ein armer, armer Mann, Mister«, jammerte Petes Vater, als er durchsucht wurde. »Sie brauchen mich nich’ zu bestehlen, ich hab’ doch nix.«
»Keine Waffen, Cain«, rief der erste Mann.
Cain nickte. Er hob Petes Mantel an, griff an seine Hüften und fand einen sechsschüssigen Revolver im Bund seiner Jeans. Er nahm sie und schob den Jungen beiseite.
»Alle herhören.« Cain schoß ein paarmal in die Luft, und augenblicklich schenkten ihm alle ihre volle Aufmerksamkeit, der Kutscher und der Mann, der als Schutz mitgereist war und nun auf der Erde stand, eingeschlossen. »Die Männer werden den Rest des Weges zu Fuß gehen. Ihr werdet der Kutsche folgen.« Cain sah zu den zwei Reitern, die die Pferde unter der Brücke hervorgeholt hatten. »Die Jungs werden dafür sorgen, daß ihr sicher ankommt.«
»Wo?« fragte Pete tapfer.
Cain warf ihm einen finsteren Blick zu. »In einer Stadt namens Falling Water. Schon mal davon gehört, Junge?«
Pete schob trotzig sein Kinn vor. »Klar. Is’ ’ne verdammte Geisterstadt. Seit Jahren lebt da keiner mehr.«
»Stimmt. Aber du wirst jetzt eine Weile dort sein.«
»Sie entführen uns?«
»Genau.«
»Warum?«
Christal klammerte sich an der Tür fest und wartete angstvoll auf die Antwort. War dies wirklich nur ein einfacher Überfall, oder ging es hier um etwas Komplexeres, etwas Schlimmeres? In ihrem Geist spielte sie ein Szenario nach dem anderen durch. Das schlimmste davon war, daß ihr Onkel sie irgendwie gefunden hatte.
»Der Overland Express schickt am Dienstag seine Löhne auf den Weg. Wir brauchen euch alle als Tauschobjekte.« Cain steckte die Waffe des Jungen in den Bund seiner eigenen Hose. »Ihr Männer geht hinter der Kutsche her. Wenn jemand aus der Reihe tanzt, hat Zeke hier die Erlaubnis, ihn mit der Peitsche wieder reinzutreiben.« Der Mann, der Zeke genannt worden war, trieb seinen Fuchs auf die Gruppe zu. In seiner Hand hielt er eine gewaltige, brutal aussehende Peitsche, die gewiß leicht die Haut eines Mannes vom Rücken ziehen konnte.
Christal sah, wie sich dumpfer Schrecken in die Mienen der anderen Fahrgäste schlich. Auch sie hatte Angst, aber es war tröstend, daß nicht ihr Onkel hinter dieser Sache steckte. Wenn Baldwin Didier sie gefunden hätte, würde sie den Abend nicht überlebt haben. Bei diesen Verbrechern hatte sie wenigstens noch eine Chance.
»Solange können Sie uns nicht festhalten! Dienstag ist erst in vier Tagen!« rief Mr. Glassie aus, und dachte dabei offenbar an seine nun fehlenden Gewinne.
Cain zuckte die Schultern. Was kümmerte es ihn?
»Wer sind Sie denn, guter Mann, daß Sie glauben, Sie könnten uns einfach so behandeln?«
»Macaulay Cain.«
Pete keuchte auf. »Macaulay Cain! Macaulay Cain ist doch vor einem Monat in Landen gehängt worden!«
»So sagen einige Leute.«
»Und einige sagen, Macaulay Cain wäre davongekommen und hätte sich der Kineson Gang angeschlossen. Is’ das hier die Kineson Gang?« fragte der Vater des Jungen, das Entsetzen stand ihm im Gesicht geschrieben.
»Vielleicht ist es so, und wenn ihr recht habt, dann solltet ihr uns besser keinen Ärger machen.« Cains Stimme war so leise, daß Christal ihn nicht hätte hören können, wenn er nicht direkt neben dem Kutschfenster gestanden hätte. Die Drohung, die durch die Worte des Mannes drang, sandte ihr einen eiskalten Schauder den Rücken hinunter. Nun begriff sie, daß ihre Erleichterung zu voreilig gewesen war. Diese Männer waren Outlaws. Sie hatten schreckliche Verbrechen begangen, hatten sogar Menschen umgebracht. Sie wurden gesucht und gejagt, und sie hatten nichts zu verlieren. Und sie war die einzige Frau.
Ein weiterer Mann kam von der Brücke herübergeritten. Er führte die letzten zwei Pferde an den Zügeln, machte sie an der Kutsche fest und gesellte sich zu Zeke.
Christal hing fast aus dein Kutschenfenster heraus, als Zeke die sechs Männer hinter die Kutsche trieb, wo sie sie nicht länger sehen konnte.
Christal biß sich auf die Lippe und nahm wieder ihren Platz ein. Zwei Pferde waren an die Kutsche gebunden worden. Das bedeutete, einer würde den Wagen lenken. Dann blieb einer der Outlaws übrig und mußte entweder zu Fuß gehen … oder mit ihr in der Kutsche fahren.
Ein plötzlicher Anfall von Panik überfiel sie, und sie wäre am liebsten aus der Kutsche gesprungen, um bei den anderen Passagieren mitzulaufen. Sie wollte nicht alleine im Wagen fahren. Und noch weniger wollte sie mit einem dieser Verbrecher fahren. Am allerwenigsten mit dem Mann mit den eisigen grauen Augen.
»Behandeln Sie ja die Witwe gut«, hörte sie Pete nun drohen. »Wir stehen hier bestimmt nicht rum und sehen zu, wenn Sie ihr was tun!« Seine Worte rührten sie. Wie tapfer war dieser Junge doch, so etwas zu sagen. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sich ein Mann zum letzten Mal um ihr Wohlergehen gekümmert hatte.
Das Geräusch eines schrillen Gelächter jagte ihr eine Gänsehaut den Rücken hinunter. »Keine Sorge, Bursche. Ich nehm sie zu mir!«
»Ich fahre mit ihr.« Die zweite Stimme klang bestimmt und ließ keine Diskussionen zu.
Ein langes haßerfülltes Schweigen entstand, bevor der andere Verbrecher sagte: »Okay, Cain. Geh hin und sieh sie dir an. Wahrscheinlich ist sie sowieso zu alt, um mit ihr was anzufangen.«
Die Kutsche quietschte, als die eisernen Räder sich ein Stück bewegten. Die Anzahl der Pferde hatte sich verdoppelt, und das Geklirre von Zaumzeug und das Knarren der Sättel war nun viel lauter. Zeke ließ seine Bullenpeitsche knallen, doch es war offenbar nur zur Einschüchterung gedacht, denn keiner der anderen Fahrgäste schrie auf. Dennoch zerschnitt das Geräusch die Stille der Prärie wie ein Revolverschuß.
Christals Herz hämmerte vor Furcht. Sie trug eine kleine Muffpistole in ihrer Börse – eine winzige Waffe, die so genannt wurde, weil die Ladies in London diese in ihrem Muff versteckten, wenn sie durch weniger anheimelnde Gegenden gehen mußten. Doch sie hatte sie sich nur leisten können, weil sie schon sehr alt war und, anders als die modernen Repetierwaffen, bloß einen Schuß hatte. Sie hätte schon eine Närrin sein müssen, um die Pistole hier in der Kutsche, umgeben von bewaffneten Outlaws zu ziehen. Ihr blieb nichts anderes, als ihre Angst zu unterdrücken und abzuwarten. In diesem Moment ging die Tür auf.
Der Verbrecher namens Cain sprang mit seinem Gewehr hinein. Er zog die Tür geräuschvoll zu, hämmerte dann zweimal mit dem Gewehrkolben gegen das Dach und die Kutsche zog an. Ohne ihre Gegenwart zur Kenntnis zu nehmen, warf er sich auf die andere Bank, trat Mr. Glassies Miniaturkommode zu Boden und legte die Beine auf das geschätzte Stück.
Sie starrte ihn durch den Schleier an, während ihr das Blut vor Furcht in den Ohren rauschte. Er hatte das Gewehr über die Knie gelegt und zog damit ihren Blick auf die langen kraftvollen Beine. Er trug Chaps, deren Leder an den Innenseiten der Schenkel von den vielen Stunden im Sattel blankgescheuert war. Die Messingsporen, die an seinen Stiefeln befestigt waren, zerkratzten das Holz von Mr. Glassies Möbel. Der Mann war dreckig, voller Staub und schweißverklebt. Er strömte einen Geruch von Schwarzpulver aus, das seine Hände und sein Hemd befleckt hatte. Christal erwartete, daß nun ein übler Tiergeruch in ihre Nase dringen würde, von der Art, wie der erste Verbrecher mit den verrotteten Zähne ausgedünstet hatte. Statt dessen nahm sie einen moschusartigen männlichen Duft wahr, der sie gleichzeitig abstieß und anzog.
Es war heiß in der Kutsche. Die Sonne stand im Zenit, und der Staub wehte in das offene Fenster. Christal sehnte sich danach, sich den Schweiß abzutupfen, aber sie traute sich nicht. Sie hielt die Hand an ihrer Börse, preßte sie von außen gegen den Pistolengriff und beobachtete den Mann im Schutz ihres Schleiers. Die Schweißtropfen perlten ihre Schläfen hinunter und fielen zwischen ihre eingeschnürten Brüste.
Cain starrte aus dem Fenster, während er sich mit Zeigefinger und Daumen den Schweiß von den Augenlidern rieb. Schließlich löste er den Knoten seines Halstuches, damit er damit sein Gesicht abwischen konnte.
Sie keuchte vor Schreck auf. Der Hals des Mannes war rundherum mit einer häßlichen, schlechtverheilten Narbe umgeben. Und sie konnte sich nur eine Ursache für eine derartige Wunde vorstellen.
Der kalte, stahlharte Blick wandte sich ihr zu. Er berührte die Narbe und lächelte sie zynisch an, wobei er starke, weiße Zähne entblößte.
Dann beugte er sich vor. »Haben Sie schon mal die Schlinge um den Hals gespürt, Ma’am?« Sein Lachen war polternd und rauh.
Instinktiv wanderte ihre Hand zu ihrem Hals. Die andere Hand, unter deren Handschuh ebenfalls eine Narbe verborgen war, ballte sich zusammen, als wollte sie sie vor Blicken schützen. Sie schluckte und zwang sich, nicht an ihre Vergangenheit, nicht an Baldwin Didier zu denken. Ihr Onkel wollte ihren Tod. Wenn er nach ihm gegangen wäre, hätte er sie hängen sehen. Doch statt dessen hatte man sie nur ihrer Jugend beraubt. Bis vor drei Jahren war sie in der Park View Anstalt eingesperrt gewesen.
Der Räuber setzte sich nun in den Polstern zurück und musterte ihre schwarzgewandete Gestalt. Ohne Warnung riß er sein Gewehr hoch und zielte auf sie. Christals Herz setzte aus. Sie wartete darauf, daß er den Hahn zog. Doch statt dessen schob er den Lauf unter ihren Schleier und hob ihn an.
Ihre Hände griffen nach dem Lauf, um ihn aufzuhalten. Sie brauchte den Schutz des Schleiers. Wenn sie in seine Augen sah, wußte sie, daß es sein mußte. Er durfte ihr Gesicht nicht sehen. Er durfte sie nicht so verletzbar machen.
Sie versuchte, das Gewehr wegzuschlagen, aber er hielt es fest. Plötzlich wurde sie sich sehr deutlich des schwarzen, glänzenden Laufes bewußt, und entsetzt starrte sie ihn an, während er langsam den Schleier hob.
Dann enthüllte er mit einem Ruck ihr Gesicht.
Überraschung und Wohlwollen funkelten augenblicklich in seinen Augen auf. Er hatte ganz sicher nicht erwartet, ein blondes, neunzehnjähriges Mädchen zu sehen, das seinem Blick trotzig standhielt.
Cain sagte kein Wort. Sie starrten sich einen langen Moment gegenseitig an und schätzten den anderen ab. Christal hatte Angst, aber die Erfahrung hatte sie, gelehrt, dies niemals zu zeigen. So bot sie ihm eine reglose, marmorne Fassade dar, was für ein Mädchen, die in der edlen Knickerbockergesellschaft herangewachsen war, keine große Schwierigkeit bedeutete. Cain erwiderte den Blick mit einem rätselhaften Ausdruck auf seinem Gesicht.
Christal wandte ihr Gesicht ab und sah teilnahmslos aus dem Fenster, als würde sie einen niederen Bediensteten entlassen.
Doch Cain setzte den Lauf an ihre Wange und zwang sie, ihn wieder anzusehen.
Ihre Augen funkelten vor Zorn und Angst. Wieder erwiderte sie seinen Blick. Seine Augen waren so kalt und stählern wie der Lauf des Gewehrs an ihrer Wange. Dann tat er etwas Seltsames. Langsam senkte er die Waffe. Ihr Herz machte einen Satz, als er sich mit ausgestrecktem Arm zu ihr herüberbeugte, doch er zog ihr nur den Schleier wieder über das Gesicht. Dann setzte er sich zurück, warf ihr einen letzten, merkwürdigem Blick zu und sah gedankenverloren wieder aus dem Fenster.
»Warum hat man Sie hängen wollen?« fragte sie.
Er wandte sich ihr erneut zu und starrte ihr ins Gesicht, als wäre der Schleier nicht vorhanden. Sie glaubte ihm jedes der nun folgenden Worte.
»Vielleicht, weil ich es nötig hatte.«
Sie zog sich in ihre Ecke zurück und versuchte, die Angst in ihrer Kehle niederzuhalten. Sein Lächeln war sowohl freudlos als auch zufrieden. Dann sah er schließlich wieder in die endlosen Prärie hinaus, als würde Christal gar nicht existieren.
Kapitel 2
Je weiter sie nach Westen fuhren, desto hügeliger wurde das Gelände. Die flache Prärie mit seinem Beifuß und den struppigen Gräsern wich niedrigen Pinienwäldern. Durch das offene Fenster konnte Christal das Knurren und Fluchen der anderen Passagiere hören, die mit der Kutsche Schritt halten mußten, doch als das Terrain schwieriger wurde, drangen die Stimmen immer schwächer an ihr Ohr. Bis sie schließlich ganz aufhörten.
Die Kutsche kletterte nun in die Vorläufer der Rockie Mountains. Schneebedeckte Felsspitzen aus Granit ragten in der Ferne empor, und als sie eine besonders steile Straße erklommen, wo der Grat des Berges mit den Wolken zu verschmelzen schien, glaubte Christal, sie könne geradewegs in den Himmel schauen. Aber die Strecke war unwegsam, und sie hatte kaum Zeit, sich in Staunen zu ergehen. Die Kutsche schwankte und holperte über einen weniger ausgefahrenen Pfad, und sie mußte ihre ganze Aufmerksamkeit darauf verwenden, auf ihrer Bank sitzen zu bleiben, damit sie nicht auf den Boden geschleudert wurde. Oder noch schlimmer: in den Armen dieses Mannes landete.
Schließlich kam die Kutsche schwankend zum Stehen. Christal warf einen verstohlenen Blick aus dem Fenster. Doch alles was sie entdecken konnte, waren Felsen, Pinien und der holprige Pfad hinter ihnen, der durch die wettergegerbten, zerklüfteten Berge führte. Eingeschüchtert warf sie dem Outlaw einen anklagenden Blick zu.
Cain, den die ruppige Reise kaum mitgenommen hatte, nahm seine Füße von Mr. Glassies geliebtem Muster. Er sah sie nicht an, sondern stieß die Tür auf und bedeutete ihr knapp auszusteigen.
Einerseits wollte sie verzweifelt dieser Kutsche entfliehen und nachsehen, ob die anderen Passagiere aufgeholt hatten, doch andererseits hätte sie sich am liebsten gar nicht gerührt, um nicht die Pistole in der Börse loslassen zu müssen.
»Ich sehe keine Bewegung Ihrerseits, Ma’am.«
Sie starrte ihn an. Selbst durch ihren Schleier konnte sie seine erstaunlichen, grauen Augen erkennen. Tapfer kletterte sie aus der Kutsche.
Zu ihrer Überraschung befanden sie sich in einem Ort. Vor ihr ragten drei Gebäude auf, von denen zwei brüchig und zerfallen war. Blauer Himmel schimmerte wie Flicken durch Löcher in den Wänden. Das dritte Gebäude war einst ein Saloon gewesen, doch das oberste Stück der Fassade war heruntergekommen und versperrte nun den Eingang. Christal hob die Hand, um die Sonne abzuschirmen. Über den Schwingtüren des Saloons hing noch ein Schild, das jedoch derart viele Einschußlöcher hatte, daß die Schrift nicht mehr lesbar war. Das Geräusch von rauschendem Wasser, das aus der Schlucht hinter dem Saloon kam, bot den einzigen Anhaltspunkt, wo sie sich befanden. Die Männer hatten gesagt, sie wollten sie zu einer Geisterstadt namens Falling Water bringen. Und dort waren sie zweifellos angekommen.
Sie wandte sich um, um ihren Gefängniswächter anzusehen. Von den Männern aus der Kutsche war auf der staubigen Straße noch nichts zu sehen. Statt dessen kamen nun drei andere mit Gewehren hinter dem Saloon hervor. Cain starrte sie mit unbewegter Miene an.
»Wo sind die anderen?« fragte er einen der Männer, der sich ein veraltetes Sharps-Gewehr umgehängt hatte.
Cain machte mit dem Kopf eine Bewegung die Straße hinunter. »Sie kommen.«
Die Männer stießen ein Gebrüll aus, und stiegen über die hinabgestürzten Planken, wobei ihr Unbehagen sich zusehends in Jubeln verwandelte.
»Wir haben sie! Hey, wir haben sie!« tönte einer der Männer. Ein zweiter stieß schrille Pfiffe aus, während der dritte zu Cain hastete.
»Hab’ n Raum gefunden, wo wir sie einsperren können. Wie du gesagt hast.« Der Mann war klein und picklig. Obwohl ihr Gesicht durch den Schleier verborgen war, grinste er sie schmierig an, daß sie unwillkürlich einen Schritt zurücktrat. »Es ist oben im Saloon. Könnte nich’ besser sein. Ehrlich, Könnte nich’ besser sein.«
»Wo ist der Schlüssel?« wollte Cain wissen, der sich offenbar nicht von der Begeisterung des Mannes anstecken ließ. Er streckte die Hand aus, und der kleine Mann reichte ihm gehorsam den Schlüssel.
»Was haben wir denn da?« Ein zweiter Mann, groß, mit häßlich grobem Gesicht, der seine fettigen Haare mit einem Lederband zurückgebunden hatte, kam herüber. Er wirkte mehr als nur neugierig, als er vor Christal trat und den Schleier anheben wollte. Christal schreckte zurück und prallte an Cains Brust.
»Das reicht«, knurrte Cain den Großen an.
Und dieser zog sich zurück.
Cain legte einen Arm fest um ihre Taille. Sie wußte nicht, ob er sie am Fliehen hindern oder vor den anderen schützen wollte. »Wir haben eine Menge zu tun, bevor die anderen kommen. Boone«, sagte er und winkte dem Grobian zu, »gib den Pferden Wasser.« Er wandte sich zu dem Mann mit dem gemeinen Grinsen und dem dritten Kumpanen, einem alten Mann um die sechzig, der gerade über die Bretter stolperte. »Ihr zwei besorgt etwas zu essen. Ich habe Hunger, und ich werde unangenehm, wenn ich hungrig bin.«
Die zwei nickten, schulterten ihre Gewehre und verschwanden wieder hinter dem Saloon. Boone warf Christal noch einen Blick zu, bevor er und der Verbrecher, der die Kutsche gefahren hatte, die Pferde zum Paddock südlich vom Saloon führten.
Wieder war sie allein mit Cain. Nur sie und er, verlassene Häuser, Staub und der erbarmungslose, blaue Himmel. Ihre Kehle war so trocken wie die Straße, und sie schluckte. Sie wollte nicht ohne die anderen Fahrgäste irgendwohin gebracht werden, und ihre Gedanken rasten auf der Suche nach einem Fluchtweg in ihrem Kopf umher. Ihre Hand umklammerte die Börse fester, ihre Finger tasteten nach dem Hahn, aber schon packte Cain wieder ihren Arm. Der Drang wegzulaufen war so stark, daß sie bereits die Röcke anhob, um die Beine ungehindert bewegen zu können, doch Cain griff nun mit beiden Händen zu und zog sie in Richtung Saloon, bevor sie noch ein Wort des Protestes stammeln konnte.
»Wohin gehen wir?« fragte sie, während sie gegen seinen eisernen Griff kämpfte und ihr Herz wild in ihrer Brust hämmerte.
Er hielt an. Dann riß er den Schleier von ihrem Gesicht und warf ihn auf die Straße. Ein Windstoß packte ihn und wirbelte ihn davon.
»Ich brauche den Schleier«, sagte sie und verbarg ihre Angst hinter ihrer trotzigen Miene.
Zum ersten Mal entdeckte sie ein winziges Aufleuchten von Mitgefühl in seinen Augen. Ruhig antwortete er: »Ja. Sie müssen dieses Gesicht wirklich vor den anderen Männer verstecken. Aber im Moment will ich sehen, mit wem ich rede.« Er drückte ihren Arm und schob sie wieder auf den Saloon zu, wobei ihre Börse und die Pistole darin außer Reichweite von ihrem freien Arm baumelte.
Man hatte die Trümmer vor dem Eingang so weggeräumt, daß ein kleiner Durchlaß entstanden war. Als er sie durch die Schwingtür geschoben hatte, ließ er sie los. Christal ging ein paar Schritte und traute ihren Augen nicht. Im Saloon sah es nicht anders aus als auf der Straße. Eine dicke Staubschicht bedeckte die rohen Bodenbretter, die Bar, die umgestürzten Stühle – alles.
»Die Treppe rauf.«
Ihr Atem stockte. Sie wirbelte zu ihm herum. Sie war entschlossen, nicht mit ihm in die Schlafzimmer des Saloons zu gehen. Lieber würde sie ihn auf der Stelle erschießen, als sich vergewaltigen zu lassen.
»Los doch«, forderte er sie auf.
Sie blickte sich nach einer Fluchtmöglichkeit um. Doch die einzige Tür war die, die er versperrte.
Er trat auf sie zu, und seine Gesichtszüge wirkten im Dämmerlicht des Saloons noch härter. »Wie heißen Sie?«
»Christal«, flüsterte sie, ohne ihn anzusehen.
»Christal was?«
»Christal Smith.«
Ein Hauch von einem Lächeln flog über seine Lippen. »Nicht Mrs.?«
»Doch. Mrs. Christal Smith«, fauchte sie.
»Wie lange ist er schon tot?«
Sie hätte fast »wer?« gefragt, besann sich dann aber schnell. »Mein Mann ist vor sechs Wochen gestorben.«
»Sie können nicht besonders lange verheiratet gewesen sein.«
Sie gab ihm keine Antwort.
Cain zuckte die Schultern. Mit einem tiefen Knurren sagte er: »Wir alle müssen sterben.« War da ein Hauch von Gefühl in seiner Stimme gewesen? Wenn ja, so betete Christal, daß sie daran appellieren konnte. Wenn nicht, konnte sie nur hoffen, daß Gott gnädig mit ihrer Seele sein würde.
»Wollen Sie wissen, wer ich bin?« Er verschränkte die Arme über seiner breiten Brust. Das Gewehr hatte er in der Kutsche zurückgelassen, aber mit den beiden Sechsschüssern, die in zwei Holstern an seiner Hüfte hingen, brauchte er es nicht. Nun trat er auf sie zu. Christal versuchte, ihre Stimme kühl und emotionslos zu halten. Je weiter er von der Tür wegging, desto größer waren ihre Chancen zu fliehen.
Langsam antwortete sie: »Ich weiß, wer Sie sind.« Er lächelte. »Wer bin ich denn?«
Sie blickte noch einmal verstohlen zu Tür, während ihre Nerven bis zum Zerreißen angespannt waren. »Sie sind Macaulay Cain, der gesuchte Verbrecher.«
Er machte noch einen Schritt auf sie zu. Und plötzlich stürzte sie los. Sie rannte los, als wäre der Teufel hinter ihr her, erreichte die Schwingtüren und spürte Hoffnung in sich aufkeimen. Doch er folgte ihr, und hatte keine Mühe, sie in ihren hinderlichen Röcken einzuholen. Sie stolperte, fiel auf die Straße, ihre Börse flog ihr aus der Hand und landete in unerreichbarem Abstand im dicken Staub vor dem Saloon.
Er ließ sich auf die Knie fallen, riß sie auf den Rücken herum und hielt ihr die Arme über dem Kopf fest.
Sie kämpfte, um sich loszumachen, sah sein dunkles Gesicht vor dem leuchtenden Himmel dicht über sich. Sie riß ihr Knie hoch, traf ihn jedoch nicht, und so bäumte sie sich wie ein Fohlen auf, das seinen Reiter abwerfen wollte. Cain schien keine Mühe zu haben, sie festzuhalten und gluckste vergnügt. Dafür hätte sie ihn erschießen können. Sie tastete nach der Börse, die nur knapp aus ihrer Reichweite entfernt lag und konnte bereits die Seidenkordel spüren, doch im gleichen Moment riß er ihre Arme zur Seite. Sie war gefangen.
Ihr Atem kam stoßweise und zornig, und sie konnte sich nicht wehren, als er die dicke Strähne streichelte, die sich aus den Haarnadeln gelöst hatte. Er hob eine Locke an, deren helle Farbe auffallend mit den schwarzen Härchen auf seiner Hand kontrastierte. »Lassen Sie mich los!« fauchte sie.
»Ihre Haare haben die Farbe von Butter, wußten Sie das?« Seine Mundwinkel verzogen sich, als versuchte, er etwas zu unterdrücken, was er nicht empfinden wollte.
»Ich sagte, lassen Sie mich los!«
Er strich sanft über ihren hohen Kragen, der schmucklos war, weil sie zu wenig besaß, um sich selbst die schlichteste Brosche leisten zu können. Ihr Kinn in der Hand, zwang er sie, ihn anzusehen. »Nun kann ich auch Ihre wunderschönen Augen sehen. Die Farbe des Himmels. Hat Ihr Gatte Ihnen das jemals gesagt?«
»Was geht Sie das an?« fragte sie wütend.
Er ignorierte ihre Erwiderung. Seine Hand glitt zu ihrer Taille. Sie wand sich, doch er bewegte sich keinen Zentimeter. Er liebkoste den schäbigen Stoff ihres Rockansatzes, strich dann mit den Knöcheln über die Rundung ihrer Hüften. Seine Stimme war heiser, als er sagte: »Sie haben eine wunderschöne Wespentaille. Sehr schmal«, wiederholte er fast widerwillig.
Langsam wanderte sein Blick zu ihren Brüsten. Aus dem Funkeln seiner Augen konnte sie schließen, daß es ihm gefiel, wie ihr Busen sich unter ihren heftigen, verzweifelten Atemstößen hob und senkte. Oh ja, und wie es ihm gefiel.
Sie schürzte ihre Lippen, um ihn anzuspucken. Niemand durfte sie so ansehen. Niemand.
»Wenn Sie mich anspucken. Ma’am, wird dieser Yankee-General Butler neben mir wie ein verdammter Ritter wirken.«
Heiße Wut traf auf Eis. Ihre Kenntnisse über die Kriegsereignisse waren begrenzt, aber sie wußte, wer Butler war. Er hatte die Frauen von New Orleans als Prostituierte freigegeben, als sie es gewagt hatten, auf einen seiner Soldaten zu spucken. Christal gab ihr Vorhaben auf.
Statt dessen stieß sie ein wütendes Heulen aus, und er ließ sie schließlich los. Er half ihr auf die Füße, und als sie nach ihrer Börse greifen wollte, zog er diese an der Seidenkordel aus dem Staub. Dann umfaßte er ihre Taille, und während sie sich wand, nach ihm kratzte und trat, zog er sie wieder auf den Saloon zu. Doch so sehr sie sich auch wehrte, mit seiner gewaltigen Kraft hielt er sie im Arm, als wäre sie nichts als eine Puppe. Sie mußte sich fügen.
Er zerrte sie durch die Schwingtüren und auf die Treppe zu, wo er sie vor sich her schubste. Wieder wehrte sie sich verzweifelt, doch er ging einfach Stufe für Stufe nach oben, wobei seine schweren Stiefel laut durch den Raum dröhnten.
»Nein«, keuchte sie und versuchte, sich aus seinem Griff zu lösen, doch er beendete ihre Versuche, indem er sie plötzlich packte und sie wie einen Sack über die Schulter hievte. Sie trat nach ihm und zappelte so heftig, daß ihre Unterröcke bis zu ihren Oberschenkeln hochrutschten, doch es nützte alles nichts. Er hielt sie in seinem eisernen Griff und trug sie die Treppe hoch. Oben angelangt betrat er ein Zimmer, ließ sie auf eine dreckige Matratze fallen und warf ihre Börse auf einen Stuhl, der viel zu weit von ihr entfernt war.
Durch den Staub, der aus der Matratze aufwirbelte, starrte sie ihn haßerfüllt an. Er stand zwischen ihr und ihrer Börse – sie hatte keine Chance. Er würde sie vergewaltigen, ohne daß sie vorher an ihre Pistole kam.
Doch sie würde sich nicht kampflos ergeben. Und wenn er sie umbringen würde!
Er beugte sich über sie, und seine Größe schüchterte sie ein. Trotzig sah sie ihm in die Augen. Drei Jahre hatte sie damit verbracht, sich vor Männern wie ihm zu schützen, drei Jahre hatte sie gekämpft und war davongelaufen. Andere Frauen um sie herum hatten ihre Ehre für etwas Eßbares geopfert, doch sie hatte widerstanden, selbst wenn sie nicht genug Arbeit fand, um das nagende Gefühl in ihrem Magen zu betäuben. Niemals hatte sie sich prostituiert, um überleben zu können. Und sie würde es auch niemals tun. Ihre Erscheinung wirkte hart, kalt und distanziert. Sie war zu dem Wesen geworden, zu dem das Leben sie gezwungen hatte. Doch der Sinn war nur, ihr Inneres zu schützen, das zerbrechlich und verletzbar war. In ihrem Inneren war sie immer noch das Mädchen, das sie in New York gewesen war, bevor das Verbrechen ihres Onkels ihr Leben zerstört hatte, ein Mädchen, das geben und vertrauen wollte, das lieben konnte und sich Liebe wünschte. Und dieser Schurke sollte keine Gelegenheit bekommen, sie zu vergewaltigen und das zarte Kind in ihr zu zerstören. Nicht, solange sie noch atmete und sich wehren konnte. Sie würde dieses Kind mit all ihrer Kraft verteidigen. Denn wenn er es tat, wenn er sie zerstörte, dann würde er ihr auch jeden Sinn nehmen, zu überleben, zu kämpfen. Wenn das Mädchen fort war, dann konnte Christal van Alen nie wieder heimkehren. Niemals würde sie diesen Namen mehr tragen können.
Er berührte ihre Wange und schien etwas sagen zu wollen. Doch sie ließ ihm keine Zeit. Sie griff ohne Vorwarnung an, schwor sich, sich lieber einen Arm zu brechen, als ihn heranzulassen. Er knurrte irgend etwas und versuchte, sie festzuhalten, doch die Panik verlieh ihr Kräfte, die sie sonst nicht gehabt hätte. Ihre Fäuste hämmerten auf ihn ein, und schlugen überall hin, wo sie ihn verletzlich glaubte. Sie tat ihr Bestes, ihm Schaden zuzufügen, doch sie spürte seine steinharten Muskeln und wußte, es war vergeblich. In seiner Miene zeichnete sich weder Schmerz noch Ärger ab … nichts, außer Überraschung. Dennoch schaffte er es nicht, sie festzuhalten. Sie kämpfte weiter gegen ihn an, bis er einen ihrer Arme zu fassen bekam. In einem Reflex, der angelernt war, holte sie mit dem freien Arm aus und ohrfeigte ihn so fest, daß er für einen Moment wie erstarrt dasaß.
»Wildkatze!« knurrte er heiser, bevor er ohne Schwierigkeiten die zweite Hand einfing.
»Sie werden mich nicht anrühren. Niemals!« Sie öffnete den Mund, um ihn zu beißen. Cain fuhr zurück und stieß einen Laut des Zornes aus.
Schließlich hielten beide atemlos inne und starrten sich an. Mit zusammengepreßten Lippen rieb er sich die Stelle am Kiefer, die sie getroffen hatte. In seinen Augen lag eine Art väterlichen Zornes, als wäre sie ein ungehorsames, kleines Kind. »Lassen Sie mich Ihnen einen Rat geben, Mrs. Smith«, sagte er heiser. »Sie sind eine wunderschöne, junge Frau und Sie sollten wirklich lernen zu gehorchen, denn es gibt eine Menge einsamer Männer hier in unserem Lager.«
Sie biß sich auf die Lippe. Er sollte sie nicht erbeben sehen.
Cain beugte sich näher zu ihr, so daß sie jeden silbernen Sprenkel in seinen unglaublichen Augen sehen konnte. »Sie halten sich für sehr tapfer, aber das nützt Ihnen wenig. Ohne mich haben Sie nicht den Hauch einer Chance. Hier draußen kann ein Mann eine Frau auf eine Meile Entfernung riechen.«
»W … was soll das heißen?«
Seine Hand berührte ihr Haar, ohne daß er den Blick von ihr wandte. »Ich meine damit, Lady, daß ich Sie riechen kann. Alles an Ihnen hat einen Duft. Ihr Haar ist mit Rosenwasser gespült worden, wahrscheinlich erst heute morgen. Das Kleid tragen Sie wohl nicht besonders oft – Sie haben es erst heute aus der Tasche genommen, denn ich nehme noch den Lavendel wahr, den Sie zwischen Ihre Sachen packen, um die Motten fernzuhalten. Parfum nehmen Sie keins – wahrscheinlich, weil Sie es sich nicht leisten können. Dennoch riechen Sie immer noch besser als alles andere, denn wenn ich näher komme, kann ich den Duft der Frauen wahrnehmen, aber wenn ich Ihnen den näher beschreibe, schlagen Sie wieder zu.« Seine Stimme wurde drohend und tief. »Was ich Ihnen damit sagen will, Lady, ist folgendes: Dies alles veranlaßt einen Mann zum Grübeln. Und zu begehren!«
»Ich wehre mich«, flüsterte Christal.
Er lachte freudlos. »Sie hätten keine Chance.« Seine Miene wurde grimmig. »Aber wenn Sie auf mich hören, und nur auf mich, dann haben Sie gute Chancen, bis Dienstag durchzuhalten, ohne wie eine zerlumpte Decke herumgereicht zu werden. Haben Sie mich verstanden?«
Alle Farbe wich aus Christals Gesicht, ihre Augen waren voller Angst. Sie nickte. Oh ja, sie hatte verstanden. Er wollte das alleinige Recht, sie zu vergewaltigen und zu mißbrauchen. Aber sie würde sich dennoch wehren. Bis zu ihrem letzten Atemzug.
Dann stand er auf. Nackte Panik erfaßte sie, als sie darauf wartete, daß er sein staubiges Hemd abstreifte. Sie krabbelte ganz ans Ende des Bettes und machte sich zum Sprung bereit, sobald er sich der Matratze näher würde. Doch dann sagte Cain: »Es wird eine harte Woche werden, Mrs. Smith. Bereiten Sie sich darauf vor.«
Dann ging er und schloß die Tür hinter sich ab.
Verdutzt starrte sie eine lange Weile auf die geschlossene Tür. Wie durch ein Wunder war sie nicht vergewaltigt worden. Und ein Mann hatte sie verschont, dessen Augen deutlich machten, daß er niemals im Leben Gnade, Mitleid oder Wärme empfunden hatte.
Aber es war nur aufgeschoben. Er würde zurückkommen. Er würde wiederkommen, wenn er den Männern Aufgaben zugeteilt und die restlichen Passagiere eingesperrt hatte.
In Panik hastete sie zu dem Stuhl, auf dem ihre Börse lag. Ihre Finger zitterten so sehr, daß sie Mühe hatte, die Tasche zu öffnen, doch dann lag die Pistole endlich in ihrer Hand. Sie zog den Stuhl in die hinterste Ecke, setzte sich und richtete den Lauf der kleinen Waffe bebend auf die Tür.