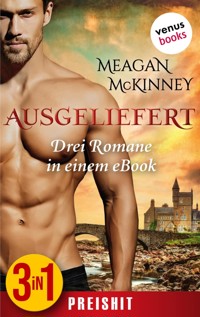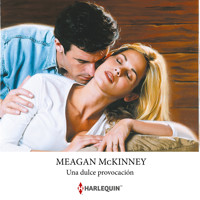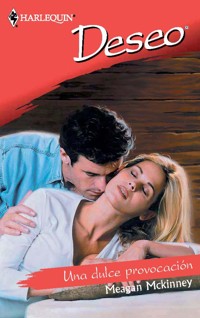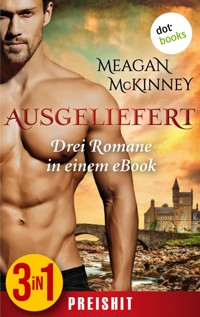4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Tod ihres Vaters reist Alexandra Benjamin nach Cairncross Castle, das inmitten der melancholischen Landschaft von Yorkshire liegt. Dort bekommt sie von dem schwermütig wirkenden, aber zugleich äußerst attraktiven John Damien Newell das Angebot, ihren Lebensunterhalt als Gouvernante bei seinem Bruder Samuel zu verdienen.
Schon bald wird Alexandra mit unheimlichen Geschehnissen konfrontiert, doch sie ist fest entschlossen, das Rätsel um die seltsame Familie zu lösen. Denn Alexandra hat sich unsterblich in John Damien verliebt, und sie möchte ihm die Zärtlichkeit geben, die ihn aus dem dunklen Gefängnis seiner Seele befreien kann ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Epilog
Über dieses Buch
Nach dem Tod ihres Vaters reist Alexandra Benjamin nach Cairncross Castle, das inmitten der melancholischen Landschaft von Yorkshire liegt. Dort bekommt sie von dem schwermütig wirkenden, aber zugleich äußerst attraktiven John Damien Newell das Angebot, ihren Lebensunterhalt als Gouvernante bei seinem Bruder Samuel zu verdienen. Schon bald wird Alexandra mit unheimlichen Geschehnissen konfrontiert, doch sie ist fest entschlossen, das Rätsel um die seltsame Familie zu lösen. Denn Alexandra hat sich unsterblich in John Damien verliebt, und sie möchte ihm die Zärtlichkeit geben, die ihn aus dem dunklen Gefängnis seiner Seele befreien kann …
Über die Autorin
Meagan McKinney hat ihre Karriere als Biologin aufgegeben, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Sie lebt mit ihrer Familie in New Orleans und schreibt nicht nur historische Liebesromane, sondern auch packende Thriller.
MEAGAN McKINNEY
Triumph der Zärtlichkeit
Aus dem Englischen von Monika Koch
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der amerikanischen Originalausgabe:Gentle from the NightCopyright © 1995 Ruth GoodmanPublished by Arrangement with Kensington Publishing Corp.
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Digiselector | Margarita Borodina | Shaun Dodds
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3888-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Do not go gentle into that good night ...Rage, rage against the dying of the light
(Dylan Thomas)
1
Noch Jahre später erinnerte sie sich daran, wie sie der Name sofort fasziniert hatte. John Damien Newell. Eine Unterschrift unter einem Brief – nichts weiter. Lediglich drei Worte in einer akkuraten und zugleich arrogant lässigen Handschrift, die nichts von den zukünftigen Ereignissen ahnen ließen.
Aber der Name hatte Alexandra neugierig gemacht. Sie brannte darauf, das Gesicht des Mannes zu sehen, der zu diesem Namen gehörte und der in Unkenntnis der wahren Umstände um Hilfe nachgesucht hatte. Sein Brief hatte sie angerührt, und in stillen Stunden malte sie sich immer wieder das Aussehen des Mannes aus, obwohl sie lediglich seinen Namen kannte.
John Damien Newell.
Erst viel später sollte sie begreifen, dass dieser Name an etwas gerührt hatte, das in ihren Augen eigentlich erledigt war. Doch an diesem grauen, regnerischen Londoner Morgen plagten sie ganz andere Gedanken. Mit der Feder in der Hand saß sie am Schreibtisch in der ehemaligen Bibliothek ihres Vaters und rang um eine Antwort. Dabei wusste sie sehr genau, dass eigentlich nur jugendlicher Übermut und eine gewisse Wut sie so handeln ließen. Sie war verletzt, und der Stachel saß so tief, dass sie ein wildes Verlangen und genügend Mut verspürte, einfach rücksichtslos voranzupreschen und auf ein Schreiben zu antworten, das vielleicht besser unbeantwortet geblieben wäre.
Sofort nachdem Mary ihr den Kaffee serviert hatte, hatte sie sich ans Werk gemacht. Der Schein des Kaminfeuers schimmerte durch das Blatt, als sie es schließlich hochhob und ihre Unterschrift kritisch begutachtete. Was dieser Tintenkrakler wohl besiegelte? Zumindest eine Lüge, dachte sie, und voller Gewissensbisse verdunkelten sich ihre haselnussbraunen Augen. Hastig blies sie über die noch feuchte Tinte und las dann noch einmal, was sie geschrieben hatte. Angesichts ihres Mutes und ihres Leichtsinns zitterten ihre Hände ein wenig.
19. April 1858
My Lord Newell,
zu meinem Bedauern muss ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass mein Vater, Dr. Horace Benjamin, Ihrer Einladung nach Cairncross Castle leider nicht Folge leisten kann. Dr. Benjamin verstarb im vergangenen Dezember infolge einer Grippe. Seine gesamten Aufzeichnungen wurden dem Royal College of Surgeons zur Fortsetzung seiner Arbeit überlassen. Ich hoffe, Ihnen mit dieser Information geholfen zu haben.
Für den Fall, dass Ihnen das College in Bezug auf das Gebrechen Ihres Bruders nicht weiterhelfen kann, bin ich gern bereit, Ihnen meine Dienste anzubieten. Ich verfüge zwar nicht über eine anerkannte Ausbildung wie mein Vater, aber während der letzten Jahre habe ich ihm bei allen Arbeiten assistiert und kann mit Fug und Recht behaupten, dass es keine Theorie und kein Experiment gibt, das wir nicht gemeinsam diskutiert hätten.
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich untertänigst
Alex Benjamin
Alexandra starrte zuerst auf das Blatt und dann auf die gläserne Schreibfeder und verspürte für Sekunden den Wunsch, ihren Namen zu vollenden. Sie belog diesen Mann. Falls er ihr tatsächlich den Auftrag erteilen sollte, musste sie ihm schreiben und die Arbeit schon aus Angst vor seinem Zorn über diese Täuschung ablehnen. Andererseits jedoch sah sie keinen anderen Weg, als so zu handeln, denn wenn sie den Brief mit Alexandra unterschrieben hätte, hätte sie sich die Mühe sparen können. Mit Sicherheit würde Lord Newell es niemals auch nur in Erwägung ziehen, eine Frau – und obendrein eine ohne medizinische Ausbildung – zur Behandlung seines Bruders nach Yorkshire zu holen. Höchstwahrscheinlich würde er ihr ohnehin die Tür weisen, sobald er sie zu Gesicht bekam – aber sie war fest entschlossen, es darauf ankommen zu lassen. Sie musste es einfach versuchen, denn sie wollte London unbedingt so schnell wie möglich den Rücken kehren. Und dazu konnte ihr nur dieser Baron John Damien Newell verhelfen.
Mit einem Mal war ihr ganz melancholisch zumute, und sie blickte sich in dem wohlvertrauten Raum um, in dem früher Axminsterteppiche in Grün und Schwarz den Fußboden bedeckt hatten. Im Geist sah sie noch die wunderschönen changierenden Taftvorhänge in Erbsengrün und Purpurrot an den Fenstern hängen und die Bücherregale mit ihren zahllosen Bänden über die unterschiedlichsten Themen, die an den Wänden Spalier gestanden hatten. Aber in Wirklichkeit war der Raum nackt und kahl. Die Teppiche waren verschwunden, und Alexandra sah zum ersten Mal die rohen Dielenbretter. Seit ihr Vater und sie das Stadthaus bezogen hatten, hatte es überall köstlich nach Rotwein und Bienenwachs geduftet, doch nun lag lediglich der Geruch nach altem Holz in der Luft. Die Fenster waren genauso nackt wie der Fußboden, denn Teppiche und Vorhänge waren an einen Altkleiderhändler aus Whitechapel verkauft worden.
Alexandras starrer Blick fixierte die Regentropfen, die langsam über die Fensterscheiben rannen. Es war ein wunderschönes Zuhause gewesen. Alexandra war gerade zehn Jahre alt gewesen, als ihre Mutter gestorben war und ihr Vater ihr den Umzug nach London angekündigt hatte, wo er auf bessere Arbeitsmöglichkeiten hoffte. Auf ein mutterloses zehnjähriges Kind hatten die ägyptisch anmutenden Portale und die prachtvolle, gewölbte Fassade wenig Eindruck gemacht, aber im Lauf der vergangenen fünfzehn Jahre hatte sich Belmont Crescent als komfortables Heim in guter Lage erwiesen.
Und das sogar für Leute wie sie.
Alexandra fühlte wieder, wie der wohlbekannte Hass in ihr Herz kroch wie ein unscheinbarer Efeu, der sogar einen Ziegelstein zerbrechen konnte, wenn er ihn erst einmal umschlungen hatte. Leute wie sie. Sie war nun einmal so, wie sie war, und ihr Vater ebenfalls. Er war ein wunderbarer, freundlicher und herzensguter Mensch gewesen, der unverdrossen weiter den Bettlern Geld gespendet hatte, obwohl man ihm bei dieser Gelegenheit bereits dreimal die Börse entrissen hatte. Beruflich hatte ihr Vater in seinem College große Anerkennung gefunden. Seine spezielle Fachrichtung hatte sich durch die Heirat mit einer wunderschönen, aber tauben Frau ergeben, die von ihrer Familie grausam behandelt worden war, weil sie nicht hören und deshalb auch nicht sprechen konnte. Sein größter Ehrgeiz als Ehemann und Wissenschaftler war immer der Wunsch gewesen, seinen Namen von den Lippen seiner geliebten Frau zu hören. Er hatte sie das Sprechen gelehrt und sich von da an ähnlich behinderten Menschen gewidmet, die von der Gesellschaft ausgegrenzt wurden, weil sie sich nicht mit Worten dagegen wehren konnten.
Im Lauf der Jahre hatte Alexandra begriffen, dass selbst alle guten Taten dieser Welt den Schatten nicht tilgen konnten, der auf Horace Benjamins Existenz lag. Ihr Vater war Jude – ein Christusmörder, den es nicht nach dem Heil der anglikanischen Kirche verlangte. Als Tochter ihres Vaters konnte Alexandra noch so oft betonen, dass ihre Mutter eine irische Katholikin aus Wexford gewesen sei – es nützte nichts. Man beurteilte sie ausschließlich nach ihrer Abstammung von diesem widerspenstigen Mann, und die Vorurteile trafen sie und ihren Vater gleichermaßen. Alexandra hatte dafür bezahlt, aber gleichzeitig hatte sie die Wut und den Trotz schätzen gelernt, die ihr immer dann zu Hilfe kamen, wenn die Situation unerträglich wurde. Sie war keine Jüdin, weil ihre Mutter Christin gewesen war, aber wenn alle Welt es unbedingt glauben wollte, dann würde sie den Leuten den Gefallen tun. Bei Gott! Und obendrein voller Stolz. Diese Leute konnten ihr samt ihrer Vorurteile gestohlen bleiben.
Und er ganz besonders.
Ihre Blicke glitten hinüber zu der nackten Sitzbank in der Fensternische, wo sie oft stundenlang auf den Satinkissen gesessen und angeblich in einem Buch gelesen hatte. Dabei hatte sie heimlich durch die Spitzenvorhänge nach ihm Ausschau gehalten. Nur zu gut erinnerte sie sich an das süße Gefühl, wenn Mary gekommen und ihr zugeflüstert hatte, dass Brian im Besuchszimmer auf ihren Vater wartete. Jahrelang hatte ihr Herz einen kleinen Sprung vollführt, wenn man nur seinen Namen nannte. Als Assistentin ihres Vaters hatte sie oft mit seinen Studenten gearbeitet, und natürlich war es nicht ausgeblieben, dass sie sich in einen von ihnen verliebt hatte.
Im Rückblick war klar, dass sich die Tragödie leicht hätte vermeiden lassen, wenn er nur nicht darauf eingegangen wäre. Aber damals hatte sie noch keine Ahnung davon gehabt, wie grausam die Liebe sein konnte und wie leicht und zugleich heimtückisch höfliche Worte täuschen konnten.
»Miss?«
Alexandra sah auf, als Mary den Kopf zur Tür hereinsteckte, und bemerkte zum ersten Mal, dass die roten Locken unter dem Spitzenhäubchen ihrer Zofe langsam ergrauten. Ob es nur das Alter war? Oder waren etwa die Aufregungen der letzten Monate schuld daran?
»Die Leute wollen den Schreibtisch abholen, Miss. Was soll ich ihnen sagen?«
Alexandra blickte auf den Brief hinunter, der gefaltet, aber unversiegelt auf dem geliebten Schreibtisch ihres Vaters lag. Wortlos stand sie auf, tropfte etwas geschmolzenen Siegellack auf das Papier und drückte den Ring ihres Vaters darauf, in den ein großes B inmitten eines Davidsterns eingraviert war.
»Würdest du ihn bitte aufgeben?« Mit diesen Worten überreichte sie Mary den Brief und nickte dann in Richtung auf die Halle, wo die Trödler warteten. »Ich bin fertig. Du kannst die Männer hereinschicken.«
Von Anfang an war Alexandra Benjamin ein ungewöhnliches Kind gewesen – äußerst lernbegierig und dabei schüchtern und ein wenig verträumt. Alexandra selbst meinte, dass sie so geraten sei, weil sie im Alter von zehn Jahren ihre Mutter verloren hatte und von da an fast ausschließlich in männlicher Gesellschaft großgeworden war. In der Tat hatten die Kollegen ihres Vaters häufig in der Bibliothek kampiert, wenn es bei der Arbeit und den anschließenden Diskussionen einmal spät geworden war. Mary und die Köchin sahen das jedoch ganz anders. Sie hatten das Thema oft genug erörtert und dabei heftig den Kopf geschüttelt. Wenn man sie gefragt hätte, hätten sie gesagt, dass ihrer Meinung nach der Grund für die Schüchternheit der Kleinen im Verhalten das Vaters zu suchen war, den seine Hilfsbereitschaft für die Leidenden der kleinen Seele gegenüber blind gemacht hatte. Nach dem Tod seiner Frau Hope hatte sich Horace Benjamin ganz und gar in seine Arbeit vergraben, und es war nicht weiter ungewöhnlich, dass Alexandra ihren Vater manchmal wochen- oder gar monatelang nicht zu Gesicht bekam, obgleich er unter demselben Dach wohnte.
Unter Tränen hatte Mary einmal der Köchin erzählt, dass es ihr fast das Herz gebrochen hatte, als das Mädchen mit glänzenden Augen ins Studierzimmer ihres Vaters gelaufen war, um ihm voller Stolz ihre neue blaue Schleife zu zeigen. »Er hat sie nicht einmal wahrgenommen!«, hatte Mary über ihrem Schlaftrunk geschluchzt. »Genau wie einer seiner stummen und tauben Patienten hat er überhaupt nicht auf die Gegenwart der Kleinen reagiert. Das arme Kind! Das Licht in ihren Augen erlosch, und sie schlich mit gerunzelter Stirn und hochgezogenen Schultern aus dem Zimmer. Man konnte genau sehen, wie die Kleine mit den Tränen kämpfte. Und soll ich Ihnen etwas sagen?« Dabei war sie näher zur Köchin gerutscht und hatte sich geräuschvoll die Nase geschnäuzt. »Die Kleine ließ die Schleife achtlos zu Boden fallen und hat sie seitdem nie wieder getragen. In ihren Augen war sie wertlos geworden.«
Alexandra dagegen wäre es nie in den Sinn gekommen, dass ihr Vater sie nicht genügend beachtete. Er versorgte sie schließlich mit allem, was man sich als kleines Mädchen nur wünschen konnte – mit Spielsachen, mit hübschen Kleidern und mit bunten Bändern. Nur Gesellschaft leistete er ihr nicht. Aber Alexandra war sich schon immer selbst genug gewesen und hatte aus Mangel an Spielgefährten beizeiten gelernt, sich allein zu beschäftigen und dabei glücklich zu sein. Zum Beispiel hatte sie sich auch ohne Anleitung einer Mutter beachtliche Fertigkeiten im Sticken und Malen angeeignet.
Eines Tages jedoch machte sie eine entscheidende Entdeckung. Als sie ihrem Vater das Teetablett ins Studierzimmer brachte, saß er wieder einmal völlig abwesend über seinen Notizbüchern und notierte gerade seinen letzten Gedanken. Wie immer war er so sehr in seine Hypothesen und Theorien vertieft, dass sie es nicht gewagt hätte, ihn zu stören. An diesem Tag jedoch arbeitete er mit einem etwa fünfjährigen kleinen Jungen, der sich von der Hand seiner Mutter losgemacht hatte und in den benachbarten Salon marschiert war, wo er voller Ernst auf den Klaviertasten herumklimperte.
Als Alexandra das Tablett neben ihrem Vater abstellte, äußerte sie ohne zu überlegen die Vermutung, dass der Kleine vermutlich auf die Vibrationen des Instruments reagierte. Zu ihrer Überraschung hob ihr Vater augenblicklich den Kopf.
Horace Benjamin starrte seine damals vierzehnjährige Tochter so verblüfft an, als ob er sie nie zuvor gesehen hätte. Neugierig geworden zog er sie mit sich in den Salon hinüber und begann auf der Stelle mit einem Experiment. Zum ersten Mal fühlte Alexandra eine wirkliche Verbundenheit mit ihrem Vater, und diesen Faden ließ sie nie wieder abreißen. Von diesem Tag an hatte sie ihren Platz im Leben ihres Vaters gefunden. Als Frau war ihr zwar die wissenschaftliche Laufbahn versperrt, so dass sie sich keine Hoffnung auf eine medizinische Ausbildung machen konnte. Nicht einmal ein bekannter Mann wie Dr. Benjamin konnte die Barrieren niederreißen, die damals den Frauen im Weg standen. Aber niemand konnte ihr verbieten, seine Assistentin zu werden und an seiner Seite zu arbeiten.
Sobald sie mit ihrem Vater über seine Arbeit sprach, waren die einsamen Stunden im Schulzimmer durch die Wärme seiner Aufmerksamkeit schnell vergessen. Trotz einer gewissen Monotonie war die Arbeit mit ihrem Vater äußerst interessant, außerdem behandelte er sie niemals als Frau, sondern eher als eine Art Kollegen, dem er alles Wissenswerte anvertraute – zuweilen auch ohne Rücksicht auf ihre Aufnahmefähigkeit und ihre Jugend.
Doch mit der Jugend hatte Alexandra ihre eigenen Erfahrungen gemacht – sie gehörte zu den wenigen Ausnahmen, die auf den Tag genau angeben konnten, wann dieser Abschnitt ihres Lebens zu Ende gegangen war. Und zwar war das genau am 24. Dezember 1857, einige Sekunden nach Mitternacht, passiert. An diesem Tag hatte sie ihren Vater beerdigt, und Kummer und Trauer hatten sie beinahe überwältigt. Doch der Gedanke an Brian hatte sie aufrecht gehalten. Der Gedanke an den gutaussehenden, witzigen Brian, der wie ein Leuchtturm aus ihrem Meer voll Kummer aufragte und ihren Gedanken die Richtung wies. Vielleicht war ja nun, nach dem Tod ihres Vaters, die Zeit gekommen, um die Arbeit für einige Zeit an die zweite Stelle zu rücken und erst einmal ihrer ganz irdischen Sehnsucht nach Liebe nachzugeben. Ganz sicher bewegten Brian ähnliche Gedanken, hatte sie überlegt, während sie in der Einsamkeit dieser Nacht darauf gewartet hatte, dass er auf ihr Briefchen reagierte.
Und tatsächlich hatte er kurz vor Mitternacht vor ihrer Tür gestanden. Mit wehmütiger Miene hatte er bestätigt, dass sich alles so verhielte, wie sie es in ihrem Brief geschrieben hätte. Während der vergangenen Jahre hatte sich zwischen langen Blicken im Arbeitszimmer und hastigem Geflüster in der Halle bei beiden der Glaube gefestigt, füreinander bestimmt zu sein. In ihrem Brief an Brian hatte Alexandra zum ersten Mal diesem brennenden Wunsch Ausdruck verliehen und geschildert, wie sehr sie sich nach einem Leben an seiner Seite sehnte, nach Kindern und einem Heim, wie es ihre Eltern in den wenigen glücklichen Jahren ihres Lebens gehabt hatten. Wie Blut war die Tinte aus der Wunde ihres Herzens über das Papier geströmt. Aber diese Wunde war heilbar, und es war an der Zeit, endlich das Schweigen zu brechen.
Mit tränenüberströmtem Gesicht hatte sie ihm ihre lang unterdrückte Liebe und ihre Hoffnungen für die Zukunft gestanden. Selbst für zwei so besessene Wissenschaftler, wie sie beide es waren, waren Ehe und Kinder nicht auf ewig unmöglich. Der Tod ihres Vaters hatte sie nur darin bestärkt, dass man sich nehmen musste, was das Leben einem bot. Es war an der Zeit, so hatte sie geschrieben, endlich von ihrer Liebe zu sprechen. Es war an der Zeit, einander endlich ihre Gefühle zu offenbaren und zu heiraten.
Wenn sie an den Abend zurückdachte, war ihr klar, dass es in dieser Sekunde genau zwei Möglichkeiten gegeben hatte. Natürlich hätte sie weinen und betteln können, um Brian begreiflich zu machen, dass das, was er glaubte, nicht der Wahrheit entsprach. Sie hatte absolut keinen Grund, diesen so genannten Makel zu akzeptieren, denn ihre Mutter hatte ihn ebenfalls nicht besessen. In den Augen der Kirche betraf dieses Vorurteil lediglich ihren Vater, der inzwischen tot und begraben war. Brian hatte ihr beide Möglichkeiten aufgezeigt, aber Alexandra hatte sich stillschweigend für die zweite entschieden. Ganz plötzlich hatte sie nämlich begriffen, dass auch von einem noch so irrigen Vorurteil immer etwas haften blieb. Sie war nicht, wofür Brian sie hielt, aber um seinen Irrtum richtigzustellen, hätte es einer noch weit größeren Ungerechtigkeit bedurft. Es hätte bedeutet, sich von dem Mann distanzieren zu müssen, den sie wie niemanden sonst bewunderte und liebte. Und das war ein Ding der Unmöglichkeit.
Der Moment, in dem Alexandra begriff, wie leicht eine einsame Seele zu täuschen war, hatte ihre Jugend mit einem Schlag und unweigerlich beendet. Brian hatte sie niemals in die Oper ausgeführt, weil, wie er sagte, seine Mutter stets darauf bestanden hätte, von ihrem Sohn begleitet zu werden. Und Geschenke hatte er ihr nie gemacht, weil, und das waren seine eigenen Worte, ein wahrer Gentleman niemals die Barmherzigkeit einer Lady missbrauchen dürfe, indem er ein minderwertiges Geschenk ihrer Bewunderung für wert erachtete. Leider hatte sich Alexandra nicht damit zufrieden gegeben und dummerweise noch versucht, alles genauer zu ergründen. Zu spät hatte sie schließlich begriffen, dass ihn schon lange eine andere Lady in die Oper begleitet und dabei seine kleinen goldenen Geschenke von Bronwyn und Schloss getragen hatte.
In ihrem Brief hatte sie Brian um Offenheit und Klarheit gebeten, und nichts anderes hatte sie bei seinem mitternächtlichen Besuch bekommen. Er hatte von Liebe geflüstert und im selben Atemzug ihre Träume vernichtet und ihr damit jede Sekunde dieses Besuchs unauslöschlich ins Gedächtnis eingegraben. Noch heute konnte sie sich haargenau an jede Gefühlsregung erinnern, an das unglaublich süße Gefühl der Erleichterung, endlich sein Gesicht zu sehen, an das sehnsuchtsvolle Ziehen ihres Herzens und die zarte Hoffnung.
Er hatte sie genau in der Sekunde geküsst, als die Uhr zwölf Mal geschlagen hatte. Die Erinnerung war grausam. Er hatte seine Lippen auf ihren verlangenden Mund gepresst und stöhnend gestanden, wie sehr er sich schon immer nach diesem Augenblick gesehnt hätte. Und atemlos hatte sie ihm unter seinen Küssen zugeflüstert, dass es für sie nun keine Hindernisse mehr gäbe, seinen Heiratsantrag anzunehmen.
Als er sich von ihr gelöst hatte, hatte sie ihn in erwartungsvoller Seligkeit angesehen. Und dann hatte er ihr ruhig und gefasst erklärt, weshalb das für ihn nicht in Frage kam.
2
Im Frühling war die Reise nach Cairncross eine lange und ziemlich neblige Angelegenheit. Alexandra und Mary saßen im Bahnhof von Stirrings-in-Field und warteten ungeduldig auf den Zug Richtung Norden. Als Alexandra wohl zum zwanzigsten Mal in ihren steifen Unterröcken aus Rosshaar auf der harten Holzbank hin und her gerutscht war, spielte sie kurz mit dem Gedanken, Mary in das Gasthaus des Städtchens zu schicken, um ein Zimmer zu mieten. Aber gleich darauf verwarf sie den Gedanken wieder. Nach dem Verkauf des Stadthauses und der Begleichung sämtlicher Schulden war ihr lediglich eine kleinere Summe geblieben, von der sie sich zwar hin und wieder einen kleinen Luxus erlauben konnte. Allerdings war Umsicht nötig, wenn die Summe sie ohne Einschränkungen bis ans Ende ihrer Tage ernähren sollte. Wenn Horace Benjamin nicht ganz so großzügig gelebt hätte, wäre seiner Tochter sicher mehr geblieben, aber diesen Gedanken ließ Alexandra erst gar nicht zu.
Ihr Vater hatte vom Leben in einer besseren Gegend und einem gepflegten Lebensstil geträumt, und er hatte alles verwirklicht, auch wenn dieses Leben sein Einkommen als Arzt gelegentlich mehr als strapaziert hatte. Viele seiner Glaubensgenossen hatten ihn für verrückt erklärt, dass er Medizin studiert und nicht die Banklaufbahn eingeschlagen hatte, denn sie hatten Reichtum als kleine Entschädigung für die gesellschaftliche Ächtung erachtet. Horace Benjamin dagegen war ein Mensch gewesen, der in erster Linie seinen Mitmenschen hatte helfen wollen, und genau das hatte er auch getan. Sogar Alexandras Mutter hatte ihm alles verdankt. Eine solche Haltung konnte und wollte Alexandra nicht tadeln, selbst wenn sie sie das Haus und alles, was einmal ihr Leben ausgemacht hatte, gekostet hatte. Horace Benjamin hatte seinen Charakter jedenfalls niemals verleugnet, tröstete sie sich nicht ohne einen kleinen Anflug von Trotz.
Stocksteif saßen die beiden Frauen einsam und verlassen auf dem hölzernen Bahnsteig, und die Minuten verstrichen in quälender Langsamkeit. Seufzend schloss Alexandra die Augen und träumte davon, die Schnürung ihres Korsetts zu lockern und es sich auf weichen Kissen bequem zu machen, bis der Zug nach York endlich in den Bahnhof dampfte.
»Miss, sind Sie sicher, dass Sie das Richtige tun?«, fragte Mary. Dabei umklammerten ihre Hände in schwarzen Handschuhen ihre Tasche so fest, als ob ihr Leben davon abhinge. »Sie haben so lange in London gelebt, dass Sie sich in York vielleicht gar nicht wohlfühlen werden. Was werden Sie machen, wenn Ihnen weder das Schloss noch der Besitzer gefallen?«
»Ich hoffe nur, dass wir überhaupt so lange bleiben können, bis wir das festgestellt haben«, erklärte Alexandra und lächelte zuversichtlich. Bisher hatte sie es für klüger erachtet, Mary noch nicht zu sagen, dass Lord Newell eigentlich einen Mann erwartete. Doch nun überlegte sie, ob sie die Gute nicht langsam einweihen sollte.
»Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, dass wir einen Fehler machen. Mag sein, dass ich ein wenig abergläubisch bin, aber ich habe so meine Vorahnungen.«
Alexandra überlegte kurz und merkte, dass sie sich überhaupt noch keine Gedanken darüber gemacht hatte. So war das eben, wenn man vor etwas davonlief. Man dachte ausschließlich an die Zustände, denen man entfliehen wollte, und machte sich um die Zukunft keine Sorgen.
»Keine Angst, Mary. Genauso gut kann das Gegenteil eintreten.« Der starke, vertrauenerweckende Ton, in dem sie das sagte, beruhigte sogar ihre eigenen, leicht angespannten Nerven.
»Außerdem halte ich eine Reise wie diese für eine junge Lady wie Sie ...«
Eine junge Lady wie Sie. Alexandra schloss die Augen. Sie wollte sich nicht mehr an diese Worte erinnern. Genauso hatte er sich ausgedrückt. Er.
Ein Mann wie ich kann eine junge Lady wie Sie unmöglich heiraten.
Langsam öffnete sie die Augen wieder, und während sie dem verschwommenen gelben Lichtschein entgegensah, der sich langsam auf den Schienen näherte, wanderten ihre Gedanken ganz gegen ihren Willen zu den besseren Tagen zurück, als ihr Vater noch gelebt hatte und die Welt noch im Lot gewesen war.
Natürlich hatte sie ihr Leben nicht ausschließlich mit Modellen von Zungen- und Rachenmuskeln verbracht oder den Patienten beigebracht, wie man von den Lippen ablas. In ihrer freien Zeit hatte sie fast immer mit untergeschlagenen Beinen auf dem Platz am Fenster der Bibliothek gehockt und gelesen. Diese Welt hatte ihr ganz allein gehört, und Sir Walter Scotts Ivanhoe war ihr Lieblingsbuch gewesen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens hatte sie die Geschichte fasziniert, und zweitens hatte sie gehört, dass Sir Walter Scott die Inspiration zu diesem Roman von einer Reise nach New York mitgebracht hatte. Angeblich hatte er in einem der wunderschönen Backsteinhäuser an einem kleinen baumbestandenen Platz ein zauberhaftes, dunkelhaariges jüdisches Mädchen kennen gelernt und sich augenblicklich in sie verliebt. Obgleich Alexandra die Arbeit mit ihrem Vater über alles geliebt hatte, war ihre Seele während der langen Stunden in der Praxis ein wenig zu kurz gekommen. Durch ihre Mitarbeit hatte sie zwar das Herz und die Aufmerksamkeit ihres Vaters gewonnen, nach der sie sich immer gesehnt hatte, aber in ihrer freien Zeit hatte sie leidenschaftlich für romantische Geschichten geschwärmt. Und diese Passion hatte Ivanhoe entzündet.
In ihrer Einbildung hatte sie sich oft in die Person der Rebecca versetzt. Ihre Locken waren zwar nicht so dunkel wie die von Rebecca, sondern eher rötlich blond, aber dafür so dick und widerspenstig, dass mindestens hundert Bürstenstriche nötig waren, um die Mähne zu zähmen. Außerdem besaß sie haselnussbraune Augen, die für ihr schmales Gesicht viel zu groß waren. Ihr Vater hatte sie oft wegen ihres angeblich so hinreißenden Blicks aufgezogen. Wenn sie jedoch an die nächtliche Unterredung mit Brian zurückdachte, als sie nur ganz still dagesessen und sich seine Rede angehört hatte, war sie froh, dass ihr Vater damals den Ausdruck ihrer Augen nicht mehr hatte sehen müssen.
In ihren Träumen waren Brian und Ivanhoe eine Person gewesen, und sie hatte sich vorgestellt, wie er um ihre Rettung kämpfte und mit dem Gedanken an seine zauberhaft schöne Jüdin ins Grab sank. In einem Punkt hatte Brian sich allerdings als echter Ivanhoe erwiesen, denn genau wie dieser hatte auch er sich für seine Lady Rowena entschieden.
»Wir tun genau das Richtige. Das fühle ich«, hörte Alexandra sich sagen. Aber Mary war längst aufgestanden und bedeutete einem jungen Mann, welche Gepäckstücke die ihren waren.
»Das fühle ich«, wiederholte Alexandra, als sie längst im Zug saßen und sie durch das Fenster zusah, wie das Bahnhofsgebäude langsam hinter Dampfschwaden verschwand.
John Damien Newell legte seinen Kopf auf die Rückenlehne des eisernen Stuhls zurück und starrte zu dem Blitz hinüber, der lautlos über der Themse herunterzuckte. Selbst oben auf dem Dach war es für Anfang Mai ungewöhnlich warm, und nach einem stürmischen Frühjahr gab es bereits die ersten Gewitter.
Die bleichen Hände einer Frau glitten aufreizend langsam über seine nackten Schultern und vergruben sich in den dichten Haaren auf seiner Brust. Abbey war leise durch das Mansardenfenster herausgeklettert und hinter ihn getreten, aber er schien ihre Liebkosungen nicht einmal wahrzunehmen. Er wartete auf den Donner, wie er das immer tat, doch diesmal blieb er aus.
»Musst du wirklich schon so bald fort?«, flüsterte sie und küsste ihn zart in den Nacken.
Unbeirrt verharrte sein Blick auf dem Schauspiel oberhalb der Dachwohnung, die er in der Vergangenheit häufig aufgesucht hatte. Dichte Gewitterwolken ballten sich mit dem Rauch aus unzähligen Kaminen zu einer samtenen Schwärze zusammen, in der er sich nur zu gern verloren hätte.
»Geh nicht weg!«, flüsterte Abbey und fuhr dabei mit den Nägeln über die Muskeln seines Bauchs. Dann machten sich ihre Finger an seinem Hosenbund zu schaffen.
»Ich komme ja wieder«, sagte er heiser. »Ich komme doch immer wieder.«
»Ja – aber nicht immer schnell genug«, gab sie verdrießlich zurück. Dann ging sie zu dem anderen Stuhl hinüber, den sie ebenfalls durch das Fenster aufs Dach bugsiert hatten. Dabei schleifte sie das Betttuch hinter sich her, das ihre größten Blößen bedeckte.
»Warum musst du diesmal weg?« Abbey sah herausfordernd zu ihm hinüber, und als sie sich setzte, rutschte das Tuch wie zufällig ganz herunter. Ihm war klar, dass das nicht unabsichtlich passiert war. Früher hatte Abbey einem Maler Modell gestanden und wusste nur zu gut, wie man sich auf erotische Art enthüllte. Es gelang ihr nur unvollkommen, das kleine selbstgefällige Lächeln zu verbergen. »Geh nicht. Du wirst dich in York nur langweilen, besonders nach dieser ... nach dieser ...«
»York ist langweilig«, konstatierte er, während seine Blicke kurz ihre alabasterfarbenen Brüste streiften. Dann sah er wieder zu den tiefen Schatten zwischen den Wolkengebirgen empor, die die Schatten in seiner Seele widerspiegelten. »Trotzdem muss ich hin.«
»Kannst du denn keinen Diener schicken?«
»Nein.« Seine Stimme hallte wie der Donner über das Dach, der bisher ausgeblieben war, und Abbey erschauerte.
Wieder überzog ein gleißend heller Blitz wie ein Spinnengewebe den dunklen Himmel, während das Hafengelände unter ihnen gespenstisch still und verlassen dalag. Vor zweihundert Jahren hatte man diese Gegend Execution Dock genannt und Piraten aufgeknüpft und danach geteert zur Abschreckung zur Schau gestellt. Inzwischen war Wapping jedoch nichts weiter als ein ganz gewöhnlicher Teil des Londoner Hafens, wo ein Aktmodell zwischen Lagerhäusern und Kneipen noch eine billige Wohnung finden konnte. Auch er hatte Wapping jahrelang als seine Heimat betrachtet.
»Ich möchte mitkommen. Ich bin noch nie in York gewesen.« Als sie aufstand, blieb das Tuch auf dem Stuhl zurück, und sie lächelte verführerisch.
Sein Körper reagierte so prompt, so dass ihm unwillkürlich der Atem stockte. Wie immer war er bereit, nur zu bereit, obwohl ihn die Vollendung des Akts zunehmend langweilte und deprimierte.
»Außerdem wäre ich gern Herrin in deinem neuen Schloss«, flüsterte sie, während sie ihn zwischen ihren weißen Schenkeln einklemmte.
Seine Hände umfassten ihre Hüften und hielten sie auf Abstand. »Dabei betonst du doch unaufhörlich, wie sehr du deine Unabhängigkeit liebst! Und nun willst du plötzlich alles aufgeben und mit mir nach York kommen?«
»Du lässt mich in der letzten Zeit viel zu viel allein. Seit du das Schloss und den Titel geerbt hast, hast du dich verändert. Anfangs dachte ich, dass es gut für uns sei, aber inzwischen hasse ich alles, was mit York zusammenhängt. Ja, ich hasse es«, wiederholte sie wie ein trotziges Kind.
»Demnach langweilst du dich, wenn ich fort bin?«
»Ja«, zischte sie gereizt.
»Und was ist mit Charles und James und Thack?«
Völlig verblüfft sah sie ihn an. »Woher weißt du das?«
Ein spöttisches kleines Lächeln spielte um seine Lippen. »Ich bin sicher, sie würden dich vermissen, wenn ich dich einfach mitnehmen würde. Das kann ich wirklich nicht verantworten.«
»Ich wollte dich nur ein bisschen eifersüchtig machen.«
Er lachte, aber er hatte keine Ahnung, wie kalt es klang.
»Wenn du nicht so oft in York gewesen wärst, hätte ich sie überhaupt nicht gebraucht.« Sie schmollte. Dann beugte sie sich nach vorn, presste ihre Brüste gegen ihn und schob ihre Hände unter den Bund seiner aufgeknöpften Hose. »Bitte, nimm mich mit nach York. Ich möchte so gern Herrin in einem großen Haus sein. Bitte, nimm mich mit.«
Er sah sie an. Sie war wirklich zauberhaft schön mit ihren schwarzen Kringellocken und den grünen Augen, die einen verhexen konnten. Eine begehrenswerte Frau, um die sich nicht nur die Maler rissen. Aber leider war ihr Seelenleben allzu seicht und nicht frei von Neid. Ehrlich gesagt, war sie auch keine gute Gesellschafterin, denn sie war weder intelligent noch geistreich.
Je länger er sie ansah, desto trauriger und deprimierter wurde er. Auch Abbey war nicht anders als die anderen Mädchen – nur eine weitere Perle in der langen Kette seiner Ausschweifungen. Seine dunkle Seele verlangte nach Extremen. Freude und Qual lagen immer dicht beieinander, und von einem Experiment zum anderen war es immer nur ein kleiner Schritt.
»Cairncross Castle ist nicht der richtige Ort für dich. Es gibt dort nichts außer ödem Heideland, Stürmen und Meer. Du würdest dich zu Tode langweilen. Für so zarte Geschöpfe wie dich ist das nichts.« Ein kleiner Klaps auf ihr Hinterteil unterstrich noch den sarkastischen Unterton. »Ich muss noch heute Abend fahren, denn der Arzt, der meinen Bruder behandeln soll, ist bereits unterwegs.«
»Ich werde dich begleiten.« Trotzig sah sie ihn an.
Er sagte nichts, sondern sah sie nur an. Und dann merkte er, dass sein Blick sie einschüchterte. Zu Beginn ihres Verhältnisses hatte sie oft gesagt, dass sie sich zuerst in sein Gesicht verliebt hätte. In sein nettes Schuljungengesicht, wie sie sich ausgedrückt hatte. Nach ihrer Miene zu urteilen, hatte sein Gesicht offenbar inzwischen auch noch die letzten menschlichen Züge eingebüßt.
Sanft legte sie ihm die Hand an die Wange. »Bitte, sei nicht so grausam zu mir. Nicht ausgerechnet jetzt.«
»Du möchtest zwar mit mir nach Cairncross kommen, aber wie lange würdest du mir treu sein?«
»Immer«, sagte sie, als ob sie tatsächlich daran glaubte.
»Es geht nicht. Ein kleines Luder wie du würde dort nicht respektiert.«
»Ich würde alles tun, was man von mir erwartet.« Sie schnippte mit den Fingern. »Die Dienstboten würde ich schon zu behandeln wissen.«
»Daran hege ich nicht den geringsten Zweifel.« Ein Schatten huschte über seine Augen. »Dabei bekommst du die Schläge doch lieber selbst.« Sein Blick wanderte zu den roten Striemen auf ihren Schenkeln und ihren Brüsten, und bei der Erinnerung stockte ihm der Atem. »Das gefällt dir doch viel zu gut«, flüsterte er, während in seinem Innern ein heftiger Kampf tobte.
Energisch schob er sie schließlich von sich, aber zu seinem Verdruss folgte sie ihm durch das Fenster ins Schlafzimmer und sah niedergeschlagen zu, wie er seine Hose zuknöpfte. Er durchquerte den Raum und schlüpfte dabei in sein Hemd. Er wusste, dass er in dem niedrigen Raum noch größer wirkte, als er war, und sie das sehr erregend fand. Einmal hatte sie ihn als Mischung aus einem Wikinger und einem Schuljungen bezeichnet, und als er sich die gebogenen Bügel seiner Brille über die Ohren schob, dachte er daran, wie bei einer ähnlichen Gelegenheit der Vergleich noch um den Lehrer erweitert worden war, den sie flüsternd um eine angemessene Bestrafung gebeten hatte. Er hatte ihr gegeben, wonach es sie verlangt hatte, und noch eine Menge mehr, aber glücklich war er dabei nicht geworden. Nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen, war sie offenbar ehrlich bekümmert, und er fragte sich ernsthaft, ob sie ihn in all der Zeit etwa tatsächlich lieb gewonnen hatte.
»Keine Frau wird jemals mit mir nach Cairncross fahren«, sagte er barsch und endgültig. Dabei knöpfte er sein Hemd zu und schlüpfte dann in seine schwarz glänzenden Stiefel. Mit einem energischen Ruck knallte der Absatz lautstark auf den Boden, als ob er damit seine Worte nachdrücklich unterstreichen wollte.
»Seit dem Tag, an dem du den Besitz und den Titel deines Vaters geerbt hast, frage ich mich, weshalb du das alles unbedingt allein genießen möchtest.«
Genießen. Am liebsten hätte er laut gelacht. Als ob er jemals in seinem Leben etwas richtig genossen hätte! Energisch zog er an den Schlaufen des zweiten Stiefels. Ohne Herz und ohne fühlende Seele ließ sich nun einmal keine vertrauensvolle Beziehung zu einer Frau finden. Genauso gut wusste er, dass er eine Frau, die vielleicht die schrecklichen Züge seines Charakters ändern könnte, nicht würde halten können. Falls es eine solche Frau überhaupt gab. Frauen wie Abbey, die Macht mit Liebe verwechselten, fand er dagegen genug.
Doch in Wahrheit verzehrte er sich nach dem Gegenteil, nach Frauen, die ihre Kinder zärtlich liebten und ihre Männer verehrten und deren silberhelles Lachen manchmal wie himmlisches Glockengeläut an einer langen Dinnertafel erklang. Früher hatte er nie solche Frauen kennen gelernt, denn schließlich standen sie nicht den Künstlern Modell und krochen auch nicht des Nachts im Hafen von Wapping wie Küchenschaben aus ihren Verstecken.
Die wenigen besseren Frauen, denen er, seit er den Titel und das Geld seines Vaters geerbt hatte, begegnet war, hatten ihn jedoch stets verunsichert, weil er nicht wusste, wie er mit ihnen umgehen musste. Sie erschienen ihm eher wie unerreichbare Göttinnen, wenn sie ihm auf der Straße begegneten, in ihren Wagen an ihm vorbeifuhren oder auf einem Ball mit ihm tanzten. Nach Jahren voller Armut und Entbehrungen verkehrte er nun in genau den Kreisen, die seine Eltern so fasziniert hatten, dass sie darüber sogar die Bedürfnisse ihrer Söhne vernachlässigt hatten. Aber nach wie vor konnte er keine Gemeinsamkeiten zwischen sich und diesen vornehmen Damen erkennen.
Es schauderte ihn schon heute bei dem Gedanken, dass er sich tatsächlich einmal in ein solch moralisches, besseres Wesen verlieben könnte. Es wäre sein sicherer Tod, denn sie würde ihn täglich an die finsteren Abgründe gemahnen, die seinen Körper unüberbrückbar von seiner Seele trennten.
»Nimm mich mit«, bat Abbey mit sanfter Stimme und riss ihn aus seinen Gedanken.
»Nein.« Mit finsterer Miene knotete er seine schwarzseidene Krawatte.
»Was brauchst du denn dann, was ich dir nicht bieten kann?«
Sie gierte förmlich nach den Worten, die sie noch brutaler treffen würden, als er das bereits getan hatte. Sie wollte nur hören, dass es allein der soziale Unterschied war, der ihn abhielt. Aber das war nicht die Wahrheit und wäre in seinen Augen höchstens eine schwache, inkonsequente Ausrede gewesen. Er trat zur Tür und drehte den Knauf, weil er so schnell wie möglich alles hinter sich lassen wollte. Aber dann wandte er sich noch einmal um, weil sie immer noch auf seine Antwort wartete.
»Sei froh, dass ich es dir erspare, mit nach Cairncross zu kommen, Abbey. Ich kenne niemanden, dem ich dieses Martyrium zumuten würde.« Er sah zu, wie ein Blitz wild über den Himmel zuckte, und seine Miene verhärtete sich. Dann ging er rasch hinaus, doch bevor er die Tür für immer hinter sich schloss, enthüllte er noch die Wahrheit, die quälend auf seiner Seele lastete. »Die Herrin von Cairncross darf sich nämlich nicht vor Gespenstern fürchten.«
3
Die Ankunft in York warf Alexandras Vorstellungen gründlich über den Haufen. Nach dem düsteren Stirrings-in-Field hatte sie eigentlich eine in Nebel gehüllte Stadt voll leichenblasser Bewohner erwartet und eine karge Moorlandschaft, die die berühmten Stadtmauern umgab. Als jedoch heller Sonnenschein die beiden Frauen beim Verlassen des Zuges empfing, wurde ihre Stimmung sofort optimistischer, und sie blickten wie benommen auf das quirlige Durcheinander auf dem Bahnsteig, wo Ladys in samtenen Reisemänteln und gut gekleidete Herren mit Hüten, die gerade aus London angekommen waren, lachend und scherzend ihre Freunde begrüßten.
»Und was werden wir jetzt tun?«, fragte Mary angesichts der lärmenden Menge. Sie umklammerte ihre abgewetzte Stofftasche wie einen Talisman, so durcheinander war sie, und die roten Locken, die sie vermutlich einem schottischen Vorfahren verdankte, kringelten sich auf ihrer erhitzten Stirn.
In einem Gefühl der Zuneigung nahm Alexandra Marys Arm. Seit sie denken konnte, hatte Mary sie umsorgt, doch nun war es an der Zeit, dass sie die Verantwortung für ihre alte Zofe übernahm. Schließlich hatte sie die alte Frau, die ihr Leben lang in London gewohnt hatte, so weit von zu Hause fortgebracht.
Während ihre Blicke über die zahllosen Menschen auf dem Bahnsteig glitten und wieder und wieder die gänzlich fremden Gesichter musterten, sank ihre Zuversicht zusehends – wie ein untergehendes Schiff. »Wie dumm von mir, York für eine unbedeutende Provinzstadt zu halten«, murmelte sie ungehalten. »Ich habe natürlich angenommen, dass wir abgeholt werden und dass wir den Fahrer aus Cairncross sofort erkennen würden.«
»Wurde dieser Umstand im letzten Brief denn nicht erwähnt?«
Alexandra schüttelte den Kopf. »Ich habe zuletzt geschrieben und Seine Lordschaft von unserer Ankunftszeit unterrichtet.« Wieder musterte sie die Menschen, die einander lachend in die Arme fielen, aber sie konnte niemanden entdecken, der seine Gesellschaft noch nicht gefunden hatte.
»Mein Hinterteil ist von der langen Fahrt ganz schön mitgenommen«, seufzte Mary, während sie ihren untersetzten Körper auf eine Bank plumpsen ließ.
»Mach dir keine Gedanken! Wenn alle Stricke reißen, können wir immer noch einen Wagen mieten und uns nach Cairncross fahren lassen«, sagte Alexandra, während sie zusah, wie die Menge dünner und dünner wurde und Träger und Diener sich um das Gepäck und die Taschen ihrer Mitreisenden kümmerten.
»Es gehört sich aber nicht, dass zwei Damen allein durch die Gegend reisen, wenn sie nicht wissen, wo sie erwartet werden. Außerdem ist es in meinen Augen auch höchst gefährlich.« Missbilligend schüttelte Mary den Kopf und blickte unter ihrer Haube immer wieder den Bahnsteig entlang.
Entschlossen umfasste Alexandra ihr geflochtenes Täschchen fester und ging ganz ans Ende des Bahnsteigs, von wo aus sie den Bahnhof überblicken konnte. Vor dem Gebäude löste sich gerade der letzte einer Reihe von Wagen, die die Reisenden erwartet hatten, vom Bürgersteig und fuhr in Richtung auf die Kathedrale davon. Ansonsten war niemand mehr zu sehen, und das einzige Lebenszeichen bestand in dem Schild »Geöffnet« über dem Fahrkartenschalter. Mit wachsender Unruhe sah Alexandra, wie eine Hand erschien und das Schild umdrehte. »Wegen Mittagspause bis zwei Uhr geschlossen.«
Na wunderbar, dachte Alexandra und ging, ohne auf Marys Habe-ich-es-nicht-gesagt-Gesicht zu achten, noch einmal suchend den Bahnsteig in ganzer Länge ab. Dabei stellte sie fest, dass sich direkt neben dem Bahnhof die graue Steinwand der berühmten Stadtmauer von York erhob, die auf Überresten aus römischer Zeit errichtet worden war. Außer diesem Ungetüm, ein paar Bäumen und einem rostigen Wasserbehälter war nichts zu entdecken.
»Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als einen Mietwagen zu nehmen. Lord Newell wird uns sicher für die Kosten entschädigen. Schließlich –« Unvermittelt hielt Alexandra inne, als sie sah, wie Mary von ihrem Platz auf der Bank aus völlig fasziniert nach oben starrte.
»Mary?«, flüsterte Alexandra, als Mary leichenblass wurde. Ihr starrer Blick ließ Alexandra erschauern, und rasch folgten ihre Augen dem Blick ihrer Zofe zu einem Punkt oberhalb der aufragenden Mauer.
»Sehen Sie sie?«, stieß Mary hervor.
»Wen soll ich sehen?«
»Aber sie starrt doch genau auf Sie hinunter, Miss. Genau auf Sie!«
Alexandras Blicke wanderten über die Mauerkrone, die ungefähr fünfzehn Meter hoch aufragte, aber sie konnte niemanden entdecken. »Ich sehe niemanden.«
»Jetzt ist sie weg«, flüsterte Mary erleichtert, aber immer noch erschreckt. Inzwischen war sie aufgestanden und nach vorn getreten, als ob sie winken wollte.
»Wie konntest du auf diese Entfernung überhaupt etwas erkennen?«
»Oh Miss, sie hat einfach fürchterlich ausgesehen. Ganz schrecklich! So etwas will ich nie wieder sehen! Niemals!«
Alexandra zuckte zusammen, als sie sah, wie blass Mary geworden war, und als sie ihre eiskalte Hand umfasste, erschauerte sie unwillkürlich. »Offenbar hat dich die Reise sehr angestrengt«, sagte sie sanft. »Ich glaube, es war sehr selbstsüchtig von mir, dich überhaupt mitzunehmen.«
»Wer hätte Sie denn sonst begleiten sollen? Sie brauchen doch jemanden, der auf Sie aufpasst. Das weiß ich jetzt ganz genau.« Mary schien nicht ganz bei sich zu sein.
»Setz dich erst einmal wieder hin und ruhe dich ein wenig aus. Du siehst aus, als ob du gleich ohnmächtig umsinken würdest.« Alexandra führte sie zurück zur Bank. »Bestimmt gibt es hier einen Gasthof, wo wir uns erfrischen können.«
Aber Mary wackelte nur erschüttert mit dem Kopf und konnte gar nicht mehr aufhören.
»Was hast du denn überhaupt gesehen? Eine Frau?« Alexandra klopfte Mary auf den Rücken, um sie ein wenig aufzumuntern. »War sie wirklich so hässlich? Vielleicht hat jemand nach uns Ausschau gehalten, um dem Fahrer von Cairncross Bescheid zu sagen. Sicher hat er im Pub die Zeit vertrödelt und uns deshalb auch nicht auf dem Bahnsteig erwartet.«
»Nein. Nein.«
Verblüfft biss sich Alexandra auf die Lippen. So hatte sie Mary ja noch nie erlebt. Die nette, immer vernünftige Mary. Nein, dieser Zustand war höchst ungewöhnlich für sie.
Plötzlich packte Mary Alexandras Arm. »Wir sollten auf der Stelle umkehren! Suchen Sie den Kartenverkäufer und sagen Sie ihm, dass wir sofort nach London zurückfahren wollen.«
»Wie kann denn eine Frau dich so erschrecken – nur weil sie dort oben auf der Mauer steht?«
»Sie sah ganz normal aus. Ganz normal. Nur ihr Haar war ungewöhnlich. Es war rot, eine leuchtend rote Mähne, die sie offen trug. Wie eine Schlampe. Es flatterte im Wind.«
Mit gerunzelter Stirn blickte Alexandra an der Mauer empor. »Aber heute ist es doch überhaupt nicht windig! Seit wir aus dem Zug gestiegen sind, habe ich nicht den geringsten Lufthauch verspürt.«
»Das ist es ja.« Die Worte waren kaum zu verstehen.
Alexandra zog ihren Handschuh aus und hob prüfend eine Hand in die Luft, doch sie fühlte nichts. Oben auf der Mauer spazierten inzwischen einige Touristen entlang, die Bücher und Karten in den Händen hielten und die Geschichte des Bauwerks studierten. Aber die Röcke der Damen hingen schlaff herunter. »Mag sein, dass ein kurzer Windstoß genau in dem Moment über die Mauer gebraust ist, als du nach oben gesehen hast. Mein kleiner Angsthase hat sich vor einer Touristin –«
»Diese Frau war keine Touristin. Sie war böse. Und sie hat genau Sie angesehen, Miss!«
Alexandra sah Mary geradewegs in die Augen und fühlte plötzlich ein seltsames Kribbeln in ihrem Magen, das sie aber mit aller Kraft ignorierte. Es reichte ihr schon, dass der Fahrer nicht gekommen war und dass der Herr des Hauses einen Mann erwartete – ein Anfall von Hysterie war in dieser Situation gänzlich überflüssig. Mary musste sich einfach zusammenreißen. »Aber woher willst du das denn so genau wissen?«, fragte sie ihre Zofe. »Ist sie etwa wie eine Hexe auf dem Besen geritten?«
»Nein. Sie war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet und sah ganz schrecklich aus!«
Alexandra starrte nur wortlos auf Mary hinunter, weil ihr überhaupt nichts Tröstliches mehr einfiel. Dem Alter nach hätte Mary ihre Mutter sein können, und so hatte sie sich bisher auch benommen. Dass nun der umgekehrte Fall eingetreten war und Alexandra sie trösten und beruhigen musste, war neu. Mit einem Mal wurde Alexandra klar, dass ihr unter der schäbigen Strohhaube das Gesicht einer alten Frau entgegenblickte. Das liebevolle Gesicht einer alten Mutter, die sich um ihr Kind sorgte.
Alexandra griff nach Marys zitternder Hand und strich tröstend darüber. »Du musst wirklich keine Angst haben, liebe Mary. Schließlich ist eine Frau in Schwarz nichts Ungewöhnliches. Du trägst doch selbst meistens Schwarz, und ich im Augenblick den Umständen entsprechend auch.«
»Das Kleid hat ähnlich ausgesehen wie Ihres, Miss. Nur altmodischer. Ohne die cremefarbenen Spitzen.«
»Dann muss ich mir schleunigst den Namen ihres Schneiders besorgen«, scherzte Alexandra. »Du weißt doch, wie sehr ich diese cremefarbene Spitze hasse. Sehr praktisch, ich weiß, aber dafür hässlich! Weiß sieht viel frischer –«
»Lassen Sie uns umkehren, Miss! Ich habe plötzlich sehr große Angst.« Mit einem Mal schimmerten Marys Augen so dunkel wie Immergrünblätter, und der entsetzte Ausdruck ihres Gesichts jagte Alexandra Angst ein.
»Ich kann nicht umkehren.« Sie presste die Hand der alten Frau in einer Geste des Mitleids gegen ihre Wange und lächelte entschuldigend. »Falls dich diese Frau tatsächlich so erschreckt hat, werde ich dich selbstverständlich nach London zurückschicken. Aber ich muss hierbleiben. Ich ...« Alexandra richtete sich auf. Auch furchterregende, flammende Locken auf den Mauern von York konnten sie nicht schrecken.
»Dann bleibe ich ebenfalls hier.« Mary fahndete in ihrer unergründlichen Tasche nach ihrem Taschentuch und tupfte sich den Schweiß von der Oberlippe. Dabei sah sie noch einmal voller Misstrauen nach oben.
»Siehst du, es sind nur Touristen.« Beruhigend strich Alexandra über die Hand, die sich immer noch an ihre klammerte.
»Ich weiß doch, was ich gesehen habe! Diese Frau war keine Touristin. Sie sah aus wie ... wie das personifizierte Böse! Sie stehen mir nahe wie ein eigenes Kind, Miss, und ich kann es nicht ertragen, wenn jemand Sie so ... so bedrohlich anstarrt.«
Alexandra öffnete den Mund, um weiter zu argumentieren, doch dann besann sie sich. Sie kannte ihre Zofe zu gut. Einmal war eine schwarze Katze erschienen, und Mary hätte Alexandra fast gesteinigt, als sie dem Tier eine Schale Milch hingestellt hatte. In Marys Augen war die Katze Satan persönlich gewesen, und nichts hatte sie vom Gegenteil überzeugen können. Von diesem Tag an war die Katze sieben Jahre lang Tag für Tag erschienen und hatte sich ihr Futter abgeholt, doch auch die flehendsten Bitten hatten Mary nicht dazu bewegen können, die Katze ins Haus aufzunehmen. Und heute würde sie sich sicher ähnlich störrisch verhalten, dachte Alexandra angesichts des verräterisch energischen Zugs um Marys Kinn.
Mit einem kummervollen Seufzer blickte sich Alexandra noch einmal nach allen Seiten um, doch der Bahnsteig war immer noch genauso einsam und verlassen wie vorher. Nichts war zu hören, und es war auch kein Windhauch zu spüren.
»Wir wollen lieber nicht mehr davon sprechen«, flüsterte Mary, die inzwischen wieder ruhiger geworden war.
Alexandra nickte. »Richtig. Wir werden die Sache einfach vergessen.«
»Sind Sie die Begleitung von Dr. Benjamin?«
Die Stimme erschreckte die beiden Frauen zu Tode. Alexandra fuhr herum und erblickte einen älteren Mann, der direkt hinter ihnen stand. Er trug Kniebundhosen aus Cordsamt und dazu eine schwarze Jacke aus rauem Stoff über einer karierten Weste. Ohne Zweifel sah er wie der Fahrer eines Herrensitzes aus.
»Wir ... wir haben bereits auf Sie gewartet«, stammelte Alexandra und hätte ihn am liebsten gefragt, von wo er so plötzlich gekommen war.
»Sind Sie Dr. Benjamins Begleitung?«, wiederholte der Mann seine Frage. Dabei zog er die Mütze vom Kopf und entblößte seinen kahlen Schädel, der wie eine Billardkugel glänzte.
»Wir werden erwartet, ja, aber einen Arzt gibt es nicht. Ich fürchte, man hat Sie in diesem Punkt falsch informiert«, entgegnete Alexandra so knapp wie möglich, um ihre Nervosität zu überspielen. Es wurde Zeit, Alex in Alexandra zu verwandeln.
»Aber man hat mich zum Bahnhof geschickt, um einen Dr. Benjamin abzuholen«, erklärte der Mann stirnrunzelnd.
»Ich bin Alexandra Benjamin und dies ist meine Zofe Mary. Wir sind auf Lord Newells Bitte hin aus London hierhergekommen.«
»Aber Lord Newell hat in seinem Brief einen Dr. Benjamin angekündigt.«
»Ich bin kein Arzt, aber ich bin genau die Person, die Lord Newell eingeladen hat. Außer mir gibt es sonst niemanden«, erklärte Alexandra in kühlem Ton.
Der Fahrer runzelte immer noch die Stirn. Dabei wanderte sein Blick über ihr schwarzes Seidenkleid und blieb schließlich an ihrem Gesicht unter der Haube hängen. Nach seiner Miene zu urteilen, entsprach sie ganz und gar nicht dem Bild, das er sich gemacht hatte.
»Dies ist unser Gepäck«, erklärte sie und wies auf den Berg von Taschen und Koffern. »Und wo befindet sich der Wagen?«, fragte sie in herrischem Ton.
»Dort.« Der Fahrer deutete zum Eingang des Bahnhofs hinüber. »Ich werde Sie selbstverständlich nach Cairncross Castle bringen, aber nichtsdestotrotz weise ich Sie nochmals darauf hin, dass Seine Lordschaft einen Dr. Benjamin erwartet.«
»Dann wird mein Äußeres diesen Irrtum eben berichtigen«, beendete Alexandra ärgerlich die Diskussion und übersah geflissentlich das leise Missfallen, das sich auf Marys Zügen malte. Wahrscheinlich werden wir ohnehin vor die Tür gesetzt werden, sobald er uns zu Gesicht bekommt, dachte Alexandra, während sie ihre Röcke raffte. Aber wenigstens haben wir es versucht. Immerhin sind wir bis hierher gekommen.
Zögerlich verstaute der Fahrer die Fahrgäste samt Gepäck in seinem grün lackierten Landauer und fuhr dann durch das Micklegate Bar in die Stadt hinein. Mit voller Absicht vermied es Mary, noch einmal zur Mauerkrone hinaufzuschauen, obwohl sie noch eine gute Viertelmeile daran entlangfuhren.
»... der Bogen des Micklegate Bar stammt noch aus römischer Zeit«, erklärte der Fahrer.
Alexandra hörte zu, als er weitschweifige Erklärungen über die baulichen Einzelheiten dieses und der vier anderen Stadttore abgab. Demnach war York die britische Hauptstadt des römischen Imperiums gewesen, bevor es zum geistigen Zentrum des Nordens aufgestiegen war, das zuerst von den Wikingern und einige hundert Jahre später von den Normannen erobert worden war. In der Hauptstadt des Königreichs Northumbria wurde die erste Kirche begonnen, die in der heutigen Form zu den größten und prächtigsten Kathedralen Englands zählte. Normalerweise hätten Alexandra die Einzelheiten der Baugeschichte und die Geschichten über die zahllosen Könige und Erzbischöfe begeistert, die endlose Ströme von Blut vergossen hatten, um die mächtige Stadt in ihrem Besitz zu behalten. Aber im Moment wollte sie nur so schnell wie möglich nach Cairncross gelangen, um die Sache endlich hinter sich zu bringen.
»Finden Sie nicht auch, dass sich dieser Mensch ein wenig seltsam benimmt?«, fragte Mary im Flüsterton, während der Fahrer auf die belebte Straße achten musste.
»Mir ist bisher nur aufgefallen, dass er sich uns nicht vorgestellt hat«, bemerkte Alexandra spöttisch.
Trotzdem hörte sie ihm von diesem Moment an genauer zu, während er über die Kathedrale sprach, aber sie konnte seinen Vortrag nicht seltsam finden. Ihr Blick wanderte zu dem gewaltigen Gebäude hinüber, dessen Größe ihr schon aus verschiedenen Berichten vertraut war. Überraschend fand sie allerdings, wie eingezwängt das riesige Gebäude zwischen den Häusern der Stadt stand. Die Rufe der Straßenhändler, das Quietschen der rostigen Kutschenräder und das Schmutzwasser, das sich laut in offene Kanäle ergoss, übertönten gelegentlich den Vortrag des Kutschers. Aber Alexandra störte sich nicht daran.
Doch Mary bohrte weiter. »Sehen Sie denn nicht, was ich meine?«
»Genau vor uns liegt das Münster von York.« Der Kutscher verminderte das Tempo, so dass er sich in den Strom der Wagen einreihen konnte, die um die Kathedrale herumfuhren. Den Frauen bot sich dadurch die Gelegenheit, das Gebäude genauer in Augenschein zu nehmen und dabei den Erklärungen ihres Fahrers zu lauschen. Während er sprach, drehte er sich andauernd zu Alexandra um. Eigentlich wollte sie ihn übersehen, doch zu ihrer Überraschung fand sie den Mann und seine warnenden, fast hypnotischen Blicke irgendwie äußerst fesselnd.
»Richten Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf das Pflaster, Miss Benjamin. Direkt darunter befinden sich die alten Gräber der früheren Bischöfe.« Er lehnte sich zurück, um ihnen nicht die Sicht zu nehmen, und grinste. »Früher sind ab und an Ringe mit Rubinen oder Saphiren aus der Erde aufgetaucht – so etwas passiert, wenn die Särge unter dem Druck der Erde schließlich zusammenbrechen und nur noch Juwelen und Knochen übrig sind. Um Grabräuber abzuhalten, hat man die Gräber zugepflastert, und dazu hat man die Grabplatten einfach zerschnitten, wie Sie sehen können.« Sein Grinsen entblößte Zähne, die mindestens ebenso verwittert und glatt geschliffen waren wie die Pflastersteine. »Was die Bischöfe wohl davon halten?«
Alexandra wusste nicht recht, was sie darauf sagen sollte.
»Da sind Sie sprachlos, nicht wahr?« Er schob seine Kappe in den Nacken und sah Alexandra an. »Es ist noch keine vierzig Jahre her, seit sie die Kneipe direkt neben dem Münster abgerissen haben. Dabei hat man den Eingang zu dem Gefängnis aus angelsächsischer Zeit gefunden. Und außerdem die Skulptur eines schreienden Mannes, in Agonie verkrümmt, dessen Seele die Dämonen geholt haben. Ihn kann man heute im Museum besichtigen.« Wieder starrte er Alexandra an. »Ich fahre die Damen gern hin, wenn Sie möchten.«
Erst jetzt merkte Alexandra, dass sie die ganze Zeit über offenbar die Luft angehalten hatte, und atmete langsam aus. »Im Moment ist das nicht nötig, Mr ...?«
»Jaymes, Miss. Roger Jaymes. Ich arbeite schon fast mein ganzes Leben lang für den Herrn, und bin ihm ein guter Diener. Und das wird sich auch nicht ändern.« Einen Moment lang sah er etwas besorgt drein und blickte Alexandra an, als ob er noch etwas sagen wollte. Doch dann besann er sich und wandte kurz darauf mit mürrischer Miene den Blick ab.
»Ich bin dafür, dass wir auf schnellstem Weg nach Cairncross fahren, Jaymes«, sagte Alexandra in sanftem Ton.
Der Fahrer setzte seine Führung auch noch außerhalb der Tore von York fort. »Sehen Sie die alten Steinkreuze dort drüben?« Dabei deutete er über das flache Land. »Die wurden während der unruhigen Pestzeiten errichtet, als der größte Teil der Stadtbewohner umgekommen ist. Die Bauern haben sie als Treffpunkt aufgestellt, wo sie mit den Leuten aus der Stadt zusammenkommen und Handel treiben konnten, ohne die Stadt betreten zu müssen. Die Leute waren schon damals nicht dumm. Es waren einfache Leute, aber sie drängten sich nicht einfach an Orte, wohin sie nicht gehörten.« Wieder warf er Alexandra einen bedeutungsvollen Blick zu, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder der Straße zuwandte.
Alexandra beugte sich zu Mary hinüber. »Du kannst sagen, was du willst, aber diese Fahrt entbehrt doch nicht eines gewissen Charmes«, flüsterte sie.
»Er ist lediglich ein ekliger alter Brummbär«, flüsterte Mary hinter vorgehaltener Hand.
»Unsere Anwesenheit passt ihm nicht, und er versucht, uns – oder besser mich – mit diesem makabren Vortrag zu erschrecken«, sagte Alexandra fast unhörbar.
»Wir sollten umkehren, Miss.« Mary drohte mit dem Finger. »Sie werden noch an meine Worte denken. Hier erwartet uns nichts Gutes.«
Alexandra setzte eine spöttische Miene auf, aber insgeheim nagte die Sorge an ihr. Seit Mary die Frau auf der Stadtmauer erwähnt hatte, konnte sie an nichts anderes mehr denken, und während sie durch die eintönige Landschaft nach Norden fuhren, malte sie sich mehr als einmal den Empfang in Cairncross aus.
»Bis zum Schloss haben wir ungefähr noch zwei Stunden Fahrt vor uns«, rief der Fahrer nach hinten, um den Wind zu übertönen. »Es liegt direkt auf den Kalkklippen nördlich von Whitby. Es ist ein gewaltiges, stolzes Schloss, wenn ich so sagen darf.«
Alexandra fühlte Marys Blicke wie Nadeln auf der Haut. »Nur gut, dass wir gleich losgefahren sind. Ich bin schon sehr gespannt«, rief sie und hoffte, dass es zuversichtlich geklungen hatte. Nein, von einem Fahrer ließ sie sich nicht ins Bockshorn jagen, und eine Rückkehr nach London kam erst recht nicht in Frage.
Als sie einige Zeit später die Kreuzung erreichten, wo die Straße nach Scarborough und Whitby abzweigte, erwartete Alexandra eigentlich, dass der Fahrer unverzüglich Richtung Norden abbiegen würde, doch er hielt an und drehte sich zu ihr um.
»Es wäre wirklich besser, wenn Sie ein Mann wären, Miss«, sagte er, was im brausenden Wind kaum zu verstehen war. Mit verkniffenem Mund musterte er Alexandra, aber es lag keine Ablehnung in seinem Blick. Damit hätte Alexandra umgehen können, aber mit dieser Miene der Verzweiflung konnte sie nichts anfangen.