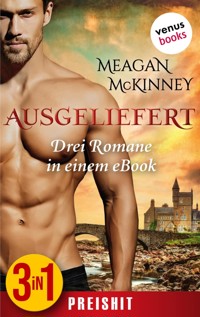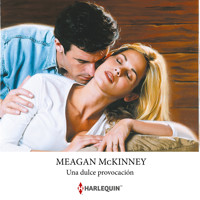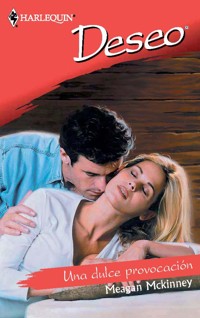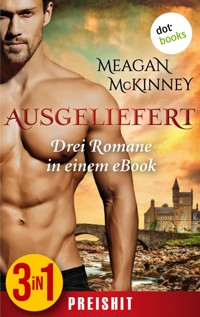4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
New York, 19. Jahrhundert. Die junge Mystere Rillieux verkehrt in New Yorks feinsten Kreisen. Keiner ahnt, dass sie in der Vergangenheit Lady Moonlight war, eine verführerische Juwelendiebin. Nur Rafe Belloch, den sie einmal um Geld und Kleidung gebracht hat, erinnert sich noch an die aufregenden blauen Augen der katzengleichen Diebin. Als beide sich wieder begegnen, genügt ein Blick in Mysteres Augen, um ihr wahres Gesicht zu erkennen. Doch Lady Moonlight das Handwerk zu legen, ist schwerer als gedacht, zumal Rafe sich von ihrem unwiderstehlichen Charme verhexen lässt ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
September 1881
1
Juni 1883
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Epilog
November 1883
Über dieses Buch
New York, 19. Jahrhundert. Die junge Mystere Rillieux verkehrt in New Yorks feinsten Kreisen. Keiner ahnt, dass sie in der Vergangenheit Lady Moonlight war, eine verführerische Juwelendiebin. Nur Rafe Belloch, den sie einmal um Geld und Kleidung gebracht hat, erinnert sich noch an die aufregenden blauen Augen der katzengleichen Diebin. Als beide sich wieder begegnen, genügt ein Blick in Mysteres Augen, um ihr wahres Gesicht zu erkennen. Doch Lady Moonlight das Handwerk zu legen, ist schwerer als gedacht, zumal Rafe sich von ihrem unwiderstehlichen Charme verhexen lässt ...
Über die Autorin
Meagan McKinney hat ihre Karriere als Biologin aufgegeben, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Sie lebt mit ihrer Familie in New Orleans und schreibt nicht nur historische Liebesromane, sondern auch packende Thriller.
MEAGAN McKINNEY
Diebin der Nacht
Ins Deutsche übertragen von Claudia Ostwig
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Moonlight becomes her, © 2001 by Ruth GoodmanPublished by Arrangement with Kensington Publishing, Corp.Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische AgenturThomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Digiselector | Scott A. Burns | Skuropatskaja
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3885-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Jude Nicholas Foret – Ein Offizier und Gentleman
Kein anderer Gedanke …
Prolog
September 1881
Rafael Belloch zog den Ledervorhang beiseite, als seine Kutsche an der City Hall vorbeirollte. Er streckte den Kopf hinaus und rief dem Kutscher zu: »Fahr hinüber zur Baxter Street!«
»Aber das ist in Five Points, Sir. Und es dämmert bereits.«
»Genau richtig. Und nun fahr bitte!«
»Es wimmelt dort nur so von rauen Gesellen, Sir. Die Wiege von Banden und alldem.«
»Das ist mir völlig egal. Fahr schon los.«
»Wie Sie wünschen, Sir.«
Der Kutscher ließ sein Signalhorn erschallen, um die übrigen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Dann knallte er die Zügel auf die glänzenden Hinterbacken des Pferdegespanns, und die schwarz lackierte Kutsche bog scharf um die nächste Ecke.
Rafe ließ den Vorhang zurückgezogen und sank müde in den Sitz aus gestepptem Satin zurück, während er beobachtete, wie der Tag in die Nacht überging. Ein zunehmender Mond war über der Upper Bay aufgegangen. Von hier aus konnte er einen schemenhaften Blick auf den Manhattan-Turm der noch unvollendeten Brücke erhaschen, der sich vor der Skyline kühn über den East River erhob. Das Gewirr von Drahtkabeln bildete eine spinnwebartige Silhouette vor dem sich verdunkelnden Himmel.
In den Leitartikeln der Zeitungen wurde mit Überzeugung vorausgesagt, dass die schwerfällige Konstruktion täglich unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen könnte. Drüben im Westen hatte er jedoch seinen Ingenieuren und Arbeitern dabei zugeschaut, wie sie Zugtunnel durch scheinbar undurchdringliche Berge aus reinem Granit gesprengt hatten. Die Brücke würde standhalten. Darauf wettete er.
Alles Menschenerdenkliche schien in diesen Tagen möglich zu sein. Einige glaubten, dass das berauschende Zeitalter längst an die Grenzen allen Wissens gestoßen sei. Rafe jedoch verachtete diese selbstgefällige Blindheit. Die Menschen konnten Berge in die Luft jagen und Türme bauen, die in den Himmel hineinragten, sie konnten jedoch noch kein Kind davon abhalten, in den dunklen Gassen der Baxter Street betteln zu gehen. Der Fortschritt war gut für das Bankkonto, jedoch ohne Nutzen für die Seele – oder das verhärtete Herz eines Mannes, der in erster Linie für die Rache lebte.
Das Getrappel der Pferde, die Kabrioletts und Kaleschen zogen, wurde schwächer, als seine Kutsche die gut instand gehaltenen Straßen aus blauem Tonsandstein gegen die unbefestigten Wege der Slums eintauschte. Einen kurzen Moment lang, bevor das laute Geschrei von Five Points ihn umgab, war es beinahe ruhig, so ruhig, dass er das abendliche Angelusläuten der St. Patrick’s Cathedral hören konnte.
Tagsüber war die Baxter Street ehrbaren Männern nicht unbekannt. Ihre Lage an der Lower East Side machte sie ideal für viele City-Hall-Beamte. Ein Mann konnte seinen Tabakwarenhändler und seine Hure auf einem Weg besuchen, denn oftmals befanden sich diese im selben Gebäude.
Rafe wusste, dass das Viertel seit der berüchtigten Epoche, in der rivalisierende Banden sich ständig gegenseitig bekämpft hatten, ein wenig besser geworden war. Selbst Charles Dickens hatte sich einst geweigert, dieses Gebiet ohne Geleitschutz zu betreten. Das lag jedoch dreißig Jahre zurück, und in der ehemals gefährlichen Old Brewery befand sich nun eine Kirchenmission. Trotzdem mieden die meisten New Yorker noch immer Five Points, als ob es das Tor zur Hölle wäre – vor allem nach Einbruch der Dunkelheit. Genau das jedoch war der Grund, aus dem er immer wieder darauf bestand, dorthin zu gehen – er, ein Patriarch der »oberen Vierhundert«, Mrs Astors Auserwählter. Die Fifth-Avenue-Brahmanen, wie er sie verächtlich nannte.
Sie? Uns, korrigierte er sich selbst. Uns.
Eine Fahrt durch Five Points war genau das richtige Gegenmittel, wann immer er sich dabei ertappte, selbstgefällig zu werden. Der Luxus und der Status seines neuen Reichtums waren wie ein Bad, in das man sich mühelos hineingleiten lassen konnte. Er brauchte jedoch den Anblick der Armut, um niemals zu vergessen, dass seine Rolle die der Rache war; Rache an genau den Menschen, die ihn nun umarmten. An denselben erbärmlichen Reichen, die seiner Familie Ruin und Schande bereitet hatten. Denselben amoralischen Menschen, die ihn als Kind nach Five Points getrieben hatten – und die niemals zurückgeschaut hätten.
Draußen im Licht der Gasbeleuchtung flackerten unheimliche Schatten. Sie rollten an Holzhäusern vorbei – modrig und ohne Anstrich –, dazwischen hohe Mietskasernen aus Ziegelstein. Als er einen Blick auf die Bettler und Diebe, Huren und Gauner warf, kämpften in seinem Innern Mitgefühl und Ekel gegeneinander an. Und überall die Gassenkinder, verlassene und verwaiste Kinder, die sich allein durchs Leben schlugen, indem sie mit den streunenden Hunden um einen trockenen Schlafplatz kämpften.
Die Wall Street braucht eine weitere Börse, dachte er. Eine Schmutzbörse. Das war nämlich eine der am reichlichsten vorhandenen Waren in der Stadt.
Plötzlich kam die Kutsche mit einem Ruck zum Stehen, einen Moment später setzte sie sich wieder in Bewegung. In unmittelbarer Nähe von Five Points, das durch drei sich kreuzende Straßen gebildet wurde, gab es ein verwirrendes Labyrinth dunkler zwielichtiger Gassen, Heimat der Halbwelt, die außer in den Penny-Zeitungen selten erwähnt wurde. Ohne Vorwarnung bog die Kutsche scharf in eine dieser Gassen ein und hielt erneut an, so abrupt, dass die Zugketten rasselten und Rafe vom Sitz geschleudert wurde. Er streckte seinen Kopf hinaus. »Wilson, verdammt, was zum Teufel …?«
Noch bevor er seine Frage beenden konnte, schoss eine schlanke, wohlgeformte weibliche Hand durch das Fenster und drückte einen feuchten Bausch unter seine Nase. Rafe gelang es, sein Gesicht abzuwenden, nicht jedoch, bevor er den üblen Geruch von Chloroform eingeatmet hatte. Er war nicht bewusstlos, hatte jedoch das Gefühl, einen wuchtigen Schlag abbekommen zu haben.
Rafe fiel der Länge nach in den Sitz zurück. In seinem Kopf drehte sich alles, er nahm nur noch ein schallendes Durcheinander von Geräuschen wahr, die nicht genau zu identifizieren waren. Dann öffnete jemand mit einem Ruck die Tür.
»Steig aus, Jack, und zwar ein bisschen flott, sonst jag ich dir ’ne Kugel durch den Kopf!«
Schwankend und gegen Übelkeit ankämpfend stieg Rafe mit wackeligen Beinen aus. Die Gasse war staubig und mit Abfall übersät. In der zunehmenden Dämmerung konnte er einen großen Mann erkennen, der einen Mantel aus grobem Wollstoff und eine dreckige, in seine Stiefel gesteckte Segeltuchhose trug. Seine rechte Hand umklammerte eine alte Dragonerpistole.
Rafe warf einen flüchtigen Blick über die Schulter und sah einen zweiten Mann oben auf dem Kutschbock stehen, der ein großes Messer an Wilsons Kehle drückte. Irgendjemand hielt eine Laterne vor Rafes Gesicht.
»Schau dir bloß diese schöne Kleidung an!«, rief der Mann in der Gasse aus, während er Rafes Überzieher befühlte. »Es ist unser Glückstag, Schätzchen.«
Rafe nahm rasch wahr, dass er zu der Frau sprach, die die Laterne hielt – derselben Frau, die ihn betäubt hatte. Eine schwarze Dominomaske verdeckte eine Hälfte ihres Gesichtes, ein mit Perlen besticktes Kopftuch aus tiefroter Seide bändigte ihr üppiges dunkles Haar. Sie trug einen geflickten braunen Wollrock und eine schmuddelige grüne Samtjacke, unter der sich ihr wogender Busen abzeichnete.
Sie erwiderte seinen forschenden Blick mit kühlen glänzenden Augen, die wie Eissplitter hinter der Maske hervorstarrten. Er hätte ihr Herz für genauso kalt halten können, wäre da nicht diese unerwartete Gefühlsregung gewesen, die er plötzlich in ihnen erkennen konnte. In ihren blauen Tiefen lag ein verletzter, vorwurfsvoller Ausdruck, der nichts mit ihm, eher mit der Welt zu tun zu haben schien.
Dieser Ausdruck verriet ihm, dass sie kein völlig verhärtetes Wesen war. Noch nicht jedenfalls.
Sein Blick trieb ein schwaches Lächeln über ihr Gesicht, bei dem sie einen Mundwinkel hochzog. Die blauen Augen blitzten auf, schauten dann weg, als fühlte sie sich unbehaglich.
»Du erkennst ihn doch sicher?«, sagte sie dann verächtlich zu ihrem Gefährten, wobei die Kultiviertheit ihrer Stimme ihn erschütterte. »Es ist Rafael Belloch persönlich. Er baut Tunnel und Brückengerüste für die Kansas-Pacific. Oder pflegte es zu tun, denn ich habe gehört, dass er inzwischen Unternehmer geworden ist.«
»Allmächtiger Gott! Du hast recht, es ist Belloch.«
Der Räuber oben auf dem Kutschbock schnaubte. »Sicher, und der hier oben ist Rockefeller.«
»Es ist Belloch, verdammt noch mal!«, versicherte ihm der große Mann, der Rafe mit der Dragonerpistole in Schach hielt. »Sein Bild war gerade im Herald. Dort, schaut nur! Schaut euch die Geschirre an – alle vergoldet.«
»Natürlich ist es Belloch«, bestätigte mit samtweicher Stimme die Frau. »Sein attraktives Gesicht ist keines, das eine Frau so leicht wieder vergisst.«
Im nächsten Moment nahmen ihre Worte jedoch einen spöttischen Ton an. »Sie sind ganz schön weit von der Fifth Avenue entfernt, Mr Mountain Mover.«
»Vielleicht«, antwortete Rafe. Sein Kopf wurde klarer, und seine Faszination für sie ging rasch in Empörung über. »Aber ich wette, dass ihr drei nicht sehr weit vom Ludlow-Street-Gefängnis entfernt seid.«
»Wenn wir deine Meinung brauchen«, fuhr der Mann, der neben ihr stand, ihn an, und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut, »werden wir sie schon aus dir rausprügeln. Her mit deiner Brieftasche und deiner Uhr. Und versuch hier keinen deiner Salontricks.«
Rafe zog seine schweinslederne Brieftasche und seine goldene Uhr mitsamt der Kette hervor und reichte ihm beides herüber.
»Den Mantel ebenfalls, Baron«, fügte die Frau hinzu, während ihre kalten, aber hinreißenden Augen sich vor Heiterkeit erwärmten.
»Baron?«, wiederholte er höhnisch, als er seinen Überzieher abstreifte. »Habe ich nun sogar einen Titel erworben?«
»Ja. Sie sind einer der Größten im Adelsstand der Räuberbarone.«
»Wenn ich der Räuber bin, dann solltet vielleicht ihr drei eure Hände hochheben und nicht ich.«
»Er versucht nur, sich Mut zu machen«, spottete der Mann auf dem Kutschbock. »Er überspielt seine feige Angst.«
»Oh, der hat keine Angst«, antwortete die Frau, während sie im Licht der Laterne eingehend sein Gesicht betrachtete. »Mr Belloch ist weder zaghaft noch ängstlich. Dieses spöttische Lächeln, das er im Gesicht trägt, ist nicht aufgesetzt. Er denkt gerade daran, wie gerne er uns drei quälen würde.« Sie gab ein boshaftes Lachen von sich.
»Madam, Sie können ja Gedanken lesen! Zweifelsohne ist eine Frau mit Ihrer offensichtlichen Schönheit und Kultiviertheit zu etwas Höherem geboren als zu gewöhnlicher Dieberei?«
Ihr Gesichtsausdruck verdunkelte sich. Das verletzte Kind, das er zuvor in ihren Augen gesehen hatte, versteckte sich, ganz so, als ob es gewohnt sei, sich im Dunkeln zu verbergen.
In genau diesem Moment wurde Rafe eines klar: Diese Frau wurde nicht gern daran erinnert, dass sie zu etwas Höherem geboren war. Das war ihr wunder Punkt.
»Dies, Mr Belloch«, versicherte sie betont kühl, während sie seinen Mantel über ihren Arm drapierte, als wäre er eine Samtdecke, »ist sehr viel gewinnbringender, als Akkordarbeit in einer Bekleidungsfabrik zu verrichten.«
»Du hast gut reden, Belloch«, spottete der Mann auf dem Kutschbock mit einer Stimme so ätzend wie Säure, während er das Messer näher an Wilsons Kehle heranführte. »Euresgleichen versteckt sich in der Wall Street und lässt die Banken die Drecksarbeit tun. Wir berauben unsere Opfer wenigstens auf ehrbare Weise, von Angesicht zu Angesicht.«
Rafe zog es vor, die Zähne zusammenzubeißen, anstatt eine scharfe Antwort zu geben. Er machte sich keine Illusionen über die Bereitschaft der beiden Männer, sie zu töten. Stattdessen konzentrierte er sich lieber darauf, sich das Gesicht der verwegenen Schönheit genauer anzusehen. Er prägte sich jedes ansprechende Merkmal ins Gedächtnis ein – zumindest diejenigen, die nicht hinter der Maske versteckt waren. Ihre schöne Stirn, die wohlgestaltete Linie ihrer Nase und die üppigen Lippen. Er würde sie wiederfinden. Ihre Entlarvung würde ihm ein Vergnügen sein.
Vielleicht starrte er sie zu eindringlich an, denn plötzlich schienen ihre Augen wieder wie Eiskristalle zu blitzen. Sie sagte frech: »Hören Sie nicht beim Mantel auf, Mr Belloch. Ziehen Sie auch den Rest Ihrer Kleidung aus. Dafür wird es beim Lumpenhändler ein paar gute Pennys geben.«
»Den Rest …? Das kann doch bei Gott nicht Ihr Ernst sein?«
Rafe zuckte zusammen, als die Mündung der Dragonerpistole sich hart auf sein Brustbein drückte. »Du hast doch gehört, was die Lady gesagt hat!«
Er schluckte seine Wut hinunter und sagte scharf: »Denken Sie, dass ich Ihre Marionette bin?«
»Ich denke in der Tat, Mr Belloch. Sie sind ohne Zweifel ein stolzer und gefährlicher Mann. Aber kein Mann ist gefährlich, wenn er nackt ist«, antwortete sie und lachte verführerisch.
»Spricht da Theorie oder Erfahrung?«
Erneut schaute sie weg. »Ich will nur sichergehen, dass der erste Ort, den Sie aufsuchen werden, ihr Zuhause ist. Und nun entkleiden Sie sich.«
»Ich benötige einen Stiefelknecht«, verlangte er missmutig. »Diese Stiefel sind neu und sie sind noch eng …«
»Die Pest soll ihn holen!«, platzte es aus dem Mann auf dem Kutschbock heraus. »Ich werde den Bastard erschießen!«
»Nein!« Mit der Anmut einer auf Spitzen tanzenden Ballerina wirbelte sie herum. »Keine Schießerei!«
Sie drehte sich wieder zu Rafe zurück. Da sie nun näher bei ihm stand, konnte er einen noch besseren Blick von ihr erhaschen. Ein paar Sekunden lang wurden ihre Augen durch das warme Licht erleuchtet – Augen, so blau wie Vergissmeinnicht.
Sie war also nicht durch und durch kalt. Nicht durch und durch schlecht.
»Ein bisschen schneller, Sir, sonst ändere ich noch meine Meinung, was das Schießen angeht.« Ihre Worte klangen beinahe wie eine Bitte.
Obwohl gärender Hass sein Blut erhitzte, gehorchte Rafe. Zuerst reichte er seine Weste, dann sein Hemd aus fein gesponnenem Leinen und sein Unterhemd hinüber. Sie genierte sich überhaupt nicht, ihn dabei in der vollen Beleuchtung stehen zu lassen.
»Wer hätte das gedacht? Er hat Muskeln so hart wie Salzsäcke«, sagte der Mann oben auf der Kutsche.
Ihr Blick wanderte fast widerwillig über Rafes Oberkörper. »Nun verstehe ich, warum Mrs Astor so begeistert von Ihnen ist. Rasch, Mr Belloch, Stiefel und Hose.«
Die Stiefel auszuziehen war ein Kampf. Er kam ins Schwanken und fiel beinahe hin, als er sich aus ihnen herauswand. Der Dieb, der mit der Pistole herumfuchtelte, schnappte sie ihm aus den Händen. »Wir sind zwar nicht gut genug, solche Stiefel zu tragen, aber bei der heiligen Barbara, wir sind gut genug, sie zu stehlen.«
Als er sich auch seiner Hose entledigt hatte, fragte Rafe dreist: »Die Unterwäsche ebenfalls?«
Trotz seiner wütenden Verachtung überrumpelte ihn ihre unverblümte Antwort.
»Natürlich!«, befahl sie ihm. »Der Auftakt war in der Tat schon sehr erfreulich. Enttäuschen Sie mich nun nicht.«
Ihr zynisches Lächeln versetzte ihn erneut in Wut.
Er zögerte.
»Genug jetzt!«, protestierte ihr Gefährte auf dem Kutschbock und sprang hinunter. »Lass ihm gefälligst seine verdammte Unterwäsche, du kleine Dirne. Ich hab keine Lust, nach Blackwell’s geschickt zu werden, nur damit du diesen Snob begaffen kannst. Wir machen uns lieber aus dem Staub.«
Die beiden Männer zogen sie mit sich wie einen Straßenlümmel. Im Grunde war sie das ja auch. Rafe beobachtete sie, als ihre sanft geformten Lippen sich zu einem erneuten Lächeln rundeten. Sie lachte ganz unumwunden über ihren Spaß.
Selbst als das Räubertrio schon tief in der finsteren Gasse verschwunden war, rief ihre spöttische Stimme noch aus: »Ich werde wohl nie aufhören, es mir vorzustellen, Mr Belloch!«
Weder sein Zorn noch seine Beschämung ließen nach. Sie hatte soeben den Fehdehandschuh hingeworfen, und sein Wille ballte sich plötzlich wie zu einer Faust zusammen.
»Nur zu, stell es dir ruhig vor, du unverschämtes kleines Frauenzimmer«, murmelte er zu sich selbst.
Diese Vorstellung sollte ruhig ihren Appetit steigern. Mit Sicherheit hatte sie den seinen gesteigert.
Denn Rafe schwor bei allen Dingen, die ihm heilig waren, dass, was auch immer sie sich heimlich vorstellte, sie es eines Tages zu sehen bekäme.
1
Juni 1883
»Ladys und Gentlemen«, verkündete Paul Rillieux mit kultivierter klangvoller Stimme, die nicht den geringsten Hinweis auf sein fortgeschrittenes Alter gab. »In unserer Mitte gibt es einige Menschen, welche die bis dato noch geheimnisumwitterte Gabe besitzen, mit Mächten außerhalb unseres physischen Bereiches Kontakt aufzunehmen. Man bezeichnet sie manchmal als sensitive Menschen. Ich selbst erhebe keinen Anspruch auf einen solchen Titel. Trotzdem beschäftige ich mich nebenbei ein wenig mit den mystischen Künsten. Da Mrs Astor von meinem Interesse weiß, hat sie mich gebeten, eine kurze Demonstration telepathischen Mentalismus zu geben. Es handelt sich dabei um die gut belegte Fähigkeit, die Gedanken anderer aus dem Äther – dem gasförmigen Element, das unsere Atmosphäre durchdringt – lesen zu können.«
Auf einem Podium am Ende der Galerie hatte ein Orchester gespielt. Nun jedoch überließen die Musiker ihre Bühne dem wohlhabenden alten Erfinder, Forscher und angeblichen Hellseher.
»Wir alle wissen«, fügte Rillieux mit einem süffisanten Lächeln hinzu, »dass eine Bitte von Mrs Astor die Überzeugungskraft eines Einberufungsbefehls der Regierung besitzt. Hier bin ich also und melde mich gehorsamst zum Dienst.«
Er verneigte sich in Richtung einer sorgfältig frisierten Matrone, die einen Wasserfall von Diamanten um ihren Hals trug. Sie nickte gnädig, und nach ihrer Erlaubnis, seinem Witz Beifall zollen zu dürfen, erklang verzögertes Gelächter durch die geschmückte Galerie und die umliegenden Gärten.
Erst ein Jahr zuvor war der erste Distrikt im unteren Manhattan mit Elektrizität aus dem neuen Kraftwerk in der Pearl Street versorgt worden. Inzwischen erstrahlte sogar im Herrenhaus der Maitlands am unteren Ende der Fifth Avenue zuverlässig und ohne zu flackern helles Licht aus fünfflammigen Wandleuchten in Form von Putten aus Messing und Kristall.
»Da ist einmal der Verstand«, fuhr Rillieux fort, »aber da gibt es außerdem noch die Seele. Nur selten befinden sich die beiden im Einklang. Das Bewusstsein mag zum Beispiel gerade darüber nachdenken, was es zum Dinner geben wird, während die Seele sich heimlich über irgendein nicht eingehaltenes Versprechen oder einen unerfüllten Traum Gedanken macht.«
Gelassen, selbstsicher und vornehm betrachtete Rillieux die glanzvolle Versammlung vor sich, wobei eine seiner hageren Hände auf seinem Spazierstock aus Peddigrohr liegen blieb. Neben Caroline Schermerhorn Astor befanden sich unter seinem Publikum noch Alice Vanderbilt, ein emigrierter französischer Adliger, und zwar der Comte de Chartrain, die Debütantin Antonia Butler, die als Nächste an der Reihe war, ein Vermögen zu erben, das mit dem der Vanderbilts konkurrieren konnte – und natürlich der Gastgeber des Abends, der Immobilienbonze Jared Maitland.
Mrs Astors Anwesenheit bewies, dass ihre Exklusivität in letzter Zeit durch die große Anzahl der neuen Millionäre stark gelitten hatte. Vor allem durch diejenigen aus dem Westen, die weniger gute Umgangsformen pflegten, dafür jedoch sehr viel mehr Geld besaßen, als ihr Snobismus es ignorieren konnte. In der Tat war dadurch letztlich eine radikale und neue Ansicht aufgekommen und hatte begonnen, ihre Wurzeln zu schlagen: Wenn man ganz genau wusste, wie viel Geld einem gehörte, so konnte man nicht wirklich reich sein. Die Quantität war dabei, ererbte Qualität zu ersetzen.
»Irgendjemand unter uns«, verkündete Rillieux abrupt, »träumte erst kürzlich von einem innig geliebten Haustier, das sie vor ein paar Jahren verloren hat. Nun trauert sie wieder im Stillen. Und irgendjemand anderer versucht krampfhaft, sich durch den Glanz dieses Abends beeindrucken zu lassen, in Wahrheit jedoch beschäftigt er sich mit so profanen Gedanken wie dem Kauf erstklassiger Immobilien auf der … ja genau, auf der 54. Straße West.«
Aufgeregtes Gemurmel brach unter den Frauen aus, die in der Nähe des Podiums standen.
»Ja natürlich, Thelma sagt, dass sie erst vor zwei Nächten von ihrem schottischen Terrier Jip geträumt hat!«, rief Lydia Hotchkiss aus, die in hellgrünem Satin glänzte. »Und dies ist das erste Mal, dass sie es erwähnt hat.«
Eine männliche Stimme schaltete sich ein. »Ich war mir nicht bewusst, tatsächlich darüber nachgedacht zu haben, ich gebe jedoch zu, vor Kurzem in Erwägung gezogen zu haben, etwas Land auf der 54. Straße West zu kaufen.«
Bei dem Sprecher handelte es sich um den Anwalt Albert Gage, dessen Wall-Street-Firma die Hälfte aller Neureichen der Stadt vertrat, ebenso wie viele aus der alten Aristokratie.
»Sie dachten auch nicht bewusst darüber nach, verehrter Mr Gage«, korrigierte Rillieux ihn.
Einen Moment lang verweilte Rillieux’ Blick auf einer zierlichen jungen Frau, die allein auf einer gusseisernen Bank saß und ihm sittsam zuhörte. Er nickte kaum erkennbar, und eine Minute später fing sie an, langsam zwischen den zerstreuten Gästen umherzuwandern.
»Hier ist noch etwas!«, rief Rillieux aus, wobei sein zerfurchtes Gesicht die Aufmerksamkeit eines jeden außer der jungen Dame erregte, die nun wie ein Puma auf der Pirsch durch die Menge lief. »Irgendjemand unter uns ist äußerst erbost wegen …«, er strahlte ein künstliches Lächeln aus, »ja genau, wegen eines emporgekommenen Reporters des New York Herald …«
Nach etwa zwanzig Minuten endete Paul Rillieux’ eindrucksvolle Demonstration mit begeistertem Applaus.
Selbst diejenigen, die nicht überzeugt waren, sagte Mystere sich, sahen zumindest äußerst amüsiert aus. Wenn Mrs Astor sich für einen einsetzte, konnte man sich seiner Beliebtheit gewiss sein. Diese war jedoch genauso schnell wieder zunichtegemacht, wenn man es sich mit ihr verscherzte.
Mystere trug ein Glas Limonade und einen schmalen Fächer aus weißer Seide in ihren Händen, als sie sich langsam auf den Weg zurück zur schmiedeeisernen Bank machte, wobei sie sich durch ein beeindruckendes Gewirr von Finanziers, Stahl- und Ölmagnaten sowie Eisenbahnbaronen hindurchschlängeln musste.
Nur einer von ihnen beunruhigte sie jedoch wirklich. Obwohl sie ihren scheuen und unaufdringlichen Blick beibehielt – wie es sich für ein anständiges junges Mädchen gehörte – und diesen Mann nicht ein einziges Mal direkt anschaute, so war sie sich doch bewusst, dass er sie von seinem einsamen Aussichtspunkt aus beobachtete. Sein Gesicht konnte sie nicht erkennen, sie bemerkte aber, dass er einen dunklen Anzug aus Kammgarn trug, und zwar einen ohne den eleganten Schwalbenschwanz der alten Garde.
Sie verscheuchte ihre bösen Vorahnungen und schlüpfte unbemerkt an Philip Armour, einem Millionär aus Chicago, vorbei, der gerade vor einer Gruppe seiner Kaufmannskollegen eine Rede hielt.
»Die besten Immobilien bekommt man jetzt«, versicherte er ihnen, »und selbst wenn wir schließlich Brooklyn unter großem Protest in unseren Verwaltungsbereich hineingezwungen haben werden, so ist die einzige Wachstumsmöglichkeit die nach oben. Genauso, wie das in Chicago schon der Fall ist. Mit all den Schiffen, die mit Rekordgeschwindigkeit durch die Narrows fahren, haben wir keine andere Wahl.«
Selbst Mystere, deren Leben weit entfernt war von dem Geldfieber, das einen großen Teil der Stadt befiel, wusste, dass es die Wall Street gewesen war, durch die die Unionsstaaten während des amerikanischen Bürgerkrieges mit Geld versorgt worden waren. Und nun war es auch die Wall Street, die die astronomischen Kapitalgewinne des langen Nachkriegsbooms erntete. Durch ihre Anwesenheit beim Vanderbilt-Ball im März, die Schlagzeilen machte, hatte Mrs Astor diesen einst von ihr verurteilten neureichen Millionären ihre seltene Zustimmung gewährt.
Der Rest der alten Aristokratie war treu und brav ihrem Beispiel gefolgt. Mystere bemerkte, dass selbst alteingesessene New Yorker in großer Zahl erschienen waren, was diese Tatsache bestätigte. Trotzdem jedoch starben alte Vorurteile nur langsam aus, und diese Gruppe mied ostentativ Armour und jeden sonst, der sich nicht an die strikten gesellschaftlichen Regeln hielt und bei Abendgesellschaften über Geschäfte redete. Mrs Astors Elitekern stritt die Existenz von Vulgarität zwar nicht ab, man bestand jedoch darauf, sie an dem Ort zu belassen, an den sie gehörte. »Handel ist nützlich«, hatte sie einst Mystere anvertraut, »aber das ist ein Abwasserkanal ebenfalls.«
Mystere hatte ihre Bank schon fast wieder erreicht, als sie spürte, wie eine Hand ihren rechten Ellbogen ergriff.
»Miss Rillieux«, begrüßte sie ein blasser, korpulenter Mann unbestimmten mittleren Alters. »Sie sehen heute Abend verdammt hübsch aus. Ich habe Sie seit dem Vanderbilt-Ball nicht mehr gesehen.«
»Danke, Mr Pollard. Ja, ich befürchte, dass ich in letzter Zeit sehr häuslich gewesen bin. Mrs Astor hat mich zu diesem Abend überredet.«
»Ein Pluspunkt für sie. Obwohl man einem in diesen Tagen ein Einsiedlerdasein kaum verübeln kann«, nörgelte Abbot Pollard. »Ja doch, man kommt uns in allen Stadtvierteln zuvor. Haben Sie kürzlich die Stadtteile Upper East und Upper West gesehen? Sie sind inzwischen ein regelrechter Schandfleck geworden mit ihren Reihenhäusern und Mietskasernen. Und erst der Park! Gott steh uns bei, der ist nun bevölkert mit Arbeitern und Ladenmädchen, die in Straßenbahnen und dieser stinkenden, qualmenden, lauten Hochbahn dorthin kommen. Man muss quer über den Harlem River fahren, um eine friedliche Kutschfahrt machen zu können. Es ist skandalös, aber daran ist ja wohl diese Tammany-Politik schuld.«
Abbot war berüchtigt für seine snobistischen Tiraden. Mystere lächelte ihm verständnisvoll zu. »Der Park ist nicht ausschließlich für die Reichen angelegt worden«, erinnerte sie ihn freundlich. »Er ist geplant worden als das Gesellschaftszimmer der Stadt, erinnern Sie sich?«
»Das ist ganz schön edelmütig, meine Liebe. Sie sind noch jung und unschuldig, daher vergebe ich Ihnen. Aber ich zum Beispiel erlaube keinem den Zutritt zu meinem Gesellschaftszimmer, der die Dienste eines Läusekammes in Anspruch nehmen muss.«
Sie wollte ihm gerade antworten, als eine kräftige männliche Stimme hinter ihr für sie Partei ergriff.
»Das ist engstirnig und grausam, Abbot. Ich habe eine Menge Ladenmädchen gesehen, die liebenswürdig, intelligent und hübsch sind. Wo bleibt Ihre Einstellung von noblesse oblige, mein Herr?«
Ein langsamer furchtbarer Schauder lief Mystere den Rücken hinunter. Sie drehte sich um und schaute in die türkisfarbenen Augen von Rafael Belloch. Das verkniffene Lächeln, das er ihr schenkte, schien ihm Mühe zu bereiten. Sein kastanienbraunes Haar war unmodern kurz geschnitten und über einer ausgeprägten Stirn und einer feinen romanischen Nase glatt zurückgekämmt.
»Noblesse oblige«, feuerte Pollard zurück, »hat widerliche Suhlen wie den vierten Bezirk und populistische Demagogen wie Tom Foley hervorgebracht, die die Iren und Italiener gegen uns aufhetzen. Der ungewaschene Pöbel hat 1863 beinahe diese Stadt niedergebrannt. Beim nächsten Mal haben sie vielleicht Erfolg damit, dank dieser ganzen neuen ›Aufklärung‹, für die Sie sich stark machen.«
Pollard stapfte mit vor Ärger gerötetem Gesicht davon. Mystere hatte jedoch bemerkt, dass Belloch dem älteren Mann überhaupt nicht zugehört hatte. Er hatte seine provozierenden Bemerkungen nur gemacht, um Pollard loszuwerden. Nun taxierten seine Augen Mystere mit aufrichtigem Interesse.
Ihr Magen verkrampfte sich. Seit ihrer Einführung in die Gesellschaft war es ihr gelungen, diesem Mann aus dem Wege zu gehen, hier jedoch war er nun. Rafe Belloch. Der berüchtigte Räuberbaron persönlich, mit einem Blick, der sie viel zu konzentriert erforschte, und mit Worten, die so sanft waren wie eine Rasierklinge.
»Dieser Haufen hier verachtet die Tammany-Politik«, bemerkte er. »Aber wer sonst macht sich die Mühe, Krankenhäuser und Waisenhäuser für die Armen zu bauen?«
»Ich wäre nicht so voreilig, Mr Belloch, Waisenhäuser zu preisen.«
Mystere bereute es auf der Stelle, in einem unbedachten Moment ihre Meinung geäußert zu haben. Die Worte waren jedoch aus ihr herausgesprudelt, noch bevor sie sie zurückhalten konnte. Da sie sich durch seinen Blick in der Falle fühlte, fügte sie in sehr viel unbeschwerterem Tonfall hinzu: »Mr Pollard ist doch nur ein harmloser alter Miesepeter. Hat Ihnen die Demonstration meines Onkels gefallen?«
Sein Blick geriet nicht einen Moment lang ins Wanken. »Sie war raffiniert und unterhaltsam, in der Tat. Aber trotz der ganzen anwesenden Finanzgenies glaube ich nicht, dass irgendjemand bisher hinter sein Geheimnis gekommen ist.«
Ein paar Sekunden lang schwebten seine beunruhigenden Worte bedrohlich und anklagend zwischen ihnen in der Luft. Mystere wurde von Panik ergriffen, denn sein Blick schien sich tief in ihre Seele zu bohren. Sämtliche Stimmen um sie herum wurden plötzlich gemeinsam mit den erhabenen Klängen eines Straußwalzers zu schrillen Geräuschen, die in ihren Ohren kreischten.
Er weiß es, dachte sie verwirrt. Der schreckliche Moment öffentlicher Entlarvung war gekommen.
Mystere hatte jedoch die Kunst der Verstellung von einem wahren Meister gelernt und schenkte ihm ein sittsames kleines Mona-Lisa-Lächeln. »Hinter das Geheimnis meines Onkels gekommen, Mr Belloch? Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen.«
»Nun ja, das ist doch ganz einfach. Es ist erstaunlich, wie viel man über einen jeden Bürger in Erfahrung bringen kann, indem man einfach einen Diener schickt, seine geparkte Kutsche zu durchsuchen. Oder Ihr Onkel erhält seine Informationen vielleicht lediglich dadurch, dass er ein paar ruhige Augenblicke mit einem geschwätzigen Zimmermädchen verbringt und sie eventuell sogar überredet, ein vertrauliches Tagebuch zu lesen?«
Sie lächelte vor Erleichterung, und ihre Selbstsicherheit kehrte zurück. Belloch meinte nur das kleine, nicht das große Geheimnis.
»Ich nehme an, das ist möglich«, gab sie ohne großes Interesse zu. »Ich bekenne, dass mein Glaube an okkulte Dinge nicht besonders groß ist. Ich betrachte die Demonstrationen meines Onkels als harmlose Unterhaltung. Mit Sicherheit hat er seine kleinen Tricks.«
»Selbstverständlich. Ermutigt durch Mrs Astor persönlich. Wenn man vom Teufel spricht …«
Er wies mit seinem Kinn hinüber. Die große Matrone kam in diesem Moment direkt auf sie zu – natürlich begleitet von ihrem Lieblingslakai Ward McCallister, der mit sorgfältig festgelegtem Abstand hinter ihr herlief. Offiziell ihr gesellschaftlicher Berater, war er außerdem weniger offiziell ein Kuppler.
»Guten Abend, Mystere«, begrüßte Caroline sie mit echter Zuneigung, indem sie der jüngeren Frau einen Kuss auf die Wange gab. »Sie sind in letzter Zeit viel zu zurückhaltend gewesen. Sie haben es doch nicht nötig, im Schatten Ihres großen Onkels zu leben. Sie sind eine Debütantin und keine von der Welt abgekapselte Nonne.«
Caroline wandte sich an Belloch. »Und was Sie betrifft, Rafe, ich muss schon sagen. Sie wissen ganz genau, dass man einen Grafen nicht mit ›mein Herr‹ anspricht. Man redet ihn mit ›le comte‹ an. Ich befürchte, die arme Emile ist schrecklich verärgert.«
Rafe senkte seinen Kopf. »Ich bin aufrichtig beschämt über das Ausmaß meiner Unwissenheit, Caroline. Ich danke Ihnen für Ihre Belehrung. Ich werde studieren, um mich Ihnen würdig erweisen zu können.«
»Sie sind skandalös«, versicherte sie ihm, wobei sie ihre perfekt manikürte Hand erhob, um für einen kurzen Moment seine Wange zu berühren. »Beschämt? Es ist Ihnen doch völlig egal. Und ich bin so vernarrt in Sie, Sie stattlicher Rohling, dass ich Ihnen nicht einmal ernsthaft böse sein kann. Indem Sie meine Schwäche spüren, nutzen Sie sie aus.«
Trotz ihres neckenden Tonfalls sandte Caroline ihm mit gesenkten Lidern ein Lächeln zu, das – zumindest nach Mysteres Auffassung der Regeln – weit über die Grenzen reinen Flirtens hinausging. Caroline wandte sich wieder ihr zu.
»Nehmen Sie sich vor dem da in Acht, meine Liebe«, vertraute sie ihr an. »New Orleans wird Sie mit Sicherheit nicht auf diese Sorte Mann vorbereitet haben. Rafe ist ein übersättigter Idealist, und Ihre Jugend und Naivität reizen ihn. Er ist ein Mann, der es gewohnt ist zu bekommen, was er haben will. Und zwar auf direktestem Wege.«
Caroline und Ward schwebten davon, und Mystere hoffte, dass Belloch ihnen folgen würde. Er blieb jedoch bei ihr stehen und beobachtete sie mit halb anklagendem, halb grüblerischem Blick.
»Ist das nicht amüsant?«, fragte er und wies mit einer Handbewegung auf die Versammlung. »Die Sterbenslangweiligen und die Emporkömmlinge, alle gemeinsam unter Carolines neu aufgespanntem Schirm. Und was sind Sie, Miss Rillieux?«
»Für jemanden, der ein finsteres Gesicht und so spitze Bemerkungen macht«, ließ sie ihn wissen, »waren Sie Caroline gegenüber gerade ausgesprochen zahm.«
»Natürlich. Man besucht ja auch nicht Rom und beleidigt den Papst.«
Sie lachte, obwohl sie sich fragte, was er wohl von ihr wollte. Mit Sicherheit jedoch hatte er sie nicht erkannt. Sie sah inzwischen völlig anders aus als noch vor zwei Jahren. Mit ihrer eigens zu diesem Zweck eingebundenen und bandagierten Figur sah sie – wenn überhaupt – eher noch jünger aus als älter. Nachdem ihre Ausbildung beendet war, hatte ihr Mentor Paul Rillieux ihr schließlich erlaubt, sich ihren Weg aus den dreckigen, erbärmlichen Lumpen hinaus zu verdienen. Jetzt trug sie das unschuldigste blaue Satinkleid, das Charles Frederick Worth jemals entworfen hatte.
Er konnte sie unmöglich erkennen, aber sie erinnerte sich gut an ihn, wie er fast nackt in der Gasse in Five Points dagestanden hatte, sein Gesicht angespannt vor Wut und Rachedrohungen. Er hatte einen atemberaubenden Anblick geboten, und oft war sie seither aus Albträumen erwacht, in denen sein Gesicht sich wie eine Fotografie in ihr Gedächtnis geätzt hatte.
Sie schaute ihn an, um dadurch ihre Selbstsicherheit wiederzuerlangen. Es half nichts. Sie hätte schwören können, dass er seine Position ständig leicht veränderte, als wollte er sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Noch immer wusste sie nicht viel mehr über ihn als das, was sie zwei Jahre zuvor aus den Zeitungsartikeln erfahren hatte. Er war ein Patriarch der »oberen Vierhundert«, wohingegen sie und Paul Rillieux nur durch besondere Protektion von Mrs Astor dazugehörten. Es gab vage Gerüchte über irgendeine Tragödie oder sogar einen Skandal. Das konnte gut möglich sein, denn man wusste von Belloch, dass er viele Bekannte, jedoch nur wenige Freunde hatte. Er hatte ein schwindelerregendes Vermögen durch Eisenbahnunternehmen angehäuft, verbrachte für gewöhnlich einen Teil des Jahres auf seinen prächtigen Besitztümern im Jagdgebiet Virginias und besaß eine private Dampfjacht, die so luxuriös war wie ein kleiner Ozeandampfer. Seine Jacht erlaubte es ihm, seinen hiesigen Wohnsitz auf Staten Island zu haben und dadurch Manhattan bewusst fernbleiben zu können.
Und natürlich war er ein äußerst begehrter Junggeselle – was auch die Tatsache erklärte, dass Miss Antonia Butler ihn selbst jetzt nicht eine Sekunde lang aus den Augen ließ.
»Miss Rillieux«, sagte er, abrupt ihre Gedanken unterbrechend, »was halten Sie von der Sache um Lady Moonlight?«
Sie antwortete ihm, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. »Ich gestehe, dem Ganzen wenig Beachtung geschenkt zu haben. Sie scheint jedoch in der Presse zu einer kleinen Sensation geworden zu sein.«
»Natürlich. Immerhin holt sich unsere Diebin ja das Beste von den ›oberen Vierhundert‹. Hält uns alle zum Narren, indem sie uns mitten in unseren Abendgesellschaften beraubt. Als sie schließlich Caroline um ihr bestes Diamantenarmband erleichterte, war man sich ja wohl der Niederträchtigkeit Lady Moonlights gewiss.«
Seine forschenden Augen sandten eine Botschaft aus, die sie nicht deuten konnte.
»Das ist ein dummer Name für sie, vorausgesetzt, dass der Dieb überhaupt eine Frau ist«, meinte sie. Ihr Tonfall klang höflich, jedoch leicht gelangweilt.
»Sie ist so ›ätherisch wie ein Mondstrahl, so schwer zu fassen wie ein Sumpfluchs‹«, zitierte er die Zeitungen, und sie mussten beide lachen. Noch immer schienen seine grünlich blauen Augen jedes Detail ihres Gesichtes zu erforschen.
»Sie ist außerdem beschrieben worden«, fügte Belloch hinzu, »als eine Walküre von einer Frau, groß und stark. Ein gewöhnlicher Sterblicher soll ihr angeblich nicht gewachsen sein. Die einzigen Zeugen geben jedoch zu, sie nur kurz von hinten und im Dunkeln gesehen zu haben. Außerdem habe ich den Verdacht, dass die Presse nur so schändlich übertrieben hat, um diesen Fall zu einer Sensation aufzubauschen. Meiner Meinung nach ist sie eher zierlich und ausgesprochen geschickt.«
»Sie scheinen sich ziemlich intensiv mit dieser Sache auseinanderzusetzen.«
»Ich habe großes Interesse an den Methoden und Techniken des Gesellschaftsdiebes, Miss Rillieux.«
»Wirklich? Wie amüsant.«
»Ja, nicht wahr?«
Er rückte ihr noch näher, bis sie seinen Atem auf ihrem Gesicht spüren konnte, der feucht und warm und süß war von dem Brandy, den er zuvor getrunken hatte. Ihre Panik kehrte zurück, und einen Moment lang fürchtete sie eine vernichtende Entlarvung – und zwar gleich hier und jetzt. Ihre Beine fühlten sich schwach an, und sie hätte sich gerne hingesetzt, sein Blick jedoch hielt sie mit der Autorität einer Gewehrmündung an ihrem Platz.
»Sehen Sie, Miss Rillieux, die geschicktesten Diebe arbeiten in Gruppen oder sogar in riesigen Syndikaten zusammen.« Seine Augen verengten sich. »Ich wäre nicht im Geringsten überrascht zu erfahren, dass unsere berüchtigte Lady Moonlight einst eine gewöhnliche Straßendiebin gewesen und mit einer Bande von ungehobelten Ganoven umhergestreift ist. Sie halten zusammen, diese Typen, und sie ziehen immer die Sicherheit der Ablenkungsmanöver vor, um ihre Aktivitäten zu verdecken. Vielleicht hat sie sogar an genau diesem Abend wieder zugeschlagen – während Ihr Onkel uns alle in seinen Bann gezogen hat.«
Sie schaute ihn an und war bereit, ihm mit Leugnen zu begegnen, obwohl sie sich eher danach sehnte wegzulaufen.
Was sie jedoch nicht erwartet hatte, war das großmütige Grinsen auf seinem Gesicht, als er ihren Blick erwiderte.
»Da ist er wieder«, flüsterte er mit fast verzücktem Gesichtsausdruck. »Dieser Blick – so voll des Vorwurfs –, so voll alter Wunden. Welchen Grund könnte eine junge Debütantin aus New Orleans wohl haben, verletzt auszusehen?«
Sie schaute weg und versuchte stattdessen, sich auf die Ballbesucher zu konzentrieren. Die Farben der Satinballkleider fingen an, vor ihren Augen durcheinanderzuwirbeln. Schon im Erstarren begriffen ermahnte sie sich, keine Angst zu haben. Er hatte nichts gegen sie in der Hand. Er stellte lediglich Vermutungen an. Wie sie sich schon tausende Male selbst versichert hatte, würde sie das tun, was sie tun musste, um zu überleben. Sie hatte dies alles schließlich nur so lange ertragen, um die Hoffnung nicht zu verlieren, eines Tages ihren Bruder Bram wiederzufinden. Und wenn das erst geschehen war, würde er sie schon aus all diesem Dreck und diesen Lügen herausholen. Er würde dafür sorgen, sie wieder in Sicherheit zu bringen, und alles würde wieder gut sein. Dann hätten sich die Dieberei und die Angst, die sie ständig mit sich trug, gelohnt.
Dank dieser Erkenntnis gelang es ihr, die Panik in ihrem Herzen zu bezwingen.
»Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden, Mr Belloch. Dieser ganze Unsinn von alten Wunden. Ich denke, Sie haben zu viel Brandy getrunken.« Sie schenkte ihm ein Lächeln.
»Wie kann es sein, dass ich Sie auf all den Abendgesellschaften noch nie bemerkt habe? Heute Abend habe ich Sie zum ersten Mal wirklich angeschaut, Miss Rillieux. Ich weiß nicht, wie Sie es geschafft haben, mir sonst aus dem Weg zu gehen. Nun jedoch, da ich Sie sehe, habe ich das Gefühl, dass Sie mir irgendwie bekannt vorkommen.« Sein forschender, spöttischer Blick glitt an ihrer Figur entlang. »Zugegebenermaßen gibt es da ein paar Unterschiede. Die Frau, an die ich mich erinnere, war auf jeden Fall … robuster, wollen wir es mal so nennen. Sie war nicht die blasse kleine Maus, die Sie zu sein scheinen, aber das würde ja zu meiner Theorie von den Ablenkungsmanövern passen, nicht wahr?«
»Und zweifelsohne«, verhöhnte sie ihn mit selbstsicherer Verachtung, »ist auch mein Onkel Mitglied dieses niederträchtigen Syndikates?«
»Vielleicht«, antwortete er mit einem erneuten starren Lächeln. »Und vielleicht sind Sie ja sogar Lady Moonlight.«
Sein Tonfall ließ die Möglichkeit offen, dass er lediglich scherzte. Diese dunklen Augen jedoch erzählten eine ganz andere Geschichte.
Sie fühlte, wie eine kalte Hand ihr Herz ergriff, und ihr Puls ging in harten stoßweisen Schlägen. Noch bevor sie antworten konnte, übertönte ein entsetzter Schrei die Musik und das Gemurmel der Gespräche.
»Oh! Meine Brosche! Irgendjemand hat meine Brosche gestohlen!«
2
Mrs John Robert Pendergast aus Gramercy Park griff nach ihrem Hals, als ob sie erdrosselt worden wäre. Nachdem die Nachricht von dem neuesten Diebstahl sich wie ein Lauffeuer verbreitet hatte, lief alles zunächst wild durcheinander. Mystere bemerkte, dass man weniger um die Brosche besorgt zu sein schien als vielmehr erregt durch die Möglichkeit, die exotische »Lady Moonlight« entdecken zu können.
»Nun, Mr Belloch«, zwang sie sich in leichtem Tonfall zu sagen, »es scheint, als könnten Ihre hellseherischen Fähigkeiten sich mit denen meines Onkels messen. Sie haben dies ja erst vor wenigen Minuten vorausgesagt.«
Belloch verschränkte die Arme vor seiner Brust und beobachtete sie mit der ganzen Wachsamkeit eines Löwen im Unterholz. »Das habe ich. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mich nur schwer dazu durchringen konnte, heute Abend hier zu erscheinen, was hätte ich verpasst!«
Um seinem prüfenden Blick auszuweichen, tat sie so, als wäre sie daran interessiert, sich die ganze Aufregung in ihrer Nähe mit anzuhören. Mrs Pendergast hörte nicht auf, mit ergriffenem Gesichtsausdruck die Halspartie ihres hochgeschlossenen Kleides zu umgreifen, wo sich nun eine Öffnung befand, an der vorher scheinbar die Brosche gesteckt hatte.
»Sie werden sie doch bestimmt fallen gelassen haben?«, fragte Thelma Richards. »Wie hätte sie denn irgendjemand entfernt haben können, ohne dass Sie es bemerkt hätten?«
»In der Tat, wie nur?«, flüsterte Belloch, während er Mystere noch immer beobachtete. »Es sei denn, unsere Lady Moonlight ist eine wahre Könnerin auf ihrem Gebiet.«
»Ziehen Sie da nicht ein paar voreilige Schlüsse, mein Herr?«, focht sie ihn an, ohne mit der Wimper zu zucken. »Ein Diebstahl ist ja bisher noch gar nicht nachgewiesen worden, geschweige denn das Geschlecht des Diebes.«
Sie hoffte, ihn in der ganzen Aufregung zu verlieren und hatte daher begonnen, sich allmählich immer weiter von ihm zu entfernen. Belloch jedoch hatte andere Pläne mit ihr. Er packte sie mit festem und äußerst schonungslosem Griff am Arm und führte sie näher an den Tumult um das Opfer heran.
Zufälligerweise war auch der Polizeichef Thomas F. Byrnes anwesend. Er war äußerst beliebt bei den »oberen Vierhundert«, denn er hatte die strikte Einhaltung der Sperrlinie nördlich der Fulton Street durchgesetzt und hielt so kriminelle und raubgierige Individuen aus dem Finanzdistrikt fern. Nachdem eine kurze und konfuse Durchsuchung des Geländes und der Galerie durch die Bediensteten nichts ergeben hatte, ging er auf die verzweifelte Frau zu.
»Wie sah denn die Brosche aus, Mrs Pendergast?«
»Nun … es war eine gelbgoldene Blumenbrosche, Inspector. Sie hatte fünf ovale Opale und zweiundzwanzig runde Rubine.«
»Ziemlich wertvoll, nehme ich an?«
Die Dame erbleichte. »Ziemlich.«
»Viel Glück, Inspector«, rief Belloch durch die Menge hindurch, wobei sein Blick noch immer auf Mystere verweilte. »Ihre Aufgabe scheint mir so aussichtslos zu sein wie der Versuch, den Ozean mit einem Besen zurückhalten zu wollen. Es scheint, dass unsere Lady Moonlight wieder mitten unter uns zugeschlagen hat. Vielleicht wäre ja eine gründliche Durchsuchung all unserer weiblichen Gäste angebracht?«
Sein Tonfall war scherzhaft, und ein paar Männer lachten bei dieser leicht ordinären Vorstellung in sich hinein, einige der Damen hingegen fühlten sich dadurch offensichtlich beleidigt.
»Das würde sich sicherlich als sehr amüsant erweisen, Mr Belloch«, gab Byrnes zu. »Jedoch auch als äußerst unklug. Ich zumindest würde mit Sicherheit zu einem Streifenpolizisten auf der South Street degradiert werden.«
Antonia Butler zog Bellochs Aufmerksamkeit auf sich und lächelte ihn an, wobei sie – wie Mystere schweigend kritisierte – zu viele Zähne sehen ließ. Sie und Antonia hatten beide in dieser Saison ihr Debüt gehabt, wie geplant hatte Antonia jedoch das größere Aufsehen erregt. Ihr Vater hatte sein Vermögen ursprünglich in Canton, Ohio, mit der Herstellung von Kohlendioxid für die Sodalimonaden-Industrie gemacht. Wie Rockefeller, Carnegie, Armour und so viele andere auch war er dann nach New York gezogen, um dort sein Vermögen arbeiten zu lassen.
Mystere beobachtete, wie Antonia sich bei der Gruppe um sie herum entschuldigte und zu ihr und Belloch hinüberkam. Zum Glück konnte sie spüren, wie Bellochs Hand ihren Arm losließ. In dem Gedränge hatte niemand bemerkt, wie unsanft Belloch sie behandelt hatte.
Antonia sah – wie Mystere zugeben musste – ziemlich attraktiv aus in ihrem eng taillierten Baumwollsatinkleid mit schwarzsamtener Bordüre. Zweifelsohne schmeichelte es ihrer Figur auf eine recht freimütige Weise, wohingegen Mysteres sittsames Kleid – wenn auch von hoher Qualität und ihren schimmernden Teint ausgezeichnet unterstreichend – bewusst so ausgesucht war, dass es sie mehr als Mädchen denn als Frau erscheinen ließ.
Die Erbin ist wunderschön, gestand Mystere sich ein, jedoch steif wie ein feines Porzellanstück. In ihrer ungnädigen Gesinnung fand sie, dass Antonia den Elan einer Schlafwandlerin ausstrahlte und dass das bisschen Lebhaftigkeit, das sie besaß, in der Hauptsache aus Schulmädchenboshaftigkeit bestand. Sie war stolz und genoss es, ihren Reichtum auf eine Art und Weise zur Schau zu stellen, die auf frühere Berührungen mit Entbehrung schließen ließ. Was jedoch noch schlimmer war, sie hatte die unscheinbare kleine Mystere immer als eine Art Wohltätigkeitsmaskottchen der Reichen und Berühmten behandelt.
»Guten Abend, Mystere«, begrüßte Antonia sie mit herablassender Höflichkeit. »Die kleine Aufführung Ihres Onkels gerade eben war recht amüsant. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es in Ihrer Familie ein solch schauspielerisches Talent gibt.«
Dies war ein weiterer Charakterzug Antonias – herabsetzende, jedoch in lieblichem Tonfall gesprochene Worte. Jeder wusste, dass Theaterleute gesellschaftlich degradiert waren. Für einen kurzen Moment packte Mystere die Wut. Antonia war jedoch schon mit Rafe beschäftigt, und Mystere war dem Mädchen im Grunde genommen dankbar für diese Ablenkung.
»Mr Belloch, Sie als Gentleman befinden sich uns Damen gegenüber in einer deutlich günstigeren Lage. Wir müssen zu Hause schmachten, während es Ihrem Geschlecht freisteht, sich ganz nach Belieben zu bewegen. Sie könnten ruhig ab und zu ihr Kärtchen vorbeischicken.«
»Miss Butler, dafür sind die Aussichten viel zu entmutigend. Das einzige Mal, als ich tatsächlich meinen ganzen Mut zusammengenommen hatte, Sie zu besuchen, waren Sie von einer Galaxis hoffnungsvoller Bewunderer umgeben.«
»Mr Belloch! So schüchtern kennt man Sie ja gar nicht – Sie sind doch der Mann, der jedes Ziel erreicht.« Antonias Augen blitzten kurz verächtlich in Mysteres Richtung, als sie hinzufügte: »Ich dachte, Sie gehörten zu denen, die an einer Herausforderung Gefallen finden und nicht an leichten Siegen interessiert sind.«
»Das tue ich auch, Miss Butler, solange meine Investitionen Aussicht auf irgendeinen Profit haben.«
Seine Anspielung war in Mysteres Augen ein wenig ordinär und direkt, Antonia aber schien nicht beleidigt zu sein. Mystere in ihren Blick einschließend antwortete sie: »Mein Vater hat mir stets versichert, dass niemand auf Gewinn hoffen kann, der nicht auch große Risiken auf sich nimmt. Ich hoffe, dass Ihr Erfolg in geschäftlichen Dingen Sie in privaten Angelegenheiten nicht … zu schnell selbstgefällig werden ließ.«
Deutlich mit sich selbst zufrieden, wünschte Antonia ihnen einen guten Abend und kehrte zu ihren Freunden zurück.
»Es mag in der Tat eine ganze Galaxis von Männern um sie herum geben«, bemerkte Mystere in neutralem Ton. »Es ist jedoch ziemlich deutlich, dass Ihr Orbit oberste Priorität besitzt.«
»Nun ja, eines Tages werde ich wohl mit ihr spielen«, antwortete er ohne großes Interesse.
»Spielen Sie auch mit mir? Ist es das, was Sie tun, sich amüsieren?«
»Ja, aber andere Frauen, andere Spiele, Miss Rillieux. Sagen Sie mir, man hat mir gesagt, dass Ihr Onkel hoch in Mrs Astors Gunst steht?«
Seine selbstgefällige Stimme ärgerte sie, daher antwortete sie nur knapp: »Sie ist ausgesprochen freundlich zu uns gewesen. Wir sind noch nicht lange in New York, wie Sie ja wissen.«
Darauf erwiderte er ihr mit einem harten bellenden Lachen. »Mindestens zwei Jahre schon, wenn mich nicht alles täuscht.«
»Andere Frauen, andere Spiele«, warf sie kühl zurück. »Ich denke, dass Sie mich da mit einer anderen verwechseln.«
Er ignorierte ihre Worte, und seine Augen verengten sich wieder in Vermutungen. »Caroline hat mir erzählt, dass Ihr Onkel in seiner Jugend viel in der Welt herumgekommen ist.«
»Er ist ausgiebig gereist, ja. Das war jedoch, bevor ich in New Orleans zu ihm gezogen bin.«
»Ach ja, richtig. Nachdem Ihre Eltern von der … Cholera hinweggerafft wurden, war es nicht so?«
»Gelbfieber. Das ist ein fürchterliches Problem in New Orleans. Im Jahre 1871 hatte es dort einen besonders schlimmen Ausbruch gegeben.«
Inzwischen hatten Mrs Pendergast und Inspector Byrnes sich in den Salon zurückgezogen, um einen detaillierten Bericht aufzusetzen. Mystere schaute so lange umher, bis sie Rillieux’ Blick auf sich zog, der zusammen mit Alice und Alva Vanderbilt an einem marmornen Sockeltisch saß. Er nickte in ihre Richtung, und Mystere versuchte, sich von Belloch davonzustehlen. Erneut jedoch hielt der Eisenbahn-Unternehmer sie mit stählernem Griff zurück.
»Ja, New Orleans ist eine bezaubernde Stadt«, fuhr er fort, obwohl sie offensichtlich den Wunsch hatte zu gehen. »Die Gegend leidet jedoch unter einem erbärmlichen Klima. Ich bin einmal beruflich dort gewesen. Verbrennen sie noch immer die Beast-Butler-Puppe?«
»Was?«
»Was?« Sein Gesicht umwölkte sich. »Mit Sicherheit meinen Sie das ironisch?«
Gegen ihre Verzweiflung ankämpfend versuchte Mystere, den bekannten Namen irgendwo einzuordnen. Dann jedoch erinnerte sie sich an Rillieux’ Privatunterricht. »Oh, natürlich. Sie meinen Ben Butler, den Unionsgeneral, der während des Krieges New Orleans besetzt hatte.«
»Ja. Aber ich bin überrascht, dass jemand, der in New Orleans geboren ist, nicht sofort darauf kommt. Soviel ich weiß, ist er einer der am meisten gehassten Männer der Geschichte der Stadt. Er beschuldigte praktisch jede Dame in New Orleans, eine Hure zu sein.«
»Ich habe keine Erinnerungen an den Krieg, Mr Belloch. Sie vergessen mein Alter. Ich habe gerade erst mein Debüt gehabt«, erinnerte sie ihn.
»Miss Rillieux, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Ich bin erst vor fünf Jahren dort unten gewesen. Er wurde noch immer von wirklich jedem beschimpft.«
Mysteres Unbehagen angesichts all dieser Fragen ging durch seine zähe Ausdauer in pure Empörung über. Mit einer beherzten Verrenkung befreite sie ihren Arm aus seinem Griff.
»Sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ein dummes Geschöpf sein muss, Mr Belloch. Nun, wenn Sie mit Ihren Beleidigungen durch sind, werden Sie mich hoffentlich entschuldigen.«
Er war offensichtlich noch nicht fertig mit ihr, sie jedoch hatte mehr als genug von ihm. Sie wendete sich schnell ab, bevor er sie wieder aufhalten konnte. Sollte er es trotzdem versuchen, so hatte sie vor, um Hilfe zu schreien. Das würde zwar einen Skandal verursachen, aber sie konnte es nicht zulassen, ihn die Oberhand gewinnen zu lassen. Es lag zu viel Gefahr in ihm.
»Dumm ist nicht der Ausdruck, der mir bei Ihnen in den Sinn kommt«, spottete seine Stimme hinter ihr.
Ohne sich umzudrehen, versteifte sie ihren Rücken und überließ ihn seinem spöttischen Lachen.
Als ihre Kutsche an den großen steinernen Torpfosten des Herrenhauses der Maitlands vorbeirollte, genehmigte Paul Rillieux sich eine Prise Schnupftabak. Er ließ seine silberne Schnupftabakdose wieder zuschnappen und sagte zu Mystere: »Nun denn, meine Liebe. Lass mich unsere neueste Errungenschaft begutachten.«
Sie hob ihren linken Unterarm ein wenig an. Unter ihrem Ärmelaufschlag aus Hermelin konnte man den Rüschenbesatz des bestickten Unterziehärmels ihres Kleides sehen. Ein Täschchen mit einer Kordel zum Zusammenziehen war strategisch günstig zwischen diese beiden eingenäht worden, und zwar dort, wo es durch die voluminösen Falten verdeckt wurde. Nach jahrelanger Übung reiner Fingerfertigkeit unter Rillieuxs peinlich genauer Anleitung konnte sie nun jedes Schmuckstück so mühelos entfernen und verstecken, dass selbst jemand, der sie von Nahem beobachtete, nichts anderes sehen konnte als eine Frau, die geistesabwesend einen ihrer Ärmel richtete.
Sie nahm die Brosche heraus und reichte sie Rillieux hinüber.
Dieser entzündete ein Streichholz, dessen auflodernder Schein glänzende Farbpunkte auf dem wunderschönen, reichlich mit Edelsteinen besetzten Stück reflektierte.
»Eine meisterhafte Anfertigung«, verkündete er in ehrfürchtigem Ton. »Mystere, ich hatte im Laufe der Jahre einige brillante Protegés. Dein Talent jedoch ist unübertroffen.«
»Talent«, wiederholte sie, wobei Bitterkeit sich in ihren Tonfall einschlich, »gehört wohl eher in den Bereich der Malerei oder der Dichtkunst, nicht jedoch in den der Diebeskunst.«
»Falsch. Auf alle Fälle einmal ›stehlen‹ wir nicht. Das habe ich dir doch schon gesagt. Wir eignen uns etwas an. Da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Stehlen ist niederträchtig, vulgär und gewöhnlich. Bei deiner Herkunft solltest du dich eigentlich gut daran erinnern, nicht wahr, meine Liebe? Ich selbst habe dich aus Five Points herausgeholt.« Er grinste selbstgefällig. »Nein, im Ernst. Stehlen ist ein schändlicher, heimtückischer Akt. Aneignung hingegen ist raffiniert, anspruchsvoll und kühn. Sie bedeutet Beschlagnahme von Eigentum, ohne irgendwelchen moralischen Rechtfertigungen Beachtung zu schenken. Es ist das, was die Römer pecca fortiter nannten – kühn sündigen. Was glaubst du, wie die ›oberen Vierhundert‹ so reich geworden sind? Indem sie sich das angeeignet haben, was sie haben wollten, so läuft das nämlich.« Das Streichholz ging aus, und Rillieux ließ das Schmuckstück in seine Manteltasche fallen. »Wo wir gerade von den ›oberen Vierhundert‹ sprechen, was hat eigentlich Belloch zu dir gesagt? Es hat nicht nach höflichem Small Talk ausgesehen.«
»Er verdächtigt mich. Es ist der Raub in Five Points – er erinnert sich an mich.«
»Unsinn. Das war vor zwei Jahren. Hat er dich irgendeiner Sache beschuldigt?«
»Nicht so sehr durch Worte, aber …«
»Nun komm schon, meine Liebe, du weißt doch, wie leicht erregbar du sein kannst. Du nimmst es zu wichtig. Du warst in Five Points maskiert, und außerdem siehst du nun sogar noch jünger aus mit deinen eingeschnürten weiblichen Rundungen.«
»Ja, vielleicht hält er mich für siebzehn statt für zwanzig. Das verwirrt ihn aber lediglich, es kann ihn nicht täuschen. Du hättest ihn hören sollen, wie er mich über New Orleans ausgequetscht hat. Und über dich. Er hat mich beinahe über eine Frage nach Beast Butler stolpern lassen. Gott sei Dank hatte ich die Bücher gelesen, die du mir gegeben hattest, und ich konnte mich gerade noch rechtzeitig an ihn erinnern.«
»Belloch sollte sich lieber raushalten. Meide ihn ganz einfach.«
»Ich werde es versuchen, aber was ist, wenn er mich nicht in Ruhe lässt?«
»Er wird es schon kapieren, ansonsten wird seine Neugier ihm noch zum Verhängnis werden.«
»Was bedeutet das?«, fragte sie mit einer Spur von Beunruhigung in ihrer Stimme.
»Nichts, was dich betrifft. Mach dir wegen Belloch keine allzu großen Sorgen. Er ist ein Sonderling. Es kursieren Gerüchte, dass er nicht ganz normal sei. Irgendeine peinliche Sache mit seinen Eltern und dem Verlust ihres Vermögens.«
»Er schien mir einen recht klaren Verstand zu besitzen, Sonderling hin oder her.«
Die Kutsche überquerte den Broadway am Madison Square, dem Hotelviertel. Die Ladies’ Mile – die in der ganzen Welt unübertroffene Einkaufsmeile – erstreckte sich von der 23. Straße Süd bis zur 14. Straße. Der Marble Palace, Lord & Taylor und die anderen riesigen Warenhäuser waren zum größten Teil dunkel und ruhig. Nur das Delmonico’s Restaurant und ein paar Spezialitätengeschäfte hatten noch geöffnet.
»Paul?«, fragte sie mit nun zögernder Stimme. »Die Brosche – wird sie einen guten Preis erzielen?«
»Das hoffe ich. Das hängt jedoch ganz von Helzer ab, weißt du. Warum willst du das wissen?« Wenn eine Stimme die Stirn runzeln könnte, so hätte die seine es nun getan. Mystere hatte noch nie solche Fragen gestellt.
»Ich … das heißt, ich frage mich nur, ob ich nicht vielleicht einen größeren Anteil bekommen könnte?«
»Wofür denn? Bin ich dir gegenüber etwa nicht großzügig genug? Vergiss bitte nicht, dass ich für uns alle einen Haushalt zu führen habe. Du hast ein schönes Zuhause, gute Kleider, Taschengeld und freie Benutzung einer Kutsche mitsamt Kutscher.« Er drohte ihr mit dem Finger. »Meine Liebe, du musst aufhören, so mit deinem Geld herumzuwerfen.«
Einen Moment lang ließ sein tadelnder Ton ihr Gesicht vor Wut erglühen. Trotz ihrer Angst vor Belloch teilte sie in diesem Augenblick dessen offensichtliche Verachtung für die »oberen Vierhundert«. Wenn sie wirklich so überlegen und scharfsichtig waren, wie konnte dann ein so grober Betrüger wie Rillieux sie so leicht mit guter Kleidung und europäischem Flair hinters Licht führen?
Wahrscheinlich wurde er durch ihr frostiges Schweigen gewarnt, denn seine Stimme senkte sich nun um eine Oktave, und sein Tonfall wurde zu einer Drohung. »Mystere, eine Sache gibt es, die ich nicht tolerieren werde, und das ist ein Judaskuss. In unserer kleinen Gruppe lautet die Devise: Einer für alle, alle für einen. Niemand verheimlicht den anderen gegenüber etwas. Habe ich mich da deutlich genug ausgedrückt?«
Einen Moment lang spürte sie, wie im Schutze der Dunkelheit Tränen in ihren Augen und in ihrer Kehle brannten. »Ja«, stieß sie hervor.
Rillieux aber, der ihre Stimmungen haargenau kannte, ging zu einem verständnisvollen Ton über. »Mystere, hast du etwa schon das Waisenhaus vergessen, aus dem ich dich herausgeholt habe?«
Vergessen? Niemals wieder würde sie so viel Glück haben. Sie dachte an die eiskalten Nächte, die schweren Bestrafungen, und es hatte wenig zu essen gegeben außer zweimal täglich Panada – eine Art Brotsuppe, in der ein paar Rübenstückchen schwammen. Dank Rillieux hatte sie das Waisenhaus als achtjähriges Kind verlassen können und gelernt, sich bis zum reifen Alter von zwanzig Jahren durchs Leben zu stehlen. Sie hatte als Straßendiebin angefangen und sich an der Seite von Rillieux in die obersten Schichten der Gesellschaft hochgearbeitet. Wie eine Schlange sich häutet, so hatte auch sie das alte leidvolle Leben einfach abgestreift – nicht jedoch die Erinnerung daran und die Angst davor, wieder dorthin zurückkehren zu müssen.
»Nein«, antwortete sie mit Nachdruck, »ich habe es nicht vergessen. Und ich bin dir dankbar. Du bist gut zu mir gewesen.«
Sie schob den Vorhang beiseite und schaute hinaus. Manhattan wurde noch immer erst teilweise mit Elektrizität versorgt, und Gaslaternen säumten die Straßen. Der Mond erleuchtete die Turmspitze der Trinity Church.
Rillieux’ noch immer freundliche Stimme schnitt sich in ihre Gedanken. »Es ist wegen Bram, nicht wahr? Du vermisst ihn noch immer. Du denkst noch immer an deinen Bruder.«
»Er ist nun sechsundzwanzig«, sagte sie grübelnd, mehr zu sich selbst als zu Rillieux. »Wenn er noch lebt, so ist er alles, was ich noch an Familie habe.«
»Falsch, meine Liebe. Wir sind deine Familie. Wir alle. Ich, du, Baylis, Evan, Rose und sogar unser kleiner Hush, wenn er so weit sein wird. Konzentriere dich lieber auf das, was du hast, und nicht auf das, was du verloren hast. Bram wird nun schon seit zwölf Jahren vermisst. Offen gesagt, diejenigen, die das Pech haben, als Matrosen entführt zu werden, leben für gewöhnlich nicht mehr sehr lange. Es ist unwahrscheinlich, dass er wieder auftauchen wird.«
Erneut spürte sie das salzige Brennen von Tränen in ihren Augen. Er hatte wahrscheinlich recht, sie würde jedoch ihre geheime kostspielige Suche nach ihrem Bruder nicht aufgeben. Hoffnung war ihr Wachtraum, das Einzige, was sie am Leben hielt.
Ihre Kutsche rollte gerade in dem Moment unter der Hochbahn hindurch, als ein später Pendlerzug über ihren Köpfen entlangdampfte. Mystere hörte Baylis, der oben auf dem Kutschbock saß und die Pferde antrieb, fluchen, als Ruß auf ihn niederrieselte. Erneut konnte sie den Mond zwischen den stählernen Stützpfeilern aufblitzen sehen. Trotz ihrer Bemerkung zu Belloch über die Lächerlichkeit des Namens Lady Moonlight wusste sie, dass dieser im Grunde auf unheimliche Weise passend war.
Das erste Mal, das Lady Moonlight die Aufmerksamkeit der Presse auf sich gezogen hatte, war nach den grandiosen, stadtweiten Feierlichkeiten zum Anlass der Eröffnung der Brooklyn Bridge im vergangenen März. An jenem Abend hatten New York und Brooklyn ein solch spektakuläres Feuerwerk inszeniert, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte.
Vier Stunden lang hatte der Nachthimmel über dem East River in brillanten Farben geglüht. Alle, ob jung oder alt, waren aus ihren Häusern gekommen, um an diesem Schauspiel teilzuhaben.
Dann, nur wenige Sekunden nach dem Abbrennen der letzten Leuchtkugelröhren, war ein atemberaubender Vollmond hinter den dunklen Wolken hervorgetreten und hatte die neue Brücke in eine überirdisch leuchtende Aura getaucht. Diese natürliche Lichtschau hatte die Zuschauer noch mehr verzaubert als das Feuerwerk selbst – und genau dies war der Zeitpunkt gewesen, als Mystere, perfektioniert durch eine zwölfjährige Ausbildung bei Rillieux, Carolines Armband entwendet hatte.
Auf diese Weise regte Lady Moonlight sofort die Vorstellungskraft der Öffentlichkeit an und wurde für die weniger vom Glück Begünstigten zu einer Heldin. Schon bald gehörte es fast zum guten Ton, eines ihrer Opfer geworden zu sein. Von Lady Moonlight beraubt zu werden bedeutete letztendlich, einer Elite anzugehören – sie beraubte ja schließlich niemals ein Mitglied der Mittelschicht. Nach ihr Ausschau zu halten, über ihre Identität oder ihr nächstes Opfer zu spekulieren – all dies verlieh dem ziemlich langweiligen Leben der Oberschicht ein wenig Nervenkitzel.
Erneut zerstreute Rillieux’ Stimme ihre Gedanken.
»Nimm dies«, sagte er zu ihr und drückte ihr ein paar Banknoten in die Hand. »Vielleicht kann ich dann und wann ein wenig mehr Geld für dich zusammenkratzen. Aber du musst mir versprechen, es nicht für die Suche nach Bram zu vergeuden.«
Es zu vergeuden … nein, dachte sie, es wäre vergeudet, wenn sie es für noch mehr Kleider oder Parfüm ausgeben würde. Die Suche nach Bram jedoch war für sie so lebensnotwendig wie die Luft zum Atmen. Ihre Antwort war daher zumindest eine Halbwahrheit.
»Ich werde es nicht vergeuden«, versprach sie. »Wirklich nicht.«