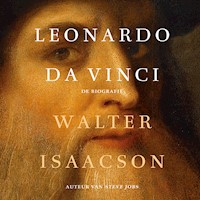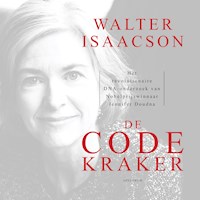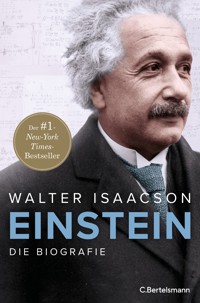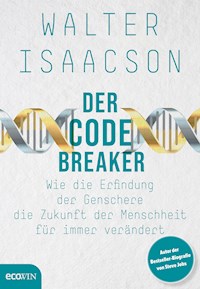
26,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 26,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die CRISPR-Methode und die Zukunft der Medizin Was macht die Natur, wenn ein neuer Feind auftaucht? Sie findet eine neue Strategie. Wenn eine Bakterie von einem Virus attackiert wird, verteidigt sie sich beispielsweise, indem sie ihre genetische Struktur ändert. Doch wie können diese Mechanismen nachgewiesen werden? Und welchen Nutzen hat dieses Wissen für die Medizin? Der Amerikanerin Jennifer Doudna und der Französin Emmanuelle Charpentier sind bahnbrechende Erkenntnisse im Bereich der Biochemie gelungen: Die beiden Forscherinnen konnten die Verteidigungsstrategien der Natur auf grundlegendster Ebene, auf jener der Zelle, entdecken und nachbauen. Das Ergebnis heißt »CRISPR«. Diese Genschere kann den genetischen Bauplan punktgenau ändern. - Ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Chemie: Die Erfolgsgeschichte des Code-Breakers - Die Erfindung von CRISPR: So funktioniert die Technologie des Gen-Editierens - Frauen in der Wissenschaft: Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier im persönlichen Porträt - Moralische und ethische Fragen, die bei der Genforschung bedacht werden müssen - So kann die Genschere in der Virus-Bekämpfung eingesetzt werden Sternstunde der Forschung: Blicken Sie den berühmten Wissenschaftlerinnen über die Schulter! Was trieb Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier zu dieser Höchstleistung an? Welche Rückschläge und Erfolge begegneten den Forscherinnen auf ihrem Weg zum Durchbruch? Wie wurde aus einer Idee, die zunächst wie Science-Fiction klang, ein Projekt, das die Welt der Wissenschaft für immer verändern würde? Walter Isaacson erzählt in diesem fundierten Sachbuch nicht nur die Geschichte der CRISPR-Methode, sondern lässt Sie auch hinter die Kulissen blicken: in die Labore, in denen der Wettlauf der Biosciences entschieden wurde. Ein packendes Wissenschaftsbuch, das Forschung und Biografie verbindet!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 828
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
WALTERISAACSON
DERCODEBREAKER
Wie die Erfindungder Genscheredie Zukunft der Menschheitfür immer verändert
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2022 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Gesetzt aus der Mercury Text
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:Red Bull Media House GmbHOberst-Lepperdinger-Straße 11–155071 Wals bei Salzburg, Österreich
The Code Breaker, Jennifer Doudna,
Gene Editing, and the Future of the Human Race
© 2021 by Walter Isaacson
Satz und Gestaltung: wir sind artisten
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie, Zürich
Übersetzung: Dr. Michael Müller
Lektorat: Dr. Elisabeth Skardarasy
ISBN 978-3-7110-0306-5eISBN 978-3-7110-5329-9
INHALT
EinleitungIn die Bresche
Teil 1: Die Ursprünge des Lebens
Kapitel 1Hilo
Kapitel 2Das Gen
Kapitel 3DNA
Kapitel 4Die Ausbildung einer Biochemikerin
Kapitel 5Das menschliche Genom
Kapitel 6RNA
Kapitel 7Windungen und Faltungen
Kapitel 8Berkeley
Teil 2: CRISPR
Kapitel 9Gehäufte Wiederholungen
Kapitel 10Das Free Speech Movement Café
Kapitel 11Mitmischen
Kapitel 12Die Joghurt-Macher
Kapitel 13Genentech
Kapitel 14Das Labor
Kapitel 15Caribou
Kapitel 16Emmanuelle Charpentier
Kapitel 17CRISPR-Cas9
Kapitel 18Science, 2012
Kapitel 19Duell der Präsentationen
Teil 3: Geneditieren
Kapitel 20Ein menschliches Werkzeug
Kapitel 21Das Rennen
Kapitel 22Feng Zhang
Kapitel 23George Church
Kapitel 24Zhang nimmt CRISPR in Angriff
Kapitel 25Auch Doudna tritt zum Rennen an
Kapitel 26Fotofinish
Kapitel 27Doudnas Schlussspurt
Kapitel 28Die Gründung von Unternehmen
Kapitel 29Mon Amie
Kapitel 30Die Helden von CRISPR
Kapitel 31Patente
Teil 4: CRISPR in Action
Kapitel 32Therapien
Kapitel 33Biohacking
Kapitel 34DARPA und Anti-CRISPR
Teil 5: »Öffentlicher« Wissenschaftler
Kapitel 35Gesetze der Straße
Kapitel 36Doudna schreitet ein
Teil 6: CRISPR-Babys
Kapitel 37He Jiankui
Kapitel 38Das Gipfeltreffen von Hongkong
Kapitel 39Akzeptanz
Teil 7: Die moralischen Fragen
Kapitel 40Rote Linien
Kapitel 41Gedankenexperimente
Kapitel 42Wer soll entscheiden?
Kapitel 43Doudnas ethische Reise
Teil 8: Depeschen von der Front
Kapitel 44Québec
Kapitel 45Ich lerne zu editieren
Kapitel 46Watson revisited
Kapitel 47Doudna kommt zu Besuch
Teil 9: Coronavirus
Kapitel 48Zeit zu Handeln
Kapitel 49Tests
Kapitel 50Das Labor von Berkeley
Kapitel 51Mammoth und Sherlock
Kapitel 52Coronavirus-Tests
Kapitel 53Vakzine
Kapitel 54CRISPR heilt
Kapitel 55Cold Spring Harbour Virtual
Kapitel 56Der Nobelpreis
Epilog
Literaturverzeichnis
Index
Bildnachweise
EINLEITUNG
IN DIE BRESCHE
Jennifer Doudna konnte nicht schlafen. Die Universität Berkeley, wo sie wegen ihrer Rolle bei der Erfindung von CRISPR – der so benannten Technologie des Geneditierens – ein Superstar war, hatte gerade wegen der rasch um sich greifenden Corona-Pandemie den Campus geschlossen. Wider besseres Wissen hatte sie ihren Sohn Andy, Schüler im letzten High-School-Jahr, zum Bahnhof gebracht, damit er zu einem Roboterkonstruktionswettbewerb in Fresno fahren konnte. Nun, um zwei Uhr nachts, weckte sie ihren Mann und bestand darauf, ihren Sohn zurückzuholen, noch bevor die Veranstaltung mit zwölfhundert Teilnehmern begann.
Sie zogen sich schnell an, stiegen ins Auto, fanden in aller Eile eine Tankstelle, die noch offen hatte, und traten die dreistündige Fahrt an. Als sie in Fresno ankamen, war Andy, ihr einziges Kind, alles andere als erfreut, sie zu sehen, doch sie überzeugten ihn davon, dass es besser war, wenn er seine Sachen packte und nach Hause zurückzukam. Als sie vom Parkplatz fuhren, erhielt Andy eine Textbotschaft von seinem Team: »Robotik-Match abgesagt! Alle Jugendlichen sollen sofort abreisen.«1
Wie Doudna sich erinnert, war dies der Augenblick, in dem ihr klar wurde, dass ihre Welt und die Welt der Wissenschaft sich geändert hatten. Die Regierung tastete sich nur mühsam an eine angemessene Reaktion auf COVID heran, daher war es für Professoren und Absolventen an der Zeit, zu den Reagenzgläsern zu greifen und die Pipetten zu schwingen, um in die Bresche zu springen. Am folgenden Tag – am Freitag, dem 13. März 2020 – leitete sie eine Versammlung ihrer Kollegen aus Berkeley und anderer Wissenschaftler aus der Bay Area, dem Gebiet um die Bucht von San Francisco, bei der man die Rollenverteilung in dieser Situation diskutieren wollte.
Ein Dutzend der Teilnehmer wanderte über den verlassen daliegenden Campus von Berkeley zu dem eleganten Gebäude aus Stahl und Stein, in dem sich Doudnas Forschungslabor befand. Im Konferenzsaal im Erdgeschoss standen die Stühle dicht beisammen; das Erste, was die Wissenschaftler taten, war, sie auseinanderzurücken, sodass sie sich in einem Abstand von 1,80 Meter zueinander befanden. Per Zoom wurden weitere fünfzig Forscher von nahegelegenen Universitäten zugeschaltet. Als Doudna im Saal vor die Anwesenden trat, ging etwas Intensives von ihr aus, das sie gewöhnlich hinter einer Fassade der Gelassenheit verbarg. »Dies ist etwas, das Wissenschaftler normalerweise nicht tun«, sagte sie, »aber wir müssen uns ranhalten.«2
Es war passend, dass ein Team zur Virusbekämpfung von einer Pionierin der CRISPR-Methode angeführt wurde. Dieses Verfahren zur Geneditierung, das 2012 von Doudna und anderen entwickelt wurde, basiert auf einer Strategie zur Virusbekämpfung, die seit mehr als einer Milliarde Jahren von Bakterien verwendet wird. In ihrer DNA bilden sie gebündelte, sich wiederholende Sequenzen aus, die als »CRISPR« bekannt sind. Diese können sich an Viren, von denen sie angegriffen werden, erinnern und diese daraufhin zerstören. Es handelt sich mit anderen Worten um ein Immunsystem, das sich an jede neue Virus-Welle anpassen und diese abwehren kann, und genau das brauchen wir Menschen in einer Zeit, in der wir – als wären wir noch im Mittelalter – immer wieder von Virusepidemien heimgesucht werden.
Wie immer vorbereitet und strukturiert, zeigte Doudna Slides, auf denen Möglichkeiten skizziert waren, wie man gegen das Coronavirus vorgehen könnte. Sie leitete die anderen an, indem sie ihnen zuhörte. Obwohl sie eine wissenschaftliche Berühmtheit war, fühlten ihre Kollegen sich unbefangen im Umgang mit ihr. Sie hatte die Kunst gemeistert, ein vollgepacktes Arbeitsprogramm zu absolvieren, aber dennoch die Zeit zu finden, sich emotional auf ihre Mitmenschen einzulassen.
Dem ersten von Doudna zusammengestellten Team wurde die Aufgabe übertragen, ein Testlabor für Coronaviren einzurichten. Eine der führenden Mitarbeiterinnen, die sie zu Rate zog, war eine Postdoktorandin namens Jennifer Hamilton, die ein paar Monate zuvor einen Tag damit verbracht hatte, mir die CRISPR-Methode zum Editieren menschlicher Gene beizubringen. Ich war erfreut darüber gewesen, wie einfach es gewesen war, andererseits bereitete mir genau dies ein gewisses Unbehagen: Sogar ich konnte das!
Ein weiteres Team wurde damit beauftragt, neue Arten von Corona-Tests zu entwickeln, die auf CRISPR basierten. Glücklicherweise kannte Doudna sich mit kommerziellen Unternehmungen aus. Drei Jahre zuvor hatte sie mit zwei ihrer Doktoranden ein Unternehmen gegründet, das CRISPR zum Aufspüren von Viruserkrankungen nutzte.
Indem sie den Startschuss zur Entwicklung neuer Tests zur Identifikation des Coronavirus gab, eröffnete Doudna eine neue Front in ihrem ebenso erbitterten wie fruchtbaren Wettstreit mit einem Konkurrenten von internationalem Rang: Feng Zhang, einem jungen, charmanten, in China geborenen und in Iowa aufgewachsenen Forscher vom Broad Institute des MIT und der Universität Harvard. Er war schon 2012 – beim Wettlauf darum, CRISPR als Erster erfolgreich zum Geneditieren zu verwenden – ihr Rivale gewesen, und seitdem hatten die beiden sich in einem intensiven Wettstreit um wissenschaftliche Entdeckungen und die Gründung von das CRISPR-System nutzenden Unternehmen befunden. Nun, mit dem Ausbruch der Pandemie, würden sie wieder gegeneinander antreten, allerdings nicht im Ringen um Patente, sondern mit der Absicht, Gutes zu tun.
Doudna entschied sich für zehn Einzelprojekte. Sie nominierte die leitenden Wissenschaftler und forderte die anderen auf, einem dieser Teams beizutreten. Jeder von ihnen sollte sich überdies mit einer Person auf professioneller Augenhöhe austauschen, damit – wie auf dem Schlachtfeld – immer jemand da sein würde, der einspringen könnte, sollte er selbst außer Gefecht gesetzt werden. Es würde ihr letztes persönliches Zusammentreffen sein: Von jetzt an lief alles über Zoom und Slack.
»Ich möchte, dass jeder bald anfängt«, sagte sie. »Sehr bald.«
»Keine Sorge«, versicherte ihr einer der Anwesenden. »Keiner von uns hat irgendwelche Reisepläne.«
Was an jenem Tag nicht besprochen wurde, war die eventuelle Aussicht, CRISPR als Werkzeug für vererbbare Veränderungen am menschlichen Gen einzusetzen, die unsere Kinder und alle unsere weiteren Nachkommen weniger anfällig für Virusinfektionen machen würden. Diese Eingriffe in die Genetik könnten die Menschheit auf Dauer verändern.
»Das ist Science-Fiction«, sagte Doudna abweisend, als ich nach dem Treffen auf dieses Thema zu sprechen kam. Ja, stimmte ich zu, es hört sich ein bisschen nach Brave New World oder Gattaca an. Doch ist Etliches aus der Science-Fiction – wie es bei guten Werken des Genres immer der Fall ist – eingetreten. Im November 2018 verwendete ein junger Chinese, der einige der Konferenzen Doudnas zum Thema Geneditierung besucht hatte, die CRISPR-Methode an menschlichen Embryos. Er entfernte ein Gen, das auf das HI-Virus reagiert, welches bekanntlich AIDS verursacht. In der Folge kamen Zwillingsmädchen mit erhöhter Resistenz gegen AIDS zur Welt – die ersten Designerbabys.
Man war erstaunt ob dieser wissenschaftlichen Leistung und war voll des Lobs. Aber man war auch schockiert. Nach mehr als drei Milliarden Jahren des Lebens auf diesem Planeten hatte es eine Spezies – die unsere – zu so viel Talent und Kühnheit gebracht, um die genetische Zukunft in die eigene Hand zu nehmen. Man ahnte, dass wir die Schwelle zu einem ganz neuen Zeitalter, vielleicht zu einer »schönen neuen Welt«, überschritten hätten, ähnlich wie damals, als Adam und Eva in den Apfel der Erkenntnis gebissen hatten oder als Prometheus den Göttern das Feuer entrissen hatte.
Die neuentdeckte Fähigkeit, unsere Gene zu bearbeiten, wirft einige faszinierende Fragen auf: Sollen wir unsere Spezies so verändern, dass wir weniger anfällig für tödliche Viren werden? Das wäre ein Segen, oder? Sollten wir zum Geneditieren greifen, um gefürchtete Krankheiten auszumerzen? Um zum Beispiel Krankheiten wie Chorea Huntington, Sichelzellenanämie oder Mukoviszidose mittels genetischer Veränderung auszuschalten? Hört sich gut an. Doch was ist mit Taubheit und Blindheit? Oder Kleinwüchsigkeit? Oder der Veranlagung zu Depressionen? Hmmm – was ist davon zu halten? Wenn es in ein paar Jahrzehnten möglich und ungefährlich sein wird, sollten wir es dann Eltern gestatten, den IQ oder die Bemuskelung ihrer Kinder zu verbessern? Sollten wir dann über ihre Augenfarbe entscheiden? Die Farbe ihrer Haut? Ihre Körpergröße?
Gemach, gemach! Wie könnten solche Eingriffe sich auf die Diversität unserer Gesellschaft auswirken? Wenn wir nicht mehr der natürlichen Auslese ausgeliefert sind, gibt es dann noch Mitgefühl mit jenen, die weniger gute Karten vom Schicksal bekommen haben? Wenn die Angebote im genetischen Supermarkt nicht gratis sind (und das werden sie nicht sein), wird dann unsere Ungleichheit größer, und wird sie vielleicht sogar an künftige Generationen weitervererbt? Sollten diese Entscheidungen angesichts solch schwerwiegender Fragen Einzelpersonen überlassen werden, oder sollten wir als Gesellschaft mitbestimmen können? Sollte es dafür nicht Regeln geben? Mit »wir« meine ich wir. Wir alle, einschließlich meiner Person und Ihrer.
Herauszufinden, wann und, wenn ja, wie man ein Genom editieren sollte, wird eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sein. Die Antworten auf diese Fragen sind von noch nie dagewesener Dimension. Daher halte ich es für wesentlich, gründlich über diese Fragen und solche Entscheidungen nachzudenken. Außerdem ist es aufgrund wiederkehrender Wellen von Virusepidemien wichtig, sich intensiv mit den Life-Sciences zu befassen. Herauszufinden, wie etwas funktioniert, ist ohnehin spannend. Wenn wir selbst dieses »etwas« sind, umso mehr. Doudna hatte diese Freude schon, und jetzt sind wir dran. Genau darum geht es in diesem Buch.
Die Entdeckung von CRISPR und die Corona-Pandemie werden die dritte große Revolution der Moderne beschleunigen. Die Basis dafür wurde durch die Entdeckung dreier Grundelemente unserer Existenz geschaffen: dem Atom, dem Bit und dem Gen.
Albert Einsteins Schriften von 1905 zur Relativität und zur Quantentheorie läuteten die Revolution der Physik ein. In den fünfzig darauffolgenden Jahren brachten Einsteins Theorien die Atombombe, die Kernenergie, Transistoren und Raumschiffe, Laserstahlen und Radar hervor.
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war die große Zeit der Informationstechnologie. Deren Grundlage bildete die Idee, dass alle Informationen in Binärziffern – als »Bits« bekannt – gefasst werden und alle logischen Verarbeitungsprozesse von Stromkreisen, die sich ein- und ausschalten lassen, durchgeführt werden können. In den 1950er-Jahren folgten der Mikrochip, der Computer und das Internet. Als diese drei schließlich kombiniert wurden, kam es zur digitalen Revolution.
Nun sind wir in die dritte Ära eingetreten, deren Folgen einen langen Nachhall haben werden. Es ist die Ära der Life-Sciences, der Biowissenschaften. Bis jetzt wollte man das digitale Codieren begreifen und anwenden. Nun kommt das Interesse am genetischen Code hinzu.
Als Doudna in den 1990er-Jahren gerade mit ihrem Aufbaustudium fertig war, überschlugen sich Biologen gerade im Entschlüsseln von DNA. Doudna interessierte sich mehr für die RNA, die weniger bekannte Verwandte der DNA. RNA ist das Molekül, das in der Zelle die eigentliche Arbeit tut, indem es einige der Anweisungen, die von der DNA kodiert werden, kopiert und damit Proteine aufbaut. Ihr Interesse an der RNA führte Doudna zur Frage aller Fragen – der nach dem Ursprung des Lebens. Sie untersuchte RNA-Moleküle, die sich selbst replizieren können. Es lässt sich vermuten, dass es diese Eigenschaft schon vor vier Milliarden Jahren gab, also bevor DNA existierte.
Bei ihrer Forschungsarbeit in den Chemie-Laboren von Berkely konzentrierte sie sich vor allem auf die Strukturen dieser Moleküle. Diese Detektivarbeiten brachten aufschlussreiche Indizien ans Licht, etwa wie die Windungen und Knicke in einem Molekül dessen Interaktionen mit anderen Molekülen bestimmen. So auch in der Struktur der RNA. Dies reflektierte die Studien zur DNA, die Rosalind Franklin durchgeführt hatte und die James Watson und Francis Crick 1953 bei der Entdeckung der Doppelhelixstruktur der DNA herangezogen hatten. Watson, ein Mensch mit einer komplexen Persönlichkeit, hatte für Doudna immer wieder große Bedeutung.
Ihre Studienergebnisse über die RNA waren der Grund dafür, dass sich ein Biologe aus Berkeley, der sich mit dem CRISPR-System befasste, das Bakterien in ihrem Abwehrkampf gegen Viren entwickelt hatten, an sie wandte. Wie viele grundlegende wissenschaftliche Entdeckungen sollten auch diese sich als praktikabel erweisen. Einige dieser Anwendungsmöglichkeiten waren recht unspektakulär – wie zum Beispiel der Schutz von Bakterien in Joghurtkulturen. Doch 2012 entdeckten Doudna und andere Wissenschaftler, dass man CRISPR zu einem viel größeren Zweck von weltbewegender Dimension verwenden konnte: um Gene zu editieren.
CRISPR wird heute gegen Sichelzellenanämie, verschiedene Arten von Krebs und gegen Blindheit eingesetzt. Und 2020 begannen Doudna und ihr Team, zu erforschen, wie man mit CRISPR das Coronavirus entdecken und vernichten kann. »CRISPR entwickelt sich in Bakterien, während sie gegen Viren kämpfen«, sagt Doudna. »Wir Menschen können nicht warten, bis unsere eigenen Zellen eine natürliche Resistenz gegen diese Viren ausbilden, wir müssen uns daher etwas einfallen lassen, damit dies geschieht. Fügt es sich nicht wunderbar, dass eines der verfügbaren Werkzeuge dieses uralte bakterielle Immunsystem namens CRISPR ist? Die Natur ist etwas Wunderbares.« Ja! Nicht vergessen: Die Natur ist etwas Wunderbares. Auch das ist ein Thema dieses Buchs.
Es gibt noch andere Protagonisten auf dem Gebiet des Geneditierens. Die meisten von ihnen hätten es verdient, dass man ihnen eine eigene Biografie widmet oder sogar einen Film über sie dreht (etwa eine Mischung aus A Beautiful Mind und Jurassic Park). Sie spielen wichtige Rollen in diesem Buch, weil ich zeigen will, dass wissenschaftliche Forschung ein Mannschaftssport ist. Ich will aber auch die Wirkungsmacht verdeutlichen, die von einem ausdauernden, wissbegierigen, hartnäckigen, ruhelosen und ehrgeizigen kompetitiven Akteur ausgehen kann. Jennifer Doudna, deren Lächeln manchmal (jedoch nicht immer) die Skepsis in ihren Augen übertüncht, wurde zu einer der Hauptakteurinnen auf dem Gebiet der Gentechnik. Sie hat den Instinkt zur Kooperation, den jeder Wissenschaftler unbedingt braucht. Aber sie ist auch eine Kämpfernatur wie die meisten großen Innovatoren. Sie hat ihre Emotionen gut im Griff und macht kein großes Tamtam um ihren Starstatus.
Die Geschichte ihres Lebens – als Forscherin, Nobelpreisträgerin und Vertreterin des Themas in der Öffentlichkeit – verbindet die Geschichte von CRISPR mit weiteren relevanten Aspekten wie etwa der immer bedeutenderen Rolle von Frauen in der Wissenschaft. Ihre Arbeit – wie auch schon die Leonardo da Vincis – beleuchtet weiters die Tatsache, dass der Schlüssel zur Innovation in der Verknüpfung von wissenschaftlicher Neugier mit der Entwicklung zweckdienlicher Werkzeuge liegt – auch um die Entdeckungen aus dem Labor herauszuholen und sie dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden, etwa am Krankenbett.
Indem ich ihre Geschichte erzähle, möchte ich sichtbar machen, wie wissenschaftliche Forschung abläuft. Was genau geschieht in einem Labor? Inwieweit hängen Entdeckungen von individuellem Genie ab, und wie groß ist der Anteil von Teamwork? Behindert der Wettstreit um Preise und Patente die Zusammenarbeit?
Vor allem aber will ich zeigen, wie wichtig die Grundlagenforschung ist, deren einzige Triebkraft die Wissbegierde und nicht ihr eventueller Nutzen ist. Die Suche nach Erkenntnis birgt häufig die Samen, aus denen später – oft unerwartet – Innovationen entstehen. Forschungen zu Oberflächenzuständen führten nach einiger Zeit zur Entwicklung des Transistors und des Mikrochips. Und ganz ähnlich ermöglichte die Untersuchung der verblüffenden Methode von Bakterien zur Viren-Abwehr die Entwicklung eines Instrumentariums, das Menschen im Kampf gegen Viren einsetzen können – der Genschere.
Aber es geht auch um die Frage aller Fragen: der nach dem Ursprung des Lebens und der Zukunft der Menschheit. In unserem Fall beginnt sie mit einem Schulmädchen, das gerne zwischen den Lavabrocken auf Hawaii nach Sleeping grass und anderen faszinierenden Naturalien suchte. Als sie eines Tages von der Schule nach Hause kam, lag auf ihrem Bett ein Buch, eine Detektivgeschichte, deren Hauptpersonen behaupteten, das »Geheimnis des Lebens« zu kennen.
TEIL EINS
DIE URSPRÜNGEDES LEBENS
»Dann legte Gott der Herr im Osten, in Eden, einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott der Herr ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten, in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.«
Genesis 2,8-9
JENNIFER IN HILO
DON HEMMES
ELLEN, JENNIFER, SARAH, MARTIN UND DOROTHY DOUDNA
KAPITEL 1
HILO
Haole
Wäre sie anderswo in Amerika aufgewachsen, wäre Jennifer Doudna sich vielleicht wie ein ganz normales Kind vorgekommen. Doch in Hilo, einer alten Stadt auf der vulkangeprägten hawaiianischen Hauptinsel Big Island, fühlte sie sich – blond, blauäugig, groß, schlank – als »totaler Sonderling«. Sie wurde von den anderen Kindern gehänselt, besonders von den Jungs, da sie im Gegensatz zu ihnen Haare auf den Armen hatte. Sie nannten sie eine haole, ein Ausdruck, der obwohl nicht ganz so schlimm, wie er klingt, zur abwertenden Bezeichnung für Nicht-Eingeborene verwendet wird. Das hatte zur Folge, dass sich später unter dem für sie typischen freundlichen und charmanten Verhalten ein leiser Hauch von Misstrauen verbergen sollte.1
Eine Geschichte, die fester Bestandteil der Familiensaga geworden ist, berichtet von einer von Jennifers Urgroßmüttern. Sie hatte drei Brüder und zwei Schwestern. Ihre Eltern konnten es sich nicht leisten, alle sechs Kinder in die Schule zu schicken. Man beschloss, nur die drei Mädchen zur Schule gehen zu lassen. Eine wurde Lehrerin in Montana und führte ein Tagebuch, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurde und in dem von zähem Durchhalten die Rede ist, von gebrochenen Knochen, der Arbeit im elterlichen Laden und anderen Erfahrungen an der frontier, dem Grenzland. »Sie war störrisch und besaß Pioniergeist«, sagt Jennifers Schwester Sarah, die Hüterin des Tagebuchs in der gegenwärtigen Generation.
Genau wie diese Vorfahrin war auch Jennifer eine von drei Schwestern. Ihr Vater war in sie als Älteste ganz vernarrt. Wenn Martin Doudna von seinen Töchtern sprach, hieß es: »Jennifer und die Mädchen«. Sie wurde am 19. Februar 1964 in Washington, DC, geboren, wo ihr Vater Redenschreiber beim Verteidigungsministerium war. Er wollte unbedingt Dozent für amerikanische Literatur werden und zog daher mit seiner Frau Dorothy, die an einem Community College unterrichtete, nach Ann Arbor und schrieb sich an der Universität Michigan ein.
Nach seiner Promotion schickte er 50 Bewerbungen ab, erhielt aber nur ein einziges Angebot, und zwar von der Universität von Hawaii in Hilo. Er lieh sich 900 Dollar aus dem Rentenfond seiner Frau und zog 1971, als Jennifer sieben war, dorthin.
Viele kreative Menschen – einschließlich der meisten, denen ich Biografien gewidmet habe, wie Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Henry Kissinger und Steve Jobs – wuchsen mit einem Gefühl der Entfremdung von ihrer Umwelt auf. So ging es auch Jennifer Doudna als blondem jungen Mädchen inmitten der polynesischen Einwohner von Hilo. »Ich war in der Schule wirklich ganz allein und isoliert«, erinnert sie sich. In der dritten Klasse fühlte sie sich derart als Außenseiterin, dass sie Essprobleme entwickelte. »Ich hatte alle möglichen Verdauungsstörungen, die, wie ich später erkannte, mit Stress zusammenhingen. Die anderen Kinder hänselten mich täglich.« Sie zog sich in ihre Bücher zurück und legte sich eine dicke Haut zu. »Ich habe einen inneren Kern, dem sie nichts anhaben können«, sagte sie zu sich selbst.
Wie viele andere, die sich als Außenseiter fühlten, entwickelte sie eine umfassende Neugier auf das Verhältnis von Mensch und Schöpfung. »Ich wollte wissen, wer ich in der Welt war und wie ich mich auf irgendeine Weise integrieren konnte, und das hat mich geprägt«, erklärt sie später.2
Zum Glück schlug das Gefühl der Entfremdung nicht allzu tiefe Wurzeln. Die Schule wurde erträglicher, sie wurde offener und freundlicher, das Narbengewebe der frühen Kindheit begann sich zurückzubilden. Es begann nur wieder zu schmerzen, wenn irgendetwas wirklich nervte, wie etwa der Versuch eines Konkurrenten, die Regeln zum Erteilen eines Patents zu umgehen, beim Auslaufen einer Antragsfrist auf Erteilung eines Patents oder wenn ein männlicher Arbeitskollege ihr etwas vorenthielt oder sie täuschte.
Es wurde besser, als sie das dritte Schuljahr zur Hälfte hinter sich hatte. Die Familie übersiedelte aus dem Herzen Hilos in ein Haus auf einem bewaldeten Hang weiter oben an einer Flanke des Mauna-Loa-Vulkans, die aus dem Felsen herausgehauen worden zu sein schien. Sie wechselte von einer großen Schule mit 60 Kindern pro Klasse in eine kleinere mit 20 Schülern pro Klasse. Dort beschäftigten sie sich mit amerikanischer Geschichte, einem Fach, das ihr ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl vermittelte. »Das war ein Wendepunkt«, erinnert sie sich. Sie war so gut, dass ihr Mathe- und Biologielehrer ihre Eltern drängte, sie die fünfte Klasse überspringen zu lassen. Also wurde sie sofort in die sechste versetzt.
In jenem Jahr schloss sie endlich mit einem anderen Mädchen eine enge Freundschaft, die ihr Leben lang Bestand haben sollte. Lisa Hinkley (inzwischen Lisa Twigg-Smith) entstammte einer klassischen hawaiianischen Familie mit gemischtem Hintergrund: Sie hatte schottische, dänische, chinesische und polynesische Vorfahren. Lisa wusste, wie man mit Rüpeln umging. »Wenn jemand mich eine beschissene Haole nannte, dann duckte ich mich«, erinnert Doudna sich. »Aber wenn irgendein Rabauke Lisa beschimpfte, dann drehte sie sich zu ihm, guckte ihm in die Augen und vergalt es ihm auf die gleiche Weise. Gleiches mit Gleichem. Ich nahm mir vor, auch so zu sein.« Eines Tages wurden die Schüler ihrer Klasse gefragt, was sie als Erwachsene einmal werden wollten. Lisa verkündete, Fallschirmspringerin werden zu wollen. »Ich dachte: Mann, ist das cool. Ich konnte mir nicht vorstellen, auch so eine Antwort zu geben. Sie war sehr beherzt, auf eine Art, in der ich es nicht war, und ich nahm mir fest vor, auch so forsch zu werden.«
Doudna und Hinkley verbrachten die Nachmittage mit Fahrradfahren und Streifzügen durch die Zuckerrohrplantagen. Die Vegetation war üppig und vielfältig: Moose und Pilze, Pfirsichbäume und Arrengapalmen. Sie entdeckten Wiesen, die mit von Farnen überwucherten Lavabrocken übersät waren. In den Höhlen im Lavagestein lebte eine augenlose Spinnenart. Doudna fragte sich, warum sie keine Augen hatte. Ebenso faszinierend fand sie eine borstige Ranken bildende Pflanze, die man Hilahila oder Sleeping grass nannte, weil ihre farnähnlichen doppeltgefiederten Blätter bei Berührung zusammenklappen. »Ich fragte mich«, erzählt Doudna, »was ist der Auslöser, dass die Blätter sich zusammenfalten, wenn man sie anfasst?«3
Wir alle sehen jeden Tag solche Wunder der Natur, ob es sich um eine Pflanze handelt, die sich bewegt, oder um einen Sonnenuntergang, der seine rosa Finger in einen tiefblauen Himmel streckt. Wahre Wissbegierde äußert sich darin, dass man innehält und über die Ursachen nachdenkt. Was macht einen Himmel blau oder einen Sonnenuntergang rosa? Was ist die Ursache dafür, dass die Blätter von Sleeping grass sich schließen?
Doudna fand bald jemanden, der ihr Antworten auf solche Fragen geben konnte. Ihre Eltern waren mit einem Biologieprofessor namens Don Hemmes befreundet. Man unternahm gemeinsame Streifzüge durch die Natur. »Wir machten Ausflüge nach Waipio Valley und an andere Orte auf Big Island, um Pilze zu suchen, denen mein wissenschaftliches Interesse galt«, erinnert Hemmes sich. Nachdem er die Pilze fotografiert hatte, holte er immer seine Bestimmungsbücher hervor, um Doudna zu zeigen, worum es sich handelte. Er sammelte auch winzig kleine Muscheln am Strand und machte sich dann zusammen mit ihr daran, diese zu kategorisieren und letztlich daraufzukommen, wie sie sich entwickelt hatten.
Ihr Vater kaufte ihr ein Pferd, einen Fuchswallach, der nach dem auf Hawaii wachsenden Baum mit duftenden Früchten Mokihana benannt war. Sie war im Fußballverein und spielte im Mittelfeld; diese Position war schwer zu besetzen, weil man dafür jemanden mit langen Beinen brauchte, der schnell laufen konnte und Durchhaltevermögen besaß. »Das ist eine gute Analogie für die Art und Weise, wie ich bei meiner Arbeit vorgegangen bin«, sagt sie. »Ich habe immer nach Gelegenheiten gesucht, eine Nische zu füllen, mich dort zu etablieren, wo es nicht zu viele Leute gibt, die die gleichen Fähigkeiten haben wie ich.«
Mathematik war ihr Lieblingsfach. Beweise zu erbringen, erinnerte sie an Detektivarbeit. Sie hatte auch eine fröhliche und passionierte Biologielehrerin, Marlene Hapai, die auf großartige Weise zu vermitteln verstand, was für eine Freude es bereitet, etwas zu entdecken. »Sie brachte uns bei, dass wissenschaftliche Arbeit in dem Prozess bestand, etwas herauszufinden.«
Obwohl sie gut in der Schule war, hatte sie nicht das Gefühl, dass man an ihrer kleinen Schule große Hoffnungen in sie setzte. »Die Lehrer vermittelten mir nicht den Eindruck, viel von mir zu erwarten.« Das löste eine interessante Immunantwort in ihr aus: Der Mangel an Herausforderungen bewirkte, dass sie sich freier fühlte, um mehr zu riskieren. »Ich kam zu dem Schluss, dass man es nur versuchen muss«, sagt sie, »denn was zum Teufel macht es schon, wenn man scheitert. Ich wurde risikofreudiger in meiner Projektauswahl als Wissenschaftlerin.«
Ihr Vater war derjenige, der sie anspornte. Er empfand seine älteste Tochter als Geistesverwandte innerhalb der Familie, als Intellektuelle, die dazu bestimmt war, an die Uni zu gehen und eine akademische Karriere einzuschlagen. »Ich hatte immer das Gefühl, der Sohn zu sein, den er sich gewünscht hatte«, sagt sie. »Ich wurde ein wenig anders behandelt als meine Schwestern.«
James Watsons Die Doppelhelix
Doudnas Vater war ein begieriger Leser, der jeden Samstag einen Stapel Bücher aus der örtlichen Buchhandlung holte und sie bis zum darauffolgenden Wochenende las. Seine Lieblingsautoren waren Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau, doch als Jennifer größer wurde, fiel ihm immer mehr auf, dass die Bücher, die er seinen Schülern zu lesen gab, größtenteils von Männern verfasst worden waren. Also ergänzte er die Leseliste um Doris Lessing, Anne Tyler und Joan Didion.
Oft brachte er für sie ein Buch nach Hause, entweder aus der Bücherei oder aus dem örtlichen Antiquariat. Und so landete eines Tages, als sie in der sechsten Klasse war, eine gebrauchte Taschenbuchausgabe von James Watsons Die Doppelhelix auf ihrem Bett.
Sie legte das Buch vorerst zur Seite, weil sie es für einen Krimi hielt. Als sie sich schließlich an einem verregneten Sonntagnachmittag ans Lesen machte, stellte sie fest, dass sie in gewisser Weise mit ihrer Vermutung richtig gelegen hatte. Sie sog das Buch in sich auf und ließ sich von der dramatischen Schilderung fesseln. Die spannende Geschichte, persönlich erzählt, voller lebendig gezeichneter Figuren, denen es darum ging, mit Ehrgeiz und auch Rivalität nach den inneren Wahrheiten der Natur zu fahnden. »Als ich mit dem Buch fertig war, diskutierte mein Vater mit mir darüber«, erinnert sie sich. »Er mochte die Geschichte und vor allem das ganz Persönliche daran – das Menschliche in Verbindung mit der Forschung.«
In seinem Buch stellte Watson in (manchmal auch übertrieben) dramatischer Weise dar, wie es dazu gekommen war, dass ein vierundzwanzigjähriger aufgeblasener Biologiestudent aus dem Mittleren Westen der USA an der Universität im englischen Cambridge landete, sich mit dem Biochemiker Francis Crick zusammentat und gemeinsam mit ihm 1953 das Rennen um die Aufdeckung der Struktur der DNA gewann. Im lebhaften Erzählstil eines Amerikaners verfasst, der die typisch englische Kunst gemeistert hatte, in zwanglosen Plaudereien nach dem Essen gleichzeitig selbstironisch und angeberisch zu sein, schmuggelte dieses Buch eine gehörige Portion wissenschaftlicher Informationen in eine geschwätzige Erzählung über die Marotten berühmter Professoren. Zudem werden Vergnügungen wie Flirten, Tennisspielen, Experimentieren im Labor und der gemeinsame afternoon tea geschildert.
Die interessanteste Figur des Buchs – neben der des glücklichen Naiven, in die Watson sich selbst kleidete – war die von Rosalind Franklin, einer Strukturbiologin und Kristallografin. Watson verwendete die betreffenden Angaben ohne ihre Einwilligung. Indem er den sorglosen, unbekümmerten Sexismus der 1950er-Jahre zu erkennen gab, bezog sich Watson auf sie immer herablassend auf »Rosy« – ein Name, den sie selbst nie benutzte – und machte sich lustig über ihr gestrenges Auftreten und ihr kühles Naturell. Er zollte ihr aber auch großzügig Respekt für die meisterliche Art, in der sie die komplexe wissenschaftliche Methode der Röntgenstrahlbeugung einzusetzen wusste, um die Struktur von Molekülen aufzudecken.
»Ich glaube, ich merkte, dass sie ein bisschen herablassend dargestellt wurde, doch was den größten Eindruck bei mir hinterließ, war die Tatsache, dass eine Frau eine große Wissenschaftlerin sein konnte«, meint Doudna. »Das mag ein bisschen seltsam klingen. Ich nehme an, dass ich schon von Marie Curie gehört hatte. Doch bei der Lektüre dieses Buchs dachte ich zum ersten Mal darüber nach, und es öffnete mir die Augen: Frauen konnten Wissenschaftlerinnen sein.«4
Watsons Buch verhalf Doudna auch zu einer Erkenntnis über die Natur, die gleichzeitig logisch und Ehrfurcht gebietend war: Es gab biologische Mechanismen, die alles Leben regierten, auch jene wundersamen Phänomene, die auf ihren Streifzügen durch den Regenwald ihre Aufmerksamkeit erregt hatten. »Auf Hawaii ging ich immer gerne mit meinem Dad auf die Jagd nach interessanten Dingen in der Natur wie dem Sleeping grass, das sich zusammenfaltet, wenn man es berührt«, entsinnt sie sich. »Das Buch machte mir klar, dass man auch nach Gründen dafür suchen konnte, warum die Natur so funktionierte, wie sie funktionierte.«
Doudnas Feststellungen und Watsons Kernaussage aus Die Doppelhelix haben einiges gemeinsam: dass die Gestalt und die Struktur eines chemischen Moleküls festlegen, was für eine biologische Rolle es spielen kann. Das ist eine erstaunliche Entdeckung für alle, die die grundlegenden Geheimnisse des Lebens ergründen wollen. Sie erklärt, wie die Chemie – die Lehre davon, wie Atome sich verbinden, um Moleküle zu erschaffen – zu Biologie wird.
Im weiteren Sinne sollte sich auch herausstellen, dass sie recht gehabt hatte, als sie damals Watsons auf ihrem Bett liegendes Buch für eine der Mystery-Storys gehalten hatte, die ihr so gut gefielen: »Ich habe solche Geschichten immer geliebt«, gesteht sie viele Jahre später. »Vielleicht fasziniert mich deshalb die Wissenschaft so und ist das der Grund dafür, das älteste aller Mysterien lösen zu wollen: das vom Ursprung und der Funktion der natürlichen Welt und unserem Platz darin.«5
Obwohl man an ihrer Schule Mädchen nicht gerade dazu ermutigte, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, wollte sie genau das. Von leidenschaftlichem Verlangen getrieben, das Funktionieren der Natur zu begreifen, und von einem Kampfgeist beseelt, der sie in dem Streben beflügelte, Entdeckungen in Erfindungen umzusetzen, sollte sie zum größten Fortschritt seit der Entdeckung der Doppelhelix beitragen.
CHARLES DARWIN
GREGOR MENDEL
KAPITEL 2
DAS GEN
Darwin
Die Grundlagen für die Wege, auf denen Watson und Crick zur Entdeckung der Struktur der DNA gelangen sollten, wurden ein Jahrhundert früher gelegt. Nämlich in den 1850er-Jahren, als der englische Naturforscher Charles Darwin sein Werk Vom Ursprung der Arten veröffentlichte und Gregor Mendel, ein als Seelsorger unterbeschäftigter Priester in Brünn, begann, im Garten seiner Abtei Erbsen zu züchten. Die Schnäbel von Darwins Finken und die Merkmale von Mendels Erbsen ließen die Vorstellung vom Gen entstehen, einer Entität im Inneren von lebenden Organismen, die Träger der Erbinformationen ist.1
Darwin hatte ursprünglich vorgehabt, die gleiche Laufbahn wie sein Vater und sein Großvater einzuschlagen, die sich beide als Ärzte einen Namen gemacht hatten. Er musste aber feststellen, dass der Anblick von Blut und die Schreie eines für eine Operation festgeschnallten Kindes ihn zu sehr entsetzten. Er hing daher das Medizinstudium an den Nagel, um anglikanischer Pastor zu werden, obwohl er für diesen Beruf ebenso ungeeignet war. Seine wahre Leidenschaft galt, seitdem er als Achtjähriger begonnen hatte, alles Mögliche aus der Natur zu sammeln, der Naturkunde. Seine große Chance kam, als sich ihm 1831, im Alter von zweiundzwanzig Jahren, die Gelegenheit bot, als gentleman collector eine von Privatleuten finanzierte Reise um die Welt an Bord der Brigg HMS Beagle mitzumachen.2
1835, im vierten Jahr der fünf Jahre dauernden Reise, erkundete die Beagle rund ein Dutzend winziger Inseln, die zur vor der südamerikanischen Pazifikküste gelegenen Gruppe der Galapagosinseln gehören. Dort sammelte Darwin die Bälge von Vögeln, von denen er – seinen Aufzeichnungen zufolge – dachte, dass es sich um Finken, Stärlinge, Kernbeißer, Spottdrosseln und Meisen handelte. Doch musste er sich nach seiner Rückkehr nach England vom Ornithologen John Gould sagen lassen, dass die mitgebrachten Vögel in Wirklichkeit verschiedenen Spezies von Finken angehörten. Darwin begann die Theorie auszuarbeiten, dass sie sich alle aus einem gemeinsamen Ahnen entwickelt hatten.
Ihm war seit seiner Kindheit bekannt, dass in der Region um seinen Heimatort im ländlichen England Pferde und Kühe gelegentlich mit leichten Variationen geboren wurden und Viehzüchter die vielversprechendsten auswählten, um im Lauf der Zeit Herden von Tieren mit den wünschenswertesten Eigenschaften zu züchten. Vielleicht tat die Natur das Gleiche. Er nannte dieses Phänomen »natürliche Selektion«. In gewissen isolierten Regionen wie auf den Galapagosinseln, mutmaßte er, würden in jeder Generation ein paar Mutationen in Erscheinung treten (er verwendete den neckischen Ausdruck »Sports«). Eine Veränderung der äußeren Bedingungen könnte bewirken, dass diese mutierten Individuen den Kampf um knappe Nahrung gewinnen und sich so eher fortpflanzen würden. Angenommen eine Finkenart besäße einen Schnabel, der sich zum Fressen von Früchten eignete, die fruchtragenden Bäume würden aber aufgrund einer Dürre eingehen. Ein paar Individuen mit Schnäbeln, die sich besser zum Aufbrechen von Nüssen eigneten, würden sich dann durchsetzen. »Das Ergebnis wäre die Entstehung einer neuen Spezies.«
Darwin zögerte, seine Theorie zu veröffentlichen, weil sie derart ketzerisch war, doch wie es in der Wissenschaft oft geschieht, trieb das Auftreten eines Konkurrenten ihn dann doch dazu an. 1858 sandte ihm Alfred Russel Wallace, ein jüngerer Naturforscher, den Entwurf eines Aufsatzes, in dem er eine ähnliche Theorie wie die Darwins unterbreitete. Darwin beeilte sich, seinen eigenen Aufsatz für die Publikation fertig zu machen, und die beiden Forscher kamen überein, ihre jeweilige Arbeit bei der bevorstehenden Versammlung einer renommierten wissenschaftlichen Vereinigung vorzustellen – und zwar am selben Tag.
Darwin und Wallace trugen beide einen entscheidenden Charakterzug, der als Katalysator für Kreativität wirkt: Sie waren vielseitig interessiert und in der Lage, Verbindungen zwischen verschiedenen Wissensgebieten herzustellen. Beide unternahmen Reisen in exotische Regionen, wo sie die Variationen von Spezies in Augenschein nehmen konnten, und beide hatten An Essay on the Principle of Population von Thomas Malthus, einem englischen Wirtschaftswissenschaftler, gelesen. Malthus prognostizierte, dass die Weltbevölkerung rascher wachsen würde als die Menge der zur Verfügung stehenden Nahrung. Die sich ergebende Überbevölkerung würde zu Hungerkatastrophen führen, der die Schwächeren und Ärmeren zum Opfer fallen würden. Sowohl Darwin als auch Wallace begriffen, dass sich dies auf alle Spezies übertragen ließe, und das führte sie zu ihrer Theorie von einer durch das Überleben der am besten angepassten Individuen in Gang gesetzten und weitergetriebenen Evolution. In seiner Autobiografie schrieb Darwin: »[Ich] las zufällig zum Vergnügen Malthus‘ Buch über Population, und weil ich durch meine lange Beobachtung der Verhaltensweisen von Tieren und Pflanzen wohl darauf vorbereitet war anzuerkennen, dass ein Kampf ums Dasein überall stattfindet, wurde mir sofort deutlich, dass unter solchen Bedingungen vorteilhafte Variationen eher erhalten blieben und unvorteilhafte eher vernichtet werden.« Wie der Science-Fiction-Autor und Biochemieprofessor Isaac Asimov später mit Bezug auf die Geburt der Evolutionstheorie konstatierte: »Was dafür nötig war, war jemand, der sich mit Arten auskannte, Malthus las und in der Lage war, eine Querverbindung herzustellen.«3
Die Erkenntnis, dass Arten sich durch Mutation und natürliche Selektion entwickeln, warf große Fragen auf, die nach Antworten verlangten: Wie sah der Mechanismus aus? Wie konnte es zu einer günstigen Variation hinsichtlich der Schnabelform eines Finken oder des Halses einer Giraffe kommen? Und wie konnte diese dann an zukünftige Generationen weitergegeben werden? Darwin dachte, dass ein Organismus kleine Partikel enthielte, die die Erbinformationen trügen, und mutmaßte, dass die Informationen eines männlichen Organismus im Embryo mit denen eines weiblichen verschmelzen würden. Er erkannte aber – wie auch andere –, dass in diesem Fall jeder neue vorteilhafte Charakterzug über Generationen hinweg verblassen und schwächer werden würde, anstatt intakt weitergegeben zu werden.
Darwin besaß in seiner Privatbibliothek ein Exemplar einer obskuren wissenschaftlichen Zeitschrift mit einem 1866 verfassten Artikel, in dem er die Antwort gefunden hätte. Doch er kam nie dazu, ihn zu lesen, und das traf auch auf fast jeden anderen Wissenschaftler seiner Zeit zu.
Mendel
Der Autor des erwähnten Artikels war Gregor Mendel, ein kleiner, molliger Mönch, der 1822 geborene Sohn deutschsprachiger Bauern im damals zum Habsburgerreich gehörenden Mähren. Er leistete mehr, indem er im Garten seine Abtei in Brünn herumwerkelte als in seiner Funktion als Gemeindepriester, denn er sprach nur wenig Tschechisch und war auch zu schüchtern, um einen guten Seelenhirten abzugeben. Er beschloss daher, sich als Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften zu betätigen. Unglücklicherweise fiel er mehrmals durch das Zulassungsexamen, auch nachdem er an der Universität Wien studiert hatte. Seine Leistungen in einer Biologieprüfung waren besonders miserabel.4
Da er nach seinem letzten vergeblichen Anlauf, das Examen zu bestehen, nur wenig anderes zu tun hatte, zog Mendel sich in den Abteigarten zurück, um sich einer Tätigkeit zu widmen, der sein geradezu obsessives Interesse galt: dem Anbau von Erbsen. In den vorherigen Jahren hatte er sich auf das Kultivieren sortenreiner Erbsenpflanzen konzentriert. Seine Erbsenpflanzen wiesen sieben Merkmale auf, die in zwei Variationen vorkamen: gelbe oder grüne Samen, weiße oder violette Blüten, glatte oder schrumpelige Hülsen usw. Durch sorgfältige Auswahl entstanden Pflanzen, die entweder nur violette Blüten oder nur schrumpelige Hülsen besaßen.
Im Jahr darauf experimentierte er aber mit etwas anderem: Er kreuzte Pflanzen mit unterschiedlichen Merkmalen, also zum Beispiel weiß blühende mit violett blühenden. Es war eine mühsame Aufgabe, die es erforderte, die Staubblätter jeder Blüte mit einer kleinen Zange abzuknipsen und Pollen mit einem winzigen Pinsel zu übertragen.
Seine Experimente lieferten eine bedeutende Erkenntnis, vor allem vor dem Hintergrund der Behauptungen Darwins: Es kam zu keiner Vermischung von Merkmalen. Hohe mit niedrig wachsenden Pflanzen gekreuzt, brachten keine Nachkommen von mittelhohem Wuchs hervor. Und Pflanzen mit violetten Blüten, die man mit weiß blühenden kreuzte, brachten keine mit Blüten von blasser Malvenfarbe hervor. Stattdessen waren alle Nachkommen, die Ergebnis der Paarung einer hohen mit einer niedrigen Pflanze waren, hochwüchsig. Pflanzen, die auf eine Kreuzung von violett blühenden Pflanzen mit weiß blühenden zurückgingen, bildeten nur violette Blüten. Mendel bezeichnete die Merkmale, die sich durchsetzten, als »dominant«, die anderen nannte er »rezessiv«.
Eine noch bedeutendere Entdeckung machte er im Sommer darauf, als seine Hybriden Nachwuchs bekamen. Während die erste Hybridengeneration nur die dominanten Merkmale aufgewiesen hatte (wie ausschließlich violette Blüten oder lange Stängel), traten bei der zweiten auch die rezessiven Merkmale in Erscheinung. Mendels Aufzeichnungen zeigten ein Muster: Drei von vier Pflanzen wiesen die dominanten Merkmale auf und nur eine die rezessiven. Wenn eine Pflanze zwei dominante Versionen des Gens erbte oder eine dominante und eine rezessive Version, zeigte sie das dominante Merkmal. Doch wenn sie zwei rezessive Versionen des Gens erbte, dann zeigte sie das weniger häufige Merkmal.
Öffentliche Aufmerksamkeit kann die Wissenschaft beflügeln. Der stille Mönch Mendel scheint aber wie unter einer Tarnkappe gelebt zu haben. Im Februar und im März 1865 trug er jeweils einen Teil seiner Abhandlung vor den vierzig Bauern und Pflanzenzüchtern des Brünner Naturforschenden Vereins vor, der den Text später in seiner Jahresschrift veröffentlichte. Die Abhandlung wurde bis 1900 nur selten zitiert, bis Wissenschaftler, die ähnliche Versuche durchführten, sie wiederentdeckten.5
Die Ergebnisse von Mendel und den seine Arbeit aufnehmenden und fortsetzenden Naturforschern ließen das Konzept einer die Erbanlage determinierenden Einheit entstehen, die der dänische Botaniker Wilhelm Johannsen 1905 »Gen« nannte. Es gab anscheinend ein Molekül, das Erbinformationen kodierte. Über viele Jahre hinweg untersuchten Wissenschaftler mit größter Sorgfalt lebende Zellen in dem Versuch, herauszufinden, was für ein Molekül das sein könnte.
KAPITEL 3
DNA
Die Wissenschaftler nahmen anfänglich an, dass Proteine die Träger von Genen seien. Schließlich verrichteten Proteine die Mehrzahl der wichtigsten Aufgaben in Organismen. Im Lauf der Zeit kamen sie aber dahinter, dass es eine andere in lebenden Zellen vorkommende Substanz gibt: Nukleinsäuren, die als Arbeitspferde für die Weitergabe von Erbgut dienen. Diese Moleküle setzen sich aus Zucker, Phosphaten und vier, »Basen« genannten, Substanzen zusammen, die zu Ketten aneinandergereiht sind. Sie kommen in zwei Varietäten vor: als »Ribonukleinsäure« (RNA) und als ein ähnliches Molekül, dem ein Sauerstoffatom fehlt und das daher »Desoxyribonukleinsäure« (DNA) genannt wird. Aus evolutionärer Perspektive sind sowohl das einfachste Coronavirus als auch der komplexeste menschliche Organismus im Kern nichts anderes als von Protein umhüllte Päckchen, die das von ihren Nukleinsäuren kodierte, genetische Material enthalten, das sie zu replizieren versuchen.
Die grundlegende Entdeckung, die auf DNA als Träger genetischer Informationen hindeutete, wurde 1944 von dem Biochemiker Oswald Avery und seinen Kollegen von der Rockefeller University in New York gemacht. Sie extrahierten DNA aus einem Bakterienstamm, transferierten sie auf einen anderen Stamm und zeigten, dass die DNA vererbbare Transformationen weitergab.
WATSON UND CRICK MIT IHREM DNA-MODELL, 1953
Der nächste Schritt hin zur Entschlüsselung des Geheimnisses des Lebens bestand darin, herauszufinden, wie die DNA das tat. Einen Anhaltspunkt hätte man, gelänge es, die exakte Struktur von DNA zu bestimmen, also zu erkennen, wie alle Atome sich zusammenfügten, und was für eine Gestalt das ergab. Dann ließe sich vielleicht ihre Funktionsweise erklären. Dies war ein Unterfangen, das das Zusammenwirken von drei wissenschaftlichen Disziplinen erforderte, die sich im Lauf des 20. Jahrhunderts ausgebildet hatten: der Genetik, der Biochemie und der Strukturbiologie.
James Watson
Der einer Chicagoer Mittelschichtsfamilie entstammende James Watson war ein außerordentlich schlauer und gewitzter Junge, der die Public School mühelos durchlief. Das machte ihn zu einem intellektuellen Provokateur, was ihm als Wissenschaftler zum Vorteil gereichte, ihn in der Öffentlichkeit aber nicht unbedingt beliebt machte. Sein Leben lang würde sein Schnellfeuer-Gemurmel unvollständiger Sätze seine Ungeduld und seine Unfähigkeit, das, was ihm aller durch den Kopf schoss, zu filtern, verraten. Er sagte später, eine der wichtigsten Mahnungen, die seine Eltern ihm mit auf den Weg gegeben hätten, war: »Zu heucheln, um gesellschaftlich anerkannt zu werden, zersetzt die Selbstachtung.« Das nahm er sich zu sehr zu Herzen. Von Kindesbeinen an bis in sein neuntes Lebensjahrzehnt hinein war er brutal offen, wenn er recht hatte und auch, wenn er nicht recht hatte. Das machte ihn gelegentlich zum Außenseiter, was aber seiner Selbstachtung keinen Abbruch tat.1
Als Jugendlicher galt seine ganz Leidenschaft dem Beobachten von Vögeln, und als er bei der Radioshow Quiz Kids drei Kriegsanleihen gewann, investierte er das Geld in ein Fernglas der Marke Bausch und Lomb. Er stand immer vor Sonnenaufgang auf und ging mit seinem Vater zum Jackson Park, wo die beiden dann zwei Stunden damit verbrachten, nach seltenen Waldsängern Ausschau zu halten. Danach fuhr er zur Laborschule der University of Illinois, einer wahren Brutstätte junger Genies.
Zunächst plante er, an der University of Chicago, an der er sich mit fünfzehn immatrikulierte, seiner Leidenschaft für Vögel zu frönen und gleichzeitig seiner Abneigung gegenüber der Chemie nachzugeben, indem er Ornithologie studierte. Doch in seinem letzten Schuljahr las er eine Rezension des Buchs What Is Life?, in dem der Quantenphysiker Erwin Schrödinger sich der Biologie zuwandte und die These aufstellte, dass die Entdeckung der Molekularstruktur eines Gens zeigen würde, wie dieses Erbinformationen über Generationen hinweg weitergab. Watson holte sich Schrödingers Buch am nächsten Tag aus der Bücherei und war fortan an davon besessen, die Funktionsweise von Genen zu verstehen.
Da seine Noten bescheiden waren, wurde seine Bewerbung um ein Doktoratsstudium am Caltech, dem California Institute of Technology, abgelehnt, und auch Harvard bewilligte ihm kein Stipendium.2 Daher schrieb er sich an der Indiana University ein, an der man, auch indem man jüdische Wissenschaftler rekrutierte, die Probleme hatten, an der Ostküste eine sogenannte »Tenure«, eine Anstellung auf Lebenszeit zu erlangen, eine der besten Genetikabteilungen des Landes eingerichtet hatte, zu dessen Stars die späteren Nobelpreisträger Hermann Müller und der gebürtige Italiener Salvador Luria gehörten.
Mit Luria als Doktorvater widmete Watson sich dem Studium von Viren. Diese winzigen Päckchen genetischen Materials sind einzeln betrachtet im Wesentlichen leblos. Doch wenn sie in eine lebende Zelle eindringen, dann entfalten sie ihren inneren Mechanismus und vermehren sich. Die Viren, sie sich am einfachsten studieren lassen, sind solche, die Bakterien angreifen. Man nennt sie »Phagen« (prägen Sie sich den Begriff ein, denn wir werden ihm wiederbegegnen, wenn wir auf die Entdeckung von CRISPR zu sprechen kommen). »Phagen« ist das Kurzwort für Bakteriophagen, was so viel wie »Bakterienfresser« bedeutet.
Watson gesellte sich zum Kreis internationaler Biologen um Luria, der als »die Phagengruppe« bekannt war. »Luria verabscheute die meisten Chemiker geradezu, und zwar namentlich die rivalisierende Abart aus den Dschungeln von New York City«, erzählte Watson. Doch Luria erkannte bald, dass man Phagen ohne Chemie nicht verstehen kann. Er verhalf Watson daher nach dem Doktorexamen zu einem Stipendium an der Universität Kopenhagen, damit er sich mit dem Fach beschäftigen konnte.
Gelangweilt und unfähig, das Englisch des vor sich hin nuschelnden Chemikers zu verstehen, der seine Studien überwachte, unterbrach Watson im Frühjahr 1951 seine Zeit in Kopenhagen, um eine Tagung in Neapel zu besuchen, bei der es um Moleküle in lebenden Zellen ging. Die meisten der Vorträge waren zu hoch für ihn, doch einer, der des Biochemikers Maurice Wilkins vom Londoner King’s College, begeisterte ihn.
Wilkins‘ Spezialgebiet waren die Kristallografie und die Untersuchung von Kristallen durch Röntgenstrahlbeugung. Oder anders gesagt: Er nahm eine mit Molekülen gesättigte Flüssigkeit, ließ sie abkühlen und purifizierte die sich bildenden Kristalle. Wenn man einen Lichtstrahl aus unterschiedlichen Winkeln auf ein Objekt fallen lässt, kann man aus den Schatten, die es wirft, auf seine Struktur schließen. Ähnlich gehen die Röntgenkristallografen vor: Sie lassen aus vielen unterschiedlichen Winkeln einen Röntgenstrahl auf einen Kristall fallen und halten die Schatten und die Diffraktionsmuster fest. Am Ende seines Vortrags in Neapel projizierte Wilkins eine »Röntgenbeugungsaufnahme der DNA auf eine Leinwand.
»Plötzlich fand ich Chemie ungeheuer aufregend«, schreibt Watson in Die Doppelhelix. »Vor Maurices Vortrag hatte ich mir Sorgen gemacht, die Gene seien womöglich unglaublich unregelmäßig. Doch jetzt wusste ich, dass sie kristallisieren konnten, also mussten sie eine regelmäßige Struktur besitzen, die man direkt ermitteln konnte.«
In den nächsten paar Tagen heftete sich Watson an Wilkins‘ Fersen, in der Hoffnung, eine Einladung in dessen Laboratorium zu ergattern. Doch er wurde enttäuscht.
Francis Crick
Stattdessen bot sich Watson im Herbst 1951 die Gelegenheit, im Cavendish Laboratory der Universität Cambridge mitzuarbeiten, das damals von Sir Lawrence Bragg, einem Wegbereiter der Kristallografie, geleitet wurde. Bragg war dreißig Jahre zuvor der jüngste Nobelpreisträger in einem naturwissenschaftlichen Gebiet geworden, was er bis heute geblieben ist.3 Er und sein Vater, mit dem er sich die Auszeichnung teilte, hatten das der Beugung von Röntgenstrahlen an Kristallen zugrundeliegende mathematische Gesetz ermittelt.
Im Cavendish Lab lernte Watson Francis Crick kennen. Die beiden Wissenschaftler sollten einen Bund eingehen, der zu den fruchtbarsten der gesamten Wissenschaftsgeschichte gehörte. Crick, ein theoretischer Biochemiker, hatte im Zweiten Weltkrieg gedient, und schon das reife Alter von 32 erreicht, ohne den Doktortitel zu erlangen. Dennoch war er sich seines instinktiven Auffassungs- und Urteilsvermögens sicher genug, und scherte sich so wenig um die in Cambridger akademischen Kreisen üblichen Umgangsformen, dass er nicht davor zurückscheute, unpräzises Denken seiner Kollegen zu korrigieren und sich dann auch noch damit zu brüsten, dass er dies getan hatte. Watson eröffnete das erste Kapitel von Die Doppelhelix mit dem denkwürdigen Satz: »Ich habe Francis Crick nie bescheiden gesehen.« Das hätte man aber auch über Watson selbst sagen können, doch die beiden bewunderten sich gegenseitig mehr für ihre Unbescheidenheit, als ihre Kollegen es taten. Crick entsann sich: »Uns beiden war jugendliche Arroganz, Skrupellosigkeit und Ungeduld gegenüber nachlässigem Denken eigen.«
Crick teilte Watsons Überzeugung, dass man durch die Darstellung der Struktur von DNA den Schlüssel in die Hand bekommen würde, mit dem sich die Geheimnisse der Heredität lösen ließen. Bald saßen sie gemeinsam im Eagle, einem angenehm schäbigen Pub in der Nähe des Laboratoriums, aßen Shepherd‘s Pie und ließen dabei ihrer Redseligkeit freien Lauf. Crick hatte eine schallende Art zu lachen und eine dröhnende Stimme, was Sir Lawrence Bragg beides auf die Nerven ging. Daher bekamen Crick und Watson einen Raum mit rohen Ziegelwänden zugewiesen.
»Sie waren komplementäre Stränge, durch Nonchalance, Verrücktheit und Brillanz miteinander verflochten«, befand der Autor und Arzt Siddhartha Mukherjee. »Sie verachteten Autoritäten und sehnten sich dennoch nach Bestätigung. Sie empfanden das wissenschaftliche Establishment als lächerlich und geistig schwerfällig, verstanden es aber dennoch, sich ebenda einzuschmeicheln. Sie sahen sich als klassische Außenseiter, fühlten sich aber in den innersten Innenhöfen der Cambridger Colleges an wohlsten. Sie waren selbsternannte Hofnarren am Hof von Trotteln.«4
Der Biochemiker Linus Pauling vom Caltech hatte die wissenschaftliche Welt gerade aufgerüttelt und für sich selbst den Weg zu seinem ersten Nobelpreis geebnet, indem er die Struktur von Proteinen ermittelt hatte. Er hatte die Röntgenstrahlkristallografie und seine Kenntnisse der Quantenmechanik chemischer Verbindungen herangezogen und anhand mit Kinderbauklötzen gefertigter Molekülmodelle dargestellt. Bei ihren Mahlzeiten im Eagle schmiedeten Watson und Crick Pläne, wie sie Pauling im Wettlauf um die Aufdeckung der DNA-Struktur mit gleichen Mitteln schlagen könnten. Sie ließen sogar die Werkstatt des Cavendish Lab Bleche und Kupferdraht zurechtschneiden, um sich mit ihnen die Modelle der Atome und der anderen Bestandteile zu basteln, mit denen sie herumspielen konnten, bis sie alle Elemente und Bindungen korrekt bestimmt hatten.
Ein Hindernis tat sich auf, weil sie mit dieser Arbeit auf das Territorium von Maurice Wilkins, dem Biochemiker des King´s College, betraten. Dessen Röntgenfoto eines DNA-Kristalls hatte Watsons Interesse erregt. Der englische Begriff von Fairplay hinderte Francis Crick daran, ein Territorium zu betreten, das Maurice Wilkins quasi gepachtet hatte. In Frankreich, wo diese Art Fairplay offenbar nicht existiert, hätte sich ein solches Problem gar nicht erst gestellt. Dasselbe gilt für die USA.
Wilkins schien seinerseits keine Eile zu haben, Pauling zu schlagen. Er war in einen peinlichen internen Konflikt verwickelt, der von Watson in seinem Buch sowohl dramatisiert, als auch trivialisiert wird. Es handelt sich um den Kampf zwischen ihm und einer brillanten jungen Kollegin, die 1951 am Londoner King’s College zu arbeiten begonnen hatte: Rosalind Franklin, eine 31-jährige englische Biochemikerin, die im Lauf ihres Studiums in Paris mit Röntgenstrahldiffraktionstechniken vertraut geworden war.
Sie war ans King’s College mit der Aussicht auf die Leitung eines Teams zur DNA-Forschung gelockt worden. Der vier Jahre ältere Wilkins war aber der Ansicht, dass man sie als Junior, die ihm bei der Röntgenstrahldiffraktion assistieren sollte, eingestellt hätte. Das barg Zündstoff. Nach nur wenigen Monaten sprachen die beiden kaum noch miteinander. Eine bestimmte räumliche Besonderheit im College half, sie auf Distanz zu halten: Es gab zwei Gemeinschaftsräume für das Lehrpersonal, einen für die männlichen Mitglieder, den anderen für die weiblichen. Letzterer war unerträglich düster und muffig, ersterer genau der richtige Ort für elegante Dinner.
Franklin war eine nüchterne Wissenschaftlerin, ganz auf ihre Forschungen konzentriert und stets »vernünftig« gekleidet. Infolgedessen nahm sie am Faible englischer Akademiker für exzentrisches Gebaren Anstoß und vor allem auch an deren Neigung, Kolleginnen nach ihrer weiblichen Ausstrahlung zu beurteilen. Diese Haltung zeigt sich auch in Watsons Schilderungen von ihr: »Trotz ihrer scharfen Züge war sie nicht unattraktiv und sie wäre sogar hinreißend gewesen, hätte sie auch nur das geringste Interesse für Kleidung gezeigt. Das tat sie nicht. Sie nahm nicht einmal einen Lippenstift, dessen Farbe vielleicht mit ihrem glatten schwarzen Haar kontrastiert hätte, und mit ihren einunddreißig Jahren trug sie so phantasielose Kleider wie jeder x-beliebige blaustrümpfige englische Teenager.«
Franklin weigerte sich, Wilkins oder sonst jemanden ihre Röntgenstrahldiffraktionsaufnahmen verwenden zu lassen, sie setzte aber für November 1951 einen Vortrag an, in dem sie zusammenfassend über ihre neuesten Entdeckungen berichten wollte. Wilkins lud Watson ein, zu diesem Anlass mit dem Zug von Cambridge herzukommen. Watson erinnert sich: »Sie sprach vor einem Auditorium von ungefähr fünfzehn Personen in hastig-nervösem Stil, der gut zu dem schmucklosen alten Hörsaal, in dem wir saßen, passte. In ihren Worten war keine Spur von Wärme oder Humor. Und doch fand ich Rosy irgendwie interessant. Einen Augenblick überlegte ich, wie sie wohl aussehen würde, wenn sie ihre Brille abnähme und irgendetwas an ihrer Frisur änderte. Dann jedoch fesselte mich hauptsächlich ihre Beschreibung des kristallinen Röntgenbeugungsmusters.«
Crick ließ sich am nächsten Morgen von Watson Bericht erstatten. Da dieser sich zum Ärger Cricks keine Notizen gemacht hatte, konnte er zu vielen entscheidenden Punkten nur vage Auskunft geben, vor allem zum Wassergehalt, den Franklin in ihren DNA-Proben entdeckt hatte. Dennoch fing Crick sofort an, Diagramme hinzukritzeln. Er meinte, Franklins Daten deuteten auf zwei, drei oder vier spiralförmig zusammengewundene Stränge hin, und wenn sie mit unterschiedlichen Modellen spielten, würden sie bald auf die genaue Struktur kommen. Innerhalb einer Woche glaubten sie auch, das richtige Modell gefunden zu haben, auch wenn bei diesem einige Atome vielleicht ein wenig zu dicht zusammengequetscht waren: drei Stränge, die sich um eine Mittelachse wanden, und vier von diesem Rückgrat aus nach außen ragende Basen.
In einem Anfall von Hybris luden sie Wilkins und Franklin ein, nach Cambridge zu kommen, um ihr Modell in Augenschein zu nehmen. Die beiden trafen am nächsten Morgen ein und ohne viel herumzureden, präsentierte Crick das dreisträngige Helixmodell. Franklin sah sofort, dass einiges nicht stimmte: »Es ist falsch aus den folgenden Gründen«, sagte sie und legte diese dann dar. Sie zerfetzte die Argumentation Cricks wie eine gereizte Schullehrerin.
Sie beharrte darauf, dass ihre DNA-Aufnahmen nicht zeigten, dass das Molekül spiralförmig strukturiert war. Wie sich später erwies, irrte sie hier. Doch mit ihren anderen Einwänden lag sie richtig: Die verdrehten Rückgrate mussten auf der Außenseite liegen, nicht im Zentrum, und das ihr vorgeführte Modell hatte einen zu geringen Wassergehalt. »Bei dieser Gelegenheit kam die äußerst peinliche Tatsache heraus, dass mich meine Erinnerung an Rosys Angaben über den Wassergehalt ihrer DNA-Moleküle getäuscht haben musste«, gab Watson später ganz trocken zu. Wilkins, der sich vorübergehend hinter Franklin stellte, meinte, wenn sie sofort loszögen, könnten sie noch den Zug um drei Uhr vierzig zurück nach London erwischen, und sie machten sich auf den Weg zum Bahnhof.
Das Ganze war nicht nur beschämend für Watson und Crick, die beiden wurden auch noch bestraft. Sir Lawrence ließ mitteilen, dass sie ihre Arbeiten an der DNA zu beenden hätten. Ihre Bauelemente für die Modelle wurden zusammengepackt und nach London zu Wilkins und Franklin geschickt.
Zu seiner weiteren Bestürzung erreichte Watson die Nachricht, dass Linus Pauling vom Caltech für Vorträge nach England kommen würde. Dadurch würden wahrscheinlich Paulings eigene Bestrebungen, die Struktur von DNA zu ermitteln, neuen Auftrieb erhalten. Das amerikanische Außenministerium kam Watson unabsichtlich zu Hilfe: In der seltsam hysterischen Atmosphäre, die von der Kommunistenjagd der Ära McCarthy erzeugt wurde, wurde Pauling am New Yorker Flughafen aufgehalten. Man konfiszierte seinen Pass, weil er seiner pazifistischen Haltung offen Ausdruck verliehen hatte. Das FBI war daher überzeugt, dass er eine Bedrohung für das Land wäre, würde man ihm erlauben zu reisen. So erhielt er nie die Möglichkeit, mit englischen Wissenschaftlern über die in ihrem Heimatland angestellten Forschungen zur Kristallografie zu diskutieren. Das trug mit dazu bei, dass die USA das Rennen um die Entschlüsselung der DNA verloren.
Watson und Crick konnten mithilfe von Paulings Sohn Peter den Fortschritt seiner Arbeit bis zu einem gewissen Grad im Auge behalten. Der junge Pauling war Mitarbeiter des Cambridger Labors. Watson fand ihn freundlich und unterhaltsam: »Peters Gesellschaft bot die Gelegenheit, jedes Mal, wenn es mit der Wissenschaft nicht weiterging, ausgiebig die verschiedenen Vorzüge englischer, europäischer und kalifornischer Mädchen miteinander zu vergleichen«. Doch eines Tages kam der junge Mann ins Labor geflattert, legte die Füße auf einen Schreibtisch und verkündete die seit langem gefürchete Nachricht. Er hielt einen Brief seines Vaters in der Hand, in dem stand, dass er eine Struktur der DNA gefunden habe und seine Entdeckung in Kürze publizieren werde.
Linus Paulings Artikel erreichte Anfang Februar Cambridge. Peter kam ins Labor geschlendert, um Watson und Crick zu informieren, dass die Lösung seines Vaters jener ähnelte, die die beiden vorgeschlagen hatten: eine dreisträngige Helix mit dem Rückgrat in der Mitte. Watson zog den Artikel aus Peters Manteltasche und fing zu lesen an. »Auf Anhieb hatte ich das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich konnte nur nicht sagen was, bis ich mir die Illustrationen mehrere Minuten lang ansah.«
Watson erkannte, dass in Paulings Modell die Bindungen einiger Atome nicht fest genug sein würden. Als er mit Crick und anderen im Labor darüber diskutierte, gelangten sie bald zu der Überzeugung, dass Pauling ein kapitaler »Schnitzer« unterlaufen war. Die Aufregung stieg. Sie ließen die Arbeit liegen und sausten ins Eagle. »Gleich nachdem es offen war, tranken wir schon auf Paulings Misserfolg. Statt mir einen Sherry zu genehmigen, ließ ich mich von Francis zu einem Whisky einladen.«
»Das Geheimnis des Lebens«
Ihnen war klar, dass sie keine Zeit mehr vergeuden und nicht mehr hinter Wilkins und Franklin zurückstehen durften. Also fuhr Watson eines Nachmittags mit dem Zug nach London, um mit den beiden zu reden. Er nahm Paulings Aufsatz mit. Wilkins war nicht da, als er eintraf, und so platzte er bei Franklin hinein, die sich über einen Lichtkasten beugte, um die neuesten ihrer immer schärfer werdenden Röntgenaufnahmen von DNA zu vermessen. Das trug ihm einen verärgerten Blick ein, doch er sprudelte sofort mit einer Zusammenfassung von Paulings Aufsatz los.
Ein paar Augenblicke lang stritten sie darüber, ob es wirklich wahrscheinlich wäre, dass DNA eine spiralförmige Struktur besäße, woran sie immer noch Zweifel hatte. »Ich unterbrach ihren Redeschwall und machte geltend, eine Helix sei die einfachste Form für ein polymeres Molekül«, erinnert Watson sich. Rosy konnte »sich kaum noch beherrschen. Mit schriller Stimme schrie sie, ich würde die Stupidität meiner Bemerkungen selbst einsehen müssen, wenn ich aufhörte, diesen Unsinn zu reden, und mir stattdessen ihre röntgenologischen Beweise ansähe.«
Das Gespräch eskalierte. Watson wies sie zu Recht, aber in unhöflichem Ton darauf hin, dass sie als gute Experimentatorin noch mehr Erfolg haben könnte, wenn sie mit Theoretikern zusammenarbeitete. »Plötzlich kam Rosy hinter dem Labortisch, der uns trennte, hervor und ging auf mich los. Da ich Angst hatte, sie könnte mich in ihrer Wut schlagen, griff ich mir Paulings Aufsatz und zog mich hastig in Richtung offene Tür zurück.«
Gerade als der Wortwechsel seinen Höhepunkt erreichte, kam Wilkins hinzu und zog Watson rasch aus dem Zimmer, damit er einen Tee mit ihm trank und sich beruhigte. Er vertraute ihm an, dass Franklin Aufnahmen von DNA-Molekülen gemacht hatte, die von einer großen Menge Wasser umgeben waren, was neue Belege für ihre Struktur ergab. Er ging ins Nebenzimmer und holte den Abzug einer Aufnahme, die als »Photograph 51« bekannt wurde. Wilkins war auf völlig legitime Weise an das Foto gekommen: Er war der Doktorvater des Studenten, der Franklin bei der Aufnahme assistiert hatte. Weniger korrekt war es, die Aufnahme Watson zu zeigen, der sich einige der wesentlichen Parameter aufschrieb, um sie in Cambridge Crick vorzulegen. Das Foto zeigte, dass Franklin Recht gehabt hatte, als sie behauptet hatte, die das Rückgrat bildenden Ketten müssten sich wie bei einer Wendeltreppe auf der Außenseite der Struktur befinden und nicht im Inneren des Moleküls. Sie hatte sich aber geirrt, als sie die Möglichkeit ausgeschlossen hatte, dass DNA die Gestalt einer Spirale habe. Watson erkannte sofort, dass »das schwarze Kreuz von Reflexen, das sich in dem Bild deutlich abhob, nur von einer Helixstruktur herrühren« konnte. Die Durchsicht von Franklins Aufzeichnungen zeigt, dass sie sogar nach Watsons Besuch noch weit davon entfernt war, die DNA-Struktur zu erkennen.5
Im ungeheizten Zug zurück nach Cambridge skizzierte Watson auf dem Rand seines Exemplars der Times