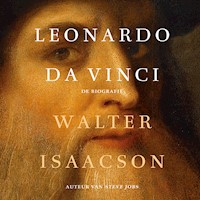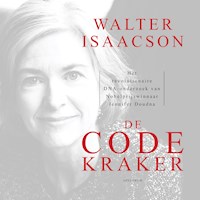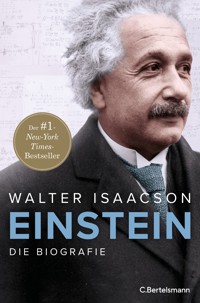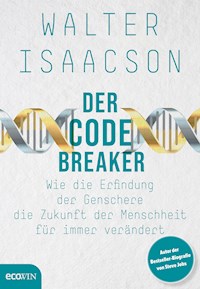24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Atemberaubende Errungenschaften. Verstörende Abgründe. Eine unglaubliche Geschichte
Walter Isaacsons packender Insider-Bericht über Elon Musk, den Außenseiter, der zum reichsten Mann der Welt wurde: Ist er ein Genie oder schlicht wahnsinnig?
Heute gilt Elon Musk als Visionär, der sich über alle Regeln hinwegsetzt und der unsere Welt ins Zeitalter der Elektromobilität, der privaten Weltraumfahrt und der künstlichen Intelligenz geführt hat. Dabei waren seine Anfänge weitaus bescheidener. Als Kind auf den Spielplätzen Südafrikas regelmäßig von jugendlichen Schlägern verprügelt, musste Musk sich auch zuhause gegen seinen gewalttätigen Vater behaupten und lernte so schon früh, sich allein auf sich selbst zu verlassen. Eine Lehre, die ihn im Verlauf seines Lebens zu einem der waghalsigsten Unternehmer unserer Zeit machte, ausgestattet mit extrem hoher Risikotoleranz und einer geradezu manischen Intensität.
Doch konnten alle Erfolge nicht über die Schatten seiner Kindheit hinwegtäuschen: Anfang 2022 – nach einem Jahr, in dem SpaceX einunddreißig Satellitenstarts durchgeführt und Tesla eine Million Autos verkauft hatte und er der reichste Mann der Welt geworden war – machte Musk sich an einen Deal, der zu einer der aufsehenerregendsten Übernahmen unserer Zeit führen sollte: Twitter. In seinen dunkelsten Stunden sollte Musk sich noch über Jahre daran erinnern, wie er auf dem Spielplatz und zuhause von seinem Vater gepeinigt wurde. Jetzt aber bot sich ihm die Gelegenheit, den ultimativen Spielplatz der Welt zu besitzen.
Zwei Jahre lang konnte der Autor Walter Isaacson Elon Musk aus unmittelbarer Nähe beobachten, nahm an seinen Meetings teil, ging mit ihm durch seine Fabriken und verbrachte Stunden damit, ihn selbst, seine Familie, Freunde, Kollegen und Gegner zu interviewen. Das Ergebnis ist ein aufschlussreicher Insider-Bericht, randvoll mit erstaunlichen Geschichten von Triumphen und Turbulenzen, der fragt: Sind die Dämonen, die Musk antreiben, am Ende das, was es braucht, um Innovation und Fortschritt voranzutreiben?
Durchgehend bebildert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1051
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Walter Isaacson
Elon Musk
Die Biografie
Aus dem amerikanischen Englisch von Sylvia Bieker, Gisela Fichtl, Katharina Martl, Ulrike Strerath-Bolz,
Inhalt
Prolog
Muse aus Feuer
Kapitel 1
Abenteurer
Kapitel 2
Eigensinn
Kapitel 3
Leben mit Vater
Kapitel 4
Der Suchende
Kapitel 5
Fluchtgeschwindigkeit
Kapitel 6
Kanada
Kapitel 7
Queen’s
Kapitel 8
Penn
Kapitel 9
Westwärts
Kapitel 10
Zip2
Kapitel 11
Justine
Kapitel 12
X.com
Kapitel 13
Der Coup
Kapitel 14
Mars
Kapitel 15
Rocket Man
Kapitel 16
Väter und Söhne
Kapitel 17
Den Motor hochjagen
Kapitel 18
Musks Regeln für den Raketenbau
Kapitel 19
Herr Musk geht nach Washington
Kapitel 20
Die Gründer
Kapitel 21
Der Roadster
Kapitel 22
Kwaj
Kapitel 23
Zwei auf einen Streich
Kapitel 24
Das SWAT-Team
Kapitel 25
Am Steuer
Kapitel 26
Die Scheidung
Kapitel 27
Talulah
Kapitel 28
Dritter Streich
Kapitel 29
Am Abgrund
Kapitel 30
Der vierte Start
Kapitel
31Rettet Tesla!
Kapitel 32
Model S
Kapitel 33
Privat ins All
Kapitel 34
Start der Falcon 9
Kapitel 35
Hochzeit mit Talulah
Kapitel 36
Produktion
Kapitel 37
Musk und Bezos
Kapitel 38
Der Falke hört den Falkner
Kapitel 39
Die Achterbahnfahrt mit Talulah
Kapitel 40
Künstliche Intelligenz
Kapitel 41
Die Einführung des Autopiloten
Kapitel 42
Solar
Kapitel 43
The Boring Company
Kapitel 44
Schwierige Beziehungen
Kapitel 45
Abstieg ins Dunkle
Kapitel 46
Die Fabrikhölle von Fremont
Kapitel 47
Open-Loop-Warnung
Kapitel 48
Fallout
Kapitel 49
Grimes
Kapitel 50
Shanghai
Kapitel 51
Der Cybertruck
Kapitel 52
Starlink
Kapitel 53
Starship
Kapitel 54
Autonomy Day
Kapitel 55
Giga Texas
Kapitel 56
Familienleben
Kapitel 57
Vollgas
Kapitel 58
Bezos gegen Musk, Runde 2
Kapitel 59
Starship-Fieber
Kapitel 60
Solar-Fieber
Kapitel 61
Nights Out
Kapitel 62
Inspiration4
Kapitel 63
Raptor-Reorganisation
Kapitel 64
Die Geburt des Optimus
Kapitel 65
Neuralink
Kapitel 66
Ein rein visuelles System
Kapitel 67
Geld
Kapitel 68
Vater des Jahres
Kapitel 69
Politik
Kapitel 70
Ukraine
Kapitel 71
Bill Gates
Kapitel 72
Aktiver Investor
Kapitel 73
»I made an offer«
Kapitel 74
Heiß und kalt
Kapitel 75
Vatertag
Kapitel 76
Aufruhr in der Starbase
Kapitel 77
Optimus 1.0
Kapitel 78
Ungewissheit
Kapitel 79
Optimus wird präsentiert
Kapitel 80
Robotaxi
Kapitel
81»Lass das mal sacken«
Kapitel 82
Die Übernahme
Kapitel 83
Die drei Musketiere
Kapitel 84
Content-Moderation
Kapitel 85
Halloween
Kapitel 86
Blaue Häkchen
Kapitel 87
All-in
Kapitel 88
Hardcore
Kapitel 89
Wunder
Kapitel 90
Die Twitter Files
Kapitel 91
Kaninchenlöcher
Kapitel 92
Weihnacht-und-Nebel-Aktion
Kapitel 93
KI für Autos
Kapitel 94
Menschenfreundliche KI
Kapitel 95
Starship-Start
Dank
Quellen und Bibliografie
Anmerkungen
Register
Die Originalausgabe erschien 2023
unter dem Titel »Elon Musk«
bei Simon & Schuster, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Walter Isaacson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
C.Bertelsmann in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion/Lektorat: Heike Gronemeier, München
Bildbearbeitung: Lorenz & Zeller, Inning a. Ammersee
Covergestaltung: Favoritbuero, München
Coverabbildung Vorderseite: © Art Streiber / AUGUST
Coverabbildung Rückseite: Mit freundlicher Genehmigung von @SpaceX
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-29390-1V003
www.cbertelsmann.de
Allen, die ich irgendwie beleidigt habe, möchte ich schlicht sagen: Ich habe Elektrofahrzeuge neu erfunden und werde Leute mit einem Raumschiff auf den Mars schicken. Habt ihr gedacht, ich könnte noch dazu ein gechillter, normaler Typ sein?
– Elon Musk, Saturday Night Live, 8. Mai 2021
Die Leute, die so verrückt sind zu glauben, dass sie die Welt verändern können, sind diejenigen, die es tun.
– Steve Jobs
© Mit freundlicher Genehmigung von SpaceX
© Mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc.
PrologMuse aus Feuer
© Mit freundlicher Genehmigung von Maye Musk
Der Spielplatz
Als Kind, das in Südafrika aufwuchs, kannte Elon Musk Schmerz, und er lernte, ihn auszuhalten.
Im Alter von zwölf Jahren brachte ein Bus ihn in ein Überlebenscamp in der Wildnis, das Veldskool genannt wurde. »Das war eine paramilitärische Version von Herr der Fliegen«, erinnert er sich. Die Kinder bekamen jeweils kleine Rationen Essen und Wasser. Man erlaubte ihnen – ja, ermutigte sie sogar dazu –, um diese zu kämpfen. »Mobbing galt als eine Tugend«, sagt Elons jüngerer Bruder Kimbal. Rasch lernten die größeren Kinder, den kleinen ins Gesicht zu schlagen und ihnen ihre Vorräte wegzunehmen. Der schmächtige, schüchterne Elon wurde zweimal verprügelt und nahm in der Zeit im Camp fast fünf Kilo ab.
Gegen Ende der ersten Woche wurden die Jungen in zwei Gruppen aufgeteilt, die einander angreifen sollten. »Das war so verrückt. Unfassbar«, erinnert sich Musk. Alle paar Jahre kam bei diesem Programm ein Kind ums Leben. Die Betreuer erzählten solche Storys zur Abschreckung. »›Seid nicht so bescheuert wie dieser Idiot, der letztes Jahr draufgegangen ist‹, sagten sie. ›Seid keine schwächlichen Idioten.‹«
Kurz vor seinem 16. Geburtstag kam Elon zum zweiten Mal in die Veldskool. Er war jetzt viel größer, gute eins achtzig, mit einer Statur wie ein Bär, und er hatte ein bisschen Judo gelernt. Mit diesen Voraussetzungen sei die Veldskool gar nicht so schlecht gewesen: »Inzwischen war mir klar, sollte mich jemand schikanieren, dann konnte ich dem ordentlich in die Fresse hauen. Und der würde mich dann nicht mehr schikanieren. Sie konnten mich immer noch brutal verprügeln, aber wenn ich denen dann ordentlich was auf die Fresse gegeben hatte, ließen sie mich in Ruhe.«
Südafrika galt in den 1980er-Jahren als ein Ort der Gewalt. Angriffe mit Maschinenpistolen und tödliche Messerattacken waren an der Tagesordnung. Als Elon und Kimbal einmal auf dem Weg zu einem Anti-Apartheid-Konzert aus dem Zug stiegen, mussten sie durch eine Blutlache neben einem Toten laufen, dem das Messer noch im Leib steckte. Für den Rest des Abends verursachte das Blut an den Sohlen ihrer Turnschuhe bei jedem Schritt ein schmatzendes Geräusch auf dem Asphalt.
Die Familie Musk hielt Deutsche Schäferhunde, die darauf trainiert waren, jeden anzufallen, der am Haus vorbeirannte. Mit sechs raste Elon die Einfahrt hinunter und wurde von seinem Lieblingshund attackiert, der ihm eine schlimme Bisswunde am Rücken zufügte. Als man die Wunde in der Notaufnahme nähen wollte, verweigerte Elon die Behandlung, bis er das Versprechen bekam, dass der Hund nicht bestraft würde. »Ihr werdet ihn nicht töten, oder?«, fragte er. Sie versprachen es ihm. Während er die Geschichte erzählt, schweigt Musk lange und starrt ins Leere. »Dann haben sie ihn natürlich doch erschossen.«
Das einschneidendste Erlebnis hatte er an der Schule. Lange Zeit war er der jüngste und kleinste Schüler der Klasse. Er hatte Probleme damit, soziale Signale zu erkennen. Empathie war ihm nicht von Natur aus gegeben, und ihm fehlte sowohl das Bedürfnis als auch das Einfühlungsvermögen, um sich beliebt zu machen. Daher wurde er in der Schule und auf dem Spielplatz oft schikaniert. Jungs, die andere mobbten, schlugen ihm ins Gesicht. »Wenn man nie was auf die Nase bekommen hat, kann man sich nicht vorstellen, wie einen das für den Rest des Lebens prägt«, sagt er.
Bei der allmorgendlichen Schulversammlung rempelte ihn ein Mitschüler an, der gerade mit seiner Clique herumalberte. Elon schubste ihn zurück. Schimpfwörter fielen. In der Pause suchte der Junge mit seinen Freunden nach Elon. Er aß gerade sein Sandwich, als sie ihn von hinten attackierten und ihn mehrere Betonstufen hinunterstießen. »Sie hockten sich auf ihn, schlugen wie verrückt auf ihn ein und traten gegen seinen Kopf«, erinnert sich Kimbal, der neben ihm auf den Stufen gesessen hatte. »Als sie fertig waren, konnte ich sein Gesicht nicht mehr erkennen. Es sah aus wie eine geschwollene Kugel aus rohem Fleisch, in der die Augen kaum noch zu sehen waren.« Man brachte ihn ins Krankenhaus, eine Woche lang konnte er nicht zur Schule gehen. Noch Jahrzehnte später musste Elon sich immer wieder Operationen unterziehen, bei denen versucht wurde, das Gewebe im Inneren seiner Nase in Ordnung zu bringen.
Doch diese Narben waren gering im Vergleich zu den emotionalen, die sein Vater ihm zufügte. Errol Musk, ein Ingenieur und so skrupelloser wie charismatischer Fantast, peinigt Elon bis heute. Nachdem sein Sohn in der Schule derart zusammengeschlagen worden war, stellte Errol sich auf die Seite des Jungen, der ihm das Gesicht so verunstaltet hatte. »Er hatte gerade seinen Vater durch Selbstmord verloren, und Elon hatte ihn Dummkopf genannt«, erklärt Errol. »Elon neigt dazu, Leute als Dummkopf zu bezeichnen. Wie hätte ich da dem anderen Kind seine Reaktion verübeln sollen?«
Als Elon endlich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, beschimpfte sein Vater ihn. »Ich musste eine Stunde lang dastehen, während er mich anschrie, mich einen Schwachkopf nannte und mir erklärte, ich wäre einfach nichts wert«, erinnert sich Elon. Kimbal, der bei der Schimpftirade zusehen musste, sagt, es sei die schlimmste Erinnerung seines Lebens gewesen. »Mein Vater rastete einfach aus, drehte total durch, wie so oft. Er hatte null Mitgefühl.«
Beide, Elon und Kimbal, reden inzwischen nicht mehr mit ihrem Vater. Sie sagen, seine Behauptung, Elon habe den Angriff provoziert, sei erfunden; der Täter sei deswegen sogar in ein Jugendgefängnis gekommen. Sie sagen, ihr Vater sei ein sprunghafter Schwindler, der sich regelmäßig Geschichten ausdenke, die er mit Fantasie ausschmücke, manchmal aus Kalkül, manchmal im Wahn. Sie attestieren ihm einen Dr.-Jekyll-und-Mr-Hyde-Charakter. In einem Moment sei er freundlich gewesen, im nächsten konnte er einen für eine Stunde oder länger gnadenlos misshandeln. Jede Schimpftirade pflegte er damit zu beenden, Elon zu erklären, wie erbärmlich er sei. Elon musste still dastehen und das Ganze über sich ergehen lassen. »Das war seelische Folter.« Elon schweigt lange, bevor er hörbar schluckt. »Er wusste definitiv, wie man Angst und Schrecken verbreitet.«
Als ich Errol anrufe, redet er knapp drei Stunden mit mir und meldet sich in den nächsten zwei Jahren regelmäßig in Form von Telefonaten und Textnachrichten. Er ist darauf erpicht, mir zu schildern – und Fotos davon zu schicken –, wie schön er es seinen Kindern gemacht habe, zumindest in den Zeiten, als seine Ingenieurfirma gut lief. Irgendwann fuhr er einen Rolls-Royce, baute mit seinen Söhnen eine Lodge in der Wildnis und bezog über einen Minenbesitzer Rohsmaragde aus Sambia, bis dieses Geschäft den Bach hinunterging.
Aber Errol gibt zu, dass er auf körperliche und emotionale Härte gesetzt habe. »Im Vergleich zu ihren Erfahrungen bei mir dürfte die Veldskool ziemlich harmlos gewesen sein«, sagt er und ergänzt, Gewalt sei schlichtweg Teil des Schulalltags in Südafrika gewesen. »Zwei hielten dich fest, während ein anderer dir mit einem Holzscheit ins Gesicht schlug und so weiter. Neue Mitschüler wurden am ersten Schultag gezwungen, sich mit dem größten Raufbold der Schule zu messen.« Stolz gesteht Errol, dass er im Umgang mit seinen Jungs »eine extrem strenge Autokratie« gepflegt habe. Und er legt Wert drauf, hinzuzufügen, dass »Elon später die gleiche strenge Autokratie sich selbst und anderen auferlegt hat«.
»Widrigkeiten haben mich geprägt«
»Jemand hat einmal gesagt, jeder Mann versucht, im Leben den Erwartungen seines Vaters gerecht zu werden oder die Fehler des eigenen Vaters wiedergutzumachen«, schrieb Barack Obama in seinen Memoiren, »und ich glaube, das erklärt mein spezielles Dilemma.« In Elon Musks Fall sollte die Wirkung des Vaters auf seine Seele anhalten. Und zwar trotz vieler Versuche, ihn sowohl physisch als auch psychisch aus seinem Leben zu verbannen. Elons Stimmungen waren ein Hin und Her zwischen fröhlich und düster, intensiv und albern, distanziert und emotional, mit gelegentlichem Abtauchen in einen Zustand, den seine Umgebung als »Dämon-Modus« fürchtete. Im Gegensatz zu seinem Vater geht Elon mit seinen Kindern aber fürsorglich um. In anderer Hinsicht deutet sein Verhalten jedoch auf eine Gefahr hin, die ständig bekämpft werden muss: die Schreckensvision, er könnte, in den Worten seiner Mutter, »wie sein Vater werden«. Nicht umsonst ist das ja eines der gewichtigsten Themen in der Mythologie. Oder denken Sie an Star Wars: In welchem Maß verlangt die epische Suche des Helden, dass er die Dämonen austreibt, die Darth Vader ihm hinterlassen hat, und dass er mit der dunklen Seite der Macht ringt?
»Ich glaube, nach so einer Kindheit in Südafrika musst du dich in gewisser Weise emotional abschotten«, meint Elons erste Frau Justine, die Mutter von fünf seiner noch lebenden zehn Kinder. »Wenn dein Vater dich ständig Schwachkopf und Idiot nennt, dann ist vielleicht die einzig mögliche Reaktion, alles in deinem Inneren abzuschalten, das eine emotionale Dimension eröffnet hätte, mit der du nicht hättest umgehen können.« Dieses emotionale Absperrventil machte ihn kaltschnäuzig, aber eben auch zu einem risikofreudigen Innovator. »Elon lernte, seine Angst zu unterdrücken«, sagt sie. »Wenn du die Angst abstellst, dann musst du andere Sachen wie Freude oder Mitgefühl vielleicht ebenfalls abstellen.«
Die posttraumatische Belastungsstörung durch seine Kindheitserfahrungen impfte ihm auch eine gewisse Abneigung gegen Zufriedenheit ein. »Ich glaube, dass er einfach nicht weiß, wie man Erfolg und Blumenduft genießt«, analysiert Claire Boucher, die sich als Künstlerin Grimes nennt und drei Kinder mit ihm hat. »In der Kindheit wurde er wohl darauf konditioniert, dass das Leben Schmerz bedeutet.« Musk stimmt dem zu. »Widrigkeiten haben mich geprägt«, meint er. »Meine Schmerzschwelle wurde sehr hoch.«
Während einer besonders höllischen Phase seines Lebens im Jahr 2008, nachdem die ersten drei SpaceX-Raketen beim Start explodiert waren und Tesla kurz vor der Insolvenz stand, wachte er eines Morgens um sich schlagend auf und erzählte Talulah Riley, die seine zweite Frau werden sollte, von den schrecklichen Dingen, die sein Vater zu ihm gesagt hatte. »Das hatte eine tiefgreifende Wirkung darauf, wie er agiert«, berichtet sie. »Ich habe Elon diese Sätze selbst sagen hören.« Wenn diese Erinnerungen hochkamen, wirkte er abwesend und schien hinter seinen stahlgrauen Augen zu verschwinden. »Ich glaube, ihm war nicht bewusst, dass ihn das immer noch beeinflusste, denn er hielt es für etwas aus seiner Kindheit. Aber in dem Mann steckt immer noch das Kind, das vor seinem Dad steht«, sagt Riley.
Aus dieser Gemengelage entwickelte Musk eine Aura, die ihn manchmal wie ein Alien wirken ließ. Als sei seine Marsmission der Versuch, nach Hause zurückzukehren, und sein Wunsch, humanoide Roboter zu bauen, die Suche nach Verwandtschaft. Man wäre nicht völlig entsetzt, wenn er sich das Hemd vom Leib risse und man sehen könnte, dass er keinen Nabel hat und nicht von diesem Planeten stammt. Seine Kindheit machte ihn jedoch auch besonders menschlich: zu einem toughen, aber doch verletzlichen Jungen, der beschlossen hat, sich auf eine epische Suche zu begeben.
Er entwickelte einen Eifer, der seine Albernheit kaschierte, und eine Albernheit, die seinen Eifer kaschierte. Wie nicht ganz zu Hause in seinem eigenen Körper oder wie ein dicker Mann, der nie sportlich gewesen ist, bewegt er sich mit Schritten, die an einen forschen Bären erinnern, mit tänzelnden Hüpfern dazwischen. Mit der Überzeugung eines Propheten spricht er von der Notwendigkeit, die Flamme des menschlichen Bewusstseins zu hüten, das Universum zu ergründen und unseren Planeten zu retten. Zuerst hielt ich das für bloßes Rollenspiel, für Peptalks, um sein Team anzuspornen, und für Podcast-Fantasien eines Kind gebliebenen Mannes, der einmal zu oft Per Anhalter durch die Galaxis gelesen hatte. Doch je öfter ich damit konfrontiert wurde, desto stärker wurde meine Überzeugung, dass sein Sendungsbewusstsein, der Glaube an seine Mission, Teil seines Antriebs war. Während andere Unternehmer schon damit rangen, ein Weltbild zu entwickeln, legte er sich ein Bild des Kosmos zurecht.
Seine Veranlagung und seine Erziehung machten ihn, zusammen mit einer besonderen Art zu denken, bisweilen gefühllos und impulsiv. All das führte aber auch zu einer extremen Risikobereitschaft. Er konnte ein Risiko kühl berechnen und zugleich fieberhaft begrüßen. »Elon sucht das Risiko um seiner selbst willen«, sagt Peter Thiel, der in den Anfängen von PayPal sein Partner wurde. »Er scheint es zu genießen, manchmal sogar regelrecht süchtig danach zu sein.«
Elon wurde zu einem Menschen der Sorte, die sich am lebendigsten fühlt, wenn ein Hurrikan aufzieht. »Ich wurde für den Sturm geboren, eine Flaute ist nichts für mich«, sagte Andrew Jackson einmal. Das Gleiche gilt für Musk. Er stand unter einem enormen Druck, einer Art innerem Belagerungszustand, der seine Vorliebe, manchmal geradezu seine Gier nach Sturm und Drama befeuerte, sowohl in der Arbeit als auch in Liebesbeziehungen, die er oft vergeblich aufrechtzuerhalten versuchte. In Krisen, im Angesicht von Deadlines und brutaler Arbeitsüberlastung blühte er auf. Vor quälenden Herausforderungen konnte er oft nachts nicht schlafen und musste sich übergeben. Gleichzeitig verliehen ihm diese Phasen auch Energie. »Er ist jemand, der Drama magnetisch anzieht«, beschreibt es Kimbal. »Das ist sein innerer Zwang, sein Lebensthema.«
Als ich über Steve Jobs schrieb, meinte dessen Partner Steve Wozniak, die große Frage, die sich stelle, sei: »Musste er so gemein sein? So hart und grausam? So auf Drama aus?« Als ich die Frage am Ende meiner Arbeit Woz noch einmal zurückspielte, erklärte er, wenn er Apple geleitet hätte, wäre er freundlicher gewesen. Er hätte jeden wie ein Familienmitglied behandelt und Leute nicht fristlos entlassen. Dann überlegte er kurz und fügte hinzu: »Aber wenn ich Apple geleitet hätte, hätten wir vielleicht nie den Macintosh gemacht.« Und so lautet die Frage zu Musk: Könnte er gechillter sein und trotzdem noch derjenige bleiben, der uns Richtung Mars und in eine elektromobile Zukunft schießt?
Anfang 2022 – nach einem Jahr, in dem SpaceX 31 Raketen erfolgreich ins All brachte, Tesla knapp eine Million Autos verkaufte und er zum reichsten Mann der Erde avancierte – sprach Musk reumütig über seinen Zwang, Dramen auszulösen. »Ich muss meine Geistesverfassung vom Krisenmodus wegbringen«, erklärte er mir. »In dem befindet sie sich jetzt seit ungefähr 14 Jahren, wenn nicht sogar schon mein Leben lang.«
Es war eine wehmütige Feststellung, kein Neujahrsvorsatz. Doch just als er sich einen Reset vorgenommen hatte, war er längst dabei, heimlich Aktien von Twitter anzuhäufen, dem ultimativen Spielplatz. Im April jenes Jahres stahl er sich nach Lanai davon, eine Insel, die zu Hawaii gehört, um ein paar Tage im Haus seines Mentors und Oracle-Gründers Larry Ellison zu verbringen. Begleitet wurde er von der Schauspielerin Natasha Bassett, mit der er hin und wieder zusammen war. Man hatte ihm einen Sitz im Twitter-Board angeboten, aber im Verlauf des Wochenendes kam er zu dem Schluss, dass ihm das nicht genügte. Es entsprach seinem Wesen, die absolute Kontrolle ausüben zu wollen. Also entschied er sich, ein feindliches Übernahmeangebot zu machen, um das Unternehmen gleich zu kaufen. Dann flog er nach Vancouver, um Grimes zu treffen. Gemeinsam blieben sie bis 5 Uhr morgens auf, um Elden Ring zu spielen, ein neues Game um Krieg und den Aufstieg von Imperien. Kaum waren sie damit fertig, setzte Elon seinen Plan in die Tat um: »Ich habe ein Angebot gemacht«, verkündete er auf Twitter.
Wann immer er im Laufe der Jahre in düsterer Stimmung war oder sich bedroht fühlte, versetzte ihn das zurück zu den Schreckenserfahrungen, als er auf dem Spielplatz und dem Schulhof drangsaliert wurde. Jetzt bot sich ihm die Chance, den ganzen Spielplatz zu besitzen.
Kapitel 1 Abenteurer
Winnifred und Joshua Haldeman (oben links); Errol, Maye, Elon, Tosca und Kimbal Musk (unten links); Cora und Walter Musk (rechts)
© O. und u. l.: Mit freundlicher Genehmigung von Maye Musk; r.: Mit freundlicher Genehmigung von Elon Musk
Joshua und Winnifred Haldeman
Elon Musks Hang zum Risiko lag in der Familie. Er kam da nach seinem Großvater mütterlicherseits, Joshua Haldeman, einem tollkühnen Abenteurer und Sturkopf, der auf einer Farm in der kahlen Prärie Zentralkanadas aufwuchs. In Iowa erlernte er chiropraktische Methoden und kehrte anschließend in seinen Heimatort nahe Moose Jaw zurück, wo er Pferde zuritt und chiropraktische Behandlungen gegen Kost und Logis vornahm.
Schließlich konnte er sich eine eigene Farm kaufen, die er jedoch in der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre wieder verlor. In den darauffolgenden Jahren arbeitete er als Cowboy, trat bei Rodeos auf und jobbte als Hilfsarbeiter auf dem Bau. Bestand hatte nur seine Abenteuerlust. Er heiratete, ließ sich scheiden, reiste als Landstreicher auf Güterzügen und als blinder Passagier auf einem Ozeandampfer.
Der Verlust seiner Farm machte einen Populisten aus ihm. Joshua Haldeman engagierte sich in einer Partei, die Social Credit Party genannt wurde und die dafür eintrat, dass Bürger gratis Kreditnoten als gültige Zahlungsmittel bekommen sollten. Die Bewegung hatte auch einen konservativ-fundamentalistischen Zweig mit antisemitischen Tendenzen. Ihr erster Anführer in Kanada beklagte eine »Perversion kultureller Ideale«, weil »eine disproportionale Anzahl von Juden Schaltstellen besetzt«. Haldeman stieg schließlich zum nationalen Vorsitzenden der Partei auf. Außerdem schloss er sich einer Bewegung namens Technocracy an, die die Überzeugung vertrat, die Regierungsgeschäfte sollten besser von Technokraten statt von Politikern geführt werden. Zeitweise war sie in Kanada verboten, weil sie sich gegen den Eintritt des Landes in den Zweiten Weltkrieg aussprach. Haldeman trotzte dem Verbot, indem er die Bewegung mit einer Zeitungsannonce unterstützte.
Irgendwann wollte er Gesellschaftstanz lernen. Dabei machte er die Bekanntschaft von Winnifred Fletcher, deren Abenteuerlust es mit seiner aufnehmen konnte. Als 16-Jährige hatte sie einen Job bei der Times-Herald in Moose Jaw angenommen, doch sie träumte nach wie vor von einer Karriere als Tänzerin und Schauspielerin. Und so war sie mit dem Zug erst nach Chicago abgehauen, dann weiter nach New York. Zurück in Moose Jaw, eröffnete sie eine Tanzschule, in der sich Haldeman zum Unterricht anmeldete. Als er sie zum Abendessen einladen wollte, erwiderte sie: »Ich gehe nicht mit meinen Schülern aus.« Also brach er den Unterricht ab und bat sie erneut um eine Verabredung. Nur wenige Monate später fragte er: »Wann wirst du mich heiraten?« – »Morgen«, antwortete sie.
Die beiden bekamen vier Kinder, darunter die Zwillinge Maye und Kaye, die 1948 geboren wurden. Bei einem Ausflug entdeckte Haldeman eines Tages ein »Zu verkaufen«-Schild an einer einmotorigen Luscombe. Das Flugzeug stand auf der Wiese eines Farmers. Joshua, der kein Bargeld bei sich hatte, konnte den Farmer überreden, die Maschine gegen sein Auto einzutauschen. Das war ziemlich unüberlegt, da Haldeman noch gar nicht fliegen konnte. Doch er konnte jemanden auftreiben, der ihn erst nach Hause flog und ihm dann beibrachte, die Maschine zu steuern.
Bald war die Familie unter dem Spitznamen »The Flying Haldemans« bekannt. Von einer Branchenzeitschrift für Chiropraktik wurde Haldeman als »die vielleicht bemerkenswerteste Gestalt in der Geschichte fliegender Chiropraktiker« gepriesen. Eine ziemlich eingeschränkte, aber zutreffende Anerkennung. Als Maye und Kaye drei Monate alt waren, schaffte die Familie eine größere einmotorige Maschine an, eine Bellanca. Die Kleinkinder hießen im Ort fortan die »fliegenden Zwillinge«.
Aufgrund seiner kruden konservativ-populistischen Ansichten kam Haldeman zu dem Schluss, dass die kanadische Regierung zu viel Kontrolle über das Leben der Einzelnen ausübte und das Land zu verweichlicht sei. Daher entschied er 1950, nach Südafrika auszuwandern, das damals noch vom weißen Apartheidregime beherrscht wurde. Zerlegt und in Kisten verpackt ließ er die Bellanca auf einen Frachter mit Ziel Kapstadt laden. Haldeman wollte im Landesinneren leben, also brachen sie Richtung Johannesburg auf. Dort sprachen die meisten weißen Bewohner tendenziell eher Englisch als Afrikaans. Doch als sie über das nahe gelegene Pretoria flogen, wo gerade die Jacaranda-Bäume violett blühten, verkündete Haldeman: »Hier werden wir bleiben.«
Als Joshua und Winnifred noch jung gewesen waren, war eines Tages ein junger Schausteller und Scharlatan namens William Hunt (bekannt als »Der große Farini«) nach Moose Jaw gekommen. Er hatte Geschichten von einer uralten »verschwundenen Stadt« erzählt, die er gesehen habe, als er die südafrikanische Kalahari-Wüste durchquerte. »Dieser Schwindler zeigte meinem Großvater Fotos, die offensichtlich gefälscht waren, aber der ließ sich davon überzeugen und machte die Wiederentdeckung zu seiner Mission«, sagt Musk. Nun, in Südafrika, zogen die Haldemans Jahr für Jahr monatelang durch die Kalahari, um diese legendäre Stadt zu suchen. Dabei jagten sie ihr Essen selbst und schliefen mit Gewehren neben sich, um Löwen abzuwehren.
Die Familie machte sich ein Motto zu eigen: »Lebe gefährlich – aber mit Vorsicht«. Man unternahm Langstreckenflüge an Orte wie Norwegen, wurde Erster beim Autorennen über 15 000 Kilometer von Kapstadt nach Algier und absolvierte den ersten Flug mit einer einmotorigen Maschine von Afrika nach Australien. »Sie mussten die Rücksitze entfernen, um Treibstofftanks einzubauen«, erinnerte sich Maye.
Seine Risikobereitschaft wurde Joshua Haldeman schließlich zum Verhängnis. Er kam ums Leben, als einer seiner Flugschüler in eine Stromleitung steuerte; die Maschine überschlug sich und stürzte ab. Sein Enkel Elon war damals drei Jahre alt. »Er wusste, dass wahre Abenteuer mit Risiken verbunden sind«, sagt er. »Das Risiko trieb ihn an.«
Haldeman prägte mit dieser Einstellung auch eine seiner Zwillingstöchter, Elons Mutter Maye. »Ich weiß, dass ich ein Risiko eingehen kann, solange ich vorbereitet bin«, sagt sie. Als Schülerin war sie gut in Naturwissenschaften und Mathe. Noch dazu sah sie umwerfend aus. Groß und blauäugig, mit hohen Wangenknochen und wohlgeformter Kinnpartie, begann sie schon als 15-Jährige zu modeln und trat an Samstagvormittagen bei Modenschauen im örtlichen Kaufhaus auf.
Ungefähr um diese Zeit lernte sie einen Jungen aus der Nachbarschaft kennen, der ebenfalls umwerfend aussah, wenn auch eher auf die lässige, gaunerhafte Art.
Errol Musk
Errol Musk war ein Abenteurer und Geschäftemacher, immer auf der Suche nach der nächsten guten Gelegenheit. Seine Mutter Cora stammte aus England. Dort hatte sie mit 14 die Schule abgeschlossen und danach in einer Fabrik gearbeitet, die Außenverkleidungen für Jagdbomber herstellte. Mit einem Flüchtlingsschiff war sie nach Südafrika gelangt und hatte dort Walter Musk kennengelernt. Als Kryptoanalytiker und Geheimdienstoffizier arbeitete Walter in Ägypten Pläne aus, um die Wehrmacht mit dem Einsatz von Waffenattrappen und Scheinwerfern zu täuschen. Nach dem Krieg beschränkte er sich hauptsächlich darauf, schweigend in einem Sessel zu sitzen, zu trinken und mit seinen kryptologischen Fähigkeiten Kreuzworträtsel zu lösen. Also verließ Cora ihn, reiste mit ihren beiden Söhnen nach England, kaufte einen Buick und kam dann wieder nach Pretoria zurück. »Sie war die stärkste Persönlichkeit, die mir je begegnet ist«, schwärmt Errol.
Errol machte einen Abschluss als Ingenieur im Bereich Maschinenbau und wirkte anschließend am Bau von Hotels, Einkaufszentren und Fabriken mit. Nebenbei restaurierte er alte Autos und Flugzeuge. Er versuchte sich auch in der Politik und setzte sich als einer von wenigen Englisch sprechenden Abgeordneten im Stadtrat von Pretoria City gegen ein Mitglied der für die Apartheid stehenden National Party durch. Die Pretoria News vom 9. März 1972 berichtete unter der Überschrift »Reaction against the Establishment« über diese Wahl.
Wie die Haldemans liebte auch Errol das Fliegen. So kaufte er sich eine zweimotorige Cessna Golden Eagle, um Fernsehteams zu einer Lodge zu fliegen, die er im Busch errichtet hatte. Als er 1986 einmal unterwegs war, um die Maschine zu verkaufen, landete er auf einer Piste in Sambia. Dort bot ihm ein panamaisch-italienischer Unternehmer an, das Flugzeug zu kaufen. Man wurde handelseinig: Statt Bargeld erhielt Errol eine gewisse Menge Smaragde aus den drei Minen, die der Mann in Sambia besaß.
In Sambia gab es damals zwar eine postkoloniale Schwarze Regierung, aber keine funktionierende Verwaltung. Daher war die Mine nicht registriert. »Hätte man sie registriert, wäre man am Ende mit nichts dagestanden, weil die Schwarzen einem alles weggenommen hätten«, sagt Errol. Er kritisiert Mayes Familie als rassistisch, während er selbst darauf beharrt, kein Rassist zu sein. »Ich hab’ nichts gegen die Schwarzen, aber sie sind einfach anders als ich«, erklärt er mir in einer weitschweifigen Diskussion am Telefon.
Errol, der an der Mine nie als Miteigentümer beteiligt war, erweiterte sein Geschäft, indem er Rohsmaragde importierte und in Johannesburg schleifen ließ. »Viele Leute kamen mit gestohlenen Päckchen zu mir«, sagt er. »Auf Reisen nach Übersee verkaufte ich Smaragde an Juweliere. Das war eine abenteuerliche Sache, weil völlig illegal.« Nach Profiten in Höhe von rund 210 000 Dollar 1 brach sein Smaragd-Business in den 1980er-Jahren ein. Die Russen hatten künstliche Smaragde im Labor entwickelt.
1 Bei der Bezeichnung Dollar handelt sich im gesamten Text um US-Dollar.
Die Ehe der Eltern
Errol Musk und Maye Haldeman kamen schon als Teenager zusammen. Von Beginn an ging es in ihrer Beziehung dramatisch zu. Er machte ihr mehrere Heiratsanträge, doch sie traute ihm nicht über den Weg. Als sie dahinterkam, dass er sie betrog, war sie so außer sich, dass sie eine Woche lang weinte und nichts essen konnte. »Vor lauter Trauer nahm ich fast fünf Kilo ab«, erinnert sie sich. Wobei ihr das letztlich dabei geholfen habe, einen lokalen Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Sie erhielt 150 Dollar Preisgeld und zehn Bowlingtickets und kam ins Finale der Wahl zur Miss Südafrika.
Nach ihrem Collegeabschluss zog Maye nach Kapstadt, um dort Vorträge über Ernährung zu halten. Errol kam sie besuchen, brachte einen Verlobungsring mit und machte ihr wieder einen Antrag. Er versprach, er würde sich ändern und ihr treu bleiben, wenn sie erst geheiratet hätten. Maye hatte soeben die Beziehung zu einem anderen untreuen Freund beendet und eine Menge zugenommen; sie fürchtete, sie könnte am Ende gar keinen Mann mehr abbekommen, wenn sie noch lange zuwartete, und willigte ein.
Am Abend nach der Hochzeit flogen Errol und Maye für ihre Flitterwochen nach Europa. Die Tickets hatten sie zu einem günstigen Preis erstanden. In Frankreich kaufte Errol mehrere Nummern des Playboy, der in Südafrika verboten war. Die las er dann auf dem schmalen Hotelbett, sehr zu Mayes Missfallen. Ihre Streitereien wurden verbittert. Zurück in Pretoria, überlegte sie, wie sie aus dieser Ehe herauskommen könnte. Doch schon bald litt sie an morgendlicher Übelkeit. Sie war in der zweiten Nacht ihres Honeymoon in Nizza schwanger geworden. »Es war ein Fehler gewesen, ihn zu heiraten«, klagt sie, »aber jetzt ließ es sich nicht mehr rückgängig machen.«
Kapitel 2 Eigensinn
Pretoria in den 1970ern
Elon und Maye Musk (oben links); Elon, Kimbal und Tosca (unten links); Elon schulfertig (rechts)
© Mit freundlicher Genehmigung von Maye Musk
Einsam und entschlossen
Am 28. Juni 1971 brachte Maye morgens um halb acht einen 3855 Gramm schweren Jungen mit einem sehr großen Kopf zur Welt.
Zuerst wollten Errol und sie ihn Nice nennen, nach der französischen Stadt, wo er gezeugt worden war. Die Geschichte hätte vielleicht einen anderen Verlauf genommen oder zumindest amüsiert reagiert, wenn der Junge mit dem Namen Nice Musk durchs Leben gegangen wäre. Stattdessen stimmte Errol – in der Hoffnung, die Haldemans glücklich zu machen – zu, den Jungen nach dieser Seite der Familie zu benennen: Elon nach Mayes Großvater Joshua Elon Haldeman und Reeve nach dem Mädchennamen von Mayes Großmutter mütterlicherseits.
Errol gefiel Elon, weil es ein Name aus der Bibel war. Später behauptete er, einer Vorahnung gefolgt zu sein. Als Kind habe er von einem Science-Fiction-Buch des Raketentechnikers Wernher von Braun mit dem Titel Das Marsprojekt gehört. Darin wird eine Kolonie auf dem Planeten beschrieben, die ein »Elon« regiert.
Elon weinte viel, aß viel und schlief wenig. Irgendwann beschloss Maye, ihn einfach schreien zu lassen, bis er einschlief. Aber nachdem Nachbarn die Polizei verständigt hatten, kam sie davon wieder ab. Elons Stimmungen schwankten rasch. »Wenn er nicht weinte«, erzählt seine Mutter, »war er wirklich süß.«
In den darauffolgenden zwei Jahren bekam Maye noch zwei weitere Kinder: Kimbal und Tosca. Maye verhätschelte ihre Kinder nicht. Sie durften frei herumstreifen. Es gab kein Kindermädchen, nur eine Haushälterin, die sich kaum darum kümmerte, wenn Elon mit Raketen und Knallkörpern experimentierte. Heute überrascht es ihn selbst, dass er seine Kindheit mit allen zehn Fingern überstanden hat.
Als Elon drei war, befand seine Mutter, er sei so aufgeweckt, dass er schon in den Kindergarten gehen sollte. Die Leiterin versuchte, ihr das auszureden, und argumentierte, er wäre dann jünger als alle anderen in seiner Gruppe und sozial überfordert. Sie solle besser noch ein Jahr warten. »Das kann ich nicht«, lehnte Maye ab. »Er braucht außer mir noch jemanden zum Reden. Ich habe tatsächlich dieses Genie zum Kind.« Und damit setzte sie sich durch.
Es war ein Fehler. Elon hatte keine Freunde, und als er später in die zweite Klasse kam, schaltete er ab. »Die Lehrerin baute sich vor mir auf und schrie mich an, aber ich nahm das alles überhaupt nicht wahr«, erzählt Musk. Seine Eltern wurden zum Direktor einbestellt, der ihnen eröffnete: »Wir haben Grund zur Annahme, dass Elon zurückgeblieben ist.« Eine seiner Lehrerinnen erklärte, er sei die meiste Zeit in Trance und höre nicht zu: »Er schaut die ganze Zeit aus dem Fenster, und wenn ich ihm sage, er soll jetzt aufpassen, sagt er, ›die Blätter werden jetzt braun‹.« Errol erwiderte, Elon habe recht, die Blätter würden doch gerade braun.
Die ausweglose Situation änderte sich, als seine Eltern zustimmten, sein Hörvermögen testen zu lassen. »Sie waren der Meinung, dass es an meinen Ohren lag, also bekam ich die Mandeln rausoperiert«, erzählt er. Das besänftigte die Schulleitung, änderte aber nichts an seiner Neigung, beim Nachdenken abzuschalten und sich in seine eigene Welt zurückzuziehen. »Schon seit ich ein Kind war, stelle ich alle meine sensorischen Systeme ab, wenn ich anfange, scharf über irgendwas nachzudenken«, sagt Elon. »Dann sehe oder höre ich nichts. Ich benutze mein Gehirn wie einen Rechner, nicht um eingehende Informationen zu verarbeiten.« Die anderen Kinder sprangen vor ihm herum und fuchtelten mit den Armen, um zu sehen, ob sie seine Aufmerksamkeit erregen konnten. Doch es funktionierte nicht. »Am besten ist es, ihn in Ruhe zu lassen, wenn er so ins Leere starrt«, sagt seine Mutter.
Was seine Probleme mit anderen noch verschlimmerte, war, dass er sich weigerte, höflich mit denjenigen umzugehen, die er für dumm hielt. »Mit dem Beginn der Schulzeit wurde er so einsam und traurig«, sagt seine Mutter. »Kimbal und Tosca schlossen gleich am ersten Tag Freundschaften und brachten Kinder mit nach Hause, aber Elon brachte nie Freunde mit. Er wünschte sich Freunde, wusste aber einfach nicht, wie er das anstellen sollte.«
Er war einsam, sehr einsam, und dieser Schmerz brannte sich in seine Seele ein. »Als ich noch ein Kind war, habe ich eines gesagt«, erinnerte er sich in einem Interview mit der Rolling Stone 2017, das er während einer chaotischen Phase in seinem Liebesleben gab. »›Ich möchte nie allein sein.‹ Das habe ich damals gesagt. ›Ich möchte nie allein sein.‹«
Eines Tages, da war er fünf, feierte einer seiner Cousins eine Geburtstagsparty. Elon sollte, weil er sich geprügelt hatte, zur Strafe zu Hause bleiben. Er war ein sehr dickköpfiges Kind und beschloss, alleine zum Haus seines Cousins zu laufen. Das erste Problem: Das Haus befand sich am anderen Ende von Pretoria, knapp zwei Stunden zu Fuß entfernt. Das zweite Problem: Er war noch zu klein, um die Straßenschilder lesen zu können. »Ein bisschen kannte ich die Strecke, weil ich schon im Auto dorthin mitgefahren war. Ich war entschlossen hinzukommen, also marschierte ich einfach los«, sagt er. Er schaffte es tatsächlich und kam an, als die Party gerade zu Ende war. Als seine Mutter ihn die Straße entlanglaufen sah, flippte sie aus. Aus Furcht, wieder bestraft zu werden, kletterte Elon auf einen Ahornbaum und weigerte sich, herunterzukommen. Kimbal erinnert sich, unter dem Baum gestanden und ehrfürchtig zu seinem Bruder aufgeschaut zu haben. »Er besitzt diese finstere Entschlossenheit, die dich umhaut und dir manchmal geradezu Angst macht. Das ist bis heute so.«
Im Alter von acht Jahren setzte Elon sich in den Kopf, ein Mofa zu kriegen. Ja, mit acht. Er stellte sich neben den Stuhl des Vaters und trug sein Anliegen wieder und wieder vor. Als sein Vater nach der Zeitung griff und sagte, er solle still sein, blieb Elon einfach stehen. »Es war außerordentlich, das mitanzusehen«, sagt Kimbal. »Er stand einfach stumm da, dann brachte er seine Argumente wieder vor und stand erneut schweigend da.« So ging das wochenlang, jeden Abend. Am Ende gab sein Vater nach und kaufte Elon eine blau-goldene Yamaha mit fünfzig Kubik.
Elon neigte ebenfalls dazu, selbstvergessen auf eigene Faust loszulaufen, ohne sich darum zu kümmern, was die anderen machten. Bei einem Verwandtenbesuch in Liverpool ließen seine Eltern den achtjährigen Elon und seinen Bruder in einem Park zurück, wo sie spielen sollten. Weil es nicht seiner Art entsprach, an Ort und Stelle zu bleiben, machte Elon sich auf und wanderte durch die Straßen. »Irgendein Kind klaubte mich auf und brachte mich zu seiner Mutter, weil ich weinte. Dort bekam ich Milch und Kekse, und die Polizei wurde verständigt«, erinnert er sich. Als er auf der Polizeiwache seine Eltern wiedertraf, fand er daran nichts Besonderes.
»Es war schon verrückt, mich und meinen Bruder in diesem Alter in einem Park allein zu lassen«, meint er, »aber meine Eltern waren nicht so überbehütend, wie Eltern das heute sind.« Jahre später beobachtete ich ihn auf der Baustelle eines Solardachs, wo er seinen zweijährigen Sohn dabei hatte, der »X« genannt wird. Es war 22 Uhr, und zwei Scheinwerfer beleuchteten Gabelstapler und andere bewegliche Maschinen und erzeugten große Schatten. Musk setzte seinen Sohn auf den Boden, damit dieser selbst alles erforschen konnte, was er ohne Furcht tat. Während X zwischen Kabeln und Drähten herumkletterte, warf Musk gelegentlich einen Blick auf ihn, griff aber nicht ein. Erst, als sich der Kleine schließlich anschickte, auf einen der Scheinwerfer zu klettern, kam er herüber und nahm ihn auf den Arm. X zappelte und quengelte, weil ihm die Einschränkung nicht gefiel.
Später sollte Musk erzählen – und sogar darüber scherzen –, dass er das Asperger-Syndrom habe. Diese Form von autistischer Störung kann die sozialen Fähigkeiten eines Menschen beeinträchtigen, seine Beziehungen, seine emotionale Anschlussfähigkeit und seine Selbstbeherrschung. »Als er ein Kind war, wurde das nie wirklich diagnostiziert«, berichtet seine Mutter. »Aber er sagt, er hat Asperger, und ich bin mir sicher, dass das stimmt.« Der Zustand wurde durch seine Kindheitstraumata noch verschlimmert. Wann immer er später schikaniert oder bedroht wurde, erzählt sein enger Freund Antonio Garcias, erfasste die posttraumatische Belastungsstörung Elons limbisches System, den Teil des Gehirns, der emotionale Reaktionen steuert. Eine Folge war, dass er schlecht darin war, soziale Stimuli zu verstehen. »Ich nahm es wörtlich, wenn Leute etwas sagten«, erklärt er, »und erst, als ich begann, Bücher zu lesen, lernte ich, dass Leute nicht immer sagen, was sie wirklich meinen.« Er hatte eine Vorliebe für präzisere Dinge wie Maschinenbau, Physik und Programmieren.
Wie alle Wesenszüge waren auch die Musks komplex und individuell. Er konnte sehr emotional sein, insbesondere wenn es um seine eigenen Kinder ging. Und er litt unter akuter Unruhe, wenn er allein war. Gleichzeitig fehlten ihm die emotionalen Rezeptoren für alltägliche Verbindlichkeit, für Wärme und das Bedürfnis, gemocht zu werden. Empathiefähigkeit war in ihm nicht angelegt. Oder, um es weniger gehoben auszudrücken: Er konnte ein Arschloch sein.
Die Scheidung
Maye und Errol besuchten mit drei anderen Paaren eine Art Oktoberfest. Man trank Bier und hatte Spaß, bis ein Kerl von einem anderen Tisch Maye hinterherpfiff und sie »sexy« nannte. Errol war stinksauer, allerdings nicht auf den Typen. Laut Mayes Erinnerung stürzte er sich auf sie und wollte sie schlagen. Ein Freund musste ihn zurückhalten. Nach diesem Vorfall flüchtete sie zu ihrer Mutter. »Im Laufe der Zeit war er immer verrückter geworden«, sagte Maye später. »Er schlug mich, auch wenn die Kinder dabei waren. Ich erinnere mich, dass Elon, der damals fünf war, ihm in die Kniekehlen schlug, damit er aufhörte.«
Errol nennt die Anschuldigungen »totalen Müll«. Er behauptet, er habe Maye vergöttert. »In meinem ganzen Leben habe ich nie die Hand gegen eine Frau erhoben und bestimmt nicht gegen eine meiner Ehefrauen«, erklärt er. »Das ist eine Waffe der Frauen, rumzuheulen, dass der Mann sie misshandelt hätte. Zu heulen und zu lügen. Und die Waffen eines Mannes sind kaufen und unterschreiben.«
Am Morgen nach der Auseinandersetzung auf jenem Fest kam Errol zum Haus von Mayes Mutter, entschuldigte sich und bat Maye zurückzukommen. »Wag nicht noch einmal, sie anzufassen«, drohte Winnifred Haldeman. »Wenn du das wieder tust, wird sie zu mir ziehen.« Maye sagte, er habe sie danach nie mehr geschlagen, aber die Misshandlung mit Worten ging weiter. Er warf ihr vor, »langweilig, dumm und hässlich« zu sein. Die Ehe erholte sich nie mehr. Errol gab später zu, es sei seine Schuld gewesen. »Ich hatte eine sehr hübsche Frau, aber es gab immer hübschere, jüngere Mädchen. Ich habe Maye wirklich geliebt, aber ich hab’s verbockt.« Sie ließen sich scheiden, als Elon acht war.
Maye und die Kinder zogen in ein Haus an der Küste, in der Nähe von Durban, etwa 600 Kilometer südlich der Gegend von Pretoria und Johannesburg. Dort schlug sie sich mit Jobs als Model und Diätberaterin durch. Das Geld war knapp. Sie kaufte ihren Kindern gebrauchte Schulbücher und – uniformen. An einigen Wochenenden und in den Ferien setzte sie die Kinder (meist ohne Tosca) in den Zug, damit sie ihren Vater in Pretoria besuchten. »Er schickte sie ohne Kleidung oder Gepäck zurück, sodass ich jedes Mal neue Sachen für sie kaufen musste«, sagt sie. »Er meinte, am Ende würde ich doch wieder zu ihm zurückkehren, weil ich so arm wäre und die Kinder nicht länger ernähren könnte.«
Wenn sie zu einem Modeljob oder einem Vortrag über Ernährung musste, ließ sie die Kinder allein zu Hause. »Ich hatte nie ein schlechtes Gewissen, weil ich Vollzeit arbeitete, denn mir blieb keine andere Wahl«, sagt sie. »Meine Kinder mussten auf sich selbst aufpassen.« Die Freiheit lehrte sie, selbstständig zu sein. Wenn sie ein Problem hatten, lautete Mayes Standardantwort: »Das kriegst du schon hin.« Kimbal erinnert sich: »Mom war nicht sanft und kuschelig, sondern hat immer gearbeitet, aber für uns war das ein Geschenk.«
Elon wurde zu einer Nachteule und blieb bis zur Morgendämmerung wach, um Bücher zu lesen. Wenn er sah, dass bei seiner Mutter morgens um sechs das Licht anging, kroch er ins Bett und schlief ein. Folglich hatte sie Probleme, ihn rechtzeitig für die Schule wach zu kriegen. Wenn sie nicht da war, tauchte er manchmal erst um zehn dort auf.
Als Errol einen Kampf um das Sorgerecht begann, ließ er Elons Lehrer, Mayes Modelagentin und ihre Nachbarn als Zeugen vorladen. Kurz vor Prozessbeginn machte Errol einen Rückzieher. Alle paar Jahre strengte er ein neues Verfahren an und ließ es wieder fallen. Als sich Tosca an diese Sache erinnert, beginnt sie zu weinen. »Ich weiß noch, dass Mom einfach nur schluchzend auf der Couch saß. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich konnte sie nur in den Arm nehmen.«
Maye und Errol neigten beide eher zu dramatischen Szenen als zu häuslichem Frieden – eine Eigenschaft, die sie weitergeben würden. Nach ihrer Scheidung begann Maye, einen Mann zu daten, der sie ebenfalls misshandelte. Die Kinder hassten ihn und steckten hin und wieder winzige Knaller in seine Zigaretten, die explodierten, wenn er sie anzündete. Bald nachdem er Maye einen Antrag gemacht hatte, schwängerte er eine andere Frau. »Das war eine Freundin von mir«, sagt Maye. »Wir haben zusammen gemodelt.«
Mit abgebrochenem Zahn und Narbe
© Mit freundlicher Genehmigung von Maye Musk
Kapitel 3 Leben mit Vater
Pretoria in den 1980ern
Elon spielt mit einer Schildkröte, Errol sieht zu (oben links); Kimbal und Elon mit Peter und Russ Rive (oben rechts); die Lodge im Timbavati-Wildreservat (unten)
© O. l.: Mit freundlicher Genehmigung von Maye Musk; o. r.: Mit freundlicher Genehmigung von Peter Rive; u.: Mit freundlicher Genehmigung von Kimbal Musk
Der Umzug
Mit zehn Jahren traf Elon eine schicksalhafte Entscheidung, die er später zutiefst bereuen sollte. Er beschloss, zu seinem Vater zu ziehen. Dafür nahm er allein den gefährlichen Nachtzug von Durban nach Johannesburg. Als er seinen wartenden Vater auf dem Bahnhof entdeckte, strahlte er »vor Freude wie die Sonne«, wie Errol sagt. »Hi, Dad, lass uns einen Hamburger holen!«, rief er. An jenem Abend krabbelte er zu seinem Vater ins Bett und blieb die ganze Nacht über dort.
Warum hat er sich entschieden, zu seinem Vater zu ziehen? Elon seufzt und schweigt fast eine Minute, als ich ihn das frage. »Mein Dad war einsam, so einsam, und ich fand, ich sollte ihm Gesellschaft leisten«, meint er schließlich. »Er hat psychologische Tricks benutzt.« Außerdem liebte er seine Großmutter, Errols Mutter Cora, die Nana genannt wurde. Sie überzeugte ihn davon, dass es unfair sei, dass seine Mutter alle drei Kinder habe und sein Vater keins.
In gewisser Weise war der Umzug zu seinem Vater gar nicht so verwunderlich. Elon war noch ein Kind, in sozialer Hinsicht unsicher, und er hatte keine Freunde. Seine Mutter war liebevoll, aber überarbeitet, abgelenkt und verletzlich. Sein Vater war dagegen angeberisch und männlich. Ein großer Kerl mit riesigen Pranken und faszinierender Ausstrahlung. Damals besaß er ein goldfarbenes Rolls-Royce-Cabrio und, noch wichtiger, zwei mehrbändige Enzyklopädien, viele weitere Bücher und jede Menge Werkzeuge.
All das erschien reizvoll für einen Zehnjährigen, und so hatte Elon entschieden, bei ihm zu wohnen. »Das erwies sich als richtig schlechte Idee«, sagt er. »Ich hatte bis dahin nicht gewusst, wie furchtbar er war.« Vier Jahre später folgte Kimbal ihm: »Ich wollte meinen Bruder nicht mit ihm allein lassen. Mein Dad hat meinem Bruder ein schlechtes Gewissen gemacht, damit er zu ihm zog. Und dann hat er mir ein schlechtes Gewissen gemacht.«
»Warum wollte er bei jemandem leben, der allen wehtat?«, fragte sich Maye Musk vierzig Jahre später. »Warum hat er nicht ein glückliches Zuhause vorgezogen?« Sie schweigt einen Moment lang. »Vielleicht weil er einfach so ist.«
Nachdem die Jungs bei ihm waren, halfen sie Errol, im Timbavati-Wildreservat, einer unberührten Buschgegend etwa 480 Kilometer östlich von Pretoria, eine Lodge zu errichten, die man an Touristen vermieten konnte. In der Bauphase schliefen sie nachts gleich neben dem Feuer, die Browning-Gewehre stets griffbereit. Als Ingenieur beschäftigte sich Errol eingehend mit den Eigenschaften verschiedener Materialien: Die Ziegel waren aus Lehm, das Dach aus Gras und die Fußböden aus Glimmer, ein guter Isolator gegen die Hitze. Auf der Suche nach Wasser rissen Elefanten oft die Rohre heraus, und regelmäßig drangen Affen in die Pavillons ein und hinterließen dort ihre Haufen, sodass es für die Jungs viel Arbeit gab.
Elon begleitete häufig Gäste auf die Jagd. Obwohl er nur über eine 22-Kaliber-Büchse verfügte, hatte die eine gute Reichweite, und er wurde damit zum erfahrenen Schützen. Er gewann sogar bei einem lokalen Wettbewerb im Tontaubenschießen, allerdings verweigerte man ihm den Preis – eine Kiste Whiskey –, weil er dafür noch zu jung war.
Als Elon neun war, nahm sein Vater ihn, Kimbal und Tosca mit auf eine Amerikareise. Sie fuhren von New York durch den Mittleren Westen bis hinunter nach Florida. Elon fing damals Feuer für die mit Münzen zu betreibenden Videospielautomaten, die in den Lobbys der Motels herumstanden. »Das war die mit Abstand spannendste Sache«, sagte er. »So was gab es damals in Südafrika noch nicht.« Errol legte während der Reise eine Mischung aus Extravaganz und Sparsamkeit an den Tag. So mietete er zwar einen Thunderbird, übernachtete mit den Kindern aber in billigen Absteigen. »Als wir in Orlando ankamen, weigerte mein Vater sich, mit uns Disney World zu besuchen, weil es zu teuer war«, erinnert Musk sich. »Ich glaube, wir waren dann stattdessen in irgendeinem Wasserpark.« Wie so oft hat Errol eine andere Version der Geschichte parat. Er behauptet, sie seien auch in Disney World gewesen, wo Elon vor allem die Fahrt durchs Spukhaus gefallen habe, und auch im Six Flags Over Georgia. »Auf der Reise habe ich ihnen immer wieder gesagt: ›Amerika ist der Ort, wo ihr eines Tages leben werdet.‹«
Zwei Jahre später nahm er die drei mit nach Hongkong. »Mein Vater hatte da einerseits tatsächlich geschäftlich zu tun, ging aber auch mit irgendwas hausieren«, erinnert sich Musk. »Er ließ uns im Hotel zurück, das ziemlich runtergekommen war, und gab uns nur ungefähr 50 Dollar. Dann verschwand er für zwei Tage.« Sie schauten sich Samurai- und Zeichentrickfilme auf dem Hotelfernseher an, ließen Tosca aber auch zurück und streiften durch die Straßen der Stadt, um in Elektrogeschäften gratis Videospiele auszuprobieren. »Heutzutage würde jemand den Jugendschutz verständigen, wenn einer machen würde, was unser Dad getan hat«, sagt Musk, »aber für uns war es damals ein wunderbares Erlebnis.«
Eine Bande von Cousins
Nachdem Elon und Kimbal zu ihrem Vater in einen Vorort von Pretoria gezogen waren, siedelte Maye ins nahe Johannesburg um, damit die Familie leichter zusammen sein konnte. Freitags fuhr sie zu Errols Haus, um die Jungs abzuholen. Dann besuchten sie ihre Großmutter, die unerschütterliche Winnifred Haldeman. Ihren Hühncheneintopf hassten die Kinder dermaßen, dass Maye hinterher immer mit ihnen Pizza essen ging.
Normalerweise übernachteten Elon und Kimbal dann im Haus neben dem der Großmutter, wo Mayes Schwester Kaye Rive und deren drei Söhne wohnten. Die fünf Cousins – Elon und Kimbal Musk sowie Peter, Lyndon und Russ Rive – wurden zu einer eingeschworenen und manchmal kampflustigen Truppe junger Abenteurer. Maye war nachsichtiger und weniger behütend als ihre Schwester. Deshalb konspirierten die Jungs mit ihr, wenn sie ein Abenteuer ausheckten. »Wenn wir zum Beispiel zu einem Konzert nach Johannesburg wollten, dann sagte sie zu ihrer Schwester: ›Ich bringe die Jungs heute Abend zu einem Camp von der Kirche‹«, schmunzelt Kimbal. »Dann setzte sie uns ab, und wir zogen los, um Unsinn zu machen.«
Solche Ausflüge konnten gefährlich sein. »Bei einem Zwischenstopp des Zuges gab es einmal eine fürchterliche Schlägerei. Wir sahen, wie ein Kerl ein Messer in den Leib gerammt bekam«, sagt Peter Rive. »Wir versteckten uns im Abteil, bis sich die Türen schlossen und es weiterging. Manchmal stieg auch eine Gang in den Zug, um irgendwelche Rivalen zu verfolgen. Die Typen randalierten dann durch die Waggons und schossen mit Maschinenpistolen um sich.«
Einige der Konzerte, die die Jungs damals besuchten, waren Protestaktionen gegen die Apartheid, so wie jenes 1985 in Johannesburg, zu dem 100 000 Menschen zusammenkamen. Auch bei solchen Veranstaltungen kam es immer wieder zu Raufereien. »Wir versuchten nicht, uns vor der Gewalt zu verstecken, wir lernten, sie zu überleben«, sagt Kimbal. »Das lehrte uns, keine Angst zu haben, aber auch keine wirklich verrückten Sachen zu tun.«
Elon erwarb sich den Ruf des besonders Furchtlosen. Wenn die Cousins ins Kino gingen und andere Leute lärmten, dann war er derjenige, der hinging und sie aufforderte, leise zu sein. Sogar wenn sie viel größer oder älter waren als er. »Es ist für ihn eine große Sache, sich bei seinen Entscheidungen nicht von Furcht beeinflussen zu lassen«, sagt sein Cousin Peter. »Und das war auch schon so, als er noch ein Kind war.«
Elon galt auch als derjenige, der am meisten auf Wettbewerb aus war. Als sie einmal mit den Fahrrädern auf dem Weg von Pretoria nach Johannesburg waren, trat er so heftig in die Pedale, dass er den anderen weit voraus war. Die stiegen ab und ließen sich per Anhalter von einem Pick-up mitnehmen. Als sie Elon eingeholt hatten, war er so wütend, dass er mit Fäusten auf sie losging. Es sei ein Rennen gewesen, sagte er, und sie hätten geschummelt.
Solche Auseinandersetzungen gab es oft. Häufig fanden die Schlägereien in der Öffentlichkeit statt. Auf ihre Umgebung schienen die Jungs dabei gar nicht zu achten. Eine der vielen Prügeleien zwischen Elon und Kimbal ereignete sich auf einem Jahrmarkt. »Sie rangen miteinander und schlugen sich gegenseitig zu Boden«, erinnert sich Peter. »Die umstehenden Leute flippten aus, und ich musste denen sagen: ›Das ist keine große Sache. Die Jungs sind Brüder.‹« Obwohl es meist um Kleinigkeiten ging, konnten sie einander übel mitspielen. »Um zu gewinnen, musste man der Erste sein, der zuschlug oder dem anderen in die Eier trat«, sagt Kimbal. »Dann war der Kampf zu Ende, weil du nicht weitermachen kannst, wenn du einen Tritt in die Eier abgekriegt hast.«
Der Schüler
Musk war ein guter Schüler, aber kein Superstar. Mit neun und zehn Jahren hatte er Bestnoten in Englisch und Mathe. »Schnell begreift er neue mathematische Konzepte«, schrieb sein Lehrer. In seinen Zeugnissen gab es aber auch immer wieder Bemerkungen wie diese: »Er arbeitet extrem langsam, entweder weil er träumt oder weil er etwas tut, das er nicht machen soll.« – »Selten bringt er etwas zu Ende. Im kommenden Jahr muss er sich auf seine Arbeit konzentrieren und während des Unterrichts nicht vor sich hin träumen.« – »Seine Aufsätze zeigen eine lebhafte Fantasie, aber er wird nicht immer rechtzeitig fertig.« Seine durchschnittlichen Ergebnisse, bevor er auf die Highschool kam, waren 83 von 100 Punkten.
Nachdem er an der staatlichen Highschool gemobbt und verprügelt worden war, steckte sein Vater ihn in eine Privatschule, die Pretoria Boys High School. Nach englischem Vorbild herrschten dort strenge Regeln, man schlug die Schüler mit dem Stock, Kirchgang war Pflicht, ebenso das Tragen einer Schuluniform. An der neuen Schule erzielte Elon exzellente Noten, mit Ausnahme von zwei Fächern: Afrikaans (im letzten Jahr erreichte er nur 61 von 100 Punkten) und Religion (»strengt sich nicht an«, notierte der Lehrer). »Ich habe nicht wirklich viel Mühe in Dinge investiert, die ich bedeutungslos fand«, sagt Elon. »Dann las ich lieber oder spielte Videospiele.« In Physik bekam er in seinem Abschlusszeugnis ein A, aber – etwas überraschend – in Mathe nur ein B.
In seiner Freizeit bastelte er gern kleine Raketen und experimentierte mit verschiedenen Mixturen, zum Beispiel mit Chlor für Swimmingpools und Bremsflüssigkeit, um zu sehen, was am heftigsten knallte. Er lernte auch Zaubertricks und Hypnotisieren. Einmal machte er Tosca glauben, sie sei ein Hund, und brachte sie dazu, grünen Speck zu essen.
Wie später auch in Amerika dachten die Cousins sich alle möglichen unternehmerischen Projekte aus. Einmal produzierten sie zu Ostern Schokoladeneier, die sie in Folie wickelten und in der Nachbarschaft verkauften. Dabei kam Kimbal ein genialer Gedanke. Anstatt die Eier billiger anzubieten als die aus dem Supermarkt, verlangten sie mehr dafür. »Manche Leute weigerten sich, das zu bezahlen«, lacht er, »aber wir erklärten ihnen, ›damit unterstützt ihr künftige Kapitalisten‹.«
Lesen blieb Elons seelische Rückzugsmöglichkeit. Manchmal vertiefte er sich für einen ganzen Nachmittag und den Großteil der Nacht in die Lektüre, auch mal neun Stunden am Stück. Wenn die Familie bei Bekannten eingeladen war, dann verschwand er in der Bibliothek der Gastgeber. Ging es in die Stadt, setzte er sich ab, und sie fanden ihn später in einer Buchhandlung wieder, wo er geistesabwesend am Boden saß. Er war auch ein großer Comicfan. Die unbeirrbare Leidenschaft der Superhelden beeindruckte ihn. »Immer versuchen sie, die Welt zu retten. Mit außen getragener Unterhose oder in diesen hautengen Rüstungen, was ja ziemlich seltsam ist, wenn man so darüber nachdenkt«, sagt er. »Aber sie versuchen wirklich, die Welt zu retten.«
Musk arbeitete sich auch durch die beiden Enzyklopädien seines Vaters und wurde nach Aussagen seiner in ihn vernarrten Mutter und seiner Schwester ein »genialer Junge«. In den Augen anderer Kinder war er vor allem ein nerviger Nerd. »Schaut euch den Mond an, der muss doch eine Million Kilometer weit weg sein«, rief einer der Cousins einmal. Darauf Elon: »Nein, es sind ungefähr 384 000 Kilometer, je nach Orbit.«
Ein Buch, das er im Büro seines Vaters entdeckt hatte, beschrieb großartige Erfindungen, die eines Tages in der Zukunft gemacht würden: »Ich kam von der Schule zurück und verzog mich in einen Nebenraum im Büro meines Vaters, wo ich es wieder und wieder las.« Eine der Ideen war eine Rakete mit Ionenantrieb, die statt normalem Treibstoff Partikel verwendete. Musk beschrieb mir spätabends im Kontrollraum seiner Raketenbasis im Süden von Texas das Buch ausführlich und auch, wie ein Ionentriebwerk in einem Vakuum funktionieren würde. »Dieses Buch hat mich zum ersten Mal auf den Gedanken gebracht, zu anderen Planeten zu reisen«, sagte er.
Russ Rive, Elon, Kimbal und Peter Rive
© Mit freundlicher Genehmigung von Maye Musk
Kapitel 4 Der Suchende
Pretoria in den 1980ern
© Mit freundlicher Genehmigung von Maye Musk
Existenzkrise
Als Musk noch klein war, nahm seine Mutter ihn hin und wieder mit in die Sonntagsschule der örtlichen anglikanischen Kirche, wo sie auch unterrichtete. Das klappte nicht gut. Sie erzählte ihrer Klasse Geschichten aus der Bibel, und er stellte sie infrage. »Was meinst du mit ›die Wasser teilten sich‹?«, fragte er. »Das ist unmöglich.« Als sie die Geschichte vortrug, wie Jesus die Menge mit Broten und Fischen speiste, entgegnete er, dass Dinge sich nicht aus dem Nichts materialisieren könnten. Nachdem er getauft worden war, sollte er auch an der Kommunion teilnehmen, doch auch die zog er in Zweifel: »Ich nahm das Blut und den Leib Christi zu mir, was schon seltsam genug ist, wenn du noch ein Kind bist. Ich fragte also: ›Was zur Hölle soll das sein? Eine abartige Metapher für Kannibalismus?‹« Daraufhin beschloss Maye, Elon an den Sonntagmorgen lieber zu Hause lesen zu lassen.
Sein Vater, der gottesfürchtiger war, machte Elon klar, dass es Dinge gibt, die wir mit unseren begrenzten Sinnen und unserem Verstand nicht erfassen können. »Es gibt keine atheistischen Piloten«, pflegte er zu sagen, und Elon erwiderte dann immer, »in Prüfungszeiten gibt’s keine Atheisten«. Elon kam früh zu dem Schluss, dass die Wissenschaft Dinge erklären könne und es daher nicht nötig sei, einen Schöpfer oder eine Gottheit zu beschwören, der oder die in unser Leben eingreift.
Ab der Teenagerzeit machte es ihm jedoch zunehmend zu schaffen, dass irgendetwas fehlte. Weder die religiösen noch die wissenschaftlichen Erklärungen könnten die wirklich großen Fragen beantworten, meint er. Woher kommt das Universum, und warum existiert es überhaupt? Die Physik könne einen alles über das Universum lehren, nur nicht den Grund dafür. Das habe zu einer »adoleszenten Existenzkrise« geführt, wie Musk diese Phase nennt: »Ich wollte unbedingt rauskriegen, worin die Bedeutung des Lebens und des Universums besteht. Und es deprimierte mich richtig, dass das Leben vielleicht keinerlei Bedeutung hat.«
Als braver Bücherwurm stellte er sich diesen Fragen mittels Lektüre. Zunächst beging er dabei den typischen Fehler ängstlicher Jugendlicher und las existenzialistische Philosophen wie Nietzsche, Heidegger und Schopenhauer. Was bewirkte, dass seine Verwirrung in Verzweiflung umschlug. »Ich empfehle nicht, als Teenager Nietzsche zu lesen«, warnt er. Glücklicherweise rettete ihn die Science-Fiction, diese Quelle der Weisheit für Video spielende Kids mit hyperaktivem Intellekt. So pflügte er sich durch die gesamte Sci-Fi-Abteilung seiner Schul- und der Stadtbibliothek. Anschließend drängte er die Bibliothekare, Nachschub zu besorgen.
Einer seiner Lieblingstitel war Robert A. Heinleins The Moon Is a Harsh Mistress, ein Roman über eine Strafkolonie auf dem Mond. Die wird von einem Supercomputer mit Spitznamen Mike beherrscht, der über ein Ichbewusstsein und Sinn für Humor verfügt. Bei einem Aufstand in der Strafkolonie opfert der Computer sein Leben. Das Buch handelt von einem Thema, das in Musks Leben eine zentrale Rolle spielen sollte: Wird künstliche Intelligenz sich dahin gehend entwickeln, dass sie der Menschheit nützt und sie beschützt, oder werden Maschinen eigene Ziele entwickeln und so zu einer Bedrohung für den Menschen?
Dies ist auch das Hauptthema eines weiteren seiner Lieblingswerke, der Foundation-Trilogie von Isaac Asimov. Darin geht es um Gesetze für Roboter, die dafür sorgen, dass diese nicht außer Kontrolle geraten. In der letzten Szene seines Buchs Das galaktische Imperium von 1985 lässt Asimov einen Roboter das fundamentalste dieser Gesetze erklären, das »Nullte Robotergesetz«: »Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch seine Untätigkeit gestatten, dass die Menschheit zu Schaden kommt.« Die Helden der Reihe entwickeln den Plan, Siedler in ferne Regionen der Galaxie zu entsenden, um das menschliche Bewusstsein angesichts eines drohenden finsteren Zeitalters zu bewahren.
Mehr als dreißig Jahre später setzte Musk einen Tweet ab, wie diese Ideen ihn dazu motivierten, die Menschen zu einer den Weltraum bereisenden Spezies zu machen und künstliche Intelligenz in den Dienst der Menschheit zu stellen. »Foundation-Serie & Nulltes Gesetz sind für die Schaffung von SpaceX fundamental.«
Per Anhalter
Der Science-Fiction-Titel, der seine Jahre der Suche am meisten beeinflusste, war Douglas Adams’ Per Anhalter durch die Galaxis. Die schwungvoll ironische Geschichte prägte Musks Philosophie und seinen skurrilen Humor. »The Hitchhiker’s Guide«, sagt er, »half mir aus meiner existenziellen Depression, und ich habe schnell begriffen, dass diese Story in jeglicher Hinsicht erstaunlich komisch war.«