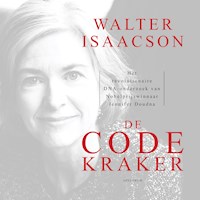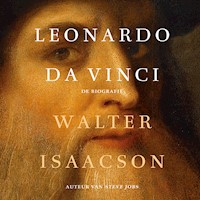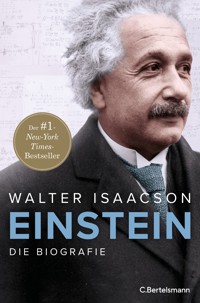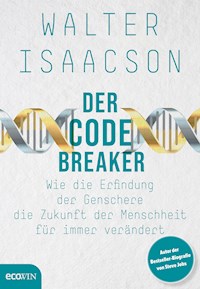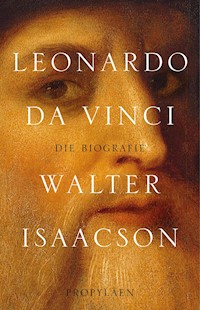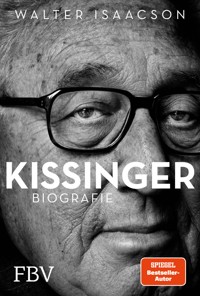
22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
100 Jahre lang prägte Henry Kissinger die Geschicke der Welt – als Außenminister, Unternehmensberater, Harvard-Professor und Autor. Sein Leben ist auf einzigartige Weise verwoben mit der Weltgeschichte des letzten Jahrhunderts. Als Kissinger vor über 50 Jahren zum Außenminister ernannt wurde, war er beliebter als jeder andere Politiker seiner Zeit. Gleichzeitig wurde er von großen Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit verachtet – von liberalen Intellektuellen ebenso wie von konservativen Aktivisten. Bestsellerautor Walter Isaacson beleuchtet die Persönlichkeit dieses komplexen Mannes, seine Außenpolitik und seine Ideen, die bis heute nachhallen. Die Neuausgabe dieser ersten vollständigen Biografie stützt sich auf ausführliche Interviews mit Kissinger und 150 weiteren Gesprächspartnern und nutzt viele von Kissingers privaten Papieren und geheimen Memos. Das Ergebnis ist eine intime Erzählung voller überraschender Enthüllungen, die diesen facettenreichen Staatsmann von seiner Kindheit als verfolgter Jude in Nazi-Deutschland über seine schwierige Beziehung zu Richard Nixon bis hin zu seinen späteren Jahren als international tätiger Unternehmensberater zeigt. Dieses Buch ist eine Neuausgabe des 1993 erschienenen Werks »Kissinger. Eine Biografie«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1614
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Walter Isaacson
Kissinger
Biografie
Walter Isaacson
Kissinger
Biografie
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/ abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
info@m-vg.de
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Dieses Buch ist eine Neuausgabe des 1993 bei edition q erschienenen Buches Kissinger.
2. Auflage 2024
© 2024 by Finanzbuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1992 bei Simon & Schuster unter dem Titel Kissinger. © 1992 by Walter Isaacson. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Dr. Jürgen Schebera, Marianne Rubach, Peter Zacher
Redaktion: Dr. Jürgen Schebera
Umschlaggestaltung: Maria Verdorfer
Umschlagabbildung: Getty Images/Derek Hudson
Fotos: Privatarchiv Henry/Paula Kissinger, National Archives/Nixon Project, Gerald R. Ford Library
Satz: Daniel Förster, Belgern
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-775-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-512-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-513-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Für Betsy, die ihren Namen verdient
Inhalt
Einleitung
1 FÜRTH Aufwachsen in Nazideutschland 1923–1938
2 WASHINGTON HEIGHTS Die Amerikanisierung eines strebsamen Buchhalters 1938–1943
3 DIE ARMEE »Mr. Henry« kehrt einmarschierend nach Hause zurück 1943–1947
4 HARVARD Der ehrgeizige Student 1947–1955
5 NEW YORK Im Dienst des Establishments 1954–1957
6 WIEDER HARVARD Der Professor 1957–1968
7 RANDZONEN DER MACHT Kennedy, Johnson und Rockefeller 1961–1968
8 DIE BEIDEN VERSCHWÖRER Kissinger und Nixon 1968
9 WILLKOMMEN, VIETNAM! Geheime Optionen, geheime Bombardierungen
10 KISSINGERS HERRSCHAFT Die Macht des Chefs und wie er damit umging
11 DIE ABHÖRAKTION Wanzen im Büro, Anzapfen privater Telefone und andere Einfälle
12 KEIN AUSWEG Vietnam verschlingt eine weitere Administration
13 DIE INVASION IN KAMBODSCHA Ausweitung des Krieges, Rücktritte und Wut
14 ZWEI WOCHEN IM SEPTEMBER Ein rekonstruierender Rückblick auf die Kunst des Spiels mit der Krise
15 SALT Rüstungskontrolle über den Geheimkanal
16 CHINA Die Erschaffung eines Dreiecks
17 EIN GEFEIERTER MANN Das heimliche Leben des unwahrscheinlichsten Sexsymbols der Welt
18 WINTER DER LANGEN MESSER Nach einem falsch geführten Krieg erreicht Kissinger einen Tiefpunkt
19 DAS DREIECK Gipfelfrühling in Moskau und Beijing
20 DER FRIEDEN IST GREIFBAR Die Pariser Gespräche ergeben ein vertracktes Abkommen
21 DAS WEIHNACHTSBOMBARDEMENT Hanoi wird zerstört, um Saigon zur Unterzeichnung zu bewegen
22 AUSSENMINISTER Ein Aufstieg, der durch den Abstieg aller anderen unterstützt wurde
23 DER JOM-KIPPUR-KRIEG Eine Nahostinitiative, ein Streit um Nachlieferungen und ein nuklearer Alarmzustand
24 DIE PENDELMISSION Schritt für Schritt durch Israel, Ägypten und Syrien
25 DIE PRESSE Wie man vor einem Hintergrund für sich einnimmt
26 ÜBERGÄNGE Die letzten Tage und ein neuer Anfang
27 DER TOD DER ENTSPANNUNGSPOLITIK Eine seltsame Koalition fährt einen harten Kurs
28 DIE ZAUBERKRAFT IST VERSCHWUNDEN Rückschläge auf Sinai und in Südostasien
29 MORAL IN DER AUSSENPOLITIK Kissingers Realpolitik und ihre Herausforderungen
30 AFRIKA Verdeckte Mitwirkung und danach Pendeldiplomatie
31 ABGANG Nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit Gejammer
32 BÜRGER KISSINGER Das Jetset-Leben eines Ministers ohne Geschäftsbereich
33 KISSINGER ASSOCIATES Wie der berühmteste Berater der Welt daraus eine Goldgrube machte
34 DAS ERBE Politik und Persönlichkeit
Danksagung
Quellenangaben
Quellennachweis
Literaturverzeichnis
Einleitung
Als Professor neigte ich dazu, die Geschichte als von unpersönlichen Kräften gelenkt zu betrachten. Doch wenn man sie in der Praxis erlebt, sieht man den Unterschied, den Persönlichkeiten ausmachen.
Kissinger im Gespräch mit Journalisten auf dem Rückflug von seiner ersten Nahostmission, Januar 1974.
Als seine Eltern mit dem Einpacken der geringen persönlichen Habe fertig waren, die man ihnen aus Deutschland mitzunehmen gestattete, stand der 15-jährige Junge mit der Brille in einer Ecke des Wohnzimmers und prägte sich jedes Detail der Szene genau ein. Er war ein belesenes und nachdenkliches Kind, mit jener seltsamen Mischung aus Ichbewusstsein und Unsicherheit, wie sie zustande kommen kann, wenn man komfortabel, aber verfolgt heranwächst. »Eines Tages werde ich zurückkommen«, sagte er zu dem Zollbeamten, der die Gepäckstücke prüfte. Jahre später wird er sich erinnern, wie der Mann ihn »mit der Verachtung des Alters« betrachtete und nichts dazu sagte.1
Henry Kissinger behielt recht: Er kam an seinen bayerischen Geburtsort zurück, zunächst als Soldat der militärischen Abwehr der US-Army, danach als anerkannter Wissenschaftler auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen und schließlich als dominierender Staatsmann seiner Epoche. Doch er sollte als Amerikaner zurückkehren, nicht als Deutscher. Beginnend mit seiner Entdeckung kurz nach der Ankunft in New York, dass er nicht mehr die Straße überqueren musste, um den Schlägen nichtjüdischer Jungen zu entgehen, war er eifrig darum bemüht, als Amerikaner angesehen und akzeptiert zu werden.
Und so geschah es. Als er 1973 zum Außenminister ernannt wurde, war er nach einer Gallup-Umfrage bereits die am meisten bewunderte Person Amerikas. Mehr noch: Als er danach die Außenpolitik leitete – mit der Aura des Ehrengastes einer Cocktailparty –, wurde er zu einer der berühmtesten Persönlichkeiten, die jemals die Fantasie der Welt beschäftigt hatten. Als er einmal Bolivien besuchte, schloss das Protokoll die Teilnahme des Präsidenten des Landes an der Begrüßungszeremonie aus; doch dieser fuhr am betreffenden Abend inkognito zum Flugplatz und mischte sich unerkannt unter die wartende Menschenmenge, sodass er Kissingers Ankunft miterleben konnte.2
Doch gleichzeitig wurde Kissinger auch von großen Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit beschimpft – von liberalen Intellektuellen bis hin zu konservativen Aktivisten, die ihn auf unterschiedliche Weise als Manipulator der Macht ansahen, dem es gefährlich an moralischen Prinzipien mangele. Für die Mandarine des Establishments der Außenpolitik war es einfach schick, ihn im gleichen Atemzug Henry zu nennen und zu verhöhnen. Als George Ball, ein Veteran der amerikanischen Diplomatie, seinem Lektor das Manuskript eines neuen Buches geschickt hatte, meinte dieser: »Wir haben ein großes Problem. In beinahe jedem Kapitel unterbrechen Sie Ihre Ausführungen und hauen erneut auf Henry Kissinger ein.« Darauf Ball: »Sagen Sie mir, in welchem Kapitel ich das vergessen habe, und ich werde sofort die entsprechenden Passagen nachliefern.«3
Angesichts derart divergierender Meinungen über Kissinger muss der Autor eines Buches über ihn zunächst die Frage beantworten: Soll es freundlich oder unfreundlich werden? Das ist eine seltsame Frage, die sich dem Biografen von Henry Stimson oder George Marshall, ja selbst von Dean Acheson nicht stellen würde. Noch Jahre nachdem er das Ministeramt aufgegeben hatte, gab es um Kissinger Kontroversen ganz persönlicher Art – geprägt von Hass und Verehrung, Animosität und Furcht –, die allesamt mit wenig Neutralität ausgefochten wurden.
Kissingers Stil voller Heimlichkeiten und sein chamäleonartiger Instinkt, der das Erkennen der wirklichen Farben bei jedem Thema schwierig machte, verweisen auf das Problem einer objektiven Einschätzung. Unterschiedliche Personen, die bei wichtigen Ereignissen direkt mit ihm zu tun hatten – der Invasion in Kambodscha, der Verminung des Hafens von Haiphong, dem Weihnachtsbombardement von Hanoi –, haben widersprüchliche Eindrücke davon gewonnen, was er wirklich fühlte und dachte.
Wahrscheinlich deshalb bewegen sich die meisten Bücher über seine Politik entweder in Richtung einer entschieden freundlichen Betrachtung oder umgekehrt einer entschieden unfreundlichen. Und wahrscheinlich auch deshalb gibt es bis heute keine umfassende Biografie von ihm. Wiewohl ich dem Leser die Entscheidung überlassen muss, ob es mir gelungen ist: Mein Ziel war eine unvoreingenommene Biografie, die Kissinger in seiner ganzen Komplexität porträtieren soll. Mir schien, dass jetzt genügend Zeit vergangen ist, um eine objektive Betrachtung möglich zu machen. Die Hauptdarsteller haben ihre Karrieren hinter sich, sie besitzen noch ihre Erinnerungen und persönlichen Aufzeichnungen, sind jedoch von früheren Sicherheitsrestriktionen und Ambitionen befreit.
Dies ist keine autorisierte Biografie. Kissinger hat sie vor der Veröffentlichung weder gesehen noch etwa zur Genehmigung vorgelegt bekommen. Er hatte keinerlei Einfluss darauf, was ich in das Buch aufgenommen habe. Es enthält Meinungen und Urteile, die er ganz gewiss diskutieren würde, zumal sein Ego und seine Sensibilität ihm heute sicher sagen, dass seine eigenen Memoiren seinen Leistungen nicht gerecht geworden sind.
Doch andererseits ist dies auch keine unautorisierte Biografie. Als ich mich entschloss, sie zu schreiben, war mein einziger Kontakt zu Kissinger ein Interview für ein Buch mit Aussagen neuerer amerikanischer Politiker gewesen, The Wise Men. Aus Höflichkeit schrieb ich ihm dann einen Brief, als ich an seine Biografie ging.
Seine Antwort verriet kaum Enthusiasmus. Er könne mich nicht davon abhalten, sagte er, doch er habe nicht den Wunsch, mich wegen dieses Projektes zu sehen. Als ich dann seine früheren Mitarbeiter befragte und Dokumente sammelte, begann ich jedoch ein steigendes Interesse seinerseits zu spüren. Denn die Komplexität des Buches faszinierte ihn stark. Niemals hatte er Erinnerungen an sein Leben vor der Nixon-Administration zu Papier gebracht, sein persönliches Leben hatte er ebenso ausgespart wie die Zeit der Ford-Administration und die Jahre danach. Es gehört zu seiner Persönlichkeit, dass er fast besessen alles unternimmt, damit die Menschen ihn verstehen mögen: Wie die Motte vom Licht wird er von seinen Kritikern angezogen und entwickelt geradezu einen Zwang, sie zu bekehren oder sich ihnen wenigstens zu erklären.
So kam es, dass er schließlich voll kooperativ reagierte. Er gewährte mir über zwei Dutzend ausführliche Gespräche, dazu Einsicht in den Großteil seiner amtlichen wie privaten Papiere. Er bat Familienmitglieder, ehemalige Mitarbeiter, Geschäftspartner und frühere Präsidenten, mit mir zusammenzuarbeiten. Er half mir sogar dabei, einige alte Widersacher aufzuspüren.
Obwohl ich versucht habe, ohne jedes Vorurteil an das Projekt heranzugehen, wurden jedoch während der Arbeit gewisse Themen deutlich, von denen ich hoffe, dass der Leser sie gleichermaßen sieht, ja vielleicht sogar davon überzeugt wird. Das Wichtigste, so glaube ich, besteht darin, dass Kissinger ein Fingerspitzengefühl – um das deutsche Wort zu benutzen – für Macht besaß, für die Schaffung eines neuen globalen Kräftegleichgewichts, das Amerika helfen konnte, mit seinem Vietnam-Syndrom nach dem Rückzug von dort fertigzuwerden. Dies wurde jedoch nicht von einem gleichen Gefühl für die Stärke begleitet, die sich aus der Offenheit des demokratischen Systems in Amerika ergibt, oder von einem Gefühl für jene moralischen Werte, die die wahre Quelle des globalen Einflusses der USA darstellen.
Ich habe weiterhin darzustellen versucht, wie Kissingers Persönlichkeit – brillant, verschwörerisch, heimlich, sensibel für Einzelheiten und Nuancen, empfänglich für Rivalitäten und Machtkämpfe, bezaubernd, doch zuweilen trügerisch – sich in die machtorientierte Realpolitik und das geheime diplomatische Manövrieren einfügte, die die Basis seiner Politik darstellten. Denn Politik wurzelt in Persönlichkeit – das wusste Kissinger vom Studium Metternichs her.
Kissinger kam in einem Wirbel großer historischer Umbrüche an die Macht, darunter die Herstellung strategischer Parität zwischen Moskau und Washington, die amerikanische Demütigung in Vietnam und Chinas notwendige Beendigung seiner Zeit der Isolation. Dies war gleichzeitig eine Periode, da überlebensgroße Persönlichkeiten auf der Bühne der Welt agierten, wie Nixon, Mao, Sadat und Kissinger selbst.
Als junger Akademiker hatte Kissinger einst über Bismarck und seine Zeit geschrieben: »Die neue Ordnung war für einen Genius maßgeschneidert, der die ihr innewohnenden Kräfte – sowohl im Inneren des Landes wie auch außerhalb – dadurch zu zwingen versprach, dass er ihre Antagonismen manipulierte.« Das Gleiche könnte für Kissinger und seine Zeit gesagt werden. Und: Das Deutschland der 30er Jahre war für ein sensibles und vielversprechendes Kind der rechte Platz, um sich Kenntnisse über »innewohnende Kräfte« und die »Manipulierung von Antagonismen« anzueignen.
1 Fürth
Aufwachsen in Nazideutschland 1923–1938
Der Punkt, an dem sich die Geister scheiden, heißt Ordnung. Sie allein kann Freiheit erzeugen.
Metternich
Die Kissingers aus Bayern
Bei den Juden von Rödelsee, einem kleinen bayerischen Dorf unweit Würzburgs, war Abraham Kissinger für seine Gläubigkeit und sein profundes religiöses Wissen bekannt. Als erfolgreicher Kaufmann konnte er den Sabbat ehren, indem er Freitag vor Sonnenuntergang seinen Laden schloss. Doch er fürchtete, dass sich seine vier Söhne, wenn sie sich gleichfalls dem Handel verschrieben, solchen Luxus nicht würden leisten können. So entschied er, dass sie alle Lehrer werden sollten, wie es sein Vater gewesen war, auf dass sie den Sabbat einhalten konnten.
Und so geschah es, dass Joseph, Maier, Simon und David Kissinger Rödelsee verließen und in nahe gelegenen Ortschaften anerkannte jüdische Schulen gründeten. Von ihren Kindern sollten wiederum fünf – darunter Davids ältester Sohn Louis – Lehrer werden. Und Louis’ ältester Sohn, ein wissbegieriger und introvertierter junger Mann namens Heinz, sollte Jahre später, nachdem die Familie in die USA geflohen war, auf einem berühmten College in dem fernen Land die gleiche Laufbahn beginnen.1
Seit sie sich im 10. Jahrhundert erstmals in der Region angesiedelt hatten, litten die bayerischen Juden unter permanenten Ausbrüchen von Verfolgung und Hass. In vielen Städten als Kaufleute und Geldverleiher wegen ihres Beitrags zur Wirtschaft durchaus angesehen, fanden sie sich nur allzu oft brutal vertrieben, wenn die Stimmung der Herrscher und der Bevölkerung umschlug. 1276 jagte man sie aus Oberbayern hinaus, damit begann eine Welle der Unterdrückung, die in den Verfolgungen nach der Pestkatastrophe von 1349 kulminierte. Im 16. Jahrhundert gab es in Bayern kaum noch nennenswerte jüdische Gemeinden.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts begannen die Juden nach Bayern zurückzukehren, hauptsächlich aus Österreich. Einige von ihnen waren nun Bankiers geworden und halfen bei der Finanzierung des Spanischen Erbfolgekrieges, andere kamen als Kaufleute und Viehhändler. Abgesehen von gelegentlichen Ausbrüchen des Antisemitismus, nahmen sie einen geachteten und sicheren Platz in der bayerischen Gesellschaft ein, so schien es jedenfalls. Eine Reihe von Gesetzen aus den Jahren 1804 bis 1813, während der napoleonischen Herrschaft, erlaubte den Juden nun Zutritt zu staatlichen Schulen und zum Militär. Sie wurden zu gleichberechtigten Bürgern und erhielten das Recht, sich Familiennamen zuzulegen.
Das erste Mitglied der Familie, das den Namen Kissinger führte, war Abrahams Vater Meyer, der 1767 in Kleineibstadt das Licht der Welt erblickt hatte. Als junger Mann war er in den bekannten Kurort Bad Kissingen gezogen, nördlich von Würzburg. Damals lebten dort etwas mehr als 1000 Menschen, darunter 180 Juden. Später ließ er sich in Rödelsee nieder, wo er 1817 offiziell den Namen Meyer Kissinger annahm. Im darauffolgenden Jahr wurde sein Sohn Abraham geboren.2
Die Eltern: Louis Kissinger und Paula Stern. Verlobungsfoto von 1922.
Das Haus der Sterns in Leutershausen. Bis zur Flucht aus Deutschland verbrachte die Familie Kissinger hier regelmäßig ihre Sommerzeit.
Abraham war der einzige von Meyers zehn Nachkommen, der nicht bereits als Kind starb. Er wurde 81 Jahre alt und Patriarch einer Familie, der jene bereits erwähnten vier Söhne entsprangen, die seinem Wunsch folgten und Lehrer wurden; dazu noch vier Töchter und später 32 Enkelkinder. Alle waren orthodoxe Juden, zugleich aber eine solide mittelständische deutsche Familie, die tiefe Loyalität gegenüber einer Nation empfand, die sie gut behandelte.
David Kissinger, der jüngste von Abrahams Söhnen, wurde 1860 in Rödelsee geboren. Danach zog er nach Ermershausen und gründete dort eine kleine Schule. Zugleich wurde er Kantor an der dortigen Synagoge. Später unterrichtete er am Jüdischen Seminar in Würzburg. Wegen seiner stets korrekten Kleidung nannten ihn seine Freunde den »Sonntags-Kissinger« und unterschieden ihn damit von seinem Bruder Simon, der wegen seiner etwas nachlässigeren Kleidung als »Werktags-Kissinger« bekannt war.
David und seine Frau Linchen, genannt Lina, waren gebildete und äußerst belesene Leute, von jenem deutschen Typ, der damals seinen Kindern französische Namen gab. So geschah es auch bei ihrem ersten Sohn, der 1887 zur Welt kam und Louis genannt wurde. Als einziges von ihren sieben Kindern schlug Louis die Laufbahn eines Lehrers ein, doch anders als sein Vater entschied er sich für säkulare statt religiöse Schulen. Nach dem Studium an der Heidelberger Universität besuchte er die Lehrerakademie in Fürth, in der Nähe von Nürnberg.
Da Deutschland Lehrer brauchte, entband man Louis während des Ersten Weltkriegs von der Militärpflicht. Stattdessen trat er seinen Dienst an der privaten Heckmannschule an, wo Kinder des gehobenen Bürgertums ihre Ausbildung erhielten. Die Hälfte der Schüler kam aus jüdischen Familien, dies zeigt den Grad der jüdischen Assimilation in Fürth an, einer Stadt, die sich stets durch religiöse Toleranz ausgezeichnet hatte.
Fürth war im 14. Jahrhundert aufgeblüht, als man Juden den Zutritt nach Nürnberg verweigerte und diese sich in dem Dorf niedergelassen hatten, das unmittelbar vor den Mauern der befestigten Stadt lag. Händler, Handwerker und Metallarbeiter machten aus Fürth rasch ein florierendes Handelszentrum, zudem eines der wenigen permanenten Zentren jüdischer Kultur in Bayern. Im Jahre 1860 lebten in Fürth 14 000 Menschen, die Hälfte von ihnen waren Juden.
Im Zuge der industriellen Revolution gründeten viele der jüdischen Geschäftsleute Textil- und Spielzeugfabriken. Die erfolgreichsten von ihnen wurden zur jüdischen Aristokratie von Fürth, mit Familien wie den Nathans und den Fränkels an der Spitze. Ihre großen Villen aus Sandstein dominierten die Stadt, sie leisteten sich ein eigenes jüdisches Waisenhaus, eine Schule, ein Krankenhaus und ein Orchester. Um einen großen Platz der Stadt reihten sich insgesamt sieben Synagogen.
Louis Kissinger, der die Neuschulsynagoge besuchte – die orthodoxeste von allen –, gehörte nicht zur Welt der Fränkels und Nathans. Doch Lehrer war in Deutschland ein durchaus angesehener Stand, und Herr Kissinger war ein stolzes und geachtetes Mitglied der deutschen Mittelklasse. Seine politischen Ansichten waren konservativ, er liebte den Kaiser und trauerte ihm nach dessen Abdankung nach. Trotz seines tiefen Glaubens übte der Zionismus auf ihn keine Anziehung aus; er war Deutscher, patriotisch und loyal zugleich.
Als die kaiserliche Regierung die meisten Privatschulen schließen ließ, bedeutete dies auch für die Heckmannschule das Aus. Doch Louis fand eine neue Anstellung als Studienrat im staatlichen Schulsystem, zunächst an einer Grundschule für Mädchen und danach an einem Lyzeum, wo er Geografie unterrichtete. Dieses Lyzeum wurde bald darauf mit einer Handelsschule vereinigt.3
Louis Kissinger mit dem wenige Monate alten Sohn Heinz. Aufnahme vom Spätsommer 1923.
Paula Kissinger mit ihren Söhnen Heinz (r.) und Walter in Fürth. Aufnahme von 1927.
Louis Kissinger war äußerst stolz auf seinen Status eines Studienrates, der in der deutschen Gesellschaft durchaus etwas darstellte. Noch Jahre später, als er durch eine andere deutsche Regierung sein Lehramt verloren hatte und aus der Heimat geflohen war, sollte er seine Korrespondenz stets handschriftlich mit »Studienrat a. D.« unterzeichnen. Er war streng, aber beliebt. Seine Schülerinnen nannten ihn »der Goldige« und auch »Kissus«, was ihn fast noch mehr erfreute. Er hatte einen kleinen Bauch, trug einen kleinen Schnurrbart und zeichnete sich durch klare Worte und achtungsvolles Auftreten aus. »Er war der typische deutsche Schullehrer«, meint Jerry Bechhofer, ein Freund der Familie in Fürth und später in New York, »mit dem Auftreten und der Strenge eines Professors. Doch er konnte keiner Fliege etwas zuleide tun.«
Kurz nach seinem Dienstbeginn am Lyzeum berichtete der Direktor von einem Mädchen namens Paula Stern, das gerade die Schule abgeschlossen hatte. Er wusste, womit er die Aufmerksamkeit des neuen Lehrers wecken konnte: Er zeigte ihm das Abschlusszeugnis, dort waren genügend ausgezeichnete Noten, um Louis Kissinger zu beeindrucken. Doch diese Noten täuschten ein wenig. Anstelle der gelehrten Ernsthaftigkeit, die Louis auszeichnete, war Paula schlagfertig, witzig, erdverbunden und praktisch. Das ergab eine feine Mischung: Louis als der weise und etwas weltfremde Lehrer, Paula als die energische und sensible Frau, die die Entscheidungen traf.
Die Sterns lebten in Leutershausen, einem Dorf etwa 50 Kilometer östlich von Nürnberg. Paulas Urgroßvater hatte dort Anfang des 19. Jahrhunderts einen Viehhandel begründet. Großvater Bernhardt und Vater Falk Stern hatten die Firma zu einem bedeutenden Unternehmen ausgebaut.
Falk Stern, eine prominente Persönlichkeit sowohl in der jüdischen wie nichtjüdischen Gemeinde der Region, war wesentlich stärker assimiliert als die Kissingers. Sein imposantes Haus mit großem Hof und sorgsam gepflegtem Garten lag im Zentrum des Dorfes. Doch bei allem Reichtum blieb er ein einfacher Mann, der jeden Abend kurz nach neun zu Bett ging und wenig Interesse für Politik oder Schulfragen zeigte. Seine erste Frau Beppi Behr, gleichfalls aus einer Familie von Viehhändlern stammend, starb jung. Ihr einziges Kind Paula war 1901 zur Welt gekommen. Der Vater heiratete danach erneut, doch weitere Kinder stellten sich nicht ein.
Als man Paula nach Fürth auf die Schule schickte, wohnte sie dort bei ihrer Tante Berta Fleischmann, Ehefrau eines der koscheren Metzger der Stadt. Berta war es auch, die die zarten Bande beförderte, die sich zu Louis Kissinger entwickelten, obwohl dieser 35 Jahre alt war und Paula erst 21. Auch die Sterns waren einverstanden. Als das Paar 1922 heiratete, erhielt die Tochter eine Mitgift, die ausreichte, um eine Fünfzimmerwohnung in einem großen Sandsteinhaus in der Mathildenstraße zu erwerben, inmitten des jüdischen Viertels von Fürth. Neun Monate später, am 27. Mai 1923, kam dort das erste Kind der Kissingers zur Welt.4
Heinz Alfred Kissinger. Der erste Vorname wurde von Paula gewählt. Der zweite war – ebenso wie Arno, Name des Onkels – eine moderne Eindeutschung des alten Abraham. Vom Vater erbte Heinz den Spitznamen »Kissus«. Als er 15 Jahre später nach Amerika kam, sollte er dort als Henry bekannt werden.
Der junge Heinz
Zu der Zeit, als Heinz5 geboren wurde, war die jüdische Bevölkerung von Fürth auf 3000 Menschen gesunken. Und eine neue Periode der Repression kündigte sich an: Als Reaktion auf die Schwächung, die Deutschland im Gefolge des Ersten Weltkriegs erlitten hatte, erhob ein Nationalismus sein Haupt, der die Reinheit der teutonischen, der arischen Wurzeln deutscher Kultur zelebrierte. Juden behandelte man im steigenden Maß als Fremde. So wurden sie unter anderem von der Teilnahme an öffentlichen Zusammenkünften ausgeschlossen – bis hin zum Besuch von Fußballspielen.
Dessen ungeachtet entwickelte sich Heinz zu einem eifrigen Anhänger der Fürther Kleeblatt-Elf, jener Mannschaft, die zuletzt 1914 die deutsche Fußballmeisterschaft gewonnen hatte. Er missachtete das Besuchsverbot bei ihren Spielen, selbst als die Eltern ihm befahlen, der Anordnung Folge zu leisten. Heimlich ging er ins Stadion, manchmal zusammen mit seinem jüngeren Bruder Walter oder einem Freund, und gab vor, kein Jude zu sein. »Alles, was wir dabei riskierten, waren Prügel«, erinnerte er sich später.
Das passierte des Öfteren. Einmal wurden er und Walter während eines Spiels von gleichaltrigen Jugendlichen entdeckt und übel zugerichtet. Die Eltern sollten es nicht erfahren, daher vertrauten sich die beiden dem Dienstmädchen an, das sie entsprechend säuberte und das Geheimnis bewahrte.
Kissingers Liebe zum Fußball übertraf seine Spielfertigkeit, nicht aber seine Begeisterung, es zu versuchen. »Er war einer der Kleinsten und Schmächtigsten in unserer Gruppe«, sagt Paul Stiefel, ein Fürther Freund, der später nach Chicago emigrierte. Was Kissinger an Kraft fehlte, machte er durch Finesse wett. Ein Jahr lang war er sogar Kapitän seiner Klassenmannschaft, wozu ihm seine Führungsqualitäten mehr verholfen hatten als seine Beweglichkeit.
Der achtjährige Kissinger. Aufnahme von 1931.
Die Juden besaßen in Fürth einen eigenen Sportklub. Dazu Henry Gitterman, ein Klassenkamerad Kissingers: »Mein Vater spielte einmal sogar in der Stadtmannschaft. Als dann die Juden überall vom Sportbetrieb ausgeschlossen wurden, bildeten sie eigene Mannschaften und einen eigenen jüdischen Sportklub.« Zum Fußballfeld wurde eine staubige Freifläche mit zwei Torpfosten, ein altes Lagerhaus mit durchlöchertem Dach diente als Turnhalle – all das Zufluchtsstätten vor den herumziehenden jugendlichen Nazibanden und einer immer bedrohlicher werdenden Welt.6
Der junge Kissinger konnte sehr ehrgeizig sein. Auf dem gepflasterten Hof hinter dem Elternhaus spielte er manchmal Fußball mit John Heiman, einem Cousin, der für fünf Jahre von den Kissingers aufgenommen worden war. »Wenn es Zeit war, nach oben zu gehen«, erinnert sich Heiman, »dann war das nur möglich, wenn er führte. Wenn er jedoch am Verlieren war, musste so lange weitergespielt werden, bis er siegte.«
Besser war Kissinger im Völkerball, einem Spiel zweier Mannschaften von gewöhnlich fünf Leuten, bei dem es darum geht, die gegnerischen Spieler mit dem Ball zu treffen. Besonders gern nahm er den Platz hinter der Linie des Gegners ein, wo die Bälle der eigenen Mannschaft aufgefangen werden müssen. »Das war eines der wenigen Spiele, bei denen ich wirklich gut war«, sollte er später sagen.
Doch Kissinger zeichnete sich eher als Lesender aus denn als Athlet. Wie sein Vater war er von gelehrter Ernsthaftigkeit. »Ein Bücherwurm, introvertiert«, erinnert sich der Bruder Walter. Und Tzipora Jochsberger, eine Kindheitsfreundin, sagt: »Ich erinnere mich an Heinz nur mit einem Buch unter dem Arm, immer.«
Seine Mutter machte sich gar Sorgen, dass die Bücher zum Fluchtpunkt vor einer ungastlichen Welt geworden seien. »Er zog sich zurück«, erinnerte sie sich. »Manchmal ging er nicht genügend nach draußen, weil er sich völlig in seinen Büchern verloren hatte.«
Heinz und der um ein Jahr jüngere Walter sahen einander sehr ähnlich. Beide waren mager und hatten krauses Haar, eine hohe Stirn sowie die großen Ohren ihres Vaters. Doch in ihren Persönlichkeiten unterschieden sie sich stark. Heinz war schüchtern, gehorsam, einzelgängerisch veranlagt, etwas unsicher, ernst und nachdenklich wie sein Vater. Walter dagegen boshaft, gesellig, lebendig, praktisch, sportlich besser und erdverbunden wie seine Mutter. Heinz wurde trotz seines Einzelgängertums zu einer Führungspersönlichkeit, weil seine Freunde seine Intelligenz anerkannten. Walter hingegen war gewandter im Umgang, mehr Macher und Anstifter als Anführer. »Henry war stets der Denker«, sagte sein Vater einmal, »er war eher gehemmt. Wally war der stärkere Macher, der Extrovertiertere von beiden.«7
Es war Louis Kissingers sehnlichster Wunsch, dass seine beiden Söhne auf das staatliche Gymnasium gehen sollten. Nach den Jahren auf einer jüdischen Grundschule hatte Heinz auch gute Chancen dazu. Als er sich jedoch beim Gymnasium bewarb, war die Welle des Antisemitismus bereits angeschwollen. Man lehnte ihn als Juden ab.8 Die Israelische Realschule, die er nun stattdessen besuchte, war vom Niveau her keineswegs schlechter. Der Schwerpunkt des Unterrichts lag auf Geschichte (deutsche wie jüdische), Fremdsprachen (Kissinger lernte Englisch) und Literatur. Die Schule war klein, etwa 30 Kinder pro Klassenstufe, halb Jungen, halb Mädchen. Dies erhöhte sich bald auf 50 Schüler, als Juden keine staatlichen Schulen mehr besuchen durften und viele von ihnen täglich aus Nürnberg und Fürth kamen. Religion wurde an der Schule ernst genommen. Täglich verbrachten Kissinger und seine Freunde zwei Stunden mit dem Studium der Bibel und des Talmud.
Seinen Vater betrachtete Kissinger zärtlich, doch zugleich ein wenig distanziert. »Er war die edelste Person, die man sich vorstellen konnte«, sagte er später, »außerordentlich edel. Für ihn existierten Gut und Böse nicht, weil er sich das Böse einfach nicht vorstellen konnte. Er konnte sich nicht vorstellen, was die Nazis eigentlich bedeuteten. Seine Edelmütigkeit war einmalig, nicht von jener Art Servilität, die man als Last empfindet.«
Louis Kissinger war ein kultivierter Mann mit großer Liebe zu Literatur und Musik. Er besaß eine umfangreiche Schallplattensammlung sowie ein Pianino, beides benutzte er voller Verve. (»Unglücklicherweise war Mahler sein Lieblingskomponist«, so Paula.) Weise und mitfühlend, war er genau jene Art Mensch, die von Nachbarn gern um Rat gefragt wird. »Er stellte nie den Moralisten heraus«, sagt sein Sohn, »doch sein eigenes Verhalten war so außergewöhnlich, dass es wie eine Lektion wirkte.«
Seine Kinder waren allerdings zurückhaltender beim Vortragen ihrer Probleme. »Er konnte nicht verstehen, dass Kinder Probleme haben«, erinnert sich Kissinger. »Er meinte nicht, dass sie wirklich Probleme haben könnten, ebenso wenig war er in der Lage, sich etwa in die Art von Problemen hineinzuversetzen, wie sie vor einem Zehnjährigen standen.«
Paula Kissinger hingegen besaß ein ausgesprochenes Geschick für die Lösung von Familienkrisen. »Mein Vater schätzte sich glücklich, eine erdverbundene Frau zu haben, die alle Entscheidungen traf«, sagt Kissinger. »Sie belastete ihren Verstand nicht mit großen Ideen oder letzten Bedeutungen. Ihr ging es mehr um die täglichen Notwendigkeiten.«
Paula verfügte über scharfe Augen und einen wachen Instinkt. Hinter ihrem Lächeln und unaffektierten Charme verbarg sich Unnachgiebigkeit, wenn es um den Schutz ihrer Familie ging. Weniger nachdenklich als ihr Mann (oder ihr Sohn), auch weniger intellektuell, verfügte sie über das stärkere Gefühl für sich selbst sowie für das, was die Leute in ihrer Umgebung dachten.
Als Kind gefiel es Kissinger besser, nur einen engen Freund zu haben, statt Teil einer ganzen Gruppe zu sein. Sein unzertrennlicher Gefährte in Fürth wurde Heinz Lion, später Biochemiker in Israel, wo er seinen Vornamen in Menachem änderte. Die beiden verbrachten fast jeden Nachmittag und jedes Wochenende gemeinsam. An den Samstagen lehrte Lions Vater den Jungs die Thora und unternahm danach mit ihnen Wanderungen.
Mit Lion und dessen Vater pflegte Kissinger jene Probleme zu diskutieren, die er dem eigenen Vater nicht vortragen konnte. »Sie wohnten ganz in unserer Nähe«, erinnert sich Lion, »und er kam immer mit seinem Fahrrad bei uns vorbei. Mir schien, dass er ein Problem mit seinem Vater hatte. Er hatte Angst vor ihm, denn Louis Kissinger war ein sehr pedantischer Mensch, der regelmäßig die Hausaufgaben überprüfte. Mehr als einmal sagte mir Heinz, er könne mit seinem Vater über nichts sprechen, besonders nicht über Mädchen.«
An den Freitagabenden gingen Kissinger und Lion gewöhnlich mit ihren Freundinnen im Park spazieren, im Winter traf man sich zum Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen See. An einem solchen Sabbatabend kamen die beiden sehr spät nach Hause. »Es gehörte zu dieser Zeit in Deutschland zu den heiligsten Betragensnormen, dass man pünktlich nach Hause kam und niemals nach Einbruch der Dunkelheit«, sagte Lions Mutter später. »So zog also mein Mann seinen Gürtel aus der Hose und verabreichte beiden eine Tracht Prügel.« Ziemlich ungerecht bezichtigte Herr Lion Kissinger schlechten Einflusses auf seinen Sohn und verbot diesem eine Woche lang jegliches Treffen mit Heinz. Etwas später schickten Lions Eltern ihren Sohn für sechs Wochen in die Tschechoslowakei zu einem Sommerlager, damit er von Kissinger getrennt war.9
Als Kissinger sieben Jahre alt war, zog sein Cousin John Heiman ein, da es in seinem Heimatdorf keine jüdische Schule gab. Er schlief mit Heinz und Walter in einem Zimmer und wurde ein Teil der Familie. »Die ersten Tage hatte ich starkes Heimweh«, erinnerte sich Heiman, der später in Chicago Werkzeug für Hobbyhandwerker herstellte. »Mir ging es ziemlich schlecht.« Eines Abends fand ihn Paula in Tränen aufgelöst. Er wolle eine Schülermütze, schluchzte er, eine blaue, wie sie die anderen Jungs auf der Realschule trugen. »Am nächsten Morgen wachte ich auf, und die Mütze lag da. So war Paula.«10
Einen besonders magischen Ort gab es für den jungen Kissinger: den mütterlichen Familiensitz in Leutershausen, wo die Kissingers den Sommer verbrachten. Das Stern’sche Haus war stattlich und sicher, es besaß einen großen und anheimelnden Innenhof, wo Heinz den Hühnern nachjagte und, als er älter wurde, mit seinen Freunden Völkerball spielte.
Falk Stern beobachtete dann mit wettergegerbtem Gesicht von seinem Fenster aus die spielenden Jungen, während seine Frau, Paulas Stiefmutter, mit umgebundener Schürze geschäftig hin und her eilte. Sie war eine äußerst eigene Person. Jeden Mittwoch säuberte sie das ganze Haus, dann waren die Kinder bis zum Ende des Sabbats (am Sonntagabend) aus dem Wohnzimmer verbannt. Die jüdische Gemeinde von Leutershausen war klein und umfasste nur an die 20 Familien. Anders als die Kissingers in Fürth hatten die Sterns daher auch viele nichtjüdische Freunde.
Tzipora Jochsberger gehörte in Leutershausen zu den engsten Freunden des jungen Kissinger. Ihre Familie besaß einen großen Garten, wo die Kinder manchmal Zirkus spielten. Auf herbeigeholten Leitern und Matten probierte man akrobatische Kunststücke. »Sogar Henry interessierte sich eine Zeit dafür«, erinnert sie sich. »Gewöhnlich war er viel zu ernst für solche Dinge.«
Als Vierzehnjährige wurde Tzipora zusammen mit den anderen jüdischen Kindern von der staatlichen Schule verwiesen. Ihre Eltern, wiewohl Reformjuden, schickten sie daraufhin auf eine orthodoxe Schule. Und im Sommer kam sie, sehr zum Verdruss ihrer Eltern, von dort als orthodoxe Jüdin zurück. »Meine Eltern waren nicht sehr religiös«, sagt sie, »und sie konnten meine Bekehrung nicht verstehen. Sie waren äußerst aufgebracht.« Da sie zugleich beschlossen hatte, koscher zu leben, konnte Tzipora nicht einmal gemeinsam mit der Familie essen. Der Einzige, der ihren Schritt verstehen würde, war – so fühlte sie – der ebenfalls orthodoxe Kissinger. Beide unternahmen lange Spaziergänge, um alles zu besprechen. Der Glaube sei wichtig, sagte er ihr dabei, und sie solle so lange orthodox bleiben, wie sie das für sich selbst als richtig empfinde. »Henry schien den Wechsel zu verstehen. Ich habe ihm immer gern zugehört, wenn er Dinge erläuterte, denn er war so klug dabei.«
Jeden Morgen vor der Schule besuchte Kissinger zusammen mit John Heiman und Heinz Lion die Synagoge. An den Samstagen las Lions Vater den dreien aus der Thora vor und diskutierte danach die Stelle. Lions Mutter zufolge ging der junge Kissinger »vollkommen in der Atmosphäre des Glaubens auf« und »betete voller Hingabe«.
Kissinger hatte bereits als Kind eine sonore Stimme. Beim Fest seiner Bar-Mizwa sang er die Passagen aus der Thora mit solcher Schönheit, dass alle Beteiligten noch nach Jahren daran zurückdachten. Rabbi Leo Breslauer leitete die Zeremonie, er ging später nach New York und sollte dort Kissingers erste Trauung vornehmen. Auf dem Familienfest im Anschluss an die Bar-Mizwa trug Paula ein Gedicht vor, das sie extra für diese Gelegenheit geschrieben hatte.11
Nach dem Abschluss der Schule in Fürth begann Kissinger ein Studium am Jüdischen Seminar zu Würzburg. Seine Zeit dort verlief ziemlich angenehm: Leben im Internat, ausgedehnte Lektüre, um den Geist von den Bedrohungen der Außenwelt abzulenken, dazu tägliche Besuche bei seinem weisen Großvater David. Kissinger war nicht etwa nach Würzburg gegangen, um jüdischer Lehrer zu werden – längst war klar, dass es in Deutschland keine Zukunft für jüdische Lehrer, ja für Juden überhaupt gab. Er ging nach Würzburg mangels besserer Möglichkeiten in diesem Moment. Das geschah zu einer Zeit, da die Familie Kissinger, an erster Stelle Paula, gerade dabei war, einen schmerzlichen Entschluss zu fassen.
Eine zerstörte Welt
1923 – in Kissingers Geburtsjahr – hatte Julius Streicher in Nürnberg, wo er den Ortsverband der NSDAP leitete, das militant antisemitische Wochenblatt Der Stürmer gegründet. Streichers Hass auf die Juden war nicht nur fanatisch, sondern sadistisch. Er forderte ihre totale Ausrottung und bezeichnete sie als »Krankheitserreger« und »Verunreiniger des Volkes«.
Sein Blatt, das wenige Jahre später bereits eine Auflage von 500 000 Exemplaren erreichen sollte, schürte in Fürth und Leutershausen das Feuer des Antisemitismus. Paula Kissinger erinnerte sich, wie die Atmosphäre ihrer Sommeraufenthalte in Leutershausen plötzlich verändert war. »Unter unseren Freunden waren auch einige Nichtjuden gewesen, doch nachdem Streichers Blatt erschien, fanden wir uns isoliert. Einige Menschen hielten noch zu uns, doch es waren sehr wenige. Die Jungs hatten kaum noch Spielgefährten.«
Streicher bereitete den Weg für die Nürnberger Rassengesetze von 1935. Damit wurde den Juden die deutsche Staatsangehörigkeit abgesprochen. Ehen zwischen Juden und deutschen Christen waren fortan verboten, ebenso durften Juden nicht mehr an deutschen staatlichen Schulen unterrichten. Die Ausübung zahlreicher anderer Berufe war ihnen ebenso untersagt.
Auch Louis Kissinger wurde plötzlich klargemacht, dass er keine wahren Deutschen mehr unterrichten durfte. Er verlor seine Stellung, auf die er so stolz war. Eine Zeit lang arbeitete er nun an der Neugründung einer jüdischen Berufsschule in Fürth mit und unterrichtete Buchhaltung. Doch er war ein gebrochener Mann, gedemütigt und erniedrigt durch einen Hass, den seine freundliche Seele nicht verstehen konnte.
Henry Kissinger sollte in späteren Jahren sein jüdisches Erbe stets herunterspielen. Wenn er über seine Kindheit sprach (was nur selten und zögernd geschah), bezeichnete er sie als eine »typisch kleinbürgerlich deutsche« und fügte höchstens hinzu, natürlich sei sie »deutsch-jüdisch« verlaufen. Seine Familie sei assimiliert gewesen, hieß es dann, und nicht alle Fürther Juden hätten sich abgesondert und eine besondere Gemeinschaft gebildet.
Auch das Trauma seiner Kindheit verkleinerte er, jene Verfolgungen, Prügel und täglichen Konfrontationen mit einem virulenten Antisemitismus, die ihm das Gefühl eines Ausgestoßenen vermittelten. Einem Reporter der Fürther Nachrichten sagte er 1958: »Es scheint so, dass mein Leben in Fürth verlief, ohne bleibende Eindrücke zu hinterlassen.« Ähnlich äußerte er sich auch in vielen anderen Interviews. »Dieser Teil meiner Kindheit kann nicht als Schlüssel für irgendetwas bezeichnet werden«, meinte er etwa 1971, »ich lebte nicht mit dem Bewusstsein, unglücklich zu sein. Was vorging, nahm ich eigentlich gar nicht wahr. So ernst erscheinen Kindern diese Dinge nicht.«12
Kissingers Freunde aus jenen Jahren bezeichnen solche Äußerungen als Akt der Verleugnung und Selbsttäuschung. Einige von ihnen sehen in dieser Flucht vor der Erinnerung einen Schlüssel für seine legendäre Unsicherheit. Aus dem Kind, das vorgeben musste, ein anderer zu sein, damit es Fußballspiele besuchen konnte, wurde ein für Ränkespiel und Selbsttäuschung empfänglicher Erwachsener, immer auf der Jagd nach Anerkennung bei politischen und sozialen Gönnern – so meinen sie.
Paula Kissinger sprach wesentlich offener über das Trauma der Nazi-Ära. »Unsere Kinder durften nicht mit den anderen spielen, sie blieben im Garten unter sich. Sie liebten den Fußball, vor allem Henry, doch die Spiele in Nürnberg waren für sie tabu.« Besonders war ihr die klägliche Furcht und Verwirrung der Kinder in Erinnerung, wenn die Nazijugend aufmarschierte und die Juden verhöhnte. »Die Hitlerjugend, der fast alle Kinder in Fürth angehörten, marschierte singend und in Uniform durch die Straßen. Henry und sein Bruder beobachteten das und konnten nicht verstehen, warum sie kein Recht besaßen, das zu tun, was die anderen taten.13
»Der Antisemitismus gehörte zu Bayern, er hat nicht erst mit Hitler begonnen«, sagt Menachem Lion. »Wir hatten, wenn überhaupt, nur sehr wenig Kontakt zu nichtjüdischen Kindern. Wenn wir sie die Straße entlangkommen sahen, hatten wir bereits Angst. Was wir erlebten, kann sich heute kaum noch jemand vorstellen, doch damals nahmen wir das als gegeben hin. Es gehörte zum Leben wie die Luft, die wir atmeten.«
Ähnlich traumatische Erinnerungen haben auch andere Freunde aus der Kindheit. Werner Gundelfinger: »Wir durften nicht ins Schwimmbad, zum Tanz oder ins Restaurant. Wir konnten nirgendwo hingehen, ohne das Schild ›Für Juden verboten‹ zu erblicken. Das sind Dinge, die für immer im Unterbewusstsein haften.« Frank Harris: »Wir alle wuchsen mit einem gewissen Minderwertigkeitsgefühl auf.« Otto Pretsfelder: »Man kann nicht aufwachsen, wie wir das mussten, und unberührt bleiben. Jeden Tag gab es Schmierereien an den Häuserwänden, antisemitische Äußerungen, und man wurde mit schmutzigen Namen belegt.«14
Am schwersten war das Anwachsen des Nazismus für Paula Kissinger zu ertragen. Ihr Ehemann Louis war verwirrt, beinahe gelähmt, sprachlos. Paula aber sah mit wachem Sinn, was da vorging, und es schmerzte sie zutiefst. Sie war die Gesellige in der Familie, die lebhafte Frau mit vielen nichtjüdischen Freunden, die es im Sommer liebte, täglich im Leutershausener Freibad zu schwimmen. Als ihre Freunde sie zu meiden begannen, als man den Juden das Betreten des Bades untersagte, wurde ihr klar, dass es für ihre Familie in Deutschland keine Zukunft gab.
»Es war meine Entscheidung«, sagte sie später, »und ich traf sie wegen der Kinder. Ich wusste, dass es für sie kein Leben sein würde, wenn wir dablieben.« Eine Cousine von ihr war bereits vor Jahren in die USA ausgewandert und lebte in Washington Heights, einer Siedlung in der Upper West Side von Manhattan, New York. Obwohl sich die beiden nie gesehen hatten, schrieb Paula ihr 1935 – unmittelbar nach Verabschiedung der Nürnberger Gesetze – und fragte an, ob Heinz und Walter wohl bei ihr leben könnten. Nein, lautete die Antwort der Cousine, die Kinder allein nicht, sondern die ganze Familie Kissinger solle emigrieren.
Paula hing sehr an ihrem Vater, der später an Krebs sterben sollte. Sie wollte ihn nicht verlassen. Doch im Frühjahr 1935 wurde ihr klar, dass keine andere Wahl blieb. Die Cousine hatte bereits die nötigen Affidavits für das Einreisevisum in die USA geschickt, und die Papiere für die Emigration aus Deutschland lagen vollständig vor.
Ein letztes Mal fuhr die Familie Kissinger nach Leutershausen, um Paulas Vater und die Stiefmutter zu besuchen. »Ich hatte meinen Vater niemals zuvor weinen sehen«, erinnert sich Kissinger, »doch jetzt, als er seinem Schwiegervater Lebewohl sagte, flossen die Tränen. Das hat mich mehr als alles andere erschüttert. Urplötzlich wurde mir klar, dass wir in große und unwiderrufliche Geschehnisse verwickelt waren. Zum ersten Mal erlebte ich, dass mein Vater hilflos war.«
Der junge Kissinger war bereit zur Abreise. Die Familie Lion war im März nach Palästina emigriert. Eine Woche vor der Abfahrt hatten sie ihre Wohnung verkauft, Heinz Lion wohnte diese letzten Tage bei den Kissingers. Die beiden Jungen sprachen über ihre Trennung, über das Verlassen Deutschlands und fragten sich, ob sie wohl jemals zurückkehren würden. Beim Abschied sagte Lions Vater zum jungen Heinz Kissinger: »Eines Tages wirst du in deinen Geburtsort zurückkommen, und du wirst keinen Stein mehr auf dem anderen vorfinden.« Nachdem die Lions abgereist waren, gab es für Kissingers kaum noch einen Grund zum Bleiben. »Damals erlebte er zum ersten Mal wirkliche Einsamkeit«, erinnerte sich seine Mutter.
Am 20. August 1938, knapp drei Monate vor der Kristallnacht, da ein aufgebrachter Mob ihre Synagoge und die meisten anderen jüdischen Einrichtungen in Deutschland zerstören sollte, verließen die Kissingers Fürth und reisten via London – wo sie zwei Wochen bei Verwandten Station machten – nach Amerika. Henry war 15 Jahre alt, sein Bruder Walter 14, sein Vater 51 und seine Mutter 37 Jahre.
Das Packen war eine leichte Aufgabe: Obwohl sie die nötigen Gebühren für die Mitnahme ihrer Habe aus Deutschland bezahlt hatten, durften sie nur einige Möbel mitnehmen und so viel an persönlichen Dingen, wie in einen großen Reisekoffer passte. Louis musste seine Bücher zurücklassen, und nur eine kleine Summe Taschengeld war ihnen mitzunehmen erlaubt.
Kissinger sollte zurückkehren, sowohl als Soldat wie als Staatsmann. Im Dezember 1975 lud die Stadt Fürth den Außenminister der USA zusammen mit seinen Eltern zur Entgegennahme der Goldenen Medaille für hervorragende Bürger der Stadt ein. Im Beisein des deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher überreichte Bürgermeister Kurt Scherzer die Auszeichnung. Ein Chor der ehemaligen Schule begleitete die Zeremonie – jener Schule, die einst die Kissinger-Jungs ausgeschlossen hatte. Die Dankesworte des Geehrten waren kurz und vermieden jede Erwähnung der Schrecken, die die Familie 1938 zur Flucht gezwungen hatten. Als man ihn zur Besichtigung jener Stadtteile einlud, wo er einst Fußball gespielt, die Thora gelernt und Prügel der Hitlerjugend eingesteckt hatte, lehnte Kissinger höflich ab.
»Meine Erinnerungen an Fürth sind nicht gerade glorreich«, sagte er später zu Journalisten, »ich bin hauptsächlich wegen meiner Eltern hergekommen. Sie haben die Zuneigung zu dieser Stadt niemals aufgegeben.« Der Vater schien dies zu bestätigen. Während eines Essens mit den wenigen noch lebenden Fürther Freunden zitierte er Euripides und sagte: »An diesem Tag vergessen wir alle schlimmen Erinnerungen.« Die Mutter allerdings vergaß nichts. »Ich war an diesem Tag bis ins Herz getroffen, doch ich sagte nichts«, erinnerte sie sich. »Ich wusste nämlich in meinem Herzen, dass sie uns wie alle anderen vergast hätten, wenn wir dageblieben wären.«15
An der wieder errichteten Synagoge, die die Kissingers einst besucht hatten, befindet sich heute eine Gedenktafel mit folgender Inschrift: »Am 22. März 1942 wurden 33 Waisenkinder als letzte Bewohner dieses Gebäudes zusammen mit ihrem Lehrer Dr. Isaak Hallermann nach Izbica in den Tod geschickt.«
Bei ihrem Besuch im Jahre 1975 gingen die Kissingers auch zum Grab von Falk Stern. Er hatte sich glücklich schätzen können, denn er starb noch vor Beginn des Holocaust in seinem Vaterhaus. Wenigstens 13 enge Verwandte Kissingers aber wurden in die Gaskammern geschickt oder kamen in Konzentrationslagern um, darunter auch Sterns Frau.
Ein Grund für ihr Sterben war nach Kissingers Meinung die Tatsache, dass sie sich alle als loyale deutsche Bürger betrachtet hatten. Sowohl Großvater David als auch Großonkel Simon vertraten die Ansicht, die Familie müsse die Nazi-Ära überstehen, diese werde vorübergehen. Erst nach der Kristallnacht emigrierte auch David und ging zu seinem Sohn Arno (Louis Kissingers Bruder) nach Schweden. Simon hingegen weigerte sich auch nach der Kristallnacht, Deutschland mit seiner Familie zu verlassen. Hier sei man stets gut zu den Juden gewesen, meinte er. Deshalb müsse man jetzt im Land bleiben und die weniger gute Phase durchstehen. Simon wurde in einem deutschen Konzentrationslager ermordet, ebenso seine Söhne Ferdinand und Julius, die wie ihr Vater und ihre Onkel Lehrer gewesen waren. Alle drei Tanten Kissingers (die Schwestern des Vaters) fielen dem Holocaust zum Opfer: Ida mit ihrem Gatten Siegbert Friedmann und einem Kind; Sarah mit ihrem Gatten Max Blattner und der Tochter Selma; Fanny mit ihrem Gatten Jacob Rau und dem Sohn Norbert. Fannys Tochter Lina Rau, die einige Zeit bei den Kissingers in Kost gewesen war, konnte nach New York fliehen. »Meine Eltern sagten Hitler keine lange Dauer voraus«, erinnert sie sich, »niemand tat das. Wir dachten, es würde vorübergehen.«
Das Erbe einer verlorenen Kindheit
Kissinger sprach über den Holocaust selten anders als mit der Betonung, dieser habe seiner Persönlichkeit keine bleibenden Narben zugefügt: »Er bedeutete kein lebenslanges Trauma, aber er hat mich natürlich beeinflusst. Indem ich im Totalitarismus gelebt habe, weiß ich, was das bedeutet.« Einmal allerdings brach der Zorn über das Geschehene aus ihm heraus. Während eines frühen Besuches in Deutschland als Sicherheitsberater der USA schlug Bonn vor, er könne sich doch bei dieser Gelegenheit mit einigen alten Verwandten treffen. »Was zum Teufel denken die sich?«, donnerte er los. »Aus meinen Verwandten hat man Seife gemacht.«16
Ungeachtet aller Verdrängung haben die Gräueltaten der Nazis bei Kissinger bleibende Eindrücke hinterlassen. »Er ist ein starker Mann«, sagt Fritz Kraemer, ein nichtjüdischer deutscher Emigrant, der in der US-Army Kissingers Mentor wurde, »dennoch gelang es den Nazis, seine Seele zu beschädigen. In den prägenden Jahren seiner Jugend sah er sich mit den Schrecken der heraufziehenden neuen Welt konfrontiert, musste erleben, wie man aus dem geliebten Vater eine hilflose Maus machte.« Aus diesen Erfahrungen – so Kraemer – resultieren die wichtigsten Züge seiner Persönlichkeit. »Deshalb suchte er Ordnung, deshalb war er hungrig nach Anerkennung, auch wenn dies bedeutete, dass er Leuten gefällig sein musste, die er als intellektuell weit unter ihm stehend einschätzte.«17
Der Wunsch nach Anerkennung, die Tendenz zu Misstrauen und Unsicherheit – das waren verständliche Reaktionen auf eine Kindheit im Angesicht des vielleicht grausamsten Kapitels der Menschheitsgeschichte. Kissingers Wunsch nach sozialer und politischer Anerkennung – und sein Sehnen danach, gemocht zu werden – war ungewöhnlich stark ausgeprägt, so stark, dass er dafür zeitweilig gegen seine Überzeugung Kompromisse einging.18
Eine seiner Unsicherheiten als Erwachsener bestand in dem Gefühl (das er manchmal mit Galgenhumor halb einräumte), es könne ihm nur schaden, wenn man ihn zu stark mit seiner Religion identifiziere. Keineswegs rein scherzhaft grollte er, zu viele Berichte über seinen familiären Hintergrund könnten »noch den letzten Antisemiten aus dem Gebüsch locken« und zu Angriffen gegen ihn führen.
Für Kissinger hatte der Holocaust die Verbindung zwischen Gottes Willen und dem Verlauf der Geschichte zerstört – ein zentraler Grundsatz des jüdischen Glaubens, zugleich sein wichtigster Beitrag zur westlichen Philosophie. Für gläubige Juden erklärt sich die Bedeutung der Geschichte aus ihrer untrennbaren Verbindung mit dem Willen Gottes und der göttlichen Gerechtigkeit. Nach dem Erlebnis der Nazigräuel sollte Kissinger aufhören, praktizierender Jude zu sein; als junger Student in Harvard sollte er auf die Suche nach alternativen Wegen gehen, um herauszufinden, was Geschichte bedeutet.19
Es kann nicht überraschen, dass die Erfahrungen der Kindheit bei Kissinger auch ein tiefes Misstrauen gegenüber anderen Menschen entstehen ließen. Oft machte er in bekannt selbstironischer Weise Scherze über seine »berühmte Paranoia« und die Überzeugung, dass ständig Verschwörungen gegen ihn im Gange seien. Henry Stimson, ein anderer bekannter amerikanischer Politiker, lebte nach der in Yale erfahrenen Maxime: Der einzige Weg, um das Vertrauen eines Menschen zu gewinnen, besteht darin, ihm selbst zu vertrauen. Kissinger hielt es dagegen eher wie Nixon: Er entwickelte gegen Kollegen wie Außenstehende gleichermaßen instinktives Misstrauen. Stimson lehnte Bespitzelung mit den Worten »Gentlemen lesen keine fremde Post« ab. Nixon und Kissinger ließen sogar das Telefon ihrer engsten Mitarbeiter abhören.
Ein anderes Erbe aus Kissingers Kindheit unter den Nazis war, dass er sich im späteren Leben niemals irgendein Zeichen von Schwäche anmerken ließ – eine Maxime, die sowohl für ihn persönlich galt wie auch für seine Außenpolitik. Kissingers Vater, den er zutiefst liebte, hatte sich durch Güte und ein edelmütiges Herz ausgezeichnet. Doch diese Werte hatten ihn angesichts der Nazigräuel eher schwach erscheinen lassen. Als Kissinger älter wurde, wandte er sich wiederholt starken, oft überstarken Gönnern mit ausgeprägter Persönlichkeit zu: in der Armee dem ungestümen und von sich selbst überzeugten Preußen Fritz Kraemer, an der Universität Harvard dem großartigen Professor William »Wild Bill« Elliott, später dann Nelson Rockefeller und Richard Nixon.
Hinzu kam, dass Kissinger – der die Kindheit als Ausgestoßener im eigenen Land verbracht hatte – zunehmend vom Wunsch nach Anerkennung getrieben wurde. Was viele Menschen als Hinterlist ansahen, war doch oft nur Ergebnis von Kissingers Versuchen, bei andersdenkenden Gruppen Akzeptanz zu finden. Während des Vietnamkrieges versuchte er beispielsweise blauäugige Harvard-Intellektuelle davon zu überzeugen, dass er immer noch einer der ihren war, während er gleichzeitig Nixon mit scharfmacherischen Ratschlägen zu beeindrucken suchte. Als ihn die amerikanischen Rechten wegen der Entspannungspolitik attackierten, versuchte er sich mit ihnen zu arrangieren – und machte gleichzeitig gegenüber seinen intellektuellen Freunden abschätzige Bemerkungen über Reagan und dessen prominente Anhänger. Sein langjähriger Freund, der Historiker Arthur Schlesinger jr., fasst diesen Charakterzug in die Worte: »Das ist das typische Streben des Immigranten nach Anerkennung.«
Auch sein philosophischer Pessimismus war ein Erbe aus der Kindheit. Seine Weltsicht war düster, überzogen mit einem Gefühl von Tragödie. Er schrieb einmal: »Die Amerikaner, die niemals Schlimmes erlitten haben, können nur schwer eine Politik verstehen, welche von der Vorahnung einer Katastrophe ausgeht.« Obwohl er Spenglers These von der Unvermeidbarkeit des historischen Verfalls ablehnte, glaubte er doch daran, dass die Politiker ständig gegen die natürliche Tendenz zu internationaler Destabilisierung kämpfen müssten.
Die Erfahrungen mit den Nazis hätten für Kissinger zwei verschiedene Wege der Außenpolitik möglich machen können: einen idealistischen, moralischen Weg zum Schutz der Rechte der Menschen oder einen realistischen, realpolitischen Weg zur Aufrechterhaltung der Ordnung durch ein Gleichgewicht der Macht und die Bereitschaft, Gewalt als Mittel der Diplomatie einzusetzen. Kissinger sollte sich für den zweiten Weg entscheiden. Vor die Wahl Ordnung oder Gerechtigkeit gestellt, würde er sich für Ordnung entscheiden, sagte er oft in Goethe’scher Paraphrase. Die Folgen von Unordnung hatte er zu deutlich selbst miterlebt.
Im Ergebnis sollte Kissinger zu einem Konservativen im wahrsten Sinne des Wortes werden – philosophisch, intellektuell und politisch. Gegenüber revolutionären Veränderungen entwickelte er instinktive Abneigung, bereits in seiner Dissertation und stärker noch in seiner späteren Politik.
Auch leidenschaftliche Äußerungen von Demokratie und Populismus waren ihm suspekt. Wie George Kennan, sein philosophischer Vorfahr als Konservativer und Realist, sollte auch Kissinger niemals lernen, die angekratzte Herrlichkeit des politischen Systems in Amerika zu würdigen, besonders wenn es um die Außenpolitik ging.
Sein Geist und Intellekt sollten europäisch bleiben, wie auch seine Sprache stets ihren rumpelnden bayerischen Akzent behielt. Wohl fühlte er sich, wenn er sich in Hegel und Kant, Metternich und Dostojewski vertiefen konnte. Für archetypische amerikanische Erscheinungen wie Mark Twain, Thomas Jefferson und Benjamin Franklin konnte er sich niemals erwärmen.
Die wichtigste Auswirkung der Schrecken seiner Jugend aber hat Kissinger selbst immer wieder benannt: die Liebe zu dem gewählten zweiten Heimatland, eine Liebe, die die gelegentliche Geringschätzung der Unordnung in der amerikanischen Demokratie bei Weitem überwog. Als der junge Heinz in Manhattan ankam und Henry aus ihm wurde, sollte jene Mischung aus Toleranz und Ordnung, die er nun in Amerika erlebte, in dem Jungen, der zuvor auf keiner Straße ohne Angst hatte entlanggehen können, ein belebendes Gefühl von persönlicher Freiheit erzeugen. Später schrieb er dazu: »Ich hatte stets ein besonderes Gefühl dafür, was Amerika bedeutet, was die hier geborenen Bürger vielleicht als ganz normal empfinden, ich aber nicht.«20
2 Washington Heights
Die Amerikanisierung eines strebsamen Buchhalters 1938–1943
Als ich 1938 hierher kam, musste ich an der George Washington High School einen Aufsatz darüber schreiben, was es bedeutet, Amerikaner zu sein. Ich schrieb ihn … und dachte, dies war ein Land, wo man erhobenen Hauptes die Straße entlanggehen konnte.
Kissinger in einer Abschiedsrede als Außenminister, Januar 1977.
Eine wiederhergestellte Welt
Sein erster Gedanke war, die Straßenseite zu wechseln – eine natürliche Reaktion, hervorgerufen durch Jahre voller Prügel und Verhöhnung. Er lief ganz allein die westliche 185th Street in Manhattan entlang, von der Amsterdam Avenue in Richtung eines kürzlich am Broadway entdeckten Eisladens, als er die ihm entgegenkommende Gruppe von Jungs bemerkte – Fremde, keine Juden. In Fürth wäre eine solche Begegnung ganz sicher mit Demütigungen, wenn nicht mehr verbunden gewesen. Also wollte er schon den Bürgersteig räumen. Dann erinnerte er sich, wo er war.
Als ihm diese kleine Offenbarung widerfuhr, war Henry Kissinger gerade einige Monate in Amerika. Seine Familie war in eine komfortable, dennoch bescheidene Wohnung in einem sechsgeschossigen Haus an der Ecke Fort Washington Avenue und 187th Street eingezogen. Auf der gleichen Etage wohnte Paula Kissingers Cousine. In ähnlichen Wohngebäuden der geschäftigen Avenue lebten inmitten Hunderter neuer jüdischer Einwanderer auch Freunde aus Fürth und Nürnberg.
Das Wohngebiet Washington Heights erstreckt sich auf einem lang gezogenen Felsplateau über dem Hudson River. Von hier aus hatten die Truppen George Washingtons im Oktober 1776 ohne Erfolg versucht, Manhattan gegen die Briten zu verteidigen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten hier zumeist polnische und russische Juden. Viele von ihnen zogen, als sie in der neuen Heimat Erfolg hatten, in die ruhigeren Vorstädte New Yorks. Zurück blieb ein Wohnviertel mit Synagogen und koscheren Delikatessenläden, das nun bereit war, eine neue Welle jüdischer Emigranten aufzunehmen. Als die Hitlerflüchtlinge eintrafen, erhielt die Gegend den Beinamen »Viertes Reich«.
Louis Kissinger hatte als Fünfzigjähriger Schwierigkeiten, sich in dem Leben mit einer neuen Sprache zurechtzufinden. Obwohl er ein solides Schulenglisch beherrschte – oder gerade deshalb –, fürchtete er beständig, grammatikalische Fehler zu machen, und war irritiert durch seinen starken Akzent. So sprach er also wenig, viel weniger als seine Freunde mit geringeren Sprachkenntnissen und nicht so viel Hemmungen.
Seine Fähigkeiten als Lehrer waren nicht gefragt, und die wirtschaftliche Depression im Lande machte es sehr schwer, einen Job zu finden. Hinzu kam, dass er in den USA mit einer chronischen Gallenblasenreizung angekommen war, von der die Ärzte eine Zeit lang meinten, es sei Krebs. Paulas Vater Falk Stern, der kurz nach ihrer Ankunft daheim in Deutschland gestorben war, hatte ihnen eine kleine Erbschaft vermacht. Doch das Geld schmolz rasch dahin. Endlich, nach zwei Jahren mit lediglich sporadischen Gelegenheitsjobs, erhielt Louis eine, wenn auch nicht sonderlich bezahlte, Anstellung als Buchhalter in einer Fabrik, die Freunden aus Deutschland gehörte.
Es oblag also der 13 Jahre jüngeren und sich viel rascher als ihr Mann an das neue Leben anpassenden Paula Kissinger, den Unterhalt für die Familie zu verdienen. Dabei halfen ihr die gesellige Natur, der wache Verstand und ihre flinke Zunge: Sehr bald meisterte sie die neue Sprache wenigstens so weit, dass sie sich ohne Schwierigkeiten verständigen konnte. Eine Zeit lang arbeitete sie bei einem nahe gelegenen Lebensmittelhändler, der frei Haus Menüs für Hochzeiten und Bar-Mizwa-Feiern lieferte, dann machte sie sich als »Accomodator« selbstständig – wie man die Essenslieferanten für kleine häusliche Feiern und Partys oft nennt.1 (Sie wurde dabei so bekannt, dass Jahre später, als ihr Sohn bereits Nationaler Sicherheitsberater war, immer noch Anfragen alter Kunden eintrafen, die eine Party veranstalten wollten. Gewöhnlich übernahm sie derartige Aufträge, bat aber darum, nur mit Paula und nicht mit ihrem Familiennamen angesprochen zu werden, damit die Partygäste nicht erfuhren, wer sie war.)
Henry Kissinger, endlich befreit von der jahrelangen Furcht in Fürth, stürzte sich in das neue Leben von Washington Heights wie ein auf Ehrenwort entlassener Gefangener. Innerhalb weniger Tage hatte er den Weg zum Yankee Stadium herausgefunden und die Geheimnisse eines Sports erkundet, den er nie zuvor erlebt hatte. John Sachs, der zur gleichen Zeit wie die Kissingers aus Fürth nach New York gekommen war, erinnert sich: »Als Erster von uns allen fand er heraus, wie man zum Stadion kam, was der Eintritt kostete; als Erster auch verstand er den Baseball. Einige Wochen nach seinem ersten Besuch forderte er meinen Onkel und mich auf, mit ihm ins Stadion zu gehen. Baseball war uns völlig unbekannt, doch er erklärte uns das ganze Spiel.«2
Als er und Sachs die Fahrprüfung machten, fiel Kissinger durch, was dann noch zwei weitere Male passierte. (»Ich habe verflixt noch mal nicht begriffen, warum ich durchfiel«, sagte er später, obwohl sich einige Leute, die in seinem Wagen mitfuhren, eine ganze Reihe von Gründen vorstellen konnten.) Sachs bestand die Prüfung ganz leicht, mit einem geborgten Auto gingen er und Kissinger auf Entdeckungsfahrten, etwa in die Berge der Catskills.
Einen Monat nach seiner Ankunft trat Kissinger im September 1938 in die George Washington High School ein. Sie war 1925 im neogeorgianischen Stil erbaut worden, der große Campus befand sich in der 192nd Street und war damals der Stolz des öffentlichen Schulsystems der Stadt. Die Schüler kamen hauptsächlich aus dem bildungsbeflissenen Judentum der Umgebung und aus anderen Emigrantenkreisen. Die Lehrer gehörten zu den besten von New York, entsprechend gut war der Unterricht.
Henry Kissinger während seiner ersten Jahre an der George Washington High School, New York. Aufnahme von 1939.
In den Unterlagen der Schule heißt es über Kissinger, er habe wie viele seiner Mitschüler das »Sprachhandicap des Ausländers« gehabt. Das traf bei genauer Betrachtung der einzelnen Fächer allerdings kaum zu. In seinem ersten Semester erreichte er in Englisch 70 (von 100 möglichen) Punkte, schon im zweiten Semester waren es 90. Von da ab bekam er in allen gewählten Fächern – Französisch, amerikanische Geschichte, europäische Geschichte, Wirtschaft, Algebra und Buchhaltung – eine 90 oder mehr. Nur in den Unterlagen für »Industrie und Handel« findet sich eine 85. »Er war unter den Emigrantenschülern aus Deutschland der ernsthafteste und erwachsenste«, sagte später seine Mathematiklehrerin Anne Sindeband. »Ich denke, alle diese Schüler waren viel ernsthafter als unsere amerikanischen.« Ein deutscher Klassenkamerad Kissingers erinnerte sich: »Natürlich waren wir ernsthaft bestrebt. Was sollten wir denn anderes tun? Nur wenn wir die Schule gut abschlossen und danach aufs City College gehen konnten, hatten wir Chancen in Amerika. Heute lästern die Kinder über Streber. Doch damals waren wir alle Streber.« Und mit einem kleinen Lächeln fügte er hinzu: »Besonders Henry.«
Die Kissingers schlossen sich der orthodoxen K’hal-Adath-Jeshurun-Gemeinde an, deren Synagoge erst im Jahr ihrer Ankunft errichtet worden war. Ihr erster Rabbi, Joseph Breuer, war das ehemalige Oberhaupt der Frankfurter Yeshiva-Gemeinde und ein bekannter Verfechter der kompromisslosen Orthodoxie. In der Gegend sprach man einfach von »Breuers Synagoge«. Kissinger, der stets den Gebetsschal trug, war ein gläubiges Gemeindemitglied. Seine Mutter allerdings hatte das Gefühl, dass er mehr aus Treue zum Vater denn aus aufrichtigem Glauben die Synagoge besuchte.
Allmählich löste sich Kissinger von seinem orthodoxen Erbe. Er schloss sich der Jugendgruppe Beth Hillel an, in der vorwiegend Reformjuden vertreten waren, die meisten von ihnen Flüchtlinge aus Bayern. Man traf sich regelmäßig in der Paramount Hall an der Ecke 183rd Street und St. Nicholas Avenue.
Vorsitzender von Beth Hillel war Henry Gitterman, ein Schulkamerad Kissingers aus Fürth. »Wir trafen uns fast jedes Wochenende, Jungen und Mädchen. So konnte man Mädchen aus der gleichen Lebenswelt kennenlernen.« Obwohl sie alle aus Deutschland kamen, wurde bei Beth Hillel nur Englisch gesprochen. Oft traten führende Vertreter der jüdischen Gemeinde vor die Jugendlichen. Hier konnte man zusammenfinden und sich gleichzeitig im neuen Leben assimilieren. »Wir waren etwa 18 bis 20 junge Leute bei den Zusammenkünften«, erinnert sich Kurt Silbermann. »Es gab Diskussionsgruppen und Literaturzirkel, manchmal auch einfach Abende, an denen wir gemeinsam ins Kino gingen oder Radio hörten.«
Neben John Sachs gehörte Walter Oppenheim zu Kissingers engen Freunden, manchmal auch zu seinen Rivalen. Auf der Realschule in Fürth hatte er mit Kissinger die Bank geteilt, beide Familien waren im Sommer 1938 emigriert und fanden sich als Nachbarn in Washington Heights wieder. Stattlich und zielbewusst, wenn auch nicht so klug wie Kissinger, war Oppenheim der geborene Anführer.
An den meisten Samstagabenden versammelten sich in der Oppenheim’schen Wohnung acht bis zehn Freunde, darunter Kissinger. Manchmal ging es dann ins Kino oder zum Eisessen. Ein größeres Fest war es schon, wenn die Jungs gemeinsam mit ihren Freundinnen zu Child’s Restaurant in der 59th Street pilgerten, wo eine Band spielte. Der Minimalverzehr betrug dort drei Dollar, kein kleiner Betrag für die jungen Emigranten. Also kalkulierten sie ihre Bestellungen genau und gaben niemals mehr als den geforderten Minimalbetrag aus.
Manchmal endete Kissingers Besuch bei den Oppenheims auch in langen Gesprächen mit dem Familienvater, der sich für Politik interessierte und ein begeisterter Anhänger Roosevelts war. »Obwohl wir alle Demokraten waren«, erinnert sich Walter Oppenheim, »betrachtete sich Henry als überzeugter Republikaner und Anhänger von Wendell Willkie. Oft diskutierte er bis in den späten Abend mit meinem Vater. Stets las er Bücher über Politik und Geschichte. Von Willkie’s Ideen war er äußerst angetan, ich kann mir nicht vorstellen, warum.«
Kissinger erlebte nun das Erwachsenwerden in einem fremden Land, dabei blieb er fast ebenso verschlossen wie in Fürth. Seine jungen Mitemigranten respektierten ihn wegen seines Verstands und seiner erwachsenen Art, doch er blieb abgekapselt und sozial unsicher. Sein Bruder Walter meint dazu: »Es war schwierig für Henry, seinen Platz zu finden, sich einzuordnen, zumal in der ersten Zeit, als unser Vater keine feste Arbeit hatte.«
Besonders linkisch stellte er sich beim Tanzunterricht in Edith Peritz’ »Ballroom Dance Classes« an – ein Muss für die meisten Mitglieder von Beth Hillel. Ein Foto von 1941 – aufgenommen in der Audubon Hall von Washington Heights – zeigt einen winzigen und bebrillten Kissinger am äußersten Ende der letzten Reihe des Gruppenbildes. Wie in allen Tanzschulen wurden auch bei Edith Peritz zahlreiche Preise vergeben, fast ebenso viel, wie Schüler den Tanzunterricht besuchten; Kissinger hat niemals einen gewonnen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: