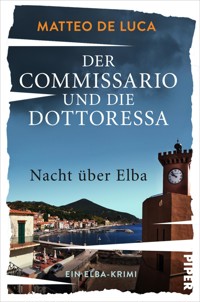9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Malerische Traumstrände, tödliche Klippen und ein Ermittlerteam, das eigentlich gar keines ist Elba – drittgrößte Insel Italiens, beliebtes und idyllisches Urlaubsparadies sowie neue Heimat von Hagen Berensen. Der Deutsche hat seinen Job bei der Kripo gekündigt und sich in einer Villa mit Traumblick an Elbas Küste niedergelassen. Seine neue Haushaltshilfe Fiorina Luccarelli ist für seinen Geschmack zwar etwas zu temperamentvoll, aber immerhin spricht sie dank ihres Psychologiestudiums in Frankfurt fließend Deutsch. Nach dem rätselhaften Tod eines Bekannten gerät ihr Bruder in Gefahr – da kommt es ihr gerade recht, dass ihr neuer Arbeitgeber früher Commissario war. Auch der Mafioso Rossi, der Hagen die leider marode Villa angedreht hat, scheint seine Finger im Spiel zu haben. Kurzerhand fälscht Hagen einen Europol-Ausweis, gibt Fiorina als seine Dolmetscherin aus, und sie beginnen zu ermitteln … Matteo De Luca ist das Pseudonym der Bestsellerautoren Wolfgang Burger und Hilde Artmeier. Mit ihren Krimireihen rund um den Heidelberger Kripochef Alexander Gerlach und die Regensburger Privatdetektivin Anna di Santosa waren sie bereits einzeln sehr erfolgreich, jetzt hat das Autoren-Ehepaar sich zusammengetan und lässt gemeinsam ein sympathisches neues deutsch-italienisches Duo ermitteln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Der Commissario und die Dottoressa – Sturm über Elba« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Annika Krummacher
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Cornelia Niere
Coverabbildung: lookphotos / Mirau, Rainer
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1
Mamma mia, schon wieder war das Kloschild weg …
Fiorina Luccarelli hatte zunächst gar nicht bemerkt, dass an der Fassade neben der Haustür wieder der hässliche Fleck prangte, der normalerweise unter dem Schild in den traditionellen Flaggenfarben Elbas verborgen war. Vermutlich, weil der Wind ihr die Handtasche in genau jenem Moment von der Schulter gerissen hatte, als sie den Haustürschlüssel herausziehen wollte.
Doch nun, da sie die Tasche in festem Griff hielt und mit dem Schlüsselbund in der Hand vor dem Eingang stand, sah sie den Fleck umso deutlicher. Hatte der Sturm das Schild davongeweht?
Sie strich sich die feuchten Ponyfransen aus dem Gesicht, ein sinnloses Unterfangen angesichts des anhaltenden Sturzregens und der peitschenden Böen, und warf einen Blick zurück auf den Asphaltbelag der Gasse, durch die sie soeben gerannt war. Der Sturm heulte wie in einem Gruselkabinett, die Straßenlaterne, die wild hin und her schaukelte, verbreitete ein wenig Licht. Doch weit und breit keine Spur von dem fehlenden Schild.
Außer Fiorina war zu so früher Stunde noch niemand auf der Straße. Es war erst halb sechs Uhr morgens, die meisten Bewohner von Elbas Hauptstadt Portoferraio schliefen noch. Nur im Haus gegenüber brannte schon Licht, der alte Nunzio war wie immer zeitig auf den Beinen.
Rasch betrat Fiorina das vierstöckige Gebäude, in dem sie mit ihrer Familie wohnte, und schloss hinter sich die Tür ab, die wie üblich nicht zugesperrt gewesen war. Seufzend schüttelte sie das Wasser von ihrer taubengrauen Steppjacke, durchquerte den eiskalten dunklen Korridor und stieg die knarzenden Holzstufen in den ersten Stock hinauf. Dabei überlegte sie, wie sie ihrer Mutter Teil zwei ihrer heutigen Neuigkeiten beibringen sollte, der wesentlich schwerer wog als das wieder einmal geklaute Schild mit der in Deutsch und Englisch verfassten Aufschrift: »Im Jahr 1814 benutzte Napoleon Bonaparte mehrfach die Toilette dieses Hauses. Besichtigung jederzeit möglich gegen eine Gebühr von € 2.« Darunter die Handynummer ihres Bruders Federico.
Als Fiorina die Fünfzimmerwohnung ihrer Mutter betrat, seufzte sie ein zweites Mal – auch diese Tür war wie so oft nicht abgeschlossen. Sie schlüpfte aus der Jacke, die immer noch vor Nässe triefte, und hängte sie an einen Haken der winzigen Garderobe.
Aus der geräumigen Küche duftete es schon nach Kaffee. Rosetta Luccarelli, eine kleine, rundliche Frau Anfang sechzig, goss sich gerade ein erstes Tässchen ein. Beim Anblick ihrer Tochter holte sie wortlos eine weitere Espressotasse aus dem wurmstichigen Büfett und füllte sie fast bis zum Rand.
»Tutto a posto?« Sie stellte die verbeulte Macchinetta zurück auf den Herd und drehte das Gas herunter, um sie warm zu halten. Ihre trotz ihres Alters immer noch beneidenswert glatte Stirn legte sich in Falten. »Alles in Ordnung? Du siehst kaputt aus, Carissima.«
»Mamma, so geht das einfach nicht.«
Während ihre Mutter sich gegen den altersschwachen Herd lehnte und sie mit hochgezogenen Brauen musterte, ließ Fiorina sich auf einen der sechs Holzstühle fallen, die um den langen Holztisch gruppiert waren. Gierig trank sie von dem starken schwarzen Caffè, den sie nach einer Nachtschicht immer besonders nötig hatte.
»Wenn du nie das Haus und die Wohnung absperrst«, sie gähnte hinter vorgehaltener Hand, »klauen sie uns eines Tages mehr als nur das dumme Kloschild.«
»Wir sind hier nicht in Livorno, Carissima, sondern auf Elba«, erwiderte ihre Mutter entrüstet. »Außerdem schließt ja immer du ab, also was jammerst du?«
In der Küche zog es fürchterlich, trotz der geschlossenen Fensterläden. Durch jede Ritze zwischen dem krummen Mauerwerk und den schlecht isolierten Fenstern des dreihundert Jahre alten Hauses pfiff und fauchte der Wind, während der Regen so heftig gegen die flaschengrün gestrichenen Holzläden trommelte, dass man fürchten musste, die Glasscheiben dahinter könnten jeden Moment zerspringen.
»Das Schild ist schon wieder verschwunden, sagst du?« Fiorinas Mutter rührte drei gehäufte Löffel Zucker in ihren Espresso – im Gegensatz zu ihrer Tochter fand sie ihn ungesüßt ungenießbar – und leerte das Tässchen in einem Zug. »Madonna santa! Und das im März, wo es noch kaum Touristen gibt.«
Je nachdem, in welcher Branche man arbeitete, liebte oder hasste man auf der Insel die Urlauber, die im Sommer die Städtchen, Straßen und Strände Elbas überfluteten und beim überwiegenden Teil der Einheimischen für ein regelmäßiges Einkommen sorgten. Nach dem ruhigen Trott in der kalten Jahreszeit sehnten die meisten Inselbewohner die Zeit herbei, wenn wieder die ersten Touristen anreisten und die Kassen füllten. Rosetta Luccarelli arbeitete in einem Supermarkt, der so versteckt am Rand von Portoferraio lag, dass sich selbst in der Hochsaison kaum ein Fremder dorthin verirrte. Deshalb betrachtete sie die Menschen, die nicht von Elba stammten, als Ursprung allen Übels, das die drittgrößte Insel Italiens in ihrer wechselvollen Geschichte heimgesucht hatte. Wenn sie aber durch die Via del Carmine stolperten, die Gasse, in der ihr Haus stand, und Napoleons Toilette gegen einen kleinen Obolus besichtigen wollten, waren die Touristen auch ihr willkommene Gäste. Manch einer hatte es allerdings schon übertrieben und das Kloschild als Andenken mitgehen lassen.
»Vielleicht weiß Nunzio was.« Fiorina nippte an ihrem brühheißen Caffè. »Bei ihm brennt schon Licht. Ich frag ihn später mal, ob er was gesehen hat.«
»Der arme Federico.« Mit theatralischem Stirnrunzeln goss Rosetta Luccarelli sich Kaffee nach und bekreuzigte sich. »Zum dritten Mal in diesem Jahr muss er ein neues machen … Oddio, wenn das bloß kein Unglück bringt.«
Das Schild hatte Fiorinas Bruder in Anlehnung an Elbas Flagge mit drei gelben Bienen verziert, die über einen roten Streifen auf weißem Grund flogen. Angeblich hatte Napoleon Bonaparte höchstpersönlich sie auf seiner Überfahrt nach Elba entworfen, wo er sein erstes Exil verbrachte. Der verbannte Kaiser hatte damals keine zweihundert Meter vom Haus der Luccarellis entfernt gelebt. In der Villa dei Mulini, an einem der höchsten Punkte der Altstadt und zwischen den beiden Festungen Forte Stella und Forte Falcone.
Die Idee mit dem Napoleon-Klo stammte von Federico, der auf diese Weise – zumindest während der Touristensaison – auch etwas zum Familieneinkommen beitrug, was leider selten genug vorkam. Er hatte die angebliche Toilette in einem alten Verschlag im Hof eingerichtet. Das Brett mit dem Loch stammte von einem abgebrannten Bauerngehöft bei San Martino, und das Arrangement sah ziemlich echt aus. Natürlich war an den zwei Euro Eintrittsgeld nicht viel zu verdienen. Der Trick waren die verstaubten Radierungen an den Wänden des Plumpsklos, die den Kaiser zeigten und angeblich seit Ewigkeiten im Besitz der Familie waren. In Wahrheit fertigte Federico sie selbst an und druckte sie auf würdig vergilbtem Büttenpapier, das er dem Besitzer einer pleitegegangenen Druckerei in Marina di Campo abgeschwatzt hatte. Die alten Rahmen kaufte er bei eBay oder auf Flohmärkten, und wenn an einem guten Tag drei Touristen Napoleons Toilette besichtigten, dann war mindestens einer darunter, der nicht widerstehen konnte und dem scheinbar naiven Besitzer eine der vermeintlich über zweihundert Jahre alten Radierungen abschwatzte. In der Regel verlangte Federico dreihundert Euro dafür, unter hundertfünfzig verkaufte er nicht.
»Der hat ja sonst nichts zu tun«, bemerkte Fiorina, weil ihr der weinerliche Ton ihrer Mutter auf die Nerven ging. Federico war nicht nur acht Jahre jünger als sie selbst und das Nesthäkchen der Familie, sondern ein Mammone, ein Muttersöhnchen par excellence. »Jedenfalls nichts, womit er wirklich Geld verdient.«
Dieser Gedanke erinnerte Fiorina an Teil zwei ihrer morgendlichen Schreckensmeldungen.
Ihre Nachtschicht als Mitarbeiterin der Sozialstation war anfangs ganz normal verlaufen – am Krisentelefon eine einsame Betrunkene, drei Youngsters mit Liebeskummer, die Inhaberin eines Agriturismo, deren Ehemann im Hintergrund noch lauter getobt hatte als der Sturm. Aber dann, kurz nach Mitternacht, hatte Fiorina die Unglücksmail in ihrem Posteingang entdeckt.
»In der Zentrale in Livorno haben sie wieder mal über Rationalisierungsmaßnahmen nachgedacht.« Sie räusperte sich unbehaglich und zupfte an der Plastiktischdecke herum, die mit Tomaten, Gurken und Karotten in leuchtenden Farben bedruckt war. »Maßnahmen, die sich leider auch auf meine Stelle auswirken.«
Ihre Mutter kramte in einem der Hängeschränke aus kanariengelbem Resopal, holte die Schale mit den Biscotti hervor und stellte das zierliche Porzellangefäß, das noch aus der Aussteuer ihrer Urgroßmutter stammte, auf den Tisch. Dann hob sie die Hände gen Zimmerdecke und die akkurat nachgezogenen kohlschwarzen Brauen. Ihr pausbäckiges Gesicht verzog sich zu der Märtyrermiene, die sie bei den Schicksalsschlägen ihres Lebens zu zeigen pflegte.
»Madonna santa«, klagte sie erneut. »Bitte nicht schon wieder!«
»Leider doch. Die Dienststelle in Portoferraio wird aufgelöst. Ottavia, meine Kollegin von der Tagschicht, hat noch zwei Wochen, um alles zu regeln. Aber die Nachtschicht ist ab sofort gestrichen.«
So, jetzt war es heraus. Fiorina kippte den Kaffee hinunter und stellte die Tasse so unsanft auf den Tisch, dass sie fast lauter schepperte als die Fensterläden, an denen der Wind rüttelte.
»Mi dispiace tantissimo, mamma«, fügte sie grimmig hinzu. »Aber ich bin wieder mal arbeitslos.«
2
Die Wolken rasten dahin wie eine Büffelherde auf panischer Flucht. Tintenschwarz, drohend und so tief hingen sie über der aufgepeitschten See, als wollten sie jeden Augenblick darin versinken. Die Gischt spritzte meterhoch und flog sogar hin und wieder über das Dach des kleinen Toyota, der über die Küstenstraße nach Portoferraio jagte.
Der Mann hinter dem Steuer zog den Kopf ein, als eine besonders hohe Woge einen Schwall Wasser gegen das Blech warf und eine Sturmbö seinen Wagen um ein Haar von der Straße gefegt hätte. Er umklammerte das Lenkrad so fest, dass seine Fingerknöchel im bläulichen Schein der Armaturenbeleuchtung weiß hervortraten. Noch zwei Kilometer. Wegen dieses Katastrophenwetters war er spät dran, viel zu spät. Hoffentlich schaffte er es noch rechtzeitig bis zur Abfahrt der ersten Fähre.
Vor wenigen Minuten hatte es endlich zu regnen aufgehört. Dennoch war die Straße stellenweise noch so überschwemmt, dass er ein ums andere Mal fürchten musste, die Reifen würden die Bodenhaftung verlieren. Jeden Moment konnte er die Kontrolle verlieren, den Steilhang hinabschlittern, auf einem Felsen aufschlagen. Ohne sich umzuwenden, tastete er nach dem Aktenkoffer auf dem Rücksitz, als könnte dieser sich während der Fahrt in Luft aufgelöst haben. Doch der unscheinbare schwarze Koffer lag immer noch dort, wo er ihn hingelegt hatte.
Der Fahrer entspannte sich ein wenig, versuchte, nicht mehr an das schreckliche Wetter zu denken, sondern an seine Zukunft, an all die Möglichkeiten, die das Leben ihm auf einmal bot. Bis zum nächsten Brecher, der die schmale, kurvige, an vielen Stellen schlecht befestigte Straße kurzzeitig in einen wild schäumenden Gebirgsbach verwandelte.
Wieder blitzten die Scheinwerfer im Rückspiegel auf. Der andere war immer noch hinter ihm, hatte es offenbar genauso eilig wie er, wollte vielleicht auch die Sechs-Uhr-Fähre erreichen. Oder verfolgte er ihn etwa? War es möglich, dass seine Flucht schon entdeckt worden war?
Der Mann im Toyota fluchte lauthals, stieg so heftig auf die Bremse, dass der Wagen kurz schlingerte. Vor ihm stand die Straße zentimetertief unter Wasser, es rauschte und spritzte, dann hatte er die Stelle hinter sich und konnte wieder Gas geben. Er schoss am schwärzlichen Dickicht der Macchia vorbei, die die nur schwach besiedelten Hänge an der Nordküste Elbas großenteils bedeckte.
Eigentlich hatte er gedacht, er hätte den Wagen hinter sich längst abgeschüttelt. Schon, als er am Campingplatz bei Acquaviva vorbeiraste, hatte er das zuckende und tanzende Licht hinter sich bemerkt. Ein großer Wagen schien es zu sein, ein teurer Wagen. Mühsam kämpfte er die Angst nieder, die ihm die Luft abschnürte, warf erneut einen Blick in den Rückspiegel. Das Scheinwerferlicht war verschwunden. Er atmete auf.
Endlich erreichte er Portoferraios Stadtgrenze. Hier herrschte plötzlich reger Verkehr, besonders auf der Gegenfahrbahn. Gab es seit Neuestem auch eine Fähre, die vor sechs Uhr morgens anlegte?
Mit viel zu hoher Geschwindigkeit passierte er das Industriegebiet, bog schlingernd in die Zufahrt zum Hafen, sah die Fähre am Pier liegen, Gott sei Dank. Er bremste hart, aber … Aber was war das?
Normalerweise sollte hier jetzt eine lange Schlange von wartenden Fahrzeugen stehen, Berufspendler, die aufs Festland übersetzen wollten. Doch da war niemand, die Schranke an der Zufahrt war geschlossen, die Ampeln alle rot und …
Und die Fähre war dunkel!
Wie ein Schlag in die Magengrube traf ihn die Erkenntnis: Der Fährbetrieb war wegen des Unwetters bis auf Weiteres eingestellt. Die Autos, die ihm vorhin entgegengekommen waren, gehörten Menschen, die wie er selbst am Morgen weder Nachrichten gehört noch ins Internet geschaut hatten.
Langsam, ratlos und in schon wieder hochkochender Panik fuhr er weiter, fand am Rand der Altstadt einen Parkplatz auf der dem Meer abgewandten Straßenseite. Was war er nur für ein Idiot! Es war ja nicht das erste Mal, dass die Fähren nicht ausliefen. Das geschah mehrmals pro Jahr. Er hätte es wissen können, verdammt! Er hätte es wissen müssen.
Was nun?, fragte er sich, als er wie gelähmt bei ausgeschaltetem Motor im Wagen saß.
Die Wellen in der sonst so ruhigen Hafenbucht schäumten und spritzten, als würden übermütige Seeungeheuer ihr Morgenbad darin nehmen. Der kleine Leuchtturm an der Molo del Gallo hingegen blinkte so friedlich und verlässlich, als wäre alles in bester Ordnung.
Erneut fluchte der Mann im Toyota, duckte sich. Ein Wagen kam langsam die Straße entlang, als hielte der Fahrer nach irgendetwas oder irgendjemandem Ausschau. Ein Mercedes, dessen Stern im Licht der heftig schaukelnden Straßenbeleuchtung aufblitzte.
Noch hatte der andere ihn nicht entdeckt. Zufällig hatte er an einer Stelle geparkt, wo die Straßenlaterne kaputt war. Rasch zerrte er den Aktenkoffer und seine Steppjacke vom Rücksitz, riss die Tür auf, die der Sturm ihm wütend entgegenschlug, lief davon, zog dabei die Jacke über. Die Reisetasche mit seinen wenigen Habseligkeiten würde er später holen. Falls es ein Später für ihn geben sollte.
Schwer atmend bog er in eine Seitenstraße ein, die ins Centro storico führte. An heruntergelassenen Rollgittern rannte er vorbei, an geschlossenen Geschäften, zugeklappten Fensterläden. Hinter sich hörte er die Tür eines Wagens zufallen, schnelle Schritte über den Asphalt klappern. Wer immer ihn verfolgte, er war ihm dicht auf den Fersen.
Durch steinerne alte Torbögen lief er, an heruntergefallenen und auf dem Pflaster zerschellten Blumentöpfen vorbei, an einer umgestürzten Vespa. Wahllos bog er abwechselnd links und rechts ab, geriet in immer schmalere Gassen. Der Aktenkoffer, den der Wind unablässig hin und her zerrte, behinderte ihn, aber er packte ihn nur noch fester.
Auf der Piazza Cavour glitt er auf dem nassen Kopfsteinpflaster aus, fing sich mit knapper Not an einem glitschigen Laternenmast ab, horchte in die Nacht. Doch sein eigener Atem, sein rasender Puls überdeckten jedes andere Geräusch.
Bei Salvatores Panetteria, wo er manchmal Panini oder Brot kaufte, wenn er in Portoferraio zu tun hatte, flackerte Licht hinter den Schaufenstern. Der Bäcker war offenbar schon bei der Arbeit, der Laden aber noch geschlossen.
Wieder hörte er von irgendwoher eilige Schritte, dieses Mal aus einer ganz anderen Richtung als vorhin. Gehetzt blickte er sich um, sah etwas aus dem Augenwinkel, das ihm erneut den Atem verschlug. Eine Gestalt trat aus dem Schatten eines Vordachs. Wie konnte sein Verfolger jetzt schon hier sein?
Aber nein, das war doch …?
Sie war ihm so verflucht vertraut, diese Gestalt, allerdings hatte er nicht damit gerechnet, sie hier zu sehen. Wenn es überhaupt die Person war, für die er sie hielt. Aufgrund der großen Kapuze konnte er das Gesicht nicht erkennen.
Ein Blitz durchzuckte ihn. Steckten die beiden, der Fahrer des Mercedes und der Mensch mit der Kapuze, etwa unter einer Decke? Dann war er verloren …
Er wandte sich so ruckartig ab, dass er auf dem nassen und glatten Untergrund erneut ausrutschte. Dieses Mal konnte er den Sturz nicht vermeiden, sondern schlug der Länge nach hin. Mit zusammengebissenen Zähnen rappelte er sich wieder hoch, packte den Aktenkoffer, der ihm aus der Hand gefallen war, stolperte in die nächste Gasse.
Weiter lief er, immer weiter, aufwärts jetzt, bog wieder um eine Ecke und noch eine, hastete eine breite Treppe hinauf, wandte sich an ihrem Ende scharf nach rechts, in die Via Victor Hugo. Wenn er wenigstens den schweren Aktenkoffer nicht schleppen müsste, der ihm bei dem Sturm immer wieder zwischen die Beine geriet. Der Wind zerrte an seinen Haaren, an seiner Jacke, deren Reißverschluss er in der Eile nicht zugezogen hatte. Erst jetzt bemerkte er, dass es wieder zu regnen begonnen hatte.
»Volare, dadada, cantare …«, schmetterte jemand in seiner Nähe mit so volltönender Stimme, dass er sogar das Heulen des Windes übertönte.
Der Mann mit dem Koffer hetzte weiter, seine Lungen schmerzten, der Atem ging keuchend, weiter die Gasse hinauf, an dunklen Häusern vorbei, an geparkten Autos. Da prallte er mit jemandem zusammen.
»Attenzione!«, rief der Mann, der bis eben gesungen hatte. »Wohin denn so eilig?«
Das Gesicht des Sängers schien in den herabstürzenden Wassermassen zu verschwimmen. Doch dann erkannte er ihn.
»Oddio!« Aufatmend packte er ihn am Arm. »Wie gut, dass ich dich treffe.«
»Äh … Kennen wir uns?«
»Certo, wir sind alte Schulfreunde, weißt du nicht mehr? Hör zu, du musst mir helfen.«
3
»In Cecina suchen sie eine Psychologin«, sagte Fiorina Luccarelli beim zweiten Espresso zu ihrer Mutter. »Zwar nur halbtags, aber immerhin bei der Stadtverwaltung, im Settore sociale, da könnte ich …«
»Was willst du in Cecina?«, wischte Rosetta Luccarelli, die schwungvoll in einem Kochtopf rührte, den Vorschlag zur Seite. »Da bist du jeden Morgen und Abend anderthalb Stunden unterwegs. Allein schon die Überfahrt jedes Mal … Nein, Carissima, schlag dir das aus dem Kopf!«
»Die Stelle wäre perfekt für mich, Mamma. Ich würde gern wieder mit traumatisierten Frauen arbeiten, und nebenbei könnte ich endlich meine Ausbildung zur Psychotherapeutin abschließen.«
Ihre Mutter stemmte eine Hand in die Hüfte und wirbelte mit dem Kochlöffel in der anderen aufgebracht in der dampfgeschwängerten Luft herum. »Und wie sollen Federico und ich zurechtkommen, wenn du jeden Tag das Auto brauchst, eh?«
»Jetzt hör mal, es ist immer noch mein Auto, und …«
»Wir können uns ein zweites Auto nicht leisten. Basta. Du wirst auch auf der Insel wieder eine Stelle finden.«
Der Wind heulte auf, wehte so heftig, als fegte er mitten durch die Küche. Die einfach verglasten Scheiben klirrten und schepperten. Offenbar hatte jemand die Wohnungstür geöffnet, ohne dass sie es gehört hatten.
Schon rumste sie ins Schloss, Schritte schlurften durch den Korridor. Die Anfangsklänge von Zuccheros Ohrwurm Diamante drangen an Fiorionas Ohr.
»Federico!«, rief Rosetta Luccarelli mit einem plötzlichen Strahlen im Gesicht. »Vuoi un caffè? Einen Espresso?«
»Später, Mamma«, tönte es hohl zurück. »Bin hundemüde.«
Wie immer, wenn Fiorinas Bruder so frühmorgens nach Hause kam, klang seine Stimme halb belegt, halb beschwingt. Sie konnte sich schon denken, warum. Natürlich war er wieder bei Andrea gewesen.
»Weck mich zum Abendessen – d’accordo, mamma?«
»Certo, amore, certo. Schlaf gut!«
Die Tür von Federicos Zimmer klappte auf und wieder zu.
Fiorina konnte den feinen, leicht bitteren Geruch erschnuppern, der vom Korridor hereinwehte. Ihre Mutter hingegen schien nichts davon zu bemerken. Allerdings umgab sie ein Duftgemisch aus Oregano und Knoblauch, das den brodelnden Töpfen entstieg.
»Heute gibt’s eine feine Ribollita mit extra viel Fenchel«, rief sie ihrem Sohn nach, der vermutlich längst nichts mehr hörte. »Die magst du doch so gern, Amore.«
Wie immer ärgerte sich Fiorina über Mammas Getue, sobald es um ihren Sohn ging. Während ihr Nichtsnutz von kiffendem Bruder von ihrer Mutter stets »Amore« genannt wurde, wurde ihr höchstens ein »Carissima« gegönnt. Das bedeutete zwar »Liebste«, lag aber auf der Skala der Liebesbezeugungen meilenweit unter »Amore«, das durch nichts zu toppen war.
»Ist ja mal wieder spät geworden bei meinem Bruderherz«, brummte Fiorina und überlegte, wie viele Joints er seit dem vergangenen Abend wohl geraucht hatte.
»Der Arme, bestimmt hat er wieder die ganze Nacht gearbeitet.« Sorgenvoll schüttelte Rosetta Luccarelli die schwarzen, nur da und dort angegrauten Locken und drehte das Gas der Herdplatte herunter, sodass der Gemüseeintopf nur noch leicht köchelte. »Wenn die ihm für dieses Kalenderprojekt auch nur die Hälfte der Zeit bezahlen würden, die er dafür opfert, dann müsste ich mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, wovon wir die neue Waschmaschine bezahlen sollen.«
Fiorina dachte an die Spülmaschine, die in letzter Zeit seltsame Geräusche machte und über kurz oder lang ebenfalls den Geist aufgeben würde. Sie war überzeugt, dass Federico in der Nacht keineswegs Aufnahmen für dieses todsicher niemals zum Abschluss kommende Kalenderprojekt »Elba by night« gemacht hatte – wie auch, bei diesem Höllenwetter?
Der Sturm schien sich endlich zu legen. Der Regen prasselte zwar nach wie vor gegen die Fensterläden, doch nicht mehr so stark wie noch vor wenigen Minuten.
»Aber so ist es nun mal, und warum, frage ich dich«, fuhr Fiorinas Mutter mit ihrer unerschöpflichen Energie fort, mit der sie alle bisherigen Tiefen ihres Lebens gemeistert hatte, »soll man weinen, wenn man lachen kann?«
Sie setzte sich zu Fiorina an den Tisch und wischte sich die vorbildlich manikürten Hände an der Kochschürze ab, die mit bunten Vögelchen bedruckt war. Darunter trug sie einen perfekt sitzenden, knielangen Rock aus dunkelblauem Feincord, die farblich dazu passende Strickjacke und eine Taftbluse in Alabasterweiß. Auch wenn sie nur als unterbezahlte Kassiererin arbeitete, achtete sie wie die meisten ihrer Landsmänninnen stets auf ein vorzeigbares Äußeres.
»Und deshalb, Carissima, fährst du heute noch nach Porto Azzurro.«
Fiorina fühlte, wie die Müdigkeit sie allmählich übermannte.
»Was soll ich denn da, Mamma?«, fragte sie gähnend.
»Arbeit suchen.«
»Und wo, bitte schön?«
»Renata hat mir von einem Zettel erzählt, im Coop.« Rosetta Luccarelli tauchte einen Cantuccino in ihren Caffè. Inzwischen war sie bei der dritten Tasse, zusammen mit den Mandelkeksen ihr übliches Frühstück, bevor sie zu ihrer Arbeitsstelle aufbrach. »Da steht, dass ein deutscher Signore eine Haushaltshilfe sucht, die putzen und kochen kann.«
»Als Haushaltshilfe? Bei einem Deutschen?« Fiorina verdrehte die Augen. »Und seit wann kann ich kochen?«
»Es wird Zeit, dass du es endlich lernst, Cara mia. Jede Frau, die heiraten und Kinder haben will, muss kochen können.«
»Mamma, du weißt doch, der Zug ist für mich abgefahren.« Fiorina hatte keine Lust auf Streit, erst recht nicht so früh am Morgen. »Schau, ich bin nun mal Psychologin, ist doch logisch, dass …«
»Certo, und zwar eine, die hier auf der Insel bestenfalls als Hilfskraft im Kindergarten unterkommt, wie bei deiner vorletzten Stelle, wo du noch weniger verdient hast als ich, oder die sich als Telefontrösterin jede Nacht mit den Problemen von Alkoholikern, Junkies und anderen Verrückten herumschlagen muss.« Ihre Mutter schnaubte. »Gut, dass sie die Telefonseelsorge zumachen – endlich muss ich nicht mehr dauernd Angst haben, dass dir einer von diesen Asozialen auflauert, wenn du im Dunkeln nach Hause gehst.«
»Mamma, das sind Menschen in Not und keine …«
»Auf dem Zettel steht, dass der Signore nur jemanden nimmt, der Deutsch spricht. Renata sagt, dass er gut zahlt, das ist sogar rot unterstrichen, und geregelte Arbeitszeiten hättest du auch.« Rosetta Luccarelli schob ihrer Tochter ein Post-it zu, auf dem sie die Telefonnummer dieses Superarbeitgebers notiert hatte. »Da rufst du nachher an und bewirbst dich, basta!«
Fiorina wusste, es hatte keinen Sinn, noch länger zu diskutieren. Auch wenn sie nicht so müde gewesen wäre, wie hätte sie argumentieren sollen? Sie brauchten das Geld. Und wenn Mamma sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann war Widerspruch zwecklos. Ergeben nickte sie.
»Perfetto, und wenn du dich bei dem deutschen Signore vorstellst, dann zieh dir ausnahmsweise mal was Nettes an.« Sie ließ einen missbilligenden Blick über Fiorinas Leggings und Schlabberpulli wandern.
Trotz ihrer Erschöpfung raffte Fiorina sich noch einmal auf. »Mamma, warum soll ich mich in Schale werfen, wenn ich den Job sowieso nicht kriegen werde? Ich kann nicht kochen, ich will nicht putzen. Außerdem bin ich dreiunddreißig und weiß selbst …«
»Ja, und vor allem kannst du die Deutschen nicht leiden. So, und jetzt muss ich los, mein Bus geht gleich. Schlüssel, Handy, ich glaube, ich habe alles.« Rosetta Luccarelli kramte in ihrer Handtasche, die an der Stuhllehne hing. »In zehn Minuten kannst du den Herd ausschalten. Und bring der Nonna ihr Essen rauf, bevor du nach Porto Azzurro fährst, okay?«
Ihre Mutter küsste sie links und rechts auf die Wange, schwang die Handtasche über die Schulter und verschwand im dunklen Flur. Im nächsten Moment rumpelte etwas. Wie üblich hatte sie kein Licht gemacht, um Strom zu sparen.
»Was liegt denn hier herum?«, hörte Fiorina sie schimpfen. »Jetzt hab ich mir auch noch den Strumpf zerrissen, ach herrje. Ist das dein Aktenkoffer, Fiorina?«
»Der muss Federico gehören. Ich weiß nichts von einem Aktenkoffer.«
Sie wunderte sich, wofür er seit Neuestem so etwas brauchte. Für seine Kameraausrüstung, die er meist ohnehin nur zur Tarnung mitnahm, hatte er einen silbernen Metallkoffer.
»Er räumt sein Zeug doch nie weg, Mamma«, rief sie, während ihr wieder die Kündigungsmail durch den Kopf geisterte. Von einem Tag auf den anderen, unfassbar.
»Und eine Riesenschweinerei hat dein Bruder hier gemacht, Madonna santa.« Die Wohnungstür wurde geöffnet. Wieder fuhr der kalte Wind durch die Küche. »Kannst du die Pfütze bitte gleich aufwischen, Carissima? Ich habe es wirklich eilig. Bis später, ci vediamo.«
Fiorina murmelte etwas, das sehr nach einem derben Fluch klang, verschränkte die Arme auf dem Tisch und legte den Kopf darauf. Und dass ich für einen Deutschen das Dienstmädchen mache, hat mir gerade noch gefehlt, dachte sie. Dann war sie eingeschlafen.
4
Violetta war noch blöder als ihre vier Vorgängerinnen, und der Tag begann so beschissen, wie der gestrige geendet hatte.
Herzhaft vor sich hin fluchend, stemmte Hagen Berensen die immer noch klemmende Glastür auf, trat auf seine Terrasse hinaus, blickte missmutig auf das grau tosende Meer und die im Tiefflug dahinjagenden Wolken, die es offenbar nicht erwarten konnten, endlich das im Dunst kaum auszumachende Festland zu erreichen, um dort ein paar Frühaufsteher zu ersäufen.
Wegen der klemmenden Tür hatte er schon mindestens hundertmal diesen begriffsstutzigen Schreiner in Marina di Campo angerufen. Die Pflanzen in den schweren Terrakottatöpfen, die die Terrasse zum gefährlich steilen Abhang hin begrenzten, waren vom Sturm völlig zerrupft. Sie hatten schon vorher so vor sich hin gekümmert, dass ihm das Herz blutete. Mehrfach hatte er deshalb einen Gärtner in Porto Azzurro angebettelt, aber man schien auch dort keinen Wert auf Umsatz zu legen.
Ob es daran lag, dass er Deutscher war, oder brauchte man auf Elba über Jahre gewachsene Kontakte und spezielle Beziehungen, um einen Handwerker zu bewegen, etwas für einen zu tun? Musste man auf dieser bescheuerten Insel persönlich vorsprechen, auf Knien flehen und eine ordentliche Anzahlung auf den Tisch blättern, bevor hier irgendwer einen Finger rührte?
Heute war alles noch viel schlimmer als sonst: Weder der Fernseher im Wohn- noch der im Schlafzimmer funktionierte mehr, hatte Hagen feststellen müssen, als er um halb sechs mit schmerzendem Rücken auf der Couch im Wohnzimmer aufgewacht war. Was kein Wunder war, wie er bald begriffen hatte, denn der Strom war mal wieder ausgefallen. Vermutlich hatte der Sturm irgendwo auf den fünf Kilometern zwischen Porto Azzurro und seiner einsam am Hang liegenden Villa einen der morschen Holzmasten umgelegt, und wie er die Italiener kannte, würde es Wochen dauern, einen neuen aufzustellen und sein Haus wieder mit elektrischer Energie zu versorgen.
Notgedrungen hatte er am frühen Morgen die neuesten Nachrichten auf dem Handy gelesen, was allerdings auch nicht lange funktionierte, weil bald der Akku leer war. Er hatte versucht, wieder einzuschlafen, was jedoch nicht klappte, da sein Blutdruck vor Ärger vermutlich auf hundertfünfundneunzig war. So hatte er sich schließlich in die Folterkammer begeben, wo das Wasser demnächst kniehoch stehen würde, wenn es öfter so regnete wie in der vergangenen Nacht, und hatte sich auf dem Steptrainer abgestrampelt. Dann hatte er sich mit dem Hightech-Trimmrad herumgequält, bis ihm die Puste ausging. Wodurch sich seine Laune aber auch nicht gebessert hatte.
Die Folterkammer war der Raum seines verwinkelten Heims, der am tiefsten lag. Der todsicher schwachsinnige Architekt hatte sich einen Spaß daraus gemacht, jeden Raum auf einer anderen Ebene anzuordnen. Ständig ging es ein paar Stufen hinauf oder hinab, und sein fensterloser Fitnessraum lag ganz unten, mit der rückwärtigen Wand im Fels. Schon, als Hagen einzog, hatte sie einen Riss gehabt, der mit der Zeit immer breiter und länger wurde, und als es im November zu regnen begann, war durch den Spalt Wasser gesickert. Anfangs nur wenig, dann immer mehr.
Er hatte Balken besorgt, in Stücke gesägt, um seine Geräte aufzubocken. Als es im Januar überhaupt nicht mehr aufhören wollte zu regnen, hatte er dickere Balken besorgt, und wenn das noch eine Weile so weiterging, dann würde das Wasser demnächst ins Wohnzimmer und in die Küche laufen. Seine Versuche, der nassen Bescherung mit Eimern Herr zu werden, hatten nur Hagens Rückenschmerzen verstärkt, den Wasserstand jedoch kaum gesenkt. Demnächst musste er sich endlich eine Lösung für dieses Problem einfallen lassen.
Von der körperlichen Anstrengung im abgesoffenen Fitnessraum war er jetzt völlig verschwitzt. Es war Viertel vor sieben, der Regen hatte endlich aufgehört, und nichts in seiner tollen Villa mit fast dreihundert Quadratmetern Wohnfläche, sensationellem Meerblick, undichtem Pool und eigenem Ministrand, den er nie benutzte, funktionierte mehr. Immerhin war ihm beim Work-out eingefallen, dass er das Handy im Ferrari aufladen konnte. So würde er demnächst wenigstens wieder mit der Außenwelt in Verbindung treten können.
Die Frage war nur, wozu? Wen sollte er anrufen? Wem eine Nachricht schicken?
Was für eine Schnapsidee, sich auf Elba niederzulassen und diese auf den ersten Blick so nett anzusehende Bruchbude zu kaufen! Auf dieser Insel am Ende der Welt, wo absolut nichts los war, wo er niemanden kannte, die Menschen, die Deutsch verstanden, an zwei Händen abzuzählen waren, und jede Zugehfrau eine noch größere Katastrophe war als die vorhergehende.
Die erste, Laura, war zu hübsch und zu jung gewesen, hatte über alles und jedes gelacht und schon am ersten Tag versucht, ihn zu verführen. Natürlich, um den offenkundig reichen Tedesco baldmöglichst vor den Traualtar zu schleppen und anschließend mit Unterstützung ihrer Großfamilie nach Kräften auszuplündern. Im Putzen war sie eine Null gewesen, seine Sprache hatte sie weder verstanden noch zu lernen versucht, und alles, was sie kochte, hätten selbst die Schweine auf dem Bauernhof unweit von Bielefeld, wo Hagen aufgewachsen war, nur unter Protest gefressen.
Wie die zweite und dritte Haushaltshilfe hießen, hatte er glücklicherweise vergessen. Sie waren beide schon in den Fünfzigern gewesen, hatten ihn im Großen und Ganzen in Ruhe gelassen, aber sobald er länger als zehn Sekunden nicht hinsah, Pause gemacht, um auf ihren Telefoninos herumzudaddeln oder hinter dem Haus zu rauchen.
Mit Nummer vier, Chiara, hatte er es immerhin fast drei Monate ausgehalten. Auch mit ihr konnte er sich nur mit Händen und Füßen verständigen, doch sie war immerhin klug genug gewesen, immer früher oder später zu begreifen, was er von ihr wollte. Zudem war sie fleißig und halbwegs geschickt gewesen, konnte sogar recht passabel kochen, war allerdings irgendwann einfach nicht mehr aufgetaucht.
So hatte er wieder einmal seinen Zettel im Coop in Porto Azzurro aufgehängt, in dem er auf Italienisch (von Google übersetzt) nach einer Deutsch sprechenden Zugehfrau suchte, die zuverlässig und außerdem imstande war, ein für den menschlichen Verzehr geeignetes Mittagessen zuzubereiten.
Nummer fünf hörte nun also auf den Namen Violetta, war erst seit zwei Wochen bei ihm und dämlicher als die ersten vier zusammen. Sie war noch hübscher als Nummer eins, lauter als Nummer drei, kleidete sich bunter als Nummer zwei, redete ohne Punkt und Komma und ohne jede Rücksicht darauf, ob er sie verstand oder nicht, und war ein Genie darin, mit einfachsten Mitteln größtmögliche Katastrophen herbeizuführen. Beim Versuch, das Bad sauber zu machen, hatte sie gleich am ersten Tag den Spiegelschrank mitsamt Schrauben und Dübeln heruntergerissen – den allerdings vermutlich ein Italiener mit zwei linken Händen aufgehängt hatte – und dabei das Waschbecken gleich mit zertrümmert. Zwei Tage später hatte sie – bis heute konnte er sich nicht erklären, wie – den Teppich im Schlafzimmer in Brand gesetzt und beim Löschversuch seine Matratze so gründlich gewässert, dass er am nächsten Tag nach Portoferraio fahren musste, um eine neue zu besorgen. Die dann natürlich nicht in den Ferrari passte, sodass er sie liefern lassen musste. Immerhin sprach der Verkäufer Englisch, besser als er selbst sogar, und es war eine Wohltat, sich mit ihm zu unterhalten. Zu seiner großen Verblüffung wurde die Matratze dann auch wie versprochen noch am selben Tag gebracht.
An ihrem vierten oder fünften Tag verletzte Violetta sich beim Zwiebelschneiden so übel, dass er Erste Hilfe leisten und sie anschließend ins Krankenhaus von Portoferraio fahren musste, um die Wunde nähen zu lassen. Hagen war schon fast gespannt, welches Unheil sie heute anrichten würde.
Allmählich wurde ihm kalt, sein T-Shirt war immer noch schweißfeucht, der Wind blies nach wie vor kräftig. So setzte er sich in Bewegung, um herauszufinden, was der nächtliche Sturm so alles angerichtet hatte.
Immerhin war dieses Mal kein Baum auf seinem Grundstück umgefallen, und am Haus schien im Großen und Ganzen noch alles dran zu sein. Nur der Plattenweg zum Parkplatz, der oberhalb des in den Hang gebauten Hauses lag, hatte unter den Wasserfluten gelitten. Aber den würde er selbst in Ordnung bringen können. Es war in den sechs Monaten, die er hier hauste, ja erst das achte oder neunte Mal, dass der Weg verwüstet war. Auch der Ferrari, der zum Glück in der Garage stand, hatte keinen Schaden genommen.
Hagen kroch ins Auto, fummelte das Ende des Ladekabels ins Handy und stellte befriedigt fest, dass das Ding tatsächlich lud. Immerhin etwas, das an diesem Katastrophenmorgen funktionierte.
Als er von oben auf die verschachtelte Villa aus Beton und Glas blickte, entdeckte er, dass der Sturm das Stahlrohr umgerissen hatte, an dem die Satellitenschüssel befestigt war. Die Schüssel selbst lag in dem See, der sich über Nacht auf dem Flachdach gebildet hatte. Offenbar war der Ablauf schon wieder verstopft, und er würde auch nicht fernsehen können, wenn es wieder Strom gab. Aber darum würde er sich später kümmern. Jetzt brauchte er erst einmal einen starken Kaffee und etwas zu beißen.
Vorsichtig stieg er den zerstörten Weg zur Terrasse hinunter. Manche Platten fehlten ganz und lagen jetzt vielleicht am Strand, andere waren unterspült und gefährlich wacklig. Doch er erreichte die Terrasse unversehrt.
Als er den plötzlich vom Licht der Morgensonne durchfluteten, riesigen Wohnraum betrat, wurde ihm bewusst, dass es ohne Strom auch keinen Kaffee geben würde. Außerdem würde der Gefrierschrank im Lauf des Tages abtauen, sodass er spätestens am Abend den kompletten Inhalt zu den Mülltonnen würde hinaufschleppen dürfen.
Was für ein Scheißleben!
Was für ein Scheißwetter!
Was für eine Scheißinsel!
Von der Straße hörte er das Geknatter eines Fiat Punto mit defektem Auspuff näher kommen. Violetta rückte an. Nachdem er sie mehrmals auf Deutsch und mit unmissverständlichen Gesten zur Uhr ermahnt hatte, weil sie jeden Tag mindestens eine halbe Stunde zu spät kam, war sie heute also eine Dreiviertelstunde zu früh.
Das Geknatter erstarb. Eine Autotür schepperte zu, leichte Schritte auf dem Plattenweg – hoffentlich verletzte sie sich nicht schon, bevor sie das Haus überhaupt betreten hatte –, und schon erklang ihr schmerzhaft fröhliches »Buongiorno, signor Berensen! Come va?«
Sie fegte herein, warf ihre passend zum Namen violette Jeansjacke mit Schwung aufs Sofa, die Handtasche hinterher und strahlte ihn tatendurstig an. Wie üblich mit einem Viertelpfund Schminke im wohlproportionierten Gesichtchen mit den großen dunklen Kleinmädchenaugen und der lustigen Stupsnase.
»Espresso?«, fragte er zaghaft und deutete auf die Küche.
»Sì sì, lo faccio subito«, plapperte sie. »Vuole un caffè?«
»Espresso, sì, aber …«
Wie sollte er ihr begreiflich machen, dass es keinen Strom gab? Er zuckte die Achseln. Sie würde es selbst merken.
Kurz darauf hörte er sie in der Küche werkeln und tüchtig Lärm erzeugen. Krach zu machen, schien überhaupt eine Lieblingsbeschäftigung der Bewohner dieser trostlosen Insel zu sein. Hagen wartete vergeblich auf ein Zeichen von Verblüffung oder Verwunderung von Violetta. Für Sekunden war es sogar still, und dann, oh Wunder, kam sie stolz und mit einem duftenden schwarzen Tässchen in der Hand herein. Sie schaffte es sogar, es ohne zu stolpern auf den Esstisch zu stellen, erzählte ihm mit leuchtenden Augen etwas von »bagno« und wirbelte davon.
Verblüfft schnupperte Hagen am Kaffee, drückte den Lichtschalter, um zu testen, ob der Strom vielleicht schon wieder funktionierte, und erinnerte sich endlich daran, dass der Herd mit Gas betrieben wurde. Das Gas kam aus roten Stahlflaschen, die alle paar Tage leer waren, sodass er sie nach Porto Azzurro karren und dort gegen volle eintauschen musste.
Nachdem er reichlich Zucker hineingerührt hatte, schmeckte der Espresso gar nicht mal übel. Oben rumpelte etwas bedrohlich, aber der Schrei, den Violetta bei größeren Schäden von sich zu geben pflegte, blieb aus.
Er schlappte zu seiner hellgrauen Sitzlandschaft hinüber, die ein Schweinegeld gekostet hatte und ihm regelmäßig Rückenschmerzen bescherte, und ließ sich seufzend darauf fallen. Nach dem Espresso war ihm ein wenig wohler, und er beschloss, eine ordentliche Dusche zu nehmen. Vielleicht war ja noch genug Wasser im elektrischen Boiler. Violetta konnte das Bad ebenso gut später …
Da war er, der Unheil verkündende Schrei!
Oben krachte etwas, Scherben klirrten, ein Scheppern und ein zweiter Schrei. Bisher hatte sie immer nur einmal geschrien.
Er würde sie feuern.
Jetzt sofort.
Den Zettel im Supermercato hatte er in finsterer Vorahnung gar nicht erst abgenommen.
5
Die Schüssel mit der Ribollita in der einen und die cognacbraune Lederjacke in der anderen Hand, schlüpfte Fiorina Luccarelli in ihre Schuhe und verließ die Wohnung. Drei Stunden hatte sie geschlafen, bevor sie schließlich die Pfütze im Flur aufgewischt und sich unter die Dusche gestellt hatte, immerhin. Den Rest würde sie später nachholen. Wenn sie wieder zu Hause war und den Job als Putzfrau hoffentlich nicht bekommen hatte.
Sie stellte den Eintopf auf der Treppe ab, die nach oben führte, und steckte den Schlüssel ins Schloss der Wohnungstür. Als sie ihn umdrehte, fiel ihr ein, dass sie sie nach dem Aufbruch ihrer Mutter am frühen Morgen nicht abgesperrt hatte. Ebenso wenig wie die Haustür unten. Stattdessen war sie todmüde ins Bett gefallen. Oddio …
Seufzend stieg Fiorina mit dem Eintopf die knarrenden Holzstufen hinauf, vorbei an der Wohnung im zweiten Obergeschoss, für die ein stinkreiches, kinderloses Ehepaar aus Bologna Monat für Monat Miete bezahlte, nur um an den drei, vier Wochenenden, die sie im Sommer auf der Insel waren, nicht im Hotel wohnen zu müssen, und …
War da nicht ein Geräusch gewesen? Hinter der Tür? Sollten die Bolognesi etwa schon hier sein?
Fiorina verharrte, hörte jedoch nichts mehr. Sie ging weiter. So ein altes Haus, dachte sie kopfschüttelnd, machte ja ständig irgendwelche Geräusche.
Im obersten Stockwerk bollerte sie mit dem Ring des Türklopfers, einem weit aufgesperrten Löwenmaul aus blind gewordenem Messing, gegen das alte Holz. Als ihre uralte Großmutter wie üblich nicht reagierte, öffnete sie die Tür, die ebenfalls nicht abgesperrt war. Es war zum Aus-der-Haut-Fahren, dass in diesem Haus niemand außer ihr jemals daran dachte, eine Tür abzuschließen. Falls sie es – wie heute – nicht auch vergaß …
»Buongiorno, nonna!«, rief Fiorina in den dunklen, muffigen und nach Moder riechenden Flur und stolperte über einen Korb mit zerfledderten Büchern und Porzellanbechern, der gestern noch nicht hier gestanden hatte. Offenbar war die alte Dame noch am Leben. »Ich bringe dir das Essen. Bist du schon auf?«
Wie immer – keine Antwort.
Nonna Maria lebte hier oben unter dem Dach wie ein Gespenst. Seit ihr einziger Sohn, Fiorinas Vater, verschwunden war, hatte sie sich mehr und mehr in ihrer eigenen Welt verkrochen. Ihre Wohnung verließ sie nur noch unter Zwang und kreischendem Protest. Jedes Mal, wenn sie zum Arzt gebracht werden musste, war es ein Riesendrama, und selbst die Sonntagsmesse besuchte sie inzwischen nur noch in Ausnahmefällen.
Tausendmal hatte Mamma ihre betagte Schwiegermutter schon zu überreden versucht, in die leer stehende Erdgeschosswohnung zu ziehen. Leider fehlte es am Geld für die dort nötigen Renovierungsarbeiten, aber irgendwie würde es schon gehen. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, sie in Federicos Zimmer zu stecken. Der wäre glücklich, sich in der Dachwohnung ausbreiten zu können, wo er sich endlich ein kleines Atelier einrichten könnte. Aber auch hier oben müsste erst einmal das Dach abgedichtet und alles Übrige gründlich renoviert werden.
Vorsichtig bahnte Fiorina sich einen Weg durch das Gerümpel, das überall herumlag. Sie stieg über defekte Regenschirme, Kisten mit Frauenzeitschriften von anno dazumal und der Inseltageszeitung Il Tirreno aus den letzten zwanzig Jahren, mottenzerfressenen Pelzmänteln, Schals und Hüten. Nonna Maria war noch nie eine Freundin des Saubermachens gewesen, über die Jahre hatte sie sich jedoch mehr und mehr zu einem Messie entwickelt.
Wieder einmal schwor Fiorina sich, demnächst einige Nachmittage zu investieren, um diese finstere Höhle gründlich auszumisten. Und wieder wusste sie schon jetzt, dass sie den guten Vorsatz nicht in die Tat umsetzen würde. Es würde sie viel zu viele Nerven kosten, wegen jedem einzelnen Ding stundenlang mit der Nonna zu diskutieren.
Die Küche war zugemüllt wie der Rest der Wohnung, es roch nach vergammeltem Prosciutto und alter Frittata. Immerhin erreichte Fiorina den Kühlschrank, ohne über die losen und an vielen Stellen gesprungenen Fliesen zu stolpern, die ebenfalls dringend erneuert werden mussten. Sie nahm sich vor, Federico noch einmal auf das Thema anzusprechen, wenn er aus seinem Schönheitsschlaf erwacht war.
Aus einem der hinteren Zimmer hörte sie das vertraute Klappern und Rumpeln. Nonna Maria war also doch schon wach und wie üblich damit beschäftigt, irgendwelchen Plunder von einer Ecke in die andere zu räumen.
Fiorina schüttete das Wasser aus der grünen Plastikschüssel weg, die sie gestern in weiser Voraussicht an die Stelle des Esstischs gestellt hatte, wo es bei Regen immer von der Decke tropfte. Heute war sie voller denn je. Ob sie wohl jemals so viel Geld haben würden, um das Dach nicht nur notdürftig zu flicken, sondern richtig instand setzen zu lassen?
Mit einem noch tieferen Seufzen riss sie Fenster und Läden auf, um frische Luft hereinzulassen. Nur mit Mühe fand sie einen Platz für die Schüssel mit dem Eintopf, den niemand auf Elba besser zubereitete als ihre Mamma. Früher war auch Nonna Maria für ihre Kochkünste berühmt gewesen, doch das war Ewigkeiten her. Mit ihren vierundneunzig Jahren und beängstigend zittrigen Händen konnte sie kaum noch ein Messer halten, geschweige denn ein Essen zubereiten.
Fiorina zählte die Tabletten auf das Tellerchen mit Goldrand. Jeden Morgen, wenn sie kam, waren die vom Vortag verschwunden, was hoffen ließ, dass die Nonna ihre Medizin auch tatsächlich schluckte. Kurz überlegte Fiorina, ins Schlafzimmer zu gehen, um ihre Großmutter zu begrüßen und vielleicht sogar einige Worte mit ihr zu wechseln. Aber sie fürchtete, dies könnte aufseiten der alten Dame eine ihrer üblichen Schimpfkanonaden auslösen, und verzichtete lieber. Die Einzige, die überhaupt noch zu ihr durchdrang, war Fiorinas Mutter. Jeden Abend sah sie nach der Nonna und machte ein wenig Ordnung, so gut es eben ging.
Kopfschüttelnd schloss Fiorina die Fenster wieder, hielt sich die Nase zu und verließ eilig die Wohnung.
Minuten später stand Fiorina in der Via del Carmine und hielt nach ihrem quietschgelben Fiat Tipo Ausschau, den sie sich mit Federico und ihrer Mutter teilte. Doch die Stelle, an der ihr Bruder ihn sonst zu parken pflegte, war von einem rostigen Lieferwagen belegt. Davor und dahinter drängten sich die Kleinwagen der Nachbarn und der SUV der Florentiner Familie, die am Ende der Gasse eine Ferienwohnung hatte. Vermutlich hatte Federico den Fiat weiter oben in der Via Victor Hugo abgestellt.
Die Sonne stand schon hoch über den rosa, ockerfarben oder zartgelb gestrichenen Häusern, nur in den Ecken, die ihre Strahlen nicht erreichten, war das Pflaster noch regennass. Der Sirocco, der aus dem Süden kam und sich um diese Jahreszeit – wie in der vergangenen Nacht – gern zu einem kräftigen Sturm mauserte, war nur noch ein frisches Windchen. Weiße Tuffwölkchen spielten am Himmel Fangen, Möwen zogen ihre Kreise.
Nunzio Giaccone, der sonst jeden Vormittag auf seinem Stuhl vor dem Haus oder einige Meter weiter auf der Piazza Antonio Gramsci saß, war noch nicht zu sehen. Auch sonst begegnete Fiorina niemandem außer dem wie immer fröhlich vor sich hin pfeifenden Briefträger, zwei schon jetzt müden Handwerkern in verstaubten Overalls und einer Mittvierzigerin im Businesskostüm auf einem knatternden ferrariroten Motorroller. Fiorina warf einen Blick aufs Handy. Es war halb zehn und damit Zeit für ihr Frühstück. Vielleicht würde sie anschließend mit etwas wacherem Kopf das Auto finden.
»Ciao, dottoressa, tutto a posto?«, begrüßte sie Gabriele, den Barista in der kleinen Bar am Rand der Piazza, wo sie fast jeden Morgen einen Cappuccino und ein Blätterteighörnchen zu sich nahm, wahlweise mit Vanille- oder Nougatcreme gefüllt. »Mamma, Nonna, Federico – alle wohlauf?«
Obwohl sie nicht promoviert hatte, stand ihr als Hochschulabsolventin in Italien die förmliche, aber nicht ganz ernst gemeinte Anrede Dottoressa zu.
Ende der Leseprobe