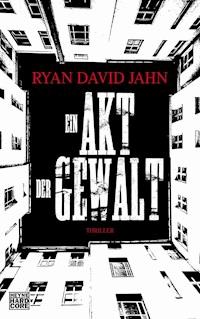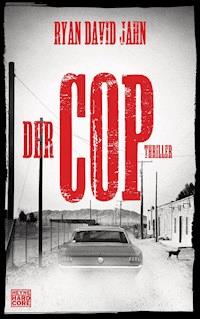
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Telefon klingelt. Es ist deine Tochter. Sie ist seit vier Monaten tot.
Ian Hunt hat noch eine knappe Stunde bis Schichtende, als seine Tochter anruft. Es ist über sieben Jahre her, dass er ihre Stimme zuletzt gehört hat. Vor vier Monaten wurde sie für tot erklärt. Plötzlich wird der Anruf von einem Mann unterbrochen. Es ist der Mann, der Maggie vor sieben Jahren aus dem Kinderzimmer entführt hat. Maggie kann noch vage Angaben zu ihrem Entführer machen, dann bricht die Verbindung ab. Eine gnadenlose Jagd quer durch Amerika nimmt ihren Lauf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
RYAN DAVID JAHN
DER COP
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Ulrich Thiele
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Dispatcher bei Macmillan, London
Copyright © 2011 by Ryan David Jahn
Copyright © 2012 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Ulf Müller
Umschlaggestaltung: © Melville Brand Design, unter Verwendung des Originalmotivs: © Maggie Payette; Artwork: © Jonathan Barkat;
Fotos: © Stephen Shore / Gallery Stock, DEK / ImageBroker / Superstock
Gesetzt aus der 11,5/12,2 Punkt Kepler Light bei C. Schaber Datentechnik, Wels
ISBN 978-3-641-07969-7V003
www.heyne.de
Für meinen VaterTHOMAS NATHAN JAHN1949–2004
Liebst du mich nicht, so werde ich nicht geliebt.Lieb ich dich nicht, so werde ich nicht lieben.
SAMUEL BECKETT
Was aus Liebe getan wird,geschieht immer jenseits von Gut und Böse.
FRIEDRICH NIETZSCHE
EINS
Ian Hunt hat noch eine knappe Stunde bis Schichtende, als seine tote Tochter anruft. Es ist über sieben Jahren her, dass er ihre Stimme zuletzt gehört hat. Damals war sie ein anderer Mensch – ein siebenjähriges Mädchen mit dicklichen Fingern, einem fehlenden Schneidezahn und grünen Augen, die einem das Herz brechen konnten, wenn sie es darauf anlegte. Deshalb begreift Ian im ersten Moment nicht, dass er tatsächlich mit seiner Tochter spricht.
Aber es ist seine Tochter.
Ian sitzt in der Leitstelle des Polizeireviers von Bulls Mouth, Texas, in einem kleinen Gebäude an der Crouch Avenue. Wie gewöhnlich ist er allein im Zimmer, aber würde er sich aufraffen und seinen Kopf durch die Tür in den Empfangsraum stecken, würde er dort mit ziemlicher Sicherheit Chief Davis sehen, wie er auf seinem zurückgekippten Stuhl döst, die Stiefel auf dem Tisch, den Stetson über die Augen gezogen. Im Fenster links von Ian rumort die urzeitliche Klimaanlage, Wasser tropft von den Lamellen auf den verschimmelten Teppichboden, doch die Julihitze lässt sich davon kaum beeindrucken. Ian rinnt der Schweiß über die Schläfen. Er neigt den Kopf, hebt die Schulter und reibt die Feuchtigkeit ins Uniformhemd, bevor er sich wieder der Solitär-Partie auf dem rechnergestützten Einsatzleitsystem widmet. Gott sei Dank weiß niemand, dass er fünfundneunzig Prozent seiner Arbeitszeit mit Patiencen totschlägt. Die Leute würden ausrasten, wenn sie es erführen.
Aber Bulls Mouth ist nun mal keine besonders große Stadt: inklusive Umland dreitausend Menschen, und das auch nur dann, wenn man die ganzen Endzeitfanatiker, selbst ernannten Propheten, Schlangenbeschwörer, Meth-Köche, Schulabbrecher und Junkies mitzählt. Wahrscheinlich sollte man sie mitzählen. Mit all diesen Leuten muss die Polizei von Bulls Mouth sich schließlich herumschlagen.
Obwohl Bulls Mouth das prototypische Provinznest ist, handelt es sich bei ihm doch um die zweitgrößte Stadt im gesamten Tonkawa County. Immerhin ein Viertel von dessen Bevölkerung wohnt hier.
Ian greift zum Kaffeebecher und kippt sich die kalte Brühe die Kehle hinunter. Er schneidet eine Grimasse, nimmt aber trotzdem einen zweiten Schluck. Es hilft nichts, er muss seine drei Kannen Folgers-Kaffee täglich schaffen, und so schüttet er sich einen Becher nach dem anderen hinunter, während er sich durch Hunderte Partien von Solitär klickt.
Kaum hat er den Becher abgestellt, kommt der Anruf rein, von einem Münztelefon an der Main Street, ein Stückchen nördlich der Flatland Avenue. Wahrscheinlich bloß ein Scherz, denkt er. Warum sonst sollte man im Handyzeitalter noch ein Münztelefon benutzen? Nein, wahrscheinlich wollen nur ein paar angeödete Highschool-Kids ein bisschen auf den Putz hauen, um sich den langweiligen Sommertag zu vertreiben. Ian kann ihnen nicht wirklich böse sein, denn damals in Venice Beach, Kalifornien, als er selbst noch jung war, war er genauso drauf.
»Polizeinotruf. Was kann ich für Sie tun?«, spricht er ins Headset, die Finger schon über der schwarzen Tastatur, um die notwendigen Informationen einzugeben.
»Bitte helfen Sie mir!«
Ein Mädchen oder eine Frau, Ian ist sich nicht sicher. Auf jeden Fall zittert die Stimme vor Panik, und das Mädchen/die Frau ist völlig außer Atem. In der Leitung knackt es, als würde ein heftiger Wind wehen. Sie keucht in den Hörer, tief aus ihrer Kehle dringen hohe Quietschlaute. Wenn das ein Scherz ist, hat er es mit einer verdammt guten Schauspielerin zu tun.
»Bitte, Ma’am, bewahren Sie Ruhe. Sagen Sie mir einfach, was los ist.«
»Er ist hinter mir her, er …«
»Wie heißen Sie, und wer ist hinter Ihnen her?«
»Ich heiße Sarah. Das heißt, nein. Nein, ich heiße Maggie, Maggie Hunt, und der Mann, der hinter mir … Ich war … Er … Er …«
Maggie Hunt. Ian spürt seine Lippen nicht mehr. Ein eigenartiges Zittern läuft durch seinen Körper, als wäre in ihm eine Stahlsaite angeschlagen worden. Schwindelgefühl in fis-Moll.
Er schluckt.
»Maggie?« Ian atmet durch die Nase ein und durch den Mund aus, ein lang gezogenes, bebendes Seufzen. »Ich bin’s, Maggie. Daddy.«
Die Beerdigung war im Mai, das ist jetzt zwei Monate her. Eigentlich wollte Ian keine Beerdigung. Was für ein absurdes Ritual, dachte er – eine Vergangenheit zu begraben, die noch so lebendig war. Noch so lebendig ist. Man schaufelt doch niemandem ein Grab, solange sein Herz noch schlägt. Aber Debbie überzeugte ihn schließlich. Es ginge nicht anders, sagte sie, sie brauche einen deutlichen Schlusspunkt. Zumindest war das die Meinung ihres Therapeuten, für dessen Ratschläge sie jedes Mal bis nach Houston fuhr. Also hielten sie die Beerdigung ab. Viele Leute kamen. Pastor Warden stellte sich vor einen kleinen, leeren Sarg und erging sich in Gemeinplätzen.
Seine Worte waren genauso leer wie der Sarg.
Die Leute weinten, sangen Lieder, selbst wenn sie nicht singen konnten, sanken auf die Knie, neigten den Kopf und beteten. Sie betrachteten Bilder der hübschen kleinen Maggie, von ihrem ersten Lebensjahr bis zum siebten, aber nicht darüber hinaus. Maggie in ihrem Kinderstuhl, das Gesicht mit Kuchen verschmiert. Maggie bei ihren ersten wackligen Gehversuchen. Maggie vor blauem Hintergrund auf dem Porträt im Jahrbuch ihrer zweiten Klasse. Maggie auf der Treppe vor ihrem Haus am Grapevine Circle Nummer 44, mit aufgeschlagenem Knie, einem Sturzhelm auf dem Kopf und einem durchtriebenen Grinsen im Gesicht. Wie die Grinsekatze aus dem Wunderland.
Im September wäre sie fünfzehn geworden.
Ian hatte nicht mitgesungen. Auch nicht mitgeweint. Er hatte überhaupt keinen Laut von sich gegeben. Stattdessen saß er in der letzten Reihe, mit geradem Rücken, die gefalteten Hände auf dem Schoß. Schon im Mai war es in der Baptistenkirche von Bulls Mouth brütend heiß, aber er wischte sich nicht den Schweiß von Stirn oder Schläfen. Er rührte sich überhaupt nicht. Sein Kopf war wie ein leeres Zimmer, unmöbliert. Erst als die Leute kamen, um ihm ihr Beileid auszusprechen, bewegte er sich wieder. Er schüttelte ihnen die Hände, bedankte sich, ließ sich auf jede Umarmung ein. Dabei wollte er die ganze Zeit nur weg, nach Hause gehen und allein sein.
Ganz zum Schluss kam Debbie. Mit Bill Finch, ihrem neuen Mann. Auch Bill war Gesetzeshüter; allerdings arbeitete er nicht für die städtische Polizei, sondern für die Dienststelle des Sheriff’s Department von Tonkawa County in Bulls Mouth, gleich neben dem County-Gefängnis gegenüber von Ians Polizeirevier. Bill stürzte sich immer wieder in Kompetenzstreitigkeiten mit Chief Davis, selbst wenn es bloß um irgendwelche Kleinigkeiten ging, die seit jeher von der örtlichen Polizei geregelt wurden. Überflüssige Diskussionen, die meist in lautstarken Auseinandersetzungen zwischen Davis und Sheriff Sizemore, Bills Vorgesetztem, mündeten. Bill war einer von drei Beamten, die das County in Bulls Mouth stationiert hatte, ihr eigentliches Hauptquartier hatten sie in Mencken. Da die Polizei in Bulls Mouth das Tagesgeschäft mehr oder weniger allein abwickelte, landeten sämtliche Notrufe zunächst in Ians Leitstelle.
Auf der Beerdigung hatte Debbie ihn umarmt und sich bedankt, dass er der Zeremonie zugestimmt hatte. Bill und er nickten sich knapp zu, doch keiner der beiden streckte die Hand aus. Dann gingen sie ihrer Wege – Debbie und Bill zu ihrem Haus, den mittlerweile dreijährigen Zwillingen, den zwei Hunden, dem Garten mit Swimmingpool. Ian zu seinem Apartment an der College Avenue, dem summenden Kühlschrank und seinem persönlichen Ozean aus Reue.
»Daddy?«, fragt Maggie ins Telefon.
Einen Moment glaubt er, die Sprache verloren zu haben. »Ja … Ich … Ich bin hier«, antwortet er schließlich. Erst jetzt erinnert er sich an seine eigentliche Aufgabe. »Bitte sag mir, wo du bist. Auf der Main Street?«
Die Ortsangabe des Leitsystems ist eindeutig, aber nicht immer verlässlich. Und wenn seine Tochter in Gefahr ist, will er sichergehen, dass er den Streifenwagen auch zur richtigen Stelle schickt.
»Ich weiß nicht. Bitte hilf mir!«
»Ja, Maggie, ja. Ich helfe dir. Aber dazu muss ich wissen, wo du bist. Siehst du ein Straßenschild? Oder irgendwelche Läden?«
Eine unendlich lange Pause. Ganze Kontinente entstehen und vergehen. »Ja, ja, das ist die Main Street, das Main Street Shopping Center!«
Noch vor zwei Monaten war sie tot. Während Ian mit seiner Tochter spricht, steht ihr Grabstein auf dem Hillside Cemetery gleich hinter der Wallace Street. Reihe 17, Nummer 29. Doch das Grab ist leer, und der Mensch, der eigentlich dort unter der Erde liegen sollte, befindet sich im Main Street Shopping Center und presst sich einen Telefonhörer ans Ohr.
Seine Tochter lebt. Ian weiß es, denn er kann sie atmen hören.
»Gut, Maggie, gut. Und der Mann, der dich entführt hat, wie sieht er aus?«
»Er … Er ist groß«, sagt sie, »mindestens so groß wie du, vielleicht noch größer. Und alt, wie ein Opa. Oben auf dem Kopf hat er keine Haare mehr, da kann man seine Haut glänzen sehen. Und seine Nase … an seiner Nase sind lauter aufgeplatzte Adern und … Oh Gott, er kommt! Daddy, er kommt!«
Ian ringt um Atem. Er muss schlucken, um überhaupt etwas herauszubringen. »Was hast du an?«
»Was? Er kommt!«
»Maggie, was hast du an?«
»Ein … ein Kleid, ein blaues Kleid mit rosa Blumen drauf!«
»Weißt du, wie der Mann heißt?«
»Er heißt H…«
Weiter kommt sie nicht. Ian hört nur noch ihren Schrei.
Am anderen Ende kracht der Hörer gegen irgendetwas, anscheinend schwingt er an der Schnur. Noch ein Krachen, und noch eins, und so weiter, wie Trommelschläge, die in immer kürzeren Abständen ausklingen. Bis kein weiterer Schlag mehr folgt, bis sich die Stille ins Unendliche dehnt. Nichts als leerer Raum.
Wäre die Tür nicht offen gewesen, wäre Maggie nicht geflohen.
Sie hätte es nicht mal versucht. Nach Jahren der Gefangenschaft ist ihre Hoffnung erkaltet. Maggie spürt sie nicht, schon lange nicht mehr. Gut möglich, dass sie gar nicht mehr da ist. Oder doch? Ja, vielleicht existiert die Hoffnung noch, als kleiner Schimmer.
Egal ob Tag oder Nacht, sie ist immer hier unten. Sie ist am Leben, aber unter der Erde. Begraben, gefangen zwischen den Betonwänden des Kellers, im Albtraumland. So hat sie diesen modrig stinkenden Ort getauft. Sie ist allein mit den lebendigen Schatten, allein mit ihren Gedanken.
Aber nicht immer. Manchmal ist Borden bei ihr. Sie hat ihn damals erst nach ein paar Tagen entdeckt, er hatte sich in den Schatten versteckt. Ein kleiner, dünner Junge in Chucks, Levis und einem roten, zugeknöpften Hemd, das er immer in die Hose steckt. Aber sein Gesicht ist kein normales Jungengesicht. Vom Haaransatz bis zur Schnauze ist es von glänzendem braunem Fell bedeckt. Er hat schwarz schimmernde Pferdeaugen und aufgeblähte Nüstern und riesige, rechteckige Zähne. Am Anfang hat sie sich vor ihm gefürchtet, aber ihre Einsamkeit war größer als ihre Angst. Jetzt ist er ihr bester, ihr einziger Freund.
Er hat ihr nie gesagt, wie er hierhergekommen ist. Außer Maggie weiß niemand, dass er bei ihr ist. Sobald oben die Tür aufgeht, sobald die ersten Schritte auf der Holztreppe knarren, versteckt er sich. Maggie versteckt sich nicht. Es würde nichts bringen. Sie wissen, dass sie hier ist, sie haben sie hergebracht, an diesen schrecklichen Ort. Es ist ein winziger Ort, abgeschnitten vom Rest der Welt, getrennt vom blauen Himmel, von den Bäumen und den Wiesen und den Freundinnen, mit denen sie früher gespielt hat.
Ihr einziger Zugang zur Außenwelt ist ein Fenster. Würde sie die Außenwelt nicht durch diese rechteckige Öffnung sehen, hätte sie schon vergessen, dass es noch etwas anderes als den Keller gibt. Aber sie kann nur gucken. Denn das Fenster ist zu klein, nicht mal eine Katze könnte sich hindurchzwängen. Dafür scheint morgens die warme, helle Sonne auf Maggies Haut. Kurz nach Mittag legen sich Schatten auf den Boden, sie werden immer länger, je später es wird, aber der Morgen gehört ihr.
Leider wuchert Unkraut draußen vor dem Fenster, und Dreckspritzer überziehen die Scheibe. Maggies größte Angst ist, das Unkraut könnte eines Tages so dicht werden, dass sie überhaupt nichts mehr sieht. Dass sie sich nicht mehr in den hellen Schein stellen kann, der die Dunkelheit jeden Tag für einen halben Tag zerteilt. Das heißt, nicht jeden Tag. Wenn es sehr wolkig ist, dringt nur ein fahles graues Leuchten in den Keller, das sie irgendwie immer an eine Erkältung denken lässt. Aber jetzt ist Sommer, der Himmel ist blau und das Licht strahlend hell.
Das war es zumindest.
Denn mittlerweile ist es Nachmittag. Die Sonne scheint zwar noch, aber sie ist auf die andere Seite des Hauses gewandert, und bald wird sie wieder am Horizont versinken.
Aber wenn das Licht in den Keller fällt, stellt sich Maggie mitten hinein. So lang wie möglich. Sie geht mit, während sich der helle Fleck langsam über den Boden schiebt. Doch jetzt ist die Sonne verschwunden, und sie sitzt auf ihrer Matratze in der Ecke, die Knie angewinkelt, die Arme um die Beine geschlungen. Neben ihr liegt ein Buch. Donald bringt ihr ab und zu Bücher, und manchmal gibt er ihr sogar Unterricht, aber im Moment hat sie keine Lust auf Lesen.
»Borden?«, fragt sie flüsternd in die Schatten. Keine Antwort.
Dann muss sie eben zählen. Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht. Maggie zählt oft. Wenn sie nicht zählt, drängen sich lauter schlimme Gedanken in ihren Kopf, und ihr wird schlecht. Manchmal hilft es, wenn sie liest, manchmal nicht. Zählen ist besser, das funktioniert immer. Sie zählt, bis ihr Kopf voller Zahlen ist. Am Anfang klappt es noch nicht so gut, weil die kleinen Zahlen zu einfach sind, da braucht sie sich nicht zu konzentrieren, und so können sich immer noch ein paar schlimme Gedanken dazwischenschmuggeln. Aber die hohen Zahlen, zum Beispiel zweitausenddreiundzwanzig, zweitausendvierundzwanzig, sind so groß, dass nichts anderes mehr Platz hat. Sie füllen den ganzen Kopf aus, alles in ihr wird still, und sie hat keine Angst mehr.
Schon bei dreihundertsiebzehn kommt Beatrice die Treppe herunter, um den leeren Teller vom Mittagessen zu holen. Er steht auf dem kleinen Klapptisch, an dem Maggie meistens isst. Manchmal setzt sich Borden zu ihr, dann reden sie über alles Mögliche, auch wenn sie sich hinterher kaum an die Gespräche erinnern kann. Und wenn sie ihm etwas von ihrem Essen geben will, schüttelt er immer den Kopf.
Dreihundertsieb…
Mit einem Knarren öffnet sich die Tür. Beatrice steht oben an der Treppe, ihr riesiger Schatten füllt den gesamten Türrahmen aus. Als sie den Schalter umlegt, leuchtet gelb die Glühbirne auf, die in der Mitte des Kellers von einem bräunlichen Kabel hängt. Blasses Licht vertreibt die Schatten. Maggie kneift die Augen zusammen und sieht zu, wie Beatrice die Treppe heruntersteigt: Sie stellt den rechten Fuß auf die erste Stufe, zieht den linken nach und atmet einen Moment durch. Dann setzt sie ihren Weg fort, wieder mit dem rechten Fuß voran.
»Wie geht es dir, Sarah?«, fragt sie, als sie unten angekommen ist.
»Ganz okay.«
»Gut.«
Maggie schweigt.
»Soll ich dir ein bisschen die Haare bürsten, bevor ich den Abwasch mache?«
»Nein.«
»Willst du mir die Haare bürsten?«
»Nein.«
»Geht’s dir auch wirklich gut?«
»Ja.«
»Du lügst mich doch nicht an, oder?«
»Nein.«
»Na gut.«
Beatrice geht zum Klapptisch und schnappt sich den leeren Teller. Er ist weiß mit blauen Blumenranken am Rand. Maggie hasst diesen Teller.
»Schön, dass du aufgegessen hast.«
»Ja, Ma’am. Danke für das Essen.«
»Ich wünschte mir, du würdest mich nicht immer Ma’am nennen.«
»Tut mir leid.«
»Ich wünschte mir, du würdest mich Mommy nennen.«
»Okay.«
»Das sagst du immer, und dann tust du’s doch nicht.«
»Tut mir leid.«
»Okay.«
Damit geht Beatrice zur Treppe zurück und schleppt sich wieder nach oben. Als sie die Hand schon an der Klinke hat, dreht sie sich noch einmal um.
»Zum Abendessen gibt’s Hackbraten. Mit schön viel geriebenen Karotten, genau wie du es magst.«
Beatrice schaltet das Licht aus, tritt in die Küche und zieht die Tür hinter sich zu. Aber Maggie hört kein Klicken des Schlosses. Sie hört auch nicht, wie der Riegel einrastet. Sie kauert auf der Matratze und lauscht in die Stille. Nichts.
Nach einer Weile steht sie auf und schleicht zum Fuß der Treppe. Sie schaut hinauf. Da oben, zwischen Tür und Wand, schimmert ein heller Spalt. Licht fällt auf die obersten Stufen; sie sind ausgetreten, abgeschliffen von den Schuhen, die so oft darüber hinweggeschlurft sind. Hier und da ragen rostige Nägel aus dem Holz.
»Borden«, sagt sie. »Borden, die Tür ist offen.«
Etwas in ihr wandelt sich. Die lange Sonnenfinsternis endet, das Licht kehrt in ihr Inneres zurück.
Noch bevor sie einen Entschluss fassen kann, noch bevor sich der Instinkt zu einer Handlung formt, spürt sie, wie ihr das Herz klopft bis zum Hals, wie ihr Mund schlagartig trocken wird. Ihre Hände ballen sich zu Fäusten und zerknittern das Kleid an ihrer Hüfte. Sie stellt erst einen nackten Fuß auf die unterste Stufe, dann den zweiten. Statt kühlem Beton spürt sie nun warmes, gemasertes Holz. Es fühlt sich gut an, irgendwie lebendig, als würde es zur Außenwelt gehören, nicht zu allem anderen hier unten.
Noch ein Schritt. Vorsichtig rollt sie den Fuß ab, verlagert das Gewicht auf die rechte Seite und drückt sich nach oben ab. Zum Glück ist sie leichter als Beatrice; bei der knarren die Stufen immer, Maggies Gewicht hingegen tragen sie schweigend. Bis auf das dumpfe Dröhnen des Fernsehers hinter der Wand und das rhythmische Pochen ihres Herzens in der Brust, den Ohren und ihren Schläfen ist es völlig still.
Der nächste Schritt – oh Gott, lass die Stufe bloß nicht knarren –, dann noch ein Schritt.
Als sie oben angelangt ist, kriegt sie kaum noch Luft. Ihre Handflächen jucken, und wenn sie ein- und ausatmet, klingt es, als hätte sie anstatt der Lunge einen löchrigen Gartenschlauch in der Brust.
Maggie schluckt ihre Angst herunter.
Ihre Hand legt sich auf die Klinke. Sie spürt kühles, glattes Metall. Kurz entschlossen zieht sie an der Tür. Helligkeit ergießt sich auf die Treppe, der Spalt verwandelt sich in ein türgroßes Rechteck aus Licht an der Wand zu ihrer Linken, in der Mitte nur geteilt vom Schatten ihres Arms.
Und als sie durch die Tür linst, sieht sie aufgeplatzten, grünen Linoleumboden, dunkle Schränke und eine laminierte Küchentheke mit einem Berg schmutziger Teller, der an einen Stapel Porzellanpfannkuchen erinnert. Der Herd ist uralt. Früher muss er einmal weiß gewesen sein, doch nun ist er von einer Schicht aus Essensresten überzogen. Wassertropfen sprenkeln das Fenster über der Spüle. Fliegen kleben an der Decke.
Eine Kakerlake huscht aus dem Geschirrhaufen hervor und verschwindet im Waschbecken.
Links dröhnt der Fernseher. Also sind Henry und Beatrice im Wohnzimmer, auch wenn sie die beiden weder sieht noch hört.
Dann hört sie die beiden doch. Zumindest einen von ihnen, denn auf der anderen Seite der Wand knarren die Dielen.
Maggie weicht zurück, schließt die Tür bis auf einen Spalt und späht hindurch. Ihr stockt der Atem. Sie würde so gern blinzeln, aber sie traut sich nicht. Mit trockenen, weit aufgerissenen Augen beobachtet sie, wie Beatrice in die Küche tritt. Maggies Muskeln verkrampfen sich. Sie kann sich nicht rühren.
Auf dem Weg zur Spüle greift sich Beatrice durch den Stoff ihres Kleids hindurch zwischen die Beine und kratzt sich. Danach dreht sie den Hahn auf. In den Rohren ertönt ein Klappern und Seufzen. Der Hahn spuckt einen Schwall rostige Brühe aus, gefolgt von rötlichem und schließlich klarem Wasser. Bald dampft es aus dem Waschbecken. Trotz der Hitze beschlägt das Fenster sofort.
Beatrice spritzt etwas orangefarbenes Spülmittel auf einen grünen Schwamm, dann nimmt sie sich einen schmutzigen Teller – den blau-weißen von eben –, befeuchtet ihn und fängt an, ihn zu schrubben. Als der Teller sauber ist, taucht sie ihn kurz ins Wasser, stellt ihn in das rostige Abtropfgestell und schnappt sich den nächsten.
Sie steht mit dem Rücken zu ihr. Vielleicht ist das ihre einzige Chance, hier rauszukommen. Jetzt oder nie. Maggie spürt die Schwelle unter den Füßen. Der Weg ist frei. Wieder öffnet sie die Tür, ganz leise. Ein paar Augenblicke lang steht sie reglos da, obwohl sie für jeden zu sehen ist. Als würde sie es darauf anlegen, entdeckt zu werden. Ihr Herz schlägt unglaublich laut, eigentlich müsste Beatrice das Klopfen hören. Tut sie aber nicht. Anstatt sich umzudrehen, spült sie weiter.
»Komm zurück, bevor sie dich sieht.«
Eine Stimme in ihrem Rücken. Maggie zuckt zusammen.
Hinter ihr, auf halber Höhe der Treppe, steht Borden. Das Licht aus der Küche erleuchtet seinen Pferdekopf, der Körper verschwindet in den Schatten. Maggie sieht ihm in die Augen, tiefe, dunkle Löcher, wie mit einem Eisportionierer ausgehöhlt. Weißer Schaum bedeckt seinen Mund.
Erneut muss sie schlucken – und schüttelt dann den Kopf. Nein, ich komm nicht zurück. Sie dreht sich wieder um. Beatrice steht immer noch vor der Spüle.
»Komm zurück.«
Nein.
Hier oben kennt sie sich nicht aus, aber sie weiß, dass sie nicht nach links kann, denn von dort hört sie den Fernseher. Deshalb schleicht sie sich nach rechts durch die Küche, so leise wie möglich. Bitte, Gott, mach, dass der Boden nicht knarrt. Ein Schritt, noch ein Schritt. Eins, zwei, drei, und du bist frei.
Beatrice stellt den nächsten Teller ins Gestell.
Vorne rechts führt eine Tür in den Flur. Gelbliches Licht fällt auf die schiefen, altmodischen Bilder an der gegenüberliegenden Wand. Maggie weiß nicht, woher das Licht kommt, aber es schimmert wie die Reflexion auf einer Wasseroberfläche. Hoffentlich kommt es von draußen, von der Sonne. Wenn ja, ist es nicht mehr weit bis zur Außenwelt. Bis zu einer Welt, in der die Sonne scheint.
Sie wirft einen Blick auf Beatrice. Die schnappt sich gerade einen dreckigen, mit trockenem Kohl verkrusteten Stieltopf und fängt an, ihn mit dem Schwamm zu bearbeiten. Dabei summt sie vor sich hin, ein Lied, das Maggie gut kennt. Jesus liebt mich, oh ja, denn die Bibel sagt es mir. Kleine Kinder, die sind sein, denn er ist stark, und sie sind …
Plötzlich bellt ein Hund. Maggie zuckt zusammen – und schreit. Sofort schlägt sie sich die Hände vor den Mund, um den Schrei wieder einzufangen, aber es ist zu spät. Er ist heraus, und Beatrice kann ihn hören.
Dabei weiß Maggie eigentlich, dass hier oben ein Hund ist. Jahrelang hat sie über ihrem Kopf seine Tatzen über den Boden klackern hören. Sie weiß sogar, wie er heißt: Buckshot. Aber sie hat ihn noch nie gesehen. Bis jetzt. Buckshot steht in der Tür, die von der Küche in den Flur führt. Er reicht ihr bis zur Hüfte, sein Fell ist braun wie Baumrinde, und die Zunge hängt ihm aus dem Maul. Er wedelt so wild mit dem Schwanz, dass er ihn dauernd an den Türrahmen schlägt.
Beatrice hat den Topf sinken lassen. Sie steht da und starrt auf Maggie. Ihr Unterkiefer hängt herab, ihre Schultern hängen herab, ihre nassen Hände hängen herab und tropfen auf den schmutzig grünen Linoleumboden.
Buckshot knurrt. Ein Knurren, das zu einem kurzen, hektischen Bellen anschwillt.
Wieder zuckt Maggie zusammen.
Gleichzeitig hört sie Bordens Stimme aus dem Keller. Er flüstert laut zu ihr herüber: »Wenn du jetzt zurückkommst, tun sie dir nichts.«
»Henry!«, ruft Beatrice. »Henry, sie ist draußen! Sarah ist aus dem Keller entwischt!«
Ein Blick zum Fernsehzimmer. Henry ist nicht zu sehen, aber bestimmt wird er gleich auftauchen. Ein Blick zum Flur. Buckshot steht noch immer in der Tür, sein Schwanz schlägt unverändert gegen den Rahmen. Wie soll sie bloß an ihm vorbeikommen? Er hat struppiges Fell, Narben ziehen sich über sein Gesicht und seine Seiten. Aber das macht ihr weniger Angst als Henry. Damit ist ihre Entscheidung gefallen. Als sie an Buckshot vorbeirennt, leckt er ihr über die Hand, und sein Schwanz klatscht auf ihre Hüfte, aber er beißt nicht zu, er bellt nicht mal. Rechts führt der Flur tiefer ins Haus hinein, links sieht sie eine Holztür, deren obere Hälfte eine gelbe Strukturglasscheibe umrahmt. Die Scheibe lässt ein wenig Licht herein und hält neugierige Blicke fern. Maggie packt den Knauf der Tür, drückt mit dem Daumen den kleinen Metallhebel herunter und zieht.
Eine Wand aus Hitze schlägt ihr entgegen, sie starrt in gleißendes Licht. Es ist, als hätte sie eine Ofentür geöffnet und dabei ein ganzes Universum entdeckt. Wind weht ihr um die Nase.
»Sarah, komm zurück! Sie will abhauen, Henry!«
Als sie sich umdrehen will, spürt sie Beatrice’ Finger im Nacken. Sie sprintet vorwärts über die Veranda und stößt sich mit aller Kraft vom Boden ab. In hohem Bogen segelt sie durch die Luft und landet im Kies der Einfahrt. Scharfe graue Steinchen bohren sich in ihre nackten Sohlen. Fast wäre sie hingefallen, aber nur fast. Sie schaut sich um. Wohin jetzt? Links liegt eine Weide mit ein paar Kühen, die stumm vor sich hin kauen, rechts ein Wald mit Walnussbäumen, Eichen und Kiefern. Vielleicht kann sie sich dort verstecken. Also los.
Sie spürt jeden Herzschlag, jeder Atemzug kratzt in ihrer trockenen Kehle. Aber die Sonne scheint ihr auf die Haut, ein wundervolles Gefühl. Sie ist draußen draußen draußen, und der warme Wind treibt sie immer weiter an, drückt sie nach vorne, weg von hier, hinein in die Freiheit.
Gegenüber der Einfahrt, kurz vor dem Waldrand, blickt sie zurück – und sieht Henry. Der alte Mann rennt, so schnell er kann, sein riesiger Bauch schwingt hin und her wie das Pendel einer Standuhr, ein paar Strähnen des ansonsten ordentlich über den Schädel gekämmten Haars flattern im Wind. Sein Gesicht verzerrt sich, seine Augen treten hervor, seine grässlich rote Nase ragt in die Luft wie eine Geschwulst, die kurz vorm Platzen steht.
»Du«, brüllt er zwischen keuchenden Atemzügen, »du bleibst jetzt stehen, Sarah!« Noch ein Keuchen. »Bleib verdammt noch mal stehen!«
Maggie rennt in den Wald.
Und hört nicht auf zu rennen. Sonnenstrahlen dringen durchs Blätterdach, durchschneiden die Dunkelheit. Das Licht fällt ihr aufs Gesicht, auf Arme und Beine. Sie hört Vögel singen, die fliehen, sobald sie näher kommt. Hört das Rauschen der Blätter im Sommerwind. Sie ist draußen. Sie ist frei. Ein Blick zurück – niemand zu sehen. Sie ist draußen. Keine Wände mehr, kein Keller.
Sie rennt, bis jeder Atemzug wehtut. Sie springt über Pflanzen, die wie Gifteiche oder Giftefeu aussehen, sie duckt sich unter dicken Ranken hindurch, die zwischen den Bäumen wuchern und sich um die Stämme winden, dann wird das Seitenstechen unerträglich. Sie rennt, bis es nicht mehr geht, bis sie nicht mehr kann.
Also bleibt sie stehen, stützt sich auf die Knie und schnappt nach Luft. Selbst den Schmerz in ihren Lungen genießt sie. Gierig saugt sie die heiße, saubere Sommerluft ein, sie kann gar nicht genug davon bekommen. Dann hält sie inne, um zu lauschen. Nichts. Sie hört nichts, und als sie sich umschaut, ist auch niemand zu sehen.
Vielleicht hat er aufgegeben. Vielleicht ist sie tatsächlich frei.
Ein paar Meter weiter fällt ein breiter Sonnenstrahl durchs Blätterdach. Maggie stellt sich mitten in das weiße Licht. Als Außenstehender würde man ein blasses, zerbrechliches Mädchen sehen, das von innen heraus zu leuchten scheint, während der Rest der Welt im Schatten liegt. Als Außenstehender würde man einen Engel sehen. Aber es gibt hier keinen Außenstehenden. Es gibt nur Maggie und das Licht der Sonne und die Stille des Waldes.
Diesen einen ruhigen Moment gönnt sie sich, und fast hätte sie sich auch ein paar Tränen gegönnt. Aber nein, sie muss sich zusammenreißen, sie muss weiter. Zuerst geht sie, dann joggt sie, kurz darauf rennt sie wieder.
Und das Rennen tut gut, auch wenn jeder einzelne Schritt sie schmerzt. Im Keller konnte sie nicht rennen, deshalb genießt sie den vielen Platz, den sie auf einmal hat.
Fünf Minuten später stößt sie auf eine sonnengebleichte Straße. Risse überziehen den Asphalt wie Flüsse eine Landkarte.
Links oder rechts? Sie entscheidet sich für links, ohne nachzudenken, ohne zu wissen, warum. Ihre nackten Füße klatschen über den aufgeheizten Teer, und auch dieses Gefühl genießt sie. Der Boden ist fast zu heiß; würde sie nicht rennen, sondern gehen, wäre es bestimmt nicht zu ertragen. Aber sie geht nicht. Sie rennt.
Als Beatrice nach ihm ruft, sitzt Henry vor dem Fernseher und nuckelt an einer Dose Budweiser wie an einer Mutterbrust.
»Henry!« Bees Stimme kommt aus der Küche. »Henry, sie ist draußen! Sarah ist aus dem Keller entwischt!«
»Shit«, murmelt er, steht auf und leert, den Kopf in den Nacken gelegt, das Budweiser bis auf den letzten Rest. Dann stellt er die Dose auf den Wohnzimmertisch. »Wie zum Teufel hat sie das denn geschafft?«
»Sarah, komm zurück! Sie will abhauen, Henry!«
»Bin schon auf dem Weg!«
Henry geht in die Küche – Beatrice steht am anderen Ende des Raums und starrt auf die offene Haustür. Als sie ihn kommen hört, dreht sie sich um.
»Sie ist draußen.«
»Verdammte Scheiße!«
»War doch keine Absicht.«
»Scheiße!«
»Ich hab’s dir gleich gesagt!«
Ohne weitere Worte eilt er zur Haustür – und sieht Sarah barfuß über die geschotterte Einfahrt rennen. Anscheinend will sie zum Wald westlich des Hauses.
Henry rattert die Vortreppe hinunter und nimmt die Verfolgung auf. Sofort wird ihm speiübel. Für so was ist er einfach zu alt. Sarah wird bereuen, dass sie weggerannt ist, dafür sorgt er schon. Sie wird bereuen, dass sie ihn gezwungen hat zu rennen. Sie wird vor Reue schreien, oh ja, das wird sie. Sie wird wochenlang schreien.
Am Waldrand wirft sie einen Blick zurück.
»Du«, brüllt er zwischen zwei keuchenden Atemzügen, »du bleibst jetzt stehen, Sarah!« Noch ein Keuchen. Bestimmt hat er gleich einen Herzinfarkt. »Bleib verdammt noch mal stehen!«
Sie fürchtet sich vor ihm, das weiß er. Dabei wäre es ihm lieber, wenn es auch anders ginge, wenn sie endlich einsehen würde, dass sie nun zu dieser Familie gehört. Immerhin hatte sie alle Zeit der Welt, um sich daran zu gewöhnen. Warum macht sie es allen so schwer? Vor allem sich selbst? Es ist jammerschade, aber so was kann man sich eben nicht aussuchen. Wenigstens fürchtet sie sich vor ihm, und deshalb tut sie, was er sagt.
Entsprechend erwartet Henry, dass sie seinem Befehl gehorcht. Er kann es sich gar nicht anders vorstellen. Doch sie bleibt nicht stehen, sondern dreht sich wieder um und verschwindet im Unterholz.
»Fuck!«
Er rennt zum Wald und hinein in ihn.
Zwischen den Stämmen blitzt ab und zu ihr blaues Kleid auf, daran kann er sich orientieren. Äste kratzen ihm über das Gesicht und verhaken sich in seiner Kleidung, während er versucht, Sarah nicht aus den Augen zu verlieren. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn er nicht auf den Weg achtet, läuft er noch geradewegs gegen einen Baum. Bald sieht er sie überhaupt nicht mehr – bis dreißig, vierzig Meter vor ihm wieder das Blau des Kleides durch das Blattwerk blitzt. Er sprintet direkt darauf zu, doch der Absatz seines Stiefels verfängt sich in einer Wurzel. Henry landet mit dem Gesicht voraus im Dreck und schmeckt halb verrottete Blätter. Er spuckt aus, steht wieder auf, sieht sich um. Keine Spur von Sarah. Kurz überlegt er, ob er trotzdem weiterrennen soll, aber nein, zu Fuß hat er keine Chance. Doch der Wald wird rundherum von Straße begrenzt, und irgendwann muss sie ja rauskommen.
Also dreht er sich um und rennt zurück zum Haus.
»Die Schlüssel, Bee!«
Einen Augenblick später erscheint Beatrice in der Haustür.
»Hast du sie erwischt?«
»Nein. Die Schlüssel, verdammt noch mal!«
»Für den Pick-up?«
»Wofür denn sonst? Ich hab nur einen Schlüsselbund. Jetzt mach schon!«
»Okay.«
Beatrice dreht sich um und läuft ins Haus. Als sie zurückkehrt, baumelt der Schlüsselbund von ihren Fingern. Sie wirft ihn in seine Richtung, doch er landet einen Meter vor seinen Füßen im Kies. Henry bückt sich und murmelt einen Fluch, verdammte Scheiße, aber dann hat er den Schlüssel in der Hand und marschiert zu seinem Pick-up, einem grünen Ford Ranger, Baujahr ’97, den er vor ein paar Jahren gebraucht bei Davis Dodge, dem Autohändler um die Ecke, erstanden hat. Schon damals war die Kupplung etwas weich, aber was soll man schon erwarten, wenn man seinen Wagen bei Todd Davis kauft, dem Chef der örtlichen Polizei. Und wer weiß, vielleicht winken sie ihn ja seltener raus, weil auf dem Rahmen des Nummernschilds Davis Dodge steht.
Henry schiebt sich hinters Steuer und rammt den ersten Gang rein. Kiesel spritzen in die Luft, als er die Einfahrt hinunterrast, nach Norden, zur Crouch Avenue.
Während er über die alte, von Schlaglöchern übersäte Straße Richtung Westen brettert, schielt er immer wieder nach links in sein eigenes Waldstück. Vielleicht blitzt ja irgendwo ein Fetzen weiße Haut oder blaues Kleid auf. Rechts liegt Pastor Wardens Grundstück, wie immer bellen seine Hunde aus vollem Hals. Ein Krach wie auf dem Pausenhof, denkt Henry. Warden züchtet Dackel, um sie an Tierhandlungen in Mencken und anderen größeren Städten zu verkaufen, vielleicht sogar bis rauf nach Houston, und die verdammten Köter können einfach nicht still sein. Keine Ahnung, wie Warden den Lärm erträgt. Aber okay, wenn ihm ein paar notleidende Gemeindemitglieder wieder mal die Ohren vollgeheult und ihre Schuld bei ihm abgeladen haben, ist das Gekläffe vermutlich sogar Musik in seinen Ohren.
Henry erreicht die Main Street, ohne eine Spur von Sarah entdeckt zu haben. Aber damit hat er gerechnet. Sie ist Richtung Westen in den Wald gerannt, also warum sollte sie ausgerechnet im Norden rauskommen? Da müsste sie schon komplett die Orientierung verloren haben. Deshalb biegt er links ab und fährt nach Süden, am westlichen Waldrand entlang.
Vor ihm erstreckt sich graue, leblose Straße.
Er spürt einen unbestimmten Druck in seiner Brust. Als würde sich ein Schraubstock um sein Herz schließen.
Sollte Sarah aus dem Wald entkommen und irgendjemandem begegnen und diesem Jemand erzählen, was sie erlebt hat, wäre seinem langen, friedlichen Leben hier in Bulls Mouth ein Ende bereitet. Henry kennt die ganze Stadt, die ganze Stadt kennt ihn, und die meisten mögen ihn. Natürlich nur, weil sie ihn nicht wirklich kennen, weil er immer allen auf die Schulter klopft und sagt, schöne Grüße an deine Frau, Dave. Aber das ist doch auch normal. Wer zeigt der Welt schon seine Eingeweide? Eingeweide sind ekelhaft, sonst bräuchte man doch keine Haut. Was wäre ein Mensch ohne Haut? Sicher kein besonders beliebter Nachbar.
Auf dem Weg Richtung Süden schaut er immer wieder nach links auf den Wald. Irgendwann muss Sarah doch auftauchen.
»Wo steckst du, du kleines Miststück?«
Plötzlich sieht er sie – nicht im Wald, sondern auf der Straße, in einiger Entfernung vor ihm. Sie rennt zum Main Street Shopping Center. Allerdings hat sie einen ziemlichen Vorsprung. Vielleicht ist es auch irgendein anderes Mädchen im blauen Kleid, auf die Distanz ist das nicht so einfach zu erkennen.
Aber nein, er ist sich ziemlich sicher. Henry schaltet vom zweiten in den dritten Gang und drückt das Gaspedal durch.
»Er heisst H…«
Weiter kommt sie nicht. Ian hört nur noch ihren Schrei.
Am anderen Ende kracht der Hörer gegen irgendetwas, anscheinend schwingt er an der Schnur. Noch ein Krachen, und noch eins, und so weiter, wie Trommelschläge, die, schneller werdend, ausklingen. Bis kein weiterer Schlag mehr folgt, bis sich die Stille ins Unendliche dehnt. Nichts als leerer Raum.
»Maggie?«
Keine Antwort. Sie ist weg.
»Officer Peña? Deine Position? Bist du einsatzbereit?«
»Ecke Oak Street und Flatland. Was liegt an?«
»Bist du im Walmart?«
»Bis jetzt noch nicht mal auf dem Parkplatz.«
»Fahr sofort zum Main Street Shopping Center. Es geht um eine Entführung. Der Verdächtige ist ein hochgewachsener Weißer über sechzig mit grauem Haar und Halbglatze. Das Opfer ein vierzehnjähriges Mädchen namens Maggie Hunt. Blondes Haar, grüne Augen. Sie trägt ein blaues Kleid. Code drei.«
»Bin auf dem Weg. Hast du gesagt, das Opfer heißt Maggie Hun…«
»Ja. Meine Tochter.«
Bevor Diego etwas erwidern kann, reißt Ian sich das Headset vom Kopf und beugt sich über den Mülleimer. Er zittert am ganzen Körper, seine Arme und Beine vibrieren wie Trommelstöcke, Schweiß bedeckt seine Haut. Gleich muss ich kotzen, denkt er, doch als er den Mund öffnet, kommen bloß ein paar Tropfen saurer Speichel und fallen auf das zerknüllte Blatt gelben, linierten Papiers am Boden des Mülleimers. Er weiß, dass er vorhin irgendetwas auf dieses Blatt gekritzelt hat, aber was? Er hat keine Ahnung, und es ist ihm auch egal. Seine Tochter lebt, das ist alles, was jetzt noch zählt. Er starrt auf das zerknüllte Blatt Papier und erinnert sich.
Es war Frühling, als Maggie entführt wurde. Ihr großer Bruder Jeffrey sollte auf sie aufpassen. Jeffrey stammt aus Ians zweiter Ehe, Debbie war seine dritte Frau. Heute ist sie seine dritte Exfrau. Jeffrey war aus Los Angeles herübergeflogen, um die Schulferien bei seinem Vater zu verbringen. Damals war er vierzehn, jetzt ist er zweiundzwanzig. Er hatte erst letzten Monat Geburtstag, am siebenundzwanzigsten, um genau zu sein. Ian hat ihm kein Geschenk gekauft, keine Karte geschickt. Die ersten Jahre nach Maggies Verschwinden hatten sie noch eine Art Beziehung aufrechterhalten, auch wenn sie häufig aneinandergerieten. Doch mit der Zeit wurde es immer weniger, bis schließlich nichts mehr übrig war. Auf Ians Wohnzimmertisch ist noch immer die Schachpartie aufgebaut, die sie vor drei Jahren begonnen haben. Ganz unten in seiner Sockenschublade liegen zwei Geburtstagskarten, die er nie abgeschickt hat. Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn. Ich hab dich lieb. Vor zwei Jahren hat er versucht, bei ihm anzurufen, er hat dem Freizeichen gelauscht, bis sein Sohn abgehoben hat. Hallo? Plötzlich hat er keinen Ton mehr herausgebracht. Die Worte sind ihm einfach im Hals stecken geblieben, Widerhaken aus Vokalen und Konsonanten.
Es war Frühling, als Maggie entführt wurde, und obwohl er sich dessen nicht bewusst war, nicht bewusst sein konnte, hat ihm der Entführer gleich zwei Kinder genommen. Nur, dass es beim zweiten ein Verlust auf Raten war. Jeffrey ist nicht auf einen Schlag verschwunden, sondern nach und nach.
Aber damals, in dieser einen Nacht im Frühling, hat es angefangen. Es war Samstag. Am unendlich schwarzen Himmel hing ein knochenweißer, aufgeblähter Vollmond.
Und Ian saß hinter dem Steuer seines teilrestaurierten ’65er Ford Mustang. Sein Vater hatte den Wagen gekauft, als Ian siebzehn war und noch bei seinen Eltern in Venice Beach lebte. Das wäre doch eine nette Sache, meinte sein Vater, das Auto zusammen auf Vordermann zu bringen. Und tatsächlich unternahmen sie ein paar Ausflüge zum Schrottplatz in Downy, wo sie einen passenden Kotflügel, einen grau grundierten Kofferraumdeckel und eine Rückleuchte aufstöberten. Nur leider kam ihnen etwas dazwischen: Ians Vater nahm sich das Leben. Drei Monate, nachdem er den Mustang erworben hatte, hielt er es für eine gute Idee, sich den Lauf einer Schrotflinte in den Mund zu stecken und abzudrücken. Ian fand ihn auf dem Boden im Schlafzimmer, als er von der Schule heimkehrte.
Doch in dieser Nacht, der Frühlingsnacht, in der Maggie entführt wurde, saß Ian hinter dem Steuer, Debbie neben sich, die Fenster des Wagens heruntergekurbelt. Er genoss den kühlen Wind in seinem Gesicht, während er dem Radio lauschte: »Love Comes in Spurts« von Richard Hell. Debbie trug ein enges Sommerkleid, ihre großen Brüste quollen über den Rand des Dekolletés. Als er mit der rechten Hand über die Mittelkonsole griff und sanft die Innenseite ihres Oberschenkels streichelte, spreizte sie leicht die Beine.
»Bin ich froh, dass wir uns den Abend gegönnt haben«, sagte er. Gerade fuhren sie die Crockett Street entlang, auf dem Weg von Morton’s Steakhouse nach Hause. Endlich wieder mal ein Abendessen zu zweit. »Hat Spaß gemacht.«
Debbie nahm sachte seine Hand, schob sie an der Innenseite ihres Schenkels hinauf, unter ihr Kleid, an ihren Slip. Durch den Stoff hindurch spürte er ihr kratziges Schamhaar und ihre heiße, angenehm klebrige Feuchtigkeit.
Dabei dachte er an ein Erlebnis aus seiner Kindheit in Venice Beach: Er war elf oder zwölf Jahre alt, sein Vater hatte noch den Surfladen. Damals ging er immer zum Strand, um mit den älteren Jungs herumzuhängen und vielleicht ein Bier zu schnorren. Eines Tages fiel ihm ein Mädchen auf, sie war so um die zwanzig – sie trug einen Bikini, und zu beiden Seiten des Höschens schauten ihre Schamhaare hervor. Weil sie gerade aus dem Wasser kam, schmiegte sich der Stoff eng an ihren Körper, und er konnte den leicht gekräuselten Hügel zwischen ihren Beinen sehen. Es war ein fremdartiger, seltsamer und sehr aufregender Anblick. Er wusste nicht, was da mit ihm passierte, aber er verzog sich sofort ins Meer, wo ihn niemand sehen konnte, und holte sich einen runter, zu dem Bild, das noch ganz frisch in seinem Kopf war. Er spritzte einfach so ins Wasser ab, und auch das fand er ziemlich geil. Obwohl es schon ewig her ist, erregt ihn der Gedanke an dieses Mädchen bis heute, an ihre rätselhafte, kaum zu begreifende Sexualität. Wie das Mädchen, mit dem er zum ersten Mal Sex hatte, mit vollem Namen hieß, weiß er nicht mehr – Jennifer irgendwas –, nicht mal ihr Gesicht kann er sich ins Gedächtnis rufen. Aber diesen Tag am Strand, vier oder fünf Jahre vor Jennifer irgendwas, hat er nie vergessen. Er erinnert sich an jedes Detail.
Er blickte auf und sah Debbie in die Augen.
»Der Abend hat gerade erst angefangen«, sagte sie und lächelte. »Das Beste kommt noch.«
Nachdem er sie ein letztes Mal gestreichelt hatte, musste er die Hand wohl oder übel zurückziehen, um rechts in die Crouch Avenue und kurz darauf links in den Grapevine Circle einbiegen zu können. Rechts lag glitzernd der Speichersee von Bulls Mouth, der riesige Mond und die Sterne spiegelten sich im Wasser und wirkten wie leuchtende Fische. Als sie der scharfen Rechtskurve der Straße folgten, sah er einen Streifenwagen in zweiter Reihe vor ihrem Haus parken. Blaulicht blitzte durch die Nacht.
»Sind die etwa bei uns?«, fragte Debbie.
»Oh Gott.«
»Nur die Ruhe. Ist bestimmt nichts Schlimmes.«
»Ich bin ruhig.«
Trotzdem raste er die Straße in halsbrecherischer Geschwindigkeit hinunter, riss dann das Lenkrad nach rechts und stieg knapp vor der Nummer 44 und dem geparkten Streifenwagen gleichzeitig auf Kupplung und Bremse. Als er den Fuß von der Kupplung nahm, soff der Motor ab. Er riss den Schlüssel aus der Zündung, stieß die Tür auf und sprang aus dem Wagen. Debbie kam schon von der Beifahrertür herüber.
Die Kühlung surrte unter der Motorhaube. Das Rauschen des Verkehrs auf dem Interstate 10. Tagsüber bemerkte man es kaum, doch in der Stille der Nacht war es deutlich zu hören. Ein leises Bellen im Westen, Pastor Wardens Hunde. Einige Nachbarn standen auf ihren Verandas und glotzten mit offenem Mund herüber. Ian hasste jeden Einzelnen von ihnen. Und sich selbst. Und Debbie.
Es war ihre Schuld. Sie hätten Maggie niemals mit Jeffrey allein lassen dürfen. Doch Ian hatte auf dem Abend zu zweit bestanden, und Jeffrey war ja auch schon vierzehn, eigentlich alt genug, um auf seine kleine Halbschwester aufzupassen. Aber wenn ihr irgendetwas passiert war, würde er es sich nie …
Jeffrey stand auf dem Rasen vor dem Haus im gelben Lichtkegel der Verandabeleuchtung und sprach mit Chief Davis. Offenbar hatte es der alte Chief für nötig erachtet, seinen Whiskyschlaf zu unterbrechen und sich persönlich hierherzuschleppen. Kein gutes Zeichen. Davis machte sich Notizen, während Jeffrey redete. Jeffreys Augen waren gerötet, er wischte sich ständig mit dem Handrücken über die Nase.
»Was ist passiert?«, rief Ian schon aus ein paar Metern Entfernung. »Wo ist Maggie?«
Jeffrey und Davis drehten sich um und sahen ihn schweigend an.
»Wo ist Maggie?«
Immer noch keine Antwort.
Er packte Jeffrey an den Schultern und schüttelte ihn. Seine Finger bohrten sich tief in das weiche Fleisch. »Wo ist Maggie? Wo ist sie?«
»Liebling«, sagte Debbie. »Hör auf.«
»Ian.« Als er Davis’ Hand auf seiner Schulter spürte, fuhr er herum und stieß sie weg. Der Chief blinzelte hinter seiner eulenhaften Brille, rieb sich den Schnurrbart und schob den Stetson nach hinten. Dann hakte er die Daumen in die Hosentaschen, begann auf den Fersen seiner Stiefel zu wippen und schaute zur Seite. Debbie schaute nicht zur Seite.
»Fasst mich nicht an!«, schnauzte Ian, ohne genau zu wissen, wen er überhaupt meinte, und wandte sich wieder an seinen Sohn. »Jeffrey. Wo ist Maggie?«
Als Jeffrey den Blick hob, sah Ian die Angst in seinen Augen. Sie brannten vor Panik, die hinter den Pupillen tanzte wie Flammen hinter dunklen Fenstern. Schnell sah Jeffrey wieder auf seine Füße. Er trug Hausschuhe aus blauem Cord, deren Stoff vom Gehen durch das nasse Gras dunkel angelaufen war. Sie hatten ihm die Hausschuhe letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Debbie hatte sie in der Drogerie gesehen und mitgenommen, als sie ein Rezept für Antibiotika eingelöst hatte, und zu den anderen Geschenken in das Paket geworfen, das sie alljährlich nach Kalifornien schickten, zusammen mit einer höflichen, aber distanzierten Grußkarte für Lisa, Jeffreys Mutter und Ians zweite Frau.
»Sie ist weg«, sagte Jeffrey schließlich. Dabei starrte er weiter auf seine blauen Hausschuhe.
»Weg?« Ian hatte mit allem gerechnet. Dass sie sich verletzt, den Arm gebrochen, die Finger auf der Herdplatte verbrannt oder sich schlimm geschnitten hatte – aber einfach weg? Was sollte das heißen? Sein Verstand scheiterte an diesem einen kleinen Wort.
Jeffrey nickte, ohne aufzublicken.
»Wie, weg?«
Ein hilfloses Schulterzucken. »Ich … Ich weiß nicht … Ich hab sie ins Bett gebracht und David Letterman geschaut … Und auf einmal war da so ein Lärm in ihrem Zimmer, ich dachte, sie ist wieder aufgestanden. Also hab ich gerufen, sie soll ruhig sein und schlafen gehen, ich … ich hab ziemlich rumgebrüllt. Dann ist es sehr still geworden, und ich hab ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich so geschrien habe. Deshalb bin ich zu ihr, um nach ihr zu schauen und mich zu entschuldigen, falls sie beleidigt war, aber da war sie schon …« Er befeuchtete sich die Lippen. »Sie war weg.« Jeffrey blickte kurz auf und sofort wieder zu Boden.
Wortlos ging Ian zum Haus, vorbei an Jeffrey und Chief Davis, den er dabei an der Schulter streifte. Er ging hinein und geradewegs in Maggies Zimmer. Das nun nicht mehr Maggies Zimmer ist. Das jetzt, in der heutigen, der anderen Welt, die der von damals gar nicht so unähnlich und doch völlig anders ist als sie, den Zwillingen gehört. Debbie und Bill haben es renoviert, gestrichen, einen neuen Teppich verlegen lassen, bis es kaum noch wiederzuerkennen war. Damals war es leer. Er lief zum Bett und legte die Hand auf die Mulde in der Matratze. Kalt. Nicht mal ein kleines bisschen Wärme war von ihrem Körper geblieben. Unter dem Kissen fand er einen Zahn. Die Zahnfee würde nicht mehr kommen. Zu spät. Er ging zum Fenster; es stand offen, eine leichte Brise bewegte den Vorhang. Der Rahmen des Fliegengitters befand sich noch an Ort und Stelle, das Gitter selbst war herausgeschnitten. Ein paar einzelne Fäden zitterten in der Luft, der Rest lag draußen im Gras. Bei jedem Windstoß blähte sich das Netz wie ein lebendiger Schatten.
»Ian«, hörte er Davis in seinem Rücken sagen. »Du solltest besser nicht drin sein. Ich hab Sheriff Sizemore gebeten, ein paar Leute aus Mencken rüberzuschicken. Um die Spuren zu sichern.«
Ian nickte, ohne sich umzudrehen. Er starrte hinaus in die Nacht. Ein erneuter Windstoß, das Fliegengitter bewegte sich. Nach einer Weile hörte er, wie Davis den Raum verließ. Ein paar Sekunden später riss er sich vom Fenster los und folgte ihm.
Damals war er achtunddreißig, heute ist er fünfundvierzig, obwohl er sich manchmal älter vorkommt. Drei Ehen, eine Abtreibung, zwei Kinder (einen Sohn, mit dem er zuletzt vor drei Jahren gesprochen hat, eine Tochter, die mehr als doppelt so lange verschwunden war), sieben Knochenbrüche (vier Finger, das Schlüsselbein, die Nase, ein Zeh), eine Schussverletzung, vier Autounfälle, drei tote Haustiere, zwei tote Eltern. Ja, manchmal kommt er sich wirklich älter vor.
Wirft man einen Blick über die Schulter auf das ganze Gepäck, das man sein Leben lang mit sich herumschleppt, kann man schon mal ans Aufgeben denken.
Jeden Morgen ist es dasselbe: Er wacht auf und kann den Hals nicht richtig drehen, in der rechten Hand spürt er einen ersten Anflug von Arthrose, das rechte Knie ist so stark geschwollen, dass er es die erste Stunde über gar nicht beugen kann, sein Rücken tut weh, und sein Kopf ist voller Erinnerungen, von denen er schon lange nichts mehr wissen will. Jeden Morgen wacht er auf, duscht sich, zieht sich an. Er rasiert sich nur jeden zweiten Tag, denn er ist blond und kann es sich daher leisten, in dieser Hinsicht ein bisschen faul zu sein. Danach isst er zwei hart gekochte Eier (manchmal auch ein Toast) und trinkt einen Becher Kaffee. Dann auf zur Arbeit, acht Stunden lang herumsitzen, Solitär spielen und Anrufe entgegennehmen. Wenn irgendwo Verstärkung benötigt wird und es nicht allzu weit entfernt ist, fährt er auch mal selbst zu einem Einsatz (daher das Blaulicht im Handschuhfach seines Wagens). Auf dem Papier ist er ein echter Polizist, er geht jeden Tag in Uniform aus dem Haus – aber nur, weil der Stadtrat keinen Zivilisten für die Leitstelle anheuern wollte. Die meiste Zeit hockt er im Büro und telefoniert. Manchmal sind die Anrufe nicht ohne: Ehemänner, die beim Pferdefüttern zusammenbrechen oder versuchen, ihre Pferde zu beschlagen, und dabei einen Huftritt abbekommen; Söhne, die sich versehentlich einen Finger absägen; Hausfrauen, die sich einen Eimer ätzender Lauge über das Kleid kippen. Und wenn ein solcher Anruf reinkommt, lässt der nächste nie lange auf sich warten. Fast immer häufen sich die schlechten Nachrichten, als hätte ein böser Wind das Unglück in die Stadt getragen. Nach solchen Tagen fühlt Ian sich völlig leer, ausgehöhlt wie ein Kürbis zu Halloween. Am Ende der Schicht fährt er heim zu den Skyline Apartments, stellt den Wagen ab, schließt sich in seiner Wohnung ein und schaut fern. Sitcoms. Dabei leert er exakt sechs Flaschen Guinness, dazu freitags noch ein Glas Scotch (meistens Laphroaig), bis er nach ein paar Stunden auf der Couch einschläft.
Wiederum fünf oder sechs Stunden später wacht er auf, und das Spiel beginnt von Neuem.
Doch heute ist alles anders. Normalerweise macht er um vier Uhr Schluss; heute verlässt er seinen Platz schon um Viertel nach drei.
Er steht auf und geht rüber in den Empfangsraum.
Wie erwartet döst Chief Davis auf seinem zurückgekippten Stuhl, mit den Stiefeln auf dem Tisch, den Stetson über die Augen gezogen. Die Leute halten ihn für faul, aber immerhin ist er vierundzwanzig Stunden täglich im Dienst und muss sich die Nacht oft genug mit besoffenen Idioten und gewalttätigen Ehemännern um die Ohren schlagen. Ian kann es ihm daher nicht verübeln, dass er schläft, wann immer sich die Gelegenheit bietet.
»Chief«, sagt er.
Davis stöhnt und wischt sich einen Speicheltropfen aus dem Mundwinkel.
»Chief.«
Jetzt richtet er sich auf, schiebt den Stetson nach hinten, reibt sich die Augen und zieht die Brille aus der Hemdtasche. Nachdem er sich noch einmal mit den Handflächen über das Gesicht gefahren ist und kurz geblinzelt hat, mustert er Ian.
»Ian.«
»Da ist gerade ein Anruf reingekommen.«
»Was für ein Anruf?«
»Maggie hat angerufen.«
»Maggie?« Ein Blinzeln. Noch ein Blinzeln. »Deine Tochter?«
Ian nickt.
»Bist du dir sicher?«
Ian nickt noch einmal. »Sie hat von einem Münztelefon vorm Main Street Shopping Center angerufen. Sie lebt. Diego ist schon auf dem Weg, die Jungs vom County auch, aber ich will selber hin. Kannst du mich kurz vertreten?«
»Nein. Du weißt doch, ich muss mich um Sizemore kümmern. Soll sich Thompson ans Telefon setzen.«
Steve Thompson ist der zweite reguläre Officer der Tagschicht bei der Polizei von Bulls Mouth. Soweit Ian es beurteilen kann, ist er kein schlechter Polizist – zumindest solange etwas los ist. Andernfalls verdrückt er sich gerne mal. Ab vier Uhr nachmittags sind nur noch zwei Mann im Dienst, eine der drei Teilzeitkräfte am Telefon und ein Officer im Streifenwagen. Und im Notfall natürlich Chief Davis. Von vier Uhr bis Mitternacht ist Armando Gonzales im Einsatz; er hat die Schicht vor Kurzem von Diego Peña übernommen, der sich rasch hochgearbeitet hat: vom Telefondienst in Teilzeit zur Vollzeitkraft in der Tagesschicht. Von Mitternacht bis acht Uhr hält Ray Watkins die Stellung.
Ian nickt ein drittes Mal. »Auch gut. Wo ist er?«
»Hinten im Hof. Wäscht meinen Pick-up. Sag ihm, er soll sich ans Telefon setzen, und dann nichts wie weg hier.«
Ian nickt ein letztes Mal.
»Was hast du an?«
»Was?« Maggie blickt sich um – und sieht, wie der grüne Ford Ranger auf sie zurast. Hinter der Windschutzscheibe erkennt sie Henrys riesenhaften Schatten. Er beugt sich über das Lenkrad wie ein Bär über seine Beute. »Er kommt!«
»Maggie, was hast du an?«
»Ein … ein Kleid, ein blaues Kleid mit rosa Blumen drauf!«
Mit quietschenden Reifen fährt der Pick-up auf den Parkplatz. Am Boden bleibt eine dunkle Spur zurück, es stinkt nach verbranntem Gummi. Während der Motor weiterläuft, öffnet sich die Tür. Maggie hört Henrys Stiefel hinter sich auf dem Asphalt. Sie blickt über die Schulter zurück. Mit gewaltigen Schritten marschiert er auf sie zu und flucht dabei vor sich hin. Seine Arme hängen seitlich herab, seine Fäuste öffnen und schließen sich.
Öffnen und schließen sich, öffnen und schließen sich, öffnen und …
»Weißt du, wie der Mann heißt?«
»Er heißt H…«
Weiter kommt sie nicht. Henry packt sie an der Hüfte. Als sie schreit, legt er ihr die Hand vor den Mund und zerrt sie zurück, weg vom Telefon. Sie versucht, sich am Hörer festzuhalten, sie will bei Daddy bleiben, oh Gott, das war Daddy, sie will unbedingt bei ihm bleiben, doch ihre schweißnassen Finger rutschen ab, und der Hörer schwingt an der Schnur zurück und kracht gegen ein Telefonbuch, das an einem Eisenring befestigt ist. Sie versucht erneut zu schreien, aber es geht nicht, sie kann Henrys Hand nicht abschütteln, der Schrei kann nicht heraus.
Maggie tritt mit den Füßen und kratzt mit ihren Nägeln, sie klammert sich an Henrys Finger, um sie einzeln zu lösen, sie krümmt ihren Körper, um den Entführer beißen zu können, aber sie hat keine Chance. Er trägt sie einfach zum Pick-up.
»Tu das nie wieder, du kleines Miststück«, sagt er. »Tu das nie wieder.«
Damit schleudert er sie durch die offene Fahrertür ins Wageninnere. Sie schlittert der Länge nach über den beigen Plastikbezug der Sitze und knallt mit dem Kopf gegen die Beifahrertür, rappelt sich dann wieder auf und blickt sich um. Zuerst ist sie völlig orientierungslos, sie kommt sich vor wie im Traum – bis sie die offene Tür sieht. Da ist ihr wieder klar, wo sie ist und was sie zu tun hat. Sie krabbelt auf die Tür zu Richtung Freiheit.
Doch im nächsten Moment wird die Öffnung von Henrys massigem Körper verdunkelt. Er schiebt sich auf den Fahrersitz, schlägt die Tür zu, löst die Handbremse und steuert den Pick-up auf die Straße. Maggie schaut aus dem Fenster: Der Telefonhörer baumelt immer noch an der Schnur. Daddy.
Instinktiv zerrt sie am Türöffner und drückt die Tür auf. Sie will rausspringen, solange der Wagen noch nicht so schnell ist, doch auf der Straße steigt Henry aufs Gas, und der Schwung schlägt die Tür wieder zu. Als sie die Finger wegzieht, um sich die Hand nicht einzuquetschen, erwischt Henry sie hinten am Kleid, reißt sie zurück und verpasst ihr eine Ohrfeige.