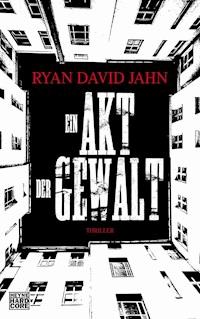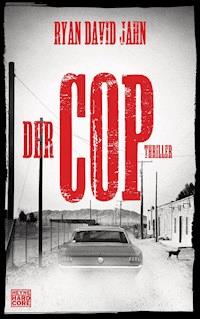Ryan David Jahn
Ein Akt der Gewalt
Roman
Aus dem Englischenvon Teja Schwaner
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem TitelActs of Violence bei Macmillan, London
Copyright © 2009 by Ryan David Jahn
Copyright © 2011 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Redaktion: Ulf Müller Gesetzt aus der 10,6/14,2 Punkt The Antiqua bei C. Schaber, Datentechnik, Wels
ISBN 978-3-641-05356-7V002
www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Danksagung
Copyright
Für Mary- mit all meiner Liebe
1
Auf einem Parkplatz fängt es an.
Der Parkplatz liegt hinter einer Sportbar, einem Backsteingebäude, an dem im Laufe der Zeit so manche Beschädigungen hässliche Narben hinterlassen haben. Betrunkene Autofahrer, die rückwärtsfuhren statt vorwärts, haben es gerammt, Initialen wurden in seine Wände geritzt, und es ist von alkoholisierten Randalierern angegriffen worden. Vor fünfzehn Jahren versuchte jemand, hier Feuer zu legen. Leider hatte der Möchtegernbrandstifter nicht beachtet, dass Regen angekündigt war. Also steht die Sportbar noch immer.
Es ist fast vier Uhr morgens, drei Uhr achtundfünfzig, die stockdunkle Zeit, in der noch kein Lichtschimmer den östlichen Horizont berührt. Die pure Finsternis.
Aus der geschlossenen Bar dringt kein Laut.
Nur drei Autos stehen auf dem sonst so belebten Parkplatz: ein 1957er-Studebaker, ein 1953er-Oldsmobile und ein 1962er-Ford-Galaxie mit verbeultem Kotflügel. Zwei gehören Gästen, von denen einer tagsüber von Tür zu Tür geht und versucht, Staubsauger unter die Leute zu bringen, während der andere arbeitslos ist und seine Tage damit verbringt, auf die Deckenrisse der Wohnung zu starren, für die er drei Monate Miete schuldig ist. Beide haben sich früher am Abend einige Gläser zu viel gegönnt und daher auf Ausweichmöglichkeiten zurückgegriffen, um nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich Taxifahrten. Besonders der arbeitslose Barbesucher. Der Vertreter ist vielleicht von einem Kumpel mitgenommen worden, aber der Arbeitslose hat mit ziemlicher Sicherheit ein Taxi genommen. Wenn du dreißig Dollar in der Tasche hast und die Miete achtzig beträgt, ist alle Sparsamkeit sinnlos. Trink, bis du betrunken bist, und zahl für die Taxifahrt nach Hause. Warum den Abstieg nicht auf die bequeme Tour genießen? Wenn du aber siebenundachtzig Dollar hast und die Miete achtzig beträgt, ist Sparen angesagt.
Pappbecher und anderer Müll – Zeitungen und Verpackungen – übersäen den verblichenen Asphalt. Eine Brise treibt den Abfall pfeifend über den rissigen Bodenbelag und ordnet ihn flüchtig um, bevor sie wieder abflaut.
Und dann stößt ein hübsches Mädchen – eigentlich bereits eine Frau, obwohl sie sich noch nicht erwachsen fühlt – die Eingangstür der Sportbar auf.
Sie heißt Katrina – Katrina Marino -, aber so gut wie alle nennen sie Kat. Die einzigen Menschen, die sie Katrina rufen, sind ihre Eltern, mit denen sie jeden Samstag telefoniert. Sie wohnen vierhundert Meilen entfernt, aber schaffen es immer noch mit Leichtigkeit, ihr auf die Nerven zu gehen. Wann wirst du endlich vernünftig werden und den Sündenpfuhl von Großstadt verlassen, Katrina? Es ist gefährlich dort. Wann wirst du endlich mit einem netten jungen Mann eine Familie gründen? In deinem Alter sollte ein Mädchen nicht mehr unverheiratet sein. Du bist keine zwanzig mehr, sondern gehst schon auf die dreißig zu, nicht wahr? Schon bald bist du nicht mehr so jugendlich frisch und schön, dass du dir einen anständigen Mann angeln kannst, einen Arzt oder Anwalt, und dann musst du dich mit weniger zufriedengeben. Du willst dich doch nicht mit weniger zufriedengeben, oder, Katrina?
Von draußen reicht Kat noch einmal hinein und tastet über die Wand. Sie findet den Schalter und legt ihn um. Klick. Hinter den Scheiben, durch die man in die Sportbar sieht, wird es dunkel, und das Licht, das sich auf den Parkplatz ergossen und den grauen Asphalt weiß getüncht hat, erlischt.
Kat stößt die Eingangstür zu und schließt ab. Um sicher zu sein, prüft sie den Knauf, schlägt ein Metallgitter zu, dass es knallt, und lässt ein Vorhängeschloss zuschnappen.
Das Metallgitter und das Vorhängeschloss sind noch nicht einmal sechs Monate alt und passen nicht recht zum heruntergekommenen Zustand des Hauses. Neu sind auch die Gitterstäbe vor den Fenstern. Jemand war durch die Hintertür eingebrochen, hatte die Kasse leergeräumt, eine Kiste Whiskey mitgehen lassen und durchs Fenster das Weite gesucht. Warum er nicht zur Tür hinaus verschwunden war, weiß niemand.
Der Verlust an Whiskey und Bargeld war alles in allem nicht der Rede wert gewesen. Aber die Reparaturkosten, die hatten es in sich gehabt. Und dazu der Umsatzverlust. Der Laden hatte zwei Tage geschlossen bleiben müssen.
Kat ist nur die Nachtmanagerin, aber fühlt sich trotzdem für die Bar verantwortlich.
Erschöpft und müde von der langen Nacht steuert sie auf ihren Studebaker zu, und es kommt ihr so vor, als hätte der Wagen Schlagseite nach rechts. Anfangs kann sie nicht sehen, warum oder ob es überhaupt so ist. Vielleicht handelt es sich nur um eine Sinnestäuschung, hervorgerufen durch das Spiel von Licht und Schatten.
Sie muss erst die halbe Entfernung bis zu ihrem Wagen zurücklegen, bevor sie erkennt, dass er tatsächlich schräg liegt. Dass ihre verflixte Karre einen Plattfuß hat.
»So ein Mist«, sagt sie, stampft zornig mit dem Fuß auf den Asphalt und spürt prompt den Schlag bis hinauf ins Knie.
Sie hastet zum Wagen, direkt zum Kofferraum. Sie schiebt den Autoschlüssel ins zerkratzte Schlüsselloch, dreht ihn nach links, falsch, dann nach rechts, hört, wie sich der Zylinder bewegt, und stößt den Deckel nach oben.
Im Innern kann sie nichts erkennen.
Sie tastet nach der Taschenlampe, die sie links in einer Ecke des Kofferraums aufbewahrt. Ihre Hand sucht eine Weile im Dunkeln, bevor die Finger schließlich eine kalte glatte Oberfläche spüren. Sie greift zu und knipst die Lampe an. Sie leuchtet nur schwach und gelblich, aber sie leuchtet. Jetzt, da sie zu sehen sind, greift Kat nach dem Reserverad und dem Wagenheber. Dabei lächelt sie.
Kat ist schon immer ein selbstbewusster Mensch gewesen, hat sich seit jeher auch mit Distanz betrachtet, und jetzt sieht sie sich, keine eins sechzig, gerade mal fünfzig Kilo, in einem blauen Wollkleid mit einem kurzen weißen Mantel darüber, wie sie ein Reserverad schleppt, das fast so groß ist wie sie selbst, und dazu einen schweren Wagenheber – sie musste wirken wie ein Nilpferd im Ballettröckchen. Bei dem Gedanken kräuselt ein Lächeln ihre Lippen. Doch als ihr einfällt, welche Arbeit ihr bevorsteht, ist es auch schon wieder erloschen.
Gleich darauf sitzt Kat in der Hocke, kurbelt ihren Wagen hoch, damit sie das verflixte Rad wechseln kann, sieht zu, wie sich der Reifen scheinbar immer weiter ausdehnt, während das Rad fest auf dem Boden bleibt – doch dann endlich hebt sich das Rad, aber die Unterseite des Reifens bleibt platt. Er müsste sich doch eigentlich mit Luft füllen und sich wieder ausdehnen, da kein Gewicht mehr auf ihm lastet. Aber er tut es nicht.
Und dann – hinter ihr ein Geräusch.
Sie hält inne, bewegt sich nicht und hofft, dass es nichts war, dass sich das Geräusch nicht wiederholt. Aber es wiederholt sich, und sie dreht den Kopf, um über die Schulter zu schauen, voller Angst vor dem, was sie vielleicht zu sehen bekommt. Aber hinsehen muss sie trotzdem. Kat ist eine von denen, die sich stets die Hände vor die Augen halten, wenn sich auf der Leinwand im Drive-in-Kino die grässlichsten Dinge abspielen, aber trotzdem zwischen den gespreizten Fingern einen kurzen Blick riskieren.
Zeitungsseiten flattern über den Asphalt, tragen die Nachrichten von gestern fort.
»Nur der Wind, Dummchen«, sagt sie. Nur der Wind.
Sie wendet sich wieder dem Wagen und ihrer Arbeit zu.
Kat verstaut den platten Reifen und den rautenförmigen Wagenheber achtlos im Kofferraum und schlägt den Deckel zu.
Ein Nagel hatte für den Schaden gesorgt. Erst als sie das Rad ganz abmontiert hatte, fiel Kat der rostige Nagelkopf auf, der an der Innenseite aus der Reifendecke ragte. Sie erinnert sich undeutlich daran, auf dem Weg zur Arbeit an einer Baustelle vorbeigefahren zu sein, wo Männer mit braungebrannten Armen ein halb niedergebranntes Reihenhaus instand setzten und zersplitterte Holzbohlen, aus denen blanke Nägel ragten, auf einen Lastwagen luden.
Ihre Hände sind schwarz von Dreck und Bremsstaub, und sie mag sich nicht anfassen, weil sie Angst hat, ihr hellblaues Kleid schmutzig zu machen oder ihren weißen Mantel. Noch schmutziger. Denn als sie den Reifen zum Kofferraum trägt, ist ihr Kleid bereits fleckig.
Dämlicher Mistplattfuß.
Sie möchte jetzt nur noch nach Hause, aus den Kleidern schlüpfen und ein warmes Bad nehmen, sich waschen, bis sie ganz sauber ist, und dann ins Bett schlüpfen, unter ihre nachtkühle Bettdecke, wo sie vielleicht bis Mittag liegen und schlafen kann, vielleicht sogar bis eins, und wenn sie Glück hat, träumt sie süße Träume von dem Moment an, wenn ihr Kopf aufs Kissen fällt, bis sie geweckt wird von der Mittagssonne, die durchs Fenster scheint.
Doch zuerst muss sie nach Hause kommen.
Sie öffnet die Autotür und lässt sich auf den Fahrersitz fallen, steckt den Schlüssel ins Zündschloss und dreht ihn in Uhrzeigerrichtung. Der Wagen räuspert sich wie ein Raucher, der drei Packungen am Tag pafft. Der Motor dreht einmal – ganz langsam.
»Komm schon, Kleiner«, sagt Kat.
Sie pumpt mit dem Gaspedal.
Der Motor dreht wieder, diesmal ein bisschen schneller. Und noch einmal. Kommt auf Touren. Sie nimmt Gas weg. Will den Motor nicht absaufen lassen. Er dreht wieder. Hustet. Furzt. Und springt dann tatsächlich an.
Gott sei Dank. Kat wischt sich über die Stirn, froh, dass sie kein Taxi rufen muss, und im selben Moment fällt ihr ein, wie schmutzig ihre Hände sind. Sie wirft einen Blick in den Rückspiegel und lacht.
Ein schwarzer Schmutzfleck, auf ihrer Stirn verschmiert wie bei einem Landstreicher im Stummfilm.
2
Kat zieht einen Knopf am Armaturenbrett, und die Scheinwerfer schicken zwei gelbe Lichtstrahlen in die Nacht. Sie sieht Staubflocken und Insekten im Licht schaukeln und erinnert sich an einen Augenblick in ihrer Kindheit, als sie drei Jahre alt war oder vielleicht vier und im Bett ihrer Eltern lag, das ihr riesig vorkam, so groß wie eine Insel. Eigentlich sollte sie ihren Mittagsschlaf halten. Deswegen hatte man sie aufs Bett gelegt. Aber sie war hellwach und schaute auf einen Sonnenstrahl, der zum Fenster herein auf ihre bloßen Beine fiel. Die Wärme tat gut, und sie sah Staubflocken im Licht taumeln. Sie hielt sie für lebendig, lachte darüber, wie sie tanzten, und griff nach ihnen, um sie einzufangen, aber es wollte ihr nie gelingen. Sie wussten immer ganz genau, wann Kat zugreifen wollte, und tanzten in letzter Sekunde davon, bevor ihre pummeligen kleinen Finger in Reichweite kamen und sich zur Faust schlossen.
Kat dreht an einem anderen Knopf und schaltet das Radio ein. Eine kratzige Männerstimme, kehlig und tief, sagt: »… und Präsident Johnson machte heute in einer Stellungnahme deutlich, dass Kubas Entschluss, die Versorgung des Flottenstützpunkts Guantánamo Bay mit Frischwasser einzustellen, absolut inakzeptabel sei. Eine weitere Meldung betrifft Jimmy Hoffa, der vergangene Woche des Versuchs für schuldig befunden wurde, Geschworene eines Bundesgerichts zu bestechen …«
Kat verzieht das Gesicht und dreht am Senderknopf.
Die Nachrichten sind doch reines Blabla und bestätigen nur immer wieder, dass sie selbst klein ist und die Welt groß, dass sie nicht das Geringste tun kann, um den entscheidenden Ereignissen Einhalt zu gebieten oder ihren Lauf auch nur zu verändern. Kat ist es wichtig, sich auf Dinge zu konzentrieren, die sie ändern kann, das Leben der Menschen in ihrer Umgebung, ihr eigenes Leben. Kleinigkeiten, erreichbare Ziele.
Einen Drink ausschenken zum Beispiel. Oder einen Reifen wechseln.
»… ist eine nächtliche Tiefsttemperatur von fünf Grad zu erwarten, ebenso wie frühmorgendliche Schauer, und …«
Wieder dreht sie am Senderknopf.
»Und jetzt Buddy Holly und die Crickets mit ›Not Fade Away‹, aufgenommen nur zwei Jahre vor Mr. Hollys allzu frühem Tod. Kaum zu glauben, dass es schon fünf Jahre her ist, oder? Hier ist Dino von WMCA, eurer Radiostation, und sagt euch: Bei uns lebt Buddy weiter.« Und schon legen die Crickets los, im Bo-Diddley-Beat, wie auf Pappkartons gehämmert.
Kat dreht die Musik auf und fährt los.
Während Buddy Holly von jenseits des Grabes singt und verrät, »… how it’s gonna be«, fährt Kat durch eine nächtlich ausgestorbene Stadt. Sie kommt an einem Kino vorbei, auf dessen Anzeigetafel für den Film Dr. Strangelove geworben wird, an einem Buchladen, in dessen Schaufenster Gold-Medal -Paperbacks ausgelegt sind, und an einem Stapel taufeuchter Morgenzeitungen, mit Bindfaden verschnürt und vor einem Kiosk abgelegt, der über Nacht mit einem Vorhängeschloss gesichert ist.
Noch eine Viertelstunde, dann wird ein fetter Kerl mit zwanzig Jahre alten Aknenarben und ebenso alter Wut darüber, dass man ihn schon in der ersten Klasse der Grundschule verarscht hat, erscheinen, den Kiosk aufschließen und den Bindfaden um den Zeitungsstapel zerschneiden.
Die Zeitungen behaupten, es sei der 13. März, aber Kat braucht nur einen Blick durch die Windschutzscheibe auf den dunklen Horizont zu werfen, um zu wissen, dass es noch drei oder mehr Stunden dauert, bevor es für die meisten Menschen 13. März wird – egal, was die Zeitungen sagen.
Sie findet, es wäre prima, wenn sie nur anzuhalten und in einer der Zeitungen zu lesen brauchte, um herauszufinden, was heute, während sie den halben Tag verschläft, geschehen wird, aber natürlich enthalten auch die Zeitungen mit dem heutigen Datum nur alte Neuigkeiten, Neuigkeiten über die Dinge, die bereits geschehen sind, Dinge, an denen sich niemals mehr etwas wird ändern lassen. Auch nicht um vier Uhr morgens.
Auf einem einsamen Straßenstück tauchen hinter Kat die kleinen runden Scheinwerfer eines Wagens auf, die von Sekunde zu Sekunde größer werden. Nach ungefähr einer halben Minute ist ein hellblauer 1963er-Fiat-600 plötzlich neben ihr und zischt mit gequält aufheulendem Motor und zermürbt jaulenden Weißwandreifen vorbei.
Kurz nachdem er überholt hat, biegt Kat nach links in eine nachtstille Straße ab und nimmt ihren gewohnten Heimweg südwestlich zum Queens Boulevard.
Wäre sie geradeaus weitergefahren, hätte sie vielleicht gesehen, wie der Fiat auf die nächste Kreuzung zusteuert. Sie hätte vielleicht gesehen, wie die Ampel an der Kreuzung von Grün auf Gelb umspringt. Sie hätte vielleicht das Aufheulen des Motors gehört, als der Fahrer des Fiats das Gaspedal unbarmherzig bis zum Anschlag durchtritt, um das Letzte aus dem Wagen herauszuholen. Sie hätte vielleicht gesehen, wie Gelb zu Rot wird und wie der Fiat trotz Rot auf die Kreuzung rast. Sie hätte vielleicht gesehen, dass ein grüner Pick-up zur selben Zeit von rechts auf die Kreuzung fährt, hätte gesehen, wie er in den Fiat kracht, direkt in die Beifahrertür; hätte den Fiat schleudern gesehen, hätte ihn sich überschlagen gesehen, weil der Fahrer das Lenkrad zur falschen Zeit in die falsche Richtung bewegt, hätte gesehen, wie er sich dreimal um die eigene Achse dreht, bevor er am Straßenrand auf dem Dach liegen bleibt, eine Spur aus Glassplittern und Metallteilen hinter sich zurücklassend. Sie hätte vielleicht gesehen, wie er da liegt, auf dem Rücken in der leeren Nacht wie ein Käfer im Irrlicht des gelben Mondes, und wie sich seine armen kleinen Räder wild drehen und doch nirgends Halt finden. Sie hätte vielleicht gesehen, wie der Pick-up, der mit ihm zusammengestoßen ist und jetzt nur noch einen heilen Scheinwerfer besitzt, zurücksetzt, wieder die ursprüngliche Richtung einschlägt und davonfährt. Sie hätte vielleicht gesehen, wie sich das bleiche Gesicht des Fahrers im Kleinlaster kurz dem Trümmerfeld zuwendet, bevor er wegfährt. Aber sie hätte niemals erfahren, warum der Fahrer vom Unfallort geflüchtet ist, wo es doch der Fiat gewesen ist, der die rote Ampel nicht beachtet hat. Das wird niemand je wissen. Nur der Fahrer des Pick-ups ganz allein.
Und außerdem fuhr Kat nicht geradeaus.
Sie bog nach links ab und fuhr weiter. Und ebendas tut sie in diesem Moment. Sie fährt langsam, aber stetig ihrem Zuhause entgegen, und zu beiden Seiten der Straße leisten ihr die eigenen Spiegelbilder in den Fenstern der Gebäude Gesellschaft. Drei Kats fahren in dieselbe Richtung. Den Unfall hätte sie hier niemals sehen können. Und als das Krachen des Zusammenpralls ertönt, weiß sie nicht, woher es kommt.
Sie hört es, dreht kurz Buddy Holly leiser und sieht in den Rückspiegel. Aber als sie dort nichts als Dunkelheit ausmachen kann, nicht einmal ein Paar Scheinwerfer, die in der Ferne wie Wolfsaugen blitzen, stellt sie die Musik wieder lauter, vielleicht sogar noch ein wenig lauter als vor dem verstörenden Lärm des Zusammenpralls. Und sie fährt weiter.
Vielleicht war es nur ein Donnern, das sie gehört hat. Hat nicht der Mann im Radio davon gesprochen, dass frühmorgendliche Schauer zu erwarten seien?
3
Kat lenkt ihren Wagen in die Austin Street.
Sie kann bereits ihr Apartmenthaus sehen.
Sie sieht auch, wie einer ihrer Nachbarn – sie erinnert sich nicht an seinen Namen, ein Farbiger, der immer sehr nett gewesen ist und der ihr einmal sogar Starthilfe gegeben hat – mit seinem Buick Skylark vom Long-Island-Railroad-Parkplatz biegt und ihr entgegenkommt.
Als ihre Autos aneinander vorbeifahren, winken die Nachbarn sich zu.
Frank! Sie meint, Frank sei sein Name. Er fällt ihr sofort ein, als sie sein Gesicht deutlich sieht, vor dem die orangefarbene Glut seiner Zigarette umhergeistert wie ein gezähmtes Glühwürmchen.
Sie fragt sich, was er wohl um vier Uhr morgens hier draußen vorhaben mag. Sie weiß, dass Franks Frau Krankenschwester ist und häufig Nachtdienst hat – wenn Kat von der Arbeit in der Bar nach Hause kam, hat sie oft Licht in der Wohnung gesehen. Aber sie ist keinem von beiden, weder Frank noch seiner Frau, um diese Zeit auf der Straße begegnet.
Kat steuert ihren Wagen auf den Long-Island-Railroad-Parkplatz, der sich genau gegenüber den Hobart Apartments befindet, in denen sie wohnt. Sie fährt mit ihrem Studebaker auf den Platz, den Franks Buick gerade frei gemacht hat, und stellt den Motor ab. Das Radio verstummt.
Erst einmal hat sie für den kurzen Heimweg von der Bar mehr als ein paar Minuten – die Länge eines Songs – gebraucht. Sie hatte damals einen anderen Weg genommen, um einen der Stammgäste daheim abzuliefern, der sein letztes Geld für einen Drink ausgegeben hatte und sich kein Taxi mehr leisten konnte. Und auch kein Trinkgeld für sie übrig hatte. Während der Fahrt war nichts Schlimmes geschehen, aber es blieb doch das erste und letzte Mal, dass Kat einen Gast nach Hause gefahren hat. Sie war die ganze Zeit nervös gewesen, hatte mit schwitzenden Händen das Lenkrad umklammert, aber entscheidender war das Gefühl gewesen, eine Grenze überschritten zu haben, die nicht hätte überschritten werden dürfen.
Ein leichter Wind bläst um die Äste der Eichen am Straßenrand. Ein paar Blätter werden fortgeweht, aber die meisten halten sich.
Als Kat sich aus dem Auto zwängt, sieht sie einen schwarzweißen Streifenwagen, der leise an ihr vorbeischleicht. Das Rotlicht springt aus seinem Dach hervor wie die Spitze eines Lippenstifts. Sie erkennt im Wageninneren das blasse Gesicht eines einzelnen Polizisten, der in ihre Richtung sieht. Dann ist er fort. Sie schaut dem roten Glühen der Rücklichter nach, bis der Wagen am Ende des Blocks um eine Ecke biegt.
In der Ferne ertönt eine Autohupe.
Ein Hund heult den Mond an, dann ein lauter Ruf, Schnauze, ein schallender Schlag, der Hund jault, und dann Stille.
Sie ist müde. So verflixt müde.
Kat ist der Ansicht, die Menschen sollten Winterschlaf halten wie die Bären. Der Winter zehrt an der Seele. Wenn die Menschen ihn verschlafen könnten, würden sie im Frühling erholt aufwachen, bereit für den Rest des Jahres. Sie könnten ihm mit Hoffnung entgegensehen, vielleicht sogar voller Optimismus. Aber nein, wenn sich der Frühling anbahnt, wie er es jetzt tut, sind die Menschen mürbe vom Winter. Kalt und mürbe. Und kurz davor, zu zerbrechen.
Kat schlägt die Wagentür zu, sieht, dass sie vergessen hat abzuschließen, reißt die Tür nochmal auf, drischt den Knopf runter und schließt sie wieder.
Sie kann es kaum abwarten, endlich in die Badewanne zu steigen.
Aber Kat ist ihrer Wohnungstür, von der die Farbe abblättert, gerade erst zwei kleine Schritte näher gekommen, als sie wie angewurzelt stehen bleibt.
Sie schluckt angstvoll.
Plötzlich ist ihr Mund schrecklich trocken.
Im Dunkel der Nacht sieht sie eine grobschlächtige Gestalt in der Nähe einer der vernarbten Eichen stehen, die den Eingang der Hobart Apartments bewachen und sie von ihrem warmen Bad trennen.
Die grobschlächtige Gestalt tritt aus dem Schatten der Bäume hervor und kommt ihr entgegen.
Sie – er – scheint von ihr angezogen zu werden wie von einem Magnet, er scheint nicht zu gehen, sondern ihr wie ein Jo-Jo an seinem Faden entgegenzugleiten. Da ist nichts zu merken von dem schwerfälligen Schlurfen, mit dem ein ungeschlachter Mann sich normalerweise von einem Ort zum anderen schleppt. Dieser Kerl fliegt auf sie zu, und es wirkt bedrohlich.
Kat presst sich die Handtasche an die Brust wie eine Art Talisman, einen Schutzschild gegen die Nacht, und möchte sich am liebsten an dem Mann vorbeischlängeln, um schnellstens in ihre Wohnung zu gelangen.
Und plötzlich ist alles grell hell. Und laut.
Sie sieht jedes Detail, sieht die Hautporen des Mannes, groß und von Schmieröl verstopft, Mitesser, die seine Nase übersäen. Der Fleck auf seinen Jeans hat die Form eines der Staaten des Mittelwestens, deren Namen sie sich nie merken kann, und ist kaffeebraun. Die Roststellen auf der Klinge des Messers, das er in den Hand hält, erinnern an Sommersprossen. Sie hört irgendwo ein Radio plärren. Gedämpfte Stimmen. Drei Blocks weiter gibt gerade ein Motor den Geist auf. Sie sieht eine Spinne an der Eingangstür ihres Gartenapartments. Sie spinnt ihr Netz links oben in der Ecke. Sie hört, wie drinnen das Badewasser einläuft, hinter der Spinne und der Eingangstür, und die Wanne mit warmem Wasser füllt, in das sie schon bald hineingleiten wird.
Aber das stimmt doch nicht, oder? Das mit dem Bad ist nicht wahr. Jedenfalls noch nicht. Und es wird niemals wahr werden, wenn sie es nicht in ihre Wohnung schafft.
Der Mann mit dem Messer hält weiter auf sie zu.
Aber Kat ist jetzt an ihm vorbei, auf der Straße. Adrenalin pulsiert durch ihre Adern. Auf der Suche nach ihren Schlüsseln zerrt sie hektisch am Reißverschluss ihrer Tasche. Sie fischt in deren offenem Schlund, und ein Lippenstift fliegt heraus, landet klappernd auf der Straße, rollt ein Stück und bleibt liegen. Sie hört, wie ihr Angreifer ihn unter seinem derben Bauarbeiterstiefel zermalmt. Also geht er tatsächlich, also muss er ein Mensch sein, obwohl er doch zu schweben schien. Gespenster tragen keine schmutzigen Jeans und haben weder verstopfte Hautporen noch Mitesser, oder? Gespenster tragen keine braunen Bauarbeiterstiefel. Und sie brauchen keine Messer. Ihre pinkfarbene Puderdose springt dem Lippenstift hinterher, und als sie auf den Boden prallt, meint Kat hören zu können, wie der Spiegel im Innern zerplatzt.
Sieben Jahre Pech, denkt sie blödsinnigerweise. Dann bin ich fünfunddreißig.
Aber jetzt spürt sie den Schlüsselbund in der rechten Hand und steht vor der Eingangstür, und sie tastet sich durch die Schlüssel, verzweifelt auf der Suche nach dem richtigen. Sie ist schweißgebadet, obwohl die Nacht so kühl ist, und dann hat sie ihn, den richtigen, den passenden Schlüssel. Sie schiebt ihn in das Schloss des Türknaufs und dreht ihn und stößt gegen die Tür. Und die Tür schwingt auf und begrüßt sie, komm herein, Kat, willkommen zu Hause. Sie macht einen Schritt in Richtung Wohnzimmer, in die sichere Dunkelheit ihres Wohnzimmers, die einladend lockt wie ein Schoß, wie die offenen Arme einer Mutter. Schon bald wird sie die Tür vor den Gefahren der Welt schließen und sich ins warme Badewasser sinken lassen. Und alles vergessen, was hier geschehen ist.
Nur dass eine grausame Hand sie an den Haaren packt und zurückhält. Und diese Hand zerrt sie fort von der Eingangstür, die offen stehen bleibt, der Schlüsselbund pendelnd am Türknauf.
Ich wollte doch nur mein verdammtes Bad, denkt sie.
Und dann erhebt sich die andere Hand, die sie nicht am Haarschopf gepackt hält, in die Nachtluft über ihr. Sie hält ein Messer, ein großes Küchenmesser, dessen Klinge von Rostflecken übersät ist.
Das Messer scheint für einen Moment in der Luft stillzustehen. Kat kann es aus dem Augenwinkel sehen.
»Bitte«, sagt sie.
Und das bleibt alles, was sie sagt, bevor das Messer herabgestoßen wird und sie gleich hinter dem Schlüsselbein trifft. Metall knirscht am Knochen, es folgt ein ekelerregendes, glitschiges Schmatzen … und dann werden diese Laute übertönt von einem Schrei. Jemand stößt einen lauten Schrei aus.
4
Patrick wacht vom Weckerklingeln auf, und obwohl er nicht weiß, was er noch Sekunden zuvor geträumt hat, ist er sicher, dass es nichts Gutes war, denn in seinem Kopf dröhnt ein schmutziger Schmerz, als habe man ihm zerknülltes Fischeinwickelpapier und dreckige Socken unter die Schädeldecke gestopft. In seinem Mund schmeckt es nach Zigarettenasche. Seine Augen brennen.
Er tastet nach dem Wecker, noch im Halbschlaf, dreht ihn wieder und wieder zwischen den Fingern, bis er schließlich den richtigen Knopf findet und das Schrillen verstummt. Er stellt die Uhr wieder dort ab, wo er sie gefunden hat.
Wo bin ich?
Er blinzelt ein paarmal.
Wohnzimmer. In einem Apartment. Auf dem Planeten Erde.
Wer bin ich?
Patrick Donaldson. Neunzehn Jahre alt.
Was bin ich?
Ein menschliches Wesen, das man aufgefordert hat, sich in ein fremdes Land zu begeben, um dort Schlitzis – ebenfalls menschliche Wesen – umzubringen. Fürs Vaterland.
Wann bin ich?
Vier Uhr morgens.
Er schaut auf den Fernseher und sieht nur Schnee.
Auf dem Sofa neben ihm ein häufig befingerter Briefbogen, dessen Betreff alles erklärt, was der Erklärung bedarf. »Vorladung zur Musterung«, heißt es dort.
»Leckt mich doch«, antwortet Patrick.
Er rappelt sich hoch, kratzt sich selbstvergessen, reckt sich, bis alles wieder an Ort und Stelle ist – er muss sich im Schlaf wohl verlegen haben -, und zupft sich die Unterhose aus der Ritze. Er säubert sich den eklig schmeckenden Mund mit der Zunge und schluckt.
Und nach einem weiteren Blick auf den Musterungsbefehl trottet Patrick über den braunen Teppich hinaus auf den Flur.
»Ist es Zeit?«
Seine Mom (sie heißt Harriette, aber obwohl er auf dem Papier schon erwachsen ist, sieht er sie immer noch als Mom und ist ziemlich sicher, dass es auch ewig so bleiben wird) blickt aus gelbsüchtigen Augen, die nicht mehr sind als Schlitze zwischen Fettwülsten, zu ihm auf. Sie sieht nicht gut aus. Patrick hat sich schon oft gefragt, wie lange sie es wohl noch machen wird.
Sie ist erst zweiundsechzig. Würde er in dem Alter sterben, das seine Mutter jetzt erreicht hat, hieße das, er hätte nun bereits ein Drittel seines Lebens hinter sich. Jedenfalls so ungefähr.
»Ist es Zeit?«, fragt seine Mutter erneut.
Patrick nickt. »Es ist Zeit.«
»Oh«, sagt sie.
»Ja«, sagt er.
Dann geht er zu einem großen Apparat in der Ecke, einer Maschine, die verhindern wird, dass es seiner Mutter noch schlechter geht, oder die zumindest den Verschlechterungsprozess verlangsamt.
So sagt jedenfalls Erin.
Frank und Erin, die nebenan wohnen, haben ihnen die Maschine besorgt. Erin ist Krankenschwester. Sie hat im Krankenhaus Beziehungen spielen lassen, damit Mom die Maschine bekam, denn Mom sagte, fortzugehen und die letzten Tage ihres Lebens in einem sterilen Krankenhauszimmer zu verbringen käme für sie nicht infrage. Sie sagte, sie würde lieber sterben, als in einem Krankenzimmer weiterzuleben, das nach Lösungsmitteln riecht, einem Krankenzimmer, aus dem man alles Menschliche weggeschrubbt hat.
Erin hat Patrick zudem beigebracht, wie die Maschine zu bedienen ist. Und danach richtet er sich jetzt.
Er schiebt sie hinüber zu seiner Mutter, greift deren Arm und dreht ihn mit Schwung herum, so dass die fischbauchweiße Unterseite sichtbar wird. Ebenso wie die arteriovenösen Fisteln: dauerhaft eingesetzte Schläuche, durch die das Blut ein- und ausfließt.
Patrick schließt seine Mutter an die Maschine an und setzt das Gerät in Betrieb, und wie jedes Mal hat er auch jetzt das Gefühl, in einem Science-Fiction-Film zu sein, so unwirklich kommt ihm die Situation vor.
Jede vierte Stunde, hat man ihn instruiert.
Um fünf Uhr, in einer Stunde, werden Moms Augen nicht mehr ganz so gelb sein. Und ihre Haut wird fast schon menschlich aussehen.
»Du kannst es bestimmt kaum erwarten, dass ich sterbe«, sagt Mom.
»Du weißt doch, dass es mir nichts ausmacht, mich um dich zu kümmern«, erwidert er, und das ist meistens, unter anderem auch jetzt, nicht unwahr. Es ermüdet und bekümmert ihn, aber insgesamt macht es ihm nichts aus. Schließlich ist er der Mann im Haus. Wer sonst sollte es tun? Sein Dad hat sich aus dem Staub gemacht, als Patrick zehn war. Ging, um das berühmte Päckchen Zigaretten zu kaufen, und kam nie wieder.
Manchmal gelingt es Patrick, sich einzureden, dass Dad sie nicht im Stich gelassen hat. Er ist von einem Laster überfahren worden oder so ähnlich, hatte ja keine Papiere bei sich, und bereits in dem Moment, als er tot im Rinnstein landete, hieß er mit neuem Namen John Doe. Ganz gewiss jedoch eine Stunde später, als man seinen Leichnam auf einen kalten Metalltisch legte, mit seitlichen Abflussrinnen, die außer der Seele alles aufnehmen, was tote Leiber von sich geben. Hätte Dad seine Brieftasche dabeigehabt, wären Patrick und Mom bestimmt informiert worden über das, was ihm geschehen ist, aber so wie es aussieht, ist man wohl mit Dad verfahren, wie man es seit dem Bürgerkrieg mit jedem John Doe gemacht hat: Man hat ihn auf dem Potter’s Field auf Hart Island anonym bestattet. Verscharrt in einem Massengrab, im Kiefernsarg, drei davon übereinandergestapelt. Ohne Zeremoniell oder individuelles Erkennungszeichen. Das Ende.
Ja, manchmal schafft Patrick es tatsächlich, das zu glauben. Irgendwie ist es angenehmer als die Vorstellung, dass er sie einfach verlassen hat. Dass er einfach davongegangen ist, ohne einen Blick zurück. Dass sein Vater irgendwo lebt und lacht mit einer neuen Frau, die nicht krank ist, mit einem neuen Sohn, der keine Ähnlichkeit hat mit der Frau, der er davongelaufen ist, in einer neuen Stadt, die ihn nicht an die erinnert, die er hinter sich gelassen hat.
Aber dann entsinnt sich Patrick an den Augenblick, als er am Tag, nachdem Dad gegangen war, dessen halbvolle Packung Pall Mall auf dem Küchentresen fand. Eben mal losgegangen, um Zigaretten zu kaufen, obwohl er noch welche hatte? Hä? Sonst noch ein Märchen auf Lager?
Eine Woche später rauchte Patrick seine erste Zigarette in einer leeren Gasse, wo er hinter Mülleimern hockte, die nach Kotze stanken und nach was Süßem – Obst vielleicht, das zu gären begonnen hatte. Er kam sich erwachsen vor, so als Raucher. Das war es doch, was Männer taten, und jetzt, wo Dad sich davongemacht hatte, war er der Mann im Haus, oder? Also würde er Pall Mall rauchen und Pabst Blue Ribbon trinken wie sein Dad.
Nur dass er Mom niemals verlassen würde.
Wahre Männer machten sich nicht aus dem Staub.
Bevor er seine erste Zigarette aufgeraucht hatte, war ihm schon flau im Magen, aber er fühlte sich dennoch gut. Sein Kopf wurde leicht, wie mit Helium gefüllt, schien sich vom Hals lösen zu können, um in die Luft aufzusteigen. Er stellte sich vor, wie sein Zeppelinkopf am grauen Großstadthimmel schwebte. Er stellte sich all die Dinge vor, die er würde sehen können – die Autos, aufgereiht wie Ameisen, die nur darauf warteten, zertreten zu werden, oder die Dachgärten der Menschen, winzige Winkel der Welt, die einzig und allein aus der Luft zu erreichen waren. Er würde ein Vogel sein und fliegen können, wohin er wollte.
Aber wahre Männer machten sich nicht aus dem Staub. Es sei denn, ihnen blieb keine Wahl.
»Wo ist dein Buch?«, fragt Patrick.
Mom zeigt mit dem Finger darauf.
Johnny zieht in den Krieg von Dalton Trumbo liegt auf ihrem Nachttisch neben einem Glas abgestandenem Wasser.
Patrick nimmt das Buch und setzt sich auf einen Sessel am Bett seiner Mutter. Er hat ihn vor zwei Monaten zu ebendiesem Zweck aus dem Wohnzimmer geholt: damit er bei ihr sitzen und ihr vorlesen kann. Der Sessel ist ramponiert und alt und zerschlissen und riecht nach Hund, obwohl sie schon seit drei Jahren keinen Hund mehr haben. Er ist voller Flecken und in sich zusammengesackt wie ein alter Mann ohne Hoffnung. Aber noch erfüllt er seinen Zweck. Patrick schlägt das Buch an der umgeknickten Seite auf und beginnt zu lesen.
»Wenn Armeen sich in Bewegung setzen«, liest er, »und Flaggen wehen und Schlachtrufe ertönen, dann gib nur acht, kleiner Mann, denn es sind nicht deine Kastanien, die im Feuer liegen, sondern die eines anderen. Du kämpfst für Floskeln, und es ist kein ehrlicher Handel, in dem du dein Leben für etwas Höheres einsetzt. Du handelst ehrenhaft, und nachdem du gefallen bist, wird dir das, wofür du dein Leben gegeben hast, absolut nicht von Nutzen sein, und man kann davon ausgehen, dass es auch niemandem sonst von Nutzen sein wird.« Er hört zu lesen auf und leckt sich die Lippen.
Mom sieht ihn aus gelben Augen an.
»Was ist?«, sagt sie.
Er antwortet nicht.
»Liebling.«
Patrick denkt an den Musterungsbefehl, der gute fünf Meter entfernt auf dem Couchtisch liegt. Er denkt an die Ränder des Briefbogens, die schon auf beiden Seiten angeschmutzt sind, so oft hat er das Blatt mit verschwitzten Fingern in die Hand genommen und immer wieder von neuem gelesen. Er stellt sich vor, wie er in Unterhosen in einer langen Reihe anderer junger Männer steht, die alle zur Musterung gekommen sind. Die ausgestreckten Arme vor die Brust heben, Handflächen nach oben. Jetzt die Arme schwenken, bis die Hände zum Boden zeigen. Jetzt die Zehenspitzen berühren. Er stellt sich vor, wie er einen Bus besteigt, um irgendein Exerziergelände zu erreichen. Er malt sich aus, wie es sein muss, während der Grundausbildung mit dem Rest seiner Einheit zu biwakieren, zu lernen, wie man im Dschungel überlebt. Er stellt sich vor, nach Vietnam zu fliegen. Er stellt sich vor, auf dem Hinweg einen Sitzplatz im Flugzeug zu haben, aber den Heimweg in einem Leichensack oder einem Sarg anzutreten, zusammen mit vielen anderen und aufgestapelt wie Gerümpel in irgendeinem Frachtraum. Noch hat er Mom nichts gesagt.
Wie wird sie reagieren, wenn er es ihr erzählt?
Eines weiß er jedenfalls genau: Sie wird sich bestimmt nicht schlagartig besser fühlen.
»Liebling?«, meldet sich Mom wieder.
Patrick wendet sich ihr zu.
»Ich glaube, mir ist jetzt nicht nach Vorlesen«, sagt er schließlich.
»Das musst du auch nicht.«
»Okay.«
Er nickt. Knickt das Eselsohr wieder ein, legt das Buch zurück auf den Nachttisch und rappelt sich auf. Er blickt hinunter auf seine Füße, sieht einen rosa Zeh, seinen großen Zeh am linken Fuß, der durch ein Loch in der Socke hervorlugt, und dann denkt er absurderweise: This little piggy went wee-wee-wee-wee-wee all the way home …
»Ich bin wieder da, bevor du damit durch bist«, sagt er und wendet sich zur Tür, dann hält er nochmal inne und sieht Mom an.
»Wenn etwas passieren würde«, sagt er. »Wenn etwas passieren würde, und ich müsste fort, würdest du zurechtkommen?«
Mom schüttelt den Kopf. Nein.
Für einen Moment denkt Patrick, das ist die einzige Reaktion, die er erhalten wird, ein Kopfschütteln, aber dann sagt Mom: »Lass mich nicht allein mit fremden Leuten.«
Patrick lächelt.
»War nur so ein Gedanke«, sagt er.
»Lass mich nicht allein mit fremden Leuten«, wiederholt sie.
Er nickt. »Tut mir leid, wenn ich dir Angst gemacht habe. Ich werde immer für dich da sein, Momma. Das weißt du doch, oder?«
Mom lächelt. »Ich weiß.«
»Okay«, sagt er. »Ich komm zurück, bevor du damit durch bist.«
Im Wohnzimmer liest Patrick den Musterungsbefehl zum sechzigsten oder siebzigsten Mal und legt ihn dann wieder auf den Couchtisch.
Er sieht aus dem Wohnzimmerfenster, vorbei an dem Fernrohr, das er dort aufgestellt hat, hinaus auf den beleuchteten Hof, der bis auf vier Bänke, ein paar Blumenbeete, Spaliere und Betonplatten leer ist. Dann geht er hinüber zum Fernrohr und richtet es auf die Fenster der Wohnungen gegenüber. Nach Patricks Überzeugung eignet sich ein Fernrohr am ehesten dazu, Nachbarn auszuspionieren. Die sind interessanter als alle Planeten und haben dazu weitaus mehr Persönlichkeit.
Um diese nächtliche Zeit sind nur zwei Fenster erleuchtet.
Auf eines davon richtet er das Fernrohr und sieht drüben nur ein vereinsamtes leeres Wohnzimmer. Eine braun und rot gestreifte Couch. Das Gemälde eines galoppierenden Pferdes an der rückwärtigen Wand. Wahrscheinlich auf der Flucht vor irgendwas. Nach Patricks Erfahrung ist es so, dass Tiere, die rennen, eher vor etwas flüchten, als dass sie einem Ziel entgegenlaufen.
Hinter dem anderen Fenster sieht Patrick eine Frau allein auf ihrer Couch sitzen. Sie muss so um die vierzig sein. Sie trägt ein schwarzes Negligé. Sie ist hübsch. Patrick denkt, dass, wenn er vierzig ist und mit einer Frau zusammenlebt, die so aussieht wie sie, er ein glücklicher Mann sein wird; er findet aber, mit einer Frau, die so aussieht wie sie, könnte er auch jetzt schon glücklich sein.
Aber dann sieht er, dass ihr die Wimperntusche über das Gesicht rinnt, und ihm wird klar, dass sie weint. Sie trocknet sich die Augen mit einem Tuch. Kein neues Rinnsal von Wimperntusche folgt dem ersten.
Er stellt sich vor, dass er hinübergeht zu ihrer Wohnung und an ihre Tür klopft. Sie würde nicht sofort öffnen. Es ist spät, und draußen laufen gefährliche Leute herum – Vergewaltiger und Klingelgangster.
»Wer ist denn da?«, würde sie fragen.
»Ihr Nachbar.«
»Ja bitte?«
»Mein Name ist Patrick. Ich wohne gegenüber, auf der anderen Hofseite.«
»Und weiter?«
»Na ja, ich hab Sie durchs Fenster gesehen. Nicht dass ich Ihnen nachspionieren wollte. Aber ich hab Sie gesehen. Ich hab gesehen, dass Sie weinen. Ich dachte, vielleicht möchten Sie darüber reden.«