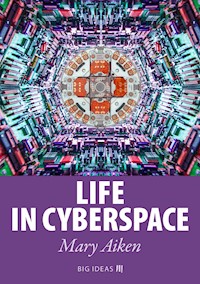18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Schützen Sie sich und Ihre Kinder vor einem Leben online – für einen intelligenten und selbstbestimmten Umgang mit dem Internet Kleinkinder, die das iPad so mühelos beherrschen wie Google-Mitarbeiter. Teenager, die mit ihrem Smartphone verwachsen zu sein scheinen und ihre Freunde nur noch im Netz treffen. Ehemänner, die ihre Nächte alleine vor dem Computer verbringen. Ehefrauen, die es keinen Tag lang ohne Internet und Kreditkarte aushalten. Großeltern, die plötzlich mit »Brieffreunden« aus Nigeria aufwarten … Das Internet beeinflusst unser Leben und unser Verhalten, verändert unsere Normen und Werte, prägt unsere Kinder und unsere Wahrnehmung. Der Cyberspace ist perfekt darin, uns zu beeinflussen. Aber wer schützt uns vor dem Cyberspace? Mary Aiken kennt die Gefahren genau und beschreibt, was das Internet aus und mit uns allen macht, wohin die digitale Revolution uns noch führen wird – und was wir dagegen tun können.Die Arbeit der profiliertesten und bekanntesten Cyber-Psychologin ist Grundlage der Fernsehserie CSI: Cyber. »An alle Eltern: Was auch immer Sie gerade tun, lassen Sie es und lesen Sie Mary Aikens ›Cyber Effekt‹, ein faszinierender Bericht, der Ihnen zeigt, wie das Internet unser Leben verändert.« The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mary Aiken
Der Cyber-Effekt
Wie das Internet unser Denken, Fühlen und Handeln verändert
Über dieses Buch
Wer schützt uns vor dem Cyberspace?
Kleinkinder, die das iPad so mühelos beherrschen wie Google-Mitarbeiter. Teenager, die mit ihrem Smartphone verwachsen zu sein scheinen und ihre Freunde nur noch im Netz treffen. Ehemänner, die ihre Nächte alleine vor dem Computer verbringen. Ehefrauen, die es keinen Tag lang ohne Internet und Kreditkarte aushalten. Großeltern, die plötzlich mit »Brieffreunden« aus Nigeria aufwarten … Das Internet beeinflusst unser Leben und unser Verhalten, verändert unsere Normen und Werte, prägt unsere Kinder und unsere Wahrnehmung. Der Cyberspace ist perfekt darin, uns zu beeinflussen. Aber wer schützt uns vor dem Cyberspace?
Mary Aiken kennt die Gefahren genau und beschreibt, was das Internet aus und mit uns allen macht, wohin die digitale Revolution uns noch führen wird – und was wir dagegen tun können.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Mary Aiken ist die bekannteste Cyber-Psychologin. Als Direktorin des CyberPsychology Research Network und Beraterin von Europol war sie auch für internationale Institutionen wie Interpol und das FBI tätig. Ihre Interessenschwerpunkte liegen auf den Gebieten Internetsicherheit, organisierte Kriminalität, Cyberstalking, Menschenhandel und Rechte von Kindern im Internet. Ihre Forschungsarbeiten waren Inspiration und Quelle der Fernsehserie »CSI: Cyber«. Mary Aiken lebt in Irland.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 bei Spiegel & Grau, Penguin Random House LLC, New York
© 2016 by Mary Aiken
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bürosüd, München
Coverabbildung: Rodrigo Corral unter Verwendung eines Fotos von Getty Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403405-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für P.L.K. & J.
Kinder sind die wichtigste Ressource der Welt und zugleich ihre größte Hoffnung für die Zukunft.
John F. Kennedy
Vorwort zur deutschen Ausgabe
In der schönen neuen Welt des Internets ist Vorsicht geboten. Das gilt für die Menschen aller Altersstufen und Lebensbereiche, doch vor allem, so findet Mary Aiken, müssen wir uns besser um die Kinder kümmern – weil sie schutzbedürftig sind und außerdem die Zukunft.
Seit das englischsprachige Original von »Der Cyber-Effekt« erschien, ist ein ganzes Jahr vergangen, in dem viel passiert ist. Grund für die Autorin, ihrem Werk noch eine Ergänzung voranzustellen:
Es ist an der Zeit, ein digitales Umfeld zu fordern, das den kindlichen Bedürfnissen gerecht wird. Das Internet wurde für erwachsene Nutzer erschaffen; deshalb wurden Kindern bei der Gestaltung des Cyberspace keine Zugeständnisse gemacht. Der utopische Anspruch des Internets lautete, dass dort alle gleich wären. Wenn alle gleich sind, werden Kinder dort wie Erwachsene behandelt, weshalb der Cyberspace für Kinder nicht geeignet ist.
Wir kennen den Komfort, die Verbundenheit, die Kreativität sowie die informativen und wirtschaftlichen Vorteile des Internets. Ich bin eine unbedingte Befürworterin der Digitaltechnologien, denn ich könnte meine Arbeit als Cyber-Psychologin gar nicht ausführen, wenn ich nicht sehr viel Zeit im Internet verbrächte. Dennoch machen mir die Auswirkungen der Technologie auf die Kindesentwicklung große Sorgen. Als ich 2013 mit der Recherche für Der Cyber-Effekt begann, war ich der Ansicht, dass man schon irgendwie auf diese Probleme eingehen werde, wenn ich nur darüber schriebe und das Augenmerk darauf richtete. Mittlerweile haben wir 2018; dennoch verschlimmert sich die Lage zusehends.
Immer jüngere Kinder nutzen heute Digitalgeräte; die aktuellste Studie belegt, dass 16 Prozent aller Drei- bis Vierjährigen inzwischen ein eigenes Tablet und mehr als 30 Prozent aller Acht- bis Elfjährigen ein eigenes Smartphone besitzen. Neuere Berichte bestätigen, dass 3 Prozent aller Fünf- bis Siebenjährigen und 23 Prozent aller Acht- bis Elfjährigen ein Profil in den sozialen Medien ihr Eigen nennen, und das trotz der Vorschrift, dass Nutzer mindestens dreizehn Jahre alt sein müssen – diese jungen Menschen werden ausgeklügelten Algorithmen ausgesetzt, die entwickelt wurden, um das Verhalten von Nutzern zu beeinflussen und zu ändern. Ich sage bereits seit einigen Jahren, dass die Technologieunternehmen sich unserer »psychologischen Achillesferse« bedienen und uns eher schwächen als stärken. Im November 2017 gab der ehemalige Facebook-Präsident Sean Parker zu, dass die Plattform wissentlich so gestaltet wurde, dass sie »eine Schwäche der menschlichen Psyche« ausnutze. Unabhängig davon, was mit Erwachsenen geschieht, müssen wir Kinder unbedingt beschützen. Das Problem besteht darin, dass die Aneignung digitaltechnologischer Kenntnisse mit dem Zugang zum Internet zusammenfällt. Deshalb ist der Hinweis wichtig, dass Kinder nur dann gefahrlos ihre technischen Fähigkeiten ausbilden können, wenn ihr Gerät durch eine sogenannte »Airwall« (auch »Air Gap«) geschützt ist, die ihnen den Zugang zu Erwachsenen-Inhalten versperrt. Im Internet gibt es keinen flachen Beckenbereich.
Wir sollten nicht auf Studien warten müssen, um die Auswirkungen der Digitaltechnologien auf die Kindesentwicklung zu beweisen. Kinder werden geboren und setzen sich aktiv mit der Technik auseinander, weshalb Eltern und Bezugspersonen dringend Rat brauchen. Wissenschaftler können sich im übertragenen Sinne nicht einfach ausruhen und auf Langzeitstudien warten – bis diese vorliegen, muss eine Kombination aus den bislang erworbenen Erkenntnissen, einer sachkundigen Meinung und Einigkeit unter Experten maßgeblich sein. Mit meinem Buch Der Cyber-Effekt bin ich ein Risiko eingegangen; als ich die Neuigkeiten über meinen Vertrag mit dem Verlag mit einem Uni-Kollegen teilte, stieß das bei ihm tatsächlich auf leichte Geringschätzung: »Ach, tu das lieber nicht – schon manch eine akademische Laufbahn wurde durch ein erfolgreiches Buch zerstört.« Instinkt kann als Tendenz betrachtet werden, auf vorhersehbare Art und Weise auf eine Sache zu reagieren; in meinem Fall bedeutet Vorhersehbarkeit, nicht der gängigen Meinung zu folgen. Ich entschloss mich, das Buch zu schreiben, und es war mir eine Freude, einige der enggesteckten Grenzen wissenschaftlicher Texte zu verlassen und frei über die Auswirkungen der Digitaltechnologien auf den Menschen zu schreiben. »Ich glaube, ich denke, vielleicht, was wäre, wenn …« Aber was noch wichtiger ist: Es war eine Erleichterung, all das in Worte zu fassen, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Mittlerweile wird mein Buch so gut wie überall verkauft; dieses Jahr wird es in China und Russland erscheinen. Der Cyber-Effekt wurde überall umfassend rezensiert, und ich freue mich, mitteilen zu können, dass mein Werk von der Times als Buch des Jahres in der Kategorie »Gedankenwelt« und von Nature. International Journal of Science als »beste wissenschaftliche Neuerscheinung« ausgewählt wurde.
Soweit es die Kinder betrifft, ist das Internet kaputt. Die zu Google gehörende Plattform YouTube geriet 2017 stark in die Kritik, weil dort Videoaufnahmen von Kindesmisshandlungen und gewalttätige/beleidigende Inhalte zum Streamen hochgeladen werden durften. Im Zuge einer BBC-Recherche stellte sich heraus, dass ein Teil des zur Moderation der Inhalte verwendeten Systems seit über einem Jahr nicht mehr funktionierte. Google ließ daraufhin verlauten, dass das Unternehmen Gegenmaßnahmen ergreifen und unter anderem »Tausende Moderatoren anstellen« werde. Moderatoren werden als menschliche Filter gegen das Schlimmste eingesetzt, was das Internet zu bieten hat. Wir sollten uns daran erinnern, dass diese jungen Moderatoren ebenfalls anderer Leute Kinder sind. Wer ist verantwortlich, wenn ihre psychische Gesundheit dadurch Schaden nimmt? Wird das für ihren Arbeitgeber überhaupt wichtig sein?
Im Januar 2018 teilte Facebook mit, dass der Algorithmus der Plattform geändert werde; in Anerkennung der Tatsache, dass die passive Nutzung sozialer Medien schädlich sein könne, sei das neue Ziel des Unternehmens, den Usern dabei zu helfen, »gehaltvoller miteinander zu interagieren«. Im gleichen Monat äußerten Apple-Aktionäre ähnliche Bedenken hinsichtlich der psychischen Gesundheit im Angesicht eines »wachsenden gesellschaftlichen Unbehagens« zur intensiven Smartphone-Nutzung von Kindern. Ich bin der Meinung, dass die Anerkennung dieser Herausforderungen durch die Unternehmen einen lang erhofften Wendepunkt darstellt und in einem gewissen Grad das akademische Risiko belohnt, das ich mit der frühen Äußerung meiner Bedenken auf mich nahm. Obwohl wir uns alle der Vorteile bewusst sind, werden viele der von mir genannten Probleme im Hinblick auf die Auswirkungen der Digitaltechnologien auf Kinder und Jugendliche mittlerweile von Studien- und Forschungsergebnissen bestätigt, ganz besonders in den Bereichen Angststörungen, Depressionen, Selbstbewusstsein, Risikoverhalten, Körperbild, Selbstverletzung, Schlafqualität und Suchtverhalten.
Die aktuellsten Studien beweisen inzwischen, dass der Anteil der an Angststörungen und Depressionen leidenden jungen Menschen im Laufe der letzten fünfundzwanzig Jahre um 70 Prozent gestiegen ist, während Jugendliche angeben, dass vier der fünf beliebtesten sozialen Medien ihre Angststörung verstärkt hätten. Im Bericht der britischen Royal Society for Public Health aus dem Jahr 2017 heißt es, dass »die sozialen Medien eine Krise der psychischen Gesundheit [junger Menschen] nähren könnten«. Auch Schlafstörungen nehmen zu: Einer von fünf Jugendlichen gibt an, nachts aufzuwachen und Mitteilungen in den sozialen Medien zu lesen, weshalb eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit besteht, im Schulunterricht an ständiger Übermüdung zu leiden. Neun von zehn Teenagerinnen sind nach eigener Aussage mit ihrem Körper unzufrieden; die Zahl der Jugendlichen, die wegen einer Essstörung stationär behandelt werden, ist ebenfalls drastisch gestiegen. In meinen Augen hängt dieser Zuwachs mit der Nutzung sozialer Medien zusammen, nebst der Zugänglichkeit solcher Websites wie »Pro-Ana« oder »Pro-Mia« – Websites, die Anorexie und Bulimie fördern oder idealisieren und anfällige, sich ihrer selbst allzu bewusste Teenager beeinflussen. Glücklicherweise gibt es in Deutschland Regelungen, die Kinder und Jugendliche im Internet vor selbstzerstörerischen Inhalten bewahren sollen.
2017 wurden wir Zeuge der explosiven Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein. Bis zum Ende des Jahres hatten mehr als fünfzig Frauen Vorwürfe gegen Weinstein erhoben, der sie verfolgt, belästigt, misshandelt, missbraucht und in manchen Fällen auch angegriffen haben soll. Zwei Dinge müssen hier auseinandergehalten werden: Akzeptierbarkeit und Illegalität. Illegales Verhalten umfasst alles, was gegen das Gesetz verstößt; Akzeptierbarkeit ist da schon ein wenig komplexer. Es hilft, sich einen Kreis von Verhaltensweisen vorzustellen, die von einem Rand umschlossen werden. Dieser Rand definiert den Punkt, ab dem akzeptables Verhalten inakzeptabel wird. Dieser Punkt wird in jeder Kultur von der öffentlichen Meinung bestimmt, d.h. davon, welches Verhalten wir als Gesellschaft akzeptieren wollen. Die #MeToo-Kampagne hat uns gelehrt, dass erzwungene Handlungen am Arbeitsplatz – also solche, bei denen ein missbrauchender Akteur in einer ungleichen Beziehung aus einer Machtposition heraus Druck auf jemanden ausübt, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen – gemeinhin als inakzeptabel angesehen werden.
Und wie übertragen wir diesen Schluss aus Beziehungen zwischen Erwachsenen auf Kinder im Internet? Zunächst wäre da die Akzeptanz. Die Gesellschaft hält es ganz bestimmt nicht für akzeptabel, wenn Kindern nachgestellt wird, ob nun im Internet oder anderswo. Viele dieser Verhaltensweisen dürften die Grenze zur Illegalität überschreiten. Aber was ist mit dem Inakzeptablen, also Verhaltensweisen, die wir als Gesellschaft nicht hinnehmbar – oder sogar abscheulich – finden, unabhängig von technischen Diskussionen über die Rechtslage bei einzelnen Aspekten dieses Verhaltens? Im Internet sind die Urheber solcher Nachstellungen Unternehmen, die zu kommerziellen Zwecken andere Menschen ins Visier nehmen, in diesem Fall Minderjährige. Wenn Kinder im Spiel sind, setzen diese Akteure Zwang in ungleichen Beziehungen ein, während Erwachsene Algorithmen schaffen, die eben dazu erzeugt wurden, Schwächen bei dem in Entwicklung befindlichen kindlichen oder jugendlichen Gehirn auszumachen und auszunutzen. Genauer gesagt konzentrieren diese Personen sich auf den jugendlichen »Drang, gemocht zu werden«, das Crowdsourcing des Selbstbewusstseins, während das Kind mit dem Gruppenzwang unter Gleichaltrigen und der Entstehung des eigenen Ichs kämpft.
Einigermaßen unausweichlich erwarten uns in den USA auf lange Sicht Sammelklagen, die Schadenersatz für jene Beeinträchtigungen fordern werden, welche dem in Entwicklung befindlichen Kindergehirn zugefügt werden, wenn es von den Tätern skrupellos für den Profit gehackt wird. Ich frage mich, wie die rechtlichen Schritte der Zukunft in Hinblick auf allgemeine Verwahrlosung und Körperverletzung aussehen werden. Treffen die Giganten der Suchmaschinen und der sozialen Medien Vorkehrungen wegen solcher zukünftiger Haftungsansprüche? Passen ihre Aktionäre auf?
Wo ist der Wendepunkt à la Weinstein? Wann kommt der Augenblick, in dem wir sagen: »Die Zeit ist um« – der Augenblick, in dem wir die Akzeptierbarkeit dieses Verhaltens unabhängig von den langfristigen rechtlichen Fragen betrachten? Was erscheint uns akzeptabel daran, wenn Erwachsene jeden Tag zur Arbeit gehen, um komplexe Software zynisch so zu gestalten, dass man damit das kindliche Gehirn samt seiner Schwächen manipulieren kann, indem man die Abhängigkeit des Kindes vom Gruppenzwang ausbeutet?
Das ist ein Angriff auf unsere Kinder, ein Angriff auf die Kindheit.
Kinderleben zählen, und 2018 sollten wir handeln.
EinleitungWenn Mensch und Technik kollidieren
Mit dem Rücken gegen die harte Betonwand gelehnt, sitze ich auf einer kalten, harten Bank im Einsatzraum eines Polizeireviers irgendwo im südlichen Los Angeles – eine Gegend, die für ihre Gangs, ihre Kriminalität, ihre Armut, ihren städtischen Verfall und, vor rund zwanzig Jahren, für ihre gewalttätigen Rassenunruhen bekannt war. Es ist 4.45 Uhr morgens. Ich habe seit Stunden nichts gegessen: nicht gerade ein kluger Schachzug. Eine Mischung aus Hunger, Jetlag und Anspannung dreht mir den Magen um.
LAPD-Lieutenant Andrea Grossmann beginnt mit der Einsatzbesprechung und erläutert, wie ein Sondereinsatzkommando in etwa einer Stunde den größten Menschenhändler der USA und einen von Kaliforniens »meistgesuchten Verbrechern« dingfest machen wird. Circa 40 Polizisten werden an dem Einsatz beteiligt sein: ein Team aus erfahrenen Profis des FBI, der Homeland Security, des ICAC (Internet Crimes Against Children), der kalifornischen Bundespolizei und des LAPDs. Und dann bin da noch ich, die Einzige im Raum ohne Schusswaffe. Nur vereidigte Beamte dürfen eine Waffe tragen.
In meinem Heimatland Irland regnet es derweil. Der Frühling zieht sich hin, grau und nass wie eh und je. Ich denke an mein gemütliches Büro in Dublin, an meine Bibliothek, meinen PC und mein ruhiges Leben als Wissenschaftlerin – nur dass mein Leben in letzter Zeit ganz und gar nicht mehr so ruhig gewesen ist. Im Laufe der letzten zehn Jahre habe ich mich als forensische Cyber-Psychologin etabliert, und in dieser Funktion habe ich die Welt bereist und mich mit anderen Experten meiner Disziplin getroffen, habe Forschung betrieben, mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, an Konferenzen teilgenommen und Hunderte Vorträge, Seminare, Workshops und Präsentationen gehalten. Die Cyber-Psychologie ist ein recht junges Fach und steckt noch in den Kinderschuhen. Jahr für Jahr weckt sie mehr Interesse. Immer stärker macht sich ein Gefühl der Dringlichkeit breit. Ich denke, die meisten von uns, die an vorderster Front tätig sind, können diese Veränderungen spüren, ebenso wie den umfassenden Eindruck der Orientierungslosigkeit. Unser Leben wandelt sich, und das menschliche Verhalten passt sich an. Den Grund für dieses Phänomen sehe ich als Cyber-Psychologin darin, dass Menschen sich bei der Interaktion mit Technologien anders verhalten als im direkten Umgang miteinander in der realen Welt.
Manche dieser Veränderungen haben sich so schnell vollzogen, dass es uns überaus schwerfällt, den Unterschied zwischen einem vorübergehenden Trend, einer sich neu entwickelnden Verhaltensweise und einer bereits akzeptierten gesellschaftlichen Norm zu erkennen. Der Einfachheit halber werde ich die unmittelbare Wirklichkeit von nun an als »reales Leben« oder »reale Welt« bezeichnen, um sie vom Cyberspace zu unterscheiden, und das, obwohl mir voll und ganz bewusst ist, dass die Geschehnisse dort so real sind wie das Leben selbst. Neue Normen, die im Internet entstehen, wirken sich auch auf die echte Welt aus. Was in der virtuellen Welt passiert, kann also die reale Welt beeinflussen – und umgekehrt.
Jedes Mal, wenn ich über meine Arbeit sprechen soll, beginne ich mit folgender Definition: Cyber-Psychologie »untersucht den Einfluss neuer Technologien auf das menschliche Verhalten«. Dabei geht es nicht allein um die Frage, ob man online oder offline ist: »Cyber« bezieht sich auf alles Digitale, Technologische – von Bluetooth bis hin zum selbstfahrenden Auto. Das heißt, ich analysiere die menschliche Interaktion mit Online-Technologien und digitalen Medien, mit Mobilgeräten und Apparaten zur Herstellung von Internetverbindungen, mit Spielen, virtueller Realität und mit künstlicher Intelligenz (A.I., »artificial intelligence«) sowie mit erweiterter Intelligenz (I.A., »intelligence amplification«) – alles von Handys bis Cyborgs. Am stärksten konzentriere ich mich aber auf die Internetpsychologie. Wenn etwas in den Bereich der »Technologie« gehört und das menschliche Verhalten zu beeinflussen oder verändern vermag, dann will ich mir das Wie anschauen – und über das Warum nachdenken.
Die Zeit ist mein größter Feind, denn meine Arbeit befindet sich im ständigen Wettlauf mit der technischen Entwicklung. Das bedeutet eine große Herausforderung dafür, wie Akademiker sich normalerweise einem neuen Phänomen nähern. Wie können wir als Wissenschaftler mit den technologischen Veränderungen in unserem Leben, unseren Verhaltensweisen und unserer Gesellschaft Schritt halten? Eine gute Langzeitstudie, die das menschliche Verhalten im Laufe der Zeit ergründet und den Forschern damit schlüssige wissenschaftliche Erkenntnisse bietet, kann einige Jahre bis Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Im Internetzeitalter entspricht das mehreren Generationen. Und aufgrund meiner Erfahrungen – besonders im Hinblick auf die Entstehung neuer Normen durch eine beschleunigte Art der Sozialisation, die ich »Cyber-Sozialisation« nenne – glaube ich, wir sollten keinesfalls nur herumsitzen und auf Antworten warten.
Die gute Nachricht: Einige Facetten der Internetpsychologie werden bereits seit den 1990er Jahren untersucht und sind heute gut bekannt und belegt. Die Auswirkungen der – wirklichen oder vermeintlichen – Online-Anonymität sind nur ein Beispiel von vielen. Bei dieser Anonymität handelt es sich um das zeitgenössische Äquivalent der Superheldenkraft Unsichtbarkeit. Der Einfluss der Anonymität – Thema unzähliger faszinierender Studien in vielen Fachbereichen – sollte nicht unterschätzt werden. Sie schürt auch den nicht minder wichtigen sogenannten Online-Enthemmungseffekt, der wiederum andere Folgen hat. Ich bin in einem Dutzend Forschungsgruppen aktiv und habe von der Cyber-Kriminalität bis hin zur Cyberchondrie – der ängstlichen Fixierung auf Gesundheitsfragen, die sich durch die medizinische Recherche im Internet nur verstärkt – so ziemlich alles untersucht. Dabei habe ich immer wieder festgestellt: Das menschliche Verhalten im Internet wird in meinen Augen meist von einem mit nahezu mathematischer Wahrscheinlichkeit vorhersehbaren Faktor bestimmt und beschleunigt: vom Cyber-Effekt – dem E=mc2 unseres Jahrhunderts.
Das Internet verstärkt beispielsweise die Nächstenliebe, was wiederum heißt, dass die Menschen im Cyberspace zuweilen großzügiger erscheinen als im realen Leben. Wir können dieses Phänomen gut am Beispiel des außerordentlichen Wachstums des nichtkommerziellen Online-Crowdfunding-Sektors beobachten. Ein weiterer bekannter Effekt im Cyberspace ist der, dass Menschen anderen, denen sie im Internet begegnen, leichter vertrauen und Informationen rascher austauschen können. Dies führt einerseits schneller zu Freundschaften und Intimität, bedeutet aber andererseits, dass die Leute dazu neigen, sich sicher zu fühlen, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht sind. Aufgrund des Online-Enthemmungseffekts (ODE, »online disinhibition effect«) sind Einzelne oft mutiger, enthemmter und in ihrem Urteilsvermögen eingeschränkter – fast so, als wären sie betrunken. Und in diesem enthemmten Zustand können sich gleichgesinnte Menschen unter dem Mantel der Anonymität schneller und einfacher finden, was wiederum zu einem weiteren Effekt führt: dem Online-Zusammenschluss. Diese Gebilde und Effekte im Cyberspace werde ich in den folgenden Kapiteln ausführlich untersuchen; auch im Glossar gehe ich auf die Begriffe ein. Letztlich jedoch lassen sich diese Bezeichnungen erst mit Hilfe intensiver experimenteller Untersuchungen, der Manipulation von Variablen und der Ermittlung von Ursache und Wirkung durch die empirische Wissenschaft vollständig nachvollziehen und bewerten. Der Cyberspace ist jedoch kein Labor mit weißen Mäusen und Schaltern. Tatsächlich ist er vielmehr eine komplexe Matrix menschlicher Daten, die sich im virtuellen Raum manifestieren. Zu seiner Erforschung bedarf es akribischer digitaler Forensik und genauer Details cyber-psychologischen Verhaltens.
Ein Sprichwort sagt: »Der Teufel steckt im Detail.«[1] Das deckt sich mit meinen Erfahrungen bei der Arbeit. Die Forensik befasst sich mit der Untersuchung und Erfassung physischer Spuren an einem Tatort: Fasern, Körperflüssigkeiten und Fingerabdrücke. Denken Sie an die TV-Serie CSI. Die forensische Psychologie beschäftigt sich wiederum mit der Untersuchung verhaltenspsychologischer Überbleibsel an einem Tatort – das, was wir als »mentale Blutspritzer« bezeichnen. Und dann ist da noch mein Fachbereich, die forensische Cyber-Psychologie, die sich auf die cyber-verhaltenspsychologischen Fundstücke am Tatort konzentriert – oder, wie ich es nenne, den »digitalen Fußabdruck«. Es war der bekannte Forensiker Edmond Locard, Pionier seines Faches, manchmal auch der »Sherlock Holmes Frankreichs« genannt, der mit seiner Regel die grundlegende Prämisse forensischer Wissenschaften formulierte: »Jede Berührung hinterlässt eine Spur.« (Ihre Fingerabdrücke befinden sich mittlerweile überall auf diesem Buch.)
Dies gilt auch im Cyberspace. So gut wie alles, was wir online tun, hinterlässt digitale Spuren, digitalen Staub und digitale Abdrücke. Diese Beweisstücke aus dem Internet helfen den Strafverfolgungsbehörden bei der Untersuchung kriminellen Verhaltens, ob die Verbrechen sich nun im Cyberspace, am anderen Ende der Welt oder auf der anderen Seite der Straße ereignen.
Die Ermittlung solcherlei Daten war es, die mich letztlich nach Los Angeles führte. Gemeinsam mit einer Expertengruppe von Interpol, der größten internationalen kriminalpolizeilichen Organisation weltweit, führte ich gerade eine Studie durch. Es ging um jugendliches Risikoverhalten im Internet. In der Hoffnung auf neues Material setzte ich mich mit Lt. Grossman vom LAPD in Verbindung. Wir waren uns im Rahmen einer Konferenz im Lyoner Interpol-Hauptsitz bereits einmal begegnet. Lt. Grossman und ihre Arbeit auf dem Gebiet der digitalen Kriminalität hatte mich nachhaltig beeindruckt. Als sie einem Treffen mit mir zustimmte, um über das Projekt mit Interpol zu sprechen, setzte ich mich in einen Flieger nach Kalifornien.
Die Polizei kann sehr skeptisch sein, wenn Wissenschaftler auf der Suche nach Daten aus ihren Elfenbeintürmen hinabsteigen, jedoch kaum Verständnis für das raue Geschäft der Verbrechensaufklärung an vorderster Front mitbringen. Deshalb war ich überaus erfreut, als Lt. Grossman mich fragte, ob ich vielleicht daran interessiert sei, mit dem LAPD unmittelbare Arbeitserfahrung zu sammeln.
»Aber natürlich«, entgegnete ich in dem Glauben, sie meinte damit eine Art Praktikum in ihrem Polizeirevier, wo ich bei Meetings anwesend sein sollte. Sie aber hatte etwas anderes, sehr viel Aktiveres im Sinn.
»Wie würde es Ihnen gefallen, sich in Schale zu werfen und uns auf einen Einsatz zu begleiten?«, fragte sie und nannte sodann Aufenthaltsort und Identität eines Händlers kinderpornographischer Bilder, Filme und anderen Materials, dessen Machenschaften mit Hilfe der Cyber-Forensik aufgedeckt worden waren. Der Fall müsste mich als akademische Beobachterin doch interessieren.
»Ähm …ja«, stammelte ich. »Wenn Sie davon sprechen, mich in Schale zu werfen, dann meinen Sie, so wie das Sondereinsatzkommando? Wann?«
»Heute Nacht.«
Bei meiner Arbeit geht es um die wissenschaftliche Untersuchung von Online-Verhalten: von der Vorhersage jugendlicher Cyber-Kriminalität (Hacking)[2] bis hin zum Erstellen typologischer Profile hinsichtlich der Entstehung und Entwicklung kriminellen Verhaltens (Online-Stalking). Ich erforsche den Einsatz maschineller Intelligenz zur Lösung von Big-Data-Problemen (etwa durch Online-Technologien erleichterter Menschenhandel) und untersuche die Möglichkeiten erweiterter Intelligenz (I.A.) im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch im Internet. All das ist anspruchsvolle Arbeit, für die ich ausgebildet wurde und mit der ich umzugehen gelernt habe. Aber praxisnahe Polizeiarbeit an der Front? Echte Verhaftungen durch ein Sondereinsatzkommando? In diesen Bereichen habe ich nur sehr wenig Erfahrung.
Später am Abend, in meinem Hotelzimmer, schlüpfte ich in eine schwarze Kluft – die unauffällige Tarnkleidung aller forensischen Experten weltweit. (Warum mögliche Daten aus der Entfernung aufs Spiel setzen, indem man etwa eine hellrosa Bluse trägt, um die eigene Unsicherheit zu betonen; einen Hauch von Gelb in sein Outfit integriert, um optimistisch zu wirken; oder ein Muster zur Schau stellt, um interessant zu erscheinen?) Dann, um 3.30 Uhr morgens, schnappte ich mir eine Flasche Wasser, ging hinunter in die Lobby und gab an der Rezeption Bescheid, dass bald eine Gruppe Polizeibeamter vom LAPD auftauchen und mich abholen würde.
Der Concierge beäugte mich misstrauisch.
»Ich habe nichts angestellt«, versicherte ich ihm. »Ich wurde nur darum gebeten, einen Einsatz zu begleiten. Mehr nicht.«
So also bin ich kurz vor Sonnenaufgang hier im LAPD-Einsatzraum gelandet. Es heißt, das Wetter in Los Angeles sei stets angenehm, doch heute früh ist es unerwartet kühl. Glücklicherweise halten mich meine schusssichere Weste und mein Helm warm.
»Mit Widerstand ist immer zu rechnen«, erklärt die zuständige Beamtin. »Wenn ein Polizist zu Boden geht, klettern Sie über ihn hinweg. Bewegen Sie sich einfach weiter voran. Falls Sie selbst zu Boden gehen, bleiben Sie liegen.«
Ich werfe einen Blick auf den Hefter mit Anweisungen auf meinem Schoß. Darin findet sich auch eine Wegbeschreibung zum nächsten Krankenhaus. Falls Sie zu Boden gehen, bleiben Sie liegen …
Im Angesicht der Ungewissheit – und der potentiellen Gefahr – nehme ich eine Haltung ein, die mir mein ganzes Leben bereits gute Dienste geleistet hat: Ich hoffe auf das Beste, erwarte aber das Schlimmste. Wie sich herausgestellt hat, ist das ein recht gutes Motto für nahezu jedes Unterfangen, ob in der realen oder der virtuellen Welt. Jedes Mal, wenn wir einem sozialen Netzwerk beitreten, eine App herunterladen oder online eine Rechnung zahlen, unseren Kindern ein neues digitales Spielzeug kaufen oder jemanden per Internet-Partnerbörse kennenlernen, setzt dieselbe steile Cyber-Lernkurve ein, und wir stoßen bald auf neue Risiken und Herausforderungen. Einen abschüssigen Bergpfad zu erklimmen, um am Ende des Weges mit einem wundervollen Ausblick belohnt zu werden, ist das eine; mit einem Gleitschirm von einem Berggipfel zu springen, dagegen etwas ganz anderes. Manche Risiken lohnen sich; andere wiederum nicht. Doch für welche gilt was? Darum geht es in diesem Buch.
»Los geht’s!«, ruft Lt. Grossman. Zwanzig Stühle werden auf einmal zurückgeschoben. Stiefel stampfen, Gewehre rasseln. Ich greife nach meinem Helm, halte kurz inne und frage mich nicht zum ersten Mal an diesem Morgen: »Wie zum Teufel bin ich hier nur hineingeraten?«
Wo bin ich?
Wir leben in einer einzigartigen Epoche der Menschheitsgeschichte, einer Epoche, die von Wandel, Veränderungen und Umbrüchen gekennzeichnet ist, wie sie vielleicht nie wieder auftreten werden. Aufgrund der schnellen und umfassenden Einführung neuer Technologien, die sich auf unsere Art und Weise zu arbeiten, zu kommunizieren, einzukaufen, Kontakte zu knüpfen sowie auf nahezu alle anderen Tätigkeiten auswirkt, kommt es zu einer erdbebenartigen Umwälzung im Leben und im Denken. Die heutige Zeit ist der Aufklärung (1650–1800) sehr ähnlich, als es ebenfalls zu gewaltigen Veränderungen in Bewusstsein, Wissen und Technik kam, begleitet von einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel.
Die Aufklärung hat uns neue Freiheiten gebracht. Und die neuen Freiheiten, die uns das Internet ermöglicht, sind für Milliarden von Menschen berauschend, aufregend und verführerisch zugleich. Das Konzept der absoluten Freiheit ist für die Ideologie des Internets von zentraler Bedeutung. Aber kann Freiheit die Menschen womöglich verderben? Und kann absolute Freiheit sie ganz und gar verderben? Mehr Freiheiten für das Individuum bedeuten weniger Kontrolle für die Gesellschaft.
Manche Veränderungen waren verführerisch und vollzogen sich schrittweise – und sorgten dafür, dass sich psychologische Normen an neue Orte schlichen. Zunächst mag es Ihnen kaum aufgefallen sein, bis Sie eines Tages auf einmal beobachteten, wie jemand einem Baby zum Spielen ein teures Smartphone in den Kinderwagen reichte oder wie ein Kleinkind mit pummeligen Fingern meisterhaft über den Touchscreen eines Mobiltelefons strich. Vielleicht besuchten Sie auch ein Einkaufszentrum und wurden dort Zeuge, wie eine Gruppe Kinder die Köpfe zusammensteckte und sich schweigend ihren Mobilgeräten widmete – statt ihrem Gegenüber. So nah und doch so fern!
Vielleicht trifft es Sie auch in den eigenen vier Wänden, beispielsweise in dem stetig unangenehmer werdenden Eindruck von Distanz in der Beziehung oder der Ehe, weil der Partner oder die Partnerin Stunden am Computer verbringt, während er oder sie im Internet mit neuen Freunden überall auf der Welt chattet oder flirtet, bis zum Erbrechen Serien auf Netflix schaut, sich dem Onlineshopping hingibt oder von den Unmengen an pornographischen Websites in den Bann gezogen wird, die mittlerweile online so leicht zugänglich sind.
Das Internet ist omnipräsent und liefert ständig reichhaltige, stimulierende Inhalte – vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Zwischen 2000 und 2015 hat sich der Anteil der Menschen mit Internetzugang nahezu versiebenfacht: von 6,5 Prozent auf 43 Prozent der weltweiten Bevölkerung.[1] Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wurde im Januar 2016 verkündet, dass mittlerweile mehr als 3,2 Milliarden Menschen online seien. In weniger als zehn Jahren hat sich die Zahl der Mobiltelefonnutzer von kaum mehr als 2 Milliarden im Jahr 2005 auf mehr als 7 Milliarden im Jahr 2015 erhöht.[2] Die Summe der Stunden, die die Leute mit ihren Mobiltelefonen verbringen, steigt jährlich drastisch an und wuchs in einem Zeitraum von gerade einmal zwei Jahren durchschnittlich um 65 Prozent. Im Zuge derselben Studie fand man heraus, dass Mobiltelefonnutzer mehr als 1500 Mal in der Woche auf ihr Telefon zugreifen.[3] Es gibt mehrere Apps zur Überwachung der Aufrufe, falls Sie ein wenig Hilfe bei der Kontrolle der eigenen Nutzungsgewohnheiten brauchen.[4]
Die Anzahl der Minuten, die man tagtäglich am Smartphone verbringt, um durch die sozialen Medien zu scrollen, ist alles andere als unwichtig. Für eine Forscherin wie mich, die das menschliche Verhalten im Internet anhand von digitalem Staub und digitalen Fußabdrücken auf minütlicher Basis studiert, weisen diese online verbrachten Zeiteinheiten darauf hin, wie die Betreffenden leben: was sie tun und was nicht. Das ist die sogenannte Lebenswandelanalyse, die sich darauf bezieht, was Menschen im Internet unternehmen. Zu Hause verbringt man dieselbe Zeit eben nicht mit anderen Dingen – beispielsweise damit, einem Kind ein Buch vorzulesen, mit einem Kleinkind auf dem Fußboden zu spielen oder sich mit der Familie am Esstisch oder dem eigenen Partner vor dem Zubettgehen zu unterhalten. Wer sein Telefon checkt oder im Internet surft, hält sich tatsächlich an einem anderen Ort auf. Man begibt sich in ein anderes Umfeld. Man ist im Sinne der realen Welt nicht mehr anwesend.
Lassen Sie mich eine Frage in den Raum stellen, die von Technologen heiß diskutiert wird: Ist der Cyberspace tatsächlich ein Ort?
Meine Antwort lautet ganz unmissverständlich: Ja! Der Cyberspace ist ein eigener Raum, den man aus einer bekannten Umgebung heraus betritt, etwa aus der Gemütlichkeit der eigenen vier Wände. Sobald man sich ins Internet begibt, bewegt man sich hinsichtlich des eigenen Bewusstseins und der eigenen Wahrnehmung, der eigenen Gefühle, der eigenen Reaktionen und des eigenen Verhaltens – alles Dinge, die sich je nach Alter, körperlicher und geistiger Entwicklung sowie Persönlichkeitsstruktur unterscheiden – an einen anderen Ort.
Instinktiv wissen wir, dass dies der Fall ist. Wir alle kennen das Gefühl, sich im Internet zu »verlieren«, um in der nächsten Sekunde wie aus einem Traum zu erwachen und zu erkennen, dass wir das Abendessen auf dem Herd vergessen haben, zu spät zu einem wichtigen Termin kommen werden oder versäumt haben, den Rasensprenger auszuschalten. Das liegt daran, dass die meisten Menschen im realen Leben sehr genau wissen, wie sie den Überblick über den Lauf der Zeit behalten. Online besteht jedoch ein Zeitverzerrungseffekt. (Versuchen Sie einmal Folgendes, wenn Sie das nächste Mal im Internet sind: Verbergen Sie Ihre Uhr und versuchen Sie immer wieder abzuschätzen, wie viel Zeit bereits vergangen ist, um zu überprüfen, ob und wie der Cyberspace Ihr Zeitgefühl beeinträchtigt.) So unterschiedlich und wandelbar die Menschen auch sind, wissen Psychologen aus einer Vielzahl von Studien, dass sich das Verhalten einer Person ändert und anpasst, sobald er oder sie sich an einem unbekannten Ort aufhält, sei es in einem neuen Zuhause, einer neuen Schule, einer neuen Stadt oder einem neuen Land. Das eigene Umfeld wirkt sich erheblich auf das eigene Verhalten aus, sagt uns die Umweltpsychologie, ein interdisziplinäres Fach, das sich mit der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt befasst. Nach den Erkenntnissen der Entwicklungstheorie entstehen das Bewusstsein und die Wahrnehmung des eigenen Ichs durch den langsamen Prozess der Anpassung an das eigene Umfeld. Und wie jeder weiß, der bereits einmal umgezogen oder verreist ist: Es dauert, bis man sich an einen neuen Ort gewöhnt. Es braucht ein Weilchen, bis man an Bord eines Schiffes nicht mehr wankt, wie Seemänner sagen, die die schaukelnden Planken dem Festland vorziehen.
Viele Menschen leugnen jedoch, dass sie sich im Internet an einem neuen Ort befinden, und verschließen sich so den Tatsachen – sie hängen dem Irrglauben an, alles wäre beim Alten. Schließlich halten sie sich in den eigenen vier Wänden auf, umgeben von vertrauten Dingen, der Körper auf Kissen gewohnter Stühle und Sofas ruhend. In ihren Köpfen haben sich diese Menschen nirgendwohin »bewegt«. Doch die Bedingungen und Eigenschaften der Online-Umgebung unterscheiden sich von denen der realen Welt. Aus diesem Grund lassen uns unsere Instinkte, die wir im realen Leben ausgebildet haben, im Cyberspace so gerne im Stich.
Naivität und schlechtes Urteilsvermögen im Angesicht dieses Umfelds können tagtäglich beobachtet werden, etwa wenn wir eine Zeitung in die Hand nehmen und dort lesen, dass ein Politiker Bilder seiner Genitalien an entsetzte Unbeteiligte weitergeleitet hat oder dass eine bekannte Persönlichkeit durchgeknallte Schimpftiraden auf Twitter hinterlässt oder dass abermals ein Sextape zum Internethit wird. Althergebrachte Autoritäten und Systeme zur Unterstützung scheint es im Internet nicht zu geben – oder sie sind ebenso orientierungslos wie wir selbst. Während die Geräte und allerlei Zubehör sich ebenso ändern wie die Technik an sich, wandelt sich auch das Umfeld des Cyberspace, was wiederum das menschliche Verhalten prägt. Das führt zu Umbrüchen auf individueller, industrieller, finanzieller, staatlicher und gesamtgesellschaftlicher Ebene. Je mehr Veränderungen stattfinden, desto mehr neue Situationen entstehen, die nur noch mehr Desorientierung hervorrufen.
Psychologen wissen, dass manchen Menschen der Umgang mit gesellschaftlichen Veränderungen leichter fällt als anderen. Den meisten jedoch bereitet allein schon der Versuch, mit der Geschwindigkeit des aktuellen technologischen Wandels Schritt zu halten, gewaltige Kopfschmerzen. Während der Großteil sich noch darum bemüht, in dieser neuen Umgebung mit all ihren unbekannten Bereichen und Verhaltensweisen Fuß zu fassen, stehen viele Umbrüche erst noch bevor. Das wiederum führt unweigerlich zu noch mehr unbekannten Situationen und noch mehr Verwirrung.
Eine sichere Möglichkeit, mit der ständigen Veränderung zurechtzukommen, lautet, mehr Wissen darüber anzusammeln, wie die Umgebung im Cyberspace sich auf uns alle auswirkt – wie Menschen, Sie und mich eingeschlossen, sich dort benehmen. Wissen ist Macht, das ist überaus beruhigend. Wer mit den Grundlagen der Cyber-Psychologie vertraut ist, wird die Fragen beantworten können, die mir Tag für Tag gestellt werden – und jede Nacht, würde ich nie zu Bett gehen, sondern rund um die Uhr E-Mails lesen.
Diese Fragen lauten zum Beispiel:
Ab welchem Alter darf mein Baby auf einen Digitalbildschirm schauen?
Darf ein Kleinkind mit einem iPad spielen?
Gibt es eine Verbindung zwischen Online Gaming und ADHS bei heranwachsenden Jungen?
Sollte ich einem Teenager gestatten, sich stundenlang mit seinem Smartphone im Badezimmer einzuschließen?
Tragen Digitaltechniken zur wachsenden sozialen Isolation bei?
Warum werden Menschen im Internet zum Troll?
Sollte ich mich vor dem »Darknet« fürchten?
Der Cyberspace ist mehr als nur ein Transaktionsmedium, mit dem man so etwas Passives tun kann wie Fernsehen schauen oder mit jemandem telefonieren. Als außerordentlich interaktives, unheimlich fesselndes und hochgradig umfassendes Umfeld ist er für den Menschen auf einzigartige Weise unwiderstehlich – vielleicht zu unwiderstehlich. Was geschieht mit Ihrem Kleinkind, das in Rage gerät, sobald Sie Ihr Tablet von ihm zurückhaben möchten, oder mit Ihrem Teenager, der sofort loszetert, kaum dass das W-LAN nicht mehr so gut funktioniert? Was passiert mit Ihrer Tante und Ihrem Onkel, die sich in einem ständigen Zustand des tech rage befinden (»Der Computer ist kaputt!«), und was ist mit der Tatsache, dass Ihre Großmutter auf Facebook eine Menge neuer »Internet-Brieffreunde« aus Nigeria kennengelernt hat?
Der Cyberspace ist voller Ortsnamen – von sozialen Netzwerken, Foren und Websites –, und sobald wir uns dort aufhalten, schließen wir uns einer größeren Gruppe an als der, zu der wir vorher gehört haben. Auch das macht diese Umgebung so speziell. Mittlerweile sind Milliarden von Menschen online. Das löst eine Menge neuer Situationen und neuer Orientierungslosigkeit aus. Angesichts einer solchen Vielzahl neuer Freunde und Kontakte ist es von größter Wichtigkeit, mehr über das menschliche Verhalten zu erfahren – und darüber, wie es sich im Internet verändert. Unsere Instinkte haben sich ausgebildet, um die persönliche Interaktion zu bewältigen, doch sobald wir uns in den Cyberspace bewegen, lassen uns diese Instinkte im Stich. Wir sind beeinträchtigt – als ob man uns die Schlüssel zu einem Auto in die Hand gedrückt hätte, ohne uns zu verraten, wie man eigentlich fährt. Wir brauchen neue Werkzeuge und neues Wissen. Denn wer mehr Zeit im Internet verbringt, trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine größere Vielfalt menschlicher Verhaltensweisen als je zuvor: von verwundbaren bis hin zu kriminellen; von fröhlichen und hilfsbereiten bis hin zu düsteren und mörderischen.
Da ich mich bei der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden vor allem mit der Cyber-Forensik beschäftige, werde ich gleichermaßen Zeuge der besten und der schlechtesten Seiten des menschlichen Online-Verhaltens. Ich sage gerne, dass die Digitaltechnologien entwickelt wurden, um für die sogenannte Durchschnittsbevölkerung einnehmend, fesselnd und verführerisch zugleich zu sein. Hat sich jedoch irgendwer einmal darüber Gedanken gemacht, wie sich diese Technologien auf abnorme, abweichende, kriminelle oder verwundbare Bevölkerungsteile auswirken?
Diese Risiken zu bedenken ist ebenso Teil meiner Arbeit.
Wie dieses Buch zu lesen ist
Wir alle kennen die unfassbaren Vorteile des Internets. Ich könnte den ganzen Tag darüber sprechen: über seine Bequemlichkeit, seine hochgradige Vernetzung, seine Erschwinglichkeit, seine Kreativität, seine Nächstenliebe, sein aufklärerisches und kommerzielles Potential, seinen Unternehmergeist und seinen kulturellen Austausch. Ich bin mir sicher, auch Sie sind sich dieser Dinge bewusst. Eine ganze Armee aus Marketingexperten tut den lieben langen Tag nichts anderes, als sich im Auftrag der größten Technologieunternehmen und -konzerne neue, unwiderstehliche Produkte auszudenken und neue, bessere Möglichkeiten zu entwickeln, um uns diese zu verkaufen. Diese Unternehmen sind ausgesprochen gut darin, uns von der Notwendigkeit solcher Geräte, Programme, Apps und Touchscreens zu überzeugen.
Mein Job besteht nun nicht darin, die Digitaltechnologien zu verteufeln. Gute Forschung ist stets um Ausgeglichenheit bemüht. Falls ich den Anschein erwecken sollte, ich würde mich allzu sehr auf die negativen Aspekte der Technik konzentrieren, geschieht dies einzig und allein, um die Debatte im Angesicht von utopischem Idealismus und Unternehmergeist wieder ins Lot zu bringen. Es ist einfach nur mein Job, die bestmöglichen Erkenntnisse zu liefern, aufbauend auf dem, was wir über den Menschen wissen und darüber, wie seine kognitiven, verhaltenspsychologischen, physiologischen, gesellschaftlichen, entwicklungsbezogenen, affektiven und motivierenden Fähigkeiten durch das Design dieser Produkte genutzt, gefährdet oder verändert werden.
Technik ist an und für sich nicht gut oder schlecht. Sie ist neutral und dient nur als Instrument menschlichen Verhaltens – was bedeutet, dass sie von der Menschheit gut oder schlecht eingesetzt werden kann. Dieses Verständnis ist für meine Arbeit von fundamentaler Bedeutung. Es unterscheidet sich nicht davon, wie wir das Auto und das Fahren unter Alkoholeinfluss betrachten: Keine Technologie ist vor Missbrauch gefeit.
Eine meiner frühesten Inspirationen war J.C.R. Licklider, ein amerikanischer Psychologe und Informatiker, der im Jahr 1960 – vor der Entstehung des Internets – unter dem Titel »Man-Computer-Symbiosis« eine bahnbrechende Forschungsarbeit vorlegte, in der er die Möglichkeit der symbiotischen Verbindung zwischen Mensch und Maschine vorwegnahm. Insofern könnte man Licklider tatsächlich den »ersten Cyber-Psychologen« nennen. Ich bewundere »Lick« für seine Fähigkeit, mit großer Genauigkeit und Intelligenz in die Zukunft zu schauen. Auch die Arbeit von Patricia Wallace, aus deren Feder The Psychology of the Internet stammt – eine einflussreiche wissenschaftliche Studie, die im Erscheinungsjahr 1999 ein durchschlagender Publikumserfolg war –, zog mich schon früh in den Bann. Kurz darauf stieß ich auf John Suler, einen klinischen Psychologen und Pionier seines Fachs sowie anerkannten »Vater der Cyber-Psychologie«, der seit den späten 1990er Jahren in diesem Bereich tätig ist und The Psychology of the Cyberspace geschrieben hat, das 2004 als Digitalausgabe erschien. John hat in seinem Werk die Essenz des Internets wirklich hervorragend eingefangen, er hat die potentiellen Vor- und Nachteile des Cyberspace untersucht und gleichzeitig beschrieben, wie die Menschen sich im Internet oft verhalten.
Als ich mich meinen eigenen Studien und Forschungen zu widmen begann, stellte ich online Kontakt zu John her. Das führte zu einer ganzen Reihe von E-Mails, die wiederum ein echtes Treffen an der Rider University in New Jersey nach sich zogen, Johns akademischer Heimat. Es heißt, ein Treffen mit seinem Idol sei nie einfach. In meinem Fall wünschte ich nur, ich hätte die passenden Schuhe angezogen.
Es war ein brütend heißer Tag, und John kam gerade aus einer Vorlesung, als ich auf dem Campus eintraf. Er wollte sich ein wenig die Beine vertreten. »Lassen Sie uns ein Stück gehen und uns dabei unterhalten«, sagte er. Dann schritt er wie ein sokratischer Philosoph der Akropolis in Lichtgeschwindigkeit über den Hof. John ist ein hochgewachsener Mann, und wenn er einen Schritt geht, muss ich vier eilig laufen. In Vorbereitung auf unser Treffen hatte ich sorgfältigst verschiedene cyber-psychologische Konzepte durchdacht, die wir hätten diskutieren können; ich hatte jedoch nicht damit gerechnet, dies im Freien in der gleißenden Sonne zu tun, während ich Absätze trug, die selbst für flaches Terrain ungeeignet gewesen wären, ganz zu schweigen von diesem Gewaltmarsch, der jeden Soldaten zum Weinen gebracht hätte. In vielerlei Hinsicht versuchen wir anderen immer noch, mit John Schritt zu halten.
Im Laufe der letzten zehn Jahre ist er zu einem guten Freund und Kollegen geworden. Einige seiner bahnbrechenden Theorien und Beobachtungen sind in dieses Buch eingeflossen. In den letzten Jahren hatte ich außerdem das große Vergnügen, eine wachsende Gruppe gleichgesinnter Forscher weltweit kennenlernen zu dürfen, die ihre Gedanken mit mir teilten und bei Studien mit mir zusammenarbeiteten. Ich freue mich, in den folgenden Kapiteln ein beeindruckendes Œuvre präsentieren zu dürfen. In etwa dreißig expertengeprüften Fachzeitschriften erscheinen mittlerweile jährlich um die tausend Artikel, die sich mit den für die Cyber-Psychologie relevanten Themen beschäftigen, einem Feld, in dem in den nächsten Jahrzehnten aufgrund des umfassenden und tiefgreifenden Einflusses der Technologie auf die Menschen ein exponentielles Wachstum zu erwarten ist.
Wie andere wissenschaftliche Unterfangen lebt meine Disziplin von Fachjargon und Sorgfalt. Zu einem gewissen Grad hat die Verhaltenspsychologie vor den technischen Entwicklungen bislang die Augen verschlossen. In den 1990er Jahren nannten Kollegen von mir das Internet ein »vorübergehendes Phänomen«. Mitte der 2000er erklärten sie dann, die Menschen würden soziale Netzwerke im Cyberspace nie als Kommunikationsplattform nutzen. Nun, fünfzehn Jahre und Milliarden Menschen später … hat die Aufholjagd begonnen.
Wir Akademiker sind sehr gut darin, komplizierte Mittel und Wege zu finden, nicht wirklich zu sagen, was wir meinen. Unsere Forschungsarbeiten sind gespickt mit absichernden Begriffen wie »möglich«, »plausibel« oder »fraglich«, darauf ausgerichtet, unsere Sätze harmloser klingen zu lassen. Manche Wissenschaftler bedienen sich solcher sprachlichen Taschenspielertricks, wie ich sie nenne, um ihre Karriere zu schützen, nur für den Fall, dass sich irgendwann eine Theorie als falsch herausstellen sollte. In meinen Augen aber bleibt echter wissenschaftlicher Durchbruch aus, wenn man aus lauter Vorsicht um den heißen Brei herumredet. An der Internetfront brauchen wir Forscher, die nicht davor zurückschrecken, bis zum Letzten zu kämpfen und ihren sachkundigen Instinkten zu trauen. Natürlich benötigen wir wissenschaftlich fundierte Studien, doch wie lang können wir warten?
Babys werden geboren, Kinder wachsen auf, und Leben ändern sich. Die Gesellschaft befindet sich im Wandel. Darüber müssen wir jetzt reden.
In der Hoffnung, ein breites Publikum anzusprechen, habe ich den Versuch unternommen, dieses Buch so praktisch nachvollziehbar und anschaulich wie möglich zu gestalten. Ich habe mich um einen verständlichen Zugang zur Wissenschaft bemüht und Wert darauf gelegt, Ihnen allzu viele Statistiken und Studien zu ersparen. Wer mein Interesse teilt und mehr erfahren möchte, dem seien die ausführlichen Kapitelanmerkungen am Ende dieses Buches ans Herz gelegt. Auch diese habe ich mit Blick auf ein breites Publikum verfasst.
Um mit den ständigen technologischen Veränderungen und dem sich verändernden menschlichen Verhalten Schritt zu halten, bedarf es in meiner Arbeit der Kreativität, der Flexibilität und der Fähigkeit, mit einer Menge theoretischer Konzepte gleichzeitig zu jonglieren. Deshalb trifft es sich wohl gut, dass ich kein linear denkender Mensch bin. Mein Gehirn kommt mir eher vor wie ein organisiertes Chaos – etwas, das sich für mich beim schnellen Erkennen von Mustern und intuitiven Gedankensprüngen als ungemein nützlich erwiesen hat. Meine Herangehensweise ist zwangsläufig interdisziplinär und schöpft aus der Psychologie, Soziologie, Anthropologie, Kriminologie, der Netzwerkforschung und der Informatik. Zuweilen überschreite ich auch noch andere akademische Grenzen, und die verschiedenen Disziplinen, derer ich mich bediene, empfinde ich als überaus hilfreich bei der Beleuchtung neuer Probleme und deren Lösung.
Wenn keine Langzeitstudien vorhanden sind, halte ich mich an die Logik – eine Mischung aus gesundem Menschenverstand und rationalem Denken –, um plausible Argumentationsketten zu schaffen, die auf dem vorhandenen Wissen und den augenblicklich zu beobachtenden Phänomenen ebenso aufbauen wie auf aktuellen Berichten – und hoffentlich zu einer sinnvollen Debatte über das menschliche Verhalten im Internet beitragen, die in meinen Augen dringend notwendig ist. Ebenso zehre ich von jenen ganz besonderen, einzigartig menschlichen Eigenschaften: Einsicht und Intuition. Wie der große Robotiker Masahiro Mori bereits sagte: »Ignorieren Sie nicht die kleinen Dinge!« In der Forschung sollten wir uns nicht davor scheuen, auf uns selbst zu vertrauen und den kleinen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken. Mori selbst schreckte nicht davor zurück, seine Gedanken und Gefühle mit anderen zu teilen: über Menschen und Maschinen, über künstliche Intelligenz und über die Notwendigkeit, Gefallen an unseren Intuitionen zu finden, ja uns geradezu für sie zu begeistern. Seine Herangehensweise inspiriert mich. Wir Wissenschaftler müssen überdenken, wie wir mit den problematischen Verhaltensweisen umgehen, die im Laufschritt der Internettechnologien entstehen. Was wir brauchen, sind akademische Ersthelfer.
In vielen Fällen habe ich mich auf den investigativen Journalismus von Publikationen wie Wired, The Washington Post, The New York Times und andere verlässliche Quellen sowie auf Berichte der alten Medien gestützt, um Erkenntnisse von der Front anhand anekdotischen Beweismaterials zu sammeln, Verhaltensmuster zu erkennen und daraus schlau zu werden. Auf einem Gebiet, das sich so rasant verändert wie das Internet und die damit verbundenen Techniken und Technologien, brauchen wir guten Journalismus mehr denn je.
In den neun folgenden Kapiteln habe ich das Material nach Themenfeldern wie auch nach meinen eigenen Arbeitsschwerpunkten geordnet. Der technologische Einfluss auf das menschliche Verhalten beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod, weshalb ich mich in den jeweiligen Kapiteln mit allen Altersgruppen beschäftige: von Babys und Kleinkindern über Teenager bis hin zu Erwachsenen. In den Kapiteln über Abhängigkeit und zwanghaftes Verhalten beleuchte ich, wie einige Arten problematischen Gebarens stark vom Internetumfeld geprägt werden. Im Kapitel über das Phänomen der Cyberchondrie argumentiere ich wiederum, dass die weite Verbreitung medizinischer Online-Recherche zu einem Anstieg unnötiger Arztbesuche und risikoreicher OPs geführt hat.
Die beängstigenden Enthüllungen in diesem Buch und das Kapitel zum Darknet habe ich nicht bloß für den Nervenkitzel aufgenommen. Die dunklen, versteckten Ecken des Internets, in denen sich Kriminelle mit gemeinsamen Interessen versammeln und der Schwarzmarkt floriert, sollten jedem ein Begriff sein, der sich im Cyberspace bewegt. Warum? Weil mehr und mehr junge Menschen, angetrieben von jugendlichem Leichtsinn und Neugier, dazu verlockt werden, diese Orte aufzusuchen. Aus irgendeinem Grund sind sie zu der falschen Einschätzung gelangt, im Darknet wären sie in Sicherheit und könnten einfach Spaß haben. Dem ist aber nicht so.
Mein spezielles Interesse gilt dem Einfluss der Online-Technologien auf die Kindesentwicklung. Das Internet hat unserem Nachwuchs den Zugang zur Welt ermöglicht; doch ebenso ermöglicht es der Welt den Zugang zu unserem Nachwuchs. Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen sich darüber wirklich im Klaren sind. In der Fachzeitschrift Pediatrics erschien unter dem Titel »The Good, The Bad, and the Unknown« ein hervorragender Artikel darüber, wie die Digitaltechnologien die Entfaltung unserer Sprösslinge beeinflussen.[1] Das Letztgenannte – »das Unbekannte« – bereitet mir dabei wirklich Sorgen. Wie der klinische Psychologe Michael Seto bereits sagte: »Wir erleben das größte unkontrollierte soziale Experiment aller Zeiten – eine ganze Generation Jugendlicher wird online extremen Inhalten ausgesetzt.«
Was passiert mit dieser Generation im Lauf der Zeit? Wie wirkt es sich auf diese jungen Leute aus, dass sie mit den rauen und finsteren Seiten des Internets in Berührung kommen?
CSI: Cyber
Die Razzia in South Central Los Angeles war genauso beängstigend, wie man es sich vorstellt. Ich muss zugeben, dass ich – kaum war unser Trupp vor dem Zielgebäude vorgefahren – mich an Lt. Grossman wandte und fragte, ob ich nicht im gepanzerten Polizeiwagen bleiben dürfe, statt mit der Einheit vorzurücken.
»Nein, Mary, das ist zu unsicher«, antwortete sie.
Das Panzerfahrzeug war zu unsicher? Wow, dachte ich. Wo bin ich hier nur hineingeraten? Die nächsten zwanzig Minuten zogen wie hinter einem Schleier an mir vorbei. Es wurde viel gebrüllt, Türen wurden geschlagen, Befehle mit gezückter Waffe gerufen, Handschellen angelegt und Kriminelle festgenommen. Für mich als Beobachterin war das erschreckend und faszinierend zugleich. Ich hielt mich im Hintergrund, nahe der Wand des Wohnzimmers, wo der Verdächtige gefasst wurde. Ich ertappte mich dabei, wie ich die Wand abklopfte, in der Hoffnung, sie bestünde aus Beton, damit sie mich vor Querschlägern bewahrte. Glücklicherweise darf ich vermelden, dass keine einzige Kugel abgefeuert wurde. Die Razzia war ein voller Erfolg: eine routinierte und professionelle Operation, wie sie von besagter LAPD-Einheit mehrmals die Woche durchgeführt wird. Der Hauptverdächtige wurde auf der Stelle in ein mobiles computerforensisches LAPD-Labor verfrachtet, das in einem Kleinlaster untergebracht war und »das Biest« genannt wurde. Dort legte er ein Geständnis ab.
Sobald alles vorüber war, entspannten sich die Polizisten und genossen ein herzhaftes Frühstück aus Burritos, während ich schweigend daneben saß und in einem Zustand zwischen Schock und Erleichterung Wasser aus einer Flasche trank, meinen Schutzanzug immer noch am Leib. Seitdem wurde ich noch mehrfach gebeten, Lt. Grossman und ihr Team auf Einsätze zu begleiten, doch jedes Mal versicherte ich, dass ich mehr als genug Erfahrungen an der Front gesammelt habe. Ich habe für die alltägliche Arbeit der Ersthelfer in den Strafverfolgungsbehörden den allergrößten Respekt, und meine Teilhabe als Beobachterin an einem Unterfangen wie diesem vergrößerte diesen Respekt nur noch. Die Wahrheit ist: Ich glaube nicht, dass ich für den aktiven Frontdienst in der realen Welt gemacht bin – aber ich freue mich, im Grenzland zur Cyberwelt meinen Teil dazu beizutragen.
Außerdem ist meine eigentliche Arbeit bereits Herausforderung genug: Risiken dort aufzuspüren, wo wir uns vollkommen sicher fühlen. Jahr für Jahr erscheinen in meinem Fach neue Studien, und es werden bislang unbekannte Entdeckungen gemacht. Während meiner Recherche war es mir vergönnt, weltweit führende Persönlichkeiten aus Politik, Polizei und Justiz kennenzulernen und mich mit ihnen zu unterhalten. Als Wissenschaftlerin habe ich mit Europol, Interpol, dem FBI und dem Weißen Haus zusammengearbeitet. Im Jahr 2012 gründete ich mit der Unterstützung eines hervorragenden Mentors und Kollegen, Professor Ciaran O’Boyle, das Cyberpsychology Research Centre in Dublin, das sich mittlerweile zu einem internationalen Netzwerk zur Finanzierung und Unterstützung innovativer Forschungsprojekte entwickelt hat. In letzter Zeit habe ich zudem eine geraume Weile in Hollywood verbracht, wo ich an der Fernsehserie CSI: Cyber mitgewirkt habe, die auf meiner Arbeit basiert. In dieser Serie spielt Patricia Arquette die Avery Ryan, eine FBI-Spezialagentin für Cyber-Kriminalität, deren Aufgabe darin besteht, schwere Verbrechen zu klären, »die im Kopf beginnen, online ausgelebt werden und sich in der realen Welt abspielen«. Das beschreibt meine Arbeit perfekt.
Das Menschliche einbeziehen
An früherer Stelle in dieser Einleitung habe ich meine Ansicht erläutert, dass sich das Internet zwar von der sogenannten realen Welt unterscheidet, ich damit aber keineswegs meine, dass alles, was im Cyberspace geschieht, nicht real sei. Hinsichtlich des menschlichen Verhaltens ähneln die Ereignisse im Internet ein wenig der Ausbreitung von Grippeviren oder Ebola: Eine spezifische Verhaltensweise macht eine Mutation im Cyberspace durch, wo ihr eine große Menge Menschen begegnen. Es stellt sich ein Bumerangeffekt ein, und das neue Verhalten wird im realen Leben bald zur Norm – ein Phänomen, das ich als »Cyber-Migration« bezeichne. Das bedeutet, dass die Auswirkungen dessen, was wir in der Online-Umgebung erfahren, überaus umfassend sind und uns alle betreffen, unabhängig davon, wo wir leben oder womit wir unsere Zeit verbringen.
Als ich mich noch in den ersten Jahren meines Psychologiestudiums befand, sagten wir gerne, das Problematische an unserer Disziplin sei vor allem die Tatsache, dass sie sich viel zu lange »von weißen Mäusen und Umfragen unter Collegestudenten ernährt« habe. Ähnliches gilt für die Digitaltechnologien: Viel zu lange haben sie sich von Daten, Geräten und Technikexperten ernährt. Es wird Zeit, dass wir uns den breiteren soziotechnologischen Folgen widmen. Wie haben Entwicklungen dieser Art das menschliche Verhalten und die Gesellschaft beeinflusst? Es wird Zeit, dass wir uns jener seltsamen Spezies Homo sapiens zuwenden, deren Finger zu groß für die Tastatur der Mobiltelefone sind, deren Körper zu plump für tragbare Geräte und deren Gedächtnis zu schwach ist, um sich mehrere zehnstellige Passwörter zu merken. Mit anderen Worten: Es wird Zeit, dass wir das Menschliche einbeziehen. Zuweilen hat unsere Technikbegeisterung uns nämlich den Blick auf das große Ganze versperrt.
Inmitten der menschlichen Migration in den Cyberspace ist die Untersuchung dessen, was hinter uns liegt, wo wir uns jetzt befinden und was noch kommt, von allergrößter Bedeutung. Gleich Reisenden, die sich auf eine abenteuerliche Fahrt begeben, müssen wir sorgfältig darauf achten, nicht zu schnell aus der Tür zu treten, ohne die notwendigen Werkzeuge mit uns zu führen. Es gibt einige Dinge – Aspekte des menschlichen Lebens –, die uns jahrhundertelang gute Dienste geleistet haben und entscheidend für unser Überleben sind. Wir können es uns nicht leisten, diese Dinge unterwegs zu verlieren. Hier kann die Cyber-Psychologie überaus nützlich sein, weil sie an der Schnittstelle von Mensch und Maschine wichtige Erkenntnisse liefert. Ich hoffe, dass mein Buch ebendies zu leisten vermag.
Kapitel 1Die Normalisierung eines Fetischs
Das menschliche Verhalten wurde immer schon von Techniken und Technologien geformt und geprägt; doch soweit ich das beurteilen kann, hat uns seit dem Aufkommen des Internets nichts mehr beeinflusst als das World Wide Web. Man muss kein Experte für Online-Verhalten sein, um zu erkennen, dass irgendetwas am Cyberspace die Menschen zu größerer Abenteuerlust verleitet.
Sie handeln in der Illusion, das Online-Umfeld wäre sicherer als das reale Leben und der Kontakt zu anderen Menschen im Internet mit weniger Risiken verbunden als der von Angesicht zu Angesicht. Aber es ist nun einmal die reale Welt, in der wir unsere Instinkte ausbilden und verfeinern, und in Ermangelung von Reizen aus der realen Welt und anderen subtilen Hinweisen wie Mimik, Gestik oder Räumlichkeit sind wir nicht dazu in der Lage, komplett durchdachte Entscheidungen zu treffen. Und weil wir uns nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, wenn wir online mit anderen kommunizieren und interagieren, können wir anonym handeln – oder, was noch viel wichtiger ist, uns so fühlen. Wie in der Einleitung dieses Buches bereits angesprochen, kommen wir uns im Cyberspace häufig frei und verwegen vor. Die Leute verlieren ihre Hemmungen und benehmen sich in gewisser Weise, als wären sie »betrunken«, weil bei manchen das Online-Umfeld zur Beeinträchtigung des Urteilsvermögens und zur Senkung der Impulskontrolle führt, ungefähr so, wie es auch der Alkohol tut. Zusätzlich erleichtert wird diese Enthemmung noch durch die spezifischen Eigenschaften des Cyberspace: das vermeintliche Fehlen jedweder Autorität, die online herrschende Anonymität sowie der Eindruck von Distanz und körperlicher Ferne.
Das erkennt man an den sich wandelnden Balzritualen eigenhändig kuratierter Selfies, Sexting-Nachrichten und Flirts in den sozialen Netzwerken. Im Internet fällt es uns leichter, mutig und direkt zu sein. Mancher beweist im realen Leben Verstand, Vernunft und Zurückhaltung und gibt beim Eintritt in den Cyberspace dennoch all dies an der Garderobe ab. Weshalb?
Im cyber-psychologischen Jargon lautet die Erklärung für dieses wagemutige Gebaren »Online-Enthemmungseffekt«.[1] Dieser von John Suler eingeführte Begriff wird von den Experten des Fachgebiets inzwischen hinreichend akzeptiert und vielfach angeführt. Außerdem spielt ein weiterer wichtiger Faktor eine große Rolle, den ich untersucht und in unterschiedlichen Texten behandelt habe: die Online-Eskalation.[2] Mit diesem Konstrukt bzw. Konzept versuche ich zu beschreiben, wie problematisches Verhalten sich im Internet erweitert oder multipliziert, ein Prozess, den jeder von uns schon mal beobachtet hat, sei es in äußerst negativer, wütender E-Mail-Kommunikation, aggressiven Texten oder beleidigenden Kommentaren in Diskussionsforen, die einzig und allein provozieren sollen.
Das bedeutet nun nicht, dass die Digitaltechnologien schlecht für uns wären – oder gar grundsätzlich negativ. Problematisch sind sie nur dann, wenn wir uns ihrer Auswirkungen nicht bewusst sind. Die meisten Menschen erkennen nicht, welchen Einfluss der Cyberspace auf sie hat. Sie meinen, im Internet gehe es ebenso zu wie überall sonst. Menschen, die zu impulsiven Handlungen oder vorschnellen Reaktionen tendieren, sind besonders gefährdet. Die Online-Eskalation und ihre Folgen sorgen jedoch dafür, dass sich jeder schneller neue Verhaltensweisen und Normen aneignen kann.
In einem späteren Kapitel werde ich mich der Cyber-Romantik zuwenden und die neuen Arten und Weisen beschreiben, wie Menschen sich im Internet kennenlernen, Freundschaften schließen, Gemeinschaften bilden und sinnstiftende persönliche Beziehungen knüpfen. In diesem Kapitel werde ich mich jedoch mit der Frage beschäftigen, wie sich die Internettechnologien auf einen kleineren Bevölkerungsteil auswirken, nämlich auf Menschen mit Fetischen oder Paraphilien – was als atypisches Sexualverhalten gilt. Und warum betrachte ich das Online-Verhalten einer einzigen Bevölkerungsgruppe überhaupt so genau? Weil wir durch die Untersuchung extremer Auswirkungen der Digitaltechnologien auf randständiges oder unübliches Verhalten auch deutlicher erkennen können, wie sich der Cyberspace auf uns alle auswirkt. Als forensischer Cyber-Psychologin begegnet mir dieser Sachverhalt immer wieder: Sobald jemand mit einer tieferliegenden Prädisposition oder einer Neigung zu gewissen Handlungen mit Internettechnologien in Berührung kommt, kann dies zu einer Ausweitung oder Eskalation des jeweiligen Verhaltens führen.
Ich behaupte, dass persönliche Neigungen oder Schwächen, die schon im realen Leben das meiste Leid hervorrufen, online sogar noch größere Qualen auslösen. Das gilt für jedes Verhalten.
Wenn besagte Tendenzen nicht zerstörerisch oder riskant sind, bleiben die Folgen oft recht harmlos. Besucht jemand gern Online-Foren für Gärtner, ist das nicht sehr destruktiv. Mancherlei riskantes Verhalten wird jedoch online zu einem noch größeren Risiko – besonders pathologische oder kriminelle Handlungen. Hier ein Beispiel: In der realen Welt nimmt ein Stalker normalerweise immer nur ein Opfer zur selben Zeit ins Visier, aber ein Cyber-Stalker[3] kann zahlreiche Opfer gleichzeitig stalken, weil die Technologie es möglich macht. Damit kann Cyber-Stalking als Evolution eines kriminellen Verhaltens der realen Welt betrachtet werden. Der Cyberspace ist eine Brutstätte für Mutationen. Verhaltensweisen aus der realen Welt verlagern sich in den Cyberspace, wo sie beschleunigt oder verstärkt werden. Zuweilen kann das ernste Auswirkungen auf die reale Welt haben.
Ein Fall von »Cranking«
Jordan Haskins träumte davon, in seinem spärlich besiedelten Heimatort in Saginaw County, Michigan, etwas zu bewirken. Der blasse, glattrasierte Dreiundzwanzigjährige beschreibt sich selbst als »Abtreibungsgegner, Anhänger von traditionellen Familienwerten, Gegner von zu großer Einmischung der Bundesregierung und Anhänger von Religiosität«. Im Sommer 2014, als er noch an der Maranatha Baptist University studierte, verkündete er, dass er für ein politisches Amt kandidieren werde und darauf hoffe, den 95. Wahlbezirk als Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Michigan vertreten zu dürfen.[1]