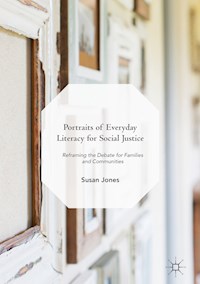Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: blue panther books
- Kategorie: Erotik
- Serie: Der Assistent Roman
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book entspricht 204 Taschenbuchseiten ... Susan Jones entführt, fesselt und berauscht! Sie ist der Chef, doch er hat das Sagen. Sie will ihm ebenbürtig sein. Wird er es zulassen? Eine hörige Chefin! Ein perfekter Assistent! Eine große Aufgabe! Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
Der dominante Assistent 2 | Erotischer Roman
von Susan Jones
Als leitende Angestellte in einem großen Unternehmen kennt Susan Jones die Tücken und Fallstricke der Wirtschaft genau. Doch zwischen Meetings in grauen Büros und dem Unterzeichnen wichtiger Verträge bleibt zum Glück immer noch Platz für die schönste Sache der Welt ... und jede Menge wilder Fantasien. Sie ist gern Chefin und gibt ungern die Kontrolle ab. Es sei denn, ein aufregender Mann betritt ihr sonst so kontrolliertes Leben. Da kann es schon mal passieren, dass ... ach, lesen Sie doch selbst.
Lektorat: Nicola Heubach
Originalausgabe
© 2023 by blue panther books, Hamburg
All rights reserved
Cover: © lightfieldstudios @ 123RF.com
Umschlaggestaltung: MT Design
ISBN 9783756160792
www.blue-panther-books.de
Kapitel 1
»Haben Sie Ihr Bild schon gesehen?« Dr. Raphael Sterling spricht wie immer so ruhig und bedächtig, dass sie ihn schütteln möchte. Sie ist eine erwachsene Frau, die seiner Meinung nach vielleicht traumatisiert ist, aber sie ist keine Idiotin. Irgendwo tief in ihr ist die alte, starke Rebecca noch vergraben, das weiß sie. Das muss sie wissen, denn sonst hätte das weitere Leben keinen Sinn mehr.
Sie schüttelt den Kopf so heftig, dass die langen, braunen Haare fliegen. »Nein, ich habe ihn ja seit dem Abend nicht mehr gesehen«, sagt sie. »Und ich habe im Moment nicht vor, ihn zu Hause aufzusuchen.«
»Um Himmels willen«, sagt Dr. Sterling und runzelt besorgt die Stirn. »Das hielte ich auch für viel zu gefährlich. Haben Sie denn noch einmal darüber nachgedacht, ihn doch bei der Polizei anzuzeigen?«
Sie wölbt nachdenklich ihre Unterlippe vor. »Ehrlich gesagt – Nein. Ich habe ja gar keinen Beweis mehr, und soweit ich weiß, ist so ein Verfahren äußerst schwierig und langwierig. Ich sehe mich momentan nicht in der Lage, so etwas durchzustehen.«
Dr. Sterling nickt verständnisvoll.
Kein Beweis. Die Tätowierung auf dem Steiß schmerzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr, doch jedes Mal, wenn sie sie im Spiegel betrachtet, kommt alles wieder hoch. Kommt er wieder hoch.
»Sie haben trotzdem einige Jahre Zeit für eine Anzeige«, sagt der Psychologe. »Das wissen Sie, oder? Auch wenn die Beweisführung natürlich schwieriger wird, je mehr Zeit ins Land geht.« Er streicht nachdenklich mit einer Hand über sein Kinn, das von winzigen, blonden Bartstoppeln übersät ist.
Marc rasiert sich täglich gründlich. Sein Kinn ist glatt, weich und fordernd. Sein Profil ist klar und fein, und doch liegt so viel Härte, so viel Unnahbarkeit in seinem Gesicht, dass es sie noch immer schaudert. Es war gut gewesen, Dr. Sterling aufzusuchen und sich endlich zu befreien. Es tat so gut, ihre ganze Geschichte zu erzählen, auch wenn sie bei den Gesprächen oft geweint hatte und rot angelaufen war vor Scham. Dr. Sterling hatte ihr nur stumm ein Papiertaschentuch gereicht und ihre Hand gedrückt. Er hörte zu. Er urteilte nicht über sie, verdammte sie nicht, dafür konnte er sie beruhigen und ihr sagen, dass sie nicht die einzige Frau auf der Welt war, der so etwas passierte.
Sie kam sich so dumm vor. Wie hatte sie auf so jemanden hereinfallen können?
»Wie ich verstanden habe, arbeitet er noch in Ihrer Firma«, sagt Dr. Sterling und nimmt die Brille ab. Er hat graue Augen, das fällt ihr jetzt zum ersten Mal auf. Grau wie die Wolken am Himmel, die sie auf dem Weg hierher eingehüllt haben.
Rebecca nickt. »Ja, in meinem Büro«, sagt sie und verzieht die Lippen. »Als hätte er sich das so ausgedacht. Er vertritt mich während meiner Krankheit. Wenn man das so nennen kann.«
Raphael Sterling nickt eifrig. »Selbstverständlich kann man das so nennen«, sagt er. »Sie haben jedes Recht, sich krank zu fühlen, und Sie sollten sich so viel Zeit nehmen, wie Sie brauchen. Allerdings kann ich es sicherlich nicht gutheißen, wenn Sie Ihre alte Tätigkeit wieder aufnehmen, solange er noch dort ist. Sie können unmöglich weiter mit ihm zusammenarbeiten, das verstehen Sie sicher? Es wäre nicht gut für Sie.«
Sie schnauft verächtlich. »Ich denke momentan gar nicht darüber nach, wieder zu arbeiten«, sagt sie leise. »Ich bin froh, wenn ich morgens überhaupt aufstehen kann und sich nicht gleich nach dem Öffnen der Augen die dunkle Welle über mir auftürmt.« Sie hat Depressionen. Ein Trauma, hat Dr. Sterling gesagt, das sei ganz normal nach so einer Erfahrung, sie sei schließlich vergewaltigt worden von dem Mann, den sie zu lieben glaubte, körperlich wie psychisch.
Dass es nicht wirklich Liebe war, davon hatte er sie in den vielen Gesprächen nicht so recht überzeugen können. »Rebecca, Sie sind diesem Mann hörig«, hatte er gesagt, nachdem sie mit den ersten Schilderungen ihrer Beziehung geendet hatte. »Obwohl er Ihnen nicht guttut, können Sie nicht von ihm lassen. Insgeheim lieben Sie es, dass er Sie so schlecht behandelt. Das ist ein kompliziertes psychologisches Phänomen, das ich nur allzu häufig an Frauen erlebe.« Allerdings nicht an attraktiven, selbstbewussten Frauen, die im Job ihren Mann stehen, hatte sie gedacht und sich über sich selbst geärgert.
»Ich träume jede Nacht von ihm«, gesteht sie dem Arzt. »Darum will ich auch nicht aufwachen. Im Traum ist er bei mir, er ist lieb zu mir, gut. Er verführt mich, um mich anschließend bei sich zu behalten. Er hat alle Bilder an der Wand im Flur abgehängt, auch meines. Verspricht, sich zu ändern, für mich. Verspricht, das für mich zu sein, was ich mir von ihm wünsche, für mich da zu sein, mich zu lieben …« Wieder löst sich eine Träne aus ihrem Augenwinkel, und noch bevor sie sich einen Weg über ihren Nasenrücken gebahnt hat, reicht der blonde Psychologe ihr schon ein neues Papiertuch. Sie nimmt es dankbar entgegen und tupft unbeholfen an ihrem Auge herum.
»Sie wissen, dass das ein Traum bleiben wird, Rebecca«, sagt Dr. Sterling leise und greift nach ihrer Hand. Er sitzt dicht neben ihr auf einem Stuhl, mit übereinandergeschlagenen Beinen. Sie hat sich auf seinem Sofa zurückgelehnt und die Knöchel überkreuzt. Ihre Hände öffnen und schließen hektisch einen Knopf nach dem anderen an der grauen Bluse, während sie spricht.
»Er ist ein pathologischer Narzisst, nach allem, was Sie mir erzählt haben, und er wird niemals fähig sein, eine normale Beziehung zu führen. Nicht mit Ihnen und mit niemand anderem. Glauben Sie mir.« Ach, Sie würde ihm zu gern glauben. Sie würde ihn so gern vergessen, einfach weiterleben wie zuvor, aber nicht nur die Tätowierung auf ihrem Rücken hat Narben hinterlassen, die noch immer brennen.
»Wie soll ich denn weitermachen?«, fragt sie leise und starrt mit leerem Blick durch das Fenster nach draußen. Graue Häuser türmen sich auf der anderen Straßenseite auf, die fehlende Sonne lässt ihr Grau heute noch düsterer und trostloser wirken.
Dr. Sterling zieht die Schultern hoch und atmet tief aus. »Ich denke, es ist noch zu früh, um darüber nachzudenken«, sagt er. Sein Blick ruht auf ihr, mit wissenschaftlicher Neugier beobachtet er ihre Reaktion auf seine Worte. »Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich Sie allein in die Realität zurücklassen kann. Je tiefer eine Traumatisierung sitzt, umso länger dauert es, die Seele zu heilen von den hinterlassenen Wunden. Und Ihre Wunden scheinen tatsächlich sehr tief zu sein.«
Sie wendet den Kopf und sieht mitten hinein in seine grauen Augen. Marcs Augen sind dunkel, beinahe schwarz. Wenn er sie zusammenkneift, sind sie gefährlich, und wenn er sie von oben herab ansieht, mit den langen, dichten Wimpern, die der Iris einen wunderschönen Rahmen geben, schmilzt sie dahin. Noch immer? Würde sie ihm widerstehen können, wenn er jetzt plötzlich bei ihr auftauchen würde?
»Was soll ich tun, falls er sich bei mir meldet?«, fragt sie. Ein Anflug von Panik macht sich in ihr breit. Schließlich hofft sie jeden Tag darauf, dass er plötzlich vor ihrer Tür steht, andererseits weiß sie aber genau, dass er sich nicht gerade bei ihr entschuldigen würde, um ihr einen Heiratsantrag zu machen. »Die Möglichkeit besteht ja immerhin …«
Dr. Sterling kaut auf seiner Unterlippe und legt den Kugelschreiber an die Nase. »Sie sollten ihn wegschicken«, sagt er entschlossen. »Auf keinen Fall sollten Sie mit ihm sprechen. Lassen Sie sich nicht auf ihn ein! Nach allem, was Sie mir erzählt haben, ist er gefährlich. Er ist manipulativ, und so stark Sie sich auch in einem Moment fühlen mögen, so schnell wird er Sie wieder verwandeln in das willenlose Wesen, das er aus Ihnen gemacht hat. Die hilflose Puppe, die ihm zur Verfügung steht, wann er will und die sich ihm sexuell öffnet, wie es ihm beliebt.« Er atmet schwer. Offenbar haben ihre Erzählungen auch ihn nachhaltig beeindruckt.
»Ich kann nicht«, antwortet sie. »Ich werde ihn nicht wegschicken können. Noch nicht. Wenn er zu mir kommt, würde ich mich sofort bereitwillig vor ihm hinwerfen, mich öffnen und mich spreizen, wie er es will. Schon der bloße Gedanke an ihn erregt mich körperlich, mein Körper reagiert ganz eigenwillig auf ihn. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Reaktionen kontrollieren kann, und das macht mich wütend.« Sie schnieft.
Dr. Sterling nickt langsam. »Sie müssen sich Ihre Situation vorstellen wie die eines Drogensüchtigen«, erklärt er in ruhigem Ton. »Auch der ist nicht in der Lage, im Entzug seine körperlichen Reaktionen zu kontrollieren. In Ihrem Fall handelt es sich um körpereigene Drogen. Endorphine, Adrenalin, Oxytocin … Und bei seinem Anblick rasen diese unkontrolliert durch Ihren Körper und lassen Sie Dinge tun, die sich die meisten von uns gar nicht vorstellen können.«
Rebecca seufzt und richtet sich auf dem Sofa auf. »Drogen, ja? Vielleicht kann ich meinen Entzug mit stärkerer Chemie lindern.« Hoffnungsvoll lächelt sie den Arzt an.
Doch der schüttelt mitleidig den Kopf. »Ich würde Ihnen keinen Gefallen tun, wenn ich Ihnen noch stärkere Medikamente aufschriebe«, sagt er. »Sie werden das auch so schaffen, da bin ich mir sicher. Die Zeit heilt in diesem Fall die schlimmsten Wunden. Je mehr Abstand Sie von den Geschehnissen bekommen, umso einfacher wird es für Sie werden. Die vermeintlichen Drogen werden sich verflüchtigen und irgendwann werden Sie ihm sogar reaktionslos gegenüberstehen können. Glauben Sie mir.«
Sie rümpft die Nase. Es ist schwer zu glauben, denn schließlich hat schon die Erinnerung, ausgelöst durch das Gespräch mit ihrem Therapeuten, sie wieder feucht werden lassen. Wie Blitze zucken Erinnerungsfetzen vor ihrem geistigen Auge auf. Die Peepshow, in die er sie genötigt hat und in der sie sich für ihn, vor ihm und vor anderen Männern entblößt hat. Das Pornokino, dessen intensiver Pheromongeruch jetzt wieder in ihrer Nase kribbelt, wenn sie daran zurückdenkt. Die lustvolle Vereinigung mit ihm in seiner Wohnung, die so elegant und katzenhaft ist wie er selbst. Allein die Erinnerung an seinen Schwanz lässt sie innerlich erschauern.
Für sie hat er den schönsten Schwanz der Welt. Er ist perfekt, gerade, und er passt in ihre Möse hinein wie kein Zweiter. Er ist für sie gemacht, dessen ist sie sich sicher. Erregt presst sie die Beine zusammen, als die Erinnerungen sie wieder überkommen. Sie will das nicht, sie will ihren Körper unter Kontrolle haben, aber das funktioniert noch nicht. Alles in ihr verzehrt sich nach ihm, sie will von ihm gefickt werden, will ihre Beine für ihn öffnen, und sogar der Gedanke an das letzte Treffen, das so schmerzhaft endete, lässt ihren Schoß heftig pulsieren. Tief ist er in ihren Anus eingedrungen, es tat weh, doch jeder Stoß bahnte sich seinen Weg direkt in ihr Lustzentrum und löste einen Schauer nach dem anderen aus. Mit leichtem Druck der Oberschenkel massiert sie ihre klopfende Klit. Dr. Sterling wird es sehen, schließlich liegt sie wie so oft in den letzten Monaten direkt vor ihm auf diesem Sofa. Sie denkt an die Chaiselongue in Marcs Wohnung, auf der sie sich hingegeben hat für ihn. Er hat sie geküsst und in den Nacken gebissen, an diese Stelle, die schon den Frauen in der Urzeit der Menschheit Paarungswilligkeit signalisieren sollte und daher nie ihr Ziel verfehlte. Wie eine Katze hatte sie sich unter seinen Zähnen geschüttelt und es genossen, wie er in sie eingedrungen war, nicht einfach nur mit seinem Schwanz, sondern mit seinem ganzen Körper, seiner ganzen Person. Er war so tief in ihr gewesen wie noch kein Mensch zuvor, und sie hatte ihm ihre Seele geöffnet, nicht nur ihren Schoß.
Das Blut jagt so heiß durch ihren Unterleib, dass sie sich nicht länger beherrschen kann. Vergessen ist der Arzt, der doch direkt neben ihr sitzt, vergessen sind die Schmerzen, die Marc ihr zugefügt hat, zu groß ist die Erregung der Erinnerungen, die sich jetzt Platz verschafft. Und dann drückt sie schnell und kräftig die Schenkel immer wieder fest zusammen, spürt die harte und groß gewordene Perle dazwischen, die keine Ruhe geben will, denkt an ihn und seinen Schwanz, das prächtige Schwert, das sie lutscht und saugt und mit dem er sie anschließend durchstößt, in sie eindringt und sie so egoistisch und vehement vögelt wie noch niemand vor ihm. Sie kneift die Augen zu und unterdrückt ein leises Stöhnen, als der Höhepunkt sie durchzuckt und ihren Leib schüttelt, kaum merklich, kaum sichtbar.
Vorsichtig öffnet sie die Augen wieder und blinzelt zu dem Arzt, der stumm neben ihr gesessen hat. Er räuspert sich und schlägt verlegen die Beine übereinander, um seine Erregung zu verstecken, aber sie hat sie gesehen, die Beule in seiner Hose. Plötzlich schämt sie sich. Ihr ist heiß, und zwischen ihren Beinen zeugt die Feuchtigkeit eindeutig von der Lust, die sie allein beim Gedanken an Marc erlebt hat.
Konditioniert sei sie, hatte Dr. Sterling erklärt, und sie fragt sich, ob er sein Wissen ihr gegenüber wohl ausnutzen würde, um mit ihr zu schlafen. Sie ist schließlich eine attraktive Frau, das weiß sie, und er ist ein nicht unattraktiver Mann, nur wenige Jahre älter als sie. Er weiß so viel von ihr, so intime Dinge, die sie nie jemandem erzählen wollte und für die sie sich im Nachhinein selbst schämt. Aber ihm hat sie sich geöffnet, ihn hat sie reingelassen in ihre Mördergrube.
Würde sie mit ihm schlafen wollen? Vielleicht könnte er den Schmerz ein wenig lindern, den sie so tief in sich spürt? Vielleicht wäre er in der Lage, mit seinem Schwanz seine Spuren auszumerzen? Sie könnte sich langsam entblättern vor ihm, er würde dem Anblick ihrer Brüste sicher nicht widerstehen können, und dann würde sie mit ihm auf das graue Sofa sinken, das ihr in den letzten Wochen beinahe ein Zuhause geworden ist.
»Woran haben Sie gedacht?« Dr. Sterling zwinkert neugierig und schiebt seine Brille auf die Nase zurück, als wolle er einen Schutzschild aufrüsten und eine transparente Barriere schaffen. Schließlich sollte er gemerkt haben, was sie gerade eben vor seiner Nase getan hat.
Rebecca lächelt verlegen. »Nichts Besonderes«, erwidert sie und lässt ihren Blick über seinen Schoß schweifen, doch die Beule scheint schon wieder verschwunden zu sein. Schade.
»Wir sehen uns morgen wieder«, sagt Raphael Sterling und steht auf. Die schwarze Kladde, in die er sich ständig Notizen macht, legt er auf den Schreibtisch. Rebecca erhebt sich ebenfalls vom Sofa und zupft den schwarzen Rock zurecht. Seit der letzten Nacht mit Marc legt sie nicht mehr so großen Wert auf ihr Äußeres, schminkt sich kaum und greift morgens lustlos in den Kleiderschrank, um irgendetwas herauszuziehen, das ihr noch passt. Sie hat ein wenig abgenommen, und die meisten Kleider aus ihrem Schrank rutschen nun unelegant an ihrem Körper herum.
»Was werden Sie heute noch machen?«, fragt Dr. Sterling in der Haustür und hält ihre Hand fest, die er zum Abschied ergriffen hat. Sie lässt den Druck zu, der stark und kräftig ist und irgendwie beschützend wirkt.
»Ich weiß nicht«, murmelt sie. »Vielleicht gehe ich einkaufen … Ich brauche neue Sachen.« Sie deutet mit dem Kopf auf ihren Rock, der sich mal wieder über ihren Hüften verschoben hat. Dr. Sterling lächelt zustimmend. »Das ist eine gute Idee. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Bis morgen, Rebecca.«
Sie geht die wenigen Stufen zur Straße hinunter und verlässt die schützende Umgebung der Praxis. Freiwild in der Stadt, die um sie herum lebendig pocht und pulsiert. Es ist mitten am Tag, und die Menschen eilen von der Mittagspause in ihre Büros zurück.
Wie von einer unsichtbaren Hand gezogen, findet sie zu Fuß den Weg durch die Straßen. Ihr schwarzer Mercedes parkt am Rand, direkt gegenüber von Dr. Sterlings Haus, aber sie will jetzt nicht damit fahren, will keine weiteren Erinnerungen an ihn, die sogar mit ihrem Auto verknüpft sind, wie so viele Dinge ihres Lebens unwiderruflich mit ihm verbunden zu sein scheinen. Zwischen ihren Beinen stört der feucht gewordene Slip. Vielleicht sollte sie ihn einfach ausziehen?
Sie durchquert den kleinen Park, in dem Mütter Kinderwagen über den feinen, roten Kies schieben und Menschen mit kleinen oder großen Hunden unterwegs sind. Die Luft ist kühl und feucht, ein feiner Nebel liegt über allem und kräuselt ihre Haare, die sie heute Morgen nur gebürstet hat, ohne sich weiter darum zu kümmern.
Das große Gebäude jagt ihr einen Schauer über den Rücken. Sie bleibt kurz davor stehen, lässt eilige Menschen an sich vorbeilaufen, und sieht an dem grauen Haus nach oben. Achte Etage. Da ist es. Da gehört sie hin, doch sie kann sich hier nicht sehen lassen. Noch nicht. Es ist noch zu früh, das hat auch Dr. Sterling gesagt.
Ihr Herz rast, wenn sie daran denkt, wer dort oben nun sitzt, in ihrem Büro. Ihre Hände werden feucht wie ihr Schoß bei dem Gedanken an das feine Grübchen in seinem Kinn, an das Blitzen in seinen Augen, wenn er sie zu Dingen verführt, die sie früher nicht zu träumen gewagt hätte. An den spöttischen und mitleidigen Blick, den er ihr zuwirft, wenn sie ihn am Arm einer anderen Frau erwischt, Eifersucht und Lust im Herzen, die sie nicht zulassen will.
Mit wem verbringt er seine Zeit? Hat er weitere Frauen seiner Bildersammlung hinzugefügt, die seinen Flur ziert und in der sich nun wohl auch ihr Foto befindet? Mit Schaudern erinnert sie sich an die Schwarzweiß-Aufnahmen der vielen Frauen, die dort hängen, sorgfältig drapiert in aufwendigen Rahmen, wie eine Ahnengalerie. Sie denkt an die erschrockenen, ängstlichen Gesichter, die sie von der Wand angestarrt haben, und an das Aufblitzen seiner Kamera, als er ihr seine Tätowierung auf den Steiß gemalt hat. La mienne, toujours. Die Meine, für immer.
Ein Verrückter, der nicht einmal vor ihrer besten und einzigen Freundin Halt gemacht hatte. Stacy! Rebecca starrt auf die leeren Glasaugen des großen Gebäudes. Irgendwo da drin sitzt ihre ehemals beste Freundin, verheiratet und glückliche Mutter einer kleinen Tochter, und doch hatte auch sie ihm nicht widerstehen können. Rebecca hatte die beiden in ihrem Büro erwischt, lustvoll ineinander verkeilt auf ihrem Schreibtisch. Vielleicht war es das Schlimmste gewesen, das er ihr angetan hatte. Aber sie hatte ihm verziehen. Mit Stacy hatte sie seit Wochen kein Wort gesprochen, ihre Anrufe ignorierte sie, bis sie endlich aufgab und sich nicht mehr meldete. Nun sehnt sie sich plötzlich nach ihr. Sie würde ihr alles erzählen, vielleicht versteht sie es ja. Sie hat Verständnis für die Freundin, wie konnte sie ihm nicht erliegen? Diesen schwarzen, dunklen Augen, die so tief in die eigene Seele hineinblickten und einem das Gefühl geben, der einzige Mensch auf der Welt zu sein. Dem neckisch vorgewölbten Kinn, das ihm einen so männlichen und unnachgiebigen Ausdruck verleiht, wie ein strenger Vater, dessen Zuneigung man sich unter allen Umständen erarbeiten will.
Enttäusche mich nicht, hatte sein Blick in jeder Minute gesagt, und verbissen eifrig wie eine strebsame Tochter hatte sie getan, was er von ihr erwartete, und sie hatte es genossen.
Natürlich hatte er sich Stacy absichtlich ausgesucht. Er wusste von ihrer besonderen Beziehung, und Stacy war die einzige Person in ihrem Leben gewesen, der sie von ihrer verhängnisvollen Affäre berichtet hatte. Er hatte nicht mit ihr geschlafen, weil er das so wollte. Sie war eine Trophäe, ein Symbol seiner Macht, mit dem er Rebecca gezeigt hatte, wie sehr er sie in der Hand hatte.
Nachdenklich kaut sie auf der Unterlippe und geht zurück in die Straße, in der das große, schwarze Auto parkt, auf das sie früher einmal so stolz gewesen ist. Dann fährt sie nach Hause. Wenn sie nur nicht so schrecklich allein wäre …
Kapitel 2
Dr. Sterling hatte ihr Mut gemacht und gemeint, es sei der richtige Schritt. Und nun steht sie, mit seinen Worten noch im Ohr, wieder vor dem großen Gebäude mit der eintönigen Fensterfront, hinter der sich die klimatisierten Büroräume befinden, die jahrelang ihr zweites Zuhause gewesen waren.
Ihr Herz rast bei dem Gedanken an ihn, der sich in diesem Komplex befindet und jederzeit auf die Straße treten könnte. Sie sehen könnte.
Sie wartet hier nicht auf ihn. Da es erst früher Nachmittag ist, wird er noch nicht herauskommen, er hat sicher viel zu tun seit ihrem Arbeitsausfall. Denkt er wohl an sie? Fragt er sich nicht, wie es ihr nach ihrem letzten Treffen geht? Oder hat er einfach genug von ihr, jetzt, da sein Ziel doch erreicht ist? Er hatte sie besessen, sie hatte alles zugelassen, was er von ihr verlangte, und zuletzt wurde sie auch noch beruflich ausgebootet von ihm. Krank, haha. Sie schnauft verächtlich und starrt wie hypnotisiert auf die gläserne Tür, die sich wie von Geisterhand leise zischend öffnet, sobald jemand hineingeht oder herauskommt.
»Rebecca! Was machst du denn hier?«
Sie erkennt die jugendlich klingende Stimme sofort und fährt zusammen. Dann dreht sie sich vorsichtig zu ihr um.
Die schlanke Blondine läuft freudestrahlend auf sie zu und umarmt sie.
»Natalie!« Ihre Sekretärin hier zu sehen, hat sie nicht erwartet. »Gehst du schon nach Hause?«
Natalie schüttelt den Kopf. »Nein, nein, ich musste nur etwas für Mr Adams besorgen. Aber wie geht es dir? Bist du wieder gesund? Kommst du bald wieder? Marc arbeitet vierzehn Stunden am Tag, er will dich so perfekt wie möglich ersetzen, aber ich wünschte, du wärest wieder da.« Die schlanken Arme drücken sich um ihre Schultern und pressen sie fest gegen den leichten Trenchcoat, den die Sekretärin trägt.
»Ich bin noch nicht wieder gesund«, murmelt Rebecca und kann den Blick nicht vom Eingang abwenden. Nur niemanden verpassen. »Ich warte auf Stacy.«
Natalie runzelt die jugendlich glatte Stirn und pustet eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Habt ihr euch gestritten? Ich habe sie neulich gefragt, ob sie weiß, wie es dir geht, aber sie ist mir ausgewichen. Sonst ist sie ja immer so fröhlich und offen, aber bei der Frage wirkte sie plötzlich betroffen und traurig.«
Rebecca hebt die Schultern und verzieht den Mund zu einem traurigen Grinsen. »Na ja, wir kennen uns schon so lange, und selbst unter besten Freundinnen kann ein Streit ja mal vorkommen …« Den Grund des Streites verschweigt sie der jungen Frau lieber. Es ist schlimm genug, dass sie von einer Affäre zwischen Rebecca und Marc weiß, das ganze Ausmaß des Desasters muss sie nicht erfahren.
»Ruf mich doch mal an, wenn du Zeit hast«, sagt Natalie und tätschelt beinahe mütterlich ihren Arm. »Wir können einen Kaffee zusammen trinken und ich kann dir ein bisschen Büroklatsch verraten. Vielleicht heitert dich das auf? Werd ganz bald wieder gesund, ja? Versprochen?«
Rebecca nickt aufatmend. »Ich gebe mir Mühe«, sagt sie. Und dann erstarrt sie vor den Augen der jungen Frau zur Salzsäule.
Natalie folgt ihrem Blick irritiert und sieht sofort, wer diese Reaktion ausgelöst hat. »Marc!«, ruft sie fröhlich und winkt dem großen, schlanken Mann zu, der in der offenen Glastür stehen geblieben ist und irritiert lächelt.
Rebecca stockt der Atem. Sie will weglaufen, fort von hier, aber ihre Beine versagen ihr den Dienst. Wie festgefroren steht sie da in ihrem grauen Mantel, ungeschminkt und nicht frisiert, in flachen Schuhen, die er doch so sehr verabscheut an ihr.
Was denkt sie da? Es sollte ihr egal sein, wie sie aussieht, sie will ihn nicht sehen und schon gar nicht mit ihm sprechen. »Es ist zu früh«, dröhnen die Worte von Dr. Sterling in ihren Ohren. »Geben Sie sich Zeit. Er ist gefährlich für Sie.«
Sie kriegt keine Luft, während sie zusieht, wie er sich ganz langsam nähert. Wie in Zeitlupe sieht sie ihn auf sich zukommen, und das Blut rauscht in ihren Ohren, verursacht heftige Kopfschmerzen. Ihr wird übel.
Sie streckt die zitternde Hand nach Natalie aus und berührt ihren Arm. »Ich … Ich muss wieder … weg …«, stößt sie hervor, dreht sich auf dem Absatz um und läuft die Straße hinunter. Sie ist blind, nimmt die Menschen um sich herum nicht wahr, die sie irritiert ansehen. Sie rennt um ihr Leben, läuft so weit, bis sie außer Sichtweite ist und lässt sich erschöpft und mit rasendem Herzen in einem Hauseingang fallen.
Dort schließt sie die Augen und lehnt den Kopf an die harte Mauer. Warum musste er ausgerechnet jetzt aus dem Büro kommen und sie sehen? In diesem Aufzug? In ihrer Verfassung? Er wäre vielleicht sogar entsetzt, wenn er wüsste, wie es um sie steht. Und doch hat sein Anblick wieder diese wilden Emotionen in ihr ausgelöst, die sie nicht kontrollieren kann. Ihre Hände sind eiskalt und feucht, sie presst die zitternden Knie aneinander und legt die Stirn darauf, um sich selbst zu beruhigen.
Zu gefährlich … Natürlich kann sie dem inneren Drang nicht widerstehen. Obwohl sie doch genau weiß, dass es ihr nicht guttun wird, rappelt sie sich nach wenigen Minuten auf und tritt zurück auf die Straße. Dann geht sie wie mechanisch die Straße wieder hinunter, zwischen den hohen Bürogebäuden vorbei, die das ganze Viertel in Beschlag genommen haben, und steuert auf ihr Unglück zu.
Natalie ist fort, und auch von ihm ist weit und breit nichts zu sehen. Noch immer am ganzen Körper zitternd bleibt sie vor dem Portal stehen und starrt hinein in das Foyer, das ihr früher beim Betreten so vertraut gewesen war. Der ältere Portier erkennt sie und nickt ihr freundlich lächelnd zu. Sie lächelt gequält zurück, fassungslos über sich selbst und ihre eigene Reaktion.
Ihr Körper spricht seine eigene Sprache, die sie nicht mehr beherrscht. Das heftige Pochen in ihrem Schoß ist unmissverständlich, und sie weiß genau, wer es ausgelöst hat.
Eine ganze halbe Stunde steht sie auf der Straße vor dem hohen Gebäude und wartet. Endlich öffnen sich leise fauchend die Glastüren, und sie erkennt den blonden Schopf. Eine neue Frisur, kürzer, frecher, sie steht ihr gut und macht sie jünger.
»Becca!« Stacy bleibt wie vom Donner gerührt stehen, dann breitet sie die Arme aus und läuft wie ein kleines Kind auf sie zu, die Augen sorgenvoll und erleichtert zugleich. Rebecca lässt sich drücken und küsst die Freundin auf die Wange. Sie lachen, sie weinen, sie umarmen sich, als seien sie gerade von einer Weltreise zurückgekehrt, und dann fasst Stacy sie wortlos unter den Arm und zieht sie mit sich in das Café, in dem sie früher so oft gesessen und geredet haben.
Sie ist glücklich. »Ich habe mir solche Sorgen gemacht«, gesteht Stacy und greift über den kleinen Tisch nach ihrer Hand. »Du hast dich gar nicht mehr gemeldet, und Marc spricht nicht über dich. Ich wusste nicht einmal, ob ihr euch überhaupt noch seht. Du warst ja wie vom Erdboden verschluckt.«
Rebecca schluckt und starrt in den Kaffeebecher vor sich. »Du weißt, warum ich nicht mit dir sprechen wollte«, sagt sie leise und sieht auf.
Stacy verzieht den Mund und schließt kurz die Augen. »Natürlich«, flüstert sie. »Es tut mir so leid! Ich weiß nicht, warum das passieren konnte. Du musst mir glauben, dass das ganz sicher nicht geplant war. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid es mir tut, Becca!« Ihre Augen glitzern feucht, und der treue Hundeblick verfehlt seine Wirkung nicht.
»Es ist gut«, sagt Rebecca und lächelt traurig. »Ich bin wohl die Letzte, die nicht verstehen würde …«
»Es war ein einmaliges Erlebnis«, sagt Stacy. »Das musst du mir glauben! Mein Gott, wenn Miguel davon erfahren würde, wäre ich morgen schon geschieden!« Sie schüttelt sich.
»Er wird es nicht erfahren«, beruhigt Rebecca sie. Nicht einmal in ihrer größten Wut hatte sie eine Sekunde lang darüber nachgedacht, Stacy auf diese Art und Weise für ihr Verhalten zu bestrafen.
Sie wusste, dass Marc die Schuld an diesem Ereignis traf. Er hatte die Freundin verführt, in ihrem Büro, wissend, dass Rebecca die beiden erwischen würde. Er hatte sie verletzen wollen, um ihr zu zeigen, dass er sie noch immer beherrschte, dass er nicht nur ihr Assistent war, sondern der Überlegene, obwohl sie seine Vorgesetzte darstellte. Er wollte sie verletzen und demütigen, um zu sehen, wie weit er gehen konnte. Er sah das als Zeichen ihrer Liebe. Sie verzieh ihm alles, kein noch so obszöner Wunsch war ihr zu viel, sie konnte ihm nichts abschlagen und war ständig für ihn bereit.
»Gehst du noch zum Psychologen?« Stacy nippt an dem heißen Kaffeebecher.
Rebecca nickt. »Ja, Dr. Sterling hat mir in den letzten Wochen wirklich sehr geholfen. Er hat mir dazu geraten, mich mit dir zu treffen und um eine Aussprache zu bitten.«
Stacy wird rot. Nervöse Flecken breiten sich auf ihren leicht gebräunten Wangen aus. »Ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll«, sagt sie leise.
Rebecca winkt ab und lächelt. »Es ist okay«, erwidert sie. »Lass es uns am besten vergessen … alles.«
Nachdenklich trinkt sie von dem heißen Getränk und sieht aus dem Fenster auf die Straße. Es hat angefangen zu regnen, die Straße glitzert von der Feuchtigkeit und die vorbeifahrenden Autos wirken mit ihren hektischen Scheibenwischern eiliger als sonst. Menschen mit gesenkten Köpfen huschen vorbei, auf dem Weg nach Hause. Der Blick auf die Uhr zeigt, dass es gleich sechs ist. Die hektischste Stunde des Tages, in der die Massen die Büros verlassen und nach Hause eilen, zu Fuß, mit dem Auto oder mit der U-Bahn.
Vielleicht wird auch er gleich herauskommen. Der Gedanke daran schlägt wie eine Faust in ihren Magen ein, ihr wird übel.
»Was ist mit Marc passiert?«, fragt Stacy besorgt und vorsichtig. »Etwas ist zwischen euch geschehen, bevor du dich so zurückgezogen hast …«
Die blauen Augen der Freundin sind so vertraut, sie kennt sie seit ihrer Kindheit. Sie haben schon in der Schule miteinander gestritten, Eifersüchteleien durchlitten, sich gegen die Eltern verschworen und waren immer die besten Freundinnen gewesen. Sie hatten keine Geheimnisse voreinander, bis Rebecca Marc traf. Es hatte lange gedauert, bis sie ihrer Freundin von ihrer Affäre erzählte, und Stacy war direkt beunruhigt gewesen und hatte versucht, sie zur Abkehr zu bewegen. Dass ihr diese bis zum Schluss nicht gelungen war, hatte sie geflissentlich verschwiegen, es war ihr unangenehm und peinlich der Freundin gegenüber.
Doch nun erzählt sie. Erzählt von den Momenten, die sie durchlitten hat, seitdem sie Marc und Stacy in ihrem Büro erwischte. Erzählt, wie sie ihm verziehen hat und was er ihr bei ihrer letzten Begegnung angetan hat. Schonungslos und offen, so wie sie es Dr. Sterling erzählt hat. Tief atmend spricht sie langsam und bedächtig, wie ein Priester bei der Predigt, betont jede Silbe überdeutlich, um selbst mehr Abstand von dem Gesagten zu bekommen, das ja Erlebtes ist.
»Traumatisierung«, sagt sie und lächelt gequält. Vergewaltigung. Nötigung. Sie zieht das Sweatshirt hoch und zeigt ihrer Freundin den Rücken.
Stacy schnappt nach Luft. »Ist nicht dein Ernst! Das hat er selber gemacht?«
Rebecca lässt den Pullover zurückgleiten über diese Narbe, die sie an jeden Moment ihrer Affäre erinnert, und seufzt.
»Der ist kranker als ich befürchtet habe, Becca! Gut, dass du professionelle Hilfe hast, das kann man ja allein gar nicht durchstehen! Du solltest ihn anzeigen, weißt du das? Dann wird er seinen Job los und du kannst beruhigt zurückkommen und den ganzen Spuk vergessen.« Stacy kaut wütend auf ihrer Unterlippe herum und starrt nachdenklich auf den Tisch. »Ich könnte ihn … Ach, ich weiß nicht, was ich ihn gerade könnte. Der Mann ist krank, Becca, und offenbar gefährlich für dich. Wer weiß, mit was für psychologischen Tricks und Mitteln er dich so hingebogen hat. Du kannst nichts dafür, es ist dir einfach passiert, wie es sicher noch vielen anderen Frauen mit ihm auch passiert ist. Er ist gefährlich und gehört eingesperrt! Zeig ihn an!« Sie redet sich in Rage und schnauft zwischen den Sätzen.
Rebecca grinst. »Ich werde ihn nicht anzeigen«, sagt sie. »Ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich denke, es ist besser, ihn zu vergessen. Und sobald es mir wieder gut geht, suche ich mir einen neuen Job. Dann kann er glücklich werden mit dem, was er hat. Aber ohne mich.«
Stacy tätschelt ihre Hand, die trotz des heißen Kaffees im Becher eiskalt ist. Der Gedanke, dass sie ihn nie wiedersehen wird, bedrückt sie noch immer.
Wer sich in Gefahr begibt …
»Ich finde das nicht fair«, brummt Stacy. »Es ist dein Job, du hast hart dafür gearbeitet, und wenn einer von euch gehen muss, dann sollte er das sein. Ich werde dich unterstützen und stehe dir als Zeugin zur Verfügung, wenn du mich brauchst. Das weißt du hoffentlich?«
Rebecca nickt. Natürlich weiß sie das. Dreißig Jahre Freundschaft kann auch ein Marc nicht einfach so zerstören.
»Ach herrje, schon so spät!«, ruft Stacy und springt auf. »Ich muss nach Hause, Emily wird gleich gebracht.« Stacy hat ihre Tochter bei einer privaten Nanny untergebracht, die noch andere Kinder betreut, während sie im Büro ist. »Tut mir leid, aber ruf mich morgen an! Wir treffen uns auf jeden Fall noch diese Woche zum Reden, versprochen!«
Rebecca haucht ihrer Freundin einen Kuss auf die Wange, bezahlt bei der jungen Kellnerin den Kaffee und verlässt wenige Minuten später ebenfalls das kleine Café.
Die Straße ist noch feucht von dem feinen Regen, der sie überzogen hat. Die Feuchtigkeit dringt tief in ihren Körper ein und lässt sie frösteln. Den dünnen Mantel eng über der Brust verschlungen geht sie mit festen Schritten den bekannten Weg entlang. Eigentlich müsste sie in die andere Richtung, denn dort steht ihr Auto und wartet darauf, sie endlich nach Hause zu bringen, in die schützende Umgebung ihres teuren Penthouses am anderen Ende der Stadt. Doch ihre Beine gehorchen nicht, sie finden den kurzen Weg wie von selbst, und plötzlich findet sie sich schwer atmend vor der Glastür wieder, mit klopfendem Herzen.
Nur ein Blick, wenn er herauskommt, nur kurz in die schwarzen Augen sehen, unentdeckt. Warten, ob er allein nach Hause geht oder ob er abgeholt wird, von einer anderen.
Sie kennt die Gegend wie ihre Nachttischschublade, schließlich hat sie viele Jahre ihres Lebens genau hier verbracht. Und so überquert sie die belebte Straße und betritt eine kleine Boutique in einer Shoppingmall gegenüber, von deren Schaufenster aus sie einen perfekten Blick auf das zischende Glasportal hat.