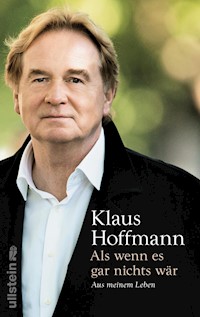Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Winter hat die Stadt Krefeld fest im Griff, als das idyllische Studentenleben von Johannes Wassen und seinen Mitstudierenden abrupt durch den Mord an einem Kommilitonen beendet wird. Die junge Kommissarin Charlotte Becker und ihr Schulfreund Johannes versuchen alles, weitere Verbrechen zu verhindern, doch es bleibt nicht bei diesem einen Todesfall. In der Verbindung von Kriminalroman, Kulturgeschichte und Lokalkolorit strebt alles dem dramatischen Höhepunkt entgegen, der aufs Neue die alte Frage beantworten soll: Wer war der Täter?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Hoffmann
Der dritte Turm
Ein Kulturkrimi
Zweite Auflage 2024
Umschlagfotos von Klaus Hoffmann
Gedruckt bei epubli GmbH, Berlin
© by Klaus Hoffmann
Krefeld
Für die Freunde von Hercule Poirot, William von Baskerville und Sam Hawkins, besonders aber für die Stadt Krefeld, welche die Kulisse dieses Romans zur Verfügung stellte.
Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Frau Elke, deren wohlmeinende Kritik mir beim Verfassen dieses Buches wertvolle Hilfe war.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen und Lokalitäten sind möglich, Handlung und Personal allerdings frei erfunden.
Inhalt
Vorwort
1. Kapitel: Die Werkstatt
2. Kapitel: Der Laden
3. Kapitel: Der Palast
4. Kapitel: Das Museum
5. Kapitel: Das Boot
6. Kapitel: Das Café
7. Kapitel: Der Wald
8. Kapitel: Die Wirtschaft
9. Kapitel: Der Kalender
Nachwort
Vorwort
Da mir die Psychologin, Lotte und auch meine Freunde geraten haben, alle Einzelheiten des Falls niederzuschreiben, von Anfang bis Ende und nichts auszulassen oder zu verändern außer den tatsächlichen Namen der darin verstrickten Personen, so sitze ich jetzt hier an meinem Laptop am Ende dieses verschneiten Winters und gehe in der Erinnerung zurück zu der Zeit, als wir uns noch völlig unbeschwert in der Hochschule unserer Stadt trafen und nicht ahnten, welche grauenvollen Ereignisse auf uns warten sollten.
Noch immer kann ich kaum fassen, was geschehen ist und vor allem, dass ich, Johannes Wassen, ein einfacher Studienanfänger des Kommunikationsdesigns und ehemaliger Student der Germanistik und Anglistik, in den Mittelpunkt der furchtbaren Geschehnisse geraten konnte, die mich, meine Freunde und unsere Stadt in Angst und Schrecken versetzten.
Den Rat der Ärztin will ich gern befolgen und mir alles von der Seele schreiben, was sich in den letzten Wochen ereignet hat. Meine Hände sind auch schon wieder ganz gut verheilt, so dass ich ohne größere Schmerzen werde schreiben können.
Dazu muss ich allerdings nicht nur auf das zurückgreifen, was ich selbst erlebt habe, sondern auch auf die Berichte anderer, auf Protokolle und Schriftstücke, die mir vorliegen oder mir zur Verfügung gestellt wurden und die eine unverzichtbare Rolle für die Beschreibung der ganzen Geschichte spielen, die ich ohne diese Informationen niemals vollständig wieder-geben und begreifen könnte.
Einige Zeit wird es wohl dauern, alles aufzuschreiben und festzuhalten, selbst wenn ich mich hier in meiner kleinen, aber gemütlichen Studentenbude unterm Dach voll und ganz auf die Aufgabe konzentriere, mich genau
zu erinnern, die richtigen Worte zu finden und das Chaos zu ordnen, in das wir hineingezogen wurden. Nichts soll mich dabei ablenken, meine Freunde wissen Bescheid, dass mit mir in der nächsten Zeit kaum zu rechnen sein wird.
Vor mir auf dem Bildschirm die ersten Sätze meines Berichts, links daneben die Dokumente und Notizen, rechts die Kanne mit frisch aufgebrühtem Kaffee, ein Kännchen mit Milch, mein roter Weihnachtsbecher mit dem Elch darauf und genügend Schokolade – alles, was ich brauche, steht bereit.
So fange ich also an mit meiner Geschichte und versetze mich in die Zeit zurück, als ich mich noch ahnungslos und unbeschwert auf den Weg in die Hochschule machte, um dort zu arbeiten und meine Mitstudierenden zu treffen.
1. Kapitel: Die Werkstatt
Wenn die Zeit doch nur verginge und ich mein Ziel endlich erreichte. Das verfluchte Fieber wird ihn noch ins Grab bringen. Dass ich nur rechtzeitig ankomme! Der Doktor – ob er nicht doch ein Mittel weiß?
Welcher Wahnsinnige hat denn da das Fenster geöffnet? Der Qualm der Lokomotive, die eisige Kälte... Am Ende komme auch ich noch todkrank an in dieser Stadt, die nur darauf wartet, mich in den dunklen Nebel ihrer Fabrikschornsteine zurück zu ziehen und endlich zu ersticken.
Jedoch es soll ihr nicht gelingen. Schon einmal bin ich ihr entkommen und ganz gleich, wie lang mein Aufenthalt auch dauern mag: Ich will und werde sie verlassen, zurückkehren zu meinen Werken und den Freunden im Süden.
Nur eines wüsste ich so gern: Werde ich Dich, mein Ein und Alles, bei meiner Ankunft wiedersehen?
Die Weihnachtszeit und die Semesterferien warenvorüber und die Hochschule hatte wieder geöffnet. Ich wollte einen Neujahrsvorsatz umsetzen und hatte es geschafft, schon so früh aufzustehen, dass ich nach unsicherer Fahrt auf noch nicht vom Neuschnee befreiten und schwach beleuchteten Straßen, vorbei an teils abrissreifen Gebäuden, kurz nach acht mit meinem Fahrrad vor dem Haupteingang ankam, dessen herausragende aluminiumverkleidete Überdachung, in der sich ein Teil des Audimax befand, Schutz vor Regen und Schnee bot. Es war noch dunkel und fing wieder an zu schneien. Deshalb beeilte ich mich, mit klammen Fingern das Rad an der noch fast leeren Fahrradständerreihe anzuschließen, um schnell die Glastüren zu erreichen und so dem schneidenden Wind zu entgehen. Zwar hatte ich mir meine coole Schiebermütze und die mit Lammfell gefütterten Stiefel angezogen, aber meine Handschuhe hatte ich vergessen.
Zwei Studentinnen, die ich nicht kannte, standen vor den Eingangstüren und rauchten neben einem der weißen, trapezförmigen Pfeiler, die den wuchtigen Überbau – irgendwo auch „futuristischer Betonannex“, aber auch „gelandetes Raumschiff“ genannt – elegant stützten. Die beiden Frauen wippten von einem Bein aufs andere, schenkten der Schutz gewährenden Architektur des Bernhard Pfau, der ja immerhin auch das Schauspielhaus der Landeshauptstadt Düsseldorf gestaltet hat, offensichtlich keine Beachtung und froren trotz warmem Rauch. Kein Wunder, denn das Thermometer war weit unter Null gefallen.
Ich passierte die Raucherzone, öffnete eine der sechs Glastüren und befand mich in der hellen Eingangshalle, wo mich wie erhofft eine angenehme Wärme empfing. Schnell durchquerte ich sie geradlinig und nahm die sechs Stufen zur Mensa mit morgendlichem Schwung.
Wer sich anders als ich die Zeit nahm, nicht sofort durch die Tür in die Mensa zu hasten, der konnte durch die Aufschrift auf den quadratischen, gläsernen Elementen rechts neben dem Eingang erfahren, dass das Bauwerk am Frankenring als Gebäude der Textilingenieur Schule unserer Stadt in der Zeit von 1952 bis 1958 errichtet worden war und dass zu dieser Zeit ihr Herz die Textilkunst-Klasse des charismatischen Bauhauslehrers Joseph Itten gewesen war. Leider nahm hier die Bedeutung der Textilindustrie in den sechziger Jahren so dramatisch ab, dass das architektonische Kunstwerk 1965 vom Land übernommen werden musste, das es wiederum 1971 mit Eröffnung der Hochschule Niederrhein deren Studenten zur Verfügung stellte.
Wie ich im Seminar für Kunstgeschichte gelernt hatte, wurde 2006 der Fachbereich Design dort zentriert, dessen Wurzeln die ehemalige Werkkunstschule unserer Stadt war, an der als Dozenten oder Studenten neben anderen die Künstler Helmut Macke, Jan Thorn Pricker, Heinrich Campendonk, Jil Sander, Henry van der Velde und Peter Lindbergh gewirkt hatten.
Eigentlich eine Gruppe großer Künstler, dachte ich immer, deren Präsenz an dem Lehrinstitut, wie überhaupt viele der künstlerischen Werte in der Stadt, eher nachlässig in Erinnerung gehalten wurde und daher leider mehr und mehr an Beachtung verlor.
In der Regel liest man als Student diesen Text mit dem Titel „Vision und Perspektive“ höchstens einmal, meist bei Studienbeginn und konzentriert sich danach dann doch eher auf das dahinter liegende kulinarische Angebot.
Die Mensa war noch fast leer, es duftete verführerisch nach Kaffee, Kakao und Gebäck und - der Versuchung wie üblich erlegen - lief ich schnurstracks Richtung Kaffeeautomat, wobei ich mir im Vorbeigehen ein Tablett griff. Diesmal zog ich mir aber nicht etwa wie sonst nur einen einfachen Kaffee, sondern einen Cappuccino, ging zur Kasse, wo ich mir noch einen Schokoriegel dazulegte und bezahlte mit meiner Mensakarte bei der Kassiererin, die mir unter ihrer weißen Kappe wie immer freundlich zulächelte, was ich zu dieser frühen Stunde sehr bewundernswert fand.
Direkt vor einem der wandhohen Fenster fand ich einen freien Platz mit Sicht auf den in rotem Backstein errichteten Seitentrakt, dessen wellenartig gebogene Dachkonstruktion den Blick in den noch immer dunklen Morgenhimmel lenkte und die Schneeflocken die Baukunst in unvorhersehbaren Wirbeln umtanzten. Vor diesem dunklen Hintergrund sah man immer nur gerade die Flockenschwärme, die in den Lichtschein der Gebäudetrakte gerieten. Ein Spektakel, mit dem keine Schneekugel mithalten konnte.
Ich stellte das Tablett auf dem weißen Tisch ab, zog die Mütze und meine Winterjacke aus und legte beides auf einen Stuhl. Dann setzte ich mich auf meinen Galerieplatz, lehnte mich genießerisch in dem stabilen Mensastuhl zurück, spürte die Sicherheit der gebogenen Holzlehne im Rücken, umfasste meinen Becher und ließ die Wärme auf meine Hände übergehen, während ich zusah, wie der Schneefall weiter zunahm.
Ich hätte noch stundenlang dem märchenhaften Schneetreiben zusehen können, aber ich hatte mir vorgenommen, noch vor der ersten Veranstaltung, einer Vorlesung über Kunstgeschichte, in den Arbeitsraum neben der Bibliothek zu gehen.
Als die Hochschule einen großen Nachlass kunst-historischer Bücher und Dokumente geerbt hatte, der nun zu katalogisieren war, hatte ich Glück gehabt und war als zusätzliche, wie leider üblich, zeitlich befristete wissenschaftliche Hilfskraft eingestellt worden. Es würde zu meinem Glück allerdings noch Monate dauern, bis alles vollständig erfasst sein würde.
Leider lag ich ein wenig hinter meinem Zeitplan und wollte den verlorenen Boden wieder gutmachen, indem ich ab und zu morgens etwas eher anfing – noch so ein Vorsatz fürs neue Jahr.
Doch im Augenblick stand mir der Sinn noch gar nicht nach Katalogisieren, denn der Schneewirbel da draußen fesselte mich weit mehr als die Aussicht auf die dort aufgetürmten staubigen Bücher. Außerdem hatte ich meinen Schokoriegel noch nicht ganz aufgegessen, was ich für mich als Grund zur Verzögerung gelten ließ.
Also gab ich mich noch eine Zeitlang dem Tanz der weißen Flocken hin, solange, bis mein Aufbruch nicht mehr länger zu vermeiden war, ohne ein Zeitproblem zu bekommen und ich bedauernd den letzten Schluck Cappuccino austrank, endlich aufstand, meinen pastellroten Stuhl zurück unter die Tischplatte schob, mein Tablett an die Sammelstelle zurückbrachte und mich auf den Weg Richtung Bibliothek machte: die Treppen hoch, durch den langen Gang, links die Bürotüren, rechts die Glasfront mit Blick auf den Frankenring, wo im morgendlichen Berufsverkehr die Karawane der Autos unablässig vorbeizog.
Als „Hiwi“ hatte ich einen Schlüssel für den Arbeitsraum, einen umfunktionierten Büro- und Lager-raum für die Bücher und Dokumente, die aus dem Nachlass eines Düsseldorfer Bankiers stammten. Es hieß, sie hätten große Bedeutung für die lokale Kunstgeschichte, weil es sich fast ausschließlich um Erstausgaben, Kleinstauflagen, Verzeichnisse, Privatdrucke und Manuskripte handelte, die teilweise von mit ihm befreundeten Künstlern stammten, welche auf die eine oder andere Weise mit unserer Stadt im Zusammenhang standen. Darüber hinaus – zur großen Freude unseres Dekans – handelte es sich bei dem Nachlass um eine Schenkung.
Ich schloss also die Tür auf, betrat den Raum und wurde wieder einmal überwältigt vom Anblick der Bücherberge, die auf und vor den Tischen an der Wand gegenüber vom Eingang aufgestapelt waren. Noch beeindruckender waren allerdings die Unmengen von Büchern, die noch in den scheinbar zahllosen Kisten und Kartons ruhten, welche den Rest des nicht gerade kleinen Raumes fast vollständig füllten. Nur sahen diese Kistenstapel bei weitem nicht so malerisch aus wie die Türme der bereits ausgepackten alten Bücher, deren Geruch bereits von dem Raum Besitz ergriffen hatte. Auf dem Tisch links neben dem nicht gerade neuen Rechnermodell, hatte ich meinen „Turm zu Babel“ errichtet – das waren die Bücher und Dokumente, die ich mir am Ende einer Arbeitseinheit schon für das nächste Mal zurechtstellte.
Ich hing meinen blauen Wollmantel an den Wandhalter, schaltete den Erfassungs-PC ein, schaute noch einmal aus dem kleinen und einzigen Fenster in der Wand rechts neben den Tischen, wo der Winter sich immer noch wie von Spitzweg gemalt präsentierte und griff mir die Liste, die vor dem mir am nächsten aufragenden Bücherstapel lag. Jeder Kiste lag eine solche Liste bei, die ihren Inhalt unter Angabe von Autoren und Titeln dokumentierte. Wir Hiwis sollten nun prüfen, ob sich auch wirklich alle angegebenen Dinge in den Kisten befanden und außerdem die möglichst genauen bibliographischen Angaben jedes Buches oder Dokuments in das System eingeben. In der Regel reichte der Inhalt von ein oder zwei Kisten zum Bau meines babylonischen Turmes aus. Als der PC endlich bereit war, fing ich an, die ersten Bücher zu prüfen und zu erfassen, während es draußen langsam heller wurde.
Die Zeit verging wie im Flug und knapp eine Stunde später hatte ich mein von mir vorgesehenes Pensum für diesen Morgen erfüllt und die Vorbereitung für das nächste Mal Bücher stapelnd getroffen – ein gutes Gefühl – und, mit meiner Leistung zu so ungewohnt früher Stunde zufrieden, schaltete ich den PC aus.
Die neu erfassten Bücher stellte ich abschließend in die Regale an der Wand, die sich dem PC-Tisch gegenüber befand. Die Professoren wollten sich irgendwann später die Liste der erfassten Werke anschauen, um zu entscheiden, was damit geschehen sollte. Die meisten sollten wohl in den Archivbestand übergehen, manche in den Präsenzbestand, einige sogar in die Ausleihe. Was absolut unbrauchbar war, würde zum Verkauf oder kostenlos den Studierenden angeboten werden, aber das würde nicht viel sein, soviel stand schon fest.
Bester Laune schloss ich den Arbeitsraum ab und ging zum kleinen Hörsaal, wo ich meine Kenntnisse in Kunstgeschichte aufbessern wollte.
Die Vorlesung war gut besucht, der Raum war erfüllt von mehr oder minder leise geführten Gesprächen und es roch nach feuchter Kleidung. Überall lagen Schals, Jacken, Mützen und Handschuhe auf den Ablageflächen. Nach einigem Suchen fand ich einen Sitzplatz in der drittletzten Reihe. Neben mir saß in grauer Multifunktionsjacke und unrasiert einer der älteren Studenten und Dauer-Gasthörer, von denen es einige an der Hochschule gab. Keiner wusste genau, seit wann er eigentlich schon die Veranstaltungen besuchte. Selbst die Studierenden, welche die größte Anzahl an Semestern hinter sich hatten, konnten sich daran erinnern, dass er schon bei ihrem Einstiegssemester dabei gewesen war. Man munkelte, dass er früher einmal Kunsthändler gewesen war, der sich zur Ruhe gesetzt hatte und jetzt noch die Wissenslücken füllen wollte, die er während seiner Berufstätigkeit aus Zeitnot nicht hatte füllen können. Er nickte mir freundlich zu und ich nickte genauso zurück. Das Designstudium an unserer Hochschule hatte schon etwas Familiäres und das wiederum bestärkte mich in meiner Entscheidung, das Sprachstudium nicht zu Ende geführt und mich für eine andere kreative Studienrichtung entschieden zu haben.
Dann betrat mit immer wieder beeindruckender, von einigen Studentinnen unverhohlen bewunderter, schwarzer Lockenpracht und mit schwungvollen, klackenden Schritten der Dozent Viktor Dorm den Saal, der trotz seiner Jugend und noch kurzer Lehrtätigkeit ein geschätzter Kunsthistoriker war.
Mit auf sein Manuskript fokussiertem Blick stellte er sich hinter das Pult und ließ, nachdem er sich gesammelt hatte, seinen Blick kurz und betont gelangweilt in die Runde schweifen. Er kratzte wie gedankenverloren seinen gepflegten Dreitagebart, schüttelte kurz seine Mähne, senkte den Blick wieder auf sein Papier und legte in gewohnt resigniertem, aber zugegeben auch außerordentlich angenehm klingendem Tonfall los, der, wie ich vermutete, uns Wissbegierigen signalisieren sollte, dass all seine weisen Worte von solch schlichten Gemütern wie den unseren sowieso niemals verstanden werden könnten.
Heute war die Pop Art das Thema und mein Sitznachbar, der diese Phase wohl noch als junger Mann miterlebt hatte, kommentierte den Vortrag Dorms hier und da mit missbilligendem Schnauben.
Für mich war die Vorlesung allerdings sehr unterhaltsam, weil mir die Ideen und Werke der besprochenen Künstler gefielen. Du malst eine Dose Tomatensuppe in Öl auf eine Leinwand, vervielfältigst das Ganze, erklärst der verblüfften Kunstwelt, dass du damit dem elitären Kunstverständnis der Zeit widersprechen willst und schon kannst du dich vor interessierten Kunstsammlern nicht retten, die diesen neuen Trend und somit die Gelegenheit, eine lohnende Investition zu tätigen, nicht verpassen wollen. Zugegeben, vielleicht eine etwas vereinfachende Sicht des Kunstmarktes, aber ich gebe den Verdacht nicht auf, hier nicht ganz falsch zu liegen.
Die Vorlesung dauerte eineinhalb Stunden und endete mit Dorms bekanntem Aufruf, das quasi vor der Haustür stehende Kaiser Wilhelm Museum zu besuchen, in dem etliche Meisterwerke nicht nur der besprochenen Kunstrichtung zu sehen wären - wenn auch leider nicht mehr Robert Indianas „Great Love“, was 2008 mit der gesamten Sammlung Lauffs abgegeben werden musste - aber immerhin noch zum Beispiel die Werke von Joseph Beuys. Zuletzt gab uns Dorm noch ein paar Lektürehinweise zur Vor- und Nachbereitung, dann war die Veranstaltung beendet und er ging, wie er gekommen war: Klick, klack…
Durch das lange Sitzen etwas ungelenk geworden, stand ich auf und beschloss, nochmal in die Mensa zu gehen. Der Ruf des Kaffee-Automaten war unüberhörbar - und nicht nur für mich.
„Hallo Jo!“
Jemand klopfte mir von hinten leicht auf die Schulter und ich drehte mich um.
Na klar, eigentlich konnte es nur Ly sein, die mich wie die meisten immer „Jo“ und nicht „Johannes“ nannte, wobei sie tatsächlich nur „Jo“ sagte und diese Abkürzung nicht wie das englische „Joe“ aussprach. Ly war Chinesin, 25, im dritten Semester und hatte schon erstaunlich gut Deutsch gelernt. Meistens trug sie Kleidung in rot und schwarz, heute einen schwarzen Rollkragenpullover zum schwarzen Rock und schwarzen Stiefeln, dazwischen eine rote Strumpfhose und zusätzlich noch eine rote Schleife um ihr zum Pferdeschwanz gebündeltes glänzend schwarzes Haar. Als Model hätte Ly sicher überall gute Chancen gehabt, aber mich erinnerte sie in ihren Rot-Schwarz-Kombinationen seltsamerweise immer an einen Marienkäfer.
„Gehst Du auch in die Mensa?“, wollte sie wissen.
„Ja, sicher“, antwortete ich, „wie war’s in den Ferien?“
„Sehr schön!“, sagte sie und nickte heftig.
„Wir waren in den Bergen, in der Eifel.“
Berge in der Eifel waren mir eigentlich nicht bekannt, Hügel schon, aber weil ich der begeisterten, zierlichen Ly nur ungern widersprechen wollte oder vielleicht nur nicht genug über die Eifel wusste, beließ ich es dabei.
Wir kehrten zurück in die Eingangshalle, in der mittlerweile ein reges Kommen und Gehen herrschte.
„Hattet Ihr Schnee?“, nahm ich den Gesprächsfaden wieder auf.
„Nein, immer Regen, aber war trotzdem schön.“
„Eifel eben“, konnte ich mir nicht verkneifen.
Ly hatte einen deutschen Freund, Max, der aus Kalterherberg stammte und anscheinend waren sie während der Feiertage und zur Jahreswende dort gewesen. Max war eigentlich schon ausgebildeter Schreiner, studierte aber jetzt noch zusätzlich Design und hatte sich auf Graphik spezialisiert. Den etwas ungeschlachten, aber in sich ruhenden und immer freundlichen Max mochte ich gut leiden und wenn ich die beiden gemeinsam sah, hatte ich den Eindruck, dass sich hier genau die Richtigen gefunden hatten.
Ganz Gentleman hielt ich ihr die Tür auf. Sie lächelte und huschte an mir vorbei in die Mensa, wobei mich ihr unaufdringliches Parfüm kurz an blühende Apfelbäume denken ließ. Gemeinsam gingen wir zum Kaffee-Automaten, umgeben vom Gemurmel und vereinzeltem Lachen der zahlreichen Kommilitonen und Kommilitoninnen, die gut die Hälfte der pastellfarbenen Stühle besetzt hatten.
„Nie weiß ich, was ich auswählen soll.“
Ly schaute verzweifelt.
„Nimm Cappuccino – der schmeckt voll gut.“
Sie nickte entschieden und drückte die Taste für Milchkaffee – typisch Ly.
Ich folgte meiner eigenen Empfehlung und wir steuerten einen Fensterplatz an, wo wir uns aus unseren Mänteln schälten und uns auf den bewährten Holzstühlen niederließen.
Der erste Schluck war immer der beste.
Draußen war es mittlerweile hell geworden, soweit man das an einem Januartag behaupten kann. Es schneite immer noch.
„Hast Du mit Max’ Familie Weihnachten gefeiert?“
Sie lachte zurückhaltend.
„War sehr lustig.“
„Kann ich mir ungefähr vorstellen. Eine Weihnachtsfeier muss ja auf jemanden, der aus China kommt, ziemlich seltsam wirken.“
Sie schüttelte den Kopf bedächtig.
„Lustig, aber kann man verstehen. Max hat mir alles erklärt: Ist das Fest der Liebe und der Familie“, und sie zupfte an ihrer roten Haarschleife, während sie abwechselnd in ihren dampfenden Becher und nach draußen schaute.
Sie war wirklich ausgesprochen hübsch und Max ein Glückspilz.
Auch ich würde in diesem Jahr meine große Liebe finden. Zumindest war das ein weiterer meiner Vorsätze fürs neue Jahr.
„Hallo, meine Süßen!“ tönte es unvermittelt von der Seite her und aufgeschreckt stellten wir fest, dass sich unser Mitstudent Jean-Marie, der eigentlich Paul hieß, angeschlichen hatte, um uns zu überraschen. Er trug eine sehr enge, blaue Hose und ein gelbes Rüschenhemd, wie immer kaum ein Finger ohne Ring. Sein schmales Gesicht war leicht geschminkt und seine blonden Haare wurden schwungvoll mit Gel in Form gehalten. Eigentlich ein netter Kerl, nur meistens so aufdringlich schwul, dass es schnell unerträglich wurde.
Jean-Marie setzte sich auf den Platz neben Ly und nahm sie überschwänglich in den Arm, bevor er meine rechte Hand zur Begrüßung in seine beiden Hände einschloss.
„Hattet ihr auch so eine wundervolle Weihnachtszeit?“, wollte er in seiner gedehnten Art zu sprechen wissen und ohne die Antwort abzuwarten, fuhr er fort:
„Karel und ich hatten es so wunderschön all die Tage. Die ganze Wohnung geschmückt, überall kleine, nackte Engel...“
Karel war sein neuer Freund, den er vor ein paar Wochen kennengelernt hatte. Ein Holländer aus dem nicht weit entfernten Venlo, der eine Wohnung in unserer Stadt gemietet hatte, weil er hier bei einer Unternehmensberatung einen Auftrag angenommen hatte.
„Habt ihr euch auch was Schönes geschenkt?“, fragte Ly.
Darauf hatte Jean-Marie nur gewartet und mit einem durchtriebenen Lächeln und verschwörerischem Augenaufschlag legte er los.
„Aber natüüürlich! Wir hatten doch uns. Und zur Bescherung hat mir mein Karel...“
Ly lief nach den ersten Details puterrot an und mein Beschützerinstinkt erwachte.
„Tut mir echt leid, Jean-Marie“, unterbrach ich ihn, „aber ich muss noch etwas arbeiten, in der Shedhalle. Meine Formen müssten fertig sein.“
Das entsprach übrigens der Wahrheit, denn da ich noch ein wenig unentschlossen war, in welche kreative Richtung ich mich letztendlich entwickeln wollte, hatte ich auch einen Keramikkurs begonnen.
Rasch stand ich auf, Ly ebenfalls.
„Da muss ich auch hin“, schloss sie sich mir heftig nickend an.
Aber so leicht sollten wir nicht davonkommen.
„Na sowas, da können wir ja zusammen hingehen“, und mit diesen Worten erhob sich nun leider auch Jean-Marie, um sich uns anzuschließen. Hätten wir gewusst, was uns bevorstand, wären wir wohl alle in der Mensa geblieben.
Um in die Shedhalle zu kommen, mussten wir den Haupteingang und leider auch die Geborgenheit der Mensa hinter uns lassen und rechts um das Haupthaus zum Gebäude O herumlaufen, in dem sich vor allem die Keramikschaffenden aufhielten. Mittlerweile war der Schnee knöchelhoch und knirschte heimelig bei jedem Schritt.
Wir liefen geduckt und von Schneeflocken umwirbelt auf den Gebäudetrakt zu, dessen Dach sich wie zwei nach rechts strebende Wellen vor uns erhob und dem eher bieder wirkenden Backsteinbau einen eleganten Abschluss nach oben hin verlieh.
Wir beeilten uns, die kurze Strecke zurückzulegen und öffneten die schwere Brandschutztür so schnell es ging. Angenehme Wärme flutete uns entgegen.
Auf kurzem Weg erreichten wir den Tonraum, wo auf weißen Tischtüchern die neuesten Gefäße, Schalen und Freiformen irgendeines Kurses wohl für eine anstehende Präsentation aufgestellt worden waren: Avantgardistisches und Traditionelles nebeneinander. Jedoch hatte ich kaum Zeit, mir die Werke meiner Mitstudierenden in Ruhe anzuschauen, denn Ly eilte mit kurzen, trippelnden Schritten rasch voran, gefolgt von Jean-Marie und mir, der ich mich bemühte, den Anschluss nicht zu verlieren.
Kurz vor unserem Ziel trafen wir auf dem Flur den Werkstattleiter Egger, wie immer in grauem Arbeitskittel. Wir mochten den kleinen Kauz, der mich mit seiner Glatze und dem passend grauen Vollbart an einen Hobbit erinnerte und der schon seit vielen Jahren hier sein Bestes gab, um mit seinen Fachkenntnissen die Studierenden in ihrer künstlerischen Entwicklung weiter zu bringen.
„Hallo, Herr Egger“, rief ich ihm zu, woraufhin er leicht abwesend eine Hand zum Gruß hob und uns ausgesprochen freundlich anlächelte.
„Hi“, grüßte er zurück, während wir an ihm vorbeiliefen.
„Mal wieder im Auenland, wo das Gras so schön blüht“, bemerkte Jean-Marie, als er außer Hörweite war.
Wir nickten zustimmend, wohl wissend, dass sein Laster Egger nicht darin beeinträchtigte, ein hervorragender Werkstattleiter und Ratgeber zu sein.
Wir erreichten den Arbeitsraum, an dessen Decke große Belüftungsrohre für Luftqualität sorgen sollten und in dem, mit feinem Ton- und Gipsstaub bedeckt, nicht nur die Drehscheiben auf den Tischen an den Wänden standen, sondern auch Maren und Alex auf uns warteten, die ich hier zu treffen gehofft hatte.
„Ja, da seid ihr ja!“, begrüßte uns Maren wie immer laut und überschwänglich und da wir sie alle schon lange kannten und mochten, wussten wir, was jetzt kommen würde. Sie breitete ihre gewaltigen Arme aus und drückte zuerst Ly, dann Jean-Marie und zuletzt mich an ihre gipsgetränkte Schürze, dass uns die Luft wegblieb.
„Ein frohes neues Jahr, ihr Lieben“, rief sie aus und ihr von braunen Locken umrahmtes, rundes Gesicht strahlte uns mit geröteten Wangen freudig an.
„Frohes neues Jahr!“, wünschte daraufhin auch Alex und drückte uns Neuankömmlingen wohlerzogen die Hand, bevor er seine braun gefasste Brille gerade rückte.
Jean-Marie ließ seinen Blick schweifen und bekam große Augen.
„Nein, wie ist das wundervoll!“
Er beugte sich über die Objekte, an denen Alex und Maren wohl bis eben gearbeitet hatten.
Maren hatte so etwas wie einen Engel gebaut, der sowohl Ähnlichkeit mit dem Michelin-Männchen als auch mit Maren hatte.
„Diese Energie, diese Körperlichkeit – Maren, du bist einfach begnadet, einfach begnadet.“
„Wie nennst du dein Werk denn?“, wollte er wissen.
„Der Mitternachtself“, gab Maren bereitwillig Auskunft.
„Ach tatsächlich“, sagte Jean-Marie verständnislos.
Die begnadete Künstlerin schaute Jean-Marie nachsichtig an und hob beide Hände: „Ich glaube, der große Ofen ist gleich fertig, dann wird aus- und eingeräumt und los geht’s mit dem nächsten Brand. Hoffentlich fällt er dann nicht zusammen.“
„Ja, das wäre dann wohl wirklich schlimm“, bemerkte Jean-Marie in zweideutigem Tonfall. Seine Vorliebe, alles und jedes sexuell zu interpretieren, sorgte immer wieder für allgemeines Fremdschämen.
Noch während Maren hilfesuchend Richtung Hallendecke blickte und Ly wieder rot anlief, wandte sich Jean-Marie Alex’ Werk zu.
„Ja, was haben wir denn hier?“, fragte er scheinbar begeistert und stürzte sich auf die circa 40 Zentimeter hohe, pfahlartige Skulptur.
„Das wird eine sensorgesteuerte Lampe“, erklärte Alex und schob seine Brille wieder zurecht, die gut zu seinem kurzen dunkelbraunen Haar und seinen braunen Augen passte.
„Aha“, staunte Jean-Marie.
„Ich habe ein Programm geschrieben, das je nach den gemessenen Daten erkennen kann, ob ein Mensch oder ein Tier den Raum betritt. Hier oben wird eine kleine Webcam eingebaut, die die Bewegungen erfasst und an einen kleinen Prozessor weitergibt, der die Bewegungsmuster dann auswertet. Je nach Muster wird dann entschieden, wie hell die Lampe leuchten soll und ob sie ein warmes oder eher kaltes Licht abgeben soll. Ich nenne es „Hi!-Light“.“
Ly blickte Alex bewundernd an, während Maren eher unbeeindruckt an ihrem riesigen rechten Ohrring spielte. Jean-Marie schüttelte ungläubig den Kopf und klatschte in die Hände.
„Was du aber auch immer für tolle Ideen hast!“
„Ich habe auch eine tolle Idee“, unterbrach Maren, wie immer auf das Wesentliche achtend, die Kunstbetrachtung.
„Wir könnten jetzt alle etwas Süßes gebrauchen. Ich habe für uns alle Brownies gebacken und koche uns jetzt erst einmal ein paar Tassen Kaffee.“
„Geniale Idee“, bemerkte ich, denn von Kaffee konnte ich in dieser kalten Jahreszeit nie genug bekommen.
Während Maren in den Nebenraum ging, wo es eine kleine Kochnische gab, fragte Alex:
„Und wie ist es euch ergangen? Wart ihr weg?“
Und schon erzählte Jean-Marie ausführlich von Karels Weihnachtsbescherung, während Lys Wangen sofort wieder an Farbe gewannen.
„Ich war auch nicht weg“, unterbrach ich seine ausschweifende und leider auch sehr detailreiche Erzählung, „aber ich habe endlich mein Referat über die keramischen Arbeiten Picassos in den sechziger Jahren zu Ende geschrieben.“
Alle schienen beeindruckt.
„Und dann habe ich im Netz noch einen Fotoapparat ersteigert. Ich will im nächsten Semester den Fotokurs belegen.“
„Das habe ich auch vor“, sagte Ly.
„Nur habe ich noch keinen Fotoapparat.“
„Ich kann Dir meinen leihen, meine Liebe“, bot Jean-Marie spontan an und erkundigte sich umgehend, was Ly denn eigentlich noch außer ihrem Eifelurlaub in der vorlesungsfreien Zeit erlebt hatte.
Ly hatte nach ihrem Ausflug in die von mir immer noch angezweifelten Eifelberge hauptsächlich gearbeitet. Sie half in einem Restaurant aus und finanzierte so ihr Studium. Als sie im zweiten Semester war, waren ihre Eltern bei einem Hausbrand ums Leben gekommen, worauf sie beschloss, nicht mehr nach China zurückzukehren, was sich aber nicht so ganz einfach umsetzen ließ, weil ihre Aufenthaltserlaubnis begrenzt war. Daher vermuteten wir alle, dass sie über kurz oder lang Max heiraten würde.
„Und ich habe viel gezeichnet. Ganz viel“, fügte sie ihrem Bericht hinzu.
Alex schaute sie bewundernd an, denn das Zeichnen war seine schwache Seite.
„Und was hast du gezeichnet?“, wollte Jean-Marie wissen.
Doch bevor er eine Antwort bekam, kehrte Maren mit einem großen Tablett, auf dem es aus den Bechern heimelig dampfte, aus dem Nebenraum zurück, wobei sie sich trotz ihrer Körperfülle elegant an den zahlreichen Tischen vorbeibewegte.
„Der Kaffee ist fertig“, verkündete sie und stellte ihre duftende Last ab.
Jeder nahm sich ein Getränk und einen Brownie, Maren erhob ihren Becher.
„Auf ein aufregendes neues Jahr, meine Lieben!“
Wir stießen mit den Bechern wie mit Sektgläsern an und erhoben sie zum Toast, nicht ahnend, wie aufregend dieses Jahr für uns beginnen sollte.
Als wir nach Plaudern und Lachen schließlich ausgetrunken hatten, wendeten wir uns wieder unserer Arbeit zu. Ly und ich holten unsere unfertigen Formen aus den Wandregalen und versuchten, die Unregelmäßigkeiten durch vorsichtiges Abreiben und Schleifen zu beseitigen.
Maren ging hin und wieder zum größten der Öfen und prüfte, wie lange dieser noch brauchte. Sie hatte ihn am Vortag mit hasenartigen Figuren gefüllt, die sie geschäftstüchtig vorausblickend hier für ihren privaten Osterverkauf anfertigte. Die Uhr auf dem großen, rechteckigen Körper des Ofens ungeduldig betrachtend seufzte sie ab und zu schwer und stemmte ihre Fäuste in ihre üppigen Hüften. Zwischendurch kehrte sie immer wieder zur Werkbank zurück, wo sie mit der Produktion einer weiteren Hasenfamilie begonnen hatte. Ly summte melodisch vor sich hin, Alex schwieg konzentriert, während er versuchte, eine Kabelverbindung in seinem Objekt zu verlegen und Jean-Marie bearbeitete mit seinen schlanken Fingern einen Klumpen Ton, den er sich frisch geholt hatte, ohne dass erkennbar wurde, worauf seine schöpferischen Bemühungen hinauslaufen sollten.
So verging die Zeit in kreativer Konzentration, bis Maren nach ungefähr zwei Stunden dem unfertigen Hasen vor sich mit der flachen Hand den Todesstoß versetzte und zu dem Schluss kam:
„So, Leute, der Ofen braucht ja doch noch einige Zeit. Ich glaube, ich habe jetzt Hunger. Kommt ihr mit?“
Für jede Ablenkung zu haben, klopften wir uns den Staub von den Kleidern und verließen gemeinsam die Werkstatt. Der Schneefall hatte nachgelassen, aber nicht aufgehört. Mittlerweile war die Schneedecke weiter gewachsen und obwohl ich Stiefel trug, rutschte mir hin und wieder Schnee hinein und ließ meine Socken feucht werden. Mich wunderte, dass Ly nicht an den Beinen fror.
Als ich an diesem Tag zum dritten Mal in die Mensa kam, war der große Raum immer noch gut gefüllt und wir hatten großes Glück, dass wir noch einmal einen Platz am Fenster bekamen. Der Kaffeegeruch wurde von Bratenduft überlagert, denn als Hauptgericht gab es Rinderbraten mit Rotkohl.
Maren hatte sich die größte Portion aufgeladen. Sie war ungefähr 1,80 Meter groß und man sah ihr immer mehr an, dass sie seit einiger Zeit zu größeren Portionen neigte. Jean-Marie hatte die Vermutung geäußert, dass es da einen Zusammenhang zu ihrem Liebesleben geben sollte, aber da gingen die Meinungen auseinander.
Sie zeigte mit ihrer Gabel Richtung Eingang.
„Die drei heiligen Könige sind auch wieder da.“
Wir blickten Richtung Eingang. Der Dekan Professor Oldenburg und die Dozenten Dorm und Delius gingen in heftige Diskussion vertieft Richtung Essenstheke.
Oldenburg führte das Wort und selbst aus weiter Entfernung konnte man sehen, dass eine gewisse Überheblichkeit in seinen Gesten lag. Dorm schien dagegen zu halten, während Delius ab und zu höflich lächelnd Einwände zu machen schien. Sie führten ihre Diskussion fort, bis sie sich an einem Tisch in einiger Entfernung von uns niederließen. Als Delius vermutlich in seiner manchmal doppelbödig humorigen Art irgendetwas sagte, lachten sie alle drei plötzlich laut auf und begannen daraufhin ihre Mittagsmahlzeit.
„Worüber die wohl wieder diskutiert haben“, wollte Jean-Marie wissen.
„Wissenschaftler haben immer was zu diskutieren“, warf Alex nüchtern ein.
„Du meinst wohl zu streiten“, berichtigte Maren.
“Vielleicht ging es um die Seminarinhalte fürs nächste Semester?“, gab Ly zu bedenken.
„Gerade wegen unserer Historie müssen wir die regionalen Künstler mehr in den Fokus unserer Lehre stellen!“, ahmte Jean-Marie den Dozenten Viktor Dorm nach.
„In einer globalisierten Gesellschaft sollten wir uns nicht zu Sklaven einer lokalen Kunstbetrachtung machen!“, konterte Alex, indem er den melodischen, stets aber hintergründigen Tonfall von Franz Delius imitierte.
„Die Grundpfeiler der Lehre stehen auf einem finanziellen Fundament, das imstande sein muss, diese auch zu tragen!“, ergänzte ich die Reihe der geflügelten Worte, indem ich einen der Lieblingssätze des Dekans zum Besten gab.
Wir lachten leise, bemüht, dabei nicht in die Richtung des Dozententisches zu schauen, nur Alex blieb nachdenklich.
„Wusstet ihr, dass im nächsten Semester eine Dozenten-Planstelle zwei befristete ersetzen soll?“
„Und was heißt das genau?“, wollte Jean-Marie wissen.
„Das heißt, mein Schatz“, erklärte Maren mit erhobenem Zeigefinger, „dass einer von zwei befristet angestellten Dozenten eine feste Stelle bekommt, was ja sehr erfreulich ist und dass ein anderer seinen Job verliert, was gar nicht erfreulich ist.“
Jean-Marie machte große Augen.
„Das ist bitter.“
„Zumindest für den anderen“, bemerkte Alex in seiner gewohnt trockenen Art.
Wir schwiegen, wohl weil jeder von uns darüber nachdachte, wen es dann treffen würde. Die beiden heißesten Kandidaten saßen drüben am Dozententisch.
Ich blickte in die Runde.
„Wo ist eigentlich Tristan?“
Alle schauten mich erstaunt an.
„Stimmt, ich habe ihn auch noch nicht gesehen“, sagte Ly und machte große Augen..
Tristan, Ly und ich arbeiteten gemeinsam an der Katalogisierung des Bankiersnachlasses und hatten uns vor den Ferien häufig im Erfassungsraum getroffen.
„Vielleicht fangen seine Vorlesungen erst morgen oder übermorgen an“, vermutete Alex.
„Ich habe noch ein Buch von ihm, das er mir für mein Referat geliehen hatte“, fiel mir ein.
„Benno habe ich auch noch nicht gesehen“, stellte Ly fest.
„Benno ist krank“, sagte Alex, „hat er mir vorgestern im Chat geschrieben.“
„Dann bestelle ihm mal gute Besserung von uns“, bat ich ihn und Alex nickte.
„Wer möchte noch einen Kaffee oder Tee?“, fragte Maren und stand auf.
Jeder gab noch eine Bestellung auf und wir tranken noch eine Runde im Lichte von scheinbar zahllosen kreisförmigen Leuchtkörpern, die wie Heiligenscheine von der Hallendecke auf Studierende und Dozierende gleichermaßen herabschienen.
So unterhielten wir uns noch eine Weile, während draußen Kälte und Schneefall wieder zunahmen, doch als die Becher geleert waren, gab wieder einmal Maren das Signal zum Aufbruch:
„Es ist nach zwei, ich glaube, der Ofen müsste jetzt fertig sein und ich kann meine neuen Rohlinge einstellen. Ich gehe dann mal jetzt los, bevor jemand anderes die Chance nutzt und ihn füllt.“
Seufzend packten wir unsere Sachen zusammen, schoben die Stühle an den Tisch, brachten die Tabletts zurück und machten uns auf den Weg.
Auch mein Fahrrad war mittlerweile gut von Schnee bedeckt, wie ich mit einem kurzen Blick feststellte, als wir aus dem Hauptausgang herauskamen und im Laufschritt dem Gebäude O entgegenliefen.
Alex war als erstes am Eingang der Shedhalle und öffnete die Tür für uns. Wir huschten hinein und erreichten kurz darauf unsere Werkplätze.
Maren band sich ihre Schürze um und lief in den Brennraum, in dem die drei beeindruckenden Brennöfen, nach Größe angeordnet, an der Wand aufgereiht standen.
„Ha!“, brachte sie nach einem kurzen Blick auf die Anzeige des Ofens triumphierend hervor.
„Nur noch 40 Grad - endlich fertig.“
Sie klatschte voller Vorfreude in die Hände.
Alex zeigte mit dem Daumen nach oben und blickte sie aufmunternd an. Wir wussten, dass es trotz aller Vorsicht immer noch passieren konnte, dass ein Objekt den Brand nicht wie geplant überstand und man den ganzen Prozess wiederholen musste.
Deshalb blickten wir drei aus einiger Entfernung gespannt zu Maren, die vor dem größten der Brennöfen stand und den Öffnungsmechanismus betätigte.
Sie fasste den linken Griff der schweren Stahltür und zog sie mühelos, aber dennoch erwartungsvoll langsam auf. Es ist immer noch jedes Mal ein spannender Moment, einen Ofen zu öffnen und sich vom Erfolg oder Misserfolg des Brennvorgangs überraschen zu lassen.
Wie lange sie starr in den Ofen blickte, kann ich nicht mehr sagen, aber ich weiß noch genau, wie sie plötzlich mit einem markerschütternden Dauerschrei und ausgebreiteten Armen nach hinten taumelte, bis sie mit dem Rücken heftig an die weiße Wand und mit den Händen an ein Regal stieß und langsam abwärts rutschte, während mehrere der Objekte aus dem Regal am Boden zerschellten.
„Komm, Schätzchen, so schlimm sind Deine Häschen nun auch wieder nicht“, versuchte Jean-Marie zu beschwichtigen. Doch als wir zu Maren liefen, um sie zu trösten, merkten wir rasch, dass mehr hinter ihrem Entsetzen steckte als gedacht, denn vom Ofen her kam uns ein schneidender, süßlicher, den Atem zum Stocken bringender Gestank entgegengeweht, der nun auch Jean-Marie würgend auf die Knie zwang.
„Und wer hat die Leiche entdeckt?“
Hauptkommissar Martin stand neben dem Tisch und blickte leicht irritiert auf Marens Mitternachtself, während er mit uns sprach, sein Notizbuch in der linken, einen Kugelschreiber in der rechten Hand. Seine stämmige Gestalt und Körperhaltung, die in dem braunen Ledermantel an einen Bär erinnerte, gab seiner Frage besonderen Nachdruck. Offensichtlich war der Mantel gut gefüttert, denn auf dem etwas aufgedunsenen Gesicht des Polizisten zeigten sich Schweißperlen, was ihn aber nicht dazu brachte, die Knöpfe des Kleidungsstücks zu öffnen.
Nach einem kurzen Blick auf Maren, die immer noch blass auf einem Drehschemel saß, meldete sich Alex zu Wort.
„Das war Maren, Maren Friedrich.“, und er deutete in ihre Richtung.
Der Hauptkommissar wandte sich der noch immer vom Entsetzen gezeichneten Künstlerin zu und sparte sich daraufhin die Fragen, die er eigentlich stellen wollte. Stattdessen sagte er: „Der Psychologe wird gleich hier sein und sich um Sie kümmern. Wenn es Ihnen besser geht, wird Frau Becker Ihnen ein paar Fragen stellen müssen.“
Maren blickte ihn nur verständnislos an und Ly streichelte ihr beruhigend die Schultern.
Auf dem Stuhl neben Maren saß Jean-Marie und schüttelte ungläubig den Kopf.
Ich stand neben Jean-Marie, als ein Mann im Plastikanzug aus dem Brennraum kam und den Hauptkommissar ansprach.
„Wir können den Toten jetzt abtransportieren, wenn Sie nicht nochmal einen Blick drauf werfen wollen. Die Reste der Figuren, die sonst noch im Ofen waren, nehmen wir mit und untersuchen sie im Labor. Vielleicht hat der Täter darauf Spuren hinterlassen, allerdings besteht da wenig Hoffnung wegen der Hitze. Die Fingerabdrücke vom Ofen werden noch etwas dauern. In einer Stunde müssten wir hier fertig sein.“
„Danke. Ich brauche nichts mehr. Wenn Sie soweit sind, versiegeln wir den Raum“, sagte Martin.
„Und wann kann man die Öfen wieder benutzen?“, meldete sich überraschend Maren zu Wort.
„Ich muss doch meine Objekte fertig...“, sagte sie und die Tränen stiegen ihr in die Augen.
„Das muss jetzt noch etwas warten, Frau Friedrich“, unterbrach sie Martin, worauf Maren wieder in sich zusammensank und Ly sie in die Arme nahm.
Mit lauten Schritten betrat der Dekan den Raum, steuerte direkt auf den Hauptkommissar zu und blickte ungehalten auf den auch nicht gerade kleingewachsenen Beamten herunter.
„Ich bin Professor Oldenburg und Dekan der Hochschule. Was geht denn hier vor? Es ist ein Unfall passiert, hat man mir berichtet?“
Martin zog die linke Augenbraue hoch und blickte unbeeindruckt zu ihm hoch.
„Wenn jemand in einen Brennofen gesperrt und bei ein paar hundert Grad erhitzt wird, kann man wohl kaum von einem Unfall sprechen“, stellte der Hauptkommissar klar.
„Vielleicht ein Schrühbrand“, stellte Alex fachmännisch und gedankenverloren, aber völlig unpassend fest und erschrak über seine eigene Bemerkung.
Martin blickte ihn kritisch von der Seite her an, Jean-Marie begann nervös zu kichern, stand auf und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand.
Professor Oldenburg wedelte hilflos mit den Armen, was bei seiner Größe schon komisch wirkte.
„Hören Sie“, versuchte er es jetzt mit verschwörerischem Unterton, „mir ist schleierhaft, wie das passieren konnte, aber könnten wir das bitte diskret behandeln. Sie wissen ja: Der Ruf des Hauses...in der heutigen Zeit...nicht auszudenken! Und solange noch nichts geklärt ist, muss man ja nicht unbedingt...“
„Herr Professor“, unterbrach ihn der Polizist mit offensichtlich gespielter Nachsicht, „Sie können sicher sein, dass ich mein Handwerk verstehe. Und dazu gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit. Selbstver-ständlich werden wir nicht vorschnell ungesicherte Informationen an die Presse herausgeben.“
Der Dekan wirkte erleichtert und strich sich durch sein sowieso schon zerwühltes Haar.
„Können Sie mir denn Genaueres sagen?“, wollte Oldenburg wissen.
Martin zog die Augenbrauen zusammen und schien nachzudenken.
„Ja, aber das sollten wir nicht hier besprechen, Herr Professor. Sie haben sicher ein Büro.“
„Aber natürlich, folgen Sie mir bitte“, antwortete Oldenburg und mit diesen Worten schwenkte der Dekan um 180 Grad, wobei sein wallendes, lockiges rotes Haar die Bewegung imposant unterstrich und lief mit weit ausholenden Schritten dem Ausgang entgegen. Hauptkommissar Martin wandte sich noch einmal an uns.
„Sie bleiben bitte hier. Kommissarin Becker wird gleich hier sein und Sie alle einzeln vernehmen. Gehen Sie also bitte nicht weg.“
Mit diesen Worten drehte auch er sich nicht ganz so schwungvoll um und folgte so schnell er konnte dem Professor Richtung Ausgang.
Kaum waren der Dekan und der Kommissar verschwunden, da wurde die Tür zum Brennraum geöffnet, zwei der Plastikgestalten trugen eine verschlossene, weiße Bahre heraus und verschwanden ebenfalls durch die Ausgangstür.
„Ich glaube, ich kriege einen Nervenzusammenbruch.“
Jean-Marie rutschte wie zuvor Maren mit dem Rücken die Wand entlang abwärts, bis er auf dem Boden saß und legte sich eine Hand an die Stirn.
Ly setzte sich neben ihn und klopfte ihm beruhigend auf den linken Unterarm.
„War ja auch schlimm“, bestätigte sie voller Mitgefühl.
„Ja, nicht wahr. Der Geruch geht nicht weg und wie das aussah...“
Jean-Marie verzog angeekelt das Gesicht.
„Wie in einem Hockergrab“, versuchte Alex sein Bestes.
„Eher wie eine geplatzte Blutwurst“, meldete sich Maren noch etwas geistesabwesend, aber unüberhörbar wieder zurück, was dazu führte, dass Jean-Marie aufsprang und unter Ausstoß von Würgegeräuschen zum Spülstein im Nebenraum lief.
„Ob das jemand war, den wir kennen?“, gab ich zu Bedenken, um das Gespräch wieder auf eine sachliche Ebene zu bringen.
„Das werden wir sicher bald erfahren“, meinte Alex.
„Hoffentlich nicht – mir wäre es lieber, ich würde den Toten nicht kennen“, flüsterte Ly.
„Ganz meine Meinung“, stimmte ihr Maren zu und stand unbeholfen auf.
„Ich könnte jetzt einen starken Kaffee gebrauchen. Wer noch?“