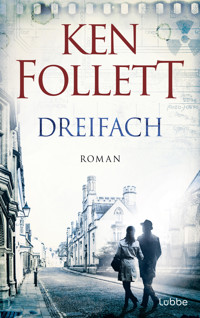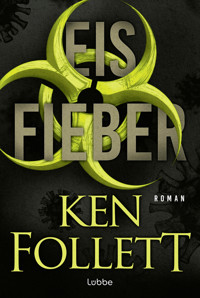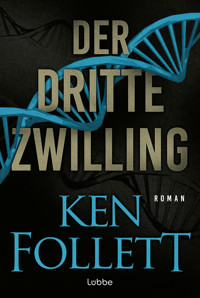
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch gibt es in zwei Versionen: mit und ohne Farbschnitt. Sobald die Farbschnitt-Ausgabe ausverkauft ist, liefern wir die Ausgabe ohne Farbschnitt aus.
Wenn gewissenlose Forscher in ihrem Labor Gott spielen ... Ken Folletts packender Gentechnik-Thriller
Als die Polizei Steve festnimmt und ihm vorwirft, eine junge Frau brutal vergewaltigt zu haben, glaubt er zunächst an ein Missverständnis. Doch das Opfer identifiziert ihn bei einer Gegenüberstellung, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, und auch der DNS-Test ist positiv. Alles spricht gegen ihn. Wie ist das möglich? Hat er etwa einen genetischen Doppelgänger? Steves letzte Hoffnung ist die Zwillingsforscherin Jeannie. Doch je mehr diese über Steves geheimnisvolle Herkunft herausfindet, desto stärker gerät auch sie unter Druck. Hinter Steve erscheint ein ganzes Heer von schattenhaften Gestalten. Jede einzelne von ihnen könnte Jeannies Feind oder ihr Freund sein, ihr Liebhaber - oder ihr Mörder ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 754
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchTitelPrologSonntagKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3MontagKapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13DienstagKapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19MittwochKapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28DonnerstagKapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36FreitagKapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41SamstagKapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50SonntagKapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Kapitel 56Kapitel 57Kapitel 58Kapitel 59Kapitel 60MontagKapitel 61EpilogDanksagungÜber den AutorImpressumÜber dieses Buch
Wenn gewissenlose Forscher in ihrem Labor Gott spielen … Ken Folletts packender Gentechnik-Thriller
Als die Polizei Steve festnimmt und ihm vorwirft, eine junge Frau brutal vergewaltigt zu haben, glaubt er zunächst an ein Missverständnis. Doch das Opfer identifiziert ihn bei einer Gegenüberstellung, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, und auch der DNS-Test ist positiv. Alles spricht gegen ihn. Wie ist das möglich? Hat er etwa einen genetischen Doppelgänger? Steves letzte Hoffnung ist die Zwillingsforscherin Jeannie. Doch je mehr diese über Steves geheimnisvolle Herkunft herausfindet, desto stärker gerät auch sie unter Druck. Hinter Steve erscheint ein ganzes Heer von schattenhaften Gestalten. Jede einzelne von ihnen könnte Jeannies Feind oder ihr Freund sein, ihr Liebhaber – oder ihr Mörder …
Meinen Stiefkindern
Jann Turner, Kim Turner und Adam Broer
in Liebe
Wie ein Leichentuch lag ein Hitzeschleier über Baltimore. In den schattigen Vororten sorgten Hunderttausende von Rasensprengern für Kühle, doch die wohlhabenden Einwohner blieben in den Häusern, in denen die Klimaanlagen auf vollen Touren liefen. An der North Avenue suchten lustlose Stricherinnen den Schutz der Schatten und schwitzten unter ihren Haarteilen, und an den Straßenecken verkauften Kinder Stoff aus den Taschen ausgebeulter Shorts. Es war Ende September, doch der Herbst schien noch in weiter Ferne.
Ein rostiger weißer Datsun fuhr gemächlich durch ein von Weißen bewohntes Arbeiterviertel nördlich der Innenstadt. Ein Scheinwerferglas des Wagens war zerbrochen; die Scherben wurden mit einem Kreuz aus Klebeband zusammengehalten. Das Auto besaß keine Klimaanlage, und der Fahrer, ein gut aussehender Mann Anfang zwanzig, hatte sämtliche Fenster heruntergekurbelt. Er trug abgeschnittene Jeans, ein weißes T-Shirt und eine rote Baseballmütze, auf der vorn in großen Buchstaben das Wort SECURITY stand. Unter seinen Oberschenkeln war die Kunststoffbespannung des Sitzes glitschig von seinem Schweiß, doch er ließ sich nicht davon stören. Er war bester Laune. Das Autoradio war auf den Sender 92Q eingestellt – »Zwanzig Hits Schlag auf Schlag!« Auf dem Beifahrersitz lag eine aufgeschlagene Mappe. Hin und wieder warf der Mann einen Blick darauf und lernte für eine Prüfung am morgigen Tag technische Begriffe auswendig, die auf einer maschinengeschriebenen Seite standen. Das Lernen fiel ihm leicht; nach wenigen Minuten hatte er sich alles eingeprägt.
An einer Ampel hielt eine Frau in einem Porsche-Cabrio neben ihm. Er grinste sie an und sagte: »Schickes Auto!« Die Frau schaute weg, ohne ein Wort zu erwidern, doch der Mann sah den Anflug eines Lächelns in ihren Mundwinkeln. Hinter ihrer großen Sonnenbrille war sie vermutlich doppelt so alt wie er; das galt für die meisten Frauen, die in Porsches saßen. »Wer als Erster an der nächsten Ampel ist, hat gewonnen«, sagte er. Die Frau lachte – ein kokettes, melodisches Lachen –; dann stieß sie mit ihrer schmalen, gepflegten Hand den Schalthebel nach vorn, und der Wagen schoss wie eine Rakete von der Ampel los.
Der Mann zuckte mit den Schultern. Er übte ja bloß.
Er fuhr am bewaldeten Campus der Jones-Falls-Universität vorüber, einer Elitehochschule, die sehr viel renommierter war als die Uni, die er besuchte. Als der Mann das prunkvolle Eingangstor passierte, kam eine Gruppe von acht oder zehn Frauen im lockeren Laufschritt vorüber: enge Shorts, Nike-Sportschuhe, verschwitzte T-Shirts und rückenfreie Tops. Eine Feldhockeymannschaft beim Training, dachte sich der Mann im Wagen, und die durchtrainierte junge Frau an der Spitze war wohl die Mannschaftsführerin, die ihr Team für die Saison in Form brachte.
Die Gruppe bog in den Campus ein, und plötzlich überkam den Mann ein so übermächtiges, erregendes Fantasiebild, dass er kaum mehr weiterfahren konnte. Er stellte sich die Frauen im Umkleideraum vor – die Dickliche, wie sie sich unter der Dusche einseifte; die Rothaarige, wie sie sich ihre kupferfarbene Mähne abtrocknete; die Farbige, wie sie sich ein weißes spitzenbesetztes Höschen anzog; die lesbische Mannschaftsführerin, wie sie nackt umherging und ihre Muskeln zur Schau stellte – und wie etwas geschah, das die Mädchen in Angst und Schrecken versetzte. Plötzlich waren sie alle in Panik, die Augen vor Entsetzen weit aufgerissen, kreischend und schreiend und der Hysterie nahe. Sie rannten wild durcheinander, stießen zusammen. Die Dicke stürzte und lag schreiend und weinend am Boden, während die anderen rücksichtslos über sie hinwegtrampelten, als sie verzweifelt versuchten, sich zu verstecken oder die Tür zu finden oder davonzulaufen vor dem, das ihnen so schreckliche Angst einjagte – was es auch sein mochte.
Der Mann fuhr an den Straßenrand, ließ den Motor im Leerlauf. Sein Atem ging schwer, und er spürte das Hämmern seines Herzens.
Ein so wundervolles Fantasiebild hatte er noch nie gehabt. Doch ein kleiner Teil dieses Bildes fehlte. Wovor hatten die Mädchen sich gefürchtet? In seiner blühenden Fantasie suchte der Mann fieberhaft nach der Antwort und stieß voller Verlangen den Atem aus, als er die Lösung fand: ein Feuer. Der Umkleideraum stand in Flammen, und die Mädchen waren bei dem Brand in Panik geraten. Sie husteten und keuchten vom Rauch, während sie verzweifelt umherirrten, halb nackt und voller Entsetzen. »Mein Gott«, flüsterte der Mann, blickte starr nach vorn und sah die Szene wie einen Film vor sich, der vor ihm auf die Innenseite der Windschutzscheibe projiziert wurde.
Nach einiger Zeit wurde er ruhiger. Noch immer verspürte er ein heftiges Verlangen, doch das Fantasiebild reichte nicht mehr: Es war wie der Gedanke an ein Bier, wenn man brennenden Durst hatte. Der Mann hob den Saum seines T-Shirts und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Er wusste, dass es besser wäre, das Fantasiebild zu verscheuchen und weiterzufahren; aber das Bild war einfach zu schön. Es war eine sehr gefährliche Sache – falls man ihn fasste, würde er für Jahre ins Gefängnis wandern –, doch sein Leben lang hatte eine Gefahr ihn nie von irgendetwas abhalten können. Der Mann versuchte, sich dem Verlangen zu widersetzen; aber nur für einen Augenblick. »Ich will es«, raunte er, wendete den Wagen und fuhr durch den prächtigen Torbogen auf den Campus.
Er war schon einmal hier gewesen. Die Universität lag auf Hunderten von Hektar Rasenflächen und Gärten und Waldstücken. Die meisten Gebäude waren gleichförmig aus rotem Ziegelstein errichtet; nur hier und da standen moderne Bauwerke aus Glas und Beton. Sämtliche Gebäude waren durch ein Gewirr schmaler, von Parkuhren gesäumter Straßen miteinander verbunden.
Die Hockeymannschaft war verschwunden, doch der Mann fand problemlos die Sporthalle: Sie war ein niedriges Gebäude, vor dem die große Statue eines Diskuswerfers stand, und befand sich gleich neben einem Sportplatz. Der Mann stellte den Wagen an einer Parkuhr ab, warf aber keine Münze ein; er steckte niemals Geld in eine Parkuhr. Die muskulöse Trainerin der Hockeymannschaft stand auf der Treppe vor der Sporthalle und unterhielt sich mit einem Burschen in einem verschlissenen Sweatshirt. Der Mann rannte die Treppe hinauf, lächelte beim Vorübereilen die Trainerin an, stieß die Tür auf und betrat das Gebäude.
In der Vorhalle herrschte ein reges Kommen und Gehen junger Männer und Frauen, die Tennisschläger in den Händen hielten und sich Sporttaschen über die Schultern geschlungen hatten. Die meisten Universitätsmannschaften mussten sonntags trainieren. In der Mitte der Halle saß ein Wachmann hinter einem Schalter und überprüfte die Studentenausweise, doch in diesem Augenblick kam eine große Gruppe Jogger in die Halle und ging an dem Wachmann vorbei. Einige wedelten mit ihren Ausweisen, andere vergaßen es, und der Wachmann zuckte mit den Schultern und las weiter in Dead Zone.
Der Fremde drehte sich um und betrachtete eine Sammlung von Pokalen in einem gläsernen Schaukasten – Trophäen, welche die Sportler der Jones-Falls-Universität errungen hatten. Einen Augenblick später kam eine Fußballmannschaft in die Halle, zehn Männer und eine untersetzte Frau mit Stollenschuhen. Sofort schloss der Fremde sich der Gruppe an, schlenderte wie ein Mannschaftsmitglied an dem Wachmann vorbei und folgte den anderen eine breite Treppe hinunter ins Kellergeschoss. Die Mannschaftsangehörigen unterhielten sich über ihr Spiel, lachten über ein glückliches Tor und schimpften über ein übles Foul. Den Fremden bemerkten sie nicht.
Er schlenderte gelassen mit ihnen, doch seine Augen waren wachsam. Am Fuß der Treppe befand sich eine weitere kleine Halle mit einem Cola-Automaten und einem Münztelefon unter einer geräuschdämpfenden Schutzglocke. Der Umkleideraum der Männer lag auf der gegenüberliegenden Seite der Halle. Das Mädchen aus der Fußballmannschaft ging einen langen Flur hinunter, der offenbar zum Umkleideraum der Frauen führte. Wahrscheinlich war dieser Raum nachträglich erbaut worden. Vor vielen Jahren, als »Gemeinschaftserziehung« noch ein anstößiger Begriff gewesen war, hatte der Architekt der Halle offenbar nicht damit gerechnet, dass es an der Jones Falls jemals viele Studentinnen geben würde.
Der Fremde nahm den Hörer des Münztelefons ab und tat so, als suchte er nach einer Vierteldollarmünze. Die Männer strömten in die Umkleidekabine. Der Fremde beobachtete, wie das Mädchen eine Tür öffnete und verschwand. Dort musste der Umkleideraum der Frauen sein. Sie sind alle dadrin, dachte der Fremde aufgeregt; sie ziehen sich aus, stehen unter der Dusche oder trocknen sich die nackten Körper ab. Das Gefühl, den Mädchen so nahe zu sein, ließ Hitze in ihm aufsteigen. Er wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Um sein Fantasiebild vollständig zu machen, musste er nur noch dafür sorgen, dass die Mädchen sich halb zu Tode erschreckten.
Er zwang sich zur Ruhe. Er würde die Sache nicht vermasseln, indem er jetzt übereilt handelte. Er brauchte ein paar Minuten, sich einen Plan zurechtzulegen.
Als alle Studenten verschwunden waren, schlenderte der Mann den Flur hinunter – auf dem Weg, den das Mädchen genommen hatte.
Drei Türen befanden sich auf dem Korridor, je eine zu beiden Seiten und eine dritte am Ende des Flurs. Durch die Tür zur Rechten war das Mädchen verschwunden. Der Fremde öffnete die Tür am Ende des Flurs und stellte fest, dass sich dahinter ein großer, staubiger Raum befand, in dem klobige Maschinen standen: Heißwasserbehälter und Filter für das Schwimmbecken, wie er vermutete. Er trat ein und schloss die Tür hinter sich. Ein tiefes, elektrisches Summen war zu vernehmen. Der Fremde stellte sich ein Mädchen vor, das halb verrückt war vor Angst. Sie trug nur Unterwäsche – vor seinem geistigen Auge sah er ihren Büstenhalter und ihren Slip mit Blumenmuster – und lag auf dem Boden; aus schreckgeweiteten Augen schaute sie zu ihm hinauf, während er seine Gürtelschnalle öffnete. Für einen Moment genoss er diese Vorstellung und lächelte. Das Mädchen aus dem Fantasiebild war nur wenige Meter von ihm entfernt. Vielleicht überlegte sie genau in diesem Moment, wie sie den Abend verbringen sollte; vielleicht hatte sie einen Freund und fragte sich, ob sie es in der Nacht mit ihm treiben sollte. Oder sie war ein Erstsemester, einsam und ein bisschen schüchtern, und wusste nicht, was sie mit dem Sonntagabend anfangen sollte, außer sich Columbo anzuschauen. Oder sie musste morgen, am Montag, vielleicht eine Arbeit abgeben und würde die Nacht aufbleiben, um sie fertigzuschreiben. Nichts von alledem, Baby. Heute ist Albtraum-Abend.
Der Fremde tat so etwas nicht zum ersten Mal; allerdings war es diesmal einige Nummern größer als je zuvor. Solange er sich erinnern konnte, hatte es ihm Lust verschafft, Mädchen in Furcht und Schrecken zu versetzen. Auf der Highschool hatte er nichts lieber getan, als ein Mädchen allein abzufangen, irgendwo in einer Ecke, und ihr so viel Angst einzujagen, dass sie weinte und um Gnade winselte. Deshalb hatte er immer wieder von einer Schule zur anderen wechseln müssen. Manchmal hatte er sich mit Mädchen verabredet; aber nur, um so zu sein wie die anderen Jungs und jemanden zu haben, mit dem er Arm in Arm in eine Bar gehen konnte. Falls die Mädchen erwarteten, von ihm gebumst zu werden, tat er ihnen den Gefallen, doch stets war es ihm irgendwie sinnlos erschienen.
Der Fremde war der Ansicht, dass jeder irgendeine Macke hatte: Manche Männer zogen gern Frauenkleider an; andere standen darauf, dass Mädchen in Ledersachen und mit hochhackigen Schuhen auf ihnen herumtrampelten. Er hatte mal einen Burschen gekannt, für den der erotischste Teil eines Frauenkörpers die Füße waren: Der Typ hatte einen Ständer bekommen, wenn er durch die Damenschuhabteilung eines Warenhauses geschlendert war und beobachtet hatte, wie die Kundinnen sich die Schuhe an- und auszogen.
Seine Macke war es, Angst zu verbreiten. Es törnte ihn an, wenn eine Frau vor Furcht zitterte. Ohne Angst keine Erregung.
Er schaute sich methodisch um und entdeckte eine Leiter, die an der Wand befestigt war und hinauf zu einer eisernen Luke führte, welche von unten mit Riegeln verschlossen war. Rasch stieg der Fremde die Leiter hinauf, zog die Riegel zurück, stieß die Luke auf und starrte auf die Reifen eines Chrysler New Yorker, der auf einem Parkplatz stand. Er rief sich ins Gedächtnis, welchen Weg er genommen hatte. Ja, er musste sich im hinteren Teil des Gebäudes befinden. Er schloss die Luke wieder und stieg die Leiter hinunter.
Er verließ den Maschinenraum des Schwimmbeckens. Als er über den Flur ging, kam ihm eine Frau entgegen und bedachte ihn mit einem feindseligen Blick. Für einen Moment stieg Furcht in ihm auf; vielleicht fragte die Frau ihn, weshalb er sich vor dem Damenumkleideraum herumtrieb. Eine solche Auseinandersetzung war in seinem Plan nicht vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Frau sein ganzes Vorhaben über den Haufen werfen. Doch ihre Augen richteten sich auf seine Mütze; sie sah das Wort SECURITY, wandte den Blick von ihm ab und verschwand im Umkleideraum.
Er grinste. Er hatte die Mütze für 8 Dollar und 99 Cent in einem Souvenirladen gekauft. Doch die Leute waren es gewöhnt, Wachmänner in Jeans zu sehen – bei Rockkonzerten, zum Beispiel – oder Polizeibeamte in Zivil, die wie Ganoven aussahen, bis sie ihre Dienstmarken zückten, oder Flughafenpolizisten in Rollkragenpullovern. Es lohnte die Mühe nicht, jeden Typ, der sich als Wachmann bezeichnete, nach dem Dienstausweis zu fragen.
Der Fremde öffnete die Tür, die sich gegenüber vom Damenumkleideraum befand, auf der anderen Seite des Flures. Sie führte in einen Lagerraum. Der Mann knipste das Licht an und machte die Tür hinter sich zu.
Um ihn herum standen Regale, in denen alte, abgenutzte Sportgeräte verstaut waren: große schwarze Medizinbälle, verschlissene Gummimatratzen, Holzkeulen, verrottete Boxhandschuhe und Klappstühle aus zerfaserndem Holz. Da war ein Sprungpferd; eines der Beine war zerbrochen, und die Kunststoffpolsterung war aufgeplatzt. In dem Raum roch es muffig. An der Decke verlief eine dicke silberne Rohrleitung. Der Mann vermutete, dass es das Belüftungsrohr der Damenumkleidekabine auf der anderen Seite des Flures war.
Er reckte sich und versuchte, die Schrauben zu lösen, mit denen das Rohr an einer Art stählernem Fächer befestigt war, hinter dem sich vermutlich der Ventilator befand. Mit bloßen Fingern konnte er die Schrauben nicht drehen, doch im Kofferraum seines Datsun lag ein Schlüssel. Falls er das Rohr losbekam, würde der Ventilator statt der frischen Luft von draußen die Luft aus dem Lagerraum in die Umkleidekabine saugen.
Er würde das Feuer genau unter dem Ventilator entzünden. Er würde sich den Benzinkanister nehmen, ein bisschen Sprit in eine leere Mineralwasserflasche füllen und dann hierher zurückkommen: mit der Flasche, dem Schraubenschlüssel, Zündhölzern und einer Zeitung zum Entfachen des Feuers.
Die Flammen würden rasch hochschlagen und riesige Rauchwolken entwickeln. Er würde sich ein nasses Tuch vor Mund und Nase halten und so lange warten, bis der Lagerraum im Qualm erstickte. Dann würde er das Lüftungsrohr losschrauben, sodass die Rauchwolken vom Ventilator in die Rohrleitung gesaugt und in den Umkleideraum der Frauen geblasen würden. Zuerst würde niemand etwas bemerken. Dann würden ein, zwei Mädchen die Luft schnüffeln und sagen: »Raucht hier jemand?« Er selbst würde dann die Tür des Lagerraums öffnen, sodass der Flur sich mit Rauch füllte. Wenn die Mädchen merkten, dass irgendetwas nicht in Ordnung war, würden sie die Tür der Umkleidekabine aufreißen und den Rauch sehen. Sie würden annehmen, dass die gesamte Sporthalle in Flammen stand, und in Panik ausbrechen.
Und dann würde er in den Umkleideraum gehen, in ein Meer aus Büstenhaltern und Slips, nackten Brüsten und Hintern und Schamhaar. Einige Mädchen würden unter den Duschen hervorgerannt kommen, nackt und nass, und würden hastig nach ihren Badetüchern greifen; andere würden versuchen, sich etwas anzuziehen; aber die meisten würden panisch umherirren, halb blind vom Rauch, und nach der Tür suchen. Und er würde weiterhin den Wachmann spielen und den Mädchen Befehle zurufen: »Lassen Sie alles stehen und liegen! Das ist ein Notfall! Raus hier! Das ganze Gebäude steht in Flammen! Rennt, rennt!« Er würde den Mädchen auf die nackten Hintern schlagen, sie herumschubsen, ihnen die Kleidung aus den Händen reißen, die Mädchen begrapschen. Natürlich würden einige erkennen, dass irgendetwas an der Sache nicht stimmte, doch die meisten würden viel zu verängstigt sein, um eine Ahnung zu kriegen, was es war. Falls die muskulöse Mannschaftsführerin des Hockeyteams sich unter den Mädchen befand, war sie vielleicht geistesgegenwärtig genug, den Wachmann zur Rede zu stellen; aber er würde sie einfach auf den Flur hinausprügeln.
Dann würde er herumgehen und sich sein Hauptopfer aussuchen – ein hübsches Mädchen mit verletzlichem Aussehen. Er würde sie beim Arm nehmen und sagen: »Hier entlang, bitte. Ich bin vom Sicherheitsdienst.« Er würde sie auf den Flur führen und dann die falsche Richtung einschlagen, zum Maschinenraum des Schwimmbeckens. Und dort, wenn das Mädchen sich in Sicherheit wähnte, würde er sie ins Gesicht schlagen und ihr die Fäuste in den Leib hämmern und sie auf den schmutzigen Betonboden werfen. Er würde beobachten, wie sie durch den Staub rollte und sich drehte und aufsetzte, und wie sie zu ihm emporstarrte, keuchend und schluchzend, die Augen voller Entsetzen.
Dann würde er lächeln und seine Gürtelschnalle öffnen.
Kapitel 1
»Ich will nach Hause«, sagte Mrs Ferrami.
»Mach dir keine Sorgen, Mom«, erwiderte ihre Tochter Jeannie. »Wir holen dich schneller hier raus, als du glaubst.«
Jeannies jüngere Schwester, Patty, bedachte Jeannie mit einem raschen Blick und sagte: »Und wie sollen wir das anstellen?«
Die Krankenversicherung ihrer Mutter zahlte nur für das Bella-Vista-Pflegeheim, und das war drittklassig. Die Einrichtung des Zimmers bestand aus zwei hohen Krankenbetten, zwei Wandschränken, einem Sofa und einem Fernseher. Die Wände waren pilzbraun gestrichen, und der Fußboden war mit Fliesen aus Kunststoff ausgelegt: cremefarben, mit orangenen Streifen. Das Fenster besaß Gitterstäbe, aber keine Gardine und gewährte den Blick auf eine Tankstelle. In der Ecke befand sich ein Waschbecken, und die Toilette lag den Flur hinunter.
»Ich will nach Hause«, wiederholte Mom.
»Aber Mom«, sagte Patty, »du vergisst doch laufend etwas. Du kannst nicht mehr auf dich selbst aufpassen.«
»Natürlich kann ich das. Wag es ja nicht, so mit mir zu reden!«
Jeannie biss sich auf die Lippe. Als sie das Wrack betrachtete, das einst ihre Mutter gewesen war, hätte sie am liebsten geweint. Mom besaß markante Gesichtszüge: schwarze Brauen, dunkle Augen, eine gerade Nase und ein kräftiges Kinn. Die Gesichter Jeannies und Pattys wiesen die gleichen Merkmale auf; allerdings war Mom klein, die Töchter dagegen hochgewachsen wie Daddy. Alle drei waren so willensstark, wie ihr Äußeres vermuten ließ. »Energiebündel« war der Begriff, der für gewöhnlich benutzt wurde, um die Ferrami-Frauen zu charakterisieren. Doch Mom würde nie wieder ein Energiebündel sein. Sie hatte die Alzheimerkrankheit.
Mom war noch keine sechzig. Jeannie, neunundzwanzig Jahre alt, und die sechsundzwanzigjährige Patty hatten die Hoffnung gehegt, dass Mom noch einige Jahre für sich selbst sorgen könnte, doch an diesem Morgen um fünf Uhr früh war diese Hoffnung zunichtegemacht worden. Ein Polizist aus Washington hatte angerufen und mitgeteilt, er habe Mom gefunden, als sie in einem schmuddeligen Nachthemd über die Achtzehnte Straße geschlurft war. Sie hatte geweint und gesagt, sie könne sich nicht mehr erinnern, wo sie wohne.
Jeannie war in ihren Wagen gestiegen und an diesem stillen Sonntagmorgen nach Washington gefahren, eine Stunde von Baltimore entfernt. Sie hatte Mom auf dem Polizeirevier abgeholt, sie nach Hause gebracht, gewaschen und angezogen und hatte dann Patty angerufen. Gemeinsam hatten die beiden Schwestern sich um die Formalitäten für die Einweisung Moms ins Bella Vista gekümmert. Das Heim befand sich in der Stadt Columbia, zwischen Washington und Baltimore. Schon ihre Tante Rosa hatte ihre letzten Jahre im Bella Vista verbracht. Tante Rosa hatte die gleiche Versicherungspolice gehabt wie Mom.
»Mir gefällt es hier nicht«, sagte Mom.
»Uns gefällt es auch nicht«, sagte Jeannie, »aber im Moment können wir uns nichts anderes leisten.« Sie versuchte, ihrer Stimme einen beiläufigen Tonfall zu geben, doch die Worte klangen schroff.
Patty warf der Schwester einen tadelnden Blick zu und sagte: »Nun hab dich nicht so, Mom. Wir haben schon schlechter gewohnt.«
Das stimmte. Nachdem ihr Vater das zweite Mal ins Gefängnis gewandert war, hatten Mom und die beiden Mädchen in einer Einzimmerwohnung gehaust, mit einer Kochplatte auf der Anrichte und einem Wasserhahn auf dem Flur. Das war während ihrer Sozialhilfe-Jahre gewesen. Doch in der Not hatte Mom wie eine Löwin gekämpft. Sobald Jeannie und Patty in der Schule waren und Mom eine vertrauenswürdige ältere Dame gefunden hatte, die sich um die Mädchen kümmerte, wenn sie nach Hause kamen, besorgte Mom sich einen Job – sie war Friseuse gewesen und immer noch tüchtig in ihrem Beruf, wenngleich ein bisschen altmodisch – und bezog mit den Mädchen eine kleine Zweizimmerwohnung in Adamsorgan, ein zur damaligen Zeit respektables Arbeiterwohnviertel.
Mom machte immer Toast mit Ei zum Frühstück und schickte Jeannie und Patty in sauberen Kleidern zur Schule; dann frisierte sie sich, schminkte sich – man muss gepflegt aussehen, wenn man in einem Salon arbeitet – und ließ stets eine blitzsaubere Küche zurück; auf dem Tisch stand immer ein Teller mit Plätzchen für die Mädchen, wenn sie nach Hause kamen. An den Sonntagen machten die drei ihre Wohnung sauber und wuschen gemeinsam die Wäsche. Mom war so tüchtig, so verlässlich, so unermüdlich. Es brach einem das Herz, nun diese vergessliche, nörglerische Frau auf dem Bett zu sehen.
Mom runzelte die Stirn, als wäre sie verwundert, und fragte: »Jeannie, warum hast du einen Ring in der Nase?«
Jeannie berührte den filigranen Silberreif und lächelte matt. »Ich habe mir die Nase schon als Mädchen durchstechen lassen, Mom. Weißt du denn nicht mehr, wie sehr du dich darüber aufgeregt hast? Damals dachte ich, du würdest mich auf die Straße setzen.«
»Ich vergess schon mal was«, sagte Mom.
»Dafür kann ich mich noch sehr gut daran erinnern«, sagte Patty zu ihrer Schwester. »Ich hielt es für das Allergrößte. Aber ich war elf, und du warst vierzehn, und ich fand alles stark und geil und ätzend, was du getan hast.«
»Vielleicht war es das ja auch«, erwiderte Jeannie mit gespielter Eitelkeit.
Patty kicherte. »Aber nicht die orangene Jacke.«
»Oh Gott, die Jacke! Zum Schluss hat Mom sie verbrannt, als ich in einem leer stehenden Haus gepennt und mir dabei Flöhe eingefangen hatte.«
»Daran kann ich mich erinnern«, sagte Mom. »Flöhe! Eines meiner Kinder!« Fünfzehn Jahre später war sie immer noch böse darauf.
Mit einem Mal hatte die Stimmung sich aufgehellt. Die alten Geschichten hatten die Frauen daran erinnert, wie nahe sie einander gewesen waren. Es war ein günstiger Zeitpunkt, sich zu verabschieden. »Ich mache mich jetzt auf den Weg«, sagte Jeannie und erhob sich.
»Ich auch«, sagte Patty. »Ich muss das Abendessen kochen.«
Dennoch ging keine der beiden zur Tür. Jeannie kam sich vor, als würde sie ihre Mutter aufgeben, sie in der Not allein lassen. Niemand hier liebte sie. Sie brauchte eine Familie, die sich um sie kümmerte. Jeannie und Patty sollten bei ihr bleiben und für sie kochen und ihre Nachthemden bügeln und im Fernseher ihre Lieblingssendung einstellen.
»Wann sehe ich euch wieder?«, fragte Mom.
Jeannie zögerte. Sie wollte sagen: »Morgen. Ich bringe dir das Frühstück und bleibe den ganzen Tag bei dir.« Aber das war unmöglich; sie hatte eine arbeitsreiche Woche vor sich. Schuldgefühle stiegen in ihr auf. Wie kann ich nur so grausam sein?
Patty half ihr aus der Klemme. »Ich komme morgen vorbei, Mom«, sagte sie. »Und ich bringe die Kinder mit. Das wird dir gefallen.«
Doch so leicht wollte Mom Jeannie nicht davonkommen lassen. »Kommst du auch, Jeannie?«
Jeannie fiel das Reden schwer. »Sobald ich kann.« Mit einem kummervollen Schluchzer beugte sie sich vor und küsste ihre Mutter. »Ich liebe dich, Mom. Das darfst du nie vergessen.«
Kaum waren sie aus der Tür, brach Patty in Tränen aus.
Auch Jeannie war nach Weinen zumute; aber sie war die ältere Schwester, und sie hatte sich vor langer Zeit daran gewöhnt, die eigenen Gefühle im Zaum zu halten, wenn sie sich um Patty kümmerte. Sie legte der Schwester den Arm um die Schultern, als sie über den Flur gingen, in dem es nach Desinfektionsmitteln roch. Patty war kein schwacher Mensch, doch sie war fügsamer als die kämpferische und willensstarke Jeannie. Mom hatte Jeannie stets kritisiert und erklärt, sie solle sich ein Beispiel an Patty nehmen.
»Ich wollte, ich könnte sie zu mir nach Hause holen, aber das geht nicht«, sagte Patty kläglich.
Jeannie gab ihr recht. Patty war mit einem Schreiner namens Zip verheiratet. Sie wohnten in einem kleinen Reihenhaus mit zwei Schlafzimmern. Das zweite Schlafzimmer teilten sich ihre drei Söhne. Dave war sechs, Mel vier und Tom zwei. Da war kein Platz mehr, Oma unterzubringen.
Jeannie war Single. Als Assistenzprofessorin an der Jones-Falls-Universität verdiente sie dreißigtausend Dollar im Jahr – sehr viel weniger als Pattys Ehemann, wie sie vermutete. Sie hatte vor Kurzem ihre erste Hypothek aufgenommen, eine Zweizimmerwohnung gekauft und einen Kredit für die Möbel aufgenommen. Eines der Zimmer war ein Wohnraum mit Kochnische, das andere ein Schlafzimmer mit Wandschrank und einem winzigen Bad. Würde sie Mom ihr Bett überlassen, müsste sie jede Nacht auf der Couch schlafen; außerdem war tagsüber niemand in der Wohnung, der sich um eine Frau kümmern konnte, die an der Alzheimerkrankheit litt. »Ich kann sie auch nicht zu mir nehmen«, sagte Jeannie.
Hinter dem Tränenschleier blitzte Zorn in Pattys Augen auf. »Warum hast du ihr dann gesagt, wir würden sie da rausholen? Das schaffen wir doch nicht!«
Draußen blieben sie in der sengenden Hitze stehen. »Morgen gehe ich zur Bank und nehme ein Darlehen auf. Dann bringen wir Mom in ein schöneres Heim, und ich zahle was zu ihrem Pflegegeld dazu.«
»Aber wie willst du das jemals zurückzahlen?«, fragte die stets praktisch denkende Patty.
»Indem ich zur außerordentlichen Professorin befördert werde und später eine volle Professur bekomme; dann werde ich den Auftrag erhalten, ein Lehrbuch zu schreiben, und drei Firmenkonsortien werden mich als Beraterin verpflichten.«
Auf Pattys tränennasses Gesicht legte sich ein Lächeln. »Ich glaub’s dir ja, aber wird dir auch die Bank glauben?«
Patty hatte niemals an Jeannie gezweifelt. Sie selbst hatte nie sonderlichen Ehrgeiz an den Tag gelegt; als Schülerin war sie nicht einmal Durchschnitt gewesen. Mit neunzehn hatte sie geheiratet und hatte ohne erkennbares Bedauern die Aufgaben einer Hausfrau und Mutter übernommen.
Jeannie war das Gegenteil. Sie war Klassenbeste gewesen, Kapitän sämtlicher Sportmannschaften und Meisterin im Tennis. Deshalb hatte sie sich ihr Studium mit Sportstipendien finanzieren können. Wenn Jeannie sagte, sie würde dies tun oder das – was es auch sein mochte –, Patty zweifelte nie daran.
Doch Patty hatte recht. Die Bank würde Jeannie keinen weiteren Kredit gewähren, nachdem sie erst vor Kurzem den Kauf ihrer Wohnung finanziert hatte. Außerdem war sie erst seit Kurzem Assistenzprofessorin; es würden noch drei Jahre vergehen, bevor sie für eine Beförderung infrage kam. Als die Schwestern zum Parkplatz gelangten, sagte Jeannie verzweifelt: »Also gut, ich werde meinen Wagen verkaufen.«
Dabei hing sie an ihrem Wagen. Es war ein zweiundzwanzig Jahre alter Mercedes 230 C, eine rote zweitürige Limousine mit schwarzen Ledersitzen. Jeannie hatte den Wagen vor acht Jahren von ihrem Preisgeld gekauft, als sie für den Sieg beim Tennisturnier am Mayfair-Lites-College fünftausend Dollar kassiert hatte – zu einer Zeit, als es noch nicht als schick galt, Besitzer eines alten Mercedes zu sein. »Wahrscheinlich ist der Wagen doppelt so viel wert, wie ich dafür bezahlt habe«, sagte sie.
»Aber dann musst du dir ein anderes Auto kaufen«, bemerkte Patty mit ihrem erbarmungslosen Sinn für Realität.
»Da hast du recht.« Jeannie seufzte. »Na ja, ich könnte private Nachhilfestunden erteilen. Es verstößt zwar gegen die Vorschriften der Uni, aber vielleicht sind vierzig Dollar die Stunde drin, wenn ich reichen Studenten, die beim Examen an anderen Unis durchgerasselt sind, Einzelunterricht in Statistik gebe. Dann könnte ich um die dreihundert Dollar pro Woche verdienen – steuerfrei, wenn ich es nicht angebe.« Sie schaute ihrer Schwester in die Augen. »Kannst du auch was beisteuern?«
Patty wandte den Blick ab. »Ich weiß nicht.«
»Zip verdient mehr als ich.«
»Er würde mich umbringen, könnte er mich jetzt hören, aber fünfundsiebzig, achtzig Dollar die Woche könnten wir vielleicht zuschießen«, sagte Patty schließlich. »Ich werde Zip mal auf die Füße treten, dass er wegen einer Gehaltserhöhung nachfragt. In dieser Beziehung ist er ein bisschen ängstlich, aber ich weiß, dass er ein höheres Gehalt verdient hätte. Außerdem kann sein Chef ihn gut leiden.«
Jeannies Stimmung hob sich, wenngleich die Aussicht, ihre Sonntage mit Nachhilfestunden für verkrachte Studenten verbringen zu müssen, nicht gerade erhebend war. »Mit vierhundert Dollar zusätzlich die Woche könnten wir Mom ein eigenes Zimmer mit eigenem Bad besorgen.«
»Und dann könnte sie mehr von ihren alten Sachen unterbringen, die Andenken und den ganzen Schnickschnack. Und vielleicht ein paar Möbel aus der Wohnung.«
»Wir hören uns mal um, ob jemand eine schöne Bleibe für sie weiß.«
»In Ordnung«, sagte Patty, plötzlich nachdenklich geworden. »Sag mal, Moms Krankheit ist erblich, nicht wahr? Ich hab einen Fernsehbericht darüber gesehen.«
Jeannie nickte. »Es ist ein genetischer Defekt, AD3, der mit dem Frühstadium der Alzheimerkrankheit in Zusammenhang steht.« Man hatte den Defekt im Chromosom I4q24.3 lokalisiert, wie Jeannie sich erinnerte; aber das würde Patty nichts sagen.
»Bedeutet das, du und ich werden so enden wie Mom?«
»Es bedeutet, dass die Gefahr besteht, ja.«
Beide schwiegen für einen Augenblick. Der Gedanke, den Verstand zu verlieren, war beinahe zu grauenhaft, als dass man darüber reden konnte.
»Ich bin froh, dass ich meine Kinder so jung bekommen habe«, sagte Patty. »Wenn die Krankheit mich erwischt, sind sie alt genug, sich um mich zu kümmern.«
Jeannie entging nicht der Anflug des Vorwurfs. Wie Mom war auch Patty der Meinung, dass irgendetwas nicht stimmte, wenn jemand mit neunundzwanzig Jahren noch keine Kinder hatte. »Dass man dieses Gen entdeckt hat, stellt aber auch eine Hoffnung dar«, erklärte Jeannie. »Es bedeutet möglicherweise, dass man uns einen veränderten Typus unserer eigenen DNS spritzen kann, wenn wir in Moms Alter sind. Eine DNS, die das verhängnisvolle Gen nicht aufweist.«
»Darüber haben sie im Fernsehen auch gesprochen. Dabei geht es um eine Technologie zum Austausch winziger Bestandteile des Erbmaterials, stimmt’s?«
Jeannie lächelte ihre Schwester an. »Stimmt.«
»Ich bin gar nicht so dumm, weißt du.«
»Ich hab dich auch nie für dumm gehalten.«
»Aber die Sache ist doch die«, sagte Patty nachdenklich, »dass die DNS uns zu dem macht, was wir sind. Wenn man die DNS verändert, erschafft man dann nicht einen anderen Menschen?«
»Es ist nicht allein die DNS, die dich zu dem macht, was du bist. Es liegt auch an der Erziehung. Um diese Fragen dreht sich meine ganze Arbeit.«
»Wie kommst du im neuen Job eigentlich zurecht?«
»Er ist aufregend. Und meine große Chance, Patty. Mein Artikel über die Frage, ob die Kriminalität in unseren Genen angelegt ist, ist von vielen gelesen worden.« Der Artikel war im Jahr zuvor erschienen, als Jeannie noch an der Universität von Minnesota gewesen war. Der Name ihres vorgesetzten Professors hatte über dem Jeannies gestanden; aber die Forschungsarbeit stammte von ihr.
»Ich habe nie so richtig verstanden, ob du in dem Artikel sagen wolltest, dass kriminelle Veranlagung erblich ist oder nicht.«
»Ich habe vier ererbte Eigenschaften bestimmt, die zu kriminellen Handlungen führen: Impulsivität, Wagemut, Aggressivität und Hyperaktivität. Aber meine eigentliche Theorie läuft darauf hinaus, dass bestimmte Methoden der Kindererziehung diesen Eigenschaften entgegenwirken und potenzielle Verbrecher in brave Mitmenschen verwandeln.«
»Wie könnte man so etwas jemals beweisen?«
»Indem man eineiige Zwillinge studiert, die getrennt aufgewachsen sind. Eineiige Zwillinge besitzen die gleiche DNS. Wenn sie nach der Geburt von verschiedenen Pflegeeltern adoptiert oder aus anderen Gründen getrennt werden, dann werden sie unterschiedlich erzogen. Deshalb suche ich nach Zwillingspaaren, bei denen eines der Geschwister kriminell ist, das andere nicht. Dann untersuche ich, wie die Geschwister aufgezogen wurden und was die jeweiligen Eltern anders gemacht haben.«
»Deine Arbeit ist wirklich wichtig«, sagte Patty.
»Ich glaube schon.«
»Wir müssen herausfinden, weshalb sich in der heutigen Zeit so viele Menschen zum Schlechten entwickeln.«
Jeannie nickte. Genau darum ging es, kurz und bündig.
Patty ging zu ihrem Wagen, einem großen alten Ford-Kombi; der Gepäckraum war vollgestopft mit Kindersachen in leuchtenden Farben: ein Dreirad, ein zusammengeklappter Kinderwagen, eine kunterbunte Sammlung von Schlägern und Bällen und ein großer Spielzeuglaster mit einem zerbrochenen Rad.
»Gib den Jungs einen dicken Kuss von mir, ja?«, sagte Jeannie.
»Danke. Ich ruf dich morgen an, wenn ich bei Mom gewesen bin.«
Jeannie holte die Wagenschlüssel hervor und zögerte; dann ging sie zu Patty und umarmte sie. »Ich liebe dich, kleine Schwester.«
»Ich dich auch.«
Jeannie stieg ein und fuhr los.
Sie fühlte sich unruhig und aufgewühlt, von Gefühlen erfüllt, über die sie sich nicht im Klaren war – Gefühle gegenüber Mom und Patty und dem Vater, der nicht da war. Sie gelangte auf die Interstate 70 und schlängelte sich, wie immer mit überhöhter Geschwindigkeit, durch den Verkehr. Dabei fragte sie sich, was sie mit dem Rest des Tages anfangen sollte. Dann fiel ihr ein, dass sie um sechs zu einem Tennismatch verabredet war; anschließend wollte sie mit einer Gruppe Studienabsolventen und jungen Angehörigen des Psychologischen Instituts auf ein paar Bierchen und eine Pizza ausgehen. Jeannies erster Gedanke war, den ganzen Abend sausen zu lassen. Aber zu Hause sitzen und grübeln wollte sie auch nicht. Sie beschloss, zum Tennis zu gehen; die körperliche Anstrengung würde dafür sorgen, dass sie sich besser fühlte. Anschließend würde sie ein Stündchen in Andy’s Bar gehen und sich dann früh aufs Ohr legen.
Doch es sollte anders kommen.
Ihr Tennisgegner war Jack Budgen, der Chefbibliothekar der Universität. Er hatte mal in Wimbledon gespielt. Trotz seiner Glatze und der fünfzig Jahre war Jack immer noch fit und hatte nichts von seiner alten Technik und Ballbeherrschung eingebüßt. Jeannie hatte es nie bis Wimbledon geschafft. Der Höhepunkt ihrer Karriere war die Zugehörigkeit zur amerikanischen Olympiamannschaft gewesen, als sie noch Studentin war. Doch sie war stärker und schneller als Jack.
Sie spielten auf dem Hartplatz, der sich auf dem Campus der Jones Falls befand. Jeannie und Jack waren einander ebenbürtig, und das Spiel lockte eine kleine Zuschauermenge an. Es gab keine Kleiderordnung, doch aus Gewohnheit spielte Jeannie stets in gestärkten weißen Shorts und weißem Polohemd. Sie hatte langes dunkles Haar – nicht seidig und glatt wie Pattys, sondern gelockt und widerspenstig; deshalb hatte sie es unter eine Schirmmütze gesteckt.
Jeannie hatte einen knallharten Aufschlag, und ihre beidhändige, cross geschlagene Rückhand war tödlich. Jack konnte gegen den Aufschlag nicht viel ausrichten, doch nach den ersten Spielen stellte er sich so auf Jeannie ein, dass sie ihren Rückhand-Schmetterball nur noch selten anbringen konnte. Jack spielte rationell, teilte sich seine Kräfte ein und ließ Jeannie Fehler machen. Sie spielte zu aggressiv, machte beim Aufschlag Doppelfehler und rückte zu früh ans Netz vor. Jeannie war sicher, dass sie Jack an einem normalen Tag hätte schlagen können, doch sie konnte sich heute nicht voll konzentrieren und schaffte es nicht, seine Schläge vorauszuberechnen. Beide gewannen je einen Satz; im dritten stand es schließlich 5 zu 4 für Jack, sodass Jeannie ihren Aufschlag durchbringen musste, um weiter im Match zu bleiben.
Beim entscheidenden Spiel gab es zweimal Einstand; dann machte Jack einen Punkt und hatte Matchball. Jeannies erster Aufschlag ging ins Netz, und vom Publikum drang ein vernehmliches Stöhnen herüber. Statt eines normalen, langsameren zweiten Aufschlags schlug sie alle Vorsicht in den Wind und hämmerte den Ball übers Netz, als wäre es das erste Service. Jack bekam gerade noch den Schläger an den Ball und retournierte auf Jeannies Rückhand. Sie schlug einen Schmetterball und stürmte vor ans Netz. Doch Jack war nicht so aus dem Gleichgewicht, wie er vorgegeben hatte, und schlug den Ball als perfekten Lob zurück, der in hohem Bogen über Jeannies Kopf hinwegsegelte und auf der Linie landete. Es war der Siegesschlag.
Jeannie stand da und schaute auf den Ball, die Hände in die Hüfte gestemmt, wütend auf sich selbst. Obwohl sie seit Jahren kein ernsthaftes Match mehr gespielt hatte – den unbeugsamen Siegeswillen, der ihr das Verlieren schwer machte, hatte sie sich bewahrt. Doch sie kämpfte ihren Zorn nieder und zwang ein Lächeln auf ihr Gesicht. Sie drehte sich zu Jack um. »Ein Superschlag!«, rief sie, ging zum Netz und schüttelte dem Sieger die Hand. Von den Zuschauern kam spontaner Applaus.
Ein junger Mann steuerte auf Jeannie zu. »He, das war ein tolles Spiel!«, sagte er und lächelte breit.
Jeannie musterte ihn mit einem raschen Blick. Der Mann sah blendend aus: hochgewachsen und athletisch, mit gewelltem, kurz geschnittenem blonden Haar und schönen blauen Augen, und er schien sich seiner Wirkung auf Frauen durchaus bewusst zu sein.
Doch Jeannie war nicht in Stimmung. »Danke«, sagte sie kurz angebunden.
Wieder lächelte er – ein selbstsicheres, lässiges Lächeln, das besagte: Die meisten Mädchen sind Feuer und Flamme, wenn ich mit ihnen rede, und mag es ein noch so belangloses Geplauder sein. »Ich spiele selbst ein bisschen Tennis, wissen Sie, und da hab ich mir gedacht …«
»Wenn Sie nur ein bisschen Tennis spielen, sind Sie wahrscheinlich nicht in meiner Liga«, erwiderte Jeannie und huschte an ihm vorbei.
In ihrem Rücken hörte sie seine freundliche Stimme: »Dann darf ich also davon ausgehen, dass ein romantisches Abendessen, gefolgt von einer Nacht voller Leidenschaft, nicht infrage kommt?«
Wider Willen musste Jeannie lächeln, und sei es nur seiner Beharrlichkeit wegen. Außerdem war sie gröber als nötig gewesen. Sie drehte den Kopf. Ohne stehen zu bleiben, sagte sie über die Schulter: »Stimmt. Trotzdem, danke für das Angebot.«
Sie verließ den Tennisplatz und schlug den Weg zu den Umkleideräumen ein. Sie fragte sich, was Mom jetzt wohl tun mochte. Inzwischen musste sie ihr Abendessen bekommen haben; es war halb acht, und in Heimen bekamen die Insassen ihr Essen stets früh. Vielleicht saß Mom jetzt im Aufenthaltsraum und sah fern. Vielleicht fand sie eine Freundin, eine Frau in ihrem Alter, die ihre Vergesslichkeit in Kauf nahm und sich für die Fotos der Enkelkinder interessierte. Früher hatte Mom viele Freundinnen gehabt: die anderen Friseusen im Salon, einige Kundinnen, Nachbarn – Menschen, die sie seit fünfundzwanzig Jahren gekannt hatte. Doch es war schwer für diese Leute, die Freundschaft aufrechtzuerhalten, wenn Mom nicht einmal mehr wusste, wen sie vor sich hatte.
Als Jeannie am Hockeyplatz vorüberkam, traf sie Lisa Hoxton. Jeannie war erst seit einem Monat an der Jones Falls, und Lisa war bis jetzt ihre einzige richtige Freundin. Sie arbeitete als Technikerin im Labor für Psychologie. Lisa hatte einen Abschluss in Naturwissenschaften, wollte aber nicht als Lehrkraft tätig sein. Wie Jeannie stammte sie aus ärmlichen Verhältnissen, und der akademische Dünkel einer Eliteuniversität schüchterte sie ein bisschen ein. Die beiden Frauen hatten einander auf Anhieb sympathisch gefunden.
»Gerade hat ein Knabe versucht, mich anzumachen«, sagte Jeannie mit einem Lächeln.
»Wie sah er denn aus?«
»So wie Brad Pitt, nur größer.«
»Hast du ihm gesagt, dass du eine Freundin hast, die altersmäßig besser zu ihm passt als du?«, fragte Lisa. Sie war vierundzwanzig.
»Nein.« Jeannie warf einen raschen Blick über die Schulter, doch es war niemand zu sehen. »Geh weiter, falls er mir hinterherkommt.«
»Was wäre so schlimm daran?«
»Na, hör mal.«
»Man läuft nur vor den miesen Typen davon, Jeannie.«
»Jetzt hör endlich damit auf!«
»Du hättest ihm meine Telefonnummer geben können.«
»Ich hätte ihm einen Zettel mit deiner BH-Größe geben sollen«, sagte Jeannie. Lisa hatte einen großen Busen. »Das hätte seinen Zweck schon erfüllt.«
Lisa blieb stehen. Für einen Moment glaubte Jeannie, sie wäre zu weit gegangen und hätte die Freundin beleidigt. Dann sagte Lisa: »Was für eine tolle Idee! Und wie raffiniert! ›Meine BH-Größe ist 36 D; weitere Informationen unter folgender Nummer …‹«
»Ich bin bloß neidisch. Ich habe mir immer viel Holz vor der Hütte gewünscht«, sagte Jeannie, und beide kicherten. »Ja, wirklich. Als Mädchen habe ich gebetet, dass mir endlich Brüste wachsen. In meiner Klasse habe ich als Letzte die Periode bekommen. Es war schrecklich peinlich.«
»Hast du dich wirklich neben dein Bett gekniet und gesagt: ›Lieber Gott, lass mir einen Busen wachsen‹?«
»Um ehrlich zu sein, ich habe zur Jungfrau Maria gebetet. Ich hab mir damals gedacht, es ist Mädchensache. Und natürlich habe ich nicht ›Busen‹ gesagt.«
»Was dann? Brüste?«
»Nein. Damals dachte ich mir, ich darf den Begriff ›Brüste‹ der Muttergottes gegenüber nicht benutzen.«
»Was hast du denn gesagt?«
»›Titten‹.«
Lisa lachte schallend.
»Ich weiß nicht, wie ich an das Wort gekommen bin. Hab es wohl bei einem Männergespräch aufgeschnappt. Mir kam es wie eine höfliche und mildernde Umschreibung vor. Diese Geschichte habe ich noch nie im Leben jemandem erzählt.«
Lisa warf einen Blick nach hinten. »Tja, ich sehe keinen gut aussehenden Burschen, der uns hinterherläuft. Wir haben Brad Pitt abgeschüttelt, nehme ich an.«
»Ist auch gut so. Er ist genau mein Typ: hübsch, sexy, übertrieben selbstsicher und ganz und gar nicht vertrauenswürdig.«
»Woher willst du wissen, dass er nicht vertrauenswürdig ist? Du hast ihn nur zwanzig Sekunden gesehen.«
»Man kann keinem Mann trauen.«
»Da hast du vermutlich recht. Sag mal, kommst du heute Abend ins Andy’s?«
»Ja, aber nur auf ein Stündchen. Jetzt muss ich erst mal duschen.« Ihr Polohemd war schweißdurchtränkt.
»Ich auch.« Lisa trug Shorts und Joggingschuhe. »Ich hab mit der Hockeymannschaft trainiert. Warum willst du nur für eine Stunde kommen?«
»Ich hatte einen schweren Tag.« Das Match hatte Jeannie abgelenkt; nun aber zuckte sie zusammen, als der Schmerz sie wieder überkam. »Ich musste meine Mom in ein Heim bringen.«
»Oh, Jeannie, das tut mir schrecklich leid.«
Jeannie erzählte Lisa die Geschichte, als sie die Sporthalle betraten und die Treppe ins Kellergeschoss hinunterstiegen. Im Umkleideraum erhaschte Jeannie einen Blick auf ihrer beider Spiegelbilder. Ihr Äußeres war so verschieden, dass sie beinahe wie Darsteller in einer Slapstick-Komödie aussahen. Lisa war von knapp durchschnittlicher Größe, während Jeannie gut eins achtzig maß. Lisa war blond und kurvenreich; Jeannie dagegen dunkel und drahtig. Lisa besaß ein hübsches Gesicht mit bogenförmigem Mund und eine kleine, kesse, mit Sommersprossen gesprenkelte Nase. Die meisten Leute bezeichneten Jeannie als blendende Erscheinung, und Männer sagten ihr mitunter, dass sie attraktiv sei; aber als hübsch hatte sie noch niemand bezeichnet.
Als sie ihre verschwitzten Sportsachen auszogen, sagte Lisa: »Was ist mit deinem Vater? Von dem hast du noch nie erzählt.«
Jeannie seufzte. Es war die Frage, die sie schon als kleines Mädchen zu fürchten gelernt hatte; doch früher oder später wurde sie unweigerlich gestellt. Viele Jahre lang hatte sie gelogen und erklärt, ihr Daddy sei tot oder verschwunden oder wieder verheiratet und wäre nach Saudi-Arabien gegangen. In letzter Zeit jedoch hatte sie die Wahrheit gesagt. »Mein Vater ist im Gefängnis.«
»Oh Gott! Ich hätte nicht fragen sollen.«
»Schon gut. Er hat den größten Teil meines Lebens im Knast verbracht. Wegen Einbruchs. Er sitzt jetzt das dritte Mal.«
»Wie lange muss er denn hinter Gittern bleiben?«
»Ich weiß es nicht mehr. Spielt auch keine Rolle. Wenn er freikommt, wird er uns keine Hilfe sein. Er hat sich nie um uns gekümmert, und er wird auch in Zukunft nicht mehr damit anfangen.«
»Hatte er nie einen ordentlichen Beruf?«
»Nur wenn er ein Geschäft ausspionieren wollte. Er hat zwei, drei Wochen als Hausmeister, Türsteher oder Sicherheitsmann gearbeitet, bevor er den Laden ausgeraubt hat.«
Lisa schaute die Freundin verschmitzt an. »Interessierst du dich deshalb so sehr für die Frage, ob Kriminalität vererbbar ist?«
»Kann sein.«
»Oder auch nicht.« Lisa machte eine wegwerfende Handbewegung. »Amateurpsychologie kann ich sowieso nicht ausstehen.«
Sie gingen in den Duschraum. Jeannie brauchte länger, weil sie sich noch die Haare wusch. Sie war dankbar für Lisas Freundschaft. Lisa war seit gut einem Jahr an der Jones Falls; sie hatte Jeannie herumgeführt, als diese zu Beginn des Semesters an die Uni gekommen war. Jeannie arbeitete im Labor gern mit der freundlichen und verlässlichen Lisa zusammen, und nach Feierabend ging sie ebenso gern mit ihr aus – zumal sie Lisa alles anvertrauen konnte, was es auch sein mochte, ohne befürchten zu müssen, ihr einen Schock zu versetzen.
Jeannie rieb sich gerade Pflegespülung ins Haar, als sie seltsame Geräusche vernahm. Sie hielt inne und lauschte. Es hörte sich wie entsetztes Kreischen an. Eine eiskalte Woge der Angst durchflutete Jeannie und ließ sie schaudern. Plötzlich kam sie sich schrecklich verletzlich vor: nackt, nass, im Kellergeschoss. Sie zögerte; dann kämmte sie sich rasch das Haar, bevor sie unter der Dusche hervortrat, um nachzusehen, was los war.
Jeannie war kaum aus dem Duschstrahl heraus, als ihr auch schon der Brandgeruch in die Nase stieg. Sie konnte nirgends ein Feuer sehen, doch unter der Decke wogten dichte Wolken schwarzen und grauen Rauches. Er schien durch die Lüftungsrohre in den Raum zu strömen.
Jeannie hatte Angst. Sie war noch nie in einem brennenden Gebäude gewesen.
Die weniger schreckhaften Mädchen schnappten sich ihre Taschen und eilten zur Tür. Andere wurden hysterisch, schrien sich mit schriller Stimme an und rannten ziellos umher. Irgendein Arschloch von Sicherheitsmann, der sich ein gepunktetes Tuch vor Mund und Nase hielt, verschreckte die Mädchen noch mehr, indem er auf und ab stapfte, sie umherschubste und Befehle brüllte.
Jeannie war klar, dass sie nicht bleiben sollte, um sich anzuziehen, doch sie brachte es nicht über sich, das Gebäude nackt zu verlassen. Die Furcht strömte wie Eiswasser durch ihre Adern, aber sie zwang sich zur Ruhe. Sie eilte zu ihrem Spind. Lisa war nirgends zu sehen. Jeannie schnappte sich ihre Sachen, schlüpfte in die Jeans und zog sich ihr T-Shirt über den Kopf.
Es dauerte nur wenige Sekunden, doch in dieser kurzen Zeit leerte sich der Raum von Menschen und wurde von Rauch erfüllt. Jeannie konnte den Türeingang nicht mehr ausmachen, und sie begann zu husten. Der Gedanke, nicht atmen zu können, erfüllte sie mit Entsetzen. Du weißt, wo die Tür ist!, sagte sie sich. Du musst nur die Ruhe bewahren! Ihre Schlüssel und ihr Geld steckten in der Jeanstasche. Sie nahm ihren Tennisschläger, hielt den Atem an und ging rasch an den Spinden vorüber zum Ausgang.
Der Flur war von dichtem Rauch erfüllt, und Jeannies Augen tränten so sehr, dass sie fast blind war. Jetzt wünschte sie sich sehnlichst, sie wäre nackt aus dem Umkleideraum gestürmt und hätte auf diese Weise ein paar kostbare Sekunden gewonnen. Ihre Jeans konnten ihr schließlich nicht helfen, in diesen Rauchschwaden zu sehen oder zu atmen. Und für einen Toten spielte es keine Rolle, ob er nackt war.
Jeannie hielt ihre zitternde Hand an die Wand gepresst, um ein Gefühl für die Richtung zu haben, als sie über den Flur stolperte, wobei sie noch immer den Atem anhielt. Sie rechnete damit, gegen andere Mädchen zu prallen, doch alle anderen schienen vor ihr ins Freie gelangt zu sein.
Als ihre Hand die Wand nicht mehr spürte, wusste Jeannie, dass sie in den kleinen Vorraum gelangt war, wenngleich sie nur Rauchwolken sehen konnte. Die Treppe musste genau vor ihr liegen. Jeannie tastete sich weiter und stieß gegen den Cola-Automaten.
Befand sich die Treppe von hier aus rechts oder links? Links, sagte sich Jeannie und bewegte sich in diese Richtung, gelangte jedoch zur Tür der Männerumkleidekabine und erkannte, dass sie die falsche Wahl getroffen hatte.
Sie konnte den Atem nicht mehr anhalten. Mit einem Schluchzer sog sie die Luft ein, die dermaßen mit Rauch geschwängert war, dass Jeannie krampfhaft husten musste. Mit taumelnden Schritten tastete sie sich an der Wand entlang in Gegenrichtung, von Hustenanfällen geschüttelt. Ihre Augen tränten; der Rauch brannte ihr in der Nase, und sie konnte kaum die Hand vor Augen sehen. Mit jeder Faser ihres Seins sehnte Jeannie sich danach, frische Luft atmen zu können, wie sie es neunundzwanzig Jahre lang als selbstverständlich erachtet hatte.
An der Wand tastete Jeannie sich bis zum Cola-Automaten vor und umrundete ihn. Sie wusste, dass sie die Treppe gefunden hatte, als sie über die unterste Stufe stolperte. Sie ließ den Tennisschläger fallen, und er schlitterte davon und verschwand. Es war ein besonderer Schläger – mit ihm hatte sie das Turnier von Mayfair Lites gewonnen –, doch sie ließ ihn liegen und kroch auf Händen und Knien die Treppe hinauf.
Plötzlich wurde der Rauch dünner, als sie in die große Halle im Erdgeschoss gelangte. Sie konnte die Eingangstüren sehen; sie waren geöffnet. Draußen stand ein Sicherheitsmann. Er winkte ihr und rief: »Kommen Sie! Kommen Sie her!« Keuchend und hustend taumelte Jeannie durch die Eingangshalle und hinaus an die herrliche frische Luft.
Zwei, drei Minuten stand sie auf den Stufen, würgend und nach Atem ringend, und hustete den Rauch aus ihren Lungen. Als ihre Atmung sich halbwegs normalisiert hatte, hörte sie in der Ferne die Sirene eines Rettungswagens. Sie schaute sich nach Lisa um, konnte sie aber nirgends entdecken.
Sie war doch bestimmt nicht mehr in der Sporthalle? Oder doch? Immer noch zittrig, bewegte Jeannie sich durch die Menge und ließ den Blick über die Gesichter schweifen. Jetzt, da sich alle außer Gefahr befanden, war von allen Seiten unsicheres, nervöses Lachen zu hören. Die meisten waren mehr oder weniger angezogen, sodass eine seltsam vertrauliche Atmosphäre herrschte. Jene, die ihre Taschen hatten retten können, reichten anderen, die nicht so viel Glück gehabt hatten, überschüssige Kleidungsstücke. Nackte Mädchen nahmen dankbar die schmutzigen, verschwitzten T-Shirts ihrer Freundinnen entgegen. Einige hatten sich nur Handtücher um den Leib geschlungen.
Lisa war nicht in der Menge. Mit wachsender Besorgnis kehrte Jeannie zu dem Wachmann an der Tür zurück. »Ich glaube, meine Freundin ist noch in der Halle«, sagte sie und hörte das Zittern der Furcht in der eigenen Stimme.
»Ich kann nicht nach ihr sehen«, entgegnete der Mann rasch.
»Was für ein tapferer Kerl!«, sagte Jeannie mit scharfer Stimme. Sie wusste selbst nicht, was sie von dem Mann erwartete; aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass er überhaupt keine Hilfe war.
Auf dem Gesicht des Mannes spiegelte sich Zorn. »Das ist ihre Aufgabe«, sagte er und wies auf einen Löschzug, der die Straße herunterkam.
In Jeannies Innerem wuchs die Furcht um Lisas Leben, doch sie wusste nicht, was sie tun sollte. Ungeduldig und hilflos beobachtete sie, wie die Feuerwehrleute aus dem Löschzug stiegen und sich Atemmasken aufsetzten. Die Männer schienen sich so langsam zu bewegen, dass Jeannie sie am liebsten geschüttelt und angeschrien hätte: »Macht schnell! Macht schnell!« Ein weiterer Löschzug traf ein; dann ein weißes Polizeifahrzeug mit dem blauen und silbernen Streifen des Baltimore Police Department.
Während die Feuerwehrleute einen Schlauch ins Gebäude zerrten, knöpfte der leitende Einsatzbeamte sich den Wachmann der Sporthalle vor und fragte: »Wo, meinen Sie, ist das Feuer ausgebrochen?«
»Im Damenumkleideraum«, antwortete der Wachmann.
»Und wo genau ist der?«
»Kellergeschoss. Hinterer Teil.«
»Wie viele Ausgänge gibt es im Kellergeschoss?«
»Nur einen. Da vorn, die Treppe, die rauf zur Haupthalle führt.«
Ein Wartungsmann, der in der Nähe stand, widersprach ihm. »Im Maschinenraum des Schwimmbeckens gibt’s ’ne Leiter. Sie führt zu ’ner Einstiegsluke im hinteren Teil der Halle.«
Jeannie trat auf den Feuerwehrchef zu. »Ich glaube, es ist noch jemand im Gebäude!«, sagte sie drängend. »So tun Sie doch was!«
»Mann oder Frau?«
»Eine Frau. Vierundzwanzig. Klein, blond.«
»Wenn sie in der Halle ist, werden wir sie finden.«
Für einen Moment war Jeannie erleichtert. Dann erst wurde ihr klar, dass der Feuerwehrchef ihr nicht versprochen hatte, Lisa lebend zu finden.
Der Sicherheitsmann, der im Umkleideraum gewesen war, war nirgends zu sehen. »Da war noch ein anderer Wachmann«, sagte Jeannie zum Feuerwehrchef. »Unten, im Kellergeschoss. Ein hochgewachsener Kerl. Ich kann ihn nirgendwo sehen.«
»In dem Gebäude gibt es kein weiteres Sicherheitspersonal«, sagte der Wachmann.
»Aber er trug eine Mütze, auf der ›Security‹ stand, und er hat den Leuten gesagt, sie sollen das Gebäude verlassen!«
»Es ist mir egal, was er auf der Mütze …«
»Herrgott noch mal, wir haben keine Zeit für Diskussionen!«, fuhr Jeannie ihn an. »Vielleicht habe ich mir den Kerl nur eingebildet. Aber wenn nicht, ist sein Leben in Gefahr!«
In der Nähe stand ein Mädchen in einer Männerhose mit hochgerollten Aufschlägen und hörte ihnen zu. »Ich hab den Mann auch gesehen«, sagte sie. »Ein widerlicher Typ. Er hat mich begrapscht.«
Der Feuerwehrchef erklärte: »Bewahren Sie Ruhe, wir werden jeden finden. Danke für Ihre Mithilfe.« Damit ging er davon.
Für einen Augenblick starrte Jeannie den Wachmann an. Sie spürte, dass der Feuerwehrchef sie für eine hysterische Zicke hielt, weil sie den Wachmann angeschrien hatte. Zornig wandte sie sich ab. Was sollte sie jetzt tun? Die Feuerwehrleute stürmten in ihren Helmen und Stiefeln ins Gebäude. Sie selbst war barfuß und trug nur Jeans und ein T-Shirt. Sollte sie versuchen, gemeinsam mit den Feuerwehrleuten in die Sporthalle einzudringen, würden die Männer sie hinauswerfen. Verzweifelt ballte Jeannie die Fäuste. Denk nach! Denk nach! Wo könnte Lisa stecken?
Die Sporthalle stand neben dem Gebäude des Psychologischen Instituts, das nach Ruth W. Acorn benannt war, der Frau eines Gönners der Uni. Doch allgemein wurde das Gebäude – selbst innerhalb des Instituts – als »Klapsmühle« bezeichnet. Hatte Lisa sich dorthin geflüchtet? Sonntags waren die Türen zwar abgeschlossen, doch Lisa besaß wahrscheinlich einen Schlüssel. Möglicherweise war sie ins Gebäude gerannt, um sich einen Laborkittel zu besorgen und damit ihre Blößen zu bedecken. Oder sie hatte sich einfach an ihren Schreibtisch gesetzt, um sich von dem Schock zu erholen. Jeannie beschloss nachzusehen. Alles war besser, als untätig herumzustehen.
Sie flitzte über den Rasen zum Haupteingang der Klapsmühle und spähte durch die Glastüren. In der Eingangshalle war niemand. Jeannie zog ihre Plastikkarte aus der Tasche, die als Schlüssel diente, und ließ sie durch das Kartenlesegerät gleiten. Die Tür öffnete sich. Jeannie stürmte die Treppe hinauf und rief: »Lisa! Bist du da?« Das Labor war menschenleer. Lisas Stuhl war ordentlich unter den Schreibtisch geschoben, und der Monitor ihres Computers war grau und leer. Jeannie schaute auf der Damentoilette am Ende des Flurs nach. Nichts. »Verdammt!«, stieß sie verzweifelt hervor. »Wo steckst du?«
Keuchend eilte sie nach draußen. Sie beschloss, die Sporthalle zu umrunden, für den Fall, dass Lisa irgendwo auf dem Boden saß und nach Atem rang. Jeannie rannte an einer Seite des Gebäudes entlang und über einen Hof, auf dem riesige Müllbehälter standen. Auf der Rückseite der Halle befand sich ein kleiner Parkplatz. Jeannie sah, dass eine Gestalt im Laufschritt über den Gehweg eilte und sich dabei von der Halle entfernte. Die Gestalt war zu groß, als dass es Lisa hätte sein können. Jeannie war ziemlich sicher, dass es ein Mann war, vielleicht der vermisste Mann vom Wachdienst. Doch bevor Jeannie sicher sein konnte, verschwand die Gestalt um eine Ecke des Gebäudes der Studentenvereinigung.
Jeannie setzte den Weg um die Halle fort. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich der Sportplatz; auch er war verlassen. Jeannie umrundete ergebnislos die gesamte Halle und gelangte wieder zum Gebäudeeingang.
Die Menge war angewachsen; weitere Löschfahrzeuge und Polizeiwagen waren eingetroffen, doch von Lisa war weit und breit nichts zu sehen. Sie musste sich noch in dem brennenden Gebäude befinden; es konnte gar nicht anders sein. Das Gefühl einer sich anbahnenden Katastrophe durchströmte Jeannie, doch sie wehrte sich dagegen. Das darfst du nicht zulassen!
Jeannie sah den Feuerwehrchef, mit dem sie zuvor schon gesprochen hatte, ging zu ihm und packte seinen Arm. »Ich bin sicher, dass Lisa Hoxton noch in der Halle ist«, sagte sie drängend. »Ich habe überall nach ihr gesucht.«
Der Feuerwehrchef bedachte Jeannie mit einem prüfenden Blick und schien zu der Ansicht zu gelangen, dass man ihr glauben konnte. Ohne ihr zu antworten, hielt er sich ein Funksprechgerät vor den Mund. »Haltet nach einer jungen weißen Frau Ausschau. Sie könnte sich noch im Gebäude befinden. Ihr Name ist Lisa. Ich wiederhole: Lisa.«
»Danke«, sagte Jeannie.
Er nickte knapp und schritt davon.
Jeannie fiel ein Stein vom Herzen, dass der Mann so prompt reagiert hatte, doch ruhig war sie deshalb noch lange nicht. Lisa konnte irgendwo in der Halle gefangen sein. In einem Waschraum eingeschlossen oder von Flammen an der Flucht gehindert, schrie sie vielleicht um Hilfe, ohne dass jemand sie hörte. Oder sie war gestürzt, mit dem Kopf aufgeschlagen, und hatte das Bewusstsein verloren. Oder sie war vom Rauch ohnmächtig geworden und lag besinnungslos am Boden, während die Flammen mit jeder Sekunde näher krochen.
Jeannie fiel plötzlich wieder ein, was der Wartungsmann gesagt hatte – dass es einen weiteren Zugang zum Kellergeschoss gab. Sie hatte diesen Zugang nicht gesehen, als sie aus der Halle gerannt war, und beschloss, noch einmal nachzuschauen. Sie kehrte auf die Rückseite des Gebäudes zurück.
Und sah sie sofort. Die Einstiegsluke befand sich im Boden, dicht an der Mauer, und wurde teilweise von einer grauen Limousine verdeckt, einem Chrysler New Yorker. Die stählerne Klapptür stand offen und lehnte an der Gebäudewand. Jeannie kniete neben dem viereckigen Loch nieder und beugte sich vor, um in die Tiefe zu schauen.
Eine Leiter führte in einen schmutzigen Raum hinunter, der von Neonröhren erleuchtet wurde. Jeannie konnte Maschinen und ein Gewirr von Rohrleitungen sehen. Dünne Rauchschwaden schwebten in der Luft, aber keine dichten Qualmwolken.
Der Raum war offenbar vom übrigen Teil des Kellergeschosses getrennt. Dennoch musste Jeannie beim Geruch des Rauches daran denken, wie sie gehustet und gekeucht hatte, als sie blind nach der Treppe suchte, und sie spürte, wie ihr Herz heftiger schlug, als sie sich daran erinnerte.
»Ist da jemand?«, rief sie.
Sie glaubte, ein Geräusch gehört zu haben, war sich aber nicht sicher. Sie rief lauter. »Hallo?« Keine Antwort.
Jeannie zögerte. Das Vernünftigste wäre, wieder zum Eingang der Halle zurückzukehren und sich einen Feuerwehrmann zu schnappen. Aber das konnte zu lange dauern, besonders wenn der Mann sich vorher genauer erkundigte. Die andere Möglichkeit bestand darin, die Leiter hinunterzusteigen und sich umzuschauen.
Bei dem Gedanken, wieder in die Halle zurückzukehren, bekam Jeannie weiche Knie. Ihre Brust schmerzte immer noch von den krampfartigen Hustenanfällen, die der Rauch verursacht hatte. Aber Lisa konnte irgendwo da unten sein, verletzt und nicht mehr fähig, sich zu bewegen; oder sie war von einem heruntergestürzten Balken eingeklemmt oder einfach nur bewusstlos. Jeannie musste nachschauen.
Sie gab sich einen Ruck und setzte einen Fuß auf die Leiter. Ihre Beine waren schwach, und um ein Haar wäre sie gestürzt. Sie zauderte. Nach einigen Sekunden fühlte sie sich kräftiger und setzte den Fuß erneut auf eine Sprosse. Im selben Moment atmete sie einen Schwall Rauch ein. Sie musste husten und kletterte wieder nach oben.
Als der Hustenanfall geendet hatte, versuchte sie es noch einmal.
Sie stieg eine Sprosse hinunter, dann zwei. Wenn du von dem Rauch nur husten musst, sagte sie sich, wirst du schon rechtzeitig wieder nach oben kommen. Der dritte Schritt war leichter; dann stieg Jeannie rasch die Leiter bis zum Ende hinunter und sprang von der letzten Sprosse auf dem Betonboden.
Sie befand sich in einem großen Raum voller Pumpen und Filter, die vermutlich für das Schwimmbecken dienten. Es roch durchdringend nach Rauch, doch Jeannie konnte normal atmen.
Sie sah Lisa sofort, und bei dem Anblick schrie sie auf.
Lisa lag auf der Seite, nackt, in fötaler Haltung, die Knie an den Leib gezogen. Auf ihrem Oberschenkel war irgendetwas Dunkles, Verschmiertes zu erkennen, das wie Blut aussah. Sie rührte sich nicht.
Für einen Moment war Jeannie starr vor Angst.
Sie versuchte, die Beherrschung wiederzuerlangen. »Lisa!«, rief sie, hörte den schrillen Beiklang von Hysterie in ihrer Stimme und atmete tief durch, um sich zu beruhigen. Bitte, lieber Gott, lass ihr nichts passiert sein! Sie ging durch den Maschinenraum, bewegte sich durch das Gewirr von Rohrleitungen und kniete neben der Freundin nieder. »Lisa?«
Lisa schlug die Augen auf.
»Gott sei Dank«, sagte Jeannie. »Ich dachte, du wärst tot.«