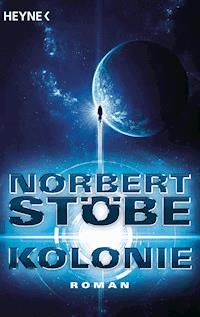5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Zehn SF-Storys von Norbert Stöbe – zehn gute Gründe, dieses Buch zu lesen. Mit den Gewinnerstorys "Der Durst der Stadt" (KLP 1995) und "Zehn Punkte" (DSFP 1992). Stöbe beschreibt in seinen Geschichten Skurriles, Phantastisches und entrückt das Alltägliche dabei stets der Ultima Ratio.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Ähnliche
Norbert Stöbe
DER DURST DER STADT
und andere SF-Geschichten
s*ernwerk 1
Norbert Stöbe
DER DURST DER STADT
und andere SF-Geschichten
s*ernwerk 1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Juni 2016
Sven Klöppings s*ernwerk & p.machinery Michael Haitel
Titelbild & Illustrationen (in der Printausgabe): Peter Wall
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat: Sven Klöpping, Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda, Xlendi
Sven Klöppings s*ernwerk im Verlag p.machinery Michael Haitel
Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee
sternwerk.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 000 9
Zehn Punkte
Martin wusste einen Moment lang nicht, ob es Morgen oder Abend war. Er brachte den rasselnden Wecker mit der Faust zum Schweigen und suchte in der kreiselnden Leere seines Kopfs nach einem Grund zum Aufstehen.
Seit dreieinhalb Jahren war er arbeitslos. Zwei erfolglose Entziehungskuren, das ständige Zuspätkommen, seine wachsende Konzentrationsschwäche, die nicht mehr vorhandene Belastbarkeit – untragbar für den Betrieb. Er war ein Spacer, für die Arbeitswelt verloren, Ausschuss. Er hatte keine Frau, keine Freunde, keine Katze, keinen Kanarienvogel, er besaß nicht einmal mehr ein Bankkonto. Die Raten für den letzten Dauerüberziehungskredit bei der Sparkasse wurden ihm von der Sozialhilfe abgezogen, die er sich bei seinem Sozialhelfer allwöchentlich in bar abholte. Seitdem ihm die Sparkasse das Konto gekündigt hatte, stand er auf irgendeiner Schwarzen Liste; kein Konto, keine Kreditkarte, kein Überziehungskredit, nichts mehr. Warum also aufstehen? Wozu hatte er überhaupt den Wecker gestellt?
Die Erinnerung durchzuckte ihn wie ein Stromstoß – ein schwacher Stromstoß nur, aber doch genug, dass er sich aufsetzte und mit den Zehen zwischen Chipskrümeln und leeren Bierflaschen einen Platz für die Füße suchte. Stöhnend kam er auf die Beine, rieb sich die verklebten Augen und bemerkte anschließend das rote Blinken.
Der Anrufbeantworter. Jemand hatte ihn angerufen.
Er versuchte sich zu erinnern, wie lange es her war, dass das Telefon bei ihm geklingelt hatte, aber es fiel ihm nicht ein. Er wusste nur noch, dass ihm jemand französischen Landwein zum Vorzugspreis hatte verkaufen wollen, zehn Flaschen für neunundachtzig Mark fünfzig. Eine angenehme Altstimme war das gewesen, und er hatte das Gespräch mit ihr genossen, und davor war es ein Anlageberater gewesen, der sich von der noch nicht gelöschten Eintragung im Telefonbuch (Ingenieur war er einmal gewesen) auf eine falsche Spur hatte locken lassen. Im neuen Telefonbuch hieß es nur noch Pape, Martin, und seitdem war er auch bei den Telefonverkäufern unten durch. Vielleicht war es ja ein Meinungsforscher, der ihn über Rasiergewohnheiten oder Wahlverhalten befragen wollte, aber Martin war noch nicht nach Zwischenmenschlichem zumute. Er warf ein Handtuch über den blinkenden Anrufbeantworter und tappte, nur mit Unterhose bekleidet, an schmutzigen Wäschestapeln vorbei durch das Halbdunkel der zugezogenen Vorhänge ins Bad.
Er entleerte seine Blase, spritzte sich halbherzig kaltes Wasser ins Gesicht und hob, die Arme aufs Waschbecken gestützt, die Augen zum Spiegel. Hundert Jahre Einsamkeit, ging es ihm beim Anblick seines verwüsteten Gesichts durch den Sinn, eine Erinnerung an einen Buchtitel, den er im Vorbeigehen im Schaufenster eines Antiquariats gesehen und der ihn zwar nicht zum Kauf motiviert, aber doch stark beeindruckt hatte. Und als hätte jemand einen Schalter umgelegt, wurde das Blinzeln seiner verquollenen, brennenden Augen zu einem roten Glimmen, zum rosafarbenen Rechteck mit dem roten Balken diagonal hindurch, zum verdoppelten Anti-Cyberspace-Emblem, mit dem das Gesundheitsministerium seine Aufklärungsbroschüre ›Zehn Punkte, die Ihnen helfen können‹ schmückte. Und während seine Gesichtszüge noch weiter verschwammen – sie ›gingen auf‹ wie die tiefgefrorenen panierten Camemberts, die er manchmal in der Mikrowelle erhitzte –, formten sich darüber dicke weiße Buchstaben, die wie eine gescrollte Computerschrift langsam von oben nach unten über den Spiegel liefen – die hilfreichen zehn Punkte des Gesundheitsministeriums:
1. Haben Sie morgens gerötete, tränende Augen?
2. Zittern Ihnen beim Aufstehen die Hände?
3. Kommt es häufiger vor, dass Sie eine Mahlzeit versäumen?
Das Kleingeschriebene unter den Fragen konnte er nicht lesen, er wusste aber auch so, dass die Sätze alle mit ›Dann‹ anfingen und einem weismachen wollten, man sei wieder einmal reif für eine Entziehungskur. Martin wandte sich stöhnend vom Spiegel ab, zog den lockeren Bund der Unterhose hoch und schlurfte zur Kochnische.
Über Nacht war der Stapel leerer Konservenbüchsen umgefallen, und durch dessen mehr oder minder flächendeckende Verteilung auf dem Boden schien sich der Gestank verdoppelt zu haben. Ich muss zum Mülleimer runtergehen, dachte Martin und vergaß es wieder, als er vor dem summenden Kühlschrank stand, bis zu den Waden in Konservendosen und Klopapierrollen versunken. Beim Gedanken an das muffige Toastbrot und die Ölsardinen in ihren Blechsärgen wurde ihm übel. Einen Moment lang dachte er daran, den Nagel herauszuziehen, der das defekte Springrollo unten hielt, und nachzusehen, ob der Aachener Dom noch stand. Wie auf einer Ansichtskarte konnte er ihn an sonnigen Tagen im dunstverhangenen Stadtzentrum liegen sehen, aber eine ebensolche Ansichtskarte pappte neben dem Fenster an der Wand, und je länger er mit dem Hinaussehen wartete, desto größer wurde die Wahrscheinlichkeit, dass er eines Tages tatsächlich etwas Überraschendes draußen sah, vielleicht sogar … Martin lachte in sich hinein. Plötzlich hatte er es eilig, holte eine Flasche Multivitaminsaft aus dem Getränkefach, goss sich ein Glas voll und führte es mit beiden Händen an den Mund, damit er nichts verschüttete. Als er getrunken hatte, fühlte er sich schon erheblich besser. Er riss die Ansichtskarte von der Wand ab und warf sie zwischen die Konservendosen. Dann ging er in sein Schlafwohnzimmer zurück und setzte sich vor den Computer.
Martin hatte sich nicht die Mühe gemacht, sich anzuziehen. Es war Sommer, und in seiner Wohnung war es stickig-warm. Vielleicht hätte er seine Unterhose wechseln können, aber dann hätte er erst waschen müssen, und dazu hatte er keine Lust, nicht heute, nicht jetzt. Und sollte wirklich, solange er noch ›draußen‹ war, der Briefträger mit einer eingeschriebenen Mahnung klingeln – solche Leute waren ganz andere Anblicke gewohnt, Briefträger waren die Zahnärzte der Gesellschaft, sie guckten dem sozialen Ausschuss in den Zimmerschlund, und manchmal bohrten sie sogar – zum Beispiel bei der rothaarigen Schlampe von gegenüber.
Martin kicherte wieder, inzwischen war er richtig gut in Form, er war heiß. Wie stets, wenn er vor den elfenbeinweißen Tasten des Keyboards saß, mit dem fünf Jahre alten, aber immer noch unübertroffenen NEC-Monitor und dem Commodore 586 Slimline dahinter, durchrieselte ihn Stolz. Diese Anlage war sozusagen die Frucht seines Arbeitslebens, nichts war umsonst gewesen, alles hatte sich gelohnt. In monatelanger Arbeit hatte er das Basisprogramm mit Informationen und Bildern gefüttert, bis er seinen Traum verwirklicht hatte. In den Elektronenströmen der Mikrochips wohnte das Leben; es wartete auf ihn, es lockte, es lud ihn ein.
Rasch überprüfte er die Ladeanzeige des Notstromakkus, sozusagen sein Fallschirm im Falle eines Stromausfalls, mit dem er weich in der Realität landen konnte, während anderenfalls beim Absturz des Programms die Gefahr eines psychischen Schocks bestanden hätte, der wochen- oder monatelange Behandlungen notwendig machte; ausgebrannt, hieß es dann. Solche Fälle kannte er persönlich, beziehungsweise aus der Mailbox, und vielleicht war ja auch Übertreibung mit im Spiel, aber Vorsorge war in jedem Fall besser.
Er spreizte kurz die Finger der rechten Hand – fünf vibrierende Spinnenbeine –, dann schlüpfte er in den Anzug. Es war ein ebenfalls fünf Jahre alter Nintendo SX-3000, Black Line natürlich, mit fünfundzwanzig Sensoren und sechzehn Pneumoelementen. Als er den Brustschalter drückte, spürte er, wie sich der seidenweiche Stoff um Waden, Schenkel, Bauch und Schultern straffte. In der ersten Zeit hatte ihn diese fast lebendige Umhüllung jedes Mal in sexuelle Erregung versetzt, doch das war lange her.
Das Zittern seiner Hände verstärkte sich, seine Bewegungen wurden schneller. Er schaltete den Monitor ein; im Menü blinkte das Kästchen für die Mailbox, was bedeutete, die Modemverbindung war gestört. Merkwürdig. Sein Blick streifte das Handtuch, das er über den Anrufbeantworter geworfen hatte. Einen Moment lang erwog er, aufzustehen und nachzuschauen, wer ihn angerufen hatte. Aber was war ein Anruf verglichen mit dem Leben selbst? Nein, es war zu spät. Keine Zeit mehr, keine Zeit. Sein Mund verzerrte sich vor nicht mehr zu beherrschender Gier. F1, START und Enter.
Auf dem Bildschirm explodierte das 3-D-Logo von Sierra Games. Martin stülpte sich den Helm über den Kopf, streifte die Handschuhe über und drückte ein zweites Mal die Entertaste. Mit einem kaum wahrnehmbaren Summen justierten sich die Helmspiegel und Pupillentracer, das Helmvisier polarisierte sich, das Bildschirmrechteck verschwand, es wurde dunkel.
Ein Moment höchster Erwartung, einer Erwartung, die schon Gewissheit war; für Martin immer Anlass einer gebremsten, quälend-köstlichen Ekstase, einer gleichsam omnipotenten Transzendenz, ein Schweben wie in einer fünften, sechsten, siebten Dimension, während sein Nichtkörper sich anschickte, Sterne und Galaxien ins Nichts hinein zu ejakulieren: dann Dämmerung, Geräusche, die Geburt einer Welt – er war ›drin‹.
Martin stand inmitten der Panoramakuppel seines Jagdschlosses, das auf den versunkenen Resten des Ponttores gebaut worden war. Aus den grünlich braunen Schlammfluten ringsum ragten an einigen Stellen die Kronen alter Kastanienbäume, in deren kahl gewordenen Ästen Archäopteryxvögel ihr leuchtend blaues Gefieder putzten. Rechts, in Richtung der höher gelegenen Innenstadt, erhoben sich, umrahmt von den Kirchtürmen von St. Anna, St. Nikolaus, St. Peter und St. Marien, das Rathausdach mit seinen beiden Uhrtürmen und dahinter das einem umgekippten Boot ähnliche Dach der Chorhalle des Doms, jetzt beide Ruheinseln der gelb gepunkteten, fleischfressenden Varanosauren. Schräg dahinter schimmerte das dunkelgraue Obergeschoss der Stadtverwaltung durchs Wasser hindurch, und noch weiter im Südwesten, aber viel näher als der ferne bläuliche Höhenzug der Eifel weiter zur Linken, erhob sich der bewaldete Hügel mit dem Funkturm, hinter dem das ebenfalls versunkene Belgien lag.
Links, im Norden, lag die von einem grünen Meer von Schachtelhalmen umgebene Kuppe des Lousbergs; die Eiben waren längst überwuchert, und ganz oben, am Fuße des alten Drehrestaurants, blühten weiß und rot die Magnolien. Ein schwacher Südostwind trieb weiße Kumuluswolken über den Himmel, vermischt mit den ins Graue spielenden Rauchfahnen der wiedererwachten Eifelvulkane.
Martin reckte und streckte sich, genoss das Gefühl, einen durchtrainierten, muskulösen Körper zu haben. Wie als Antwort darauf erdröhnte das Jagdschloss und der Boden erzitterte, als sich wohl ein Bronto an den tief im Untergrund verankerten Teleskopstützen rieb.
»Guten Morgen, Liebster!«, gurrte eine Sissy-Spacek-Stimme hinter seinem Rücken. »Was kann ich für dich tun?«
Martin drehte sich um. Von der sonnenüberströmten Konturliege an der transparenten Kuppelwand erhob sich eine langhaarige Blondine und lächelte ihn grünäugig und sommersprossig an. Sie trug ein durchsichtiges Negligé, unter dem sich ihre dunklen Brustspitzen und die Schamhaare abzeichneten. Ihre reizenden Füßchen steckten in goldbestickten Pantoffeln.
»Hallo, Ute«, sagte Martin. »Wie geht’s?«
»Ich heiße Sissy«, sagte das Mädchen ohne Vorwurf und drehte sich kokett auf der Stelle, die Arme in die Hüften gestemmt, das Haar ein wirbelnder leuchtender Ring. »Rate mal, von wem ich heute Nacht geträumt hab.«
»Von mir«, sagte Martin; die alte Leier. Sissy hatte immer von ihm geträumt, und dann wollte sie, dass er ›den Hund machte‹, wie sie es nannte, auf allen vieren kroch, sie beschnüffelte und in die Waden biss. Er senkte den Blick, bis die grünlich leuchtende Menüleiste von unten herauf tauchte. Er fixierte das gewünschte Feld und zwinkerte zweimal. Dann den Cursor auf F8, zweimal Tab und Enter.
Sissys Konturen verschwammen. Ihr mädchenhafter Körper löste sich in ein flirrendes Muster vielfarbiger Sterne auf, die miteinander verschmolzen, eindunkelten, kondensierten. Einen Moment lang sah er noch das digitale Grundraster, dann siegte die Illusion.
Maria war älter als Sissy, hatte schulterlanges, brünettes Haar mit einem Stich Henna darin, und ihre Bluse und die hautengen Jeans waren schwarz. Sie schüttelte sich das Haar aus dem Gesicht, sah auf ihre Armbanduhr, runzelte die Stirn und sagte mit rauchiger Altstimme: »Du hast mich warten lassen. Du weißt doch, dass ich es nicht ausstehen kann, wenn man mich warten lässt.« Sie sah auf den Boden hinunter, kickte unwillig etwas in Martins Richtung, dann wandte sie ihm den Rücken zu, trat an die Wand und blickte mit vorwurfsvoll hochgezogenen Schultern hinaus.
Nanu, dachte Martin. Er blickte erstaunt auf Sissys Pantoffeln hinab. Sissy hatte noch nie etwas vergessen, ja, er wusste nicht einmal, ob es überhaupt möglich war, dass sie oder eine der übrigen sieben Frauen etwas vergaß, wenn er sie durch eine andere ersetzte. Er bückte sich, wollte die Pantoffeln aufheben, aber plötzlich sagte Maria: »Martin, komm doch mal her.«
»Was?«
»Komm doch eben mal her.« Ihre Stimme klang überraschend hart, fast befehlend.
Er trat zu ihr an den Rand der Kuppel und blickte hinaus. Der Wind bog die überall an den seichteren Stellen aus dem Boden schießenden Schachtelhalme und kräuselte die eben noch glatte Wasseroberfläche. Verschwommen machte er die Umrisse der Heilig-Kreuz-Kirche aus, deren Turm ein Ankylosaurus mit seinem keulenförmig verdickten Schwanz zum Einsturz gebracht hatte, als der Wasserstand noch nicht so hoch gewesen war. Jetzt hatten sich diese Panzerechsen, wie die anderen reinen Landbewohner auch, auf die Hügel und den Lousberg zurückgezogen. Auch jetzt wieder war das Wasser über Nacht gestiegen, und die Teleskopstützen hatten sich automatisch ein Stück weiter ausgefahren. Wenn es so weiterging und die schmelzenden Polkappen das Süßwasser noch länger in diesem Tempo ins Landinnere drückten, dann wäre hier bald Meer, und er würde sein Unterseeboot aktivieren und Jagd auf Ichthyosauren, Sägefische und Riesenschildkröten machen können.
»Da!«, sagte Maria. Sie zeigte zum einstigen Kurpark hinüber, wo sich auf dem überwucherten Dach des Kongresszentrums etwas riesiges Dunkles inmitten einer Wolke aus Gischt herumwälzte; vielleicht zwei Saurier, die miteinander kämpften. Martin sah Maria an; ihr bleiches, ernstes Profil mit dem scharfen Grat der Nase, die gerunzelte Stirn, die dunklen Augen mit den langen schwarzen Wimpern, den vor innerer Anspannung zusammengepressten Mund. Sie kam ihm verändert vor, fast wie eine Fremde, und plötzlich hörte er das Geräusch ihres beschleunigten Atems und meinte, die Wärme ihres Körpers zu spüren. Er schluckte vor Erregung.
»Da!«, rief Maria. »Siehst du?«
Er blickte wieder hinaus. Das Toben hatte aufgehört. Ein Tyrannosaurus richtete sich auf, mit den Ärmchen rudernd, im Maul eine zuckende Schlange, nein, ein Stück Saurierschwanz. Er warf den Kopf zurück, das Schwanzstück rutschte zwischen die Zähne, verschwand im Schlund, die hellere Spitze zuletzt. Der Tyrannosaurus nickte zweimal mit dem Oberkörper, dann stieß er sich mit den gewaltigen Laufbeinen ab, landete in einer Wasserfontäne und verschwand im höher gelegenen Kurpark, jetzt ein Urwald aus Schuppenbäumen, Fächerpalmen und Lorbeer.
»Ja, und?«, sagte Martin und drehte Maria zu sich herum. Ihr Blick war noch dort draußen, die Augen weit, staunend, verwirrt. »Was ist denn, was hast du denn?«
»Ich … ich weiß nicht, da … das … der Dino, er war … er hatte …« Warum sah sie ihn nicht, warum zog sie nicht die Bluse aus und bot ihm ihren Mund? Trotzdem war sie schön in ihrer Selbstvergessenheit, vielleicht schöner denn je. Ja, Maria war die schönste von allen, ein seltener Glücksfall, der die Möglichkeiten des Programms sicher bis zur Neige ausgeschöpft hatte. Vielleicht sollte er sie Sierra Games anbieten, vielleicht nahmen sie Maria ja in die Bibliothek des Basisprogramms auf …
Plötzlich sah er, dass seine Fingerspitzen zitterten. Er fühlte das Pochen seiner Erektion und war einen Moment hin- und hergerissen zwischen seinem erwachenden Jagdfieber und dem Wunsch, Maria jetzt und hier zu nehmen, nicht auf der Liege, sondern gleich auf dem zentimeterdicken Teppich, aber ihr Kuss wäre geschmacklos und ihr Haar ohne Duft, und wenn er es jetzt mit ihr trieb, müsste er schon wieder den Anzug waschen, in dem die Pneumoelemente nur darauf warteten, sein pralles Glied durchzuwalken und zur Entladung zu bringen.
Ein erneutes Aufdröhnen der Teleskopstützen gab den Ausschlag; er verdrängte das Bild seines schlaff vor dem Monitor hingestreckten Körpers, seiner wartenden, leichenähnlichen Hülle, mit der er auf so geheimnisvolle Weise verbunden war und an der sein Leben und sein Fühlen hingen, schüttelte den leichten Anflug von Ekel ab, den er jedes Mal bei diesem Gedanken empfand, ließ Maria einfach stehen und ging entschlossenen Schritts zum Aufzug, der ihn zur Waffenkammer bringen würde.
Saurierjagd war etwas anderes als die Jagd auf Füchse, Bären oder Löwen. Man brauchte dazu eine starke Hand, einen kühlen Kopf – und eine erstklassige Ausrüstung, auf die man sich blindlings verlassen konnte.
Martin schlüpfte in eine kevlarverstärkte Ganzkörpermontur aus Leder und wählte ein einfaches Messer, eine Elektromachete, einen Stahlbogen samt Karbonpfeilen mit Explosivspitze und einen Teleskopspeer mit Akku, der für Stromstöße von 200.000 Volt gut war. Das Messer und die Machete befestigte er am Gürtel, Speer, Bogen und Köcher hängte er sich auf den Rücken.
An blitzenden Haken hingen weitere Waffen, vor denen er manchmal stundenlang verweilen konnte; Gewehre, Blaster, Flammenwerfer, Harpunen, Bumerangs, Bolas und mächtige dornenbesetzte Keulen, und in den Regalen lagen Hunderte von Messern und Säbeln, sogar fernsteuerbare Drohnen. Jeder Schritt brachte diese glitzernde Pracht leise zum Klirren, als wohnte den Waffen ein eigenes, über den Tod triumphierendes Leben inne. Doch heute zog es ihn mit Macht nach draußen, ja er zitterte vor Vorfreude so sehr, dass die Pfeile im Köcher sogar dann klirrten, wenn er stand.
Vielleicht hätte er ausnahmsweise doch besser frühstücken sollen … Kreislaufkollaps bei Dauerspacern, so was kam vor. Er schob den Gedanken beiseite, ließ das Schott aufgleiten und betrat den Hangar.
An der halbkreisförmigen Rampe waren Motorboote und Scooter festgemacht, auch das drei Meter lange U-Boot mit der transparenten Sichtkuppel wartete dort, aber dafür war es noch zu früh. Er schwang sich auf den Sitz eines Skaters, schaltete die winzige Turbine ein und betätigte die Fernsteuerung für das Außenschott. Als die Öffnung groß genug war, schoss er ins Freie.
Die Turbine heulte auf. Der Scooter pflügte durch das algengrüne Wasser, verquirlte es zu weißem Gischt. Martin fuhr eine Acht, die Hände fest um den Motorradlenker geklammert, legte sich genussvoll in die Kurven hinein. Ab und zu landete ein Spritzer auf seiner Lederkluft, rann langsam daran herunter und ließ eine dunkle Spur zurück, die im Fahrtwind sogleich wieder verblasste.
Der Wind wehte immer noch von der Eifel her. Das war ungewöhnlich, denn sonst kam er meistens von Westen, von Holland, vom Meer. Aber es war bestes Jagdwetter, und als Martin auf den Lousberg einschwenkte, legte er den Kopf in den Nacken und entlud seine Anspannung in einem markerschütternden Schrei. Ein Pteranodon-Flugsaurier hob sich vor ihm mit flappenden Schlägen seiner Viermeterflügel vom Wasser, im länglichen, dem eines Pelikans ähnlichen Schnabel einen Fisch.
Martin drosselte die Geschwindigkeit, bis das Turbinengeräusch fast nur noch ein Summen war. Der Untergrund stieg langsam an, und er musste darauf gefasst sein, dass es zwischen den inselartigen Ansammlungen von Schachtelhalmen zu einer plötzlichen Begegnung mit einem Dino kam, der mit herabgebogenem Hals den Boden abäste und den er nicht gleich sah.
In Ufernähe war das Wasser erstaunlich klar; er sah die dunklen Konturen von Dächern unter sich vorüberhuschen, stille Straßenzüge, an deren Rändern verrostete, schlammverkrustete Autos standen, den versunkenen Stadtplan von Aachen. Den allmählich an die Oberfläche rückenden Baumwipfeln wich er aus.
Er bog in die Kupferstraße ein, deren Asphaltband vor ihm aus dem Wasser stieg und unter einem Farnteppich gleich wieder verschwand. Als das Wasser so niedrig war, dass er waten konnte, stieg er ab, zog den Scooter aufs Trockene und schaltete die Warnanlage ein, die auf Erschütterungen reagierte und mit ihrem durchdringenden Heulen jeden Dino verjagen würde, bevor er dem Gefährt zu nahe kam. Dann zog er die Machete aus der Scheide, schaltete den Akkumotor ein und machte sich an den Aufstieg.
Die Geschwindigkeit, mit der jetzt alles wuchs, hatte etwas Beängstigendes; als hätte die Natur früher nur geschlafen und geträumt und wäre jetzt aufgewacht. Sie griff nach jedem Flecken Boden, goss ihr alles verschlingendes Grün über das Land aus und hauchte ihren heißen, feuchten Brodem in die Luft. Nein, diese Natur ließ sich nicht mehr zähmen, allenfalls messen konnte man sich mit ihr. Sie war ein ebenbürtiger Gegner, und wenn Martin ausholte, um die von allen Seiten herandrängenden Triebe zu köpfen, legte er so viel Kraft in den Schlag, dass es jedes Mal zischte. Bis zur Brust in wogendem Farn versunken, bemerkte er erst dann, dass er vom Weg abgekommen war, als sein Fuß gegen etwas Hartes stieß; die umgekippten Bronzestatuen, das alte Weib und der Teufel. Er behielt die Richtung trotzdem bei und sagte sich im Gehen leise die Namen der Pflanzen vor: »Fächerpalmen, Sassafras, Hartriegel, Schuppenbäume …« Spacen bildete, das sollte das Gesundheitsministerium mal in seine Broschüren schreiben.
Nach zwanzig Minuten anstrengender Kletterei hatte Martin die Höhe erreicht. Er zerteilte mit der Machete eine Schlange, die als schenkeldicke Schlaufe von einer umgestürzten Eibe hing – die rotleuchtende Scoreanzeige an seinem Gürtel sprang um fünfzig Punkte auf 3.820.003 –, wischte sich den Schweiß von der Stirn und trat auf die Lichtung.
Es war schwül. Trauben von Insekten hingen, durchdringend sirrend, fast bewegungslos in der Luft, der regenbogenfarbige Pfeil einer Libelle von dreißig Zentimeter Spannweite schoss im Zickzack in Richtung Wasser. Plötzlich ein fernes Brüllen, ein Röhren der Brunst, der Drohung, der schieren Kraft, das Martin Schauer über den Rücken jagte; Stille blieb zurück, die sich erst allmählich wieder mit Geräuschen füllte, mit dem Rascheln der Blätter, dem scharfen Zischen seines Atems. Er setzte sich auf eine Bank, schob seine Beine in den Spalt zwischen Sitz und Lehne und stützte sich mit den Armen auf.
In seinem Rücken, mehr als achtzig Meter unter ihm, erstreckte sich das überflutete Aachen bis zu den bläulichen Hügeln im Südwesten, und vor ihm, auf der anderen Seite der Lichtung, lag der rötliche Klinkerbau des Drehrestaurants mit seinen hässlichen vertikalen Betonstreben, die wie Fischgräten aus der Wandrundung vorsprangen. Die Fensterscheiben waren zerbrochen, das Mauerwerk geborsten, und von der Drehplattform an der Spitze hingen lange Pflanzenschnüre herab, wie leblose grüne Schlangen. Der Boden der Lichtung war aufgewühlt vom dröhnenden Tanz der Paarungen, und die vereinzelt herumliegenden Skelette, Überbleibsel seiner Jagdausflüge, waren blank genagt und versanken teilweise in schulterhohem Gras.
Schräg links konnte er seinen mit Nachtsichtgerät, Bar und Video ausgerüsteten Hochsitz sehen, der wie der Kokon eines Riesenschmetterlings in der Krone einer Fächerpalme klebte; die Steigrippen aus Edelstahl, die er in den Stamm getrieben hatte, funkelten im Sonnenschein.
Der Anblick hatte auf ihn die Wirkung eines Amphetaminstoßes. Er sprang auf und begann in geduckter Haltung am Rand der Lichtung entlangzulaufen, vorbei an Fußabdrücken, die wie Bombentrichter waren, und Trampelpfaden, die wie Eisenbahntunnel im Dickicht verschwanden. Kurz vor der Fächerpalme hielt er plötzlich an. Etwas hatte sich verändert. Er schaute zu den Baumwipfeln hoch, drehte sich einmal um die eigene Achse. Hatte sich dort hinten am Turm nicht etwas bewegt? Es könnte auch eine Bö gewesen sein, dachte er – dann spürte er das Zittern des Erdbodens.
Es war bloß ein leichtes Zittern, fast ein Schauder, der sogleich wieder verebbte – dann kehrte es zurück, stärker als zuvor, wurde ein Beben, ein Geräusch krachender Äste, splitternder Bäume, der donnernde Rhythmus, der einem sich nähernden Dino vorauseilte und der Welt gleichsam verkündete: Wir sind die Größten, die Stärksten, die Wunderbarsten, wir sind und werden sein die Herren der Welt! Eine Naturgewalt näherte sich, vergleichbar nur mit einem Gewitter, einem Erdbeben oder Vulkanausbruch, und die Erde bebte nicht mehr, sie war ein Paukenfell, das von jedem Schritt des noch unsichtbaren Giganten in Schwingung versetzt wurde, und Martin, ein winziger Jäger am Rande einer Lichtung auf dem Hügel über der versunkenen Stadt, erbebte ebenfalls.
Er riss sich aus der verzückten Erstarrung, schätzte die Entfernung zum Hochsitz ab; dreißig, vierzig Meter noch, und dann die Kletterei in den Wipfel – zu weit. Er steckte die Machete in die Scheide, nahm den Bogen von der Schulter, zog einen Pfeil aus dem Köcher und aktivierte die Sprengladung durch eine Vierteldrehung der rotmetallenen Spitze. Dann führte er den wunderbar austarierten Schaft zwischen Daumen und Zeigefinger seiner um den Bogen geballten Faust hindurch und spannte mit der anderen Hand probeweise die Sehne. Dem Lärm nach musste es ein Großer sein, ein Bronto oder vielleicht sogar ein Stegosaurus – zwei Rückenplatten fehlten ihm noch für die Wandverkleidung des Ausgucks im Schloss.
Und da wich seitlich hinter dem Turm auch schon das Gebüsch auseinander, und eine junge Lebenseiche stürzte krachend um – das Geräusch eines brechenden Streichholzes neben dem Schritt des Giganten. Und dann weit oben ein Kopf, ein länglicher halb offener Rachen voller Säbelzähne, die kleinen Augen unter dicken Wülsten versteckt, die beiden Stummelärmchen, wo der Hals fast übergangslos in den aufrechten Oberkörper überging – es war kein Stego und kein Bronto, es war ein Tyrannosaurus Rex, und als er endlich frei auf der Lichtung stand, schlug er fast anmutig seinen Schwanz im Halbkreis vor die krallenbesetzten Füße, reckte sich auf den muskelstrotzenden Beinen, bog den Kopf zurück … und brüllte. Es klang wie ein halber Weltuntergang.
Martin schätzte, dass der Tyrannosaurus von der Schnauze bis zur Schwanzspitze mehr als fünfzehn Meter maß. Sein Kopf ragte bis in die Höhe des dritten Restaurantstockwerks auf, das machte sechs Meter. Vom Nacken ausgehend lief ein Saum dreieckiger Kammplatten über den Rücken bis zum Schwanz – viel kleiner als beim Stegosaurus, aber irgendwie gefährlicher wirkend, etwa wie der Bürstenschnitt eines Schlägers, der in der Tasche Schlagring und Springmesser trägt. Der Tyrannosaurus hatte keine Taschen und brauchte sie auch nicht; er sah wunderbar und schrecklich aus in seiner von Adern und Sehnen wie eine Reliefkarte gemusterten grauen Lederhaut; am tonnenartig gewölbten Bauch war sie eher glatt, am Kopf noppenartig zu einem Panzer verdickt – hier war er so gut wie unverwundbar. Martin wusste, dass er entweder den Bauch oder noch besser den Hals treffen musste, zwischen den weicheren Hautfalten der Kehle.
Während der riesige Fleischfresser mit ruckartigen Kopfbewegungen um sich äugte und mit der Schwanzspitze klopfend auf der Stelle verharrte, spannte Martin zum zweiten Mal den Bogen. Er stand vierzig, fünfzig Meter vom Tyrannosaurus entfernt, in der zweifelhaften Deckung einiger kaum brusthoher Hartriegelsträucher. Der Wind kam schräg von hinten, der feuchtheiße Hauch des immer gärenden Dschungels. Wie gut konnten Saurier riechen? Ein Schuss über diese Entfernung hinweg war kein Pappenstiel, auch wenn das Ziel so groß war. Er musste den Dino mit dem ersten Pfeil tödlich verwunden, sonst war er seines Lebens nicht mehr sicher. Oder doch lieber verzichten, sich ducken, ins Gebüsch kriechen, auf die mehrfach gesicherte, unangreifbare Fächerpalme zu? Sein Arm begann, von der Bogenspannung zu zittern. Er hatte den Bauch im Profil völlig ungeschützt vor sich – eine zu große Versuchung. Ja!, dachte er. Ja, ich krieg dich!
Er war im Begriff, den Pfeil loszulassen, als der Saurier den Kopf herumschwenkte und eine halbe Drehung nach rechts vollführte. Wieder brüllte er, leiser als beim ersten Mal – er hatte ihn entdeckt.
Jetzt musste er schießen, und zwar gut. Er schwenkte den Bogen einige Grad nach oben, sodass der Pfeil, wenn er die Flugbahn richtig berechnet hatte, im Hals eindringen musste – und ließ los.
Das Schwirren der Sehne, ein Zischen, ein silberglänzendes Steigen, dann Fallen – die schwere Spitze drang seitlich ein, der Schaft verschwand bis zur Hälfte im Hals. Martins Mund war ein wartender Schrei, wartend auf die Explosion, die Blutfontäne, den dröhnenden Sturz, den zuckenden Todeskampf … doch die Sprengladung explodierte nicht.
Der Tyrannosaurus senkte verdutzt den Kopf, als wollte er sich mit den Ärmchen über die Schnauze streichen, aber dafür waren sie viel zu kurz. Dabei drückte er auch den Pfeilschaft nach unten, doch die Spitze hing fest. Der Riese schüttelte sich, schlug mit dem Schwanz. Steine spritzten, Gras und Büsche wirbelten durch die Luft. Seine Augen blickten dumpf und trübe. Dann hob er das linke Bein und setzte es, während Muskelstränge aus dem Körper platzten und wieder verschwanden und der Schwanz eine zuckende Ausgleichsbewegung vollführte, nach vorn, bohrte die Krallen in den Boden, hob den rechten Fuß. Der erste Schritt. Martin spürte ihn im ganzen Körper. Er konnte den Blick nicht wenden. Ehe er auch nur die angehaltene Luft ausstoßen konnte, hatte der Saurier die Distanz halbiert. Noch nie war er einem lebenden T-Rex so nahe gewesen.
Plötzlich wurde ihm bewusst, dass er sterben könnte und dass er nicht wusste, wie das Programm darauf reagierte. Würde es abstürzen und ihn schlagartig in den Sessel zurückkatapultieren, vor einen flimmernden Bildschirm und mit flimmerndem Hirn? Jedenfalls konnte er damit rechnen, dass sein Highscore gelöscht oder wenigstens vermindert würde – und was geschähe dann mit seinem Jagdschloss, das er sich mühsam hatte erkämpfen müssen, was würde aus der prallen Waffenkammer und seinen acht Frauen?
Dieser Gedanke löste seine Starre. Um normal aus dem Programm auszusteigen, war es zu spät. Er riss die Machete aus der Scheide, schaltete sie an und schleuderte sie dem anstürmenden Tyrannosaurus entgegen. Die Klinge drang im Bauch ein und verschwand darin, als wäre er aus Butter. Martin warf sich herum, tauchte in den Dschungel, der sich hinter und über ihm schloss. Er rannte wie noch nie in seinem Leben, rutschte Böschungen hinunter, überschlug sich, kletterte auf umgestürzte Baumstämme, sprang auf der anderen Seite hinab. Farnwedel peitschten ihm Brust, Gesicht und Arme, Hartriegel zerschrammte ihm die Hände, die Kanten der Palmblätter schnitten in seine Haut. Und hinter ihm ein Bersten und Krachen, ein Röhren und Donnern, das ihm im Boden vorauseilte.
Plötzlich schimmerte vor ihm grauer Asphalt durch den grünen Pflanzenvorhang; er hatte die Straße erreicht. Wasser blinkte, die Bäume wichen zurück, vor ihm lag der Scooter und dahinter ein grauer Buckel, aus dem ein grauer Bogen in die Höhe wuchs – der Hals eines in Ufernähe äsenden Brontosaurus.
Durch das Gebrüll aufmerksam geworden, schwenkte der Hals mit dem gutmütig Schachtelhalme mümmelnden Kopf herum. Warum schaltet sich die verdammte Warnanlage nicht ein?, dachte Martin, dem mit jedem Schritt ein stechender Schmerz durch das Hüftgelenk fuhr und der nun, da er sich fast in Sicherheit wähnte, dramatisch langsamer geworden war. Doch als er sich über die Schulter umsah, hatte auch sein Verfolger bereits den Waldrand erreicht. Sein Rachen spuckte Geifer und roten Schaum, die Beine schnellten ihn auf Martin zu – er schrie auf, warf sich dem Scooter entgegen, ein Schatten wuchs hinter ihm auf, er stürzte und fiel, prallte mit der Schulter auf, wollte sich aufrichten und konnte es nicht mehr, blieb liegen und duckte sich und wartete auf das Ende.
Einen Moment lang war es dunkel um ihn herum, als der Tyrannosaurus über das Loch hinweg stürmte, in das Martin gefallen war, der Fußabdruck eines Dinos, der durch den unterspülten Asphalt gebrochen war. Der verletzte Tyrannosaurus trampelte geradeaus weiter, zerquetschte den Scooter und warf sich, als habe seine Wut endlich das ihr angemessene Ziel gefunden, auf den halb im Wasser stehenden Brontosaurus.
Als Martin den Kopf über den Rand der Grube hob, sah er die beiden Giganten in einer Wolke aus Gischt und Blut miteinander kämpfen. Es war ein ungleicher Kampf; der Tyrannosaurus hockte auf dem breiten Rücken des Pflanzenfressers, die Füße in dessen Flanken gekrallt. Während der Bronto mit dem Schwanz das Wasser verquirlte und seinen Peiniger mit hilflosen Halsverrenkungen hinunterzustoßen versuchte, riss dieser riesige Fleischbatzen aus Rücken und Unterhals und wirbelte sie durch die Luft. Doch da war noch etwas, das Martins Aufmerksamkeit auf ganz andere Weise fesselte; jedes Mal, wenn die Schwanzspitze des Brontos momentweise in diesem Toben sichtbar wurde, glaubte er, etwas Helles daran zu erkennen, etwas Dreieckiges, eine Art Fahne oder Schild. Brontosaurier hatten keine Rückenkämme, ihr Schwanz lief in einer glatten Spitze aus; das Dreieckige war künstlich. Doch Martin konnte nicht erkennen, was es war, und da das Ende des Kampfes bevorstand, musste er an seine eigene Sicherheit denken. Er kletterte stöhnend aus dem Loch und verschwand hinkend im Urwald.
Über Holland ging die Sonne unter. Das Wasser war ein stiller Spiegel des Himmels und schlug mit sanftem, beruhigendem Plätschern ans Ufer. Martin hatte sich die Arme um die Brust geschlungen und blickte nachdenklich in die lichtdurchflutete Ferne.
Seit er die andere Seite des Lousbergs erreicht und sich in der von Steilhängen abgeschirmten Bucht in Sicherheit gebracht hatte, zitterte er. Das Zittern war eine Reaktion auf die Folge der Schocks, das Versagen der Sprengladung, die wilde Flucht vor dem Tyrannosaurus, die Zerstörung des Scooters – und den Hunger. Sein im Halbdunkel des Zimmers zurückgelassener Körper, der den ganzen Tag über weder getrunken noch gegessen hatte, brachte sich nachdrücklich in Erinnerung. Ehe er sich’s versah, war es Abend geworden. Es wurde Zeit, dass er ausstieg; um alles andere würde er sich später kümmern. Nur einen Moment lang noch wollte er die friedliche Abendstimmung genießen, die er plötzlich als trügerisch empfand, die ihm aber merkwürdigerweise gerade deshalb doppelt kostbar schien; die rotgoldenen Wolkenungetüme am Horizont, das vor seinen Füßen schwappende Wasser.
Endlich gab er sich einen Ruck und rollte die Augäpfel nach unten, bis irgendwoher die flimmernde Menüleiste mit dem blinkenden Cursor erschien. Er fing ihn ein, setzte ihn auf Quit, zwinkerte zweimal. Nichts geschah.
Er versuchte es ein zweites Mal, wieder ohne Erfolg. Er kam nicht mehr aus dem Programm heraus! Ein leises, flappendes Geräusch ließ ihn aufblicken und die Leuchtleiste verschwinden; kaum zwanzig Meter über dem Wasser segelte eine Pteranodongruppe vorbei, einer hinter dem anderen, in der Luft gehalten von einem gelegentlichen Schlag der riesigen hautbespannten Schwingen. Mit den überlangen Schnäbeln, den vergleichsweise winzigen Körpern und den nach hinten abgestreckten Beinchen sahen sie ein wenig kopflastig aus, dennoch war der Anblick der fast lautlos dahingleitenden Flugsaurier, die sich als scharf umrissene Silhouetten vor dem glühenden Sonnenuntergang abhoben, wunderschön. Was Martin jedoch mit Grauen erfüllte, waren die Banner, die sie an kaum sichtbaren Schnüren hinter sich herzogen. Sechs Pteranodae zählte er, und jeder zog ein Banner hinter sich her wie diese einmotorigen Flugzeuge, die ab und zu mit ihren albernen Werbebotschaften über der Innenstadt kreisten.
Plötzlich hatte er das Gefühl, dass es Botschaften waren – aber Botschaften von wem? Er kniff die Augen zusammen, meinte auch Buchstaben auf den Bannern auszumachen, doch sie verschwammen im Gegenlicht. Er sprang auf, winkte und schrie. Die Pteranodae reagierten nicht. Sie zogen vorbei, wurden immer kleiner und verschwanden im Dunst über dem Wasser. Martin blieb mit hängenden Armen zurück. Sissys vergessener Pantoffel fiel ihm ein, das Fähnchen am Schwanz des Brontos, und hatte ihn nicht auch Maria auf irgendetwas hinweisen wollen? Etwas stimmte nicht, aber was? Wer konnte ihm eine Nachricht schicken wollen, und warum? Und wie? Es gab nur eine Erklärung; im Programm steckte ein Virus, deshalb war auch die Quit-Funktion außer Betrieb. Er meinte, den Boden unter sich schwanken zu spüren. Er musste so schnell wie möglich aus dem Programm aussteigen, auch auf die Gefahr hin, dass beim übergangslosen Realitätswechsel ein paar graue Zellen auf der Strecke blieben.
Er setzte sich im Schneidersitz auf die Erde, verbiss sich den Schmerz in Hüfte und Rücken und schloss die Augen. Er stellte sich seinen im Sessel wartenden Körper vor, den seidigen, über den Sensoren und Pneumoelementen wuchtig verdickten Stoff des Anzugs, die rechts und links schlaff auf seinen Schenkeln, nein, auf den Lehnen ruhenden Arme. Er versuchte, seine Arme anzuheben, krümmte die Finger, streckte sie, krümmte sie wieder. Er konnte sie spüren, seine Finger und Hände und Arme, und hob sie bis an seinen Kopf, dachte an die glatte Plastikwölbung des Helms, unter der sein Kopf in dieser künstlichen neuen Urzeit gefangen saß und träumte, tastete sich zum Kinnriemen vor, öffnete ihn, griff unter den Rand des Helms, drückte dagegen, hob ihn an … und öffnete die Augen. Wasser, verblassender Himmel, ringsumher nickender Farn. Seine Arme waren in einer sinnlosen Geste der Beschwörung erhoben, die Finger hatten sich in seine Haare gewühlt, zogen sie so fest nach oben, dass es wehtat. Er hatte keinen Kontakt mehr zu seinem Körper, die winzigen Verlagerungen der Hände, die seine hier ausgeführten Gesten dort auslösten, ließen sich dort nicht in die zum Abnehmen des Helms erforderliche Anstrengung übersetzen.
Er fühlte den nassen Boden unter sich, dessen Feuchtigkeit allmählich sogar durchs Anzugleder zu sickern schien, fühlte den kühlen Luftzug auf seiner Haut, der vom Wasser kam, alles Einbildung, Illusionen, die nicht dem Programm entstammten, sondern ihm selbst.
Als er zufällig an sich hinunter sah, entdeckte er, dass die Scoreanzeige an seinem Gürtel gelöscht war. 3.820.003 Punkte, von einem Augenblick zum andern einfach gelöscht! Er schüttelte den Kopf, biss sich in die Fingerknöchel, damit er nicht losheulte. Was für ein verrückter, sinnloser, schrecklicher Tag. Er verspürte plötzlich Durst, und wenn es auch nichts nützen würde, rutschte er doch auf den Knien zur Wasserkante und beugte sich vor, um zu trinken.
Auf der Wasseroberfläche spiegelten sich dunkel die buschigen Kronen von Fächerpalmen, und zwischen ihnen formten sich plötzlich helle weiße Buchstaben, ein Auszug aus den Zehn Punkten:
4. Hat sich Ihr Zeitgefühl verändert?
5. Haben Sie öfters Schmerzen in der Wirbelsäule?
Martin schrie auf, schlug mit der flachen Hand in das scrollende Bild hinein, und das Wasser, das kein Wasser war, rann kühl über sein Gesicht und tropfte von seinem Kinn auf den Boden.
Obwohl es bereits Vormittag war, lag noch dichter Dunst über dem Wasser, der das Jagdschloss verdeckte. Martin ruderte so, dass er den Lousberg im Rücken hatte, und er rechnete damit, das Schloss auf seinen drei Stelzen jeden Moment vor sich auftauchen zu sehen.
Er hatte bestimmt drei Stunden gebraucht, um aus Ästen und Farnstängeln das Floß zu bauen. Einige der Befestigungen hatten sich bereits gelöst, und da er, um mit dem provisorischen Paddel rudern zu können, ganz am Rand knien musste, war er bis zu den Oberschenkeln im Wasser und musste gehörig balancieren, damit er nicht den Halt verlor.
In der Nacht hatte er geschlafen, zum ersten Mal innerhalb des Programms. Er hatte gar nicht gewusst, dass das überhaupt möglich war; anscheinend gab es vieles, das er noch nicht wusste. Er konnte nur hoffen, dass auch sein physischer Körper etwas Ruhe gefunden hatte; vierundzwanzig Stunden saß er jetzt bereits in Anzug und Helm, und wahrscheinlich, bestimmt sogar, hatte er sich in die Nintendohose gemacht.
Gleich nach dem Aufwachen hatte er noch einmal den Programmausstieg versucht –
wiederum ohne Erfolg. Die alte Aachener Sage von der Entstehung des Lousbergs war ihm eingefallen: Als die Aachener den Teufel um die Seele des ersten Dombesuchers betrogen hatten, schwor er ihnen Rache. Er lud sich einen riesigen Sack Sand auf den Rücken und machte sich auf den Weg nach Aachen. Da begegnete ihm ein altes Weib, und er fragte sie, wie weit es noch bis Aachen sei.
Das alte Weib, das seinen Pferdefuß wohl gesehen hatte, entgegnete schlau: ›Lieber Herr, schaut euch meine Schuhe an. Ich erstand sie heute Morgen in Aachen, und nun sind sie vom Laufen schon ganz zerrissen.‹
Da schleuderte der Teufel seinen Sack wutentbrannt auf die Erde, dass er zerplatzte. So war der Lousberg entstanden.
Er hatte diese Legende immer gemocht, vielleicht weil die Teufelshypothese nicht minder fantastisch war als das von ihm geschaffene elektronische Aachen. Aber warum fiel sie ihm gerade jetzt wieder ein? Vielleicht weil ihn der Teufel geritten hatte, dass er sich auf dieses verfluchte Spiel eingelassen und sich der fehlerhaften Software eines raffgierigen Konzerns ausgeliefert hatte, der seine unausgereiften Produkte zu überhöhten Preisen an Leute verkaufte, die dem ganzen Brimborium nicht gewachsen waren. Nein, er war dieser Welt längst nicht mehr gewachsen, er fühlte sich von ihr verschlungen, ausgesaugt, entleert, und auf einmal sehnte er sich so sehr nach dem Motorenlärm vor seinem Fenster, seinem speckigen, aber wirklichen Bettbezug und seinem ganzen engen, überschaubaren Leben zurück, dass ihm die Tränen in die Augen schossen. »Die Rache des Teufels, die Rache des Teufels …«, sagte er sich im Takt des Ruderns vor, bis er bemerkte, was für einen Unsinn er da redete – wurde er etwa allmählich verrückt?
Er dachte an die ›Zehn Punkte, die Ihnen helfen können‹ – warum hatte er nicht auf sie gehört, warum hatte er die Symptome seiner Sucht nicht ernst genommen und bei den Entziehungskuren stattdessen den coolen Spacer gespielt? Ja, er hatte rote, tränende Augen, ihm zitterten die Hände, seit Wochen hatte er nicht mehr anständig gegessen, bloß Hamburger und Tiefkühlfraß aus der Mikrowelle, und wenn er sich abends aus dem Sessel wuchtete, glaubte er manchmal, das Rückgrat werde ihm zerbrechen. Jetzt bekam er die Quittung dafür, vielleicht sogar eine Quittung direkt vom Gesundheitsministerium. Natürlich, die Viren mussten vom Gesundheitsministerium über seine Mailbox auf die Festplatte und in das Programm eingeschleust worden sein, als Denkzettel, als Warnung, nur das erklärte die Zitate aus den dämlichen Zehn Punkten. Doch wenn es so war, dann würde der Spuk früher oder später von selbst vorübergehen. Das Gesundheitsministerium würde nicht zulassen, dass jemand durch einen Virus zu Schaden kam. Die Rache des Teufels, was für ein Quatsch! Und Martin ruderte schneller, damit er endlich das Schloss erreichte und wieder trockene Füße bekam.
Der Dunst löste sich allmählich auf, doch es wurde nicht heller, im Gegenteil. Ein dunkler Vorhang trieb von Südosten heran, legte sich vor die Sonne, bis sie nur noch eine blasse Scheibe war, kleiner und kraftloser als der Mond. Über Nacht musste in der Eifel ein Vulkan ausgebrochen sein, und nun verteilte der Wind den Ascheregen. Während Martin mit zurückgelegtem Kopf zum Himmel hochsah, formten sich die Schlierenmuster in Sekundenschnelle zu Buchstaben:
6. Vergessen Sie manchmal, ob Sie ›drinnen‹ oder ›draußen‹ sind?
7. Leiden Sie gelegentlich an Halluzinationen?
Jetzt machten sie sich auch noch über ihn lustig! Er wandte den Blick ab, und plötzlich sah er das Schloss. Es lag viel näher als erwartet. Er hatte ein wenig zu weit nach links gehalten und sich zu sehr auf das Rudern konzentriert, deshalb hatte er es nicht gleich entdeckt. Es war eine Ruine. Zwei der drei Teleskopstelzen waren eingeknickt, von der dritten hing die Plattform schräg ins Wasser. Ein Teil der Aufbauten war über den Rand gerutscht und in den trüben Fluten verschwunden, der Rest war ein Durcheinander von verbogenen Streben und ziehharmonikaartig zusammengefalteten Aluwänden – Schrott.
Langsam ruderte er näher. Auf der Oberkante der schiefen Plattform saß Maria. Sie baumelte mit den Beinen und blickte ihm starr entgegen.
»Was ist passiert?«, rief Martin, als er in Rufweite gekommen war.
Die dunkelhaarige junge Frau reagierte nicht. Er ruderte noch näher heran, dann rief er wieder: »Maria, um Himmels willen, was ist denn passiert?«
»Es waren Brontos«, sagte Maria in vier oder fünf Meter Höhe. Es hätten mehr sein sollen, was bedeutete, dass das Wasser weiter gestiegen war.
»Fünf auf einmal. Sie haben sich auf die Stützen gestürzt und alles kurz und klein geschlagen.« Ihre Stimme klang gleichmütig, fast gelangweilt, und ihre Beine schwangen vor und zurück wie die eines kleinen Mädchens.
»Hast du denn nicht die Ultraschallanlage eingeschaltet, als du gesehen hast, was los war?«
»Nein.«
Martin fluchte. Sie war außer Kontrolle geraten, das ganze System spielte verrückt. Er tauchte das aus einer schilfumwickelten Astgabel bestehende Paddel unschlüssig ins Wasser. Was sollte er jetzt tun? Abwarten, bis der Virus das Programm abschaltete? Wie viel Zeit blieb ihm noch, bis sein erschöpfter Körper, sein wirklicher Körper, einen Kreislaufkollaps bekam? Bis das überlastete Gehirn durchbrannte, das Herz zu flimmern begann?
Er verdrängte den Gedanken an den schlaffen Körper, dessen Hände ihm nicht mehr gehorchten. Jetzt kam es zunächst einmal darauf an, sich vor den Amok laufenden Dinos in Sicherheit zu bringen; die Pfeile hatte er auf seiner Flucht aus dem Köcher verloren, den nutzlosen Bogen unterwegs weggeworfen, und der Speer ließ sich nicht mehr ausfahren. Er war praktisch wehrlos; dazu kam die deprimierende Beinahegewissheit, dass er auch in der Ruine des Jagdschlosses nichts Verwertbares mehr finden würde.
Sein Blick glitt über die noch dunstverhangene bewaldete Hügelkette hinter dem Dom, blieb am Fernsehturm hängen. Auf einmal kam ihm die wahnsinnige Idee, sich dort einen Computer zu suchen und ihn mittels Notstromaggregat wieder in Gang zu bringen; mit seiner Hilfe bekäme er den Virus vielleicht zu packen, könnte er den anderen, den wirklichen Computer möglicherweise kurzschließen. Ein verzweifelter Gedanke, gewiss, doch mit neuer Entschlossenheit zog er das Paddel kräftig durch.
»Wohin willst du?«, rief Maria von der Plattformkante herunter; ihre Stimme klang auf einmal gar nicht mehr gelangweilt und desinteressiert.
»Zum Fernsehturm«, antwortete Martin automatisch, ohne sich umzusehen.
»Nimm mich mit!«, rief Maria. »Hörst du, nimm mich mit!«
Martin blickte auf. Maria hatte einen Fuß auf die Kante gesetzt, mit einer Hand hielt sie sich fest, die andere hatte sie hoch erhoben.
»Du kannst nicht mit«, sagte Martin. »Du siehst doch, das Floß ist zu klein, es trägt uns beide nicht.« Er zuckte die Achseln, wandte sich ab und begann wieder zu paddeln. Das laute Klatschen ließ ihn innehalten; als er zurücksah, tauchte Marias Kopf gerade an die Oberfläche. Mit zügigen Kraulbewegungen schwamm sie auf ihn zu.
Er senkte den Blick, bis die Menüleiste in seinem Gesichtsfeld erschien. F8, Sissy, Ute, Maria, und Delete. Aber sie verschwand nicht. Sie streckte ihre manikürten Finger nach dem Floß aus, zog es unter Wasser. Er stieß mit dem Paddel nach ihr, halbherzig nur, denn schließlich war sie Maria, ein Mensch wie er, so wie die Dinge lagen.
»Das Boot issu … issu … ist zu klein für uns beide!«, rief er, sich an einem losen Ast festhaltend, da seine schwimmende Unterlage heftig schaukelte. »Wir werden beide ersaufen, wennu … wennu … wenn du mit drauf kommst. Bleib hier!« Sein Mund fühlte sich plötzlich an wie aus Gummi, wie harter Gummi, und Maria hörte nicht auf ihn, ignorierte seine Paddelstöße, zog sich aufs Floß. Laut keuchend kniete sie neben ihm, Wasser troff aus ihren jetzt schwarzen Strähnen, mäanderte über ihren weißen Hals in die wie festgeklebte Bluse hinein. Sie hustete, wischte sich den Mund. Erstaunlicherweise trug das Floß das zusätzliche Gewicht, es war jetzt, da beide Seiten gleichmäßig belastet waren, sogar besser ausbalanciert als zuvor.
»Tut mir leid«, sagte Martin. »Tut mir wirklich leid.«
Sie hob langsam den Kopf. »Was hast du denn mit deiner Hand gemacht?«
Er blickte auf das Paddel, das er mit seiner Rechten umklammert hielt. Nach einem Moment des begriffslosen Staunens sträubten sich ihm die Haare, und er riss den Mund auf, wollte schreien – kein Laut kam heraus.
Wie manche Comic- und Zeichentrickfiguren hatte seine Hand nur noch vier Finger. Der Mittelfinger war verschwunden, nicht einmal ein Stummel oder eine Lücke war zurückgeblieben. Er hielt seine Linke hoch, dort waren es noch fünf.
»Meinott!«, stöhnte Martin, schüttelte fassungslos den Kopf. Dann begann er wieder zu paddeln.
Das Dach des Kaiserdoms erinnerte immer noch an ein gekentertes Schiff – an eine gescheiterte Arche Noah. Der zugehörige Turm wie auch der Turm der benachbarten St. Foillankirche waren verschwunden – unterspült, eingestürzt, versunken. Nur das kreuzgekrönte Türmchen auf der Kuppel der dem größeren gotischen Westchor vorgelagerten Pfalzkapelle stand noch. Als das Floß näher herankam, glitten Hunderte von armlangen Varanosauren vom Dach ins Wasser; gelbbraune Schatten, die lautlos verschwanden.
Martin warf eine lockere Ranke um das steinerne Geländer, welches das Dach umgab. Bis zu den Hügeln hätte er es nicht mehr geschafft; überhaupt, was wollte er eigentlich da? Das Floß tanzte einen Moment lang unter ihm; Maria war auf das Dach gesprungen, ging leichtfüßig nach rechts davon. Er hielt sich mit beiden Händen an der Brüstung fest, schwang mühsam erst das eine Bein darüber, dann das andere. Dahinter blieb er schwer atmend liegen, den Rücken an die asphaltgraue Dachschräge gedrückt.
Es war fast dunkel, obwohl es noch nicht Abend war. Das konnte er am Stand der Sonnenscheibe sehen, die manchmal für Sekunden zwischen den Ascheschlieren auftauchte. Zusammen mit der braunen Vulkanasche trieben riesige Schriftzeichen über den Himmel:
8. Haben Sie in letzter Zeit eines oder mehrere Hobbys aus Zeitmangel aufgegeben?
9. Fällt ihnen das akustische Sprechen manchmal schwer?
Die Bäume auf dem Lousberg sahen violett und künstlich aus. Martin schloss die Augen, versank im leisen Summen seiner Nerven. Seine Gedanken waren dunkle Schatten in einem dunklen Meer, und wenn er sie ergreifen wollte, tauchten sie lautlos vor ihm in die Tiefe.
Als er die Augen wieder öffnete, hing die Sonnenscheibe tief über dem Horizont. Die Schrift war verschwunden. Nur die Asche war noch da, sie schien sogar noch dichter geworden zu sein. Trotzdem konnte er seine Hände deutlich erkennen, als er sie hochhob und einmal fünf, einmal vier Finger zählte. Alles schien wie von einem schwach leuchtenden Strahlenkranz umgeben, auch die Frau, die am Altarende des Daches stand und unbewegt auf das Wasser hinausschaute, als wartete sie auf etwas.
Er richtete sich auf. Wie war er hierhergekommen? Mit einem Floß natürlich, aber das Floß war weg. Das Wasser war noch weiter gestiegen, es schwappte leise gegen den Sockel der Brüstung. Martin balancierte an ihr entlang, sein Körper war leicht geworden, fast schien er zu schweben. Als die Frau ihn näherkommen hörte, warf sie einen Blick über die Schulter, dann begann sie, das steile Dach hochzuklettern. Plötzlich fiel Martin ihr Name ein: Maria. Er folgte ihr. Erst jetzt bemerkte er die Risse, die das Dach horizontal durchzogen, wie Falten einer alternden Haut. Er kroch behutsam über sie weg.
»Was willst du?«, sagte über ihm Maria. Sie stand mit abgewinkelten Armen auf dem Dachfirst, die Beine leicht gespreizt, die bloßen Füße in einem unmöglichen Winkel abgeknickt und zu beiden Seiten des Firstgrates gegen die Dachschräge gestemmt. Sie schaute in die Richtung, aus der die Asche herantrieb. Der Himmel war fast schwarz.
»Maria«, sagte Martin, den Bauch flach auf die grauen Schindeln gepresst, sich mit einer Hand an den Firstgrat klammernd, »Maria, was … was hattas … hat das alles zu bedeuten?«
Sie sah ihn nicht an. »Das weißt du doch«, sagte sie.
»Ich weiß es nicht! Maria, wennu … wenn du etwas weißt, dann … dann sag es mir! Bitte!«
Mit einer unwilligen Kopfbewegung beförderte sie das Haar in den Rücken. Auf einmal sah er, wie schön sie war mit ihren zarten Schulterblättern, die sich unter der Bluse abzeichneten, mit ihren vollen Hüften, der vollkommenen Rundung ihres Hinterns.
»Du hast dich nie für mich interessiert«, sagte sie.
»Was?«
»Ich war nichts als ein Spielzeug für dich, eine bewegliche Puppe, ein Renommierobjekt, und als du geglaubt hast, mit mir nicht mehr renommieren zu können, da …«
»Was redest du da! Du warst doch … du hast … du konntest doch gar nicht …«
»Ich verachte dich«, sagte Maria. »Du bist ekelhaft.«
Ihr Haar war heller geworden, fast blond, ihre ganze Figur hatte sich verändert; die Schultern waren noch schmaler geworden, die Arme zierlicher, die Beine länger. Ein delikates Sommersprossenmuster überzog ihre bleiche Gesichtshaut. Es war nicht mehr Maria, die dort stand, es war …
»Sissy!«, schrie Martin. »Sissy!« Er umklammerte eine Dachspiere mit beiden Händen und versuchte, sich auf den Grat hinaufzuziehen. Sissy hatte sich umgedreht und starrte hasserfüllt auf ihn herab. »Du hast Schweißfüße«, zischte sie. »Du bist ein Langeweiler, ein egozentrisches Arschloch, und von Frauen verstehst du einen Dreck. Und jetzt ist es aus mir dir!« Sie trat nach ihm, plötzlich trug sie hochhackige Krokoschuhe, deren Spitzen mit Stahl ausgekleidet waren. Blut rann über sein Handgelenk, tropfte ihm ins Gesicht.
»F8!«, brüllte er. »Sissy, Ute, Maria, Esther! Enter!«
Ein Fingerknochen splitterte, er spürte, wie die Kraft aus seinen Händen wich. Er ruderte mit den Füßen, um sich abzustützen, doch sie fanden auf den glatten Schindeln keinen Halt; er begann, bäuchlings am Dach herunterzurutschen. Er versuchte, sich mit den blutüberströmten Händen abzubremsen, doch seine Fingernägel brachen, sein Rutschen wurde immer schneller, ein Fallen – er stürzte durch eine der Spalten im Dach.
Ein kurzer Moment des Schwebens, dann schlug Wasser über ihm zusammen. Der Kälteschock kam mit einigen Sekunden Verspätung, presste ihm die Luft aus den Lungen. Er tauchte an die Oberfläche, über sich das von Rissen und Spalten durchzogene Chorgewölbe, um sich herum bläulich leuchtendes Wasser. Unter sich nahm er die verschwommenen Umrisse der strahlenverzierten, an eine überdimensionale Monstranz erinnernde Madonna mit dem Jesuskind wahr, die in der Mitte des Westchores freischwebend aufgehängt war. Dahinter lag der bogenförmige Durchgang zum Octogon, der noch von Kaiser Karl erbauten karolingischen Pfalzkapelle, die erst später mit dem gotischen Westchor und weiteren Kapellen erweitert worden war, die sich wie Pilzknollen um die sechzehneckige Umhüllung des Oktogons gruppierten.
Das blaue Leuchten passte zu der mystischen Stille im überfluteten Dom, so als hätte das Wasser eine dem Ort immer schon innewohnende Kraft freigespült. Dann begriff er, dass von außen Oberflächenlicht durch die blauen Glasfenster des Westchors fiel, das im Wasser diffus gestreut wurde.
Als sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, bemerkte er die Stühle, die überall um ihn herum auf dem Wasser trieben, Holzstühle mit winzigen Sitzflächen, zu kurzen Beinen und überlangen Lehnen. Er schwamm auf einen der horizontalen Ankerzüge zu, die das Gewölbe aus irgendwelchen statischen Gründen durchspannten, hielt sich daran fest und musterte das Dach.
Von Sissy war nichts zu sehen. Einen der Risse zu erreichen, um wieder ins Freie zu klettern, war aussichtslos, sie waren alle außer Reichweite. »Sissy!«, rief er, so laut er konnte; seine Stimme hallte schaurig über das Wasser hin, ihr Klang war fremd, als gehörte sie gar nicht ihm, sondern einem der Bischöfe, die dort unten in ihren Grüften ruhten. Sissy zeigte sich nicht.
Martin hatte die Arme über die Querstange gelegt und bewegte langsam die Beine. Die Kälte hatte seine Gedanken noch langsamer, aber auch wieder schärfer gemacht. Die einzige Möglichkeit, den Dom wieder zu verlassen, lag unter Wasser. Er musste tauchen und durch eine Lücke in einem der Fenster in Freie schwimmen, und wenn er keine Lücke fand, musste er ein Loch in die Bleiverglasung schlagen; aber womit? Die Holzstühle hatten zu viel Auftrieb, als dass er in seinem geschwächten Zustand einen von ihnen hätte hinabziehen können. Bestimmt gab es dort unten massive Kerzenleuchter; aber in die Tiefe tauchen, einen Leuchter finden, zum Fenster hochtauchen, das Glas zerschlagen und dann hinaus und an die Oberfläche – selbst wenn er es schaffte, würde Sissy auf ihn warten und dafür sorgen, dass er sich nicht auf dem Dach würde in Sicherheit bringen können.
Seltsam, dachte er, wie sehr sie sich verändert hat. Woher stammte diese plötzliche Wut, dieser abgrundtiefe Hass? Gewiss, er hatte ihr Unrecht getan – aber ihn deshalb sterben lassen? Er hob seine Hände, die wie Flossen im Wasser trieben, und betrachtete sie.
Das Blut war abgewaschen, die Wunden hatten sich in der Kälte geschlossen, aber der linke kleine Finger war ausgerenkt, vielleicht gebrochen, und die übrigen Gelenke waren unnatürlich verdickt. Unter der Haut des rechten Ringfingers zeichnete sich ein spitzes Knochenstück ab. Doch er spürte keinen Schmerz, er spürte nicht einmal mehr, dass er überhaupt Hände hatte; von der Mitte des Unterarms bis zu den Fingerspitzen war alles taub, wie nicht vorhanden. Lautlos die Lippen bewegend, zählte er einmal fünf und einmal vier.
Der Finger.