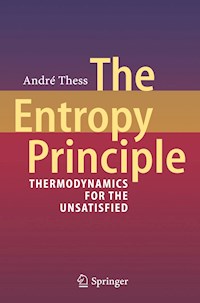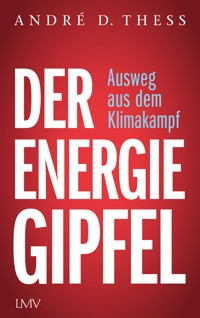
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Themen Energie und Klima spalten Deutschland. Ein ehemaliger Universitätspräsident warnte im Oktober 2021 gar: »Die Energiewende hat das Potenzial zum Bürgerkrieg.« Die Kontrahenten stehen einander unversöhnlich gegenüber, beschimpfen sich gegenseitig als »Klimaleugner« oder »Grüne Khmer«. Kann diese Spaltung durch eine »Energiewende 2.0« oder durch ein »Ende des CO2-Wahnsinns« überwunden werden, wie manche Politiker es behaupten? Der Autor geht einen radikal neuen Weg: Er wagt das Gedankenexperiment eines Energiegipfels, basierend auf der Analyse energie- und klimapolitischer Entscheidungen der vergangenen 70 Jahre seit dem Atomeinstieg. Seine Hauptfrage lautet: Wäre die heutige Energieversorgung hinsichtlich Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit besser oder schlechter, wenn sich der Staat herausgehalten hätte? Die Antwort mündet in einen Friedensplan, der auf zwei Säulen ruht: Trennung von Klima und Staat sowie defensive Energiepolitik. Die Verantwortung für Energie und Klima soll vom Staat in weiten Teilen auf Bürger und Unternehmen übertragen werden. Dies eröffnet die Perspektive, CO2-Emissionen kostengünstig zu reduzieren sowie gleichzeitig die Bürger von staatlichen Eingriffen zu entlasten. So könnte die gesellschaftliche Spaltung überwunden werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
1. Motivation: Vom Fenstersturz zum Friedensgipfel 7
1.1 Wie Energie und Klima die Gesellschaft spalten 8
1.2 Energiegipfel statt Energiewende 2.0 10
1.3 Energiegipfel: Die Arbeitsaufgaben 12
1.4 Energiegipfel: Die Verhandlungsdelegationen 14
1.5 Energiegipfel: Die Spielregeln 17
1.6 Für eilige Leser 19
2. Rückblick: Acht Staatsprojekte für Energie und Klima 20
2.1 Atomeinstieg 22
Worum geht es? 22
Ein Blick auf die Daten 23
Ein Blick in die Geschichte 27
2.2 Atomausstieg 32
Worum geht es? 32
Ein Blick auf die Daten 33
Ein Blick in die Geschichte 36
2.3 Kohlepfennig 40
Worum geht es? 40
Ein Blick auf die Daten 40
Ein Blick in die Geschichte 43
2.4 Kohleausstieg 47
Worum geht es? 47
Ein Blick auf die Daten 47
Ein Blick in die Geschichte 49
2.5 Gasgeschäfte 52
Worum geht es? 52
Ein Blick auf die Daten 53
Ein Blick in die Geschichte 55
2.6 Gasembargo 60
Worum geht es? 60
Ein Blick auf die Daten 60
Ein Blick in die Geschichte 61
2.7 Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG 63
Worum geht es? 63
Ein Blick auf die Daten 64
Ein Blick in die Geschichte 69
2.8 Verbote 71
Worum geht es? 71
Ein Blick auf die Daten 72
Ein Blick in die Geschichte 76
3. Die Messlatte: Otto Schmidt und der Minimalstaat 80
3.1 Gesundheitsbilanz eines Kanzlerlebens 81
3.2 Von Otto Schmidt zum Minimalstaat 82
3.3 Energiesystem im Minimalstaat 84
4. Analyse: Acht Kostbarkeiten? 87
4.1 Atomeinstieg 89
Frage 1-1: Versorgungssicherheit durch Atomeinstieg? 89
Frage 1-2: Bezahlbarkeit durch Atomeinstieg? 92
Frage 1-3: Umweltverträglichkeit durch Atomeinstieg? 95
Fazit zum Atomeinstieg 98
Nebenwirkungen 99
4.2 Atomausstieg 100
Frage 2-1: Versorgungssicherheit durch Atomausstieg? 100
Frage 2-2: Bezahlbarkeit durch Atomausstieg? 102
Frage 2-3: Umweltverträglichkeit durch Atomausstieg? 105
Fazit zum Atomausstieg 108
4.3 Kohlepfennig 109
Frage 3-1: Versorgungssicherheit durch Kohlepfennig? 109
Frage 3-2: Bezahlbarkeit durch Kohlepfennig? 111
Frage 3-3: Umweltverträglichkeit durch Kohlepfennig? 113
Fazit zum Kohlepfennig 114
Nebenwirkungen 114
4.4 Kohleausstieg 115
Frage 4-1: Versorgungssicherheit durch Kohleausstieg? 116
Frage 4-2: Bezahlbarkeit durch Kohleausstieg? 118
Frage 4-3: Umweltverträglichkeit durch Kohleausstieg? 119
Fazit zum Kohleausstieg 121
4.5 Gasgeschäfte 121
Frage 5-1: Versorgungssicherheit durch Gasgeschäfte? 122
Frage 5-2: Bezahlbarkeit durch Gasgeschäfte? 123
Frage 5-3: Umweltverträglichkeit durch Gasgeschäfte? 125
Fazit zu den Gasgeschäften 125
4.6 Gasembargo 126
Frage 6-1: Versorgungssicherheit durch Gasembargo? 126
Frage 6-2: Bezahlbarkeit durch Gasembargo? 127
Frage 6-3: Umweltverträglichkeit durch Gasembargo? 128
Fazit zu den Gasgeschäften 130
Nebenwirkungen 131
4.7 Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG 132
Frage 7-1: Versorgungssicherheit durch das EEG? 132
Frage 7-2: Bezahlbarkeit durch EEG? 134
Frage 7-3: Umweltverträglichkeit durch das EEG? 136
Fazit zum EEG 138
Nebenwirkungen 138
4.8 Verbote 139
Frage 8-1: Versorgungssicherheit durch Verbote? 139
Frage 8-2: Bezahlbarkeit durch Verbote? 142
Frage 8-3: Umweltverträglichkeit durch Verbote? 143
Fazit zu Verboten 146
Nebenwirkungen 146
4.9 Gesamtschau 148
4.10 Zugabe: Was sagt die künstliche Intelligenz? 150
5. Ein Friedensplan für Energie und Klima 155
5.1. Ökologisch-soziale und freiheitlich-konservative Interessen 156
5.2 Die Brücke zum Klimafrieden: Trennung von Klima und Staat 158
Angekündigte Revolutionen scheitern 159
Die Entlastung des Staates 160
Projekte des ADKC: Effizienz durch Eigenverantwortung 162
Reicht das Geld? 164
Ist das nicht sozial ungerecht? 166
Personalisierte Verantwortung 167
5.3 Die Brücke zum Energiefrieden: Defensive Energiepolitik 168
In eigener Sache 169
Rangliste energiepolitischer Maßnahmen 170
Defensive versus offensive Energiepolitik 175
Der Friedensschluss 176
Dank 177
Anmerkungen 178
1. Motivation: Vom Fenstersturz zum Friedensgipfel
Am Mittwoch, dem 23. Mai 1618 warfen wütende Protestanten unter Führung von Heinrich Matthias von Thurn die katholischen Statthalter Jaroslaw Borsita und Wilhelm Slavata sowie den Kanzleisekretär Philipp Fabricius aus dem 17 Meter hohen Fenster des Alten Prager Königspalastes. Ob die fliegenden Herren ihr Überleben einem Misthaufen, ihren dicken Mänteln oder der Jungfrau Maria verdanken, liegt im Dunkel der Geschichte verborgen1.
Unstrittig ist hingegen, dass der Prager Fenstersturz den Dreißigjährigen Krieg einläutete – einen erbitterten Religionskrieg mit sechs Millionen Todesopfern. Erst 30 Jahre später, am 24. Oktober 1648, fand dieses traumatische Kapitel europäischer Geschichte mit der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens in Münster und Osnabrück sein Ende.
Deutsche Politiker dürften vor diesem Hintergrund am 10. Juni 2023 erleichtert gewesen sein. Bei den Protesten von 13000 Bürgern gegen das Gebäudeenergiegesetz in Erding ging es gesitteter zu als damals in Prag. Defenestrationen sind weder aus Erding noch aus Berlin überliefert. Ministerstürze auch nicht. Anders als bei den Protesten von Kernkraftgegnern in den 1980er-Jahren gegen die Aufbereitungsanlage Wackersdorf wurden in Erding weder Molotowcocktails geworfen noch Polizeiautos angezündet.
Ungeachtet der Tatsache, dass die heutigen Auseinandersetzungen um Energie- und Klimapolitik weitgehend gewaltfrei verlaufen, hatte der Hamburger Universitätspräsident Dieter Lenzen auf einer Online-Diskussionsveranstaltung schon im Oktober 2021 in meinem Beisein gesagt: »Die Energiewende hat das Potenzial zum Bürgerkrieg.«
Wie kann die Spaltung der deutschen Bevölkerung zu Energie- und Klimapolitik überwunden werden? Diese Analyse soll dazu beitragen, dass wir uns nicht erst im Jahr 2053 versöhnen.
1.1 Wie Energie und Klima die Gesellschaft spalten
Die Polarisierung des Volkes zu Energie und Klima ist allgegenwärtig. Ein Teil der Deutschen will Wind- und Solarenergie beschleunigt ausbauen, Kohlekraftwerke schneller stilllegen, Verbrennungsmotoren und Gasheizungen verbieten, Flugreisen rationieren, schwere Geländewagen (SUV) höher besteuern und Fleisch verteuern. Dies diene dem Ziel, möglichst bald das Ziel eines klimaneutralen Deutschlands zu erreichen.
Einigen geht der Prozess zu langsam. Sie begehen – nach eigener Behauptung als legitimes Zeichen zivilen Ungehorsams – Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten: unentschuldigtes Fernbleiben von der Schule, Blockade von Straßen und Flughäfen durch Festkleben am Boden, Sachbeschädigung wie etwa das Beschmieren des Brandenburger Tors oder Hausfriedensbruch im Hafen von Emden2.
Stadträte3, Universitätspräsidenten4 und sogar das EU-Parlament5 rufen »Klimanotstände« aus. Mit den Notstandsverkündungen werden Verantwortliche aufgefordert, »dass alle ihre politischen und planerischen Entscheidungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes hin geprüft werden und zukünftige Beschlüsse mit ihm in Einklang gebracht werden müssen.«6
Häufig belegen Klimaaktivisten Menschen, die ihre Meinung nicht teilen, mit politischen Kampfbegriffen wie »Klimaleugner« oder »Umweltsau« und unterstellen ihnen Verantwortungslosigkeit gegenüber künftigen Generationen. Die KI-Software ChatGPT, deren »Denkweise« ein Abbild des öffentlichen Meinungsgefüges ist, listet auf meine Frage nach der Systematik der Methoden der Klimawandelleugnung die stattliche Zahl von sechs Kategorien und fünfzehn Unterkategorien auf – ein Indiz für gesellschaftlichen Zwiespalt.
Ein anderer Teil der Deutschen sieht die Themen Klima und Energie ganz anders. Viele halten den Klimawandel zwar für real und sprechen sich im Grundsatz auch für eine langfristige Abkehr von fossilen Energieträgern aus. Doch widersprechen sie der These, es handle sich um das dringlichste Problem der Zivilisation. Sie verweisen darauf, dass in keinem Bericht des Weltklimarates IPCC von einer existenziellen Bedrohung für die Menschheit die Rede ist.
Auch lehnen sie es ab, Milliarden an Steuergeldern in »Große Transformationen« zu investieren, weil diese Gelder nach ihrer Meinung besser in Bildung und Infrastruktur angelegt sind – einschließlich Klimaanpassungsmaßnahmen wie der Begrünung von Städten oder der Installation von Klimaanlagen in Gebäuden. Diese Gruppe möchte sich ihren Lebensstil nicht vom Staat vorschreiben lassen. Sie will unbehelligt Fleisch essen, SUV fahren und nach Bali in den Urlaub fliegen. Die Bürger argumentieren, dass Deutschland weniger als zwei Prozent des weltweiten Ausstoßes von CO2 verantwortet und China fast jede Woche ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb nimmt. Einige Vertreter bezeichnen ihre Gegenspieler ihrerseits wenig schmeichelhaft als »Grüne Khmer« oder »Klimaterroristen«. Deren alarmistische Berichterstattung nennen sie »Klimahysterie«. Viele kritisieren »Landschaftszerstörung« durch den Neubau von Windkraftanlagen.
Manche halten den menschengemachten Klimawandel gar für Spinnerei oder Propaganda. Obwohl ich diese Auffassung nicht teile, halte ich es im Rahmen von Meinungs- und Religionsfreiheit für legitim, solche Meinungen zu vertreten und öffentlich zu äußern. Einige Klimaschutzkritiker behaupten, Klimapolitik sei in Wirklichkeit ein Vehikel für den Weg in ein totalitäres System oder eine Gelehrtendiktatur. Sie sehen eine Analogie zwischen dem Missbrauch der Wissenschaft während der Coronapandemie für die Rechtfertigung schwerwiegender Eingriffe in Freiheitsrechte einerseits und der Instrumentalisierung von Klima- und Energieforschung für Freiheitsbeschränkungen im Namen des Klimaschutzes andererseits. Nach meiner Wahrnehmung vertieft sich die gesellschaftliche Spaltung in den Jahren seit der Coronapandemie, anstatt abzunehmen.
Gibt es einen Weg, diese Spaltung zu überwinden?
1.2 Energiegipfel statt Energiewende 2.0
Viele Befürworter meinen, die Energiewende sei nur schlecht organisiert. Man hätte sie nicht beherzt angepackt. »Wir brauchen jetzt eine »Energiewende 2.0!« Organisiert von klugen Wissenschaftlern, unideologischen Politikern und visionären Unternehmern. Mitgetragen von einer einsichtigen Bevölkerung. Oft zu hören ist auch die These, man müsse den Menschen »da draußen« Klimaschutz und Energiewende nur besser erklären. Auf meine Frage nach seinem Rezept gegen die Spaltung der Bevölkerung antwortete der Vater des Erneuerbare-Energien-Gesetzes Hans-Josef Fell im August 2024, er würde eine großangelegte Informationskampagne befürworten, mit der man der Bevölkerung die Gefahr des Klimawandels und die Chancen der Energiewende umfassend erklärt.
Zahlreiche Kritiker meinen hingegen, die deutsche Energiewende sei gescheitert. Ein Neustart in Form einer staatlich organisierten »Energiewende 2.0« sei ähnlich erfolgversprechend wie der »Sozialismus 2.0«. Sie plädieren hingegen für ein »Ende der Klimaplanwirtschaft«, einen Stopp des Baus von Windkraftanlagen, für die Abschaffung von Subventionen für erneuerbare Energien, für die Weiternutzung fossiler Energieträger und für den Wiedereinstieg in die Nutzung der Kernenergie.
Es scheint schwierig, zwischen diesen unversöhnlichen Fraktionen Frieden zu schließen. Doch ist es wirklich unmöglich? Ich bin überzeugt: Wir Deutschen müssen weder auf Wind- und Sonnenenergie noch auf Schweinshaxen, SUV und Urlaubsflüge verzichten. Wie soll das funktionieren?
Ich habe mich bei diesem Buch von zwei Erfolgskapiteln deutscher Geschichte leiten lassen. Von der Versöhnung verfeindeter Religionen im Westfälischen Frieden von 1648 und vom Wirtschaftswunder der alten Bundesrepublik, welches durch die Befreiung der Bürger und Unternehmer von staatlicher Gängelung eingeläutet worden war. Die zentrale These meines Friedensplans lautet, dass der Schlüssel für die Befriedung des gesellschaftlichen Konflikts in einer Einigung über die Rolle des Staates in Energie- und Klimapolitik liegt.
Der deutsche Staat hat sich während der 70 Jahre seit dem Atomeinstieg 1955 intensiv in der Energiepolitik engagiert. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Klimapolitik zu einem zusätzlichen Betätigungsfeld für Politiker gemausert. Über Erfolg oder Misserfolg staatlicher Weichenstellungen zu Energie und Klima gehen die Einschätzung in der Bevölkerung weit auseinander.
Ich halte es für aussichtslos, diesen Widerspruch zu befrieden, indem eine der beiden Seiten die andere von ihrem Standpunkt überzeugt – ebenso wie es in den 500 Jahren seit der Reformation keine Einigung zwischen evangelischer und katholischer Kirche gegeben hat. Eine Bekehrung der Klimakritiker-Fraktion zu ambitioniertem Klimaschutz halte ich für ebenso unwahrscheinlich wie die Einführung des Zölibats in der evangelischen Kirche. Und vermutlich wird die katholische Kirche eher eine Päpstin wählen, als dass sich ein Klimakleber davon abbringen lässt, den Klimawandel für die größte Herausforderung der Menschheit zu halten.
Auch freie Wahlen – eigentlich der Königsweg zum Interessensausgleich in einem demokratischen Rechtsstaat – sind vermutlich für die dauerhafte Auflösung eines so tiefgreifenden und verhärteten Zerwürfnisses ungeeignet. Gewinnt eine Seite bei einer Wahl die Oberhand, wird sie als Erstes eifrig die aus ihrer Sicht falschen Klima- und Energiegesetze der Vorgängerregierung aufheben oder entschärfen, um nach vier Jahren in der nächsten Wahlperiode zuschauen zu dürfen, wie ihre politische Konkurrenz in einer Nachfolgeregierung alle Entscheidungen wieder zurückdreht. Dieses Hin und Her bewirkt das genaue Gegenteil der Berechenbarkeit, die sich Bürger und Unternehmer eigentlich wünschen.
Nach meiner Überzeugung liegt der Schlüssel zur Lösung des gesellschaftlichen Konflikts darin, die Rolle des Staates in strittigen Fragen wie Energie und Klima grundsätzlich zu überdenken. Um dem Staat eine angemessene Rolle zuzuweisen, schlage ich einen Energiegipfel ähnlich den Westfälischen Friedensverhandlungen vor.
Bevor dieser eines Tages tatsächlich stattfinden wird, stelle ich mit dem vorliegenden Buch ein Gedankenexperiment über den möglichen Verlauf eines solchen Gipfeltreffens vor. Der Energiegipfel sei ein mehrtägiges Treffen, bei dem sich Vertreter der unterschiedlichen politischen Strömungen zusammensetzen und über einen möglichen Weg in einen Energie- und Klimafrieden verhandeln. Um dem Ereignis Richtung und Struktur zu geben, schlage ich einen vierstufigen Verhandlungsablauf vor.
1.3 Energiegipfel: Die Arbeitsaufgaben
Die Verhandlungen des hypothetischen Energiegipfels könnten in vier Schritten erfolgen. In einem ersten Schritt in Kapitel 2 bekommen die Gipfelteilnehmer die Aufgabe, die wichtigsten Fakten über acht staatliche Entscheidungen der vergangenen 70 Jahre zusammenzutragen, die die Energie- und Klimapolitik Deutschlands geprägt haben. Ähnlich wie die Beweisaufnahme in einem Gerichtsverfahren ist diese Aufgabe darauf beschränkt, Fakten zu sammeln und Experten anzuhören, ohne die politischen Maßnahmen zu bewerten.
Als zweiten Schritt sollen die Gipfelteilnehmer in Kapitel 3 die Frage beantworten, wie die Energieversorgung Deutschlands heute aussähe, wenn es in der Vergangenheit weder energie- noch klimapolitische Maßnahmen gegeben hätte – abgesehen von Antimonopol- und Emissionsschutzgesetzen. Diese beiden Instrumente werden selbst von eingefleischten Libertären akzeptiert, weil sie Eigentum und öffentliche Ordnung schützen. Schritt zwei dient dazu, einen Vergleichsmaßstab herzustellen. An diesem kann dann die tatsächliche Politik bewertet werden.
Aufwändigster Teil des Energiegipfels ist der dritte Schritt in Kapitel 4. Hier erhalten die Teilnehmer die Aufgabe: »Bitte analysieren Sie für jede der acht Maßnahmen, wie sie sich auf Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit der Energieversorgung im Vergleich zu einem hypothetischen Deutschland ohne Energie- und Klimapolitik ausgewirkt hat.« Das ergibt 24 Fragen, deren Beantwortung intensive Diskussionen erfordern würde. Aus den Antworten ergibt sich eine Bilanz aus 70 Jahren deutscher Energie- und Klimapolitik.
Nachdem diese Bilanz vorliegt, kommt als vierter Schritt in Kapitel 5 der kreative Teil des Konvents mit der Aufgabe: »Leiten Sie aus dieser Bilanz einen Friedensplan ab, der für alle Gipfelteilnehmer annehmbar ist.« Auf diese Frage werde ich eine Antwort formulieren – den Friedensplan für Energie und Klima –, von dem ich mir vorstelle, er sei für alle sechs stimmberechtigten Verhandlungspartner annehmbar. Neben dieser Antwort werde ich auch meine eigene Position offenlegen, die vom dargestellten politischen Kompromiss etwas abweicht.
Über den spekulativen Charakter meiner Überlegungen bin ich mir im Klaren. Ich nehme deshalb das Risiko auf mich, dass mein Friedensplan möglicherweise anders aussieht als ein tatsächliches Verhandlungsergebnis. Wenn diese Arbeit allerdings als Anregung für einen oder mehrere tatsächliche Energiegipfel auf nationaler, kommunaler oder auf Familienebene dient, ist der Zweck des Buches erfüllt.
1.4 Energiegipfel: Die Verhandlungsdelegationen
Um unserer Analyse ein menschliches Gesicht zu verleihen, stellen wir uns in Analogie zu den Westfälischen Friedensverhandlungen einen runden Tisch vor. Zur Vermeidung der Begriffe links und rechts teile ich die Vertreter des politischen Spektrums holzschnittartig in eine ökologisch-soziale (ÖS) und in eine freiheitlich-konservative (FK) Fraktion. Jede entsendet eine kleine Zahl an Vertretern. Die fiktiven Delegationen der beiden Seiten sollten deutlich schlanker sein als die Hundertschaft bei den Westfälischen Friedensverhandlungen. Drei stimmberechtigte Vertreter pro Fraktion zuzüglich eines Moderatorenduos ohne Stimmrecht ergäbe eine überschaubare Zahl von acht Personen. Die stimmberechtigten Vertreter würden jeweils vom Volk gewählt, allerdings getrennt nach jeweils einer Liste von ÖS und FK.
In den beiden Delegationen sollte je eine Stimme von Bürgern, Unternehmern und Wissenschaftlern vertreten sein. Politiker gehören nach meiner Auffassung nicht auf die Teilnehmerliste. Um unserem Gipfel – zumindest theoretisch – Strahlkraft und Unterhaltungswert zu verleihen, sollten die Teilnehmer eine gewisse öffentliche Bekanntheit besitzen. Deshalb würde ich die Bürger durch Journalisten vertreten lassen. Die Journalisten sollten ihre jeweiligen Anhänger unter den vielen unbekannten arbeitenden Bürgern, die unser Land durch ihren Fleiß am Laufen halten, angemessen repräsentieren. Bei den Unternehmern würde ich solche auswählen, deren Leistung im weitesten Sinne des Wortes mit Energie, Umwelt oder Mobilität in Verbindung steht und die – zumindest zeitweise – durch unternehmerisches Geschick den Wert ihres Unternehmens gemehrt haben. Bei den Wissenschaftlern würde ich auf Ökonomen und Energiefachleute setzen und keine reinen Klimaforscher einladen. Letzteres ist dadurch begründet, dass der Klimawandel weitgehend unbestritten ist und für den Energiegipfel nicht zur Debatte steht.
Wen würden Sie, liebe Leser, für die Friedensverhandlungen nominieren? Meine Vorschlagsliste mit drei Kandidaten pro Posten sieht so aus:
Für den Wissenschaftlerposten der ökologisch-sozialen Fraktion würde ich zur Abstimmung stellen: den Energieforscher Hans-Martin Henning, Professor für Solare Energiesysteme an der Universität Freiburg und Direktor des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme, den Ökonomen Ottmar Edenhofer, Professor für die Ökonomie des Klimawandels an der TU Berlin und Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung und den Physiker Armin Grunwald, Professor für Technikphilosophie am Karlsruher Institut für Technologie KIT und Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Für die Wissenschaftlerposition der freiheitlich-konservativen Fraktion würde ich für die Abstimmung nominieren: Den Ökonomen Hans-Werner Sinn, emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians Universität München und Ex-Präsident des ifo-Instituts, den Energieforscher Michael Beckmann, Professor für Energieverfahrenstechnik der TU Dresden und Organisator des Dresdner Kraftwerkstechnischen Kolloquiums sowie den Ökonomen Stefan Kooths, Professor für Volkswirtschaftslehre und Leiter des Prognosezentrums der Universität Kiel.
Für den Unternehmerplatz der ÖS-Fraktion würde ich zur Auswahl stellen: Josef Kallo, Gründer des Stuttgarter Unternehmens H2FLY GmbH für Brennstoffzellen-Flugzeugantriebe, Frank Asbeck, Gründer der SolarWorld AG, und Christoph Ostermann, Gründer der Sonnen GmbH für Batteriespeicher. Für die FK-Fraktion würde ich zur Abstimmung stellen: Jürgen Großmann, ehemaliger RWE-Vorstandsvorsitzender und Alleinaktionär der Stahlgruppe Georgsmarienhütte, Regine Sixt, Vizepräsidentin des Mobilitätsdienstleisters Sixt SE und Vorstandsvorsitzende der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung sowie Wolfgang Reitzle, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Linde AG.
Als Journalisten und Medienvertreter würde ich für die ÖS-Fraktion nominieren: Heribert Prantl, Journalist für die Süddeutsche Zeitung, Professor Harald Lesch, Astrophysiker und Fernsehmoderator, sowie Mai Thi Nguyen-Kim, Wissenschafts-kommunikatorin und Youtuberin mit 1,5 Millionen Abonnenten. Für die FK-Fraktion nominiere ich: Roland Tichy, Chefredakteur des Magazins Tichys Einblick, Axel Bojanowski, Wissenschaftsjournalist bei der Tageszeitung Die Welt sowie Marc Friedrich, Bestsellerautor und Youtuber mit einer halben Million Abonnenten.
Das Moderatorenteam erlaube ich mir eigenmächtig und ohne Volksbefragung zusammenzustellen: Mein Wunschpaar wären die ehemalige Fernsehmoderatorin Sabine Christiansen sowie die Wissenschaftlerin Sabine Hossenfelder, Physikerin und Youtuberin mit 1,5 Millionen Abonnenten.
Christiansen hat während ihrer aktiven Zeit unter anderem die TV-Kanzlerduelle zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und seinem Herausforderer Edmund Stoiber im Jahr 2002 sowie zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und seiner Herausforderin Angela Merkel im Jahr 2005 moderiert. Sie besitzt damit unzweifelhaft das publizistische Format, einen Verhandlungsgipfel von nationaler Bedeutung zu moderieren.
Hossenfelder erreicht mit ihren populärwissenschaftlichen Videos ein Millionenpublikum und gibt überdies wertvolle Ratschläge für lebenswichtige Herausforderungen des Alltags. In ihrem Video7 über Kernenergie warnt sie zum Beispiel: »Wenn Sie zufällig ein Gramm eines unbenutzten Kernbrennstabs essen, erhalten Sie [nur] etwa 1,3 Millisievert […] Der frische Atommüll gebrauchter Stäbe ist hingegen […] 10000 Mal radioaktiver. Ein Gramm würde Sie wahrscheinlich in ein paar Wochen umbringen. Essen Sie also bitte keine gebrauchten Kernbrennstäbe!«
Die beiden Moderatorinnen besitzen allem Anschein nach keine energie- und klimapolitischen Ambitionen. Auch habe ich von ihnen keine Äußerungen wahrgenommen, die eine ausgeprägte Parteinahme für eine der beiden Fraktionen erkennen ließen. Damit sind die beiden Damen für den Gipfel bestens aufgestellt.
1.5 Energiegipfel: Die Spielregeln
Im ersten Schritt tragen die Verhandlungsführer die ihnen wichtig erscheinenden Fakten zu den acht Staatsprojekten zusammen. Die Sammlung von Informationen kann bei einem echten Energiegipfel von externen Berichterstattern ergänzt werden. Im vorliegenden Fall werden diese Externen durch die Autoren der in Kapitel 2 zitierten Literaturverweise verkörpert. In diesem Schritt steht es jeder Seite frei, alle ihr wichtigen Zahlen und Fakten auf den Tisch zu legen, unabhängig davon, ob die Gegenseite diese Informationen ebenfalls als bedeutsam anerkennt.
Zu den Spielregeln des ersten Tagesordnungspunktes gehört auch, dass keine der Seiten Bewertungen vornimmt. In diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Abstimmungen. Die Rolle der Moderatorinnen würde im Wesentlichen darauf beschränkt sein, die professoralen Mitglieder von überlangen Monologen abzuhalten und auf eine ausgewogene Verteilung der Redezeiten zu achten.
Im zweiten Schritt führen beide Parteien das Gedankenexperiment durch, wie es mit der Versorgungssicherheit, mit der Bezahlbarkeit und mit der Umweltverträglichkeit der heutigen Energieversorgung bestellt wäre, wenn sich der Staat in der Vergangenheit weder mit Energie noch mit Klima beschäftigt hätte. Dabei käme jedes der sechs stimmberechtigten Mitglieder mit einem Kurzreferat zu Wort. Aus diesen Einzelbeiträgen müsste die Gruppe mit Unterstützung der Moderatorinnen ein Gesamtbild erarbeiten. Ich würde für diesen Tagesordnungspunkt keine großen Kontroversen erwarten. Das Resultat müsste dennoch in einer Abstimmung mit einfacher Mehrheit angenommen werden.
Der anspruchsvollste Teil der Verhandlungen dürfte der dritte Tagesordnungspunkt – Kapitel 4 – sein, in dem sich die beiden Parteien auf Antworten zu den 24 Fragen einigen müssten. Sie müssten für jede der acht Maßnahmen drei Fragen beantworten, nämlich ob sie sich die Staatsprojekte auf Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit gut, schlecht oder unentschieden ausgewirkt hätten.
Zu jeder der Fragen könnte jedes stimmberechtigte Mitglied der Verhandlungsgruppen eine eigene Einschätzung vortragen. Unter Leitung der Moderatorinnen müssten sich die Parteien auf eine einvernehmliche Antwort einigen. Ist eine Einigung nicht herbeizuführen, würde eine einfache Mehrheit für ein Abstimmungsergebnis reichen. Im Fall von Stimmengleichheit wird die betreffende Frage mit »unentschieden« beantwortet. Dies führt dazu, dass die Prädikate »besser« oder »schlechter« für eine politische Maßnahme nur vergeben werden können, wenn sich mindestens ein Mitglied einer Fraktion mit seiner Meinung auf die Seite der anderen Fraktion stellt.
Die Spielregeln für Kapitel 5, in dem der Friedensplan formuliert wird, würden bei einem echten Energiegipfel darin bestehen, dass der Friedensplan von allen sechs stimmberechtigten Mitgliedern einvernehmlich angenommen werden muss. Gibt es kein Einvernehmen, ist der Gipfel gescheitert. Für unseren fiktiven Gipfel formuliere ich einen Friedensplan, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er von beiden Seiten akzeptiert werden könnte. Ob dies der Fall ist, lässt sich erst nach Durchführung eines echten Energiegipfels entscheiden.
1.6 Für eilige Leser
Während die Kapitel 1, 3 und 5 kurz und ohne Fachwissen über Energie und Klima verständlich sind, enthalten die arbeitsintensiven Kapitel 2 und 4 zahlreiche Zahlen, Fakten und teilweise subtile Analysen. Für ein umfassendes Verständnis des Friedensplans sowie für eilige Leser oder solche ohne Interesse an fachlichen Details sind diese Einzelheiten nicht unbedingt notwendig.
Bei Kapitel 2 reicht es aus, zu Beginn jedes Abschnitts die kurze Rubrik »Worum geht es?« zu lesen. Dort findet sich eine allgemeinverständliche Darstellung der betreffenden politischen Maßnahme ohne schwer verdauliche Zahlen und technische Details. Danach können Sie direkt zu Kapitel 3 springen. In Kapitel 4 ist es für eilige Leser ausreichend, die vollständige Bewertungstabelle 14 sowie die Gesamtschau in Form von Tabelle 15 zu studieren. Danach können Sie direkt mit Kapitel 5 fortfahren.
2. Rückblick: Acht Staatsprojekte für Energie und Klima
Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl wird oft mit den Worten zitiert: »Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.« Jede Entscheidung über künftige energie- und klimapolitische Maßnahmen sollte deshalb mit einer Analyse der Vergangenheit beginnen. Dies ist die erste Aufgabe für die Teilnehmer unseres Energiegipfels.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat sich seit ihrer Existenz umfassend auf dem Gebiet der Energiepolitik betätigt. (Die Energiepolitik der DDR ist nicht Gegenstand des Energiegipfels, weil man ihr zwar Umweltschäden anlasten kann, jedoch nicht die heutige gesellschaftliche Spaltung.) Vor etwa 30 Jahren kamen klimapolitische Maßnahmen hinzu. Aus der Vielfalt an Verordnungen, Gesetzen und staatlichen Maßnahmen habe ich die nach meiner Meinung acht wichtigsten ausgewählt. Sie haben entweder die heutige Energiesituation geprägt oder befeuern wegen ihres umstrittenen Charakters die Spaltung der Gesellschaft.
Diese Staatsprojekte werden die beiden Verhandlungsdelegationen des Energiegipfels näher beleuchten: (1) den Atomeinstieg im Jahr 1955, (2) den Atomausstieg im Jahr 2023, (3) die Kohlesubventionen von 1974 bis 2018, im Folgenden als »Kohlepfennig« bezeichnet, (4) den für das Jahr 2038 beschlossenen Kohleausstieg, (5) die Erdgasröhrengeschäfte zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion von 1970 bis Ende der 1980er-Jahre, im Folgenden als »Gasgeschäfte« bezeichnet, (6) die Einschränkung der Erdgasimporte aus Russland im Zuge des Ukrainekrieges seit 2022, (7) die Subventionen im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG seit dem Jahr 2000 sowie (8) technologiespezifische Verbote wie das de-facto-Verbot von Gas- und Ölheizungen durch das Gebäudeenergiegesetz GEG (im Volksmund »Heizgesetz«) aus dem Jahr 2023 und das für 2035 geplante Aus für Verbrennungsmotoren. Diese Maßnahmen werden mit der Kurzbezeichnung »Verbote« versehen.
Den Einstieg Deutschlands in die Petrochemie sowie die Schaffung des europäischen CO2