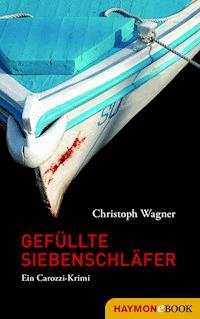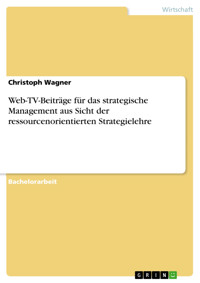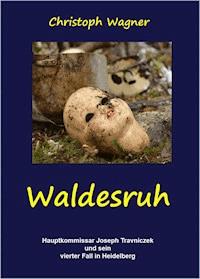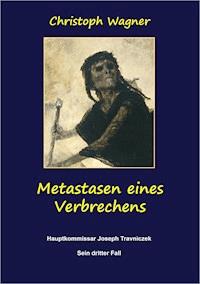Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Heidelbergkrimi
- Sprache: Deutsch
Vor mehr als 20 Jahren, im Mai 1990, legte die damals 28jährige Angela Ricardi im Dom zu Speyer vor dem Bischof die Beichte ab. Sie plagte eine schwere Gewissensnot und sie war dem Selbstmord nahe. Der Bischof verstand ihre Lage und wurde aktiv, um ihr einen Ausweg zu ermöglichen. Am 29.September 2012 brannte im syrischen Bürgerkrieg der weltberühmte Basar von Aleppo nieder. Zwei junge Männer, die das Inferno schwerverletzt überstanden hatten, lernten sich zufällig im Krankenhaus kennen. Der eine hatte seinen Vater, der andere seine beiden Kinder verloren. Sie eint der Hass auf Assad. Sie schmieden einen Plan, ihn zu vernichten. Der eine von ihnen hatte in Heidelberg studiert. Er glaubte, dort bekommen zu können, was sie für ihren Plan brauchten. Im Dezember 2012 saß ein Student im Hörsaal 2 des Psychologischen Seminars der Uni Heidelberg und konnte den Ausführungen des Professors nicht wirklich folgen. Ihn trieb eine Frage um: Wer bin ich eigentlich? Er machte sich auf die Suche und wurde fündig. Doch was er fand, ließ ihn zu Tode erschrecken. Er wusste: In Zukunft würde nichts mehr so sein wie bisher. Diese drei Ereignisse verbinden sich zu einer hochexplosiven Gemengelage. Am 31. Mai 2013 finden Wanderer im Wald hinter Heidelberg-Ziegelhausen eine verstümmelte Frauenleiche. Sie wird wenig später als jene Angela Ricardi identifiziert, die uns schon am Anfang der Geschichte begegnet ist. Sie hieß mittlerweile Wendlandt und war Richterin am Landgericht. Schnell wird ein Verdächtiger festgenommen und es scheint ein ganz "normaler" Mordfall zu werden, wäre da nicht der Terminkalender des Opfers, der eine ganze Reihe gänzlich unverständlicher Einträge enthält. Lange tappt das Ermittlerteam völlig im Dunkeln und kann nicht verhindern, dass innerhalb weniger Tage fünf Menschen tot sind und zwei Kinder entführt. Dabei entgeht Hauptkommissar Travniczek bei einem nächtlichen Einsatz selbst nur knapp dem Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Zur Serie Heidelbergkrimi
Impressum
Christoph Wagner
Der Autor
Gelobt seist Du, mein Herr,
Prolog
Freitag, 31. Mai 2013
Samstag, 1. Juni 2013
Sonntag, 2. Juni 2013
Montag, 3. Juni 2013
Dienstag, 4. Juni 2013
Mittwoch, 5. Juni 2013
Donnerstag, 6. Juni 2013
Freitag, 7. Juni 2013
Epilog
Dichtung und Wahrheit
In der Reihe bisher erschienen:
Zur SerieHeidelbergkrimi
Der Chef der Mordkommission Heidelberg, Hauptkommissar Joseph Travniczek, ist ein sehr ungewöhnlicher Kriminalist. In seiner Ermittlungsarbeit geht er zusammen mit seinen Mitarbeitern Martina Lange und Michael Brombach eher wie ein Profiler vor als wie ein klassischer Kriminalkommissar. Er will die Psyche von Täter und Opfer verstehen, will wissen, wie sie ticken. Das sieht er als unabdingbare Voraussetzung, um einen Fall lösen zu können.
Aufgewachsen ist er in einer Musikerfamilie und wollte als Jugendlicher eigentlich Konzertpianist werden, ging dann aber nach prägenden Erlebnissen als Zivildienstleistender in einer Jugendstrafanstalt zur Polizei. In der Polizeidirektion Heidelberg hat er ein elektronisches Klavier in ein kleines Zimmerchen gestellt. Dorthin verschwindet er immer, wenn die Ermittlungsarbeit besonders angreifend wird, spielt Bach, um „sein Gehirn zu reinigen“.
Das Ermittlerteam wird bei seiner Arbeit auch immer wieder zu den markanten Plätzen Heidelbergs geführt. Dabei sind die Texte so konzipiert, dass sie nicht nur für Einheimische, sondern gerade auch für Menschen interessant sind, die Heidelberg gar nicht oder nur wenig kennen. Hauptkommissar Travniczek war, bevor er vor drei Jahren seinen Dienst bei der Heidelberger Kripo antrat, noch nie in dieser Stadt. Der Leser wird Zeuge, wie er sich die Stadt allmählich aneignet und sie kennen und lieben lernt. Darüber hinaus gibt es über alle mit *) bezeichneten Orte und Sehenswürdigkeiten im Heidelberg-Glossar auf der Internetseite www.heidelbergkrimi.de Erläuterungen, Bilder und oft auch weiterführende Links.
Diese Serie will nicht nur spannende und aufwühlende Kriminalgeschichten bieten, sondern ausdrücklich auch Lust auf Heidelberg machen.
Impressum
Alle Rechte vorbehalten
Copyright©2013 Christoph Wagner
Coverfoto: Detail aus der Ölbergszene am Speyerer Dom
Copyright©2013 Christoph Wagner
Christoph Wagner
Der Engel mit den
traurigen Augen
Hauptkommissar Joseph Travniczek
sein zweiter Fall
Der Autor
Christoph Wagner wurde 1953 in Jever (Norddeutschland) geboren. Er lebte von 1959 bis 1983 in Heidelberg, besuchte dort die Grundschule, von 1964 bis 1972 das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium und studierte danach Musik und Mathematik. Seit 1983 arbeitete er bis Ende des Schuljahrs 2015/16 als Musikund Mathematiklehrer in Frankfurt am Main. Der Kontakt zu Heidelberg blieb immer bestehen.
Zu der Reihe „Heidelbergkrimi“ sagt er:
Ich will hier meine Liebe zu Heidelberg, das ich für eine der schönsten und interessantesten Städte überhaupt halte, verbinden mit der Frage nach der Psychologie des Bösen. Im ersten Roman habe ich meine Grundfrage Hauptkommissar Joseph Travniczek in den Mund gelegt. Angesichts eines brutal erschlagenen Mannes sagt er: "Wie unendlich viel muss in der Seele eines Menschen zerstört worden sein, damit er zu so einer Tat fähig wird? ... Kein Kind wird als Mörder geboren."
Dabei interessieren mich vor allem Menschen, die nicht einfach nach den Kategorien Gut und Böse eingeordnet werden können, und Themen, die politische, gesellschaftliche oder ethische Bedeutung haben.
Als Motto über die ganze Reihe diene ein Ausspruch von Robert Louis Stevenson:
„Im Schlechtesten der Menschen steckt noch so viel Gutes
und im Besten noch so viel Böses,
dass keiner befugt ist zu urteilen und zu verurteilen.“
Gelobt seist Du, mein Herr,
durch unseren Bruder Tod,
dem kein Lebend'ger kann entrinnen.
Aus dem „Sonnengesang“ von Franz von Assisi
Prolog
1 – Mai 1990
Angela Ricardi war völlig verzweifelt. Ihren Blick auf den Boden geheftet, nicht starr, sondern unstet flackernd, verließ sie das beschauliche Waldhilsbach* langsam und stolpernd, die Schultern hochgezogen und den Rücken gebeugt, das Gesicht von ihrem langen schwarzen, leicht gelockten Haar fast vollständig verdeckt. Immer wieder sah sie sich scheu nach den Seiten um, als ob sie Angst hätte, verfolgt zu werden.
Sie hatte sich Pater Ignatius in der Beichte anvertraut, der sie schon vor genau zwanzig Jahren zur Erstkommunion geführt hatte. Aber er half ihr nicht, im Gegenteil. Er ließ nicht gelten, dass sie unschuldig an ihrem Unglück war, und fällte sein Urteil gnadenlos und hart: Neues Leben sei immer ein Gottesgeschenk. Die sündigen Menschen hätten nicht zu fragen, ob sie mit den Bedingungen seiner Entstehung einverstanden sind. Das in ihr reifende Kind mochte für sie eine schwere Prüfung sein, aber die müsse sie bestehen. Gott habe selbst seinen Sohn geprüft, da dürften sich die sündigen Menschen seinen Prüfungen nicht widersetzen. Daran auch nur zu denken sei schon schwere Sünde. Als Buße dafür gab er ihr auf, fünfzig Ave Maria und zehn Vaterunser zu beten.
Dabei war früher alles so schön gewesen. Umsorgt und behütet war sie aufgewachsen als einziges, spätes Kind ihrer Eltern. Die waren überglücklich, dass nach zwölf kinderlosen Ehejahren ihr sehnlichster Wunsch doch noch in Erfüllung gegangen war. „Unser Engel“, sagten sie immer, wenn sie von ihr sprachen. Und das meinten sie auch. Denn sie waren tief gläubig. Ein Zweifel an dem, was die Kirche lehrte, wäre ihnen nie gekommen. In dieser Atmosphäre der unbedingten Gültigkeit der Lehren der Kirche war sie groß geworden. Unvergessen
blieb der Tag der Erstkommunion. Das weiße Kleid, der Weihrauch, die vielen Menschen, die auf sie schauten. Die schönen Lieder, die wunderbare Orgel. So ähnlich muss es im Himmel sein, dachte sie damals und fühlte sich wahrlich als Engel.
Sie hatte nie empfunden, wovon erst viele ihrer Mitschüler und später Studienkollegen sprachen: die Enge und Muffigkeit katholischer Erziehung. Die Eltern hatten ihren Glauben so natürlich gelebt, dass sie sich in diesem Leben rundum glücklich fühlte. Sie engagierte sich für Projekte von Adveniat in der Dritten Welt und ließ seit ihrem zwölften Lebensjahr keinen Katholikentag aus. Nach ihrem Abitur war sie mit einer Jugendgruppe nach Rom gereist und dort von dem damals neuen Papst Johannes Paul II. empfangen worden. Sie durften sogar mit ihm sprechen. Vom Charisma dieses Mannes verzaubert, verehrte sie ihn seitdem mehr als den eigenen Vater.
Und dann die große Liebe zu Benni, einer Liebe, mit der der Traum ihrer Kindheit weiterzugehen schien. Es war ausgemacht, dass sie heiraten würden, wenn sie erst im Beruf etabliert wären, dass sie Kinder bekommen und glücklich würden. Nur schmerzte sie es immer wieder, wenn Benni nicht warten wollte, bis der Segen Gottes ihre Verbindung besiegelte. Aber irgendwann schien er es eingesehen zu haben und fing nicht mehr davon an.
In der Schule war sie stets die Klassenbeste, ohne sich wirklich anstrengen zu müssen. Dann hatte sie an der Heidelberger Universität Jura studiert und vor zwei Monaten ihr Doktorexamen summa cum laude abgelegt. Sie war jetzt 28 Jahre alt und ihre Karriereaussichten waren blendend. Was wollte sie mehr?
Doch zwei Wochen nach dem Examen brach in Davos die Katastrophe über sie herein, eine totale Demütigung und ein fürchterlicher Vertrauensbruch. Aber das wäre noch verkraftbar gewesen, hätte nicht die Nachricht ihres Arztes vor fünf Tagen den zweiten Schock gebracht. Davos würde Folgen haben, die sie ihr ganzes Leben nicht loswerden könnte, es sei denn …, es sei denn, sie entschied sich für das, was ihre Religion ihr verbot.
Und jetzt der dritte Schlag: das Verdikt von Pater Ignatius. Ziellos ging sie immer tiefer in den Wald hinein und dachte nicht daran umzukehren, als es dunkel wurde. Sie prüfte immer wieder, ob sie die Forderungen von Pater Ignatius erfüllen könne. Und immer wieder hieß die Antwort: nein. Wie sollte sie ein Kind in Liebe aufziehen, das sie immer an die fürchterlichste Demütigung erinnern würde? Wie sollte dieses Kind Zuversicht zum eigenen Leben finden in dem Wissen, dass es seine Existenz einem Verbrechen verdankte? Und sie glaubte auch nicht, ihm seine wahre Entstehung verschweigen zu können. Diese Lüge würde das Kind für immer unerträglich belasten, selbst wenn sie nie offenbar würde.
Drei Tage und drei Nächte irrte sie schlaflos durch Heidelberg und die angrenzenden Wälder. Zweimal stieg sie auf den Turm der Heiliggeistkirche*, um ein Ende zu machen. Aber auch dazu war sie zu schwach. In der dritten schlaflosen Nacht kam dann überraschend die Wende: Sie hatte oben auf dem Heiligenberg in der Krypta der Michaelsbasilika* Schutz vor einem nächtlichen Gewitter gesucht. Und plötzlich stand in völliger Klarheit ein Erinnerungsbild vor ihr: Rafael Neidhardt, der Bischof von Speyer, ein Hüne von Gestalt, mit schon ergrautem, wallendem Haupthaar und gewaltigem Vollbart, steht vor einem riesigen Auditorium. Es war am letzten Katholikentag, und mit seinem Vortrag über „die Barmherzigkeit Gottes“ zog er seine Hörer in Bann. Mit dem warmen Klang seiner Stimme und dem liebevollen Ausdruck seiner leuchtenden Augen schien er Gottes Barmherzigkeit Gestalt zu geben. Er sprach davon, dass es keine Sünden gäbe, die Gott nicht auch vergeben könne, dass es keine auch noch so verworrene Situation gäbe, in der kein Ausweg zu finden sei. „Wenn du dich wahrhaft ins Gebet versenkst, wird sich dir eine Lösung offenbaren, und je schwieriger das Problem ist, um so einfacher wird sie sein.“
Im gleichen Moment wusste sie: Dieser Mann wird mich verstehen. Er wird mir helfen.
Sie erhob sich von den kalten Steinstufen und merkte nicht mehr, wie in der regennassen Kleidung die Kälte ihren Körper
herauf kroch. Voll neuer Energie trat sie hinaus in den Regen und kümmerte sich nicht um Blitz und Donner. Sie eilte hinunter zur Heidelberger Altstadt, über die Alte Brücke, hinauf zum Schloss und weiter durch den Wald, wo sie sich so gut auskannte, dass sie trotz der stockdunklen Regennacht mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg über den Königstuhl zurück nach Waldhilsbach fand.
Kurz nach halb sieben erreichte sie das Elternhaus. Mutter und Vater, die schon die Polizei zu Hilfe gerufen hatten, um ihre verloren geglaubte Tochter zu finden, kamen ihr gleichzeitig erleichtert und erschrocken entgegen und überhäuften sie mit Fragen. Sie wehrte sie wortlos ab, suchte die Kleidung zusammen, die sie sonntags beim Kirchenbesuch zu tragen pflegte, ging ins Bad, duschte lang, kleidete sich an und verließ das Haus so wortlos, wie sie gekommen war, die fassungslosen Eltern mit ihren Fragen ratlos zurücklassend.
Sie bestieg ihren weißen VW-Golf und bemerkte, dass es allmählich aufhörte zu regnen, während sie durch Heidelberg über die Speyerer Straße nach Schwetzingen fuhr. Dort sah sie die ersten Sonnenstrahlen durch die vorher so dichte Wolkendecke brechen, wie sie glänzendes Licht über die Kuppel und Minarette der Moschee im Schlosspark warfen, die einst Kurfürst Carl Theodor zum ästhetischen Vergnügen für sich und seine Gäste hatte bauen lassen.
Als sie an den Rhein kam und sich der Blick auf den Kaiserdom* öffnete, hatten sich die Wolken fast vollständig verzogen. Der gewaltige Bau mit seinen vier Türmen und den zwei Kuppeln lag vor ihr im strahlenden Licht der Morgensonne, ein Anblick, der ihr von vielen Besuchen dieses Gotteshauses vertraut war und der ihr immer noch tief aufgewühltes Inneres ein wenig zur Ruhe brachte.
Sie überquerte den Rhein und stellte ihr Auto auf dem großen Besucherparkplatz südlich des Doms ab. Langsam stieg sie aus und merkte jetzt erst, wie müde und hungrig sie eigentlich war, hatte sie doch in den letzten drei Tagen wenig gegessen und so gut wie nicht geschlafen. Aber erst musste sie erkunden,
ob, wann und wie sie dem Bischof ihre Not vortragen konnte. Sie fand am Dom einen Hinweis auf das bischöfliche Ordinariat in der Kleinen Pfaffengasse, nur wenige Meter entfernt. Aber dort öffnete ihr noch niemand, denn es war erst kurz nach acht. Enttäuscht ging sie zurück zum Dom, und plötzlich war da die Angst, sie könnte umsonst gefahren sein. Sie überquerte den Domplatz und fand in der anschließenden Fußgängerzone ein Café, das um diese Zeit schon geöffnet hatte und ein Frühstück anbot.
Etwas gestärkt, aber immer noch bang wandte sie sich zurück zum bischöflichen Ordinariat und bekam die erlösende Nachricht: Am späten Nachmittag um fünf Uhr könne sie im Dom beichten und der Bischof persönlich würde die Beichte abnehmen. Sie glaubte nicht an einen Zufall. Das musste Fügung sein. Mit Gottes Hilfe würde jetzt doch noch alles gut werden.
Für den Moment war alle Müdigkeit verflogen. Mit freudigen Schritten eilte sie zurück zum Dom und betrat ihn durch den Haupteingang in der Westfassade. Als sie in das Hauptschiff des Langhauses sah, in das durch die kleinen Obergadenfenster von Südosten das Sonnenlicht einfiel, blieb sie unwillkürlich stehen. Ihre Augen wanderten an den Fenstern entlang, folgten den Sonnenstrahlen, bis sie die nördliche Pfeilerreihe trafen, und blieben schließlich jenseits der Vierung am Torbogen des Eingangs zum Ostchor haften. Dort war es dunkler. Die Sonnenstrahlen, fein wie Silberfäden, konnten nicht sichtbar machen, was dort im Verborgenen lag.
In diesem Dunkel liegt der Ursprung allen Seins, dachte sie, benetzte zwei Finger der rechten Hand im Weihwasserbecken, schlug ein Kreuz und schritt langsam durch den Mittelgang. Kurz vor dem Volksaltar1 deutete sie einen Kniefall an und stieg linker Hand etliche Treppenstufen zum Querhaus und dem Hauptaltar empor. Sie wäre gerne weitergegangen, um sich vom Dunkel des Ostchores einhüllen zu lassen, fand den Zutritt aber durch eine Eisenkette versperrt. Sie blickte zurück in das Langhaus, ließ sich vom Silberglanz der riesigen Orgel2 gefangen nehmen und versuchte sich vorzustellen, wie ihr Klang durch die Weite dieses Raumes flutet. Schließlich sah sie an der nördlichen Stirnwand des Querhauses zwei kleine Seitenkapellen und trat in die linke von ihnen ein.
Vor dem Altar fiel sie auf die Knie, um zu beten. Aber sie fand keine Worte. Sie erschrak, weil sie das noch nie erlebt hatte. War es schon so weit mit ihr gekommen? Benommen erhob sie sich nach einer Weile wieder, setzte sich auf eine Bank an der Rückwand der Kapelle und ließ ihren Blick durch den weiten Raum des Domes schweifen. Allmählich wurden die realen Bilder durch verschwommene Erinnerungen an die schönen Zeiten der Kindheit überlagert, bis schließlich ihr Kopf auf die Brust sank und sie einschlief.
Mehrere Stunden saß sie schlafend in der Seitenkapelle. Einige wenige Touristen hatten sie gesehen und sich auf leisen Sohlen entfernt, um ihren Schlaf nicht zu stören. Die Sonne war sehr viel weiter gezogen und ihre Strahlen fielen nun direkt von Süden durch die Fenster des Langhauses ein. Allmählich erwachte sie und brauchte geraume Zeit, um zu begreifen, wo sie war. Sie sann den seltsamen Traumbildern nach, die sie bewegt hatten. Die meisten waren nicht klar genug, um bleibende Erinnerung werden zu können. Aber die Szene kurz vor dem Erwachen war haftengeblieben. Sie sah sich selbst als Kind im weißen Kleid der Erstkommunion mit anderen gleichgekleideten Mädchen freudig und ausgelassen herumtollen. Da stand plötzlich ein kleiner, schmächtiger Junge zwischen ihnen, gleichfalls im weißen Kleid, das nicht zu ihm passte, und das kindliche Toben erstarrte. Der Junge blickte sie alle aus traurigen Augen an, schüttelte immer wieder den Kopf und entfernte sich allmählich. Als er schon weit weg war, winkte er ihr wie Abschied nehmend zu. Und das Bild zerrann und ging über in die vielen runden Bögen dieses Raumes, in dem sie sich trotz seiner Größe und Höhe beschützt und aufgehoben fühlte.
Lange blieb sie noch sitzen, ehe sie sich endlich erhob und den Dom über das südliche Seitenschiff verließ. Die Mittagssonne schien ihr direkt ins Gesicht. Blinzelnd wandte sie sich nach rechts zu der in Stein gehauenen Ölbergszene3. Auf sechs rechteckigen Säulen ruhte ein Spitzdach, das den mit seinen Jüngern vor der Gefangennahme am Ölberg betenden Jesus schützte. Darunter lag eine kleine, gedrungene, dem Erzengel Michael geweihte Kapelle. Angela Ricardi hatte schon oft in der Vergangenheit viel Zeit damit zugebracht, die verschiedenen Gesichter der Szene zu studieren, und es störte sie nicht, dass die meisten gotischen Originale zerfallen waren und im 19. Jahrhundert durch neue ersetzt werden mussten.
Auch jetzt verweilte sie wieder lange vor den Skulpturen, und besonders beschäftigte sie sich mit dem Engel, der ganz oben auf dem Ölberg stand. Vor ihm kniete Jesus, die Hände erhoben, als würde er ihn, den Engel, anbeten. Aber das konnte nicht sein, dachte Angela Ricardi. Der Schöpfer dieser Szene musste gemeint haben, dass der betende Jesus den Engel nicht sehen kann und natürlich Gott, seinen Vater, anspricht. Aber was war die Bedeutung dieses Engels? Er umfasste mit seiner Rechten ein Kreuz, das auf das bevorstehende Leiden hindeutete. Er zeigte also, was sein würde.
Aber was ist das, fragte sie sich, was ist mit dem Gesicht des Engels? Die Augen sind an den Seiten nach unten gezogen, sie sind todtraurig, nein, noch mehr, auch die Mundwinkel sind nach unten gezogen. Der Engel weint! Aber – warum weint der Engel? Weil er dem betenden Jesus die Botschaft bringen muss: Dein Gebet wird nicht erhört, du musst den Weg des Kreuzes gehen? Aber das ist doch Teil des göttlichen Heilsplans für die Menschen! Wie kann ein Engel darüber weinen? Das hieße ja, Gottes Wege in Frage zu stellen. Oder weint er, weil er Jesus hier schwach sieht?
Angela Ricardi war verwirrt. Lange blieb ihr Blick auf dem Engelsgesicht haften, bis sie allmählich das Gefühl hatte, dort wie in einem Spiegel das eigene Gesicht zu sehen. Diese traurigen Augen, dachte sie, das sind meine Augen …
Schließlich löste sie sich von dem Bild, wandte sich ab und wanderte dann stundenlang ziellos umher. Auf ihrem Gangdurch die kleinen Gassen der Altstadt stieß sie auf das Kloster der Dominikanerinnen zu St. Magdalena. Still verweilte sie in der Klosterkirche und entdeckte dort nach einer Weile die Hinweise auf Edith Stein. Deren Schicksal erregte ihr besonderes Interesse. Als getaufte Jüdin und Geisteswissenschaftlerin hatte sie an der Klosterschule unterrichtet, erhielt 1933 von den Nazis Berufsverbot und trat dann in Köln in ein Kloster ein. Sie schrieb einen Brief an Papst Pius XI., er möge gegen die Judenverfolgung Stellung beziehen. Erfolglos, wie man weiß. Und 1942 wurde sie in Auschwitz vergast. – Das Gesicht des weinenden Engels stand plötzlich wieder vor Angela Ricardis innerem Auge.
Aber je weiter die Zeit vorrückte, umso unsicherer, verkrampfter, ängstlicher wurde sie. Würde sie wieder zurückgestoßen werden? Hatte Pater Ignatius nicht recht, dass sie einfach schlecht war, weil sie glaubte, Gottes Willen nicht erfüllen zu können?
Dann waren es nur noch zwanzig Minuten und sie ging auf die jetzt in der Nachmittagssonne rötlich schimmernde Sandsteinfassade des Domes zu. Aber sie getraute sich nicht mehr aufzublicken, meinte, beobachtet und verachtet zu werden, glaubte, dass Menschen unterwegs wären, die sie verfolgten, um sie am Betreten des Domes zu hindern; denn sie war eine zu große Sünderin, als dass sie würdig wäre, dieses Heiligtum zu betreten. Dann stand sie kurz vor dem Eingang. Mit einem Mal erschienen ihr die Pforten, die Fenster und die zehnblättrige Rosette unendlich klein. Übermächtig waren die monumentalen Quadersteine der Außenmauer. Sie fühlte sich zurückgestoßen. Schon wollte sie sich abwenden, weglaufen und endgültig die Zerstörung ihres Lebens hinnehmen. Doch da sah sie vor sich in schwarzer Soutane, mit wallendem, grauem Haupthaar die große Gestalt des Bischofs Neidhardt. Sofort war wieder die Erinnerung da an jenen unvergleichlichen Vortrag und die Zuversicht: Ja, er wird mich verstehen, er wird mir helfen können.
So betrat sie zum zweiten Mal an diesem Tag den Dom und wandte sich zum nördlichen Seitenschiff, wo die Beichtstühle standen. Da saßen schon viele, die auch beichten wollten, und sie setzte sich in eine Bank, etwas abseits von den anderen.
Punkt fünf Uhr läutete eine kleine Glocke, und als Erste betrat eine alte Frau den Beichtstuhl. Der Bischof schien sich Zeit zu nehmen für die Beichtenden, denn es dauerte lange, bis sie wieder herauskamen. Während so einer nach dem anderen in den Beichtstuhl trat, wurde es langsam still im Dom. Immer weniger Touristen sahen sich um und Angela Ricardi hatte das Gefühl, auch die Zeit käme zum Stillstand. Sie ließ ihre Gedanken in der Weite des Raumes schweifen und die Natur forderte nach den drei fast schlaflosen Nächten erneut ihren Tribut. Sie schlief ein.
Sie schreckte hoch, als ein älterer Mann sie an der Schulter berührte. „Sie sind jetzt an der Reihe“, sagte er leise. Es war deutlich dunkler geworden. Stunden mussten seit Beginn der Beichte vergangen sein. Als ob sie Angst hätte, doch noch zu spät zu kommen, rannte sie fast zum Beichtstuhl, schlug sich dabei das Schienbein so heftig an der Kante einer Kirchenbank an, dass sie fast gestürzt wäre. Dann trat sie schnell ein, ließ den roten Vorhang hinter sich zufallen und kniete nieder. Bischof Neidhardt bemerkte ihre Atemlosigkeit und ließ ihr etwas Zeit sich zu sammeln. „Gelobt sei Jesus Christus“, begann er schließlich und sie antwortete: „In Ewigkeit, Amen.“
„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen4“, sprach der Bischof langsam und leise.
„Du bist sehr erregt, meine Tochter. Ich sehe, du trägst eine schwere Last. Aber sag mir erst, wie ist dein Name?“
„Angela.“
„Das ist ein schöner Name. Angela, sprich! Was quält dich?“
Sie zögerte erst und sagte dann so leise, dass der Bischof sie kaum verstand: „Exzellenz, ich möchte in Demut und Reue meine Sünden bekennen5. Aber ich weiß nicht, ob es überhaupt recht ist, dass ich hier bin. Ich habe schon unserem Gemeindepfarrer gebeichtet. Aber der war sehr streng mit mir. Ich habe mich drei Tage und drei Nächte geprüft und erkannt, dass ich nicht erfüllen kann, was er von mir gefordert hat. Jetzt weiß ich nicht mehr ein noch aus. Zweimal war ich in der Zeit ganz kurz davor, meinem Leben ein Ende zu setzen.“
„So danke dem Herrn, Angela, dass er dir einen Engel gesandt hat, dich zu bewahren. Ich sehe an deinen traurigen Augen, wie du dich quälst. Du handelst nicht leichtfertig. Es ist keine Sünde, in einer schweren Lage keinen Ausweg zu sehen. Erzähle! Gemeinsam werden wir dann einen Weg aus deiner Not finden.“
Seine ruhige, gütige Stimme hatte ihr die Angst genommen. Sie begann zu erzählen, zum ersten Mal ausführlich, von jener verhängnisvollen Nacht in Davos, von den Demütigungen, vom Verlust an Vertrauen.
„Was das Schlimmste ist“, fuhr sie dann fort. „Ich habe mit einem Mal den Glauben daran verloren, dass die Welt an sich gut ist, dass Böses überwunden werden kann. Und es kam noch schlimmer. Als mir mein Arzt sagte, in mir reift neues Leben heran, habe ich auch mein Vertrauen zu Gott verloren. Warum lässt Gott es zu, dass neues Leben aus einem Verbrechen entsteht? Aber darf ich diese Frage stellen? Oder ist das Hochmut, Exzellenz?“
„Natürlich darfst du so fragen. Es gibt keine Frage, die man nicht stellen darf. Ich bin fast siebzig Jahre alt, und im Beichtstuhl habe ich immer wieder diese Frage nach dem Warum gehört. Und als junger Mann habe auch ich sie in äußerster Verzweiflung selber gestellt. Ich war im Februar 1945 dabei, als Dresden im Feuersturm versank. Und unauslöschlich hat sich in meine Seele eingebrannt, wie dabei der Mensch, der mir damals der Liebste war, als lebende Fackel von mir weglief.“
„Aber wie können wir damit leben?“
„Angela, meine Tochter, ohne die Erlebnisse von 1945 säße ich nicht hier. Damals habe ich gelernt: Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir viele Fragen zwar stellen, aber nicht beantworten können. Das gilt vor allem für die Frage nach dem Warum. Erst wenn wir aufhören, diese Frage zu stellen, kann
unsere Fantasie uns Wege zeigen, die uns die Frage vergessen lassen.“
„Exzellenz, ich würde dem ja gern folgen. Aber meine Fantasie reicht nicht, mir für mich einen Ausweg vorzustellen.“
„Wir wissen doch beide: Nicht du hast gesündigt, sondern andere Menschen haben sich an dir versündigt. Statt dir eine Buße aufzuerlegen, lade ich dich ein, morgen früh noch einmal zu mir zu kommen. Wir werden gemeinsam einen Weg suchen und finden, der dich trotz allem glücklich leben lässt.“
Er erteilte ihr Absolution und benommen verließ Angela Ricardi den Beichtstuhl. Ganz langsam ging sie in das Mittelschiff und setzte sich in die letzte Bank. Sie wusste, dieser Tag würde einer der wichtigsten in ihrem Leben sein. Sie blieb sitzen, bis ein dienstbarer Geist sie bat, den Dom zu verlassen. Sie trat durch das Tor der Westfassade und blickte in das Rot der untergehenden Sonne.
2 – Aleppo, 29. September 2012
Plötzlich sahen sie die Feuerwalze durch den Gang direkt auf sich zukommen. Überall war Rauch. Menschen rannten in Todesangst an ihnen vorbei. Prasselnd verschlang das Feuer Stand um Stand.
„Wir müssen weg, sofort!“, schrie Radi al-Sibai. Aber Faruk, der Vater, zögerte.
„Nein, wir müssen unser Hab und Gut retten!“
Der Sohn ergriff ihn am Arm und versuchte, ihn fortzuzerren. Aber der Alte war trotz seiner siebzig Jahre stark genug, sich loszureißen. Den Sohn packte Todesangst.
„Komm, sonst ist es zu spät!“, beschwor er den Vater.
„Flieh du, ich muss das Erbe meiner Väter und Vatersväter zu bewahren suchen.“
„Hier ist nichts mehr zu bewahren. Hier wütet der Tod.
Komm!“
„Flieh! Einer muss für die Familie sorgen. Wenn ich fliehe, verbrennt hier meine Seele. Ich muss bleiben.“
„Vater, bitte, es hat keinen Sinn, komm!“
„Flieh, ich befehle es dir als Vater!“
Er sah in das zu allem entschlossene Gesicht des Vaters und wusste, dass er ihn nicht mehr umstimmen konnte. Die Feuerwalze kam immer näher.
„Vater, ich schwöre bei Allah und dem Propheten Mohammed, ich werde dich rächen.“
Er warf einen letzten Blick auf den Vater und den Stand, der auch einmal seine Existenz hätte sein sollen. Dann stürzte er sich in den Strom der panisch Fliehenden. Es war die Hölle. Der Gang war zu schmal, um alle Fliehenden aufnehmen zu können. Manche wurden zur Seite in die Stände hineingedrückt. Andere hatten versucht, mindestens einen Teil ihrer Habseligkeiten zu retten, und merkten erst jetzt, wie hinderlich das war. Sie ließen fallen, was sie trugen, und die Nachfolgenden stolperten über Teppiche, Kleidungsstücke, zersplittertes Porzellan, kamen zu Fall, wurden überrannt und hatten keine Chance mehr, wieder auf die Beine zu kommen. Kinder schrien verzweifelt nach ihren Müttern, die sie im Chaos verloren hatten. Aber niemand hörte sie. Viele wurden umgerannt und zertreten. Da sah er vor sich einen alten Mann, der versuchte, in einem kleinen Leiterwagen einige Flaschen erlesener Öle, die alles waren, was er besaß, vor den Flammen zu retten. Dadurch staute sich der Strom der Fliehenden. Wütend stieß ein junger Mann den Wagen mit einem heftigen Fußtritt zur Seite. Er fiel um und die Flaschen zerschlugen. Radi al-Sibai konnte noch das Entsetzen im Gesicht des Greises sehen. Dann wurde er im Strom weitergerissen, strauchelte mehrmals, konnte sich aber auf den Beinen halten. Endlich war das Antiochia-Tor erreicht und er war dem Inferno entkommen.
Der Strom der Fliehenden ergoss sich durch das Tor ins Freie. Plötzlich fielen Schüsse. Niemand wusste, woher sie kamen. Menschen brachen blutüberströmt zusammen. In äußerster Panik stob die Menge auseinander und die Fliehenden versuchten, in kleinen Gassen Schutz zu finden. Auch Radi alSibai rannte um sein Leben. Da spürte er einen glühenden, stechenden Schmerz in der rechten Schulter, sah Blut aus seinem Körper quellen, taumelte, versuchte, sich auf den Beinen zu halten, wurde von anderen gestoßen, und dann wurde es Nacht um ihn.
Es waren Stunden vergangen, als er langsam wieder zu sich kam und die Augen öffnete. Er fand sich in einem langen Gang auf einer dünnen Matratze am Boden liegend unter einer schmutzigen Wolldecke und spürte in seiner rechten Schulter einen bohrenden Schmerz. Er versuchte, den rechten Arm zu bewegen, ließ aber sofort davon ab, weil der Schmerz unerträglich war. Er sah sich um. Wo war er? Was war geschehen?
Allmählich kam die Erinnerung zurück, an das Feuer und an den Vater, der nicht fliehen wollte und der jetzt tot war. Er begriff, er war in einem Krankenhaus. In zwei langen Reihen lagen auf dem Gang viele von denen, die beim Inferno im Basar und dem nachfolgenden Beschuss durch Scharfschützen des Regimes verletzt worden waren, aber immerhin noch lebten. Reguläre Krankenhausbetten gab es schon lange keine mehr. Oft liefen Männer und Frauen hektisch durch den Gang. Sie taten hier wohl als Krankenpfleger Dienst. Aber sie kümmerten sich nicht um die Bitten der Patienten, denn es gab viel mehr Arbeit, als sie bewältigen konnten. Immer wieder wurden weitere Verletzte auf Bahren durch den Gang getragen, stöhnend, schreiend, von denen wohl viele dieses Haus nicht mehr lebend verlassen würden.
Es fröstelte ihn und er hatte furchtbaren Durst. Aber er musste froh sein, zu denen zu gehören, die schon wenigstens notdürftig versorgt waren. Manche schrien noch immer vergeblich vor Schmerzen um Hilfe. Und hin und wieder wurden welche aus den Reihen herausgeholt und weggetragen, wenn ein Pfleger bemerkt hatte, dass sie nicht mehr am Leben waren. Da war dieser fürchterliche Gestank von Schweiß, von Blut, Erbrochenem und Urin. Der nahm ihm die Luft zum Atmen. So dämmerte er erneut in einen leichten Schlaf hinüber, der aber
keine Erholung brachte, weil sich ihm sofort grauenhafte Traumbilder aufdrängten.
Als er wieder erwachte, sah er, dass neben ihm ein Mann lag, den er bisher noch nicht wahrgenommen hatte. Er musste ungefähr in seinem Alter sein, Mitte dreißig.
„Bruder, wer bist du?“, begann er ein Gespräch.
„Mohamed Domani.“
„Ich bin Radi al-Sibai. Was ist dir geschehen?“
„Meine Beine. Diese Assadschweine! Die Kugel eines Scharfschützen hat beide zerschlagen.“
„Warst du auch im Basar?“
„Ich habe dort Gewürze verkauft“, sagte Mohamed Domani tonlos. Das Sprechen schien ihn anzustrengen. „Meine beiden Söhne haben mir geholfen. Dann kam das Feuer. Im Chaos der Flucht habe ich sie verloren.“ Er schwieg. Nach einer Weile setzte er fort: „Wahrscheinlich sind sie tot.“
„Mein Vater ist verbrannt.“
Für lange Minuten sagten sie kein Wort. Dann begann Radi al-Sibai wieder: „Wir müssen unsere Toten rächen.“
„Natürlich!“, setzte Mohamed Domani mit Emphase fort.
„Wenn ich wieder gesund werde, gehe ich zu unseren kämpfenden Brüdern.“
Aber Radi al-Sibai konnte seinen Enthusiasmus nicht teilen:
„Das wird nichts nützen. Die Assadleute haben bessere Waffen.“
„Wenn schon!“, redete sich Mohamed Domani jetzt in Begeisterung. „Wir werden sie dennoch vernichten. Und wenn wir fallen, sterben wir als Märtyrer und gelangen direkt ins Paradies. Hast du etwa Angst zu kämpfen?“
„Nein, aber ich will nicht nur kämpfen, ich will auch siegen.“
„Alle wollen siegen.“
„Aber um zu siegen, brauchen wir die richtigen Waffen.“
„Und woher bekommen wir die?“
„Hör zu! Ich habe vier Jahre in Deutschland studiert, da …“
„Bleib mir mit den westlichen Hurensöhnen vom Hals, die haben uns eh verraten!“, unterbrach ihn Mohamed Domani in tiefer Verachtung.
„Ich hasse sie auch, weil sie den Propheten beleidigen. Aber wir können die benutzen und von denen bekommen, was wir brauchen, um zu siegen.“
„Und das wäre?“
„Ich habe in Deutschland Informatik studiert, …“
„Was ist das?“
„Die Technik, Computer zu bauen, Maschinen, die alles machen, was du willst.“
„Willst du Assad mit Computern besiegen?“ lachte Mohamed Domani den anderen aus.
„Ja, genau.“
„Das ist doch lächerlich!“
„Nein, lass es dir erklären: In einer organisierten Armee wie der von Assad läuft vieles über Computer, vor allem die gesamte Kommunikation: Befehle, Auswahl der Angriffsziele, Erfassung der Standorte des Feindes und so weiter. Alle ihre Computer sind miteinander in einem Netz verbunden. Wenn es uns gelingt, mit unseren Computern in dieses Netz einzudringen, können wir sie völlig verwirren. Wenn in dem Moment unsere Brüder an den Waffen massiv losschlagen, können wir Assad besiegen.“
Mohamed Domani schwieg eine Weile, dann meinte er eher skeptisch: „Ich verstehe das zwar nicht, aber es klingt gut. Du kannst solche Computer bauen?“
„Nein, dazu ist ein Mensch alleine nicht in der Lage. Aber ich habe Kontakte nach Deutschland zu einer Firma, die uns sowas bauen kann.“
„Dann sollen die das machen.“
„So einfach ist das nicht. Wir brauchen dazu Geld, viel Geld.“
„Und woher soll das kommen?“
„Vielleicht von unseren Brüdern in Saudi-Arabien? Auch die hassen Assad. Hör zu: Um ein solches Projekt zu verwirklichen, brauchen wir eine Gruppe von Kämpfern, die das organisieren und schweigen können. Willst du mir helfen?“
„Wenn wir Assad dadurch besiegen können, will ich es.“
3 – Dezember 2012
Konstantin Lerner saß in der allerletzten Reihe des Hörsaals II im Psychologischen Seminar der Uni Heidelberg und lauschte der Vorlesung von Professor Dr. Detlev Hager zu den biologischen Grundlagen der menschlichen Persönlichkeit. Es war nicht leicht, seinen Ausführungen zu folgen, denn der Herr Professor vermittelte nicht den Eindruck, dass ihn sein Thema und auch die Studierenden sonderlich interessierten. Er las eher monoton, blieb sehr im Abstrakten und gab sich keine Mühe, die Darstellungen durch Beispiele aus der Praxis lebendig werden zu lassen.
In der ersten halben Stunde versuchte Konstantin noch, Professor Hagers Vortrag in Stichpunkten mitzuschreiben. Dann aber wurden die Aufzeichnungen immer lückenhafter, bis seine Gedanken völlig abschweiften und er vom Inhalt der Vorlesung gar nichts mehr mitbekam.
Er war wieder bei der Frage, die ihn schon seit geraumer Zeit mehr und mehr beschäftigte: Wer bin ich eigentlich?
Vor einigen Tagen war ihm ganz plötzlich klargeworden, dass er sein Studienfach eigentlich nur gewählt hatte, um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Aber in seinem Fall war klar, dass das nicht möglich war.
Wenn er sich an seine Kindheit erinnerte, so kamen widersprüchliche Gefühle in ihm hoch. Er war in Weinheim* aufgewachsen, einer kleinen Stadt, 18 km nördlich von Heidelberg an der Bergstraße* gelegen, die als besondere Sehenswürdigkeiten gleich ein Schloss und zwei Burgen zu bieten hat. Sein Vater war ein Augenarzt mit gutgehender Praxis, also wohlhabend. Sie wohnten am Berghang in einer hundert Jahre alten Villa mit einem großen Garten. Seine Eltern, vor allem die Mutter, waren immer da, wenn er sie brauchte. Und schon nach seinem ersten Jahr im Kindergarten durfte er oft seine Spielkameraden einla-den, hatten sie doch diesen wunderbaren großen, teils verwilderten Garten, der zu Abenteuerspielen aller Art einlud.
Aber, so erinnerte er sich, schon seit sehr früher Zeit hatte er das Gefühl gehabt, irgendetwas stimme nicht mit ihm, sei falsch an all dem Schönen, was er hatte. Oft spürte er scheinbar grundlose Angst. Wenn er nur kurz allein war, glaubte er schnell, er würde jetzt für immer allein bleiben müssen. Wenn er über eine Brücke ging, stellte er sich vor, sie würde gleich unter ihm einstürzen, und rannte dann so schnell wie möglich hinüber. Wenn er selbst oder jemand, der ihm nahe stand, krank wurde, fürchtete er, er würde niemals wieder gesund werden, sondern an der Krankheit sterben. Wenn dann seine Eltern versuchten, ihn zu beruhigen, und ihm erklärten, wie unbegründet seine Ängste doch wären, so half das nichts. Im Gegenteil. Er wurde tieftraurig, und manchmal wurde er auch einfach nur wütend und zerschlug Spielsachen, hin und wieder sogar Mutters edles Geschirr.
Auch konnte er schon sehr früh beobachten, wie seine Eltern oft leise miteinander sprachen, wenn er in dieser Weise reagierte. Er war sich dann sicher, dass sie über ihn sprachen und dass es etwas Schlimmes war, was sie da zu bereden hatten.
Besonders intensiv war ihm in Erinnerung, wie sein Opa starb, kurz nach seinem zwölften Geburtstag. Er hatte ihn sehr lieb gehabt und war daher unendlich traurig, ja geradezu verstört. Um ihn zu trösten, hatte man ihm erzählt, dass der Opa jetzt beim lieben Gott im Himmel wäre und dass es ihm dort gutginge und man deshalb nicht traurig sein müsse. Dann hatte er einige Tage nach der Beerdigung seinen Vater ganz plötzlich gefragt: „Man kommt in den Himmel, wenn man gestorben ist. Aber woher kommt man dann, wenn man geboren wird?“
Er bemerkte, dass sein Vater über diese Frage furchtbar erschrak und ihr auswich. Zum ersten Mal hatte er sich hier mit einer Frage allein gelassen gefühlt. Und am Abend des gleichen Tages bekam er dann auch noch zufällig einen Gesprächsfetzen mit, als sein Vater zur Mutter sagte: „Ich glaube, wir werden es ihm bald sagen müssen.“
Was werden sie mir bald sagen müssen, hatte er gedacht, aber sich nicht mehr getraut weiterzufragen.
So ging es weiter bis zu seinem sechzehnten Geburtstag. Da nahm ihn am Nachmittag nach dem familiären Kaffeetrinken sein Vater beiseite und sagte: „Konstantin, du bist jetzt sechzehn Jahre alt und es wird Zeit, dass du etwas Wichtiges über dich erfährst. Deine Mutter und ich, wir haben dich aufgezogen als unser Kind, aber Mama hat dich nicht geboren. Wir haben dich adoptiert, als du acht Wochen alt warst.“
Es hatte ihn getroffen wie ein Hammerschlag. Nach langem Schweigen hatte er gefragt: „Und wer sind meine richtigen Eltern?“
„Deine richtigen Eltern, das sind wir, Mama und ich. Du fragst nach deinen leiblichen Eltern. Und da gebe ich dir mein väterliches Ehrenwort: Wer das ist, das weiß ich selber nicht. Als wir dich damals adoptiert haben, hat man uns gesagt: Es sei für dich und deine leiblichen Eltern besser, wenn du das nie erfährst. Mama und ich haben lange überlegt, ob wir uns darauf einlassen sollten. Aber es ist nicht leicht hierzulande, ein Kind zu adoptieren. Wir hatten schon so viele Jahre gewartet. Und deshalb haben wir uns darauf eingelassen. Vielleicht hätten wir es nicht tun sollen. Aber jetzt ist es eben so.“
Durch diese Nachricht wurde Konstantin völlig aus der Bahn geworfen. Er sprach kaum noch ein Wort mit seinen Eltern. Vorher ein guter Schüler, brach er nun in allen Fächern ein. Zeitweise rutschte er in die Rauschgiftszene ab, fing sich aber nach einer Entziehungskur wieder. Doch das Verhältnis zu seinen Eltern blieb unwiderruflich zerstört.
Und nun saß er im Hörsaal II des Psychologischen Seminars und die Vorlesung über die biologischen Grundlagen der menschlichen Persönlichkeit neigte sich ihrem Ende zu. Da fasste er einen Entschluss. Er musste endlich aufhören nur zu grübeln. Damit konnte er nicht weiterkommen. Er musste handeln. Auch wenn es dreiundzwanzig Jahre her war, musste es doch noch irgendwo Unterlagen geben, aus denen hervorging, wer seine richtigen Eltern waren.
Also entwarf er einen Plan. Er wusste, dass seine Adoption damals über das Jugendamt in Weinheim gelaufen war. Da wollte er zuerst hingehen. Wenn er dort nicht weiterkäme, könnte er einen Privatdetektiv beauftragen, das Geheimnis seiner Geburt zu lüften. Da hörte er das Klopfen seiner Kommilitonen. Die Vorlesung war zu Ende.
Jetzt kein Zögern mehr, dachte er. Weitere Lehrveranstaltungen an diesem Tag mussten eben ausfallen. Er warf sich seine Umhängetasche über die Schulter und verließ das altertümliche, lange als Schule genutzte Gebäude. Zwischen den großen, kahlen Bäumen des Innenhofs hindurch gelangte er auf die Brunnengasse, wo er nach wenigen Metern in die Hauptstraße einbog. Ohne einen Blick für die weihnachtlich dekorierten Schaufenster ging er weiter und stieg bald darauf am Bismarckplatz in die Linie 6 nach Weinheim ein.
Es überkam ihn plötzlich ein immenses Aufbruchsgefühl. Alle Hemmungen und Ängste, die ihn bisher verfolgt und behindert hatten, würden endlich verschwinden, wenn er erst einmal klar sehen konnte, wer er wirklich war und woher er kam. Dass er bei seinen Nachforschungen auf schlimme Dinge stoßen könnte, diesen Gedanken ließ er jetzt nicht zu.
In Weinheim angekommen, ging er mit schnellen Schritten vorbei am heruntergekommenen, schon lange geschlossenen alten Bahnhofsgebäude, über die Kopernikusstraße aufwärts zum neugotischen Schloss, wo die Stadtverwaltung ihren Hauptsitz hatte. Dort sagte man ihm, das Jugendamt sei schon lange zusammen mit anderen Dienststellen in einen neuen Gebäudekomplex in der Dürrestraße umgezogen. Über die Grabengasse und Institutsstraße erreichte er die Fußgängerzone in der Hauptstraße, die bald die Dürrestraße kreuzt. Dort stand rechter Hand das gesuchte Gebäude, und im ersten Stock fand er nach längerem Suchen die Dienststelle, die für Adoptionen zuständig war. Er klopfte und wurde nach kurzem Warten hereingebeten.
In einem kleinen und völlig schmucklosen Büro saß hinter einem klobigen Schreibtisch, auf dem sich Aktenberge türmten, eine Frau, die etwa fünfzig Jahre alt sein mochte. Ihre Bewegungen waren hektisch und ihr fleischiges Gesicht war unnatürlich rot angelaufen. Sie schien völlig überarbeitet zu sein. Ohne von ihrem Monitor aufzublicken, sprach sie Konstantin Lerner mit einer Stimme an, die verriet, wie ungelegen ihr diese Störung kam: „Herzog mein Name, was kann ich für Sie tun?“
Obwohl vor dem Schreibtisch zwei Stühle standen, bot sie ihm keinen Sitzplatz an. Konstantin Lerner setzte sich trotzdem und begann zu reden: „Ich bin Konstantin Lerner und wohne hier in Weinheim. Ich habe folgendes Anliegen. Ich wurde im Alter von acht Wochen adoptiert und meine Zieheltern versichern mir, dass sie selbst keine Ahnung haben, wer meine leiblichen Eltern sind. Es sei damals für die Adoption Bedingung gewesen, dass meine tatsächliche Herkunft für immer unbekannt bleibt. Das kann ich aber nicht akzeptieren. Ich will wissen, wer ich eigentlich bin.“
„Bitte noch einmal Ihren Namen und auch das Geburtsdatum“, antwortete Frau Herzog trocken.
„Konstantin Lerner, 20. November 1990.“
„Einen Moment bitte, ich muss prüfen, ob mir der Computer etwas anzeigt.“
Mit schnellen Fingern gab sie seine Daten ein. Nach kurzer Zeit schien sie etwas gefunden zu haben. Sie stutzte, sah noch zweimal genau hin und sagte dann etwas zögernd und befangen:
„Herr Lerner, ich muss Sie da leider enttäuschen, der Vorgang ist zu lange her. Wir haben darüber keine Unterlagen mehr.“
„Könnte es über den Vorgang noch irgendwo anders Unterlagen geben?“
„Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.“
„Das bedeutet also, ich habe keine Möglichkeit mehr, etwas über meine Herkunft zu erfahren?“
„Ich fürchte, ja.“
„Das kann doch gar nicht sein! In diesem Land wird doch sonst jeder Mist Jahrzehnte lang aufgehoben. Und Sie sind sich sicher, dass Sie mir tatsächlich keine Auskunft geben können und nicht etwa nicht wollen oder dürfen?“
„Ich verbitte mir solche Unterstellungen, ich kann nichts für Sie tun. Damit ist dieses Gespräch beendet. Wie Sie sehen, habe ich viel zu tun. Guten Tag.“
Sie deutete auf die vielen Akten und wandte sich wieder ihrem Computer zu. Konstantin Lerner stand noch einige Augenblicke verdutzt im Raum, bevor er sich umwandte und die Tür recht lautstark hinter sich schloss.
Etwas benommen ging er den langen Gang zum Treppenhaus zurück. Er ließ das Zusammentreffen mit Frau Herzog noch einmal Revue passieren. Warum zögerte sie mit der Antwort, nachdem sie seinen Namen in den PC eingegeben hatte? Und warum reagierte sie so völlig überzogen auf seine letzte Frage? Er war sich sicher, dass sie ihm nicht die Wahrheit gesagt hatte. Aber was sollte er jetzt tun? Wie konnte er sonst noch an Informationen kommen? Da erinnerte er sich, dass es irgendwo ein Stadtarchiv geben musste. Er rief über sein Handy die Stadtverwaltung an und man sagte ihm, es läge in der Schulstraße, in dem gleichen Bau wie die Pestalozzi Grundschule.
Es war nur ein kurzer Weg bis dorthin. Aber der Eingang war nicht leicht zu finden, da er versteckt hinter der Schule lag. Als er eintrat, merkte er gleich, dass sich kaum jemand für diese Institution zu interessieren schien. Denn abgesehen von einem Aufsichtsbeamten, der in sein Kreuzworträtsel vertieft war, schien der Raum menschenleer zu sein.
Konstantin Lerner beschloss, hier eine andere Strategie zu steuern als im Jugendamt. Er trat zu dem Aufsichtsbeamten und sprach ihn an: „Guten Tag, Wilfried Fichte mein Name. Ich bin Journalist und recherchiere zurzeit an einer Story über Adoption. Dabei bin ich auf einen interessanten und wohl nicht ganz unkomplizierten Fall gestoßen, der hier in Weinheim gelaufen sein muss. Das ist aber schon eine Weile her, deswegen komme ich zu Ihnen. Es handelt sich um einen gewissen Konstantin Lerner. Die Adoption muss so Ende 1990, Anfang 1991 gewesen sein. Könnte es sein, dass es hier darüber etwas gibt? Ich war schon beim Jugendamt und die haben mich zu Ihnen geschickt.“
„Hmm“, brummte der Beamte und legte etwas unwillig das Kreuzworträtsel beiseite. „Wir haben hier schon solche Sachen. Ist nicht ganz einfach zu finden, wenn es so lange her ist. Ich werde mal meinen Computer befragen, der weiß eigentlich alles. Wie war noch der Name?“
„Lerner, Konstantin Lerner.“
„Und wann, sagten Sie, war der Vorgang?“
„Irgendwann Ende 1990 oder Anfang 1991.“
Der Beamte gab die Daten nur mit dem Zeigefinger der rechten Hand ganz bedächtig in seinen Computer ein. Es dauerte eine geraume Zeit, dann blickte er auf, sah sein Gegenüber eine Weile an und meinte dann: „Wir haben hier tatsächlich eine Akte Lerner, die aus dieser Zeit stammt. Allerdings sehe ich gerade, sie hat einen Sperrvermerk.“
„Und das bedeutet?“
„Dass ohne besondere Genehmigung niemand hier Einsicht nehmen darf.“
„Und wie kann man eine solche besondere Genehmigung bekommen?“
Der Beamte musste sich eine Weile besinnen, da ein solcher Fall schon lange nicht mehr vorgekommen war. Dann hellte sich sein Gesicht auf und er sagte: „Warten Sie einen Moment, jetzt erinnere ich mich, wo die Antragsformulare liegen.“
Er erhob sich, trat an einen Aktenschrank hinter seinem Schreibtisch, öffnete ihn umständlich, suchte eine Weile und kam dann mit einem Blatt Papier zurück.
„Also, hier wäre das Formular. Aber ich sage Ihnen gleich, Sie müssen sehr triftige Gründe angeben, wenn Ihr Antrag positiv beschieden werden soll.“
„An wen ist denn der Antrag zu richten und wie lange wird es dauern, bis das entschieden wird?“
„Also, in diesem Fall wird der Antrag an das Jugendamt zu stellen sein. Und wie lange das dauert? O je, Gottes Mühlen und die der Weinheimer Stadtverwaltung mahlen langsam. So mit sechs bis acht Wochen werden Sie da sicher rechnen müssen.“
„Das dauert mir viel zu lange. In dieser Zeit muss die Story schon längst veröffentlicht sein. Gibt es keinen anderen Weg als den Dienstweg?“
„Natürlich nicht!“, antwortete der Beamte entrüstet.
„Nun“, fuhr Konstantin Lerner mit hintersinnigem Lächeln fort. „Ich nehme an, dass dieser Job sicher nicht gerade fürstlich bezahlt wird. Wann haben Sie hier Feierabend?“
„Um 18 Uhr“, antwortete der Beamte etwas verwirrt. Er konnte sich nicht vorstellen, worauf sein Besucher hinaus wollte. Der griff in seine Hosentasche, holte einen Fünfzigeuroschein heraus und legte ihn auf den Schreibtisch. „Sehen Sie, dieses Scheinchen schenke ich Ihnen, einfach so, und nach Ihrem Dienstschluss werde ich in der Bahnhofstraße in der Pizzeria Milano zu Abend essen. Und wenn Sie da vorbeikommen und mir die Akte mitbringen, dann hab ich noch ein-
mal fünf solche Scheinchen für Sie. Ich geh dann jetzt.“
„Aber das ist doch …!“
„Regen Sie sich nicht auf. Spätestens übermorgen bringe ich Ihnen die Akte zurück und alles ist wieder in bester Ordnung. Wenn jetzt jemand diese Akte sehen will, muss er doch, wie Sie mir sagten, einen Antrag stellen, und es dauert mindestens sechs Wochen, bis der bearbeitet ist. Es kann also gar nichts passieren. Aber damit es Ihnen leichter fällt, bekommen Sie heute Abend noch neun solche Scheinchen. Ich will nicht knickerig sein. Also, bis dann.“
Er drehte sich um und verließ schnell den Raum, den Beamten in Gewissensqualen zurücklassend. Konstantin Lerner hatte jetzt keine Lust, nach Hause zu gehen. Er suchte die Stadtbücherei auf, stöberte eine Weile in diversen Büchern und fand dann in der Fußgängerzone ein Kino, dass zu einer für ihn günstigen Zeit Vorstellung hatte.
Kurz vor 18 Uhr war er in besagter Pizzeria, bestellte ein Bier und wartete gespannt. Und tatsächlich: Bereits wenige Minuten nach sechs kam der Beamte aus dem Archiv, etwas gebückt mit hochgezogenen Schultern und mit einer dünnen Aktenmappe unterm Arm. Er sah sich mehrfach um, ob ihn
nicht doch jemand beobachtet hatte und ihm gefolgt war. Er setzte sich zu Konstantin Lerner an den Tisch.
„Wollen Sie auch ein Bier?“, fragte er den Beamten.
„Also … eigentlich …“
„Herr Ober, bitte noch ein Bier für den Herrn.“
Die beiden saßen sich schweigend gegenüber, bis der Ober das Bier brachte.
„Na, dann prost!“, sagte Konstantin Lerner, hob sein Glas, und dem Beamten blieb nichts anderes übrig, als mit ihm anzustoßen. Danach wieder Schweigen. Schließlich griff Konstantin in seine Tasche und holte einen Umschlag hervor.
„Lassen Sie uns tauschen“, meinte er und sah den Beamten erwartungsvoll an. Dieser legte zögernd die Aktenmappe auf den Tisch, ergriff den Umschlag, blickte hinein und konnte sich überzeugen, dass tatsächlich neun Fünfzigeuroscheine drin waren. Sein Gegenüber öffnete die Aktenmappe ein wenig, nickte kurz, als er seinen Namen las, und steckte sie in seine Tasche.
„Also dann, spätestens in drei Tagen haben Sie die Akte wieder“, sagte Konstantin Lerner, der nicht wissen konnte, dass sie nie wieder an ihren Platz im Archiv zurückkommen sollte.
„Dann geh ich jetzt besser“, meinte der Beamte flüsternd, nahm noch einen großen Schluck Bier und verschwand, ohne sich richtig zu verabschieden. Konstantin Lerner blieb eine Weile ruhig sitzen. Aber dann hielt er es nicht länger aus, nahm die Akte aus seiner Tasche und las.
Bereits nach wenigen Augenblicken ließ er die Papiere völlig entgeistert sinken. Jetzt verstehe ich, warum ich das nie erfahren sollte, dachte er. Ich hätte die Finger davon lassen sollen. Aber jetzt ist es zu spät.
Er erhob sich, trat mit zitternden Knien an die Theke und bezahlte seine Rechnung. Langsam verließ er das Lokal. Draußen schlug ihm die kalte Dezemberluft entgegen. Es hatte angefangen zu schneien. Unschlüssig stand er vor dem Lokal. Er wusste nicht, wo er jetzt hingehen sollte. Nach Hause wollte er auf keinen Fall. Aber eines wusste er ganz sicher: Es würde in Zukunft nichts mehr so sein wie bisher.
4 – Februar 2013
Es war ein nasskalter Tag. Yvonne Dehler war gegen sieben aus dem Büro nach Hause gekommen und hatte im Wohnzimmer ihrer luxuriösen Villa den Kachelofen angeheizt, der jetzt eine behagliche Wärme verströmte. Nachdem sie eine Tiefkühl-Lasagne in den Backofen geschoben hatte, ließ sie sich in die weichen Kissen ihrer rosaroten Wohnzimmercouch fallen und kraulte geistesabwesend die Nackenhaare ihres schwarzen Neufundländers, der groß und faul vor ihr auf dem glänzenden Parkettfußboden lag.
Thomas hatte sie nach Hause geschickt. Er müsste noch mit Mario, ihrem Chefprogrammierer, ein rein technisches Problem lösen. Das könnte ziemlich lange dauern. Sie sollte nicht auf ihn warten.
Yvonne war sauer. Irgendetwas stimmte nicht mit Thomas, ihrem Mann. Sie fühlte schon seit Tagen, dass er etwas vor ihr verheimlichte. Immer wieder besprach er sich heimlich mit Mario. Die heckten sicher etwas aus, das sie nicht erfahren sollte. Das hatte es noch nie gegeben, seitdem sie Geschäftsführerin ihres kleinen, aber hochprofitablen Softwareunternehmens war. Das durfte einfach nicht sein. Sie beschloss, wach zu bleiben, bis ihr Mann nach Hause käme, und ihn dann zur Rede zu stellen, ganz gleich, wie lange das dauern würde.
Nach dem Essen hatte sie nach einem Bildband über La Palma gegriffen, wo sie bald Urlaub machen wollten. Später schaltete sie den Fernseher ein, zappte eher lustlos durch verschiedene Programme und kochte, als Mitternacht längst vorüber war, noch einen starken Kaffee, um nicht doch auf der Wohnzimmercouch einzuschlafen.
Es war schon lange nach drei, als ihr Mann endlich nach Hause kam. Er war überrascht, dass im Wohnzimmer noch Licht brannte, versuchte aber trotzdem, so leise wie möglich zu sein, weil er dachte, seine Frau hätte einfach nur vergessen, es zu löschen. Er erschrak heftig, als sie plötzlich vor ihm in der
Tür stand und ihn aggressiv ansprach: „Da bist du ja endlich, ich dachte schon, du wolltest in der Firma übernachten!“
„Was ist los, warum schläfst du noch nicht?“, antwortete er überrascht und verärgert über diesen unfreundlichen Empfang.
„Ich kann einfach nicht schlafen. Ich weiß, du verheimlichst mir etwas. Und das kann ich überhaupt nicht vertragen.“
„Was sollte das denn sein?“, versuchte er sie zu beruhigen.
„Da ist nichts. Das bildest du dir nur ein.“
„Thomas, ich kenne dich seit über fünfundzwanzig Jahren. Du kannst mir nichts vormachen. Warst du überhaupt in der Firma oder hast du eine Andere?“
Ach, daher weht der Wind!, dachte er. „Mit einer anderen Frau hat das sicher nichts zu tun.“
„Mit was dann? Rede endlich!“
Wieder zögerte er eine Weile und sagte schließlich: „Also gut, du hast recht. Da ist schon etwas, wovon ich dir bis jetzt noch nichts gesagt habe. Lass uns ins Wohnzimmer gehen.“
Yvonne setzte sich auf die Couch. Thomas öffnete die Hausbar, griff nach einer teuren Flasche Beaujolais und stellte zwei Gläser auf den Tisch.
„Es war gerade sehr anstrengend. Ich brauch jetzt unbedingt was zu trinken.“
Umständlich entkorkte er die Flasche, goss ein und reichte ihr eins von den Gläsern. Dann setzte er sich in seinen schweinsledernen Relaxsessel ihr gegenüber und prostete ihr aufmunternd zu.
„Soll das eine Wiedergutmachung werden?“, fragte sie schnippisch.
„Da ist nichts wieder gut zu machen. Also: Du weißt, dass wir schon öfters Aufträge hatten, die sich am Rande der Legalität bewegten. Und jetzt können wir einen Auftrag an Land ziehen, der da einen Schritt weitergeht, dafür aber sehr, sehr viel Geld einbringt.“
„Also etwas Kriminelles? Vergiss es! Nicht mit mir.“
Diese Reaktion hatte er befürchtet. Jetzt musste er sehr diplomatisch vorgehen, um ihr Einverständnis zu erlangen.
„Hör dir erst mal an, worum es geht. Du weißt doch, was zurzeit in Syrien los ist. In dem Krieg sind die Rebellen sehr viel schlechter bewaffnet als Assads Armee. Jetzt will eine Widerstandsgruppe von uns eine Software haben, mit der sie die komplette militärische, aber auch zivile Infrastruktur des Landes lahmlegen kann.“
„Also direkte Einmischung in einen laufenden Krieg? Du bist verrückt! Das ist zu heiß, das ist einfach eine Nummer zu groß für uns, und außerdem, wenn du mich fragst, moralisch überhaupt nicht zu vertreten.“
„Also, was das Moralische angeht, da habe ich etwas für dich. Warte einen Moment.“
Er sprang auf, eilte nach nebenan in sein Arbeitszimmer und kam mit einem großen Briefumschlag zurück.
„Sieh dir das an!“, sagte er erregt und drückte ihr den Umschlag in die Hand. „Danach wirst du sicher nicht mehr von
‚moralisch nicht vertretbar‘ sprechen.“
„Was ist das?“, fragte sie verwundert.
„Die Folgen von Assads Kriegführung gegen das eigene Volk. Sieh es dir an! Aber ich warne dich. Es ist schwerverdauliche Kost. Für mich bedeuten diese Bilder: Es ist unmoralisch, nichts zu tun.“
Sie öffnete den Umschlag und sah sich nacheinander die Bilder an. Ihr Gesicht wurde immer bleicher und ihre Hände fingen an zu zittern. Die Bilder hatten wenig gemein mit dem, was man hier in der Tagesschau zu sehen bekommt, wo nur gezeigt wird, was zumutbar erscheint. Als sie den Stapel durchgesehen hatte, ließ sie langsam die Hände sinken und sagte: „Du hast recht. Da muss man etwas tun. Was ist das Problem?“
„Wenn wir liefern, ist das ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Aber vor unserer Justiz habe ich weniger Angst. Richtig gefährlich kann es werden, wenn von dem Projekt die falschen Leute erfahren.“
„Welche falschen Leute?“
„Zum Beispiel der syrische Geheimdienst.“
1Am Volksaltar, der sich noch vor der Vierung auf der Ebene des Langhauses befindet, werden die gewöhnlichen Messen zelebriert. Der wesentlich höher liegende Hauptaltar – das eigentliche Zentrum des Doms – wird nur an hohen Feiertagen und bei besonderen Anlässen genutzt.
2 Die Hauptorgel an der Rückwand des Langhauses wurde 2010/2011 von der Firma Seifert neu gebaut. Sie hat 87 Register, verteilt auf vier Manuale und Pedal.
3 Einst bildete der Ölberg den Mittelpunkt des Kreuzganges, der sich über den Platz südlich des Domes erstreckte. Nach den Zerstörungen im Pfälzischen Erbfolgekrieg blieb nur dieses kleine Gebäude zurück. Dargestellt ist eine Szene aus dem Neuen Testament: Jesus betet vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane. Die in den Jahren 1505 – 1512 geschaffenen Figuren wurden im Laufe der Zeit immer mehr beschädigt, so dass sie Mitte des 19. Jahrhunderts durch romantische Neuschöpfungen ersetzt werden mussten.
4 Psalm 37,5
5 Text folgt der Beichtliturgie.
Freitag, 31. Mai 2013
1
Es war ein warmer sonniger Frühsommertag, als gegen zwei Uhr nachmittags ein schwarzer BMW hinter Heidelberg-Ziegelhausen* kurz vor dem Eingang zum Bärenbachtal hielt. Zwei Frauen stiegen aus. Von weitem hätte man sie für Schwestern halten können. Sie mochten um die fünfzig Jahre alt sein, waren von ähnlich großer und schlanker Gestalt und hatten beide schwarze, halblange Haare. Aber wenn man ihnen ins Gesicht sah, war es vorbei mit der Ähnlichkeit. Die Frau, die den Wagen gesteuert hatte, blickte aus tiefliegenden, hellblauen, traurigen Augen scheu wie ein Reh in die Welt. Ihr dünnlippiger Mund war zusammengekniffen und der Ausdruck ihres schönen, ovalen Gesichts verriet deutlich, wie skeptisch sie der Welt gegenüberstand.
Ganz anders ihre Begleiterin. Ihr rundes Gesicht mit einer zierlichen Stupsnase hatte etwas Spitzbübisches. Der fordernde Blick ihrer grünen Augen und die dicken, stets zum Lächeln geöffneten Lippen verrieten, wie sehr sie das Leben genießen konnte. Sie war gewohnt, sich zu nehmen, was sie haben wollte, und war mit sich und der Welt im Reinen.
Die beiden Frauen gingen langsam schweigend nebeneinander her. Der Weg führte sie zunächst schwach ansteigend parallel zum Neckar, ehe er in das schattige, dicht mit Laubwald bestandene Tal einbog. Man hörte das ruhige Plätschern des Bärenbaches. Nach ungefähr zehn Minuten überquerten sie auf einer Naturbrücke den Bach und der Wald lichtete sich und machte zum Talgrund hinunter einer Wiese Platz. Nur noch der Uferbereich war mit Bäumen bestanden. Da brach die Stupsnasige das Schweigen.
„Es war schon schlimm, Angela, was wir damals mit dir gemacht haben. Ich weiß eigentlich auch nicht, wie es geschehen konnte. Aber wir waren damals alle in einer so aufgekratzten Stimmung.“
„Wie war es eigentlich hinterher, Britta?“, fragte Angela zurück. Sie wollte gelassen klingen, was ihr aber nicht wirklich gelang. „Gab es so etwas wie Reue oder Schuldgefühle?“
„Bei mir und Martin sicher schon. Bei den anderen? Weiß ich nicht genau. Erschrocken sind wir alle, als du dann plötzlich spurlos verschwunden warst. Da hatten wir schon Angst, du könntest dir etwas angetan haben. Wo warst du da eigentlich?“
Angela blieb eine Weile stumm. Sie sah oft verstohlen nach links und rechts, als ob sie heimlich etwas suchte. Dann antwortete sie mit leiser, zögerlicher, sehr angespannter Stimme:
„Ihr habt wohl nie begriffen, was damals tatsächlich passiert ist. Diese Nacht hatte Folgen.“
„Was meinst du damit, was für Folgen?“
„Ich wurde schwanger.“
„O Gott!“, entgegnete Britta erschrocken, „jetzt wird mir einiges klarer. Du hast doch dann abgetrieben?!“
Jetzt konnte sich Angela nicht mehr beherrschen und fuhr Britta aggressiv an: „Wie kannst du das nur fragen! Ich bin katholisch, überzeugt katholisch. Da kam eine Abtreibung für mich überhaupt nicht in Frage. … Ich war damals völlig verzweifelt und stand mehrmals am Turm der Heiliggeistkirche und wollte springen. Aber die Angst war stärker. Und daran seid allein ihr schuld!“
Schweigend gingen sie weiter. Britta hatte den Kopf gesenkt und wusste nicht recht, was sie sagen sollte. Sie fragte dann leise: „Aber irgendwie ist es doch weitergegangen?“
Angela versuchte, ihre Selbstbeherrschung wieder zu finden, und begann nach einer gewissen Zeit doch recht gelassen zu erzählen: „Einmal hatte ich dann großes Glück. Ich offenbarte mich einem Geistlichen, der meine Not erkannte und mir tatsächlich half und nicht nur moralisch daherredete. Er zog
mich zunächst gewissermaßen aus dem Verkehr, brachte mich in einem Kloster unter, hier im Kloster Neuenfels. Dort konnte ich während meiner Schwangerschaft bleiben und dann auch das Kind zur Welt bringen, ohne jemandem etwas erklären zu müssen. Er sorgte dann dafür, dass das Kind sofort adoptiert wurde, von, wie er sagte, wirklich guten Eltern. Und – das war für mich das Wichtigste – er sicherte mir zu, dass es nie erfahren sollte, unter welchen Umständen es gezeugt wurde.“
Was für eine verrückte Geschichte, dachte Britta, wie konnte so etwas gutgehen? Jetzt erst, nach dreiundzwanzig Jahren, wurde ihr klar, was sie damals in Davos wegen einer blödsinnigen Wette angerichtet hatten.
„Und wie hast du das alles verkraftet?“, fragte sie schuldbewusst.
„Eigentlich gar nicht“, antwortete Angela in schneidendem Ton, denn sie konnte ihre Wut nicht mehr unterdrücken. „So etwas kann man nicht verkraften. Darüber kann man nicht zur Tagesordnung übergehen.“
„Aber du hast doch irgendwie weitergelebt.“
„Ja, sicher, irgendwie. Ich habe mich in den Beruf gestürzt, mit übertriebenem Engagement. Je anstrengender es war, umso besser. Ich wollte keine Zeit haben, um über mich nachzudenken. Und dann hatte ich noch einmal großes Glück. … Ich war mir eigentlich sicher gewesen, dass ich nie mehr mit einem Mann zusammen sein könnte. Aber dann, fünf Jahre nach Davos, traf ich jemanden, mit dem es doch ging. Wir heirateten und bekamen zwei liebe Kinder. Die Vergangenheit schien endlich wirklich abgeschlossen zu sein. Aber je älter die Kinder wurden, umso häufiger kam, wie soll ich sagen, irgendwie bei ihrem Anblick die Erinnerung an mein erstes Kind hoch. Denn trotz allem, ich hatte es geboren. Ich wollte endlich wissen, wie es ihm ging und was aus ihm geworden war. Ich konnte es kaum noch ertragen, dass ich nichts unternehmen durfte, um es zu finden. Denn das hätte ihm furchtbar geschadet. Ich fraß das alles in mich hinein, bekam massive Magenbeschwerden, dachte schon, ernstlich krank zu sein. Aber die Ärzte fanden nichts. Psychosomatisch, hieß es. Ja, und dann begann ich eine Therapie. Der Therapeut riet mir, mit euch Kontakt aufzunehmen, um das Geschehen aufzuarbeiten und endlich abzuschließen. Und deshalb bist du jetzt hier.“