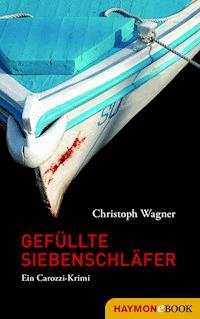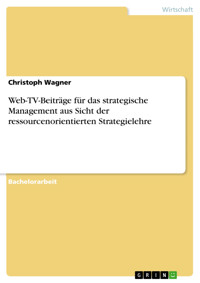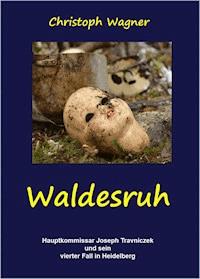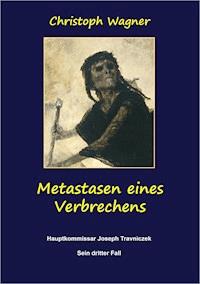Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Carozzi-Krimi
- Sprache: Deutsch
Trügerische Idylle in der Landgemeinde Schattenbach Eine verschwundene Madonnenstatue, ein abgetrennter Finger, eine Frauenleiche, mit einem Rosenkranz ans Chorgestühl der Dorfkirche gefesselt - im idyllischen Schattenbach inmitten der Weinberge der Wachau geschehen makabere Dinge. Und mittendrin: Mario Carozzi, Archäologe und Genussmensch mit einem Hang zu ausgefallenen Chili-Rezepten. Um sich vom Verdacht zu befreien, selbst der Täter zu sein, beginnt er seine privaten Ermittlungen und muss bald feststellen, dass sämtliche Honoratioren des Dorfes, vom Bürgermeister bis zum Pfarrer, einiges zu verbergen haben. Christoph Wagners Krimi-Debüt: Eine fesselnde Detektivstory aus der bigotten Welt der österreichischen Provinz, garniert mit viel schwarzem Humor - und einigen höllisch scharfen Rezepten. "Die Hauptfigur Mario Carozzi, die nach jahrelangem Mexiko-Aufenthalt nach Niederösterreich zurückkehrt, kämpft gegen das Unrecht in der scheinbar idyllischen Landgemeinde Schattenbach. Dabei verstrickt er sich aber immer weiter in einen Mordfall. Seine Erinnerungen an Mexiko und die kulinarischen Genüsse, mit denen er sich immer wieder in ferne Welten zaubert, halten ihn über Wasser. Wo die weite Welt auf ein kleines Nest trifft, kommt es nicht selten zu Konflikten. Scharfer Lesestoff für alle, die gerne in die Ferne schweifen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Christoph Wagner
Schattenbach
Ein Carozzi-Krimi
1
O happy earth! Reality of Heaven!
Percy B. Shelley
Am Freitag, an dem ich beraubt wurde, brach in Schattenbach die Welt zusammen.
Das ist, um ehrlich zu sein, weniger dramatisch, als es vielleicht klingt. Denn die meisten Dinge, die mich hier in Schattenbach umgeben, sind ohnedies nicht von dieser Welt. Oder würden Sie meinen, dass Schluckbildchen zu dieser Welt gehören?
Schluckbildchen. Briefmarkengroße Pergamentfetzen mit der Madonna drauf, oder mit heiligen Sprüchen. Auf die Zunge gelegt. Runter damit. Segen im Bauch. Das ist es, wovon ich zur Zeit lebe.
Es ist schon ein wenig lachhaft, was ich hier treibe. Statt in Ephesos im Dienste der Wissenschaft Amphorenscherben auszubuddeln oder in Mexiko nach alten Aztekenschätzen zu graben, mache ich hier im alten Schiffsmeisterhaus hoch über der Lände von Schattenbach den dummen August. Wenn jemand um einen Zehner mit mir darum wettet, dass ich mich das traue, dann schlucke ich sogar ein Schluckbildchen. Kein echtes, versteht sich, sondern ein präpariertes aus Oblaten, die ich selber mit Tintenfischtinte gestempelt habe. Die echten Bildchen wären zu wertvoll – und schmecken überdies scheußlich.
Es ist ein einsamer Job in einem einsamen Kaff ohne jede gute Hoffnung, auf den ich mich da eingelassen habe. Halbwegs was los ist nur am Wochenende, wenn ich meine größten Erfolge damit erziele, den Leuten zu erklären, wie man eine Drud fängt. Eine Drud ist ein böser Geist, der nächtens erscheint und sich einem dann recht dreist aufs Brustbein hockt. Wenn man den Albdruck erst einmal schmerzhaft spürt, ist es allerdings meistens schon zu spät, um die Drud zu verjagen. Also lieber vorher das sichelförmige, an einem Ende spitz wie eine Nadel zulaufende Drudenmesser an einer Schnur, am besten mit einem Nagel an der Decke, befestigen und über dem Brustbein pendeln lassen. Die Drud ist zwar böse, aber dumm ist sie Gott sei Dank auch. Wenn sie kommt, übersieht sie in ihrer Gier das scharfe kleine Ding, hockt sich nichts ahnend aufs Brustbein, und während sie dann auf Herz und Seele drückt, schnellt der scharfe Stahl direkt auf sie zu, spießt sie auf, und hin ist die Drud. Man kann also wieder in Ruhe schlafen. Immer ein Lacherfolg, die Geschichte. Aber es haben mich auch schon Besucher gefragt, ob man so ein Drudenmesser nicht auch käuflich erwerben kann.
Etelka, die mir gelegentlich aushilft, sagt, dass ich, wenn ich solche Geschichten erzähle, übertreibe. Aber nur wenn ich übertreibe, bekomme ich auch Trinkgeld, ansonsten ernte ich allenfalls ein müdes Lächeln.
Natürlich sind die Schluckbildchen und die Drudenmesser bei Weitem nicht alles, was ich meinen Besuchern zu bieten habe. Ich verwahre in meiner Sammlung auch ein Osterei, auf dem vierundfünfzig kleine Hufeisen befestigt sind. Ferner verfüge ich über einen Bierkrug, der sich auf vier Beinen bewegen kann und, während er, durch ein Laufwerk in Gang gesetzt, behände von einem Trinker zum anderen krabbelt, „In München steht ein Hofbräuhaus“ intoniert. Auch er ist allerdings nur eines von 924 mehr oder minder kuriosen Objekten, die im Laufe der Zeit, oft nach vielen Umwegen, hier in dem alten Schiffsmeisterhaus gelandet sind.
Im diesem ehrwürdigen Gebäude ist nämlich das Heimatmuseum von Schattenbach untergebracht. Es nennt sich ganz bescheiden Heimathaus, ist aber tatsächlich ein wirkliches Museum, allein schon weil es wie jedes echte Museum ziemlich komplizierte und unübersichtliche Öffnungszeiten hat, die noch von meiner Vorgängerin, offenbar zur Verwirrung unliebsamer Besucher, eingeführt wurden.
Mein Büro ist in dem alten Ladenkontor gleich neben der Eingangstür, in dem ich die eintretenden Gäste begrüße und sie bitte, bis zur nächsten Führung ein wenig zu warten. Hier erledige ich nicht nur den bürokratischen Kram und verkaufe die Eintrittskarten, sondern habe auch einen kleinen Souvenir-Shop mit Ansichtskarten, Ausstellungspostern, Strohblumensträußchen und kleinen Säckchen voll Mohn, Nüssen, Johanniskrauttee und gerösteten Kürbiskernen eingerichtet. Die Registrierkasse ist aus Messing, das allerdings wieder einmal blankgescheuert werden müsste. Ich darf nicht vergessen, Etelka darum zu bitten, auch wenn es für die Funktionstüchtigkeit des Museumsbetriebs gänzlich unerheblich ist, ob die Kassa glitzert und gleißt oder ob sie schmutzig und fettig aussieht wie jetzt.
Ich beginne meine Führung stets in der Mineraliensammlung, allein schon deshalb, weil mich dieser Abschnitt selbst am wenigsten freut, aber eben auch erklärt sein will. Die Mineraliensammlung hat jedoch nicht nur eine regionale, sondern auch eine dramaturgischen Bedeutung, die ich nur wenige Tage, nachdem ich meinen Posten als Kustos von Schattenbach angetreten hatte, sogleich produktiv zu nutzen verstand. Sie mündet nämlich in eine Reihe von Vitrinen mit in Spiritus präparierten Embryos, die, einmal rein pathologisch betrachtet, geradezu exemplarisch schöne Missbildungen aufweisen.
In meinem Vortrag gehe ich allerdings nicht näher auf diese Missbildungen ein, sondern sage, nachdem ich eine lange Pause verstreichen habe lassen, in einer Stimmlage, die zarter besaitete Museumsbesucher an Gefühlskälte erinnern mag: „Brauchen Sie jetzt vielleicht einen Schnaps?“
Der Moment, um diese Frage zu stellen, ist – ich kann es aus einer zwar kurzen, aber doch sehr eindeutigen Erfahrung sagen – ziemlich gut gewählt. Denn während ich die Schnapsfrage stelle, ist die Führung bereits am Ende des langen Museumsschlauches angelangt, der nicht nur in die Tiefen des alten Schiffsmeisterhauses, sondern auch zur Treppe in den Oberstock führt. Genau an dieser Bruchlinie zwischen Naturgeschichte im Parterre und Volkskunst im ersten Stock liegt jene unvergleichliche Museumseinrichtung, die ich meinen Tabernakel nenne. Von außen sieht man von dem direkt ins alte Bruchsteinmauerwerk eingelassenen Kästchen nur die in die Zirbenholzlamperie des Treppenhauses integrierte Schranktür, von der kein Besucher erwarten würde, dass sie plötzlich aufgeht. Es finden sich auch weder Schlüsselloch noch Riegel, die auf irgendeine verborgene oder gar offensichtliche Mechanik schließen lassen würden. Dennoch öffnet sich der Tabernakel, sobald ich eine Gruppe von Besuchern daran vorbeiführe, wie von Geisterhand.
Selbstverständlich will nun jeder wissen, wie ich das Schränkchen in der Wand aufkriege, doch nicht einmal Etelka, die weiß Gott was darum geben würde, habe ich bis jetzt über die wahre Funktionsweise aufgeklärt. Nur so viel: Wichtig ist, dass die Tür sich dann öffnet, wenn keiner es erwartet. Umso wirkungsvoller ist es dann nämlich, wenn dahinter gleich mehrere Schnapsflaschen zum Vorschein kommen.
Das hat noch jeden verblüfft: Ich sage also mit bewusst unterkühltem Sarkasmus: „Brauchen Sie jetzt vielleicht einen Schnaps?“, und bevor den Leuten noch ein befreiendes Jaaa!! aus der Kehle schnellt, geht die Geheimtür auf und bringt einen Vogelbeerbrand, einen Hetschepetschenschnaps, einen Trebernen, einen „Dirndl“ genannten Feinbrand aus Kornelkirschen sowie einen Zwei-Liter-Ballon voller Himbeergeist zum Vorschein.
Wenn das nicht lebendige Museumsdidaktik ist! Und es passiert auch nicht oft, dass jemand, der sich bei den Mineralien gelangweilt und vor den Embryos geekelt hat, meinen Schnaps ablehnt, dessen gar nicht so unerheblicher Preis selbstverständlich nicht in der Eintrittsgebühr inbegriffen ist. Das Geschäft mit dem Tabernakel bringt jedenfalls allemal mehr als das für gewöhnlich recht bescheiden ausfallende Trinkgeld, von dem ich überdies die Hälfte Etelka zustecke, weil sie so eine geschickte Staubfängerin ist und es im Heimathaus von Schattenbach wahrlich genug Staub gibt.
Die Schnapsflaschen sind übrigens mein bisher wichtigster Beitrag zum wenngleich bescheidenen wirtschaftlichen Aufschwung des Schattenbacher Heimathauses. Bevor ich das Museum als Kustos übernahm, waren im Tabernakel nämlich alles andere als Schnapsflaschen gestanden. Und es gibt einige im Ort, die meine Veränderungen am Tabernakel trotz aller ökonomischer Vernunft, die sich zweifellos dahinter verbirgt, als gotteslästerlich bezeichnen. Namentlich handelt es sich dabei um eine gewisse Frau Zidibulk, eine ortsansässige Matrone, die das Museum nach dem Ableben des alten Dorfschullehrers zwischenzeitlich reinigte oder, wie sie selbst es zu formulieren pflegt, „verwaltete“. Als Frau Zidibulk das erste Mal dahinterkam, was ich mit „ihrem“ Tabernakel angestellt hatte, war sie voller Entsetzen sofort zum Bürgermeister gerannt und hatte von diesem in seiner Funktion als Obmann des Verschönerungsvereins und damit als meinem unmittelbaren Vorgesetzten verlangt, meine sofortige Entlassung anzuordnen.
Bürgermeister Hannes Munknast ist jedoch ein zwar in politischer Hinsicht einigermaßen rückschrittlicher, so aber doch, wenn man mit ihm privat zu tun hat, leidlich patenter Zeitgenosse. Er hörte sich Frau Zidibulks apokalyptische Ausführungen also mit der Geduld und gelassenen Miene eines in dieser Hinsicht so wasserdichten wie wetterfesten Provinzpolitikers an, gab ihr völlig Recht – und entließ mich trotzdem nicht. Dass ich die Einnahmen des Heimathauses, seit ich dort mit dem Schnapsverkauf begann, binnen weniger Wochen mehr als verdreifacht hatte, fiel dabei allerdings noch weniger ins Gewicht als eine andere Tatsache: Ich war nämlich vorausblickend genug gewesen, den Großteil der Schnäpse bei einem der prominentesten Schnapsbrenner des Ortes einzukaufen, und das war kein Geringerer als der Bürgermeister selbst, wenngleich dieser nicht müde wurde zu betonen, dass er seine Brennblase nur für den Privatgebrauch und, wie er es ausdrückte, für gute Zwecke, anheizte.
Ich bin auf die demütigende Niederlage, die ich Frau Zidibulk im Angesicht des Gemeindeoberhaupts in der Schnapsdebatte zwangsläufig zufügen musste, also gar nicht so besonders stolz. Tatsächlich war mein Sieg wesentlich schneller erzielt, als der Bauer, wie die Einheimischen sagen, in einer Weingegend zum Milchholen braucht.
Dennoch muss ich Frau Zidibulk auch Abbitte leisten. Immerhin passiert es nicht alle Tage, dass das Prunkstück eines Heimatmuseums, das neben seinem kunsthistorischen auch noch kultischen Charakter besitzt, auf so profane Weise von seinem angestammten und durchaus würdigen Platz entfernt und durch eine Batterie von Schnapsflaschen ersetzt wird, deren Vertrieb ganz eindeutig dem schnöden Mammon dient. „Wenn er wenigstens Weihwasserflaschen hineingestellt hätte, der Herr Doktor Carozzi!“ Dieser Satz einer völlig entnervten Frau Zidibulk klingt mir heute noch in den Ohren. Aber profaner Schnaps statt eines gotischen Madonnenbildnisses …?
Tatsächlich war die Madonna, die im Baedeker sogar mit einem Sternchen ausgelobt ist, wohl einer der Hauptgründe, warum Menschen aus aller Welt, zumindest an schönen Wochenenden, in das Heimatmuseum im Schiffsmeisterhaus kamen und dafür nicht nur Mineralien, Embryos und Schluckbildchen, sondern sogar meine müden Scherzchen darüber in Kauf nahmen. Dabei sah die kleine, recht grob geschnitzte und mit längst verwitterten Erdfarben bemalte Buchenholz-Statuette alles andere als eindrucksvoll aus. Allein schon das Jesuskind, das sie anatomisch völlig verkehrt in ihren rechten Ellbogen eingeklemmt hielt, hätte man bei etwas bösem Willen auch für einen länglichen Brotlaib halten können.
Andererseits war die Madonna alleine durch die Tatsache, dass sie aus dem frühen 14. Jahrhundert stammte, um etliches wertvoller als die meisten anderen Madonnen in der Umgebung. Ihre unleugbare Popularität vermag die Madonna von Schattenbach allerdings selbst durch ihr hohes Alter nicht zu erklären. Denn auch im 14. Jahrhundert zählten die Madonnenschnitzer, ebenso wie die Flagellanten, Wanderprediger und Gaukler, zum fahrenden Volk und verdienten sich ihren Lebensunterhalt damit, dass sie jede bessere Waldkapelle mit einem sogenannten Gnadenbild aufrüsteten, um welches der geschwätzige Volksmund dann pflichtgemäß eine ebenso fromme wie wallfahrtsfördernde Legende zu spinnen wusste.
Mit dem allmählichen Versiegen der Wallfahrt war die Madonna dann wohl irgendwann von der Kirche in den Haustabernakel des alten Schiffsmeisterhauses und damit ins heutige Heimathaus übersiedelt. Dass sie in keinem Kunstführer der Welt fehlt, verdankt sie allerdings nicht den zahlreichen Legenden, die sich im Lauf der Zeit um sie verwoben haben, sondern der simplen Tatsache, dass sie, rein physiologisch betrachtet, verkrüppelt ist. Ihre rechte Hand, die als Aufforderung zum Beten möglichst vieler Rosenkränze eine kleine, dünne Perlenschnur umklammert, zählt bei genauerem Hinsehen exakt einen Finger zu viel. Darum ist die Madonna früher unter ihrem alten Wallfahrernamen „Maria mit den sechs Fingern“ wesentlich bekannter gewesen als unter der sachlicheren und weniger spektakulären Bezeichnung „Madonna von Schattenbach“, unter welcher sie im Museumskatalog vermerkt ist. Der Katalog, in dem sich mein Vorgänger, der alte Dorfschullehrer, der kunsthistorischen Zunft durch eine offensiv zur Schau gestellte Wissenschaftlichkeit als einer der ihren anbiedern wollte, verzichtet daher überraschenderweise auch auf die Erzählung aller frommen Legenden, sondern beschränkte sich auf die schlichte Bestimmung von Objekt und Entstehungszeit: „got. Madonnenbildnis, dem Meister von Schattenbach zugeschr., urspr. gen. Zu unserer Lieben Frauen Sechsfinger, Tempera auf Buche, um 1320.“
Genau so stand es auf dem kleinen Täfelchen hinter Plexiglas zu lesen, das ich unmittelbar neben dem neuen Domizil der Madonna aufgestellt hatte, welches mir um nichts weniger würdig erschien als ihr Versteck hinter der Geheimtür des Schiffsmeister-Tabernakels. Um Frömmlern von der Art Frau Zidibulks endgültig den Wind aus den Segeln zu nehmen, hatte ich unter die trockene, wissenschaftliche Beschreibung sogar noch die ersten beiden Zeilen des alten Schattenbacher Wallfahrerlieds ausgedruckt und auf das Glastäfelchen geklebt: „Wir ziehen zur Mutter der Gnaden, zu ihrem hochheiligen Bild. O lenke der Wanderer Pfade und segne, Maria, sie mild!“
Besucher des Heimathauses brauchten, um die Madonna mitsamt dem Spruch zu finden, nunmehr lediglich die Treppen hinaufzusteigen, und bevor sie noch die oberen Schauräume erreichten, grüßte sie die Madonna schon von einer geräumigen Wandnische herab, die überdies den Vorzug aufwies, südseitig zu liegen und dadurch den ganzen Tag über auf natürliche Weise beleuchtet zu werden, was den ohnedies etwas karg geschnitzten Zügen der Muttergottes zusätzliche Plastizität verlieh. Der Flur bildete vor dieser Nische eine überaus günstige, weil ziemlich geräumige Plattform, sodass sich die Besucher, die sich meiner Führung angeschlossen hatten, nicht mehr im Stiegenhaus zu drängeln brauchten, sondern sich bequem vor dem Gnadenbild versammeln und lauschen konnten, wie ich mit einer Fabulierfreude und Weitschweifigkeit, die ich auf mein Faible für das Werk Thomas Manns zurückführe, begann, die Legende der Madonna von Schattenbach zu erzählen.
Ich selbst hatte sie, ehrlich gestanden, nicht gekannt, bevor ich meinen Posten als Kustos des Schattenbacher Museums angetreten hatte, und dass ich sie mir aus ein paar alten Heimatbüchern und diversen frommen Schriften erarbeiten musste, mag mit ein Grund gewesen sein, dass sie aus meinem Munde weder abgedroschen noch besonders fromm, sondern vielmehr frisch, unterhaltsam und, wie ich hoffe, sogar ein wenig humorvoll klang.
Nicht minder dreist, als die Legende es tat, benamste ich den wissenschaftlich korrekter als „Meister von Schattenbach“ bezeichneten Anonymus kurzerhand als Meister Veit und dichtete ihm einen Riesenrausch an, in dem er, weil die Zeit drängte, letzte Hand an die den Schattenbachern versprochene Madonna legte. Er stand, so führte ich weiter aus, schon arg im Öl, als er sich an das letzte noch ungeschnitzte Teil des Buchenholzklotzes machte und daraus – womöglich auch noch unter Absingen wenig gottgefälliger bacchantischer Lieder – mit flinker Hand ein feingliedriges Händchen schnitzte und in seinem Dusel nicht einmal bemerkte, dass er nicht nur ein Gläschen, sondern auch einen Finger zu viel erwischt hatte. Als Meister Veit die fertige Madonna am nächsten Tag dem Pfarrer präsentierte, deckte dieser durch simples Nachzählen den Irrtum auf, doch die Madonna weigerte sich, so erzählt es zumindest die Legende, ihren sechsten Finger wieder zurückzugeben. Alles Herumfeiteln erwies sich als vergeblich.
So blieben der Madonna ihre sechs Finger, und es dauerte nicht lange, bis sich das Bildnis auch als Gnadenbild bewährte. Ein Bürger namens Leopold Hofstetter „verlobte sich“, wie es in der alten Ortschronik hieß, mit der Madonna, als ihm eine blinde Tochter geboren wurde. Die Madonna stellte die Geduld des armen Mannes trotz der in Aussicht gestellten Wachs- und Geldspenden zunächst auf eine lange Probe, die sich jedoch lohnen sollte: An seinem dritten Geburtstag wurde das Mädchen plötzlich sehend und die Wallfahrt entsprechend lukrativ.
„Wer weiß“, pflege ich nach dieser Erzählung noch pathetisch hinzuzufügen, „ob all das auch passiert wäre, wenn die Madonna nur fünf Finger gehabt hätte“ – eine Bemerkung, die mir besonders bei älteren Museumsbesucherinnen schon so manches zustimmende fromme Nicken und eine entsprechende Remuneration am Museumsausgang eingebracht hat.
An diesem einen Freitagvormittag brauchte ich jedoch nicht auf Trinkgeld zu spekulieren, weil mir die Erzählung der Legende für heute und, wie zu befürchten stand, auch für die kommende Zeit erspart bleiben würde. Als ich die Mineraliensammlung, die Embryos und den Schnapstabernakel mit einer Handvoll Besucher hinter mir gelassen hatte, um in die oberen Schauräume hinaufzusteigen, machte ich eine Beobachtung, die diesen beginnenden Sonnentag inmitten des Schattenbacher Idylls nachhaltig prägen und auch nicht ohne Einfluss auf mein weiteres Privatleben bleiben sollte: Die Madonna war weg.
*
Wie meistens, wenn Menschen derartige Niederlagen zustoßen, tat die Natur so, als würde sie mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Die Kirschbäume draußen vor den winzigen Fenstern trugen strahlend weiße Blüten, der Himmel leuchtete blitzblau und die Mittagsglocken sorgten für die passende Hintergrundmusik.
Verfluchtes Landleben. Ich hätte es wissen müssen. Aber wir geborenen Stadtmenschen träumen nun einmal alle diesen verlogenen Traum von der intakten, unberührten Natur. Und wenn man dann gerade auf Jobsuche ist und an einen leutseligen Bürgermeister gerät, der einem auch noch ein leidliches Auskommen zusichert, dann greift man halt zu, sagt dem Asphaltdschungel ade und sitzt auch schon in der Falle. Besonders dann, wenn man wie ich zu viel Jean Paul gelesen hat und mit der Idylle ein „Vollglück in der Beschränkung“ verbindet, das sich, wie man dann allmählich lernt, doch nicht einstellt. In den knapp zwei Monaten, seit ich die Stelle im Schiffsmeisterhaus angetreten hatte, hatte ich jedenfalls zunehmend den Eindruck gewonnen, dass hier nicht nur das Glück, sondern auch sonst noch etliches ziemlich beschränkt war, vor allem wohl auch ich selbst.
Dennoch hat das Landleben auch seine schönen Seiten. Eine davon ist, dass man jederzeit zu jedem, den man gerade sprechen möchte, hingehen kann und sich zuvor nicht einmal telefonisch anzumelden braucht. Es reicht ein ganz gewöhnliches Klopfen an der Haustür oder ein Ziehen an der Messingschelle. Und wenn auch das nichts nützt, macht man einfach die – meist unversperrte – Tür auf und geht hinein.
Das Häuschen, in das ich soeben eintreten wollte, hatte trotz seiner Geducktheit gleich zwei Erker. Dass es in relativ frischem und daher auch ziemlich aufdringlich leuchtendem Kaisergelb gestrichen war, bemerkte man kaum, da die Fassade zum größten Teil mit wildem Wein überwuchert war. Neben der Tür befand sich unter einer sanft vorspringenden Laube eine wettergraue Bank, deren Oberfläche wie eine vergilbte Landkarte aussah. Auf der Bank stand eine fast leere Flasche Wein, die ebenso in der Mittagssonne funkelte wie das Glas daneben, in dem sich bereits ein paar Fliegen am Extrakt des vertrockneten Rebensafts labten. Doch die Sonne schien mir nicht nur über die Schulter, sie strahlte mir auch direkt ins Gesicht. Es war allerdings kein leuchtendes, sondern ein kunstvoll gedrechseltes Exemplar im Zentrum des massivhölzernen Eingangstors. Ich datierte die mit einiger Sicherheit auf spätes achtzehntes Jahrhundert, als Kleineisenarbeiten noch Mikrokosmen spätbarocker Handwerkskunst waren. Die geschnitzte Sonne lachte hingegen, verglichen mit solcher Vollendung, geradezu läppisch von der Tür herab. Pausbäckig und feist ließ sie jede elegante Linienführung vermissen, wenngleich sie signalisierte: „Du bist hier willkommen.“ Ich war mir allerdings nicht sicher, ob ich das mit der Nachricht, die ich zu überbringen hatte, auch tatsächlich war.
Bevor ich eintrat, überlegte ich kurz, ob ich nicht lieber zuvor zum Gendarmerieposten hinüberlaufen und den Diebstahl noch vor dem Bürgermeister den zuständigen Behörden melden sollte. Andererseits war es vielleicht doch klüger, zuvor meinen Chef zu informieren, und sei es nur, um allfällige Missverständnisse von vornherein auszuräumen. Die Gendarmen legten gegenüber Neuzugängen in der Gemeinde gerne das an den Tag, was man ein „gesundes Misstrauen“ nennt. Und ich bildete mir – damals zumindest noch – ein, genug gesunden Menschenverstand mitbekommen zu haben, um dem auszuweichen.
Ich traf Bürgermeister Munknast beim Mittagessen an. Der schwere gedrechselte Eichentisch in der Mitte des Raumes war mit einem grobleinenen Tischtuch gedeckt, auf dessen Oberfläche sich rot bestickte Hirschen in munterem Galopp verfolgten. Auf eine seltsam vertraute Weise sah es in der Stube aus wie auf einem großflächigen Plakat, das Produkte aus vollbiologischem Landbau anpries.
Der Bürgermeister selbst wäre in jeder Werbeagentur jedoch wohl bereits vom Fräulein am Empfang als uncool eingeschätzt und für einen Irrläufer gehalten worden. Mit seinen Hamsterwangen und dem fettigen Zwirbelbart sah er tatsächlich nicht eben staatstragend, sondern fast ein wenig ungustiös aus. Genauso stocherte er auch auf seinem Teller in den zerfetzten Resten eines Schweinsnetzes herum und fischte mit der Gabel die letzten Selchfleischkrümel aus dem, was man zu Schattenbach eine Saumaise nannte und zu jeder sich nur irgendwie bietenden Gelegenheit verzehrte. Unterhalb der geduckten Gewölbebögen der kleinen Stube hatte sich daher auch bereits eine feuchte, sich schwadenartig ausbreitende Wolke aus Sauerkrautdunst festgeklebt und schien, deutlich riechbar, lediglich auf eine hilfreiche Hand zu warten, die das Fenster öffnete und es ihr ermöglichte, unauffällig zu entweichen.
Munknast musterte mich von Kopf bis Fuß, und ich ahnte bereits, dass ihm etwas an mir nicht gefiel.
„Jetzt trägt er immer noch seinen Ohrring, der Pirat“, sagte er erwartungsgemäß und spielte damit auf das Flinserl an, das ich mir zugelegt hatte, als ich im mexikanischen Hochland – übrigens wie so oft in meinem Leben ohne maßgeblichen Erfolg – nach indianischen Kalendersteinen suchte. In der Eile hatte ich vergessen, das winzige kleine Geschmeide abzunehmen, wie ich es eigentlich vereinbart hatte, bevor ich meinen Dienst hier antrat.
„Wenn Sie in Ihrer Freizeit ein Flinserl tragen“, hatte der Bürgermeister bei meinem Einstellungsgespräch gesagt, „so kann ich Sie nicht daran hindern. Aber nehmen Sie’s runter, sobald Sie offiziell unterwegs sind. Wir sind hier nicht bei den Indianern. Und Ihr komischer Blondschweif ist für Schattenbach wirklich schon extravagant genug.“
Das war angesichts der zu überbringenden Botschaft kein besonders gelungener Auftritt, und entsprechend beschämt begann ich an meinem Ohrläppchen herumzunesteln. Doch Munknast reagierte wie bis dato fast immer: jovial.
„Lassen Sie’s nur. Ist ja keiner da außer mir.“
„Und er?“, fragte ich mit Blick auf einen etwas blassen Knaben von siebzehn oder achtzehn, der während unseres Dialogs neben Munknast gesessen war und freudlos an ein paar Salatblättern herumgeknabbert hatte.
„Ach der?“, fragte der Bürgermeister erstaunt. „Das ist nur mein Sohn. Aber wenn er Sie stört, kann er sein Grünzeug auch bei der Mama in der Küche mampfen.“ Und wieder zu seinem Filius gewandt, fügte er hinzu: „Dein Typ ist hier nicht gefragt, Sebastian. Ab durch die Mitte.“
Der junge Mann nahm seine Salatschüssel in die Hand und zog ab.
„Ich wollte ihn nicht vertreiben“, sagte ich, etwas peinlich berührt.
„Machen Sie sich nichts draus. Ich wollte ihn vertreiben“, erwiderte der Bürgermeister.
Munknast bot mir einen Platz auf einem Stuhl an, der nichts anderes war als ein halbiertes Holzfass mit angenagelter Rückenlehne. Dann erhob er sich, ging zum Gläserschrank, holte einen Römer aus geschliffenem Bleikristall heraus und goss mir Wein aus der unetikettierten Flasche ein, die am Tisch stand. „Zum Wohl“, sagte er und nahm einen tiefen Schluck aus seinem eigenen Glas.
Mir war aus verständlichen Gründen nicht nach Zutrinken zumute. Ich starrte also über den bis knapp unter den Glasrand gefüllten Römer hinweg an der Flasche vorbei und sagte: „Die Madonna ist weg. Gerade wollte ich meine Vormittagsführung beginnen, aber sie war nicht mehr da.“
Der Bürgermeister sagte nichts und nahm noch einmal einen, diesmal noch tieferen Zug. Dann pickte er mit der Gabel einen weiteren fettig glänzenden Bissen von seiner Saumaise auf und zerkaute ihn, als handle es sich um eine pazifische Felsenauster. Als er den Bissen doch unten hatte, schälte er eine dicke, ebenfalls mit springenden Hirschen bestickte Stoffserviette aus dem altsilbernen Serviettenring und wischte sich den Mund ab. Seine runden Augäpfel steckten in ihren Höhlen wie zwei eingelochte Golfbälle und starrten mich, um die eigene Achse rotierend, an.
„Ist jetzt noch jemand drüben?“, fragte er.
„Etelka.“
„Ach die. Hat sie’s zuerst bemerkt?“
„Nein, ich hab’s zuerst bemerkt.“
„Sie hätten wohl doch weiter mit Frau Zidibulk kooperieren sollen, wie ich es Ihnen geraten habe. Auf die würde kein Verdacht fallen. Außerdem hätte sie den Diebstahl wohl in ihrer resoluten Art eher verhindert als …“
„… begangen? Sie wollen doch nicht etwa Etelka …?“
„Nein, ich verdächtige sie nicht, oder zumindest noch nicht. Ich sage nur, dass Frau Zidibulk über jeden Verdacht erhaben gewesen wäre, was man von einer nicht ortsbekannten Serbin, die drüben im Flüchtlingslager lebt, nicht unbedingt behaupten kann. Und außerdem hätte Frau Zidibulk sicherlich verhindert, dass Sie die Madonna für jeden greifbar in eine Nische stellen anstatt sie in ihrem Tabernakel zu lassen. Der war zwar auch nicht gerade das Fort Knox, aber immerhin zugesperrt.“
Mit Munknasts Leutseligkeit war es mittlerweile nicht mehr besonders weit her, mit meiner Geduld allerdings auch nicht.
„Sie haben der Schnapsbar selbst zugestimmt.“ Ich verkniff mir hinzuzufügen, dass er dies durchaus auch im eigenen Interesse getan hatte.
„Mit Vorbehalten, mein Lieber, mit Vorbehalten habe ich zugestimmt. Und unter der Voraussetzung, dass die Sicherheit des Museums dadurch nicht beeinträchtigt würde.“
„Das ganze Museum ist doch ein Hochunsicherheitstrakt. Ich habe schon bei meinem Dienstantritt darauf hingewiesen, dass die Alarmanlage nicht mehr funktioniert.“
„Und wann war Ihr Dienstantritt?“
„Vor knapp zwei Monaten.“
„Also Zeit genug, um etwas zu verändern. Warum wollen Sie dann mir die Schuld geben?“
„Das Ansuchen um Bewilligung einer neuen Alarmanlage liegt noch beim Gemeinderat.“
„Hören Sie mir auf mit dem Gemeinderat.“
Tatsächlich hatte mir Bürgermeister Munknast, als ich im Februar das Museum übernommen hatte, versprochen, dass das Alarmsystem des Museums umgehend erneuert würde. Die bestehende Anlage schützte nämlich kein einziges Objekt, sondern beschränkte sich nur auf eine Klingel, die ausgelöst wurde, wenn jemand gewaltsam eine Tür oder ein Fenster des Schiffsmeisterhauses öffnete, und auch die schrillte nur, wenn es draußen nicht besonders heiß oder kalt war. Der Zeitpunkt, mit dem Bürgermeister über seine Versäumnisse in Sachen Alarmanlage zu hadern, schien mir indessen nicht der allergünstigste zu sein.
Hannes Munknast schaufelte unterdessen die letzten Fettreste und Fleischkrümel zur Seite, um zu signalisieren, dass er sein Mittagessen zu beenden gedachte, bevor er sich mit einem Ausdruck sichtbaren Unwillens erhob. Mit schlurfendem Schritt überquerte er den schon etwas buckligen Parkettboden seines Wohnzimmers und machte direkt vor dem gemauerten Kaminsims Halt, wo er sein Handy zum Aufladen hingelegt hatte. Er hatte auch prompt jemanden in der Leitung, den er, obwohl er ihn keineswegs duzte, immer wieder Loisl nannte, was mich angesichts der üblichen Benimm-Usancen am Lande einigermaßen verwunderte. Die kurze Unterhaltung über die verschwundene Madonna mündete in ein unwirsches Bellen, mit dem der Bürgermeister den ominösen Loisl aufforderte, seinen Posten umgehend zu verlassen und zu einer Krisensitzung herüber in seine Wohnung zu kommen.
Ich dachte unterdessen über das delikate Thema nach, ob ein Gemeinderat, der sich nicht einmal eine einfache Umrüstung der Alarmanlage leisten wollte, jemals die Mittel bewilligt hatte, um die Madonna auch ihrem Wert entsprechend versichern zu lassen. Ich hätte fast gewettet, dass es nicht der Fall war.
Der Bürgermeister schlurfte zum Tisch zurück.
„Sie hätten Etelka nicht alleine im Museum zurücklassen sollen“, sagte er.
Ich hatte eine solche Bemerkung von Hannes Munknast befürchtet. Er zählte zu jenem Typus Mann, der davon überzeugt ist, dass man vor Frauen, die nicht Rosi, Susi, Hanni oder, wie die seine, Klothilde hießen, gar nicht genug auf der Hut sein konnte.
„Etelka war schon oft alleine“, sagte ich mit meinem angeborenen Mangel an Diplomatie. „Sie hätte das ganze Museum schon dreimal ausräumen und sich mitsamt der Madonna und sonstigen Preziosen aus dem Staub machen können.“
„Was fehlt denn sonst noch?“, brummte der Bürgermeister.
„Nichts, wovon ich wüsste.“
„Sie sollten die Inventarliste überprüfen.“
Sein Verhalten verstörte mich ein wenig. Ich hatte nicht erwartet, dass der Bürgermeister erfreut sein würde, vom Verlust der Madonna zu hören. Um ehrlich zu sein hatte ich, da er zu einem roten Kopf und cholerischen Anfällen neigte, sogar damit gerechnet, dass hinter der in zahllosen Wahlversammlungen erprobten Maske der Leutseligkeit so etwas wie ein Wutanfall zum Vorschein kommen könnte. Immerhin leitete ich das Museum erst seit kurzer Zeit, und der Bürgermeister hatte meine Anstellung als Kustos im Gemeinderat gegen die Stimmen der Opposition durchgebracht, die mein leicht exotisches Äußeres und die Tatsache, dass ich kein Hiesiger war, wesentlich mehr gestört hatte, als ihr mein in Archäologie und Ethnologie erworbenes Doktorat imponierte.
Rückblickend war es sicherlich ein Fehler gewesen, entgegen seinem ausdrücklichen Rat Etelka stundenweise zu beschäftigen und damit Frau Zidibulk zu brüskieren, die in Sachen Museumspflege wesentlich ältere Rechte geltend machen sowie in der ganzen Ortschaft gerühmte Kekse backen konnte und zu allem Überfluss auch noch im Pfarrkirchenrat saß. Andererseits hatte sie mich vom ersten Moment an nicht gemocht und hätte das nunmehr von mir betreute Museum mit Sicherheit eher bespitzelt als aufgeräumt. Abgesehen davon war meine Entscheidung für Etelka und gegen die alte Zidibulk spätestens in dem Moment gefallen, als ich hörte, dass Etelka, wenn sie nicht wenigstens einen Teilzeitjob aufweisen könnte, umgehend des Landes verwiesen worden wäre.
Mich selbst hätte eine solche Landesverweisung im Moment hingegen gar nicht gestört. Im Gegenteil: Weiß Gott was hätte ich jetzt für ein stilles Plätzchen am Fuße des Feuer spuckenden Popocatepetl gegeben und für eine Flasche Mezcal, die ich mit ein paar kräftigen Zügen bis hinunter auf den berüchtigten Wurm aus der Agave hätte leeren können. Doch ich war nun einmal hier an der Biegung eines viel beschaulicheren Flusses gelandet, als es der Rio Bravo war, und es blieb mir nichts anderes übrig, als mich über den Mangel an Mezcal mit einem Schluck Rheinriesling zu trösten, der allerdings schmeckte, als wenn man in einen unreifen Pfirsich biss.
„Ich werde gleich heute Nachmittag mit der Inventur beginnen“, erwiderte ich artig, wenngleich nicht ohne ein gewisses gegen den Strich gebürstetes Vibrato in meiner Stimme.
Hannes Munknast quittierte meine Bemerkung mit einem undefinierbaren Grunzen. Dass ihn die Sache dennoch bewegte, merkte ich lediglich daran, dass er sich mit der rechten Hand gleich mehrmals durchs schüttere weiße Haupthaar fuhr, obwohl ein solches bei genauerer Betrachtung kaum vorhanden war. Die Weinflasche auf dem Tisch hatte er, bevor ich gekommen war, schon zu zwei Drittel leer gemacht. Vielleicht war es tatsächlich nur der Alkohol, der ihn einigermaßen gnädig stimmte und daran hinderte, meine fristlose Kündigung auszusprechen. Schließlich befanden wir uns hier ja in einer Weingegend.
Doch nicht nur der Bürgermeister hatte zum Mittagessen sein sogenanntes Gläschen getrunken, was in seinem Zusammenhang ein recht euphemistischer Ausdruck war. Auch der Inspektor, der inzwischen eingetroffen war, entbehrte des gewissen, offenbar ortsspezifischen Zungenschlags nicht, als er sich als Loisl vorstellte und ich ihm mit argloser Miene und offenem Blick antwortete: „Sehr erfreut, und ich bin der Mario.“
Ohne es zu wissen und schon gar nicht zu wollen, hatte ich es damit an der gerade am Lande immer noch mit besonderer Nachhaltigkeit eingeforderten Ehrfurcht vor einer sogenannten Respektsperson fehlen lassen und mich offenbar einer schweren staatsbürgerlichen Verfehlung schuldig gemacht. Ich erntete für meinen Fauxpas auch eine entsprechend feindselige Miene meines Gegenübers.
„Josef Loisl“, erwiderte derselbe mit dem Ausdruck eines Granitfelsens und reichte mir seine Hand, die sich nicht minder kalt und steinern anfühlte. „Inspektor Josef Loisl“, wiederholte er, gewissermaßen als Ausgleich dafür, dass er gerade nicht in Uniform amtierte.
„Carozzi“, stammelte ich daraufhin, ehrlich verblüfft. „Doktor Mario Carozzi.“
„Unser neuer Museumskustos“, ergänzte der Bürgermeister.
„Schon von ihm gehört“, erwiderte Loisl mit gleichermaßen bedrohlicher wie lallender Stimme.
Wollte man von Inspektor Loisl eine Karikatur anfertigen, sie könnte nur ein Abziehbild der Wirklichkeit sein. Es fehlten ihm weder das Schnurrbärtchen unter den neugierigen, ziemlich rot geränderten Augen noch das silberne Uhrkettchen in der Tasche des grünen Samtwämschens, das er unter seinem Trachtenjanker trug. Er war ein Mann, der, allerdings mit geringem Erfolg, versuchte, stets ein wenig ernster auszusehen, als er genommen wurde. Mit Sicherheit hätte Loisl einen guten Zeremonienmeister auf jedem Feuerwehrball abgegeben, nur dass er sich sein Geld erstaunlicherweise bei der Gendarmerie verdiente.
Ganz nüchtern war er jedenfalls nicht mehr, dieser Inspektor namens Loisl, dessen Auftritt mich anfangs eher rührte als erschreckte. Wie er sich da nämlich in einer viel zu ausladenden Schleife vom Türstock in die Zimmermitte zum Esstisch des Bürgermeisters vorschob, wirkte er alles andere als zackig, auch wenn Loisl das durch ein subaltern ansalutiertes „Was gibt’s, Herr Bürgermeister?“ wieder gutzumachen trachtete.
„Arbeit gibt’s, Loisl. Die Madonna ist weg“, hörte ich Hannes Munknast mich selbst zitieren.
„Die mit den sechs Fingern?“, fragte der Inspektor.
„Welche sonst?“
„Könnte ja auch eine aus der Kirche sein, hängen immerhin genügend davon herum.“
„Auf die passt aber unser Herr Pfarrer auf, und nicht unser Doktor Flinserl.“
Der Satz stach wie eine Distel aus dem Strohblumensträußchen, das mir plötzlich in der Mitte des Esstisches auffiel.
„Dann bleibt uns jetzt wohl nichts anderes übrig, als ein Protokoll aufzunehmen“, sagte Loisl nicht eben diensteifrig, aber es war ja auch Mittagszeit.
„Wollen Sie nicht zunächst den Tatort besichtigen?“, fragte ich und ahnte schon, dass ich mir damit einen weiteren von Loisls zwar feuchten, aber keineswegs fröhlichen Blicken einhandeln würde, von denen mir noch nicht ganz klar war, ob daraus eher Verachtung oder Mitleid sprach.
„Ja, das könnte man auch tun“, antwortete er. Da er dabei eine etwas amtlichere Haltung annahm und umständlich sein Uhrkettchen zurechtrückte, wurde mir zunehmend klar, dass es sich wohl um Verachtung handelte.
Der Bürgermeister schien sich, ohne es vor mir zugeben zu wollen, ebenfalls meiner Ansicht anzuschließen, dass eine Besichtigung des Tatorts sinnvollerweise vor der Aufnahme des Protokolls erfolgen sollte.
„Gehen Sie ruhig vor, Carozzi, und passen Sie mir auf die Etelka auf“, wandte er sich, ohne zuvor mit Loisl auch nur in Blickkontakt zu treten, an mich.
„Die Etelka aus dem Asyl?“ fragte der Gendarm.
„Genau, die aus dem Flüchtlingslager. Sie hilft drüben im Museum aus“, sagte der Bürgermeister und zuckte dabei verächtlich mit den Schultern.
Etwas Besseres als „Dann schau ich halt einmal rüber“ wollte mir darauf nicht einfallen. Ich nahm einen letzten Schluck von meinem mittlerweile schon ziemlich lau gewordenen Riesling und verabschiedete mich.
Nachdem ich die Tür zum Esszimmer hinter mir geschlossen hatte, hörte ich noch, wie der Inspektor eine Bemerkung über mich machte, die offensichtlich nur für die Ohren des Bürgermeisters bestimmt war. Ich verstand sie auch nicht ganz genau, doch kam es mir so vor, als hätte Loisl schlicht und einfach „Ich mag ihn nicht“ gesagt.
Vielleicht hatte ich mich aber auch verhört.
*
Würde man sich Etelka in anderen Sachen als in diesem ausgefransten knallbunten Kopftuch und dem grässlich karierten Hauskleid denken, das sie meistens über Jeans und T-Shirt trägt, dann könnte man bei eingehenderer Betrachtung sogar zu dem Urteil kommen, dass sie ziemlich hübsch war. Wie sie sich allerdings für gewöhnlich präsentierte, wenn sie zum Aufräumen kam, hatte sie etwas nonnenhaft Altersloses an sich. Sie hätte zwanzig ebenso wie fünfzig sein können. Ihr tabakbrauner Teint und ihre wie zwei Mandolinen ausgebuchteten Backenknochen würden in anderer Umgebung durchaus das Prädikat apart zulassen. Hier schien indessen niemand an dieser Eigenschaft interessiert zu sein. Man begnügte sich lediglich damit festzustellen, dass sie von weit her kam.
Gegenwärtig wohnte Etelka mit etwa zwei Dutzend anderen Flüchtlingen ein paar Kilometer außerhalb des Ortes, gleich hinter dem Galgenberg, in einem seit über einem Jahrzehnt leerstehenden alten Gasthaus, das man vor einigen Jahren in ein Notquartier umfunktioniert hatte, bei dem die Betonung ganz eindeutig auf dem Wörtchen „Not“ lag. Seither verdiente sie sich ihr Geld als Zugehfrau, Taglöhnerin in der Schiffswerft oder als Obstpflückerin, vor allem auch bei der Weinlese, wo billige Arbeitskräfte besonders willkommen waren.
Ich hatte Etelka gleich an einem der ersten Tage meines Schattenbacher Exils kennengelernt, und es war ein ganz und gar unmusealer Anlass, der uns zusammenführte. Ich koche nämlich gerne.
Nein, ich bin kein großer Gourmetkoch, und es sind nicht die Schöpfungen der französischen Klassiker wie Escoffier oder Bocuse, denen ich nacheifere. Ich zähle mich auch nicht zu jenen Hobbyköchen, die alle Kochbücher von Sterne- und Haubenköchen aufkaufen, derer sie habhaft werden können, um dann mit den bescheidenen Mitteln ihrer Einbauküchen und unter gewaltigem Materialaufwand die Rezepte der großen Meister nachzuköcheln, aus denen letztlich ja doch nur dilettantische Kopien wohlschmeckender Originale werden.
Am ehesten könnte man mich als einen Ethnokoch bezeichnen, was mit meiner ethnologischen Ausbildung zusammenhängt. Ich habe mich nie damit beschäftigt, wie man eine Omelette Surprise perfekt hinkriegt, aber wenn ich einen guten Tag habe, dann kann man bei mir schon ganz gute mexikanische Tacos, ein ausgezeichnetes Kichererbsenpüree, leidliche Falafel, einen türkischen Pilaf oder eine indische Mulligatawnysuppe bekommen, die ich – nein, ich bin kein Vegetarier – nicht nur mit Linsen, Zwiebeln, Knoblauch, Lorbeer, Curry und Kokosmilch, sondern auch mit Hammelfleisch, Nüssen und Mandeln zubereite.
Ich koche multikulturelle Armeleutegerichte und bin daher auch ein eifriger Zutatenjäger mit einiger Erfahrung auf kleinasiatischen Bazaren und mexikanischen Indio-Märkten. Auch wenn ich in Großstädten lebte, hatte ich normalerweise niemals Probleme, an meine zugegebenermaßen oft etwas exotischen Ingredienzien zu gelangen. Es erfordert schon einige Mühe und Spürsinn, um an Palmöl, Maniokmehl oder Burghul zu kommen. Doch nach einiger Zeit hat man sich als kontaktfreudiger Mensch eine kleine Infrastruktur aus Marktfahrern, Greißlern und aktiver kulinarischer Nachbarschaftshilfe aufgebaut.
Wenn man sich freilich wie ich an ein abgelegenes Flussknie irgendwo in den Voralpen verirrt hat, dann tauchen für den Ethnokoch Probleme ungeahnten Schwierigkeitsgrades auf. Die örtliche Nahversorgung ist, wenn man von Tiefkühlpizza, Spaghetti und Fertig-Sugo absieht, fast ausschließlich auf die Herstellung von Gebackenem, Gebratenem, Gesurtem und Geselchten ausgerichtet. Und seltsamerweise ist es sogar ein echtes Problem, im Supermarkt am Dorfplatz das zu bekommen, was direkt in den umliegenden Wäldern wächst, Bärlauch zum Beispiel.
Ja, es war in der Tat der Bärlauch, der mich mit Etelka zusammengebracht hat. Als ich beim großen Spar-Markt am Ortsrand von Schattenbach danach fragte, schlug mir ein so ungläubiges Staunen entgegen, als hätte ich mich nach gerösteten Regenwürmern erkundigt. Ich insistierte dennoch darauf, dass es in dieser Gegend um diese Jahreszeit ganz einfach Bärlauch geben müsse. Worauf die missgestimmte Verkäuferin, um mich mitsamt meiner lästigen Fragerei endlich wieder loszuwerden, immerhin den Hinweis parat hatte, ich solle doch bei den Flüchtlingen vorbeischauen, weil die sich von „solchen Sachen“ ernähren würden.
Ich machte mich also furchtlos auf den Weg und fand schon nach kurzer Zeit jemanden, der ausreichend Deutsch verstand, um von mir in ein Fachgespräch über das Sammeln von Kräutern im Allgemeinen und von Bärlauch im Besonderen verwickelt zu werden. Dieser Jemand war Etelka, die ich mit einem kleinen Scheinchen davon überzeugte, dass ich eine ganz ausgezeichnete Anlaufstelle für eine allfällige Sammeltätigkeit abgeben könnte.
Es dauerte auch in der Tat nicht lange, bis sie mit einer riesenhaften Papiertüte, die randvoll mit Bärlauch gefüllt war, bei mir im Museum erschien.
Etelka sprach gut genug deutsch, um mir erzählen zu können, dass sie in ihrer serbischen Heimat als Lehrerin für Russisch und Ungarisch gearbeitet hatte, aber gleichzeitig viel zu schlecht, um hier eine vergleichbare Position anstreben zu können. Sie war mit ihrer Familie schon vor etlichen Jahren über Ungarn, die Heimat ihrer verstorbenen Mutter, geflüchtet und hatte trotz der angeblich geänderten politischen Verhältnisse seither keinen ausreichenden Grund gefunden, die Risken einer Rückkehr auf sich zu nehmen. Also sparte sie lieber eisern, schlug sich mit der Fremdenpolizei herum und hoffte, irgendwann in ein paar Jahren so viel Geld beisammen zu haben, dass sie ein Manikürstudio aufmachen konnte oder vielleicht doch eines Tages gut genug Deutsch sprach, um als Übersetzerin zu arbeiten.
Als Etelka mir dann noch erzählte, dass sie kurz vor ihrer Abschiebung stand, falls sie nicht bald irgendeine Stelle vorweisen konnte, bot ich ihr spontan einen äußerst schlecht bezahlten Halbtagsjob im Heimathaus an. Nach anfänglichem Misstrauen, was ich denn für meine guten Taten von ihr wohl an Gegenleistung verlangen würde, schien Etelka sich bei ihrer Arbeit im Heimathaus allmählich ganz wohl zu fühlen, und ich gewöhnte mir an, wenn ich gerade nichts anderes zu tun hatte (und so gestresst ist man als Kustos eines Heimatmuseums ja nun wirklich nicht), gelegentlich ein halbes Stündchen mit ihr über dies und das zu plaudern. Ihr Deutsch wurde durch diese Konversationsstunden von Tag zu Tag besser.
Dafür verschlechterten sich meine Beziehungen zu Hermine Zidibulk.
*
Wäre es nach Inspektor Loisls Willen gegangen, so hätte er Etelka, nachdem er das Museum im Gefolge des Bürgermeisters betreten hatte, wohl sofort Handschellen angelegt. Er hatte jedenfalls welche mitgebracht und schwang sie mit derselben Feierlichkeit wie der Pfarrer sein Weihrauchfass. Hinter ihm stolperte Bürgermeister Munknast, der noch ein wenig korpulenter war als Loisl, die Treppen hinauf, weswegen die alten Gemäuer des Schiffsmeisterhauses von einem unüberhörbaren Keuchkonzert widerhallten.
Etelka war gerade damit beschäftigt, den Riemenboden im ersten Stock zu bohnern und nahm von uns deshalb außer einem kurzen Aufblicken keinerlei Notiz.
„Grüßen, Etelka“, sagte Loisl herrisch. „Der Bürgermeister stattet dir einen Besuch ab.“
„Er besucht – mich?“ Etelkas Pupillen vergrößerten sich. Sie klang erstaunter, als sie eigentlich hätte sein müssen. Denn dass sich nach dem Madonnendiebstahl die Ortsobrigkeit im Museum einfinden würde, war wohl kaum weiter erstaunlich.
„Wo hast du dich die letzte Nacht aufgehalten, Etelka?“ fragte Loisl, alles andere als gentlemanlike.
„Na, sag schon, wo du warst“, murmelte ihm der Bürgermeister nach, und mir fiel unangenehm auf, dass beide sie duzten. Das tat ich zwar auch, aber im Gegensatz zu Loisl und Munknast duzte sie auch mich.
„Ich war draußen im Flüchtlingsheim, wie immer“, erwiderte Etelka, die inzwischen aufgestanden war und ihren Putzlappen zur Seite gelegt hatte.
„Wie immer?“, fragte Loisl mit einem Hohn in der Stimme, den ich mir nicht ganz zu erklären vermochte.
„Wie meistens“, korrigierte sich Etelka. „Ich habe gestern nicht in Schopperstätte gearbeitet, wenn Sie wissen wollen.“
„Ich meine gar nichts“, sagte Loisl und nestelte erneut an dem silbernen Uhrkettchen in seinem Trachtenwämschen herum. „Ich stelle nur Ermittlungen an.“
„Es treiben sich Kunsträuber in der Gegend herum“, log Loisl dreist drauf los. „Serbische Kunsträuber.“
„Ich kenne keine anderen Serben als in Flüchtlingsheim“, erwiderte Etelka trocken. „Und die verstehen nichts über Kunst.“
„Du leugnest also, etwas mit dem Diebstahl zu tun zu haben?“, fuhr Loisl fort.
Etelka zuckte mit den Achseln. „Wenn Sie glauben, dass ich etwas habe zu tun, werde ich Ihnen wohl nicht von die Gegenteil überzeugen können, oder?“
„Andererseits“, schaltete ich mich Loisl gegenüber ein, „müssen Sie es ihr erst beweisen.“
„Seien Sie ruhig, Flinserl“, herrschte mich der Bürgermeister an. „Mischen Sie sich nicht in eine Amtshandlung ein. Immerhin haben Sie uns das Ganze eingebrockt.“
Inspektor Loisl holte nach dieser Insubordination meinerseits tief Luft und wandte sich abermals Etelka zu.
„Gibt es Zeugen, die bestätigen können, dass Sie die ganze gestrige Nacht im Asylantenheim verbrachten?“
„Natürlich gibt es. Schließlich wohnen wir zu dreien in eine Zimmer.“
„Das ist alles?“
„Was alles? Da sind zwei Zeugen!“
„Schöne Zeugen“, erwiderte Loisl.
„Sie sind Zeugen. Ganz normale Zeugen“, versuchte ich Etelka beizustehen, worauf sich das Gesicht des Bürgermeisters erneut verfinsterte.
„Flinserl!“ zischte Munknast.
„Noch vor einer halben Stunde haben Sie wenigstens Doktor Flinserl zu mir gesagt.“
Munknast packte mich am Arm und zog mich hinüber in jene Seitenkammer, in der die Nachttopfsammlung des Heimathauses untergebracht war.
„Machen Sie sich nicht unglücklich, Herr Doktor“, flüsterte er mir zu. Ich lachte leise, weil mir auffiel, dass der Bürgermeister just neben einem Nachttopf zu stehen kam, auf den ein buntes Gesicht aufgemalt war, das dem seinen gar nicht so unähnlich war.
„Was gibt es da zu lachen? Sie stecken tiefer in der Sache drin, als Ihnen vielleicht bewusst ist. Machen Sie es bloß nicht noch schlimmer, indem Sie Etelka verteidigen. Der Inspektor hat Sie ohnedies schon im Verdacht, dass Sie mit ihr gemeinsame Sache machen.“
„Der Inspektor ist, mit Verlaub, ein Hohlkopf.“
So viel Respektlosigkeit hatte Munknast offenbar nicht einmal mir zugetraut. Sekundenlang rang er nach einer angemessenen Antwort auf diese Amtsehrenbeleidigung, es schien ihm aber keine einzufallen.
„Das haben Sie gesagt“, erwiderte er schließlich.
„Und ich meine es auch so“, beharrte ich trotzig, und über Munknasts Gesicht legten sich tiefe Sorgenfalten.
Auf eine seltsame Weise schien der Bürgermeister dennoch auf meiner Seite zu stehen. Jedenfalls bekam er nicht, wie ich nun fast schon mit Sicherheit erwartet hätte, seinen längst fälligen Tobsuchtsanfall, sondern wurde ganz im Gegenteil wieder ruhig und freundlich.
„Es ist ja auch in Ihrem Interesse“, sagte er, nun wieder in jener umgänglichen Art, die mich vor ein paar Wochen bewogen hatte, diesen Posten trotz mancherlei Einwänden anzunehmen, „wenn wir sie möglichst schnell kriegen.“
Loisl, der sein investigatives Dauerfeuer mittlerweile wegen erwiesener Erfolglosigkeit eingestellt hatte, forderte jetzt nämlich über sein Polizeifunkgerät Verstärkung, sprich: einen Polizeiwagen, an. Und es dauerte für Schattenbacher Verhältnisse nicht einmal lange, bis knapp hintereinander gleich drei Streifenwagen mit Blaulicht und Folgeton vor dem Museum vorfuhren, als gälte es, die gesamte Baader-Meinhof-Gruppe auf einmal festzunehmen.
„Ich sein jetzt verhaftet?“, fragte Etelka und griff intuitiv nach ihrem Lederzöger, in dem sie einen Großteil ihrer weiß Gott geringen Habe stets mit sich herumtrug.
„Sie begleiten uns jedenfalls aufs Revier“, drückte sich Loisl um eine Antwort und verfiel in seiner Unsicherheit plötzlich wieder in ein gestelztes Amtsdeutsch: „Es muss über Ihren Fall ein Protokoll aufgesetzt werden.“
„Muss ich jetzt auch mitgehen?“, fragte ich aufmüpfig, während Etelka von zwei Polizisten aus dem Museum begleitet wurde. Loisl wollte sichtlich schon mit „Ja“ antworten, als er sah, dass der Bürgermeister kopfschüttelnd eine verneinende Grimasse schnitt.
„Das hängt jetzt von den Aussagen der Verdächtigen ab“, erwiderte Loisl, während sein Schnauzbart aufgeregt auf- und abhüpfte. „Aber ich bin sicher, dass Sie unser Revier bald auch von innen kennenlernen werden.“
Ich wollte mit Etelka, bevor sie der konzentrierten ländlichen Staatsgewalt anheimfiel, noch ein paar Worte wechseln, doch Hannes Munknast legte seine Hand auf meine Schulter, und sie ruhte dort schwer wie ein Zentnergewicht.
Etelka wurde von Loisl mit einem nervösen, aber durch die Dienstvorschrift sicherlich voll und ganz abgedeckten Schubsen dazu angehalten, in einen der Streifenwagen zu steigen. Doch bevor sie sich endgültig in den Wagenfond drängen ließ, erhob Etelka noch einmal ihren dunklen Haarschopf, spannte ihren Kopf zurück, und ich konnte trotz einiger Meter Entfernung sehr deutlich sehen, wie ihr Gesicht binnen Sekundenschnelle eine Volte von tiefer Niedergeschlagenheit in ein plötzliches Aufwallen jeglichen in ihr schlummernden Temperaments schlug. „O nein, ich will ja gerne leben“, rief sie mit einem geradezu revolutionären Gestus, den ich noch nicht an ihr kannte. Die zufallende Tür des Streifenwagens verschluckte ihre weiteren Worte. Dann verschwand das Gendarmerieauto sehr schnell in den Schattenbacher Weinbergen, an deren Stöcken schon die ersten Knospen sprossen.
Der Bürgermeister stieg in einen anderen, etwas geräumigeren und vor allem wesentlich teureren Wagen und der Druck des Zentnergewichts war urplötzlich von mir genommen. Auf mich hatte man, so schien es, vergessen. Vorläufig jedenfalls. Ich ließ meinen Blick also abermals über die Weinberge mit ihrem zaghaft sprießenden Grün schweifen. Tatsächlich lugten bereits allenthalben die ersten „Augen“ des neuen Jahrgangs hervor, die man in Schattenbach auch „Gescheine“ nannte. Den ersten blühenden Weinstock würden die Weingärtner der „Muttergottes im Biri“ schenken und eine Marienkapelle mitten im Weingebirge damit schmücken.
Schon wieder eine Madonna, dachte ich.
Ich überlegte kurz, wie wohl der heurige Jahrgang ausfallen würde. Ein Blick ins freundliche Blau des wolkenlosen Frühlingshimmels stimmte mich, was den Wein betraf, ziemlich zuversichtlich. Doch abgesehen vom Wein sprach zur Zeit wenig dafür, dass es ein gutes Jahr werden würde.
2
Genau genommen ist das rein Geistige ebenso undenkbar wie das rein Materielle.
Teilhard de Chardin
In meine kleine Garçonniere im Halbstock über dem Museum zurückgekehrt, ließ ich mich wie entseelt in die alte Chaiselongue fallen, die ich trotz ihres wahrlich schon ziemlich zerschlissenen Bezugs aus dem Fundus im Keller des Heimathauses in meine kleine Wohnung übersiedelt hatte. Mein Auge fiel auf eine Spieluhr aus den Fünfzigerjahren, die ich nicht ausstellen wollte, weil sie nicht wirklich in ein alpenländisches Museum passte, und die mir, vielleicht gerade deshalb, umso besser gefiel. Der Deckel des Gehäuses enthielt eine besonders liebevoll gearbeitete Intarsienarbeit des Schlussbilds aus „Madame Butterfly“, die Cio-Cio-Sans Tod hinter einem Wandschirm aus Reispapier zeigte. Die Melodie erklang erst, nachdem man das Kästchen geöffnet hatte, und verstummte wieder beim Schließen des Deckels. Ich zog also das Uhrwerk auf, lüpfte den Deckel und ließ Puccinis Schicksalsmotiv vor sich hin rotieren, dass das Kastanienholzkästchen nur so surrte. Schon bald erschien es mir in seiner gnadenlosen Wiederholung nicht mehr wie eine Opernmelodie, sondern eher wie ein Stück minimalistischer Musik, und das Leitmotiv setzte sich dank der fast schon schmerzhaften Vibrationen des Kästchens weniger in meinen Ohren als in meinem Steiß fest.
Fast wie in Trance klappte ich das Kästchen nach einer Weile wieder zu und genoss die Stille. Zuletzt aber stellte ich doch wieder das Radio an, und mir war, als hörte ich eine alte Barry-McGuire-Nummer, die mir schon seit mindestens zwei Jahrzehnten nicht mehr zu Ohren gekommen war.
Ich dachte an den wildromantischen Galgenberg, hinter dem sich das leerstehende Gasthaus mit seinen abgenutzten Messingbetten aus Heeresbeständen befand. Und ich fürchtete mit Recht, dass dort – genau in diesen Minuten – vermutlich kein Stein auf dem anderen blieb.
Ich sah beim Fenster hinaus und merkte plötzlich, dass ich mir immer noch nicht schlüssig war, ob ich diese seltsame Landschaft mochte oder nicht. Ackerfurchen folgten auf Obstgärten. Weinberge folgten auf Ackerfurchen. Kellertriften folgten auf Weinberge. Rapsfelder folgten auf Kellertriften, denen wiederum Ackerfurchen folgten, die sanft zum Fluss abfielen. Es war ein seltsamer Raster, der dieses gleichermaßen liebliche wie raue Land strukturierte: Gelb folgte auf Rosa. Grün auf Braun. Schwarz auf Grün. Grau auf Beige. Und das Blau des Himmels folgte auf alles andere. Ich fühlte mich, als wäre ich urplötzlich in ein Gemälde von Mondrian gestürzt.
Im Radio krächzte Barry McGuire weiter sein „Eve of Destruction“, als ich mich entschloss, selbst die Initiative zu ergreifen und mein Kündigungsschreiben aufzusetzen. Doch bevor ich dazu kam, hörte ich, wie draußen vor der dicken Eichenholztür ein Lancia mit hochtourigem Motor vorfuhr und mit ebensolcher Vehemenz bremste. Munknast stieg aus, und obwohl das Museum in all seiner Putzigkeit wie die meisten Häuser im Ort über ein niedliches Messingglöckchen neben dem Eingang verfügte, pochte er mit gefährlichem Nachdruck an die Pforte.
Ich überlegte zunächst, ob ich öffnen oder lieber so tun sollte, als sei ich nicht zuhause, was durchaus glaubhaft war, da ich vorsichtshalber das noch von meinem verstorbenen Vorgänger in fettigen Fraktur-Lettern mit Tusche und Reißbrett angefertigte Schild „Museum heute geschlossen“ an die Türschnalle gehängt und die Türe versperrt hatte.
Munknast gab dennoch nicht auf und versuchte es noch einmal mit Klingeln. Erst als auch das nichts half, machte er kehrt, lief die paar Granitstufen hinab zurück zu seinem Lancia, ließ ihn aufheulen wie einen Boliden und brauste davon. Wie zu erwarten, fand sich dennoch weit und breit kein Gendarm, der ihn aufhielt.