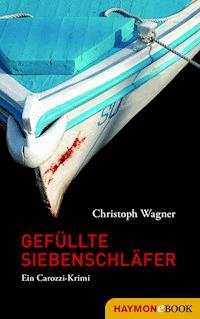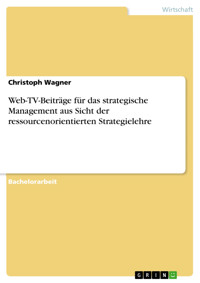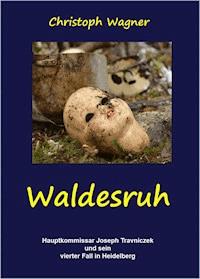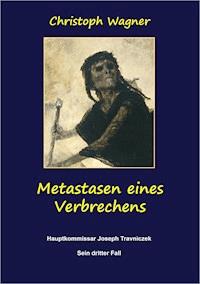Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
EINE WUNDERVOLLE REISE IN DIE WELT DER KULINARIK Christoph Wagner (1954-2010) war ein brillanter Gastrosoph, der mit Bildung, Humor und Stil über die Kultur des Genusses und den Genuss als Kultur geschrieben hat. In seinem letzten großen Werk, "Universität der Genüsse", versammelte Christoph Wagner die Summe seiner Erkenntnisse über die Kunst des Kochens und Genießens. EUROPÄISCHE ESSKULTUR IN EINER SPANNENDEN ZUSAMMENSCHAU In einer eindrucksvollen Zusammenschau zeigt er auf, dass unser Verständnis von Genuss und Geschmack nicht von ungefähr kommt. Im Gegenteil: Wir essen, was wir essen, weil Malerei, Literatur und Musik, Weltpolitik und Geschichte unauslöschliche Genussspuren hinterlassen haben. Nicht selten entpuppt sich guter Geschmack auch als Kind der Marktwirtschaft, und letztlich hat wohl sogar noch der liebe Gott seine Finger mit im Gaumen-Spiel. Immerhin ist er der größte Gourmet unseres Universums. ALLES, WAS MAN ÜBER GENUSS UND GUTEN GESCHMACK WISSEN MUSS Philosophisch-humorvoll begibt er sich auf die Suche nach dem Geschmack Gottes und kommt dabei nicht an melancholischen Genießern, dicken Engeln, Gentechnik und dem Schlaraffenland vorbei. Zugleich ist dieses Meisterwerk der Gastrosophie auch ein unerlässliches Handbuch für jeden, der sich der Kunst des Kochens verschrieben hat: eine inspirierende Reise in die Welt des guten Geschmacks - herausgegeben von Christoph Wagners langjähriger Wegbegleiterin und Co-Autorin Renate Wagner-Wittula. "Alles, was man über das Wesen von Genuss und Geschmack wissen muss. Ein fulminantes Werk! Und selbst die Geschichten sind bei Wagner zum Verschlingen - weil er nämlich ein äußerst unterhaltsamer und kluger Schreiber ist!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Wagner
Universität der Genüsse
Herausgegeben von Renate Wagner-Wittula
Vorwort
Es sollte sein Opus Magnum werden, sein bedeutendstes Werk, eine Vernetzung all jener Themen, die Christoph Wagner sein Leben lang fesselten. Fast 10 Jahre hatte der Gourmet, Vielschreiber und Vorkoster der Nation, wie ihn die Medien gerne bezeichneten, bereits an diesem Projekt gearbeitet. Sein viel zu früher Tod im Juni 2010 ließ ihn sein Werk leider nicht ganz vollenden – aber nahezu. Glücklicherweise ist der Großteil der Manuskripte, Skizzen und Entwürfe erhalten geblieben und konnte somit von mir behutsam zu einem spannenden Exkurs in die Welt der Kulinarik zusammengefügt werden.
Seine Universität der Genüsse war als eine Art Enzyklopädie des guten Geschmacks geplant, eine Anthologie all dessen, was uns dem perfekten Genuss möglichst nahekommen lassen sollte. Ausgehend von theologisch-philosophischen Überlegungen und kulinarischem Grundlagenwissen über die Geschichte des Genießens und detaillierter, aber auch literarisch formulierter Warenkunde bis hin zur Entwicklung einer neuen, besseren Weinsprache wollte Christoph Wagner sein gesamtes Wissen in einem Werk zusammenfassen, als Leitfaden für interessierte Gourmets und Feinschmecker. Praktische Verkostungs-Tipps und eine Vielzahl von Rezepten sowie Kochanleitungen sorgen dafür, dass das Werk nicht nur in der Theorie verortet ist.
Aus dieser Sicht war es mir für mich relativ klar, wie das Buch von mir zu vollenden wäre. Was sich nicht ganz durchgehend beibehalten ließ, war die Grundidee meines Mannes, all sein Wissen und Wollen seinem literarischen Alter Ego Bert Bauch in den Mund zu legen. Die Figur entstammte ursprünglich einer sehr kontroversiellen Kolumne in der Wochenzeitung Salto, in der mein Mann unter dem Pseudonym Bert Bauch all das schrieb, was ihm für konventionelle Medien zu gewagt erschien. Dass er für diese Kunstfigur fortan größte Sympathie hegte, werden auch Leser seines Krimis Siebenschläfer wissen, denen Professor Bartolomeo Belli – eine italienisch-deutsche Verballhornung des Bert Bauch – noch in Erinnerung ist. Daher ist es auch keineswegs störend, dass in der Universität der Genüsse dieser Professor Bert Bauch ganz allmählich mit Christoph Wagner eins wird, mit ihm verschmilzt. Ganz im Gegenteil, mein Mann hätte an diesem kleinen Vexierspiel seine pure Freude gehabt.
Folglich gehen auch die beiden anfangs noch exakt festgelegten Vorlesungsorte Balaor und Lacco Ameno – zwei zwar fiktive, aber doch in der Gegend rund um Grado einerseits und Ischia andererseits auszumachende Sehnsuchtsziele – schleichend in neutrale Örtlichkeiten über, an denen zu den jeweiligen Themen referiert wird. Apropos Themen: Wer sich in der Universität der Genüsse ausschließlich seitenlange Ergüsse über Feinschmeckerprodukte erwartet, wird diese nur zum Teil finden. Texte über Gänseleber und gute Rotweine gibt es freilich auch, keine Frage, aber oft sind es gerade die unkompliziertesten Genüsse, denen am meisten Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Doch zuallererst geht es einmal um die Frage: Was ist Genuss, kann man ihn überhaupt definieren und wie kann man durch ihn tiefere Welteinsichten gewinnen? Genuss nicht nur des momentanen Lustgewinns wegen, sondern als Erkenntnismodell – das sind die Themen, denen in diesem Buch viel Raum gewidmet wird. Wer erkennen will, muss zuvor allerdings auch einiges erlernen. Dazu dienen kurze Abrisse der Entwicklung der europäischen Feinschmeckerei, unserer Tischkultur, eine Geschichte von Messer und Gabel, von Tischsitten und Essgebräuchen. Kurzum: Die gesamte abendländische Esskultur mitsamt ihrer kuriosen Humorallehre darf vor unseren Augen Revue passieren.
Sobald es dann ins Detail, also um die Beschreibung einzelner, exemplarisch hervorgehobener Produkte geht, will Christoph Wagner zeigen, dass es auch andere Wege zu beschreiten gäbe, als man es von konventionellem Food-Journalismus gewöhnt ist. So lässt er beispielsweise anhand eines ausführlichen Textes über den Stilllebenmaler Georg Flegel Essgewohnheiten des frühen 17. Jahrhunderts so lebendig werden, dass man meint, man säße selbst zu Tisch. Andere Lebensmittel werden wiederum literarisch umkreist, von persönlichen Erfahrungen gespiegelt und auf diese Weise beschrieben. Und beim Thema Pilze lässt Christoph Wagner so richtig seine verbalen Muskeln spielen: mythologisch, biologisch, kulinarisch, literarisch – keine Annäherungsweise wird außer Acht gelassen.
Die Auswahl der beschriebenen Lebensmittel und Weine erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern zeigt den journalistischen Fährtensucher, den Abenteuerlustigen. Nicht was glatt und gefällig ist, interessiert. Das Ungehobelte und Außergewöhnliche ist wert beschrieben zu werden, vielleicht auch das grenzenlos Banale, das gerade durch seine Langweiligkeit zum Aufreger wird.
Diese Zugangsweise wird vor allem beim Wein, dem zweiten großen Kapitel des Buches, ganz augenfällig. Nicht die klassische önologische Beschreibung der einzelnen Sorten von Veltliner bis Muskateller steht hier im Vordergrund, sondern der Versuch, Wein aus ganz neuen, anderen Blickwinkeln heraus zu betrachten. Dazu werden wir zunächst in das Reich von Apollo und Dionysos entführt und werden Zeuge, wie diese im mythologischen Zweikampf um die Gunst der Weingenießer kämpften und immer noch kämpfen.
Aber auch rein olfaktorische Analysen des Weingenusses, wie und wo der Duft, das Aroma oder die Dichte der Weine ins Spiel kommen, erweitern das Blickfeld, um schließlich an einer ebenfalls nur exemplarischen Auswahl von Weinen die von Christoph Wagner erfundene und leidenschaftlich favorisierte »neue« Weinsprache anzuwenden. Neu, weil sie tunlichst versucht, gängige Floskeln zu umgehen und stattdessen ungewohnte sprachliche Vergleiche heranzuziehen. Das dionysische Wörterbuch – ein Kompendium unkonventioneller Beschreibungsmethoden für Weine – rundet diesen Weinteil schließlich ab.
Was abgesehen von der fachlichen Kompetenz beeindruckt, ist die Weitsicht, mit der mein Mann aus damaliger Sicht gesellschaftliche Phänomene zu beurteilen verstand. Der Großteil der Texte wurde in den späten 1980er- und 90er-Jahren verfasst, in einer Zeit, als von Genmais oder genetisch veränderten Lebensmitteln – zumindest in den Medien und der breiten Öffentlichkeit – noch keine Rede war. Bereits damals machte er sich Sorgen über die heraufdräuende unheilige Allianz von Lebensmittelproduktion und Technik. Virtuelle oder gesellschaftsverändernde Horrorszenarien bereiteten ihm ernsthafte Angst. Manches davon ist leider mittlerweile eingetreten – das generelle Rauchverbot musste er als Zigarrenliebhaber glücklicherweise nicht mehr miterleben.
Die Zeitbezogenheit mancher Texte sollte allerdings auch dann mitberücksichtigt werden, wenn es um Kritik an gesellschaftlichen oder kulinarischen Zuständen geht, die sich zwischenzeitlich zum Positiven hin verändert haben. Viele der Texte wurden vor dem Beitritt Österreichs zur EU verfasst, in einer Zeit also, in der das Tabakmonopol Zigarrenfreunden noch arg zusetzte, als viele ausländische Produkte in Österreich Seltenheitswert hatten. Heute können wir uns eine Welt ohne türkisches Joghurt, französisches Mineralwasser oder englische Salzbutter kaum mehr vorstellen, aber es gab eine Zeit, in der das einfach nicht so war. Auch dem Thema Fremdenangst und Tischgemeinschaft schenkte mein Mann besonderes Augenmerk. Ob der Siegeszug unserer heutigen Multikultiküche seine damaligen Kritikpunkte alle zum Verschwinden gebracht hat? Ich bin mir nicht sicher – mit Worten sind wir groß, in den Taten mitunter jedoch recht klein.
Aufmerksame Leser werden in den Texten auch zahlreiche Kochanleitungen entdecken. Ganz im Sinne meines Mannes, der Theorie auch immer gerne auf eine praxisbezogene Ebene heruntergebrochen sehen wollte, habe ich diese – soweit sie mit präzisen Mengenangaben versehen waren – zu veritablen Rezepten ausgeschrieben und am Ende des Buches zusammengefasst. Somit sollte die Lektüre des Buches nicht nur geistigen Ansprüchen genügen, sondern auch echtes kulinarisches Vergnügen bereiten. Genuss auf allen Ebenen, ein Zusammenspiel all unserer Sinne!
Ich wünsche eine gleichermaßen genussvolle wie genüssliche Lektüre
Renate Wagner-Wittula
Universität der Genüsse
Oder: Auf der Suche nach dem Geschmack Gottes
Vorlesungen und vermischte Schriften des Professor Bert Bauch, gehalten bzw. ediert an der Università di Santa Maria del Guatto in Balaor und an der Lupfsteinakademie von Lacco Ameno aus den Jahren 1985–2007, nach Tonbandaufzeichnungen und Mitschriften rekonstruiert und neu herausgegeben von Christoph Wagner1
Editorische Vorbemerkung zu Autor und Werk
Bert Bauch wurde 1954 im Niemandsland zwischen Österreich und Ungarn geboren und ist seither staatenlos. Er lebt in Sauris, in über 2000 m Höhe, und arbeitet an einem Standardwerk, welches das Überleben althochdeutscher Dialekte in den Karnischen Alpen zum Thema hat. Seine kulinarischen Essays sind, wie er immer wieder behauptet, Produkte schieren Zufalls.
Prof. Bert Bauch lehrte bis 2007 an der Università di Santa Maria del Guatto in Balaor, wo man ihm einen Lehrstuhl für vergleichende Geschmacksikonographie angeboten hat. Bis vor kurzem hielt er auch eine alljährliche Sommerakademie in Lacco Ameno ab, einem kleinen Ort, an dem der Professor vor allem den direkten Blick auf den Vesuv schätzt, der, wie er überzeugt ist, schon demnächst wieder ausbrechen wird.
Die Universität von Balaor ist die einzige dezentrale Universität der Welt, das heißt jeder ordentliche Professor kann seinen Lehrstuhl aufstellen und unterrichten, wo, wann und wen er will. Bert Bauch beispielsweise pflegt seine Vorlesungen einmal die Woche auf einem seiner beiden Lupfsteine auf Balaor und Lacco Ameno in den Wind zu sprechen. Diese Lupfsteine sind eigenartige Steingebilde im Meer, die wie überdimensionale, mitunter dreimannhohe Altäre aussehen. Dass Lupfsteine, weit mehr noch als das antike Rostrum und die christliche Kanzel, die eigentlichen Ausgangspunkte abendländischer akademischer Bildung sind, ist spätestens seit Rabelais bekannt. In seinem Romanzyklus Gargantua und Pantagruel reißt der junge Pantagruel die Steinplatte für seinen Studiertisch einfach aus dem Felsen Passelourdin und lässt dieselbe für seine Kommilitonen von der Universität von Poitiers auf vier Klötze hieven, damit sie die wichtigste Tugend des Studierenden erlernen können: die Muße. Als einzigen Hörer lässt der Professor nur ein altes Tonbandgerät der Marke Uher zu, das jedes seiner Worte aufzeichnet.
Kopien und (nicht autorisierte) Abschriften dieser Bänder genießen auf vielen italienischen Universitäten Kultstatus, und zwar umso mehr, als der Professor, außer vor einem Jahrzehnt in einer postkommunistischen österreichischen Wochenzeitung namens Salto, noch keine einzige Zeile publiziert hat.
Dass die gegenständliche Veröffentlichung wider jede Gewohnheit des Professors überhaupt realisiert wurde, ist seiner Vorliebe für steirisches Kernöl zu verdanken, die ihn zum österreichischen Kernöl-Papst Reinhold Reiterer führte, der damals Kulturredakteur des Salto war. Dieser ermöglichte nicht nur den Kontakt zum Herausgeber dieser Ausgabe, sondern stellte auch etliche authentische Materialien aus den unvollendet gebliebenen Werken Die rhetorische Wunderkammer, Das Wörterbuch des Wahnsinns und Das poetische Küchenbord zur Verfügung, die ihm der Professor damals zum Abdruck im Magazin Salto überlassen hatte. Reiterer, dem Professor Bauch seine Kleine Kernölphilosophie persönlich widmete, sei an dieser Stelle für seine Kooperationsbereitschaft ganz besonders gedankt.
Jede Erkenntnis hat ihren Geschmack,
ihr Gewicht und ihren Geruch;
wenn wir sie darum bringen,
bleibt nur ein unwirksamer
und schwacher Abglanz übrig.
Nicolás Gómez Dávila
Begrüßung und einführende Bemerkungen über zwei mediterrane Köstlichkeiten
Das vor uns liegende Werk hat sich ein großes Ziel gesetzt, nämlich nichts Geringeres als den Geschmack Gottes zu ergründen. Das bedeutet freilich keineswegs, dass es sich dabei um ein frommes Buch handeln wird, wenngleich, ganz so unfromm ... Na ja, ich verspreche, zumindest in dieser – meiner ersten – Vorlesung kommt Gott nicht vor. Ehe ich nicht erörtert habe, wie man richtig mit Pelati, also geschälten Tomaten aus der Dose, umgeht oder wie man ein ischitanisches Hafenkaninchen zubereitet, will ich die Theologie noch gar nicht strapazieren. Dazu muss man zunächst einmal begriffen haben, dass Gott auch in einer Dose Pelati enthalten ist, und dann wird sich die Frage nach seinem Geschmack wie von selbst stellen.
Nun läge der Schluss nahe, dass man Dosenware tunlichst zu verachten habe, vor allem, wenn man an einer Universität der Genüsse inskribiert ist. Das Gegenteil ist der Fall! Eine der elementaren Maximen des kulinarischen Genusses lautet nämlich: Auch schlechte Nahrung hat ein Recht, gegessen, schlechte Weine haben ein Recht, getrunken zu werden. Erstaunlich, oder? Doch eines steht fest: Nahrung ist, zumindest auf dieser Welt, von vornherein gut, und zwar schon alleine deshalb, weil die Abwesenheit von Nahrung schlecht ist. Es ist also nicht die Nahrung, die schlecht sein kann, sondern nur ihr Nichtvorhandensein. Analog dazu kann auch Wein nicht schlecht sein. Wirklich schlecht kann nur kein Wein sein. Natürlich hat jeder von uns schon einmal sehr gut, ein andermal sehr schlecht gegessen. Einzig und allein durch dieses Vergleichen sind wir in der Lage, zwischen Gut und Schlecht zu differenzieren. Was mich wieder zurück zu meinem elementaren Satz bringt, dass auch schlechte Nahrung und schlechte Weine ein Recht haben, konsumiert zu werden. Ja, ich gehe sogar so weit, dass man als angehender Genießer die Pflicht hat, schlecht zu essen und zu trinken, da man sonst niemals verstünde, gut zu essen und zu trinken.
Nichts gegen Pelati
Aus den Lupfsteinvorlesungen von Balaor über den kulinarischen Mehrgewinn von Dosentomaten
Dass man Dosenware ganz generell zu verachten hat, ist nicht nur unter Gourmets ein gängiger Gemeinplatz, die Verachtung macht auch aus ökologischen und ernährungsphysiologischen Gründen durchaus Sinn. Alleine die Aufzählung der nötigen Konservierungsstoffe führt in ein veritables Horrorkabinett, und dann erst der Geschmack, über den sich bekanntlich streiten lässt ... Nein, in Sachen Konserven lässt sich nicht diskutieren.
Wie alle Regeln kennt aber auch diese ihre Ausnahme. Sie heißt Pelati, stammt gewöhnlich aus Apulien und straft alles, was ich soeben zum Thema Konserven gesagt habe, Lügen. Ich könnte mir jedenfalls ein Leben ohne Pelati fast noch weniger vorstellen als eines ohne fleischliche Genüsse. Wenn ich mir also zwei lange fleischlose Monate vorstelle und wie der erste postcarnale Hunger danach allmählich meine Magensäfte zum Blubbern bringt, so gilt mein erster Gedanke – nein, noch nicht den Pelati, sondern den Spaghetti. Sollte ich jemals dem großen Pythagoras folgen und endgültig ins Lager der Vegetarier überwechseln, so würde ich unweigerlich ein Spaghetti-Vegetarier werden. Gewiss würde es mir anfangs schwerfallen, auf meine geliebte Sauce bolognese mit dem feinen Tritato di carne verzichten zu müssen. Aber immerhin blieben mir ja auch nach dem Weglassen des Ragouts noch Parmesan, Knoblauch, Olivenöl, Basilikum – und natürlich die Tomaten, mit denen mich ein ganz besonderes Naheverhältnis verbindet.
Womit wir wieder bei den Pelati wären. Man kann es drehen und wenden, wie man will, die geschälten Dosenpomodori schmecken einfach besser als das Original. Da mag es am Naschmarkt noch so schöne, saftige und fleischige Tomaten geben (wobei Schönheit bei Tomaten nur bedingt ein Qualitätskriterium ist), da mag man sie noch so liebevoll in siedend heißes Wasser tauchen und sie mit schmerzenden Fingerkuppen enthäuten, da mag man sie sogar, ganz comme il faut, entkernen und einkochen – was immer man damit kocht, es mag zwar köstlich munden, wird dasselbe Gericht jedoch mit Pelati zubereitet, so ist das Ergebnis gleich noch einmal so schmackhaft.
Woran das liegt, weiß ich nicht. Vermutlich an der apulischen Sonne, die mir aus meinen Spaghetti al pomodoro metaphorisch entgegenlacht. Vielleicht ist es auch eine kleine Prise Einbildung, spüre ich doch bereits die Nähe der Gestade Apuliens, sobald ich zum Dosenöffner greife. Es dürstet mich nach apulischem Rotwein, über den die sogenannten Weinkenner gerne die Nase rümpfen (zumindest so lange, bis sie ihre erste Flasche Il Falcone aus dem Castel del Monte Rosso getrunken haben, dann vergeht ihnen rasch das Rümpfen). Ich denke an das Pane pomodoro, ein ungesäuertes, trockenes Brot, das in Olivenöl und zerdrückten Tomaten gebadet wird, bevor man es mit frisch geschrotetem Pfeffer, Salz und etwas Oregano genießt.
Alle diese Assoziationen und das gesunde Gefühl, dass eine 230-Gramm-Dose nur 48 Kalorien, dafür aber fast 60 mg Vitamin C und jede Menge B-Vitamine enthält, haben mich ein nahezu zärtliches Verhältnis zu diesen wunderbaren Dosen entwickeln lassen. Überdies ist ihr optisches Äußeres so viele Lichtjahre abseits jeglichen Zeitgeists gestaltet, dass beim Anblick dieses Designs ähnliche Gefühle in mir wachwerden, wie sie seinerzeit Andy Warhol verspürt haben muss, ehe er sich daranmachte, die Campbell-Suppe in den Zustand der Unsterblichkeit zu versetzen.
Doch zurück zu den Spaghetti al pomodoro. Während ich all diesen – lupenrein vegetarischen – Gedankengängen freien Lauf lasse, entkorke ich also wie in Trance eine der letzten Flaschen Il Falcone, die ich noch im Keller lagern habe, und lasse dem Wein ein wenig Ruhe. (Es könnte auch ein billigerer Wein aus Apulien sein, beispielsweise ein Saraceno aus Lucera oder etwas Preiswertes von der Centrale Cantine; bei Letzterem muss man allerdings damit rechnen, dass solche Weine zu Hause im Norden nicht annähernd so gut schmecken wie auf Urlaub in Bari.) Dann widmet man sich der, wie ich meine, höchst meditativen Tätigkeit des Schälens von drei, noch besser vier Knoblauchzehen und passiert die Pelati durch ein Sieb. Den Saft sollte man nicht weggießen, sondern aufheben, denn er lässt sich auch für andere Gerichte (etwa gefüllte Paprika) weiterverwenden.
Nunmehr wird das Wasser aufgestellt, dem ein Schuss Olivenöl jene gewisse Seifigkeit verleiht, die später die Nudeln zum Rutschen bringt. Mit Olivenöl (ich verwende wegen der zu erwartenden Hitze kein kaltgepresstes) spare ich nicht, wenn ich die geviertelten Knoblauchzehen leicht anröste und sie dann gemeinsam mit den Pelati so lange dünsten lasse, bis sich eine sämige Masse bildet. Meine Mutter meint, jetzt müsse man etwas zuckern, aber Sie wissen ja, wie Mütter so sind, die noch nie in Apulien waren. Ich füge stattdessen ein paar Blätter Basilikum hinzu, salze ganz wenig und kreise ein paarmal mit der Pfeffermühle über dem Topf, den ich jetzt vom Herd nehme.
Inzwischen sind auch die Spaghetti al dente, also schön bissfest, gekocht. Jetzt hat das Extra Vergine, das Olivenöl aus erster Pressung, seinen Auftritt und zaubert das gewisse grünlich golden schimmernde Glanzerl ins Sugo, ohne das ich Spaghetti partout nicht leiden mag. Nun fehlt eigentlich nur noch das Anrichten – und selbstverständlich der frisch geriebene, geraffelte, gehobelte oder sonst wie heruntergeschabte Parmesan, der alles sein darf, nur nicht aus dem Packerl.
Unlängst habe ich dasselbe Rezept übrigens mit frischen Tomaten versucht, mit weniger befriedigendem Resultat. Ich habe also vor dem Servieren noch rasch ein paar Pelati mitschmelzen lassen – und schon war ein Stückchen Apulien mit dabei und die Spaghettiwelt wieder heil.
Lob des ischitanischen Hafenkaninchens
Aus den Lupfsteinvorlesungen der Sommerakademie von Lacco Ameno über eine perfekte Art der Kaninchenzubereitung
Willkommen auf meinem Lupfstein, auf dem heute nahezu Windstille herrscht, weswegen sein Fundament auch nur ganz sanft von den Meereswellen umspült wird. Vor mir verzehrt eine Felsenmöwe gerade mit größtem Appetit eine Schwarzgrundel, aber ich werde ihr die Freude nicht machen, ihr dazu auch noch ein Rezept zu liefern. Dabei ist das Thema meiner heutigen Vorlesung sehr wohl ein Kochrezept, allerdings eines, mit dem eine Möwe vermutlich wenig anzufangen wüsste. Der geneigte Hörer dafür umso mehr.
Das Gericht, um das es in der heutigen Vorlesung geht, ist eine Spezialität der Insel Ischia, die man allerdings auch auf der Nachbarinsel Procida antrifft. Das Coniglio alla cacciatora, wie es auch genannt wird, ist längst ein Klassiker der italienischen, ja der ganzen mediterranen Küche geworden und gehört weder nur den Ischitanern noch den Bewohnern des Golfs von Neapel, die allesamt weitaus weniger gerne Fisch essen, als man allgemein meinen möchte. (Deshalb ist der Kaninchenbraten bis heute ein klassisches Sonntagsessen geblieben.)
Die Bezeichnung alla cacciatora – nach Jägerinnenart – ist irreführend, da die Zeiten, in denen die Jagd nach wilden Kaninchen zu den Lieblingsbeschäftigungen der Inselbewohner zählte, längst vorbei sind. Mittlerweile werden die Kaninchen auf Ischia in den zahlreichen Tuffsteinhöhlen des erloschenen Vulkans Epomeo mehr oder minder freilaufend gezüchtet. Die Inselkaninchen sind zwar keine eigene zoologische Spezies, aber doch kleiner und von wilderem, intensiverem Geschmack sowie etwas dunkler getöntem Fleisch, als man es von den Stallhasen auf dem Festland kennt.
Doch es ist nicht nur der Geschmack, der das ischitanische Kaninchen unverwechselbar macht, es ist sein Umfeld – und vor allem das Meer. Zwar grasen die ischitanischen Kaninchen nicht wie die französischen Pre-Salé-Lämmer auf vom Meer überspülten, saftigen Weiden und haben das Meersalz damit gewissermaßen im Blut, doch atmen auch sie die solehaltige Luft und lecken bei der Nahrungssuche am Vulkangestein, das im Laufe der Jahrtausende ebenfalls den Geschmack von Salzstein angenommen hat.
Da das Kaninchen alla cacciatora in der tönernen Tegame oder der gusseisernen Padella – beides typische italienische flache Kochtöpfe – zudem mit einer weiteren Prise grobem Meersalz in Berührung kommen wird, ziehe ich es vor, nicht einfach vom ischitanischen Kaninchen, sondern, wie mir scheint, wesentlich treffender vom ischitanischen Hafenkaninchen zu sprechen. So schwingt in diesem Namen sowohl die feine, salzige Meeresbrise mit als auch das aus einem alten Vulkansee entstandene Hafenrund von Porto d’Ischia, wo ich vor nunmehr schon weit mehr als drei Jahrzehnten mein erstes derartiges Kaninchen mit damals noch jugendlichem Appetit verspeist habe.
Damit sei keineswegs gesagt, dass mein Hafenkaninchen vor lauter Meereslust nach Fisch schmecken würde! Nun ja, ganz auszuschließen ist es nicht, dass so ein Kaninchen da oder dort einmal neben einer Spigola (Wolfsbarsch) oder einem Korb Muscheln zu liegen käme oder dass die Padella, in der das Kaninchen zubereitet wird, den letzten Fritto Misto noch nicht gänzlich vergessen hat. Dennoch ist das ischitanische Hafenkaninchen ein Gericht der terrestrischen Aromen, eines, das zwischen Himmel und Erde geboren wurde und bei dem das Meer nur als Taufpate zur Verfügung stand.
Ein schöner Taufpate ist mir das, wenn er dann, oft schon kurze Zeit später, wieder als Leichenbeschauer auftaucht, sobald einem seiner Patenkinder der Balg abgezogen wird. Entweder winkt er dann von weitem, am Horizont gerade noch sichtbar als azurblauer Streif tief in die Weinberge hinein. Oder er stimmt mit den Wellen, die rhythmisch an die Hafenmole schlagen, einen Trauermarsch an, sobald eines seiner Taufkinder in der Padella einer einfachen Hafen- oder Strandkneipe landet.
Das Paradiso di Tullio in Ischia Porto beispielsweise ist eine solche Kneipe, in der Tullios Mamma ein besonders glückliches Händchen für die Feinabstimmung jener ganz wenigen Aromen beweist, die darüber entscheiden, ob das Kaninchen einfach ein geschmortes Kaninchen oder zu einem ischitanischen Hafenkaninchen wird. Auch im Lo Sfizicò, wo in einer eher finsteren Pinte am Fährhafen von Procida ein äußerst vertrauenerweckender Zweizentnermann in Kochmontur Hand an den Hasen legt. Beide Lokalitäten kennt übrigens kein Mensch, zumindest niemand, der mir bekannt ist, und auch in den Almanachen der Feinzüngigen wird man sie vergeblich suchen. Sie zählen zu jener raren Art von Gaststätten, die nicht von Gästen ausgesucht werden, sondern die sich ihre Gäste lieber selbst aussuchen. Deswegen tarnen sie sich lieber hinter schmutzigen Plastiksesseln und klebrigen Tischtüchern, bevor sie auf jemanden attraktiv wirken könnten, den sie nicht mögen. Andererseits verstehen sie es, ihre Gäste durch schlechte Ölgemälde, finstere Blicke, abgesplitterte Weinkrüge, verstaubte Schiffsmodelle und rätselhafte Wohlgerüche aus unvermuteten Ecken geradezu magisch in ihren Bann zu ziehen.
Beide erwähnte Lokale haben unter anderem auch gemeinsam, dass man nicht einfach hineingehen und ein Hafenkaninchen bestellen kann. Bei Tullio steht es nicht einmal auf der Speisekarte, die ohnedies eher eine Imbiss- und Barkarte ist. Die Karte des Lo Sfizicò listet Kaninchen zwar auf, allerdings denkt hier niemand daran, es auch tatsächlich zu servieren.
Man sollte sich also nicht von Lokalitäten täuschen oder blenden lassen, die einem vorgaukeln, man könnte ein ischitanisches Hafenkaninchen so einfach, mir nichts, dir nichts, bestellen und es eine Viertelstunde später auch schon am Tisch stehen haben. Gewiss: Es gibt solche Lokale. Aber ebenso gewiss ist, dass das Kaninchen kein ischitanisches Hafenkaninchen sein wird. Ein solches ist nämlich, wie ich schon angedeutet habe, ein Sonntagsgericht, und es ist eben nicht alle Tage Sonntag.
Doch gemach, gemach! Wir befinden uns ja im Golf von Neapel, wo zwar auch nicht alle Tage Sonntag ist, aber viele Menschen der Meinung sind, dass alle Tage, wenn man es nur richtig anstellt, Sonntag sein könnte. Deshalb kann es ischitanisches Hafenkaninchen selbstverständlich auch montags, donnerstags oder freitags geben. Allerdings nur mit entsprechender Vorbereitungszeit. Es lässt sich nämlich trefflich darüber disputieren, ob man das Kaninchen eine Stunde, einen Tag, eine Nacht oder überhaupt nicht marinieren sollte. Nun ist es aber an der Zeit, das eigentliche und wahre Geheimnis dieses Gerichts zu lüften, das beim ersten Hinhören etwas verblüffen wird: Das Kaninchen selbst tut bei diesem Gericht kaum etwas zur Sache, sondern spielt allenfalls eine Nebenrolle. Es geht vorwiegend um die Sauce, die man daraus zieht. Und bei dieser handelt es sich wiederum um keine wirkliche Sauce, da sie vor dem Servieren nahezu jeglicher Flüssigkeit beraubt wird.
Wenn also weder das Kaninchen noch die Sauce Hauptdarsteller ist, wer dann? Es ist der aromatische Ölrückstand, der in der Pfanne bleibt und der am Schluss, sobald das Kaninchen bis auf den letzten Rest (bei dem es sich gewöhnlich um den Kopf mit der Zunge, dem Hirn und dem Backenfleisch handelt) aufgeputzt und abgenagt ist, in großen, kreisenden Bewegungen mit einem ausreichend großen Stück außen knusprigen und innen flaumigen Fladenbrotes aufgetunkt wird.
Doch noch sind wir nicht so weit! Erst müssen wir uns mit den Präliminarien abgeben. Man sollte das ischitanische Hafenkaninchen also mindestens einen oder besser zwei Tage im Voraus bestellen. Im Lo Sfizicò mag das, wie bei einigen anderen Insellokalen, reichen. Bei Tullio wird es hingegen noch ein wenig komplizierter. Er muss dich mögen, damit er seine Mamma bittet, dieses Gericht zuzubereiten. Und erst, wenn dich auch seine Mamma mag, dann schreitet sie zur Tat. Es bedarf also etlicher, sogar emotionaler Investitionen, um an diese kulinarische Verheißung zu gelangen. Mit ihrem Rezept möchte ich auch beginnen, bevor ich dann zu den zahlreichen Ableitungen komme.
Selbstverständlich verrät die Mamma ihr Rezept niemandem, auch mir nicht, und ich kann daher nur mutmaßen, wie sie es macht: Zunächst einmal, das hat mir Sohn Tullio erzählt, bringt sie etliche Stunden damit zu, das Kaninchen auszuwählen. Sie sucht zu diesem Zweck ihren Schwager auf, der in den Weinbergen an den Hängen des Epomeo eine kleine Schänke führt, in deren Tuffsteinkeller neben etlichen alten Fässern auch ein paar Kaninchenstallungen untergebracht sind. Dort hält sie Zwiesprache mit etlichen Kandidaten. Im Zweifelsfall wählt sie nicht das größere und fleischigere, sondern das kleinere, saftigere Kaninchen aus und lässt es von ihrem Schwager mit einem schnellen Stich töten und ihm anschließend den Balg abziehen. Früher habe sie diese Arbeit, meint Tullio, auch selber getan, doch mittlerweile sei sie schon zu alt dafür, zumindest solange es Jüngere gebe, die ihr die Arbeit abnehmen könnten. Wichtig ist nur, dass die Köchin das Kaninchen selbst auswählt und anwesend ist, während es getötet wird. Dazu betet sie ein Vaterunser und ein Ave-Maria. So wird das Kaninchen zum Opfer, das man dem Herrn bringt. Würde sie ein bereits getötetes Kaninchen einfach im Geschäft kaufen, so hätte man das Opfer ausgelassen, meint sie, und das brächte wenig Gutes.
Was die Zubereitung betrifft, so ist die Signora eine Traditionalistin. Also legt sie das von ihr auserwählte Kaninchen, nachdem sie die Innereien entfernt und es in mindestens fünfzehn Stücke gehackt hat, über Nacht in einen halben Liter weißen Epomeowein ein. Das ist üblicherweise ein Biancolella, und er hat ebenso üblicherweise einen leichten Essigstich, weshalb viele ischitanische Frauen es der Einfachheit und Sparsamkeit halber vorziehen, das Kaninchen lieber gleich in Essigwasser einzulegen. Solange man dabei nicht allzu viel Essig erwischt, erzielt das einen durchaus ähnlichen Effekt.
Noch wichtiger als die richtige Bemessung des Essigs ist jedoch jene des Öls. Es darf auf keinen Fall zu wenig sein! Für ein Kaninchen benötigt Tullios Mamma zwei Deziliter davon, was Nichtitalienern und Diätassistentinnen ziemlich viel vorkommen mag. Selbstverständlich kann man die Dosis auch auf zwei, drei Esslöffel reduzieren, aber glauben Sie mir, das ischitanische Hafenkaninchen verzeiht derlei Eigenmächtigkeit nicht und rächt sich, indem es zum ganz normalen Alltagskaninchen mutiert. Ist also das ausreichende Quantum Öl erst einmal gut erhitzt, kommen Zwiebeln, Knoblauchzehen, Peperoncini und Meersalz dazu. Wie viel davon, das wissen nur die Götter. Tullios Mamma weiß es auch nicht, oder sie sagt es nicht. Sie hat das richtige Gespür dafür. Ich habe dieses Gespür mittlerweile auch entwickelt und nehme, je nach Laune und Zwiebelgröße, eine mittlere oder zwei kleinere Zwiebeln, drei bis vier Knoblauchzehen und einen großzügigen Kaffeelöffel Peperoncini (was sicher mehr ist als bei Tullios Mamma, aber ich mag es scharf). Was den Knoblauch betrifft, so möchte ich meinen Hörern die Übung des Signore Ciglio aus Barano d’Ischia nicht vorenthalten, mit den Kaninchenstücken eine ganze, mit dem Messer in zwei Teile geschnittene Knoblauchknolle mitzubraten und diese erst kurz vor dem Servieren zu entfernen. In diesem Falle, aber nur in diesem, freut sich das ischitanische Hafenkaninchen auch über die Begleitung eines Rosmarinzweigleins, das vor dem Servieren ebenfalls entfernt wird.
Die Phase, in der wir jetzt halten, ist jene, die für das Aroma des Gerichts schlussendlich die entscheidende sein wird. Entsprechend vielfältig sind auch die möglichen Schritte, die zu diesem Ziel führen können. So gibt es etwa eine von einem leider etwas touristischen Berglokal am Fuße des Epomeo hochgehaltene Schule, der zufolge mit dem Knoblauch und den Zwiebeln auch Schinkenfett mitgeröstet werden soll, was den Geschmack des fertigen Kaninchens durchaus nicht beeinträchtigt, aber doch wesentlich verändert.
Sobald die Kaninchenstücke (für eine gehaltvolle Sauce sollten die Rückenstücke, sagt Tullio, keinesfalls breiter als anderthalb Zentimeter dick geschnitten sein) dann rundum wie ein Kirchendach in der Sonne glänzen, kommt der Epomeowein ins Spiel. Da es sich, wie bereits mehrfach betont, um ein Sonntagsgericht handelt, sollte es nicht derselbe Wein sein, in dem das Kaninchen auch mariniert wurde. Es bedarf allerdings auch keineswegs eines Weines von besonders hoher Qualität. Fruttato, wie die Ischitaner sagen, sollte er halt sein, trocken und von angenehm erdigem Aroma.
Der Wein, es wird sich aller Erfahrung nach um etwa einen Viertelliter handeln, wird sich nicht lange in der Pfanne aufhalten, denn er muss von den Zwiebeln aufgenommen werden. Erst wenn er verdampft ist, kommen die Pomodori passati dazu, eine Dose geschälter und passierter Tomaten. Tullios Mamma verwendet keine dieser Konserven, sondern stellt sie Jahr für Jahr selbst her, nämlich dann, wenn die ischitanischen Tomaten am hellsten leuchten, am fruchtigsten schmecken und obendrein am billigsten sind. Wer keine solche selbstgemachte Conserva zur Verfügung hat, der verwendet am besten eine Dose fein gehackter Pelati, über deren Vorzüge ich mich ja bereits geäußert habe.
Sobald die Tomaten leise simmern, würzt Tullios Mamma noch mit Thymian und Majoran nach. Es gibt auch ischitanische Köchinnen, die stattdessen reichlich Petersilie oder Basilikum, meist nur grob gerissen, mitdünsten, was der allmählich entstehenden Sauce nicht nur zusätzlichen Geschmack, sondern auch Farbe gibt. In diesem Zusammenhang verdient übrigens auch die procidanische Sitte, das Kaninchen mit Wein und geriebener Limettenschale anzusetzen und statt der üblichen Kräuter mit Minze zu aromatisieren, eine gebührende Erwähnung.
Nun erst beginnt der lange Marsch des Kaninchens durch die Sauce. Es bedarf dazu keines Deckels, aber dafür ständigen Wendens und leisen Schmorens im Rohr oder am Rande der Feuerstelle, bis – nach etwa zwei Stunden und gelegentlichem Nachgießen eines Löffelchens Wasser oder Suppe – jener Zustand erreicht ist, in dem das Kaninchen so zart ist, dass sich sein Fleisch fast mit der Zunge am Gaumen zerdrücken lässt, und das Öl alle animalische und vegetabile Kraft der ischitanischen Vulkanerde in sich aufgesogen hat.
Es wird Ihnen sicher nicht leichtfallen, diesen paradiesischen Zustand schon beim ersten Versuch, dieses Gericht zuzubereiten, zu erreichen. Vor allem da man selten alle beschriebenen Aromen – vom Tuffstein über das Meersalz bis zu den Fleischtomaten – in einer Padella vereinigen wird können. Haben wir hingegen zumindest einen Annäherungsversuch geschafft und ziehen das knusprige Brot in kleinen Kreisen durchs Öl, so offenbart sich, dass uns Gott, der ja nicht nur die Kaninchen, die Tomaten und das Öl, sondern auch uns erschaffen hat, uns in diesem Moment als Tischgenosse Gesellschaft leistet.
Vom Wesen des Genießers
Über die Verknüpfung von Genuss und Sündenfall
Der Geschmack Gottes oder: Ist Gott Gourmet?
Aus der Rhetorischen Wunderkammer
Seit jeher beschäftigt mich die Frage, ob es möglich sei, das Wesen von Gottes Schöpfung zu erkennen, indem man sie aufisst. Die Frage ließe sich freilich auch noch weiter ausführen: Ist es möglich, Gott, indem man seine Welt anknabbert und deren Geschmack ergründet, zu demaskieren und somit auch den Geschmack Gottes zu erforschen?
Für mich ist die Antwort ganz klar: Um an Gott und seiner Schöpfung Geschmack zu finden, muss man zunächst einmal wissen, was Gott schmeckt. Nur wer Gottes Geschmack kennt, kann ihm und seiner Schöpfung auf die Schliche kommen. Aber wer weiß schon, ob er danach an Gott und seiner Schöpfung auch noch wirklich Geschmack findet?
Gott weiß das natürlich auch. Und deswegen hat er wohlweislich das Seine dazu getan, um seinen Geschmack in den Schriften des Alten Testaments gründlich zu verschlüsseln. Dabei hat er ganz klare Speisengebote dekretiert. Doch lassen diese Anweisungen Rückschlüsse auf seinen Geschmack zu, oder wollen sie nur einfach befolgt sein?
Nun gut. Versuchen wir’s einmal:
These 1: Gott liebt das Fleisch.
Dabei könnte man aus dem Studium der Genesis gerade die gegenteilige Erkenntnis gewinnen, denn das Paradies ist vegetarisch. Alles, was darin wächst, also alles Vegetarische, gestattet Jahwe seinen Geschöpfen Adam und Eva zu essen. Nur die Früchte vom Baum der Erkenntnis, an denen offenbar auch die Schlange interessiert ist, sind Adam und Eva verboten. Die Frage, ob es sich dabei um einen Apfel, eine Mandarine, einen Paradiesapfel oder einen Pfirsich gehandelt hat, scheint daher müßig. Selbstverständlich handelte es sich bei den Früchten des Baumes der Erkenntnis um nichts Vegetarisches, sondern um Fleisch. Gott aß es gerne, und er wollte nicht, dass man es ihm wegaß, also verbot er es. Am Baum der Erkenntnis hingen also Würste, Schinkenkeulen, Saumaisen und Rippenspeere. So einfach war das. Und Gott fand Gefallen daran.
These 2: Gott liebt den Wein.
Vom Wein ist im Paradies nicht die Rede. Erst nach der Sintflut, als die Menschen auch Fleisch essen dürfen, ist er plötzlich da und beschert Noah, der ihn noch nicht kennt, fürs Erste einmal einen gehörigen Rausch. Dazwischen liegt die Verkündigung der Speisegebote Jahwes, die ausdrückliche Erlaubnis, Fleisch zu essen: »Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen« (1. Mos 9,3) – zweifellos eine Geste der Milde, eine Konzession an die nunmehr, nach Sündenfall und Sintflut, bereits zum zweiten Mal bestrafte Menschheit. Dass dieses Zugeständnis zeitgleich mit dem ersten Auftreten des Weinstocks in der Bibel erfolgt, mag ein Zufall sein: In jedem Fall gönnte Jahwe Noah ausdrücklich den Braten – und schenkte ihm den Wein dazu. Aus dem himmlischen Paradies war endgültig das irdische geworden, mit allen Gefahren, die dieses auch bergen mochte. Die Frage ist lediglich, was dazu führte.
These 3: Gott liebt die Sünde.
Genau das ist die einzig mögliche Antwort auf obige Frage. Gott, der, von Anfang an seiend, gewissermaßen naturgemäß das Gute und das Böse in sich vereint, schuf sich – ob aus Langeweile, Experimentierlust oder Bosheit, wissen wir bis heute nicht – den Menschen nach seinem Bilde. Selbstverständlich war sich Gott dabei bewusst, dass in ihm und daher auch in diesem Bilde Gutes wie Böses enthalten war. Aus einem uns, trotz aller theologisch-philosophischer Aufarbeitung, ebenfalls bis heute noch nicht bekannten Grund setzte Gott sich aber, zumindest anfangs, in den Kopf, dass die von ihm geschaffenen Menschen nur den guten Teil seines Wesens erben sollten, obwohl er genau wusste, dass auch sein schlechter Kern in ihnen schlummerte. Um den nicht zu wecken, gab Gott den Menschen Vorschriften. Er versuchte sie, so gut er konnte, zum Vegetarismus anzuhalten, und er hielt den Wein und damit den Rausch von ihnen fern. Doch genau das klappte nicht. Das vorgeprägte Böse in Adam und Eva ließ sich nicht so leicht hintanhalten, ebenso wenig wie offenbar der finstere Teil in Gott selbst, der sich flugs in eine Schlange verwandelte und das Unternehmen Gutmensch von vornherein zum Scheitern brachte. Gott musste also, ob er wollte oder nicht, mit den von ihm geschaffenen Menschen in weiterer Folge das Fleisch, den Wein und die Sünde teilen.
These 4: Was Gott noch alles liebt.
So ganz und gar wollte Gott aber mit den Menschen, die er ja nicht nur als seine Geschöpfe, sondern auch als seine Untergebenen empfand, dann wieder doch nicht gemeinsame Sache machen: Also ächtete er die Sünde ganz im Allgemeinen, legte dem Weingenuss gewisse Regeln des Maßhaltens auf, indem er den nackten Noah gleich einmal zum Gespött seiner Söhne machte, und er verbot dem Menschen schlichtweg den Genuss all seiner Lieblingsspeisen. Eine andere kausale Logik für die mosaischen Speisegebote lässt sich nämlich beim besten Willen nicht finden, obwohl Theologen, Judaisten, Ethnologen und Ernährungswissenschaftler sich an diesem Thema – weiß Gott! – die Zähne ausgebissen haben. Es mag banal klingen, doch wir können davon ausgehen, dass Gott, was er als rein bezeichnete, nicht besonders mochte, während das, was er unrein nannte, seinem Geschmack entsprach. Auf diese Weise erschließt sich durch den Geschmack Gottes plötzlich ein Menü der verbotenen Genüsse: gefülltes Kamel, Dachsbraten, gebratener Aal, Drachenkopf, Forellen, Saiblinge, alle Krusten- und Schaltiere vom Flusskrebs über den Hummer bis zur Languste, Rabenragout, Heuschrecken, die feinen Geckos, Eidechsen, Salamander und so manches andere, wofür wahre Feinschmecker gewohnt sind, von weit her anzureisen.
These 5: Gott ist Gourmet.
Ob Gott Designer ist, das mögen andere beurteilen, und es ist mir, ehrlich gesagt, auch nicht so wichtig. Nach der vorangegangenen kleinen Beweisführung wage ich jedoch zu behaupten: Gott ist Gourmet.
Wechselwirkung von Souveränität und Maßlosigkeit
Von der Askese, dem Rausch und der Macht
Aus den Lupfsteinvorlesungen von Balaor
Sage keiner, er kenne keine Allmachtsphantasien! Ich kenne sie auch, speziell, wenn ich auf meinem Regiestuhl in der Mitte des Lupfsteins sitze, meinen Blick über das Meer schweifen und die Wolken vorbeidefilieren lasse. Soeben ließ ich zwei davon, während ich an meinem Malvasia nippte, wie zwei Tanker zusammenstoßen, und wer weiß, vielleicht hätte es nur eines Fingerschnippens bedurft, und die Welt, mit allem, was darauf steht, wäre implodiert. Ich natürlich mit ihr. Aber ich denke, es wäre den Spaß wert gewesen Denn Spaß ist das halbe Leben und oft mehr wert als das! Besser ein ganzer Spaß und nur ein halbes Leben als umgekehrt.
Dieser Gedanke kam mir, als ich gestern zu mitternächtlicher Stunde in eine TV-Diskussion über Exzess und Askese stolperte. Um diese Zeit sind Philosophen, zumindest meiner Erfahrung nach, selten so verschlafen, wie sie es in diesem Falle waren. Den Augenringen und der Allgemeinverfassung der Diskutanten zufolge muss die Sendung wohl in den Morgenstunden aufgenommen worden sein. Wie auch immer – bevor dem letzten der Philosophen seine noch so müden Lider zufielen, einigte sich die Runde schließlich darauf, dass Exzess zur Selbstzerstörung führe. Wohin die von der Runde allgemein favorisierte Askese führen sollte, darüber wurde keine Einigung erzielt. Man attestierte der Askese zwar, ein ins Gegenteil verkehrter Exzess zu sein (und damit ebenfalls Lust zu bereiten), warum man sich darauf einlassen sollte, wusste allerdings keiner so recht zu beantworten. Dem standen die Müdigkeit der Teilnehmer und die begrenzte Sendezeit entgegen, vor allem aber auch die Vernunft.
Es gilt nämlich unter vernunftbegabten Genießern seit jeher die Weisheit, dass Genuss stets maßvoll sein müsse, ja sogar in der bewussten Restriktion liege. Genuss sei sparsam und selbstgenügsam, er erfordere Langsamkeit, Kontemplation und Beschränkung auf das Wesentliche. Genuss, jeden Tag genossen, sei dem Genießen so abträglich wie täglicher Koitus dem Eheleben.
Diese Grundhaltung bewährt sich auch in der Praxis: In Weinbruder- und Ritterschaften zieht Trunkenheit (zumindest der Papierform nach) den sofortigen Ausschluss nach sich. Auch wer sich als Gourmet begreift, leitet seine moralische Daseinsberechtigung gerne von der Abgrenzung zum Gourmand, dem Vielfraß, ab: hie der reduzierte Genuss, die kleine Portion, die kurze Sauce, das filigrane Medaillon, die schmale Tranche – dort der opulent beladene Vorlegeteller, die wohlgefüllte Saucière, das ganze Bratenstück, die von der Kruste erdrückte Pastete, das weit über seine Form hinaus wachsende Soufflé. Die Gourmets der Askese pflegen die meist wohlbeleibten Gourmands des Überflusses daher aus gutem Grund zu verachten, weil sie ihnen einen Mangel an Selbstbeherrschung und Contenance unterstellen.
Der vollkommene Feinschmecker ist, so paradox es klingen mag, ein Asket, ja ein Puritaner viktorianischer Prägung. Er verfügt über einen klassenspezifischen Instinkt für Distinktion. Seine Haltung dem Genuss gegenüber ist insofern eine Haltung, als sie Verhalten ist, nämlich anerzogenes und gelerntes Kulturverhalten. Die Liebe zum Genuss entspringt zuvörderst der Angst vor dem Genuss, die eine distinguierte Verachtung für alles Rohe, Ungeschlachte, Unharmonische und zu massig Geratene zur Folge hat.
Zu genießen zu verstehen ist eine Tugend von Edelleuten, ein Weltverständnis, das sich seit den Zeiten der höfischen Kultur des Mittelalters die Maße einzuhalten verpflichtet. Denn Aristokratie ist nicht nur ein Adel der Geburt und/oder des Geldes, sondern auch einer des guten Geschmacks.
Nur wer Asket ist, kann auch Geld machen und Erfolg haben. Die Früchte des Kapitalismus sind nicht erst seit Max Weber Belohnung für Verzicht und Entsagung. Zumindest sagen das jene, die Geld machen, jenen, die für sie arbeiten. Askese ist nicht zufällig ein Begriff aus der Soldatensprache. Nur wer tätig und enthaltsam ist, vermag im Bedarfsfall auch zu überleben und Beute zu raffen. Wer ohne Tätigkeit und Enthaltsamkeit rafft, ist ein Parvenü und im System nicht vorgesehen. Wie er auch in der Religion nicht vorgesehen ist. Dabei ist der Parvenü der gottähnlichste unter den Erdenbewohnern, weil er das Maß an Gott und nicht am Zustand der Welt nimmt.
In einer Gesellschaft freilich, die nicht an Gott, sondern am gesellschaftlichen Verhalten einer bestimmten Schicht Maß nimmt, bekommt das Maßhalten eine neue Bedeutung. Ob Pfarrer, Militärspieß, Landtagsabgeordneter oder Chef: Alle werden sich einig sein, dass Maß zu halten ist, wenn es um den Genuss der Welt- und Gottesfrüchte geht. Das Übermaß ist, wenn überhaupt jemandem, ihnen selbst und allenfalls dem Offizierscasino vorbehalten.
Wenn nun das Maß den Genuss bestimmt, wer oder was bestimmt dann die Maßlosigkeit?
Maßlosigkeit ist zunächst einmal Selbstbestimmung und Souveränität. Der maßvolle Mensch ist fremdbestimmt, letztlich immer nur Satellit, während der maßlose Mensch Zentrum ist, in seiner Mitte ruht. Der maßlose Mensch kann Alexander oder Diogenes sein, über die Affinität beider ist genug geschrieben und gerätselt worden. Die Maßlosigkeit erfordert Unabhängigkeit von der Materie, erfordert Macht oder Machtverzicht. Dazwischen liegt das breite Band der zivilisatorischen Schichten. Das Kleinbürgertum kennt seine Maße ebenso wie die Oligarchie, Souveränität kennen weder die einen noch die anderen, marionettenhaft tänzeln sie an den Fäden der Konvention, unterschiedlich sind nur Länge und Durchmesser der einzelnen Fäden. Wo Maßhalten zum Gemeinsinn wird, da wird Askese zur Anpassung und damit das genaue Gegenteil ihrer ursprünglichen theologischen Intention, nämlich sich an Gott zu reiben.
Wie es also eine kastenartig abgestufte Hierarchie der Genießer gibt, so gibt es auch eine der genossenen Speisen. Der paradiesischen Unterscheidung in essbare und nichtessbare Materie folgte nach der Sintflut die Unterscheidbarkeit der essbaren Materie entsprechend der Gebote und Konventionen. Man schied erlaubte von verbotenen, Alltags- von Festtagsspeisen, man ordnete spezielle Speisen einzelnen Wochentagen zu (Knödeltag, Nudeltag, Fischtag, Fleischtag), man begann, billige von teuren Produkten auseinanderzuhalten, und vor allem kristallisierte sich eine einfache Küche für die einfachen Leute und eine feine Küche für die feinen Leute heraus.
Warum ist Kaviar etwas grundsätzlich anderes als Schweinshaxln? Warum ist Steinbutt etwas Besseres als Dorsch? Warum ist eine Hummerfrikadelle Luxus und ein faschiertes Laibchen Alltagskost? Ist vielleicht alles nur ein Problem der Semantik? Bräuchte man die Speisen nur anders zu benennen und sie wären in ihren sozialen Konnotationen austauschbar?
Gourmets werden sagen: Hummer schmeckt einfach feiner als Hering. Allein: Die Entwicklung der Speisekarten belehrt sie eines Besseren. Hering, früher ein Armeleuteessen, gilt heute längst als teure Delikatesse. Der Seeteufel, noch vor gar nicht so langer Zeit als Hummer des armen Mannes geschmäht, ist, seit die Meere zunehmend leergefischt sind, teurer als Hummer.
Der sogenannte Geschmack entpuppt sich als Kind der Marktwirtschaft. Im Mittelalter gab es Gewürze nur an Fürstenhöfen. Heute, da sie preisgünstig und für jeden erreichbar sind, gehen die Supermarktregale über davon. Das Menschenrecht auf Teilnahme an der Fülle des Geschaffenen ist auf ein Bündel von Anteilsscheinen geschrumpft, von denen die einen mehr und die anderen weniger haben.
Das Gesetz von Angebot und Nachfrage regelt den Geschmack viel nachhaltiger als noch so fein ausgebildete Geschmackspapillen. Und als distinguiert oder geschmackvoll können wir getrost jeden bezeichnen, der den Kanon der unterscheidbaren Genüsse so weit verinnerlicht hat, dass er zu wählen, aber auch sich zu enthalten versteht. Er ist ein Mensch, der sich, wie man sagt, im Griff hat, was freilich bedeutet, dass das, was man die Gesellschaft nennt, ihn im Griff hat, indem sie ihm ihre Codices als scheinbar eigenständiges Verhalten mit Erfolg aufgezwungen hat.
Das Maßhalten nagt an der Souveränität der eigenen Entscheidung. Am Anfang, als es noch nichts zu entscheiden gab, da war Gott, und da war auch die Maßlosigkeit. Erst als Angebot und Nachfrage die Entscheidungen zunehmend bestimmten, wurde das Maßhalten zur Notwendigkeit und der Genuss zu seinem geschminkten und aufgeputzten Alter Ego.
Gott kennt seiner Natur nach die Notwendigkeit des Maßhaltens nicht; also werden wir den Geschmack Gottes, so wir ihm denn tatsächlich auf der Spur sein sollten, nur in jener rauschhaften Maßlosigkeit finden, die – wie manche von uns wissen – auch durch den Rausch der Askese zu erreichen ist. Denn wie die Maßlosigkeit ist auch das radikale Maßhalten ein Weg, um sich den Zwängen einer verachteten Welt zu entheben und die Erlösung in Gott selbst zu suchen. Der Weg des Asketen Jochanaan und jener der bekennenden Hedonistin Salome führen über den beiden gemeinsamen Rausch des Todes direkt zu Gott. Das haben auch die Katharer erkannt, deren Religion radikale Enthaltsamkeit und ebensolche Promiskuität als zwei Aspekte des nämlichen Seins erkannte, bevor sie selbstverloren ihr und ihrer Kinder Blut vergoss. Und kaum jemand hat die Äquivalenz beider Räusche schöner formuliert als Teresa von Ávila, die da meinte: »Wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten, dann Fasten.«
Gott, dem die Macht bleibt, lacht zu beidem.
Zwei Nachträge über den göttlichen und den menschlichen Geschmack
Von dicken Engeln und schönen Teufeln
Die Engel sind die Geschmacksträger Gottes. Darum sind manche unter ihnen auch so fett. Die vollkommene Schönheit und die vollendete Harmonie sind keine Vorspiegelungen des Teufels, sie sind vielmehr der Teufel selbst, mindestens jedoch eines jener Gesichter, in denen er sich am liebsten zeigt, weil ihm die Gefahr, erkannt zu werden, da am geringsten zu sein scheint.
Vollendete Harmonie und Schönheit stehen freilich Gott allein zu, und jedes Trachten eines minderen Prinzips oder einer minderen Kreatur danach, bedeutet, Gott herauszufordern. Somit sind Satan und sein luziferisches Heer der Schönen und Ebenmäßigen auch nichts anderes als eine ständige Herausforderung Gottes.
Letztlich steht also nur Gott der vollendete Geschmack zu, und alles andere wäre Gotteslästerung. Uns ist es, da gottähnlich, wenn auch keineswegs gottgleich, aber erlaubt, Annäherungswerte an den Geschmack Gottes zu erzielen und an seinem absoluten Gaumen teilzuhaben, was im esoterischen wie im exoterischen Sinne ein Akt der Kommunion ist. Dies ist eine tröstliche, aber keineswegs herrliche oder erfüllende Wahrheit, weil sie einschränkend ist und damit dem Prinzip der Maßlosigkeit widerspricht. Das Prinzip der Maßlosigkeit vertritt indessen Luzifer, der Souveräne (und für seine Souveränität den Preis der Auflösung des Einen und somit der Harmonia Mundi zu zahlen bereite), wenn er damit lockt, seine Vorstellung von Schönheit, Harmonie und Wohlgeschmack schon im Irdischen und nicht erst im apotheotisch Verklärten vermitteln zu können.
Eine der verwerflichsten Einsichten, die Satan erfolgreich unter die Menschen gebracht hat, ist jene, dass das Bessere der Feind des Guten und Stagnation Rückschritt sei, womit der Motor des Maßlosen ein für alle Mal angeworfen wurde. Dieses Maßlose in uns strebt nach stetig weiterer Verfeinerung, die freilich notwendigerweise enttäuscht und daher auf die Folie des Irdischen zurückgeworfen werden muss, auf welcher es in alle Ewigkeit unzufrieden, neidisch und mit sich und der Welt uneins verharrt.
Man sollte sich also nicht um noch weitere Ver-Feinerung der Bedürfnisse und Geschmacksrezeptoren, sondern vielmehr um Ent-Feinerung, Klärung und Entschlackung des Gaumens von den Finten des (vermeintlich) Raffinierten bemühen. Mit einer solchen Rückkehr zu einem klaren, wachen, aufnahmebereiten und nicht zuletzt dankbaren Gaumen kämen wir dem Geschmack Gottes gewiss noch am nächsten.
Homo sapiens – der schmeckende Mensch
Der Homo sapiens ist nach seinem Geschmack benannt. Er ist ein Mensch, der – wie uns die Etymologie des lateinischen Wortes sapio lehrt – zunächst einmal schmeckt und erst im übertragenen Sinn verständig, klug und einsichtig ist. Das Wörtchen Sapor bildet die Brücke zwischen beidem. Es bezeichnet den Geschmack, die Leckerei und den Wohlgeruch, aber auch den feinen Ton im Gespräch unter Gebildeten. Der Philosoph und der Weise werden im Lateinischen daher ebenso als sapiens bezeichnet wie der Feinschmecker. Einer, der nicht zu schmecken vermag, kann auch nichts wissen oder gar verstehen. Und wer nichts weiß oder verstanden hat, der vermag umgekehrt auch nichts herauszuschmecken.
Die Franzosen haben aus dem sapio das savoir – also das Wissen – gemacht und verwenden den Begriff des Savoir vivre bis heute für (das Wissen um den) guten Geschmack. Die Italiener schwärmen von den sapori ihrer Gerichte, und die Engländer haben die beliebten kleinen Häppchen, die sie zwischen den Mahlzeiten zu genießen pflegen, kurzerhand savouries genannt. Auch das deutsche Schmecken (idg. smegh) könnte man wortgeschichtlich als Wahrnehmung durch Kosten definieren. Es ist dem lateinischen sapio insofern verwandt, als auch hier ein Erkenntnismodell vorgeführt wird: Das (der Funktionsweise eines Zettelkastens vergleichbare) Sammeln von Geschmackseindrücken führt über den Umweg der Empirie zu jenem Zustand, den wir zunächst Geschmack nannten, aber im Laufe der Zeit immer deutlicher als Bildung verstanden. Geschmack wird – wir wissen es spätestens seit Theodor Fontanes Roman Frau Jenny Treibel – nur jenem zugebilligt, der sich auch Bildungsgut erworben hat.
Betrachtet man die Sache chronologisch, so gebühren der lateinischen sapientia, also dem Geschmack eines Archestratos oder Apicius, allerdings gewiss die älteren Rechte als dem Geschmack der Jenny Treibel.
Der Einfluss der katholischen Kirche auf unser Essverhalten
Feste zwischen Himmel und Hölle
Die Heilige Schrift erweist sich bei genauerem Hineinlesen als veritabler Festkalender mit detaillierten Anleitungen für erlaubtes und unerlaubtes Schlemmen.
»An der Tafel König Salomos«, so lautete etwa das Motto eines Festmahls, das die jüdische Kultusgemeinde unlängst anlässlich der jüdischen Kulturwochen ausrichtete und dabei auch Andersgläubige zum Kiebitzen einlud. Während ein klassisches jüdisches Festtagsmahl aufgetragen wurde, rezitierte Oberkantor Shmuel Barzilai aus den Sprüchen der Weisheit und dem Lied der Lieder und dokumentierte somit, dass die alten Patriarchen und Propheten keineswegs nur von biblischem Ernst und heiligem Zorn erfüllt waren, sondern durchaus auch etwas für Lebenslust und Festesfreude übrighatten.
»Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern«, spricht der Herr denn auch im zweiten Buch Moses (23,14) zum Volke Israel – und das gesamte Alte Testament ist eine recht eindrucksvolle Bestätigung, dass es diese Mahnung mehr als nur ernst genommen hat.
Wie eindrucksvoll die salomonische Tafelkultur tatsächlich gewesen sein muss, versteht man erst, wenn man die Reaktion der Königin von Saba, die ja auch nicht gerade eine ärmliche Hofhaltung pflegte, nachliest: »Als sie den Palast sah, den er gebaut hatte, die Speisen auf seiner Tafel, das Aufwarten der Diener und ihre Gewänder, seine Getränke und sein Opfer – da stockte ihr der Atem.« (1. Kön 4–5).
Doch nicht nur die salomonischen Mähler sollten in die biblische Geschichte eingehen. Das Festmahl, das König Artaxerxes in der Burg Susa anlässlich seiner Thronbesteigung gab, dauerte gar hundertachtzig Tage lang: »Am Ende dieser Tage gab der König allen, die in der Burg Susa waren, vom Größten bis zum Geringsten, sieben Tage lang im Hofgarten des Palastes ein Festmahl. Weißes Leinen, violetter Purpurstoff und andere feine Gewebe waren mit weißen und roten Schnüren in silbernen Ringen an Alabastersäulen aufgehängt. Auf dem Mosaikboden aus Alabaster, weißem und buntem Marmor und Perlmuttsteinen standen goldene und silberne Ruhelager. Man trank aus goldenen Gefäßen, von denen keines den andern gleich war. Großzügig ließ der König seinen Wein ausschenken. Bei dem Gelage sollte keinerlei Zwang herrschen. Denn der König hatte seinen Palastbeamten befohlen: Jeder kann tun, was ihm beliebt.« (Ester 1,5–8)
Feste werden jedoch nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament gefeiert, wobei der Bogen von der Hochzeit zu Kana über das Letzte Abendmahl bis hin zu den Orgien des König Herodes reicht. Wie es bei Letzteren zugegangen sein mag, versuchte Gustave Flaubert in seiner Herodias