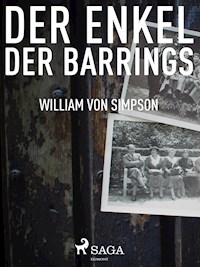
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Archibald von Barring, der "Enkel", kann den Verlust des großväterlichen Erbes nicht vergessen. Er ist froh, dass er Gisela Bancroft, die Schwester seiner Mutter, in England besuchen darf. Bei ihr lernt er eine andere, freiere Welt kennen und Menschen, die ihn fördern. Nach seiner Rückkehr aus England geht Archibald als Gehilfe auf das Rittergut Leschen. Er lernt dort viel und der Eigentümer wird sein verständnisvoller Freund. Jetzt zeigt sich, dass er mit seinem Großvater nicht nur den Vornamen, sondern auch die Tatkraft teilt. Mit Hilfe des Freundes gelingt es ihm nach einigen Schwierigkeiten, den früheren Familienbesitz Bladupönen zurückzukaufen. Und in Irmi, der jüngsten Tochter auf Leschen, findet er die Frau seines Lebens. Es scheint der der Neuanfang der Barrings zu sein, doch da bricht der Erste Weltkrieg aus.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William von Simpson
Der Enkel der Barrings
Roman
Der Enkel der Barrings
© 1939 William von Simpson
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711488577
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Erstes Buch Zwischen gestern und heute
Erstes Kapitel
Archi war es, als sei er erst gestern über die Wiesen, weit um Kallenberg herum, nach Waldheide gegangen, und doch lagen schon zehn Monate zwischen dem Heute und jenem unseligen Augusttag, an dem er sich von dem Stück Erde heruntergestohlen hatte, über das die Barrings an die hundert Jahre in Sorge und Hoffnung, Sicherheit und Dankbarkeit gegangen waren, das der Pflug seiner Väter umgebrochen, auf dem sie gesät und von dem sie geerntet hatten.
Den neunten Monat vertrauerte er nun schon in diesem trübseligen Drangwitz, wo er am 1. Oktober 1899 ohne allzu große Erwartungen sein erstes Lehrjahr angetreten hatte. Die Skepsis, mit der er seine Tätigkeit auf dem Gut begann, schien durch die mehr als fragwürdigen Bodenverhältnisse gerechtfertigt. Ganz Drangwitz bestand aus armem Sandboden, der allenfalls für Kartoffeln und Roggen reichte, und das auch nur in nassen Jahren, in denen es Tag für Tag wie aus Mulden vom Himmel pladderte.
Hinter im dehnte sich bis drüben zum fernen Waldrand hin flaches Ackerland. Nur hier und da unterbrachen ein paar halbmorsche Kopfweiden, eine windzerzauste Pappel die Eintönigkeit der tristen Landschaft. Sand, nichts als Sand, so weit das Auge reichte. Ganz Drangwitz mit seinen zweitausendsechshundert Morgen Acker war unterwegs, sobald der Wind mal etwas schärfer pfiff. Eine böse Klitsche!
Bei Hofrat Herbst, für Archis Mutter nach wie vor das unfehlbare Orakel in allen geschäftlichen und landwirtschaftlichen Fragen, konnte der Junge sich dafür bedanken, daß er in diese Sandwüste verschlagen worden war. Nachdem er im vorigen Herbst das Reifezeugnis für Prima bekommen und gleich in die praktische Landwirtschaft hineingewollt hatte, war von dem Hofrat der Rittergutsbesitzer Lüdemann auf Drangwitz als geeigneter Lehrherr empfohlen worden, und nach ein paar belanglosen Fragen, geringfügigen, rasch beiseite geschobenen Bedenken hatte Archis Mutter diesem Vorschlag zugestimmt.
Nach ihrer Auffassung konnte man dem Hofrat ja nur beipflichten, wenn er die Meinung vertrat, in Wiesenburg habe Archibald allein die angenehmen Seiten des Landlebens kennengelernt, dort aber keine Gelegenheit gehabt, auch nur den leisesten Begriff von den Schwierigkeiten zu bekommen, mit denen die Landwirtschaft häufig zu kämpfen habe und die oft zum Ruin selbst tüchtiger Landwirte führten. Mein Himmel, elftausend Morgen Weizenboden in alter, hoher Kultur, seit einem Jahrhundert im Besitz derselben Familie, bei der das Geld niemals knapp gewesen war – daraus ergab sich wohl eine Situation, in der irgendwelche ernstlichen Sorgen nicht aufkommen konnten. Ein behagliches Leben aus dem vollen hatten die Wiesenburger Barrings geführt, und nun war es nur wünschenswert, daß Archibald, der fünfte Barring der Wiesenburger Linie, einmal die Kehrseite der Medaille kennenlernte. Mochte er nur erfahren, daß ein Gut auch zum ewigen Sorgenquell werden konnte!
Und dann – dieser Lüdemann schien ganz der Mann danach, Archi sehr bald zu zeigen, daß Lehrjahre keine Herrenjahre sind. Der Drangwitzer hatte sich nur unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt, Archibald als Eleven einzustellen. Während der einjährigen Lehrzeit hatte er jede Arbeit mit zu verrichten.
Wenn nun auch jeder, der das Leben kannte, in dieser »Vonder-Pike-auf-Dienen«-Methode, Vernunft und Weitsicht erkennen mußte, so war es doch seltsam genug, daß gerade Gerda Barring, für die das Leben immer nur ein mehr oder weniger unterhaltsames Spiel gewesen war, plötzlich Sinn und Segen ernster Arbeit entdeckte. Dem guten Archi, der ja schließlich noch von seiner Mutter abhing, war aber nichts anderes übriggeblieben, als sich ihren Wünschen zu fügen und sich mit Drangwitz abzufinden.
Die Stimme des Vorschnitters Kraszinski – eines wenig sympathischen Mannes von knapp mittelgroßer, untersetzter Gestalt mit breitem, rotblauem Schnapsgesicht und listigen Schweinsaugen – unterbrach Archi in seinen Gedanken. Die kurz bemessene Frühstückspause war abgelaufen, jetzt hieß es wieder an die Arbeit gehen.
Den vierten oder fünften Tag mähte Archi nun schon mit in der Reihe, aber so recht wollte die Arbeit ihm immer noch nicht schmecken. Die Muskeln schmerzten nach wie vor, und beim Ausholen und Einschwingen stach es ihn wie mit Messern ins Kreuz.
Mit zu lang geschnallten Bügelriemen und schlapp hängenden Zügeln kam Lüdemann auf seinem struppierten Braunen, der mit dem dicken Heubauch und den melancholischen Bammelohren einer tragenden Stute glich, den Weg heruntergezockelt; er bog auf die Wiese ab und hielt gleich darauf neben Kraszinski, den er mit mißvergnügten Blicken maß. Er zögerte denn auch nicht, seinem Mißvergnügen über den schleppenden Gang der Arbeit Ausdruck zu geben.
»Nicht aus der Stell kommen die Kerls! Zum Schockschwerenot noch mal! Rein ’n Schlag an’n Hals kannst dir über die faule Bande ärgern!«
Er kramte die Zigarrentasche hervor, brannte sich ’n Tobak an und ritt auf Archi zu.
»Fluscht nich, die Arbeit, Herr von Barring, fluscht ganz und gar nich. Is ’ne Affenschande, wie die Bande faulenzt! Woll’n Sie die Kerls nich mal auf’n Schwung bringen? Wie is denn, wenn Se mal möchten vorhauen?«
»Ob ich das wohl schon riskieren kann, Herr Lüdemann?«
»Nanu! Warum nich? Was is da viel zu riskieren?«
»Ja – ich weiß nich, aber die Kreuzmuskeln – da zieht es noch höllisch beim Bücken. Und dann – so richtig in der Hand liegen tut mir die Sense auch noch nich.«
»Erbarm’n Se sich, Barring« – Lüdemann lächelte mit überlegener Nachsicht –, »und reden Se nich! Sehn Se, das mit dem Muskelziehen, das gibt sich. Bloß nich nach fragen darf man. Und die Sens’ soll Ihnen noch nich so recht liegen, meinen Se? Man immer den Arm lang, Barring, immer lang den Arm und denn de Sens’ sozusagen aus der Schulter ’rausfliegen lassen. Passen Se auf, denn haut se mit mal ganz von selbst. Machen Se keine Zatzken! Probieren Se man mal ruhig das Vorhauen.«
Er wendete sich im Sattel: »Herr von Barring übernimmt das Vorhauen«, rief er dem Vorschnitter zu, bedachte Archi mit einem Nicken und stukerte auf seinem betagten Leidgenossen zu den Gespannen, die drüben auf dem Waldschlag Kartoffeln eggten.
Gleich zu Anfang September setzte herrliches Wetter ein. Hoch und wolkenlos wölbte sich der türkisblaue Himmel über dem flachen Land, die Luft war klar wie Kristall, ein sanfter Wind spielte in den Blättern der Bäume, Sonnenglanz lag über der Welt.
Auf einem Schlag nicht weit vom Hofe schälte Archi als erster von den neun Vierschälern die Stoppeln rund. Viel wert waren die Schälpflüge nicht mehr. Alte, baggrige Dinger, seit Jahren nicht mehr richtig überholt.
Archi tat sein Bestes, um die Arbeit sauber auszuführen. An jeder Ecke hob er den Pflug rechtzeitig aus, so daß die drei Pferde nicht das schon umgebrochene Land wieder festtreten konnten, und an der nächsten Feldseite setzte er wieder neu ein. Obwohl er ein gutes Tempo eingeschlagen hatte, brauchte er auf die Pferde nicht sonderlich zu achten. Sie gingen willig und hielten Strich. Der Boden war infolge des ewigen Regens – von Mitte Juli bis Ende August hatte es fast ununterbrochen gegossen – weich wie Maibutter, und so ließ es sich nicht vermeiden, daß die Schälfurche zu tief wurde. Bei den vielen Queckennestern mußte man aufpassen. Mitunter waren sie derartig verfilzt, daß es im Boden ordentlich knirschte, wenn die Schare das Zeug faßten. Dann hieß es zupacken und den Pflug hinunterdrücken, sonst sprang er einfach heraus. Das Korn hatte miserabel gestanden. Dafür war das Unkraut um so besser geraten, und schließlich hatten die Disteln und Quecken das Getreide völlig überwuchert und den ganzen Acker versaut.
Zum Glück war Archis Lehrjahr nun in knapp vier Wochen um. Hier durchzuhalten war ihm mehr als sauer geworden. Richtig zugepackt hatte er. Ein Blick auf seine verarbeiteten Hände bewies das; breit und rissig waren sie und in den Innenflächen schwielig.
Archi schnickte mit der Peitsche nach dem Beipferd. Es stand wieder nicht fest im Strang.
Er nahm die Leine ein wenig straffer und rief die Pferde an. Das Tempo war zwar gerade richtig, aber dort kam von weitem Lüdemann über das Feld gestakt. Dem konnte es nie schnell genug gehen. Wenig Futter und viel Arbeit: nach diesem Grundsatz behandelte er Pferde und Menschen. Es fehlte an Gespannkraft in Drangwitz. Vier, eigentlich sechs Pferde mehr hätten im Ackerstall stehen müssen.
Wie ein alter Mann kam Lüdemann heran, langsam, ein wenig gebückt und ohne Elastizität. Sein uralter Filzhut, von dem kein Mensch hätte sagen können, ob er einst grün, braun oder grau gewesen war, saß ihm tief in der Stirn. Kein gutes Zeichen! Immer, wenn seine Laune unter dem Gefrierpunkt angekommen war, zog er sich den alten Filz bis auf beide Ohren. Archis Gruß erwiderte er kaum. Drei, vier Minuten ging er schweigend neben dem Pfluge her, dann gab er Archi ein Zeichen anzuhalten.
»Sagen Se mal, ich dachte, Se schälen hier? Was Sie da machen, das is kein Schälen, das is Pflügen! Den Unterschied zwischen Pflügen und Schälen könnten Se ei’ntlich allmählich begriffen haben. Sehn Se mal, Sie versaun mir hier einfach den Acker. So was geht nich! Na, nu sagen Se mal ’n Wort! Was hat das hier ei’ntlich zu bedeuten?«
Archi sah ihn ruhig an.
»Der Boden ist wie Brotteig. Da sackt der Pflug einfach weg. Ich hab’ es so und so versucht, aber er faßt nun mal so tief. Daß das nich so is, wie es sein soll, weiß ich auch. Aber zu machen is dabei nichts, Herr Lüdemann.«
Lüdemanns Blick drückte Ärger und Geringschätzung aus.
»Aha! Zu machen ist dabei nichts, meinen Sie? Also Sie werden mir nu erzählen, was sich machen läßt oder nich? Wiss’n Se, da kann ich bloß sagen, machen Se sich doch ja nich lächerlich. Nee, wissen Se, da lachen denn doch die Hühner, wenn Sie mich hier werden klug machen wollen.«
Archi blieb ruhig. Was Lüdemann da von sich gab, klang in seiner Ungerechtigkeit so albern, daß man den Mann nicht ernst nehmen konnte. Es lohnte sich wirklich nicht, darauf zu antworten. Dazu blieb übrigens auch gar keine Zeit. Lüdemann ging schon, nach einem neuen Opfer ausspähend, die Reihe der Pflüger hinunter. Nach einer kleinen halben Stunde traf er auf dem hundertzwanzig Morgen großen Schlag wieder mit Archi zusammen und hielt ihn zum zweitenmal an.
»Alle haben viel zu tief geschält, ’ne Schweinerei is das! Wozu sind Sie ei’ntlich hier, wenn Sie nich mal die neun Pflüge in Ordnung halten können? In Grund und Boden wird mir hier der Schlag versaut. Sie soll’n die Quecken so flach fassen, daß die Egge se nachher ’rausholen kann. Aber was tun Sie? Hübsch unterpflügen tun Se mir das Zeug. So tief faßt die Egge nich, nich mal der Kultivator. Nu bleibt das Jux im Boden, bloß, daß es vom Pflug kleingeschnitten is. Jaja, Sie haben es erfaßt! Besehn Se sich man den Acker in vier Wochen. Jedes Endchen schlägt Wurzel, und wo jetzt eine Queckenpflanze is, da kommen durch Ihr verdammtes Gepflüge später zehne hoch. Warum zum Deiwel halten Sie mir die Gespanne nich in Ordnung?«
Archi war langsam das Blut in die Wangen gestiegen.
»Als erster pflügen und auf die Pflüger hinter mir aufpassendas kann ich nich. Die Knechte können auch nichts dafür, wenn die Schare zu tief fassen. Die Pflüge sind so flach wie möglich gestellt, aber in dem durchgeweichten Sand sacken sie einfach weg.«
»Erbarmen Se sich und red’n Se kein Blech«, wies ihn Lüdemann laut und scharf zurecht. Alle Knechte hatten es hören müssen. »Tun Se lieber, was ich Ihnen sag’. Mit Klugreden is mir nich gedient.« Damit drehte er sich um und ging mit langen Schritten dem Hof zu.
Gut, daß Archi nicht dazu gekommen war, Lüdemann die Antwort zu erteilen, die ihm auf den Lippen gebrannt hatte. Da wäre es wohl mit ihm durchgegangen, und dann hätte es einen Krach gegeben, der vielleicht nicht mehr hätte gutgemacht werden können. Besser war es, mit Lüdemann allein zu sprechen. Nach dem Essen auf dem Hof suchte Archi ihn auf seinem Zimmer auf.
»Na, wo brennt’s denn?« fragte Lüdemann.
»Ich wollte bloß sagen, Herr Lüdemann«, begann Archi zögernd, während sich die Farbe auf seinen Wangen ein wenig vertiefte, »in knapp vier Wochen is ja nu mein Jahr ’rum …«
»Hör’n Se, das weiß ich! Na und? Möchten Se gern noch ’n Jahr länger bleiben?«
»Das nicht, Herr Lüdemann, aber im guten hier wegkommen, das möchte ich gerne. Daran liegt mir natürlich.«
»Na, mit’m Skandal werden Se ja nich weggehen. Das is doch selbstverständlich. Das brauchen Se doch nich erst lang und breit zu sagen.«
»Ja, Herr Lüdemann, ich wollte Sie bloß bitten, mich nich vor allen Leuten anzufahren …«
»Vor allen Leuten anfahren?« Lüdemann gab sich einen Ruck. Seine Brauen zogen sich dichter zusammen, ein aufmerksamer Zug trat in seine schläfrigen, wasserblauen Augen. »Nich anfahren soll ich Se vor den Leuten? Wie kommen Se ei’ntlich darauf? Wenn soll ich denn das getan haben? Das sagen Se mir doch mal erst.«
»Heute früh, beim Schälen.«
»Na, hören Sie mal, da hab’ ich Ihnen gesagt, wie man zu schälen hat, weiter nichts! Und nötig genug war es, daß ich Ihnen das sagte. Denken Se v’leicht, ich werd’ mit ansehn, wie Se mir den Acker versaun?«
Archis Stimme wurde um eine Nuance entschiedener.
»Daß die Furche nich flach genug war, das weiß ich, Herr Lüdemann. Aber die Pflüge waren doch so flach gestellt, wie es irgend geht, und mehr konnte ich doch schließlich nicht tun.«
»Erbarmen Se sich, Barring«, schnitt Lüdemann ihm unwirsch das Wort ab, »und erzählen Se mir hier nich, was man tun kann oder was man nich tun kann. Das weiß ich allein, und ich denk’, ich weiß das ’n ganz End’ besser als Sie. Wenn der Pflug stellenweis’ wirklich mal einsackt, dann packt man eben zu! Dazu hat uns der Herrgott die Fäuste gegeben.«
»Er sackt aber nich bloß stellenweise weg, überall, auf dem ganzen Schlag sackt er ein«, stellte Archi die Auffassung seines Lehrherrn richtig.
Lüdemann wurde gereizt – verlor die Geduld.
»Was? Nu werden Se herkommen und mich hier belehren wollen«, sagte er mit geringschätziger Ironie. »Wissen Se, ich werd’ Ihn’n mal was sagen, Herr von Barring, wenn Se werden zehn Jahre auf Ihrem Eignen gesessen haben, denn können wir v’leicht drüber reden, ob ’ne Arbeit so oder so zu machen is. Vorläufig sind Sie noch in der Lehre bei mir und müssen sich schon annehmen, was ich sag’.«
»Das weiß ich, und das will ich auch«, erwiderte Archi in merkbarer Erregung, »aber ich kann mir doch bloß das annehmen, was möglich is, und wenn Sie Unmögliches verlangen …«
Lüdemann zog die Oberlippe hoch, so daß sein Schnurrbart sich sträubte.
»Hören Sie, reden Sie hier keinen Unsinn zusammen!« wies er Archi gereizt zurecht. »Wie können Sie sich erlauben, mir zu sagen, ich hätt’ Unmögliches von Ihnen verlangt?« Er schlug auf den Tisch, fuhr sich mit den gespreizten Fingern durch das Gewirr seines Bartes. »Da hört sich denn doch verschiedenes auf! Ich verlang’ nichts Unmögliches! Verstehn Se mich? In meinem Leben habe ich das noch nicht getan, und bei Ihnen werd’ ich damit nich anfangen. So was muß ich mir schon verbitten. Ganz energisch verbitten muß ich mir das!«
Archi verkrampfte die Hände. Das Blut war ihm in die Wangen geschossen. Es fiel ihm sehr schwer, ruhig zu bleiben, aber zum Bruch durfte es auf keinen Fall kommen. So versuchte er denn, seiner Stimme einen ruhigen Ton zu geben.
»Herr Lüdemann, ich wollte bloß noch das sagen: Noch mal kann ich mich nich vor allen Leuten ’runtermachen lassen, sonst müßte ich Weggehen von hier.«
Lüdemann fuhr auf. Seine große Hand knallte auf den Tisch. »Was? So woll’n Se mir kommen? Mit Weggehen drohen woll’n Se mir hier? Sie sind wohl nich ganz bei sich? Was erdreisten Sie sich? Ob Sie weggehn oder bleiben, das haben Sie nicht zu entscheiden, darüber entscheiden Ihre Mutter und ich. Danken Sie Gott, wenn ich Se hierbehalt’! Nee, wissen Se, so dürfen Se mir ja nu doch nich kommen, so nich! Damit kommen Sie bei mir an den Unrechten, das lassen Sie sich gesagt sein! Ein für allemal lassen Sie sich das gesagt sein!«
Archis Augen verdunkelten sich. Er schob das Kinn vor, biß die Zähne zusammen, sein Gesicht bekam einen Zug trotziger Entschlossenheit.
»Ich hab’ nicht mit Weggehen drohen wollen«, sagte er mit etwas leiserer Stimme. »Ich will mich aber nich noch mal vor den Leuten anfahren lassen, wenn ich es nich verdient hab’.«
Lüdemann beugte sich, die riesigen geballten Fäuste auf die Tischplatte legend, weit vor.
»Ob Sie’s verdient haben oder nich, das hab’ ich zu entscheiden und nich Sie!« schrie er los. »Vergessen Sie sich hier nich! Sonst könnt’ es passieren, daß Sie schneller wegkommen von hier, als Se sich das träumen lassen!«
»Ich habe mich nich vergessen«, fiel ihm Archi vor Erregung bebend ins Wort. »Mein Recht will ich haben! Weiter nichts! Anschnauzen will ich mich nich lassen, wenn ich meine Arbeit mach’, so gut, wie es geht. Ich bin hier Lehrling, dafür zahle ich zweihundert Mark alle Monat Pension und Lehrgeld. Lernen will ich was, aber mich nich kujonieren lassen. Warum lassen Sie mich fortwährend Vorarbeiten, wenn ich meine Arbeit nich verstehen soll? Wozu tun Sie das denn?«
Lüdemann sah ihn perplex an. Der Junge schien ja total kopflos, wußte wohl überhaupt nicht mehr, was er sagte. Den konnte man bloß durch überlegene Ruhe wieder zu sich bringen.
»Sie benehmen sich hier – na, ich will nich sagen, wie«, sagte er im überlegen-ruhigen Ton spöttischer Ironie, »Sie wissen ja gar nich mehr, was Sie reden. Wo woll’n Se denn hin, wenn Se wirklich weggehn möchten? Nach Haus? Wo is Ihr Zuhaus? Denken Sie, ich weiß nich, daß Sie sich zu Ihrer Mutter so gestellt haben, daß die keinen Platz für Sie hat? Denken Sie, daß ich das nich alles weiß? Von Rechts wegen müßte ich Ihnen jetzt den Stuhl vor die Tür setzen!« Donnernd schlug er auf den Tisch. »Ausreden lassen Se mich, sage ich Ihnen! In Dreideiwels Namen, unterbrechen Se mich hier nich!« schrie er und fiel dann wieder in den scheinbar ruhigen, spöttischen Ton zurück. »Wenn ich Sie nich an die Luft setz’, denn nich, weil ich Ihn’n das nich antun möcht’. Nein, das bilden Sie sich man ja nich ein. Wegen Ihrer Mutter tue ich es nich, die hat schon gerad genug Sorgen mit Ihnen. Umsonst wird sie mir ja nich geschrieben haben, daß Se müssen gehörig ’rangenommen werden, wenn aus Ihnen was werden soll. Und nu machen Se, daß Se an de Arbeit kommen, und denken Se dran, daß Se hier sind, damit Se was lernen. Sie woll’n sich doch mal ’n Gut kaufen, nich? Na, sehn Sie! Denn sorgen Sie man dafür, daß, wenn Sie glücklich eins haben, Sie auch oben bleiben und nich auch ’runter müssen von Grund und Boden wie Ihr …«
Er stockte plötzlich. Was ging mit dem Jungen vor? Der machte ja auf einmal einen ganz merkwürdigen Eindruck. Einen Eindruck, als liege er auf der Lauer, nein, als stehe er auf dem Sprung!
»Wie wer?« fragte Archi leise. Er war aufgestanden, stand ruhig da, den Kopf wie lauschend geneigt.
Lüdemann sah zu ihm auf, als hätte er die Frage nicht verstanden. Hinter einem überlegenen Lächeln versuchte er seine innere Unsicherheit zu verbergen.
»Wie wer?« wiederholte er Archis Frage achselzuckend, »wie Ihr Vater natürlich …«
Das Wort blieb ihm in der Kehle stecken. Entgeistert starrte er auf Archi. Was – um Gottes willen – war das?
Archis langer Körper hatte sich etwas zusammengeduckt. Jeder Muskel darin schien zu spielen, jede Sehne angespannt zu sein. Seine großen Hände lagen wie festgenagelt auf den Seitenteilen der Lehne seines Stuhls, die langen Finger umklammerten sie wie Zangen. Er beugte sich nach vorne über, setzte das linke Bein zurück und schwang, mit einem Ruck aufschnellend, den schweren Stuhl wie eine Feder hoch. An den Schläfen, am Halse waren ihm die Adern herausgetreten. Sein Blick ließ Lüdemann keine Sekunde los. Wut und Verachtung kochten darin.
»Nehmen Sie das zurück«, sagte er mit rauher Stimme. »Nehmen Sie das zurück, oder – ich schlag’ zu!«
Lüdemanns Gesichtsfarbe wechselte ins Grünlichgraue. Er wußte es, bei dem ersten Versuch, aufzuspringen, krachte der schwere Stuhl auf seinen Schädel nieder.
»Barring, Mensch, kommen Sie zu sich!« sagte er beschwörend. Aus dem Mann sprach Angst, ganz gemeine Angst. »Sie haben mich ganz und gar falsch verstanden. So hab’ ich das nich gemeint. Gewiß nehm’ ich es zurück. Kommen Sie zu sich, Mensch! Um Gottes willen, kommen Sie zu sich!«
Ganz langsam setzte Archi den Stuhl hin. Nicht eine Sekunde ließ sein brennender Blick Lüdemann los. Seine großen, mageren, verarbeiteten Hände hielten die Lehne des Stuhls weiter so fest umspannt, daß die Knöchel weiß hervorsprangen. Er brauchte eine Stütze. Sein Körper flog, in den Knien fühlte er eine Schwäche.
»Kann ich in zwei Stunden einen Wagen zur Bahn haben?« fragte er heiser. Seine Stimme gehorchte ihm nicht mehr.
Immer noch den Blick in den Lüdemanns verbissen, stand Archi regungslos. Die graublauen, ins Schwarze schillernden Augen wirkten beunruhigend. Etwas Verlorenes, Verschlossenes und Einsames lag darin. Der Ausdruck dieser plötzlich alt gewordenen Augen hatte etwas Erschütterndes.
Lüdemann wurde sich auf einmal bewußt, Archi sehr falsch eingeschätzt zu haben. Falsch hatte er sich dem Jungen gegenüber benommen, ganz falsch. War die Situation überhaupt noch irgendwie zu retten, dann nur durch größte Vorsicht, unerschütterliche Ruhe. Der Gedanke an Archibalds Mutter schoß Lüdemann durch den Kopf. Sie sollte unter Umständen eine sehr offene Hand haben, diese Frau von Barring, und Geld hatte sie ja wie Heu. Ganz unberechenbar sollte sie sein, wie man immer hörte. Das zeigten ja auch ihre Briefe. Auch daß das Geld wirklich recht locker bei ihr saß, schien sicher. Kurz – es wäre das dümmste von allem gewesen, sich die Frau nicht warmzuhalten. Wer weiß, wie alles noch kommen konnte. Eine verfluchte Geschichte, eine ganz infame Geschichte! Höllisch verquer kam sie einem, ganz niederträchtig verquer.
Die Erkenntnis, eine Katastrophe heraufbeschworen zu haben, die ihn teuer zu stehen kommen könnte, lähmte Lüdemann. Auch die Augen Archis, die ihn noch immer festhielten, belästigten ihn. Unter ihrem Blick wuchs seine innere Unsicherheit.
Durch eine kleine Kopfbewegung wies er auf den Stuhl, dessen Lehne Archi noch immer umklammert hielt.
»Nu setzen Se sich erst mal hin, und denn woll’n wir mal in Ruhe weitersprechen.«
Archi rührte sich nicht.
»Ich habe nichts weiter zu sagen. Bloß, ob ich einen Wagen bekommen kann, möcht’ ich wissen.«
»Woll’n Se sich nich setzen?«
»Nein.«
»Na, denn bleiben Se meinetwegen stehen. Den Wagen können Se kriegen, aber ich denk’, Se schlafen erst noch mal über die Geschichte. Wissen Se, wer im ersten Ärger handelt, der macht Dummheiten. V’leicht war ich heut morgen auf’m Feld wirklich ’n bißchen hastig, man hat ja so allerhand auf’m Kopf. Mitunter kann es ja vorkommen, daß ei’m mal ’n Wort zuviel ’rausrutscht. Ja, das is nu mal nich anders, aber deswegen gleich in Feindschaft aus’nandergehn, nein, wissen Sie, das tut man denn doch nich.«
»Ich geh’ nich in Feindschaft, und ich geh’ nich in Freundschaft, aber ich gehe«, fiel ihm Archi in einem Ton ins Wort, der jede Verhandlung abschnitt, »ich möchte jetzt bloß wissen, ob ich einen Wagen bekommen kann oder nicht.«
Lüdemann begann die Ruhe nun doch zu verlassen. »Zum Schockschwerenot noch mal, daß Se ’n Wagen bekommen können, hab’ ich Ihn’n schon mal gesagt, aber schad’n würde es Ihn’n nichts, wenn Se sich ’n guten Rat von ’nem Mann möchten annehmen, der die Welt kennt und seine Erfahrungen hinter sich hat. Machen Se keine Dummheiten!«
Archis Gesicht blieb starr. Lüdemann sah ein, jedes Wort war hier zuviel.
»In zwei Stunden möchte ich fahren«, sagte Archi und wollte aus der Stube gehen.
Lüdemann spielte seinen letzten Trumpf aus: »Denn tun Se, was Se nich lassen könn’n. Ich hab’ genug geredt. Wem nich zu raten is, dem is auch nich zu helfen. Aber sagen Se mal, haben Se denn überhaupt Geld? Und wo woll’n Sie ei’ntlich hin?«
Archi, schon halb der Tür zugewandt, blieb stehen. Eisige Ablehnung, um nicht zu sagen Haß, schlug von ihm zu Lüdemann hinüber, der in diesem Augenblick den Kampf aufgab. Hier war wirklich nichts mehr zu wollen.
»Ob ich Geld habe oder nicht und wo ich hin will, das ist meine Sache«, sagte Archi und versuchte, seiner Stimme einen möglichst festen Klang zu geben. Dann ging er aus der Stube. Seine Füße waren kalt und schwer wie Bleiklumpen. Er trat hart auf, als er den kellrigen Flur zu seiner Stube hinunterging. Endlos erschien ihm der lange Gang. In einer Woge von Feindschaft ertrank jede andere Regung in ihm.
Zweites Kapitel
An der Wohnung am Lützowufer, die Mathilde Barring, die Witwe des verstorbenen Wiesenburgers, innehatte, klingelte es. Das Mädchen war gerade abwesend, und so ging Hanna Lamberg, die nun schon über dreißig Jahre lang durch hundert Bande mit den Wiesenburger Barrings unlösbar verbunden war, selbst hinaus, um zu öffnen.
Fast klein, so schlank, daß ihre schwarzgekleidete Gestalt beinahe mager erschien, um den Hals die lange, goldene Uhrkette geschlungen und ein mit lila Bändern geziertes weißes Spitzenhäubchen auf dem noch ganz blonden Haar, ging sie mit schnellen, leisen Schritten durch den halbdunklen Flur und öffnete die Tür.
Erstaunt, ja erschrocken sah sie auf den Depeschenboten.
»Fräulein Lamberg?« fragte dieser geschäftsmäßig kurz.
»Ganz recht«, erwiderte Hanna ein wenig beklommen. »Ein Telegramm? Und für mich?«
Der Bote wies mit seinem dicken Zeigefinger auf die Anschrift. »Jawoll! For Ihnen! Sehn Se hier, Fräuleinche, ganz klipp un klar steht druff ›Fräulein Lamberg‹. Woll’n man hoffen, det wat Scheenet drinstehn möchte. Morjen!«
In einer gewissen Erregung ging Hanna zurück in die Wohnstube, suchte die goldgefaßte Brille hervor, setzte sich auf den mit weinrotem Samt bezogenen Sessel, den einst immer der verstorbene Wiesenburger benutzt hatte, und entfaltete mit bebenden Händen das Telegramm. Es hatte immer etwas Beunruhigendes, beinahe Beängstigendes für sie, eine Depesche zu bekommen. Sie überflog den Inhalt, las ihn dann noch einmal langsam nach, indem sie leise die einzelnen Worte vor sich hin murmelte: »Eintreffe heute acht Uhr, bleibe, wenn möglich, vorläufig bei Euch. Archi.«
Im ersten Augenblick empfand Hanna nichts als Freude über die Aussicht, Archibald wiederzusehen und ihn für einige Zeit zu haben. Allein dann überkamen sie auch schon allerlei Zweifel und Bedenken.
Mein Gott, er schien auf längere, wenigstens unbestimmte Zeit zu kommen. Wie war das nur möglich? Erst in drei Wochen war seine Lehrzeit um. Warum er sie nur so kurz vor ihrem Abschluß unterbrach? – Sollte irgendwas vorgekommen sein, er womöglich Differenzen mit Herrn Lüdemann gehabt haben? Bei seinem zum Aufbrausen neigenden Temperament war das nicht so unmöglich, aber es wäre schlimm, sehr schlimm, sollte sein Scheiden aus Drangwitz vorzeitig und – Gott verhüte es – im Unfrieden erfolgt sein. Auf alle Fälle sollte er es jedoch gemütlich hier haben, der Archi. Blumen wollte sie ihm ins Zimmer stellen und dann für ein ordentliches Abendessen sorgen. Eine gute Klinge schlug er, der Archi. Ihn mit einer Schüssel Gänseklein aufräumen zu sehen war eine wahre Freude. Doch für Gänseklein war noch nicht die Zeit. Von den jungen Gänsen, die schon jetzt an den Markt kamen, schmeckte es nicht kräftig genug. So beschloß sie, Archi ein vernünftiges Rumpsteak mit geschabtem Meerrettich und Bratkartoffeln abzubraten und ihm dann noch ein gefülltes Schaumomelett, das er so gern aß, backen zu lassen. Ein bißchen verwöhnen durfte man ihn schon, dafür war er ja bei der Großmama. Sein Magen sollte nicht zu kurz kommen und erst recht nicht sein Herz.
Am Abend seiner Ankunft hatte Archi die Großmutter nicht mehr gesehen. Sie war leidend, hatte oft mit dem Herzen zu tun und sich deshalb daran gewöhnen müssen, sehr früh zu Bett zu gehn.
»Ich habe der Großmama noch gar nichts von deinem Besuch gesagt, Archi«, hatte Hanna ihm erklärt. »Sie hätte sich möglicherweise aufgeregt und dann kein Auge zugetan. Morgen vormittag, bevor du sie siehst, werde ich sie orientieren. Natürlich nur, soweit es nötig ist. Die unerhörte Bemerkung über deinen lieben Vater, zu der sich dieser Herr Lüdemann hat hinreißen lassen, darf sie nicht erfahren. Es würde sie nur sehr aufregen, und bei ihrem Herzen muß ihr jede Aufregung ferngehalten werden.«
Du lieber Gott, es war wahrhaftig kein Wunder, daß Mathilde Barrings armes Herz unter all den Wechselfällen ihres langen Lebens – sie war nun schon fünfundsiebzig – schwach und krank geworden war.
Was war nur während der letzten sechzig Jahre alles auf sie eingestürmt, was alles hatte sie erfahren an Leid und Not, Erfüllung und Enttäuschung, Freude und Leid! Viel hatte ihr ein gütiges Schicksal im Leben gegeben, mehr ein unbegreiflich grausames ihr im Alter geraubt.
Archi saß in der in Sonnenschein gebadeten Wohnstube, die tausend Erinnerungen in ihm lebendig werden ließ. Er sah auf das alte Sofa, das er kannte, solange er denken konnte. Seine Hand, groß, mager und verarbeitet lag auf dem warmen, weinroten Samtbezug. Blickte er zurück auf die Jahre seines Lebens – es waren immerhin schon fünfzehn oder sechzehn Jahre, die er zurückdenken konnte –, so erschien ihm seine Vergangenheit traumhaft flüchtig, voller Widersprüche und Rätsel.
Die Tür zum Nebenzimmer öffnete sich, und am Arm Hannas betrat die Großmama, auf einen Stock gestützt, im schwarzen Seidenkleid das Zimmer. Auf dem merkwürdigerweise immer noch glänzendschwarzen Haar saß ein Häubchen aus cremefarbenen Spitzen. Ehrerbietig ging Archi ihr entgegen und küßte ihr die Hand.
»Das ist aber mal eine Überraschung, mein Kind. Sei mir willkommen.«
Sie wandte sich Hanna zu. »Ich möchte gern zum Fenster, Fräulein Lamberg. Hier kann ich den Jungen nicht genau genug sehen.«
Am Fenster, im vollen Schein der Mittagssonne, betrachtete sie prüfend den Enkel. Endlich hob sie die Hand und fuhr ihm liebkosend über die Wange. »Großpapas Augen«, murmelte sie. »Wenn du sprichst, ist mir, als hörte ich die Stimme deines Vaters. Komm, gib mir einen Kuß, und nochmals, sei mir von Herzen willkommen.«
Dann saßen sie nebeneinander auf dem Sofa, und die Großmama hielt seine Hand in der ihren, die in einem Halbhandschuh aus schwarzen Filetspitzen steckte. Archi kam das alles beinahe merkwürdig vor. Es geschah so selten, daß die Großmama sich weich und zärtlich zeigte.
»Fräulein Lamberg hat mir erzählt, daß du in Drangwitz Verdruß gehabt und deine Lehrzeit dort vorzeitig abgebrochen hast. Das ist nicht programmäßig. Aber es ist unwichtig, sofern du selbst von der Richtigkeit deiner Handlungsweise überzeugt bist. Was hast du nun für Zukunftspläne?«
»Tante Gisa hat mich nach Bancroft Park eingeladen. Anfang Oktober will ich zu ihr fahren und erst am ersten April zurückkommen.«
»Ich weiß, Archi. Tante Gisa hat mir geschrieben, wie sie sich auf dich freut. Und deine Mutter? Ist sie einverstanden mit deinen Plänen?«
»Ich weiß nicht recht, Großmama. Bestimmtes hat sie noch nicht dazu gesagt. Aber schließlich – sie kann ja eigentlich nichts dagegen haben …«Er stockte, ein nachdenklicher Ausdruck trat in seine Augen. Dann sprach er zögernd weiter. »Allerdings – wie meine Mutter sich jetzt dazu stellen wird, wo ich vorzeitig aus Drangwitz weggegangen bin, das fragt sich. Sie muß ja doch aber einsehen, daß es nicht anders ging.«
»Ich hoffe, daß deine Mutter das einsehen wird«, sagte Mathilde Barring leise und fuhr dann in entschiedenem Ton fort: »Ich wünschte dir die schöne Zeit drüben bei Tante Gisa. Es ist nützlich für einen jungen Menschen, die Welt kennenzulernen. Auch daß du gut Englisch sprechen lernst, ist wünschenswert. Aber danach, Archi, vom April an, was hast du dann vor?«
»Dann möchte ich für ein Jahr in eine Zuckerrübenwirtschaft. Weißt du, Großmama, in eine sogenannte hochintensive Wirtschaft, wie wir sie bei uns in Ostpreußen nicht haben.«
Sie nickte. »Und dann, mein Kind, was dann?«
»Dann muß ich mein Jahr abdienen.«
»Bei den dritten Kürassieren?«
»Nein! Bestimmt nicht! Überall, aber nicht in Königsberg.«
»Nicht im Regiment deines Vaters?« fragte sie erstaunt.
»Nein, Großmama«, gab er schnell, beinahe erregt zurück. »Der Vater – das war selbstverständlich, daß der dritter Kürassier wurde. Er gehörte zu Ostpreußen und bloß dazu. Ich nicht mehr. Ich will mich nicht womöglich über die Achsel ansehen lassen. Das will ich nicht und kann ich auch gar nicht«, schloß er trotzig.
Am einundzwanzigsten September fuhr Archi nach Königsberg, wo am dreiundzwanzigsten die Trauung Alis mit dem Premierleutnant im zwölften Ulanenregiment, Lothar Freiherrn von Gyllenfeld, stattfand.
Ursprünglich hatte Archi der Hochzeit fernbleiben wollen. Der Gedanke, zwischen all den vielen Verwandten und Wiesenburger Bekannten sozusagen Spießruten laufen zu müssen, hatte etwas Abschreckendes für ihn gehabt. Alle Welt redete jedoch so lange auf ihn ein, die Hochzeit seiner ältesten Schwester, mit der er sich von Kind auf innig verbunden fühlte, mitzumachen, bis er sich schließlich dazu entschloß. Die Großmama und Hanna Lamberg, sein Onkel Andreas und Tante Marianne, Onkel Thomas Barring, der älteste Friedrichsthaler Sohn, und nicht zuletzt Onkel Axel Koßwitz, der gerade zum Oberst befördert und Kommandeur der zweiten Gardeulanen war – sie alle hatten seine Anwesenheit in Königsberg für unerläßlich erklärt, so daß ihm am Ende kaum etwas anderes übriggeblieben war, als nachzugeben.
In der eleganten Sechszimmerwohnung Gerda Barrings auf dem Mitteltragheim in Königsberg waren Gäste zum Essen versammelt: Gerdas Brüder Emanuel und Malte und ihre älteste Schwester Adelheid, Axel Koßwitz, die Gräfin Minka Hoyneburgk, Hanna Lamberg und Archi.
Archi, der zum erstenmal in der Königsberger Wohnung seiner Mutter war, sah mit Befremden die prätentiös und aufdringlich wirkenden neuen Sachen, die sich zwischen den alten schönen Wiesenburger Mahagoni- und Nußbaummöbeln breitmachten. Das Wohnzimmer, in dem man um einen großen runden Tisch herumsaß, war ganz neu eingerichtet: modern, unkultiviert, unpersönlich. Warum Gerda mit geringem Aufwand an Geschmack, aber mit viel Geld eine Menge neuer Möbel angeschafft, jene aber, die einst die Räume in Wiesenburg geschmückt hatten, auf den Speicher verbannt hatte, blieb ihr Geheimnis.
Ali und ihr Bräutigam fehlten in diesem Kreise. Sie aßen heute im »Deutschen Haus«, bei den Eltern Lothars, dem Oberst a.D. Freiherrn von Gyllenfeld.
Gerda war zu stark geworden, ihr Haar ziemlich grau, der Mund scharf, die Lippen schmal. Man sah es ihr an, daß sie jetzt eine Frau von über Fünfzig war.
Als die Hoyneburgk für einen Augenblick die Schleusen ihrer Beredsamkeit schloß, erhob sich Gerda und sagte mit einem bezeichnenden Blick auf Archi:
»Wir haben wohl noch einiges zu besprechen, Archibald. Wir wollen das nebenan tun.«
Zu Emanuel und Malte Eyff gewandt, fuhr sie fort: »Ihr tut mir wohl den Gefallen, mitzukommen? Es wäre mir lieber, in eurer Gegenwart mit Archibald zu sprechen.«
Gerda, Emanuel und Malte gingen zum Nebenzimmer – ein Kollegium von Richtern. Archi, in dem beklemmenden Gefühl, wieder einmal dem Versuch seiner Mutter, ihn zu demütigen, ausgesetzt zu sein, folgte ihnen schwer gereizt.
Die Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn wurde im Stehen abgemacht und währte nicht länger als zehn oder zwölf Minuten. Sie spielte sich anders ab, als Archi vermutet hatte.
Überraschenderweise blieb Gerda ganz ruhig. »Über den entsetzlichen Auftritt in Drangwitz will ich nur so viel sagen, daß ich Gott aus tiefster Seele danke, daß er seine Vaterhand schützend über dir gehalten hat; denn sonst … ach, es ist überhaupt nicht auszudenken, was für furchtbare Folgen es hätte haben können, wenn du …« Sie schauderte. »Durch deine schreckliche Heftigkeit wirst du dich noch mal unglücklich machen.«
»Daß ich in Wut geriet, das ist doch bloß selbstverständlich«, fiel Archi ihr ins Wort.
Gerda zuckte die Achseln: »Es lohnt sich nicht für mich, mit dir darüber zu sprechen, was selbstverständlich ist und was nicht. Ich will mich heute nicht aufregen. Ich will nicht! Verstehst du?«
Emanuel hielt es für angezeigt, einzugreifen. Besonders geschickt fing er es nicht an. »Lieber Archibald, selbstverständlich ist für jemanden aus unseren Kreisen, sich in jeder Lage, in jeder, sage ich, zu beherrschen! Es gibt Dinge, die man nicht tut, die einfach nicht gehen. Dazu gehört, daß man seinen Lehrherrn nicht mit Stühlen attackiert. Ich kann mir nicht helfen, aber das ist nun mal so.«
»Und ich kann mir auch nicht helfen«, sagte Archibald sehr erregt. »Wenn einer mir gegenüber Gemeinheiten über meinen Vater behauptet, dann tut er es – wer es auch sei – auf seine eigene Gefahr.«
Malte, der fühlte, wie aufgebracht Archi war, suchte die ihm scheußlich unbehagliche Lage zu retten.
»Wenn du erlaubst, Gerda, möchte ich vorschlagen, die Geschichte auf sich beruhen zu lassen. Schließlich ist sie nicht mehr zu ändern.« Er wandte einen Kunstgriff an. Mit einem Blick auf die Uhr fuhr er fort: »Soviel ich weiß, sagtest du, um sieben sollte zu Tisch gegangen werden? In fünf Minuten ist es soweit.«
Gerda erschrak. »Was? Schon fünf Minuten vor sieben?« Sie schien es plötzlich sehr eilig zu haben. »Mein Gott – ich hab’ noch gar nicht die Suppe und die Soßen abgeschmeckt. Sie kocht ja recht gut, die Schneidereit, aber die Soßen macht sie immer zu lang: ’ne greuliche Manier! ’ne Soße muß kurz sein. Wenn man sie verplempert, schmeckt sie nach gar nichts. Wir müssen pünktlich zu Tisch gehen, sonst verkrischelt der Braten total. Emanuel, tu mir den Gefallen und mach Archibald meinen Standpunkt klar. Ich kann heut keine Szene ertragen! Ich kann es einfach nicht!« Ihr häufig betonter Abscheu vor Szenen bestand in Wirklichkeit nicht. Im Gegenteil, von Zeit zu Zeit hatte sie ein entschiedenes Bedürfnis nach erregenden Auftritten.
Zu Archi gewandt, fuhr sie fort: »Daß man dich, unbeherrscht, unberechenbar und gewalttätig, wie du bist, nicht nach England lassen kann, wirst du wohl begreifen, denk’ ich mir.« Das eröffnete sie dem Jungen, obgleich sie längst bei sich beschlossen hatte, ihn nicht an der Reise zu hindern. Indessen glaubte sie pädagogisch zu handeln, wenn sie ihn noch »zappeln« ließ. Mit einem bekümmerten, ironischen Blick auf Archi, einem undurchsichtig lächelnden auf ihre Brüder ging sie aus dem Zimmer, um die Soße abzuschmecken. Das war jetzt natürlich sehr viel wichtiger als die Auseinandersetzung mit dem Jungen, der ja doch ein ziemlich hoffnungsloser Fall war.
Archi stand da wie jemand, der auf einen harten Kampf gefaßt, aber entschlossen ist, seine Sache durchzufechten.
»Deine Mutter steht auf einem durchaus begreiflichen Standpunkt«, erklärte Emanuel, während er sich bemühte, Nachdruck und Schärfe in seine Worte zu legen. »Man muß – das kannst du keinem Menschen verdenken – darauf gefaßt sein, daß du Tante Gisa und Onkel Harold in irgendwelche Schwierigkeiten bringst.«
»Das glaub’ ich nicht«, unterbrach Archi ihn mit unmißverständlicher Bestimmtheit.
Malte versuchte es auch jetzt wieder mit einem Ablenkungsmanöver. »Verzeih, Emanuel, aber wolltest du dich nicht noch um die Bowle kümmern?«
»Herrjees, die Bowle! Natürlich! Gut, daß du daran denkst.«
Im Grunde durch und durch anständig denkend und sehr gutherzig, innerlich außerdem auf Archis Seite, ließ Emanuel bereitwillig die Bowle als Vorwand gelten, um die Besprechung kurz und schmerzlos zum Abschluß zu bringen.
»Also, streiten wir nicht darüber, ob du falsch gehandelt hast oder nicht. Voreilig war es auf alle Fälle von dir, und, wie gesagt, die Kontenance verlieren, nein, damit macht man sich unmöglich. Das ist etwas, was einfach nicht geht. Dabei muß ich bleiben. Trotzdem haben wir, Onkel Malte und ich und auch Tante Adelheid – die übrigens ganz besonders –, wir haben also versucht, deine Mutter zu bewegen, dich doch nach England ’rüberzulassen. Ja, das haben wir drei ernstlich versucht, mein lieber Archibald. Und es hat sehr, sehr schwer gehalten. Das kannst du mir ruhig glauben! Wir haben uns den Mund fusselig geredet, um deiner Mutter klarzumachen, daß man dir keinen Strich durch die Rechnung machen sollte. Aber – sie hatte taube Ohren. Wir haben getan, was wir tun konnten.« Er legte eine Kunstpause ein, sprach dann weiter: »Ja, so war das, aber … schließlich …«, er richtete sich ein wenig gerader auf und bedachte Archi mit einem ermahnenden Blick, »schließlich ist es uns doch gelungen, und wir freuen uns nun, dir die Englandreise ermöglicht zu haben. Wir rechnen aber mit aller Bestimmtheit darauf, mein lieber Archibald, daß wir es eines Tages nicht bereuen müssen, uns für dich eingesetzt zu haben.«
Der Polterabend im Hotel »Deutsches Haus« war höchst animiert verlaufen. Allerlei Aufführungen und Allotria, ein brillantes Souper, Champagner in Strömen. Bis gegen drei Uhr früh hatte man getanzt, die Jugend wie die Brummkreisel, die älteren Damen und Herren in mäßigen Grenzen und mit ein bißchen wehmütigen, aber doch so schönen Erinnerungen an die allzu schnell verrauschte Jugend.
Der Trauung in der Schloßkirche wohnten einige fünfzig Hochzeitsgäste in etwas miesepetriger Stimmung bei. Die Damen waren mit dem Schlaf zu kurz gekommen, und die Herren hatten bei einem höchst splendiden Gabelfrühstück »Hundehaare aufgelegt«, das heißt, sie hatten ihren Kater vom Polterabend mit sehr viel Bier, Wein und Likör zu bekämpfen versucht.





























