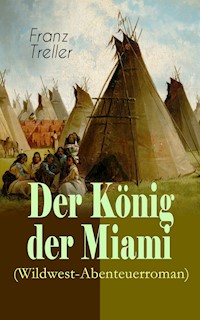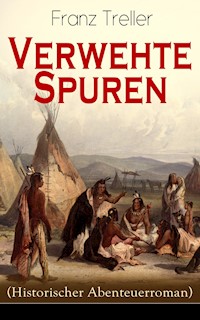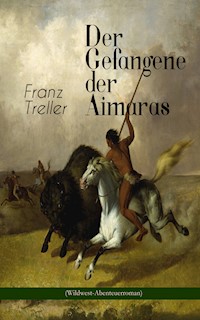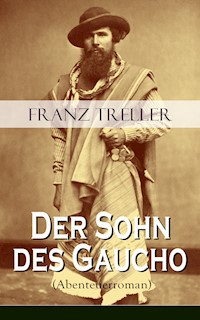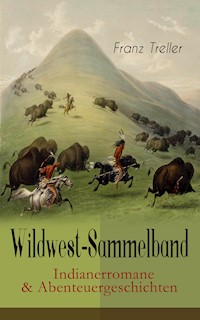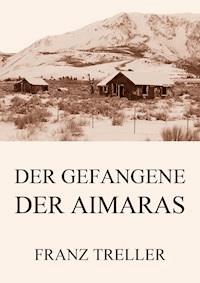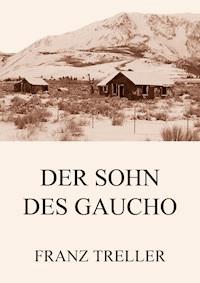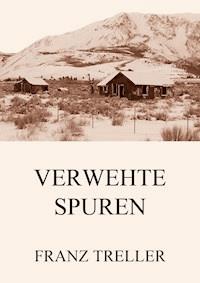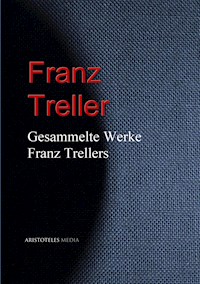Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kleiner Junge, der in der Wüste Guatemalas gefunden wird, entpuppt sich als Nachkomme der Maya-Könige. Die Häscher der Regierenden setzen bald alles daran, ihn zu töten....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Enkel der Könige
Franz Treller
Inhalt:
Franz Treller – Biografie und Bibliografie
Der Enkel der Könige
Das Königskind
Pablo und Mariquita
Die Entführung
In des Feindes Gewalt
Der Conde
Die Flucht
Die Enkelin des Conde
Der Tempelwächter
Das Haus der Könige
In Aranas Haus
Die Brandstätte
Verfolgung
Die Bandidos
In der Sierra
Nahende Vergeltung
Der König der Mayas
Der Enkel der Könige, F. TReller
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849637835
www.jazzybee-verlag.de
Franz Treller – Biografie und Bibliografie
Deutscher Abenteuerschriftsteller, geboren am 15. Oktober 1839 in Kassel, verstorben am 28. Juni 1908 ebenda. Nach seinem Schulabschluss beendete Treller auch eine Banklehre und begann mit 18 Jahren seine Laufbahn am Theater. Seine Auftritte führten ihn unter anderem nach Amsterdam, Cuxhaven, Oldenburg, Riga und schließlich nach Moskau. Erst um 1890 begann er seine Abenteuer-Romane zu schreiben, welche teilweise erst nach seinem Tode veröffentlicht wurden. Er gilt heute neben Karl May als einer der bekanntesten klassischen Vertreter dieses Genres.
Wichtige Werke:
Der Sohn des GauchosDer Gefangene der AimarasDer König der MiamisVerwehte SpurenDer Enkel der KönigeEine versunkene WeltVergessene HeldenDas Kind der PrärieDer Held von TrentonDer Enkel der Könige
Das Königskind
Zwischen Guatemala und dem mexikanischen Staat Yucatan erstreckt sich eine Hochebene. Das Land ist rauh, von Felsen zerrissen, mit dornigem Buschwerk, spärlichem Gras und vereinzelten Bäumen bestanden, vulkanischer Boden, wild und zerklüftet.
Über diese Hochebene jagten an einem stürmischen Abend, die Nacht war nicht mehr fern, zwei Reiter in südlicher Richtung dahin. Sie schienen gehetzt, verfolgt vielleicht, denn sie trieben ihre edlen Tiere zu rasendem Lauf, ihnen keine Minute der Rast gönnend. Kleidung und Aussehen verrieten sie als Indianer, Ureingeborene des Landes. Ihre dunklen, hart geschnittenen Gesichter waren finster und verschlossen, unter den Stirnbögen glühten die Augen, das lange, strähnig schwarze Haar flatterte im scharfen Luftzug, der von der See herüberkam.
Der eine der Reiter trug in seinen Poncho gewickelt ein Kind.
Sie ritten schweigend, verkrampft, Schatten gleich, stundenlang, ohne des Weges zu achten, dessen sie sicher schienen. Schließlich wurde in der Ferne ein dunkler Waldstreifen sichtbar; auf ihn hielten sie zu. über dem Schattenriß des Waldes glühten einige phantastische Bergzacken im violett schimmernden Licht des Abends. Der ältere der Reiter verlangsamte den Lauf seines Pferdes.
»Wie lange willst du das Kind noch tragen?« wandte er sich an seinen Begleiter. Die Frage wurde in der Sprache der Mayas gestellt; die Antwort kam in der gleichen Sprache:
»Bis ich es in sichere Obhut geben kann, Kazike. Keinen Augenblick länger.«
über das Gesicht des Kaziken, eines finster blickenden, nicht mehr jungen Mannes, flog ein Schatten. »Du bist ein Narr, Azual«, sagte er. »Zieh dem Balg die Machete durch die Kehle, und es ist alles vorbei.«
»Azual vergießt das Blut der Könige nicht.« Der andere schüttelte den Kopf. »Der junge Panther wird sterben, wenn die Unsichtbaren es wollen«, sagte er, »durch Azuals Hand stirbt er nicht.«
»Dann also durch meine.« Der Kazike streckte die Hand aus. »Gib ihn her.«
Azual wandte nicht einmal den Kopf; sie ritten in langsamerer Gangart nun nebeneinander. »Du wirst dann auch mich töten müssen, Kazike«, sagte er. »Sei aber sicher: stirbt der Enkel der Könige durch deine Hand, sind alle deine Pläne zunichte, und dein Leben ist verwirkt. Die Mayas werden von dir abfallen, als hätten sie nie auf deine Stimme gehört, du wirst keinen Winkel im Lande finden, der dich verbirgt.«
»Ich will, daß Ruhe wird!« stieß der Kazike heraus. »Wozu all die Mühe, wenn die Quelle der Gefahr nicht verstopft werden soll? Haben wir den kleinen Burschen Arana entrissen, das Leben aufs Spiel gesetzt, um schließlich die Natter am eigenen Busen zu züchten?«
»Komm zur Vernunft, Chamulpo« – der Mann mit dem Kind ritt etwas näher an den anderen heran – »du willst König der Mayas werden, und du sollst es. Die Mayas brauchen an ihrer Spitze einen Mann, kein Kind, und du bist der Mann, den sie brauchen. Du bist dem alten Königsgeschlecht verwandt; lebte dieses Kind nicht, du wärest der rechtmäßige Erbe der Königswürde. Wir haben das Kind – in Aranas Hand ein gefährliches Pfand; es wird nicht mehr gefährlich werden. Den letzten Sproß des alten Königsgeschlechtes töten, das wäre ein Frevel, den die Unsichtbaren furchtbar rächen würden, aber es bedarf dessen auch nicht. Gib das Kind zu den armseligen Indios an der Küste; dort wird es untertauchen, und niemand wird von ihm wissen.«
»Narr!« Der Kazike stieß ein rauhes Lachen aus. »Der Bursche trägt das Zeichen der Könige auf der Brust.«
Azual schwieg betroffen. »Mag er sterben«, sagte er nach einer Weile finsteren Nachdenkens, »aber nicht durch meine Hand. Und nicht mit meinem Wissen.«
Die Reiter näherten sich jetzt einer Bodensenke, die hohen Baumwuchs zeigte; jenseits des tiefen Einschnittes setzte sich die fast kahle Hochebene fort.
Bevor sie in die Senke ritten, wandte der Kazike sich um und stieß einen unterdrückten Schreckensruf aus. Azual, seinem Blick folgend, sah, daß eine stattliche Reiterschar in gestrecktem Galopp hinter ihnen her jagte; sie mußte, unbemerkt von beiden, aus einer Seitenschlucht aufgetaucht sein.
»Das ist Arana«, knirschte Azual, »er will sich den kleinen Panther wieder holen; jetzt heißt es, die Pferde laufen lassen.«
»Schneid' der kleinen Bestie den Hals ab!« knirschte Chamulpo. Der andere antwortete nicht.
Sie tauchten in der Talsenke unter und mußten sich nun ihren Weg zwischen gewaltigen Baumriesen bahnen; hier unten war es schon fast dunkel und das Reiten durch allerlei Hindernisse sehr erschwert. Plötzlich sprang wenige Schritte vor den Hufen ihrer Pferde ein Panther auf, der über einem erlegten Reh kauerte; mit ein paar langen Sprüngen verschwand die aufgeschreckte Bestie im Dunkel. Von der Höhe drang das wilde Geschrei der Verfolger herunter.
»Erwischen sie uns mit dem Kind, sind wir verloren!« schrie der Kazike. »Du bringst mich und dich ins Verderben.«
Einen Augenblick zögerte Azual, dann warf er in schnellem Entschluß das vom Poncho umhüllte Kind in das dunkle Gebüsch, eben dorthin, wo der Panther verschwunden war. »Der Panther ist sein Schutzgeist«, rief er, »mag er ihn vor Unheil bewahren!« Der Kazike stieß ein rauhes Lachen aus. Sie spornten die Pferde. An die dreißig Reiter, wilde, dunkle Gestalten in flatternden Ponchos, jagten hinter ihnen her. Verfolgte und Verfolger tauchten unter im samtenen Dunkel der Nacht.
*
»Was ist das?« rief einige Zeit später eine Stimme in spanischer Sprache. Ein schlanker, noch jüngerer Mann trat aus den Büschen heraus; im Arm hielt er ein Bündel, ein Indianerkind, wie man gleich darauf sah, von einem Poncho umhüllt. Verblüffung im Gesicht, betrachtete der Mann seinen Fund. »Der Panther entspringt und hinterläßt mir einen braunen Infanten«, sagte er. »Was hat das zu bedeuten?«
Zwei andere Männer, Weiße wie der Sprecher, traten heran. Aus der Umhüllung blickten zwei dunkle Augen, fragende, etwas ängstliche Kinderaugen, auf die Männer. »Die Katze habe ich verscheucht und statt ihrer den kleinen Burschen hier erbeutet«, sagte der Mann mit dem Kind. »Wahrhaftig die sonderbarste Jagdbeute, die mir jemals beschieden war.«
»Den Panther haben die Reiter verscheucht, die unseren Weg kreuzten, Don Diego«, sagte einer der Hinzugetretenen.
»Reiter?« Der mit dem Kind horchte auf. »Wie viele?« fragte er.
»An die dreißig etwa.«
»Von woher kamen sie?«
»Von Norden, Señor.«
»Dann galt es nicht mir. Waren es Weiße?«
»Nein, Indios. Wahrscheinlich gehörte ihnen das Kind.«
»Ja, wahrscheinlich.« Don Diego betrachtete nachdenklich das kleine Gesicht in der Ponchoumhüllung. Die dunklen Augen sahen ihn sonderbar an, durchdringend, fremd, unheimlich für so einen kleinen Burschen. Der Junge mochte eben ein Jahr alt sein.
Fast verwirrt wandte der Mann den Blick. »Habt ihr sonst etwas bemerkt, was auf nahe Gefahr schließen ließe?« fragte er.
»Nichts, Señor.«
»Die Ebene ist frei?«
»Soweit wir sehen konnten. Die Indioreiter sind nach Süden davongejagt.«
»Gut.« Don Diego sann einen Augenblick nach. »Bleibe noch oben, Francisco«, sagte er dann, »halte die Ebene im Auge, achte sorgfältig auf jedes bedrohliche Anzeichen. Ich will meinen merkwürdigen Fund der Señora bringen.«
Den Knaben auf dem Arm ging er ins Tal hinab und betrat gleich darauf eine Lichtung, auf der einige Pferde und Maultiere weideten. Neben einer Indianerin saß eine junge Frau mit einem erst wenige Monate alten Säugling auf dem Arm. Zwei Neger und ein Indianer waren damit beschäftigt, einige weitere Tiere an einer Quelle zu tränken.
Don Diego trat auf die junge Frau zu. »Sieh her«, sagte er, »ich bringe dir eine absonderliche Jagdbeute. Nein, keine Pantherkatze, sondern ein Menschenkind, einen kleinen Indio.« Er wickelte den Poncho los und stellte den kleinen Jungen behutsam auf die Erde. Er stand schon recht fest auf seinen stämmigen Beinchen.
Die Frau sah staunend auf das Kind. »Mein Gott«, sagte sie, »du hast ihn gefunden? Allein hier in der Wildnis? Er wird sich verlaufen haben. Es müssen demnach Menschen hier in der Nähe wohnen.«
Don Diego schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er, »auf viele Meilen keine Menschenseele. Aber Francisco hat braune Reiter gesehen vorhin, sie sind von Norden nach Süden geritten und müssen ihn verloren oder aus irgendeinem Grunde zurückgelassen haben.«
Der alte Peon, der mit Don Diego gekommen war, trat heran. »Zurückgelassen«, sagte er und schüttelte den Kopf, »nein, Señor, zurückgelassen ist wohl nicht der richtige Ausdruck; sie haben das Kind dem Panther vorgeworfen, die roten Schufte!« Die Dame schrie auf. »Was sagst du da, Juan? Das ist doch nicht möglich!«
»Nicht möglich?« Der Peon lachte rauh. »Bei diesen Indios sind noch ganz andere Dinge möglich, Señora!« sagte er.
Don Diego schaltete sich ein: »Zur Sache, Juan«, sagte er, »was hast du gesehen? Du sagst das doch nicht von ungefähr mit dem Panther.«
Der Peon zuckte die Achseln. »Ich stand ziemlich weit weg im Gebüsch«, berichtete er, »zwei Indianer auf Pferden jagten an mir vorbei, sie schienen es verdammt eilig zu haben; ich sah, daß einer von ihnen ein Bündel in den Busch warf, kurz nachdem ein aufgeschreckter Panther dort verschwunden war. Sie jagten weiter, und gleich darauf kamen an die dreißig Reiter, ebenfalls Indios, hinter ihnen her.«
»Sonderbar!« Don Diego schüttelte den Kopf; sein Blick richtete sich auf das Kind. »Ein richtiger kleiner Vollblutindianer«, sagte er.
»Ein hübsches Kind, Diego.« Auf dem blassen Gesicht der jungen Frau spielte ein Lächeln; sie zog den Jungen an sich heran.
»Irgendein heidnischer Zauber«, knurrte der Mann. »Wahrscheinlich sollte der kleine Bursche irgendeiner dieser verruchten Gottheiten geopfert werden. Unsere Indios stecken ja noch immer voll von wüstem Aberglauben; ihr Christentum ist ihnen kaum hinter die Hirnrinde gedrungen.«
Von der Talsenke her näherte sich der Peon Francisco, den Diego zurückgelassen hatte. »Die Indios sind verschwunden, Señor«, berichtete er, »sie schienen große Eile zu haben.«
»Wir müssen uns auch auf den Weg machen«, sagte Don Diego. Die Frau sah ihn an. »Und das Kind?« fragte sie, »was machen wir mit dem armen Kind?«
»Wir werden es wohl oder übel mitnehmen müssen.« Der Mann runzelte die Stirn. »Wir können es ja in der ersten Wohnstätte, die wir erreichen, abgeben«, setzte er hinzu.
Das kleine Mädchen auf dem Schoß der Frau streckte die winzigen ärmchen aus. Es erwischte ein paar Strähnen von dem schon ziemlich langen schwarzen Haar des kleinen Indianerjungen und krallte die Händchen darin fest; dabei krähte es vor Vergnügen. Der kleine Bursche aber ließ sich die ein wenig rauhe Liebkosung gefallen, ohne mit der Wimper zu zucken. Aus seinen dunklen Augen sah er unverwandt auf das kleine Wesen im Schoß der Frau. »Sieh da, Maria schließt schon Freundschaft mit dem braunen Prinzen«, lachte Don Diego. »Also nehmen wir ihn einstweilen mit; Nina«, – er wandte sich der Indianerin zu, »nimm dich deines kleinen Stammesgenossen an. – Wir müssen aufbrechen, Mercedes. Man weiß nicht, was noch kommen kann. Ich habe keine Lust, noch im letzten Augenblick den Libertados in die Hände zu fallen. Wir müssen die mexikanische Grenze sobald wie möglich hinter uns bringen.«
»Ich bin bereit, Diego«, antwortete die Frau. Sie sah tapfer und klar zu ihm auf, aber in ihren Augen schimmerten Tränen. Don Diego biß sich die Unterlippe blutig. Mit einer abrupten Bewegung wandte er sich ab. »Vorwärts, Jungen«, rief er den Negern zu, »die Mulos gesattelt; wir wollen weiter.«
Minuten später war alles zum Aufbruch bereit. Die Señora saß auf ihrem Maultier, ihr Kind im Arm, neben ihr ritt die Indianerin, den braunen Jungen auf der Kruppe ihres Pferdes. Don Diego und die Peons folgten, und ihnen schlossen sich die Neger an, die beladenen Saumtiere führend. Die Kavalkade setzte sich in Bewegung und schlug, auf der Hochebene angelangt, den Weg nach Norden ein. Nach einigen Stunden ritt ein Trupp Lanceros auf die Lichtung zu. Der Anführer sprang vom Pferde und untersuchte aufmerksam den Boden. »Matteo hatte recht«, sagte er, sich nach einer Weile aufrichtend, »hier haben sie gerastet. Also ist der Verräter entwischt, und der Preis, der auf seinen Kopf gesetzt ist, dahin. Aber die Feuer glühen noch, sie können nicht allzuweit sein. Adelante, companeros! Ihnen nach! Setzt die Sporen ein. Vielleicht erreichen wir sie doch.«
Sie wandten die Pferde und jagten die Anhöhe hinauf. Die Nacht verschluckte sie und breitete ihren dunklen Mantel über das zerklüftete Land.
Pablo und Mariquita
Seit Menschengedenken war die Westküste des Landes nicht von einem solchen Sturm heimgesucht worden. Die ganze Nacht hatte er getobt und gewütet, die Uferwände zerrissen, Bäume entwurzelt, Fischerhütten wie Streichholzschachteln zerstampft, Boote ans Land geschleudert und das Land auf weite Strecken hin verwüstet.
Es war, als sei ein Ungeist über die Erde gegangen und habe sich, nachdem er seiner wilden Wut Lauf gelassen, wieder in seine finstere Sphäre zurückgezogen.
Don Antonio d'Irala, ein begüterter Haziendero, ritt mit seinem Majordomo an dem flachen, sandigen Meeresufer entlang; ein Vaquero folgte ihnen in einiger Entfernung. Friedlich und ruhig lag das Meer, als hätte es nicht erst vor Stunden in furchtbarer Wut gebrüllt, der Himmel war blau, und die Sonne, schon jetzt am frühen Morgen eine sengende Hitze ausstrahlend, schien friedlich auf das Bild der Zerstörung.
»Schlimm, Don Estevan«, sagte der Haziendero zu seinem Begleiter, »viel schlimmer, als ich erwartet hatte. Nur gut, daß wenigstens kein Menschenleben zu beklagen ist.« Sie hielten an einer Stelle, wo gestern noch einige Hütten gestanden hatten; nur die großen Feuerherde waren zurückgeblieben. In einiger Entfernung stand eine Gruppe von Menschen, die in stumpfer und gleichgültiger Haltung auf das Meer hinaussahen.
Die Reiter setzten sich wieder in Bewegung; als sie sich der Gruppe näherten, lüfteten die dort stehenden Männer die Hüte. Es waren ein Weißer und drei Indianer.
»Eine böse Nacht, Miguel«, sagte d'Irala, dem Weißen, der herangetreten war, die Hand reichend, »hoffentlich ist hier bei euch niemand verunglückt?«
»Nein, Señor, Gott sei Dank nicht«, entgegnete der Angeredete, ein stämmiger Mann in den Vierzigern. »Wir haben, sobald das Unwetter loszubrechen begann, Frauen und Kinder hinter die Felsen gebracht« – er deutete auf eine zerklüftete Felsgruppe, die das sandige Ufer nach Süden zu wie eine Kulisse abgrenzte. »Schließlich haben wir selber dort Schutz gesucht, als es zu schlimm wurde. Aber was wir hatten, ist hin.« Sein leerer Blick streifte über die verwüstete Fläche; es zuckte in seinem Gesicht.
»Nun, äußerer Verlust läßt sich immer ersetzen«, sagte Don Antonio. »Schickt die Euren zur Hazienda, bis Ihr Euch wieder ein Heim geschaffen habt.« Der Mann stammelte einen Dank, schien aber noch zu beeindruckt von dem plötzlich über ihn hereingebrochenen Unglück, um ganz zu erfassen, was ihm da geboten wurde.
Einer der Indios schob sich vor. »Unsere Boote und unsere Netze sind zerstört, Señor«, sagte er, »das Vieh ist ertrunken oder in die Wälder entlaufen; wir haben nichts als das Leben gerettet.«
»Sei froh, daß ihr lebt, Metyllo«, versetzte der Haziendero, »wir werden helfen, wo wir können. Bringt Frauen und Kinder in unsere Arbeiterhütten. Don Estevan wird für sie sorgen. Und dann fangt wieder an; das Leben geht weiter. Die Hauptsache, ihr laßt euch nicht unterkriegen.«
»Mil gracias, Señor«, murmelte der Indio und trat zurück. Don Antonio wandte sich dem Weißen zu. »Was habt ihr vorhin so eifrig aufs Meer hinausgeschaut, Miguel?« fragte er. »Gibt es da etwas Besonderes?«
Der Mann zuckte die Achseln. »Schiffstrümmer, Señor«, sagte er, »seht dort. Sie treiben.« D'Irala wandte den Blick; er sah das ziemlich große Bruchstück eines von den Wellen zertrümmerten Schiffes. Es trieb in nicht allzu weiter Entfernung auf dem kaum bewegten Wasser.
»Mein Gott!« stammelte er, »ein Schiff gestrandet. Und zweifellos alle ertrunken. Gott sei ihren Seelen gnädig.« Er nahm den Hut vom Kopf und sah starren Blicks auf das Meer hinaus.
Miguel trat neben ihn. »Die Indios hier behaupten, es lägen Menschen auf den treibenden Balken dort«, sagte er. »Ich kann nichts erkennen, aber die Braunen haben bessere Augen.«
D'Irala ergriff ihn am Arm. »Und Ihr zögert?« rief er empört, »rasch, rasch, bewegt euch doch! Habt ihr kein brauchbares Boot?«
Miguel verzog etwas unwillig sein Gesicht. »Sind wirklich Menschen auf den Trümmern dort, sind sie tot«, sagte er, »aber meinetwegen. Gefahr ist nicht dabei. Mein Boot ist noch brauchbar; ich hatte es rechtzeitig an Land gezogen.«
»Vorwärts! Vorwärts!« drängte d'Irala.
Die Leute machten sich, nicht besonders willig und auch nicht sonderlich eilig ans Werk. Immerhin schwamm das stabile Boot nach einigen Minuten auf dem Wasser. Don Antonio selbst, Miguel und zwei Indianer saßen darin. Eine Viertelstunde später stieß es auf die Schiffstrümmer. Sie zogen sich heran und kletterten hinüber. Sie sahen: es handelte sich um den abgerissenen Teil vom Hinterdeck eines größeren Schiffes. Und gleich darauf stießen sie auch auf Menschen. Eine ältere Indianerin umklammerte noch immer mit starren Händen die Reling; die Frau war zweifellos tot. Zwischen ihrem Körper und der Bordwand lagen, zusammengekrümmt, die Körper zweier Kinder. Ein weißes Mädchen und ein brauner Junge; sie hielten sich umklammert und schienen leblos wie die Frau, die sie mit ihrem Leib vor den Wellen geschützt haben mochte.
»Entsetzlich!« flüsterte Don Antonio. Die anderen bekreuzigten sich. Der Haziendero kniete sich auf den nassen, wasserüberfluteten Boden des Schiffsdecks und suchte die Kinder aus ihrer Lage zu lösen. Plötzlich stieß er einen überraschungsruf aus. »Sie leben«, stammelte er. Er zog zunächst das Mädchen hervor, dem das nasse Kleidchen um die frostkalten Glieder klebte; er sah in ein blasses, zartes Kindergesicht, von braunen, jetzt vor Nässe glänzenden Locken umgeben. Die Augen waren geschlossen, es sah aus, als schliefe das Kind. Es mochte etwas über drei Jahre alt sein. Don Antonio fühlte nach dem Herzen der Kleinen und legte das Ohr an ihren Mund; kein Zweifel, das Kind lebte noch. Er rieb den kleinen, halb erstarrten Körper und bewegte die leblosen ärmchen, um die Lungentätigkeit zu fördern.
Einer der Indianer war d'Irala nachgeklettert und hatte den braunen Jungen hervorgeholt; auch er zeigte noch Spuren von Leben, und der Indianer verfuhr mit ihm in der gleichen Weise wie Don Antonio mit dem weißen Mädchen. Die im Boot zurückgebliebenen Männer sahen den Bemühungen zu, die nach einiger Zeit von Erfolg gekrönt waren: sowohl das Mädchen als auch der kleine Indio schlugen die Augen auf. Die indianische Frau indessen war tot.
Don Antonio und der Indianer kletterten mit den Kindern ins Boot hinüber. »Zurück an Land«, befahl der Haziendero, »nehmt auch die tote Frau mit; sie war ein braves Weib und soll ein christliches Begräbnis haben.« Mit Mühe wurden die starren Finger der Toten von der Reling gelöst und der erstarrte Körper ins Boot geschafft. Antonio d'Irala hielt das kleine Mädchen fest an sich gedrückt, ihm zur Seite lag, in seinen Rock gehüllt, der kleine Indianerjunge. So trieben sie dem Ufer entgegen.
Dort hatten sich inzwischen einige indianische Frauen und Mädchen eingefunden. »Presto, Presto!« rief Antonio ihnen zu, »schafft Milch herbei; hoffentlich ist noch eine eurer Kühe am Leben.«
Das Boot stieß an Land, und die Männer sprangen mit den Kindern heraus. Staunenden Blickes sahen die Indianerinnen auf die kleinen Schiffbrüchigen; schon aber lief eine von ihnen nach den Felsen hinüber, um bald darauf mit einer Kürbisschale voll warmer Milch zurückzukehren. Eine ältere Indianerin nahm sich der Kinder an; sie atmeten, schienen aber zu schlafen. Sie tranken etwas von der warmen Milch, die man ihnen reichte, schliefen aber sogleich, offenbar völlig erschöpft, wieder ein.
»Nun, Madrecilla«, sagte d'Irala zu der Indianerin, »nimm dich deines kleinen Stammesgenossen an, das Mädchen will ich Doña Inez bringen. Ich denke, sie wird sich freuen. Und dann kommt alle nach der Hazienda, wir wollen überlegen, wie wir euch allen schnelle Hilfe schaffen können. Miguel«, wandte er sich dem weißen Manne zu, »suche doch den Namen des Schiffes zu ermitteln, das da untergegangen ist, vielleicht findet er sich auf einem der Schiffsteile.« Er winkte dem Majordomo. »Kommen Sie, Don Estevan, wir wollen nach Haus.« Er winkte den Leuten zu und sprengte, das kleine gerettete Mädchen im Arm, mit seinen Begleitern davon.
Nah hinter dem sandigen Meeresufer erhob sich ein Saum hochragender Bäume. Dahinter dehnte sich eine weite, bebaute Fläche, und in deren Mitte stand breit und wuchtig das im Landesstil erbaute Herrenhaus der Hazienda. Eine rauhe, wenig geebnete Straße führte darauf zu; auf ihr ritten Don Antonio und seine Begleiter. In dem schmalen Waldstück, das sie durchqueren mußten, hatte der Sturm zahllose gewaltige Bäume entwurzelt, in den Feldern und Kulturen hatte er blind gewütet, und auch das Herrenhaus selbst erwies sich als schwer beschädigt.
Auf der Veranda erschien eine junge Frau von schlanker, biegsamer Gestalt; sie sah den Reitern mit einem Lächeln entgegen. »Was bringst du denn da?« fragte sie, als d'Irala vom Pferde sprang.
»Du hast dir doch immer eine Tochter gewünscht«, lachte Don Antonio, »ich bringe dir eine. Ich habe sie buchstäblich dem Meer aus den Fängen gerissen.« Er betrat die Veranda und legte das Kind in den Arm der Frau. Die sah maßlos erstaunt in das feine, blasse Mädchengesicht. »Mein Gott«, stammelte sie, »was ist denn das?« D'Irala berichtete ihr in kurzen Worten, unter welchen Umständen er die Kinder gefunden hatte. Die Augen der Frau leuchteten auf. »Die Arme«, flüsterte sie, »die arme Kleine! Mein Gott, welch ein Unglück. Kann man denn einem Kind die Mutter ersetzen?« »Du wirst es können, Inez«; ein warmer Glanz stand in den Augen des Mannes, die Frau und Kind mit zärtlichem Blick streiften. »Ich will es versuchen«, flüsterte die Frau, »ja gewiß, ich will es versuchen.«
Das Kind in den Armen der Frau schlug die Augen auf; sie waren hell und schimmerten feucht; sie streiften das Gesicht der jungen Frau mit einem ängstlichen Blick. »Mama? Wo ist Mama?« flüsterte die Kleine; ihr Blick haftete an dem fremden Gesicht. Sie erkannte wohl die Güte und die Zärtlichkeit darin; sie schloß gleich wieder die Augen und stieß einen schwachen Seufzer aus. »Pablo«, flüsterte sie dann noch mit schon wieder geschlossenen Lidern, »wo ist Pablo?«
Die Señora trug das Mädchen ins Haus und in ihr Schlafzimmer, entkleidete es und legte es in ihr Bett. »Armes Kind«, murmelte sie, die kleine Schläferin betrachtend, »sie sucht ihre Mama, sie sucht einen Pablo. Ich fürchte, sie wird sie erst im Himmel wiedersehen.« In ihren Augen standen Tränen.
»Leise, sei leise«, sagte sie, als bald darauf Don Antonio ins Zimmer trat, »sie schläft, sie ist ganz erschöpft und muß viel schlafen.« Don Antonio lächelte. Er trat auf Zehenspitzen an das Bett und sah auf das kleine blasse Gesicht zwischen den feuchtglänzenden braunen Locken. »Wir wollen für sie sorgen«, sagte er, »wir wollen versuchen, ihr Vater und Mutter zu ersetzen.« Er griff nach der Hand seiner Frau.
»Ja«, sagte die, »ja, Antonio, das wollen wir.«
Der Junge öffnete die Augen, er sah die Indianerin an. Die überflutete ihn mit einem Schwall von Worten in ihrer Sprache; der Junge zuckte zusammen, und ein sonderbarer Zug kräuselte seine Lippen; seine Augen blickten finster und scheu wie in aufbegehrendem Trotz. Die umherstehenden Indianermädchen und Frauen hatten alle lachende Gesichter, aber das Antlitz des Jungen lockerte sich nicht auf. Dabei mochte der kleine Bursche eben vier Jahre alt sein. Eigenartigerweise trug er elegante Kleider aus gutem Stoff, ganz nach der Art weißer Kinder.
Er hat wohl Angst, er ist fremd, er sucht die Seinen, dachte die Indianerin; sie sprach in den weichen, melodiösen Lauten ihrer Sprache auf das Kind ein. Der Junge schien nichts zu verstehen, augenscheinlich achtete er auch gar nicht auf das, was die Indianerin sagte; seine Augen gingen suchend im Kreis.
»Wo ist Nina?« fragte er schließlich in spanischer Sprache. »Wo ist Maria?«
Die Indianerin fuhr zurück und sah erstaunt auf das kleine Gesicht. Aber als sei sie von dem Blick des Kleinen bezwungen, bediente nun auch sie sich des holprigen Spanisch, das sie konnte. »O Söhnchen, Söhnchen«, stammelte sie, »werden alle auf dem Grund des Meeres ruhen, die du suchst. Gott sei ihnen gnädig. Die Männer haben dich dem Wasser entrissen.«
Ein verstörter Zug glitt über das Antlitz des Jungen, er sah hilflos um sich. Dann zog seine kleine Stirn sich zusammen; er schien nachzudenken. Wieder sprach die Indianerin auf ihn ein, in ihrer Sprache wieder; sie sprach doch zu einem Kind ihrer Farbe; er mußte sie doch verstehen.
Aber er verstand sie offensichtlich nicht; sein Gesicht schloß sich zu, wie sich nur indianische Gesichter verschließen können.
»Man muß seine Kleider trocknen, er wird sonst Fieber bekommen«, sagte eine der jüngeren Frauen. Sie machten sich über den nur schwach Widerstrebenden her und entkleideten ihn, hüllten ihn dann in warme, trockene Tücher. Dabei bemerkte die Alte auf der Brust des Kindes eine Tätowierung blauer Linien, die sich in seltsamer Verschnörkelung durcheinanderzogen. Sie machte die anderen Frauen darauf aufmerksam, und die holten einige Männer herbei. Die Männer besahen sich die eigenartige Zeichnung, wußten aber keine Erklärung. Nur einer von ihnen meinte, das Zeichen habe ähnlichkeit mit den Eingrabungen auf den Steinsäulen, die man hier und da in der Tiefe des Waldes antreffe.
Man bot dem Kinde Milch und Maisbrot, aber es wollte nicht essen und trinken. Es schob das Gebotene zurück und sagte wieder mit einer seltsamen Hartnäckigkeit: »Nina, Maria.« Die Frauen nahmen es auf und trugen es zu den Felsen hinüber, in denen sie vor Sturm und Flut Schutz und Zuflucht gefunden hatten.
Währenddessen begruben die Männer die auf den Schiffstrümmern zusammen mit den Kindern gefundene tote Indianerin am Rande des Waldes und errichteten ein aus zwei Holzstücken roh geformtes Kreuz über ihrem Grab.
Miguel fuhr, der Aufforderung Don Antonios nachkommend, noch einmal mit einem Boot zu dem schwimmenden Wrackteil hinaus, um wenn möglich den Namen des gesunkenen Schiffes festzustellen, doch vermochte er nichts darauf Hindeutendes zu entdecken.
Die Uferbewohner, bis auf Miguel und eine Familie sämtlich Indios, schickten sich nun an, mit den kärglichen Habseligkeiten, die sie gerettet hatten, den Weg nach der Hazienda anzutreten, um dort in den Arbeiterwohnungen vorläufige Unterkunft zu suchen. Den indianischen Jungen führten sie mit; er trug wieder seinen schönen Sommeranzug, der an der Sonne schnell getrocknet war. Sie trugen ihn abwechselnd und waren sehr stolz auf ihn, glaubten die Indianer doch, niemals ein so schönes und eigenartiges Kind ihrer Rasse gesehen zu haben.
»Mama! Nina! Pablo?« jammerte die Kleine. Sie rieb sich die Augen und sah Doña Inez aus tränennassen Wimpern heraus an. Vergeblich mühte die Señora sich, das Kind zu beruhigen; es schien keinem Schmeichelwort zugänglich.
»Wer ist Pablo?« fragte die Frau verzweifelt. »Sag doch, mein Herz, mein armes, wer ist Pablo?«
Die Kleine sah sie verständnislos an. »Pablo!« stammelte sie, und ihre Tränen liefen schon wieder. Die neue, gepflegte Umgebung des Zimmers schien keinerlei Eindruck auf sie zu machen.
Don Antonio trat ins Zimmer.
»Pablo, sie verlangt fortgesetzt nach einem Pablo«, sagte die Señora, »sollte sie etwa den kleinen Indio meinen, der gleichzeitig gerettet wurde?«
Der Haziendero runzelte ein wenig die Stirn. »Möglich«, versetzte er.
»Wo ist der Junge?«
»Ich hab ihn der alten Techpo zur Pflege übergeben.«
»Dann schick doch nach ihm. Laß ihn kommen«, bat die Frau.
Die Falten auf Don Antonios Gesicht vertieften sich. »Nicht gern«, sagte er, »gar nicht gern. Ich wünsche dem kleinen Burschen alles Gute, und ich werde für ihn sorgen. Aber ich mag keinen Indio hier im Hause haben.«
»Hole ihn trotzdem«, bat Doña Inez. »Wer weiß, wie lange wir die Kinder überhaupt haben. Wir müssen ja nach ihren Angehörigen forschen. Finden wir sie, werden wir das kleine Mädchen hergeben müssen, und mit ihr wird auch der kleine Indio gehen.«
Antonio d'Irala zögerte immer noch. Dem Enkel der Konquistadoren lag die abgründige Verachtung der roten Rasse im Blut; wie hätte er sie eines kleinen fremden Burschen wegen überwinden sollen? Aber gut, dachte er schließlich, es wird ohnehin nicht lange dauern. Er sah das bittende Gesicht seiner Frau, das ängstlich zerquälte, tränenüberströmte der kleinen Fremden und gab widerwillig Anordnung, den braunen Jungen ins Herrenhaus zu holen.
Die vom Sturm vertriebenen Fischer waren soeben auf der Hazienda eingetroffen, und so war der kleine Junge in wenigen Minuten zur Stelle. Er trat in das Zimmer und zeigte noch immer das ernste, fast widerwillig verschlossene Gesicht. In den Blicken, mit denen er die neue Umgebung musterte, lag ein Ausdruck des Stolzes, der einem vierjährigen Kinde weißer Farbe ganz unmöglich gewesen wäre.
Aber plötzlich flammte es in diesen dunklen Augen auf; ein helles Lächeln verschönte seine Züge. »Mariquita!« stammelte er und blieb anscheinend starr vor Staunen stehen.
Da jubelte auch schon das Mädchen auf. »Pablo!« rief sie, lief auf ihren strammen Beinchen auf den braunen Jungen zu und legte ihm die ärmchen um den Hals; Bäche von Tränen liefen ihr über die Backen. »Pablo«, stammelte sie und schien ganz außer sich, »Pablo ist da.«
»Ja, Mariquita«, sagte der Junge auf spanisch, »Pablo ist da, und er geht auch nicht wieder weg.«
Doña Inez sah staunend auf die Kinder. Also Maria heißt sie, dachte sie, so weiß ich doch wenigstens ihren Vornamen.
Das Kind plapperte; es hatte den braunen Jungen losgelassen, stand vor ihm und sprach sprudelnd auf ihn ein. »Mama«, sagte sie, »wo ist Mama? Wo ist Nina? Wo ist der Papa, Pablo?«
Der Junge schüttelte den Kopf, senkte ihn dann. »Pablo weiß nicht«, sagte er leise, »fort. Alle fort. Pablo weiß nicht.«
»Sie kommen doch. Sie kommen bestimmt, Pablo. Sie lassen uns doch nicht allein«, stammelte das Mädchen.
»Kommen«, sagte der Junge, »kommen ganz bestimmt.« Sein Gesicht war wieder ernst, viel ernster, als ein weißes Kindergesicht hätte sein können.
Doña Inez, die das Gebaren der Kinder mit Staunen und Rührung betrachtet hatte, ließ ihnen nun Schokolade und Maisbrot bringen, und sie aßen, für den Augenblick allen Kummer vergessend, mit dem Appetit gesunder Kinder.
»Wer sie sein mögen?« wandte die Señora sich an ihren Mann, »die Wäsche Marias ist mit einem P gezeichnet. Ich habe sie ausgefragt, aber sie kennt nur die Vornamen der Eltern: Don Diego und Doña Mercedes.«
Don Antonio zuckte die Achseln. »Ich werde sofort Nachricht an die Regierung geben, die sie dann an allen Küstenplätzen verbreiten wird. Wir werden dann schon erfahren, welches Schiff hier zugrunde gegangen ist und wer die Eltern des kleinen Mädchens waren.«
Die Entführung
Seit jener Sturmnacht, welche die Westküste Guatemalas verwüstet hatte, waren viele Jahre ins Land gegangen. Im Herrenhaus der Hazienda del Roca erinnerte nur noch die Anwesenheit der beiden von den Schiffstrümmern geretteten Kinder an das ferne Ereignis. Aus diesen Kindern waren inzwischen junge Menschen geworden. Die in den vergangenen Jahren immer wieder angestellten Nachforschungen nach der Herkunft des Mädchens – nach der des Indiojungen war überhaupt nicht gefragt worden – waren auch nach Beendigung des Bürgerkrieges ergebnislos geblieben. Daß das Mädchen Maria spanischer Abkunft war, schien außer Frage; ihr äußeres und ihre Sprache ließen daran keinen Zweifel. Aber die ganze Westküste des Kontinents von Araukanien herauf bis Kalifornien war von Spaniern bewohnt, und die verheerenden Bürgerkriege hatten die Menschen durcheinandergerüttelt. Es war auch manch einer verlorengegangen in diesen Jahren und niemals wieder aufgetaucht.
Maria selbst wußte nichts über Herkunft und Abstammung zu sagen. Sie redete noch jahrelang von Mama, Papa und Nina; unter Doña Inez' liebevoller Sorge vergaß sie bald auch diese. Don Antonio d'Irala, aus dem Bürgerkrieg glücklich heimgekehrt, nahm das fremde Mädchen an Kindesstatt an, und Doña Inez wurde ihm eine gute und liebevolle Mutter, zumal sie selbst keine Kinder hatte.
Auch durch Pablo war nichts darüber zu ermitteln gewesen, aus welchem Lande Maria stammen könnte. Der Junge wurde Marias wegen im Herrenhaus geduldet. Señior d'Irala hatte lange gezögert, bis er seinem Stolz diese Konzession abzwang. Pablo sprach spanisch, als hätte er nie eine andere Sprache gesprochen; ob er außerdem eines indianischen Dialektes mächtig war, hatte man nicht zu erkennen vermocht. Er sprach nie ein indianisches Wort. Die Sprache der Xinka-Indianer, aus denen, untermischt mit Mestizen und Negern, die Arbeiterbevölkerung der großen Hazienda zusammengesetzt war, sprach er zweifellos nicht. Auch seine Herkunft blieb ungewiß. Niemand vermochte zu erkennen, ob er aus Chile, Peru oder Mexiko stammte, oder aber etwa dem in Mittelamerika damals noch recht zahlreichen Volke der Mayas angehörte, die einmal die Herren dieses Landes gewesen waren.
Der Junge und der heranwachsende junge Mann blieben gleicherweise verschlossen; es war schwer, ihm ein Wort zu entlocken. Nur Maria gegenüber ging er aus seiner offenbar angeborenen Zurückhaltung heraus; mit ihr konnte er plaudern und scherzen wie jeder andere junge Mann seines Alters. Den indianischen Arbeitern gegenüber trug er einen ausgesprochenen Hochmut zur Schau, der von Verachtung nicht weit entfernt war.
Als Maria alt genug schien, ließ Doña Inez beide Kinder durch den jungen Cura, der als Seelsorger auf der Hazienda weilte, unterrichten. Der braune Junge lernte mit einer erstaunlichen Begabung und eisernem Fleiß. Daneben freilich trieb er sich viel in Wald und Feld umher und blieb zu Doña Inez' großer Sorge nicht selten über Nacht aus. »Es hat eben keinen Sinn«, pflegte Don Antonio in solchen Fällen zu sagen, »man kann aus einem Indio keinen Caballero machen, der Bursche ist und bleibt ein halb gezähmter Puma. Die wilde Natur bricht immer wieder durch.«
Außer Maria und dem jungen Padre Bernardo lebte nur noch ein Mensch auf der Hazienda del Roca, zu dem Pablo ein persönliches Verhältnis gewonnen zu haben schien. Es war dies ein älterer Indianer unbekannter Herkunft, der auf del Roca als Jäger diente. Die Xinkas, mit denen er keinerlei Beziehungen unterhielt, die ihm aber scheu aus dem Wege zu gehen pflegten, meinten, er gehöre den Bergmayas an. Zu ihm schien Pablo sich hingezogen zu fühlen, mindestens hatte es den Anschein, jedenfalls sah man die beiden oft beieinandersitzen und in der gemessenen Weise der Ureingeborenen miteinander reden. Lauscher wollten vernommen haben, daß sie sich in der Mayasprache unterhielten, doch wurde dies niemals sicher festgestellt, wie überhaupt dunkel blieb, welcher Art die Beziehungen zwischen dem jungen Pablo und dem alten Tamay waren, mit dem sonst niemand etwas zu schaffen hatte. Sicher war nur, daß Tamay der einzige Indianer war, von dem Pablo überhaupt Notiz nahm.
Der Junge war nun siebzehn Jahre alt, er war schlank und hochgewachsen und für sein Alter außerordentlich kräftig gebaut. Seine Haltung gab der des stolzesten Kastilianers in nichts nach. Sein hartes und stolzes Profil erinnerte mehr an einen Römer denn an einen Indianer. Unter Tamays Anleitung war er ein großer Jäger geworden; er traf mit unfehlbarer Sicherheit den springenden Hirsch.. Don Antonio hatte aus ihm einen vollendeten Reiter gemacht, der das wildeste Tier zu bändigen wußte und in vollendeter Haltung im Sattel saß. Auch den Lasso wußte er zu handhaben wie der geübteste Rinderhirte.
D'Irala hatte ursprünglich beabsichtigt, den anstelligen Burschen in den umfangreichen Betrieb seiner Hazienda einzuweihen, damit er eines Tages als Majordomo die Oberleitung übernehmen könne; dieser Versuch war gescheitert. Pablo zeigte keinerlei Neigung und Sinn für die Landwirtschaft. In diesem Bereich versagte seine schnelle Auffassungsgabe vollkommen.
Dagegen interessierte er sich leidenschaftlich für die Vor- und Urgeschichte des Landes; er konnte gar nicht genug darüber hören. Allein die reiche Hazienda des Konquistadorenenkels bot seinem Forschungseifer insoweit wenig Möglichkeiten. Schließlich entdeckte Pablo in einer kleinen Bibliothek d'Iralas ein Buch, das im vorigen Jahrhundert in Madrid gedruckt worden war und die Geschichte der Eroberung Guatemalas durch die Spanier behandelte. Das Buch war einseitig zum Ruhme der spanischen Glaubensritter geschrieben, doch ging nichtsdestoweniger daraus hervor, mit welchem Heldentum sich die Mayas gegen die eisengepanzerten Ritter, gegen deren Geschütze und Feuerwaffen zur Wehr gesetzt hatten. Der Junge las dieses Buch immer von neuem, er vertiefte sich in die zahllosen Kupferstiche, die federgeschmückte Indianer im Kampf mit spanischen Rittern zeigten. Er bestürmte Pater Bernardo, ihm mehr von Einzelheiten jener alten Kämpfe zu erzählen, aber der gute Padre wußte nur wenig von der Eroberungsgeschichte des Landes, und die Zeit vor der Eroberung war ihm erst recht ein Buch mit sieben Siegeln. Die Xinka-Arbeiter bewahrten nicht die geringste überlieferung an jene Epoche, außerdem war Pablo weit entfernt davon, mit ihnen über diese Dinge zu reden. Wußte Tamay, der Jäger, mehr von den alten Geschichten? Es mochte wohl sein. Jedenfalls konnte Pablo stundenlang neben ihm sitzen und dem ruhigen und gleichmäßigen Fluß seiner Rede lauschen. Oft wurden die beiden so nebeneinander sitzend beobachtet. Pablos junges Gesicht schien dann bei aller äußeren Beherrschung von innerer Bewegung zu glühen, während in Tamays schier versteinerten Zügen kein Muskel zuckte.
Am frühen Nachmittag eines besonders heißen Tages saßen Don Antonio, die Señora und Doña Maria auf der Veranda beim Tee. D'Irala war nun ein Mann Mitte der Vierzig; sein dunkles Haar begann an den Schläfen schon leicht zu ergrauen. An Doña Inez schienen die Jahre spurlos vorübergegangen. Das kleine Mädchen, das vor vielen Jahren von den Wracktrümmern eines gescheiterten Schiffes geborgen wurde, war nun eine junge Dame geworden. Sie war schlank und zierlich von Gestalt; das feine Oval ihres von dunklen Locken umwallten Gesichts zeigte trotz der leichten Sonnenbräune einen sehr hellen, fast durchsichtigen Teint; ein Zug nervöser Unruhe lag über diesem Antlitz; er schien von den Augen auszugehen, sonderbar hellen Augen, die jedes Gefühl widerspiegelten.
Man saß schon ein Weilchen zusammen, und noch immer stand ein Gedeck ungenützt. Don Antonio saß ein wenig nachlässig in seinen Sessel zurückgelehnt und war mit der Durchsicht einiger Papiere beschäftigt; der Señora schien die Hitze nichts anzuhaben; jede ihrer Bewegungen verriet Gleichmut und Ruhe; um so unruhiger schien Maria, man merkte ihr an, daß nur Erziehung und Sitte sie ruhig auf ihrem Platze hielten.
Eiliger Hufschlag wurde vernehmbar, Maria zuckte zusammen, Don Antonio legte seine Papiere aus der Hand; auf seiner Stirn erschien eine Unmut verkündende Falte. Gleich darauf betrat Pablo im Reitanzug die Veranda, verbeugte sich knapp, aber mit vollendeter Grandezza vor den Damen und nahm seinen Platz ein.
»Don Pablo führt sonderbare Sitten bei uns ein«, bemerkte d'Irala, »die Teestunde ist fast vorüber.«
Pablo verzog keine Miene. »Verzeihung, Señior«, sagte er mit ruhiger Höflichkeit, »ich habe nach den Herden gesehen. Es schien mir heute mittag, Sie wüßten gern, wie es in den Llanos steht; ich habe mich auf dem Rückweg ein wenig verspätet.«
»Du warst bei den Herden? Das ist gut.« Die Falte auf d'Iralas Stirn verschwand, er streifte den jungen Mann mit einem freundlichen Blick. »Wie sieht's draußen aus?«
Pablo setzte die Teetasse hin. »Gut, Señor«, erwiderte er, »der Vaquerochef ist mit dem Viehstand recht zufrieden. Die Weide war gut, es ist ein Zugang von rund achthundert Tieren zu verzeichnen.«
»Ausgezeichnet, mein Junge.« Don Antonio schob seinen Sessel etwas zurück und zündete sich eine Zigarette an. »Wo trafst du die Vaqueros?«
»Dort, wo der Bach in den Rio Salado mündet.«
»Sehr gut. Ich werde morgen selbst hinausreiten; du kannst mich begleiten.«
»Danke, Señor.«
Maria, die Pablo gegenübersaß, legte klirrend den Löffel hin. »Ich bin auch noch da, Pablo«, sagte sie. »Aber ich weiß schon, warum du keinen Blick für mich hast. Wo ist das junge Reh, das du mir mitbringen wolltest?« Es zuckte ein wenig um ihren Mund, die Unruhe aus den Augen war weggewischt. »Sieh ihn dir an, Mama«, sagte sie, »sieht er nicht aus wie das verkörperte schlechte Gewissen?«
über Pablos kühl verschlossenes Gesicht glitt der Anflug eines Lächelns. »Ich muß mich entschuldigen«, sagte er, »aber es gibt zur Zeit keine jungen Rehe. Wenn du vielleicht mit einem jungen Panther fürliebnehmen würdest?«
»Um Gottes willen! Was nicht gar! Ich will keinen Panther! Untersteh dich nicht! Er ist wahrhaftig imstande und bringt mir eine junge Pantherkatze ins Haus; was sagst du, Papa?«
Der Papa sagte gar nichts, aber der lächelnde Blick, mit dem er den bronzefarbenen jungen Mann streifte, schien von einem leichten Schatten getrübt.
Ein Neger betrat die Veranda und meldete, daß zwei Caballeros auf das Haus zuritten; soweit er zu erkennen vermocht habe, seien es die Señores de Fonseca und Mendez.
»Sie sind willkommen«, sagte d'Irala, »nimm ihnen die Pferde ab.« Die eben noch lächelnden Gesichter der Damen verschlossen sich. Der Neger verschwand, und Pablo erhob sich vom Tisch, verbeugte sich knapp vor der Señora und entfernte sich. Er entsprach damit einer ein für allemal getroffenen übereinkunft, über die nicht viel geredet wurde: er hatte zu gehen, wenn weiße Caballeros das Haus betraten. Kaum einer dieser vor Hochmut berstenden Konquistadorenabkömmlinge hätte sich ohne äußersten Zwang mit einem Farbigen an einen Tisch gesetzt. Er ging, und sein Antlitz verriet nichts von dem, was er etwa empfand.
Er trat vor das Haus und sah sich den beiden Ankömmlingen gegenüber, benachbarten Hazienderos, eben denen, die der Neger zu erkennen geglaubt hatte. Auch Pablo kannte sie und sie kannten ihn. Als er mit höflichem Gruß an den Männern vorüber wollte, rief der Jüngere der beiden: »Sieh da, der rote Schlingel ist immer noch hier. Komm her, mein Junge, und halte mein Pferd!« Er sagte das, obgleich bereits zwei Peons bereitstanden, den Gästen die Pferde abzunehmen.
Pablo wandte nur flüchtig den Kopf. »Sie irren sich, Señor Mendez«, sagte er kalt, »ich bin kein Diener.«
»Bleib stehen, Bursche!« brüllte der Ankömmling. »Bist du wahnsinnig geworden, einem Caballero einen Dienst zu verweigern! Gehorche, oder du bekommst meine Peitsche zu fühlen!«
»Das würde der Señor bereuen!« Noch immer schien Pablos Gesicht unbewegt, aber sekundenlang flammte in seinen Augen ein Funke auf.
»Schluß jetzt, Don Louis!« sagte der andere Pflanzer, ein älterer Mann, und legte dem Jüngeren die Hand auf den Arm. »Du weißt, daß der Junge zu d'Iralas Familie gehört.« Pablo entfernte sich, ohne die Ankömmlinge weiter eines Blickes zu würdigen.
»Es ist unerhört!« schrie Louis Mendez, vom Pferde springend. »Wie komme ich dazu, mir von einem Indio dergleichen bieten zu lassen? Den Burschen möcht' ich auf meiner Hazienda haben. Der wäre bald klein. Ich begreife d'Irala nicht.«
Sie gingen durch den Patio der Veranda zu, wo Don Antonio sie bereits erwartete. »Nett von Ihnen, einmal bei uns vorzusprechen«, sagte d'Irala und geleitete die Gäste zu den Damen. Die Begrüßung verlief in den zeremoniösen Formen der spanischen Etikette, doch saß man gleich darauf plaudernd beim Tee.
»Doña Maria entwickelt sich langsam zu einer vollendeten Schönheit«, sagte der alte Fonseca schmunzelnd, »es wird nicht lange dauern und sie überstrahlt alle unsere Señoritas.«
»Mach mir die kleine Hexe nicht eitel«, lachte d'Irala. »Sie hat vorerst noch allerlei bei Pater Bernardo zu lernen, und da hapert's ein bißchen.«
»Das ist wahr, ich muß es zugeben«, lächelte Maria, »ich eigne mich nicht sehr für die Gelehrsamkeit. Dafür ist Pablo um so eifriger.«
»Ah, Don Pablo, der Indianerprinz!« Mendez lachte verärgert auf. »Offen gestanden, d'Irala«, sagte er, »ich begreife nicht, wie du einen Indio an deinem Tisch dulden kannst. Und du weißt, daß es niemand begreift. Gewisse Grenzen sollten unter allen Umständen eingehalten werden.«
Don Antonio runzelte die Stirn. »Ich gebe dir das zu, Mendez«, sagte er, »obgleich – –; es ist ein schwieriger Fall. Du kennst die Zusammenhänge. Und außerdem – ich bin in diesem Fall außer Verantwortung. In unseren Häusern bestimmen die Damen die Etikette. Wende dich an Doña Maria.«
In Marias Augen flackerte wieder die heimliche Unruhe. Ihr blasses Gesicht wurde um einen Schein bleicher, aber aus ihrer leisen Stimme klang Festigkeit und Entschlossenheit. »Es wird wenig Sinn haben, darüber zu sprechen«, sagte sie, »ich bin mit Pablo aufgewachsen; er ist mein Bruder. Er ist gut und brav und klüger als mancher Weiße. Für seine Farbe kann er nicht.«
Der alte Fonseca sah das Mädchen mit offenem Lachen an. »Gewiß nicht, Señorita«, sagte er, »aber er ist nun einmal braun, und braune Leute – –«; er brach ab, seine Stimme schlug um, wurde kalt. »Eure Sentiments in Ehren, Señorita«, stieß er heraus, »aber Indios gehören nicht in ein weißes Haus. Das war so und ist so, seit weiße Männer in diesen Ländern leben.«
Marias blasses Antlitz erstarrte zu eisiger Kälte; sie schwieg.
De Fonseca sah es, und der Zwiespalt, der ihn bewegte, malte sich in seinem Gesicht. Er war ein ehrlicher Mann, ein gerader Kerl, der seine Leute gut behandelte und bei dem auch kein Indio zu klagen hatte. Aber er setzte sich auch nicht mit ihnen an einen Tisch. Er tat nicht das schlechthin Unmögliche. Andererseits, man kränkte hierzulande eine Dame nicht; eine Dame hat auch dann recht, wenn sie unrecht hat. Aber – wußte man denn eigentlich, wer diese junge Dame war? Sie war mit diesem Indio zusammen geborgen und nach ihrem kindlichen Benehmen offenbar zusammen erzogen worden; die Sache war ärgerlich. Man hätte erst gar nicht davon anfangen sollen. Nun mußte man wohl oder übel etwas sagen, und man konnte nur das sagen, was jeder Caballero in diesem Falle sagen würde.
»Es ist mir peinlich, d'Irala«, fuhr er fort, »und wie die Dinge liegen, hätten wir besser gar nicht darüber gesprochen. Aber du kannst erwarten, daß ich meine Meinung sage. Ich begreife nicht, wie du den Jungen, der gewiß ein ordentlicher Kerl ist, wie einen Weißen erziehen konntest. Was hat das für einen Sinn? Es bringt weder uns noch ihm Vorteil!«
»Das weiß ich nun nicht ganz«, sagte d'Irala ernst, »ich bin im Grunde deiner Meinung, und die Sache hat mich überwindung gekostet, das kannst du mir glauben. Indessen, wer weiß? Vielleicht ist es ganz gut, ein paar rote Leute zu haben, die über eine abgeschlossene Bildung verfügen. Es könnte eine Zeit kommen, wo sie uns nützen.«
»Möge uns der Himmel bewahren!« rief de Fonseca empört. »Das fehlte noch, daß wir uns zur Durchsetzung unserer erworbenen Rechte eines Tages roter Hilfe bedienen müßten!«
»Wahrhaftig, das wäre das letzte!« fiel Mendez ein, »das wäre der Anfang vom Ende! überhaupt«, setzte er hinzu, »nennen wir die Dinge doch beim Namen: Mensch ist Mensch und Vieh ist Vieh!«
Eine Teetasse klirrte, zwei Sessel wurden gleichzeitig zurückgeschoben. Marias blasses Gesicht flammte plötzlich vor Zorn. Sie wandte sich mit brüsker Bewegung ab und verließ die Veranda. Und auch die so gelassene und innerlich sichere Señora schien sich nur noch mit Mühe zu beherrschen. Sie habe noch einige Anordnungen zu treffen, bemerkte sie kalt und folgte dem hocherregten Mädchen.
Die Männer blieben nun doch betroffen zurück; d'Iralas Gesicht war finster verschattet. Er zerbiß seine Zigarette und warf sie in den Aschenbecher. Irgendwie muß das ein Ende haben, dachte er.