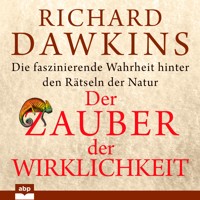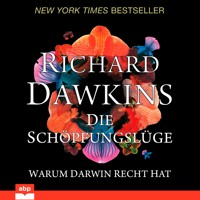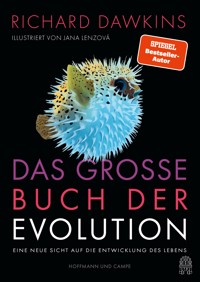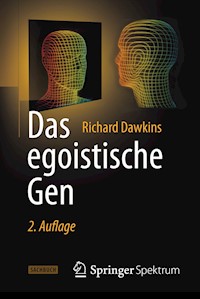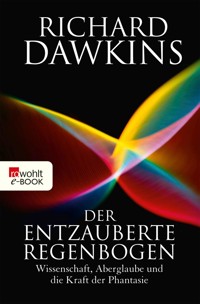
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Richard Dawkins beweist mit dem Buch «Der entzauberte Regenbogen», dass Wissenschaft alles andere als kalt, trocken und langweilig ist. Er macht deutlich, wie wunderbar die Dinge sind, gerade wenn wir um sie wissen. Das Gefühl des Staunens über die Natur verliert sich keineswegs, wenn man versucht, den Erscheinungen auf den Grund zu gehen, und das Wunderbare wird nicht weniger wunderbar, wenn wir es erklären können. Ohne die Entzauberung des Regenbogens wüssten wir heute sehr viel weniger über den Kosmos. Gleichzeitig tritt einer der besten Sachbuchautoren unserer Zeit an, Aberglauben und mystischen Kult als falschverstandene Romantik und bewusste Irreführung zu entlarven, und geht hart mit denen ins Gericht, die den Trend zum Mystischen ausnutzen, um damit Geschäfte zu machen. «Richard Dawkins kann etwas, was Charles Darwin nicht konnte: phantastisch erzählen!» (New York Times)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Richard Dawkins
Der entzauberte Regenbogen
Wissenschaft, Aberglaube und die Kraft der Phantasie
Deutsch von Sebastian Vogel
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
1. Die betäubende Wirkung des Vertrauten
2. Im Salon der Herzöge
3. Strichcodes in den Sternen
4. Strichcodes in der Luft
5. Strichcodes vor Gericht
6. Märchen, Geister, Sternendeuter
7. Berechnete Schauer
8. Wolkige Symbole von höchster Romantik
9. Der egoistische Kooperator
10. Das genetische Totenbuch
11. Die Welt wird neu verwoben
12. Ein Ballon zum Denken
Literatur
Register
Für Lalla
Vorwort
Ein ausländischer Verleger meines ersten Buches gestand mir einmal, er habe drei Nächte nicht geschlafen, nachdem er es gelesen hatte – weil ihm die Botschaft so kalt und düster vorgekommen sei. Andere fragten mich, wie ich es überhaupt fertig brächte, morgens noch aufzustehen. Ein Lehrer aus einem weit entfernten Land schrieb mir vorwurfsvoll, eine seiner Schülerinnen habe dasselbe Buch gelesen und sei dann in Tränen aufgelöst zu ihm gekommen, weil sie nun überzeugt war, ihr Leben sei leer und sinnlos. Er habe ihr geraten, das Buch nicht ihren Freundinnen zu zeigen, damit diese nicht vom gleichen nihilistischen Pessimismus angesteckt würden. Ähnliche Vorwürfe – öde Trostlosigkeit, trockene, freudlose Inhalte – werden oft ganz allgemein gegen die Naturwissenschaft erhoben, und die Naturwissenschaftler selbst tragen nur allzu leicht dazu bei. Zum Beispiel eröffnet mein Kollege Peter Atkins sein 1984 erschienenes Buch The Second Law:
Wir sind Kinder des Chaos, und Zerfall ist die Voraussetzung allen Wandels. Im Grunde gibt es nur die Auflösung und den unaufhaltsamen Sog des Chaos. Dahin ist jeder Zweck; was bleibt, ist nur die Richtung. Damit müssen wir uns abfinden, wenn wir leidenschaftslos immer tiefer ins Universum vorstoßen.
Aber diese völlig richtige Befreiung von süßlich-falschen Zielen, diese lobenswerte Seelenstärke bei der Entlarvung kosmischer Sentimentalität darf man nicht mit dem Aufgeben der eigenen, persönlichen Hoffnungen verwechseln. Hinter dem Schicksal des Kosmos steht letztlich wahrscheinlich tatsächlich kein Sinn, aber knüpft irgendjemand die Hoffnungen seines Lebens an das Schicksal des Kosmos? Natürlich nicht; das tut kein geistig gesunder Mensch. Unser Leben wird durch alle möglichen näher liegenden, gefühlvolleren, menschlichen Bestrebungen und Wahrnehmungen beherrscht. Der Naturwissenschaft vorzuwerfen, sie nehme dem Leben die Wärme, die es erst lebenswert macht, ist so grotesk falsch, meinem eigenen Empfinden und dem der meisten Naturwissenschaftler so diametral entgegengesetzt, dass mich fast schon die Verzweiflung packt, die man mir fälschlicherweise unterstellt. Mit diesem Buch möchte ich eine positivere Antwort geben und das Wunderbare in der Naturwissenschaft in den Mittelpunkt rücken, denn wenn ich daran denke, was die Kritiker und Nörgler verpassen, werde ich wirklich traurig. Solche Antworten waren eine Stärke des verstorbenen Carl Sagan, und er fehlt uns schon deswegen sehr. Das Gefühl des ehrfürchtigen Staunens, das uns die Naturwissenschaft vermitteln kann, gehört zu den erhabensten Erlebnissen, deren die menschliche Seele fähig ist. Es ist eine tiefe ästhetische Empfindung, gleichrangig mit dem Schönsten, das Dichtung und Musik uns geben können. Es gehört zu den Dingen, die das Leben lebenswert machen, und am meisten gilt das gerade dann, wenn es in uns die Überzeugung weckt, dass unsere Lebenszeit endlich ist.
Unweaving the Rainbow 1, der englische Titel des Buches, stammt von Keats, nach dessen Ansicht Newton die Poesie des Regenbogens zerstört hatte, weil er ihn in seine Spektralfarben zerlegte. Ein größerer Irrtum hätte Keats kaum unterlaufen können, und ich möchte alle, die zu ähnlichen Ansichten neigen, vom Gegenteil überzeugen. Naturwissenschaft ist eine Inspiration für große Dichtung oder sollte es zumindest sein, aber ich habe nicht die Begabung, selbst den Nachweis für diese Behauptung zu führen, und muss mich deshalb mit meiner Überzeugungsarbeit auf Prosa beschränken. Aber der aufmerksame Leser wird gewiss die eine oder andere Anspielung auf ihn (und andere) im Text wieder finden. Sie sollen ein Tribut an sein empfindsames Genie sein. Keats besaß eine liebenswürdigere Persönlichkeit als Newton, und sein Schatten sah mir beim Schreiben immer wieder kritisch über die Schulter.
Newtons Entwirrung des Regenbogens führte zur Spektroskopie, und die erwies sich als Schlüssel zu vielem, was wir heute über den Kosmos wissen. Und jedem Poeten, der die Bezeichnung «Romantiker» verdient, muss das Herz im Leibe hüpfen, wenn er das Universum eines Einstein, Hubble oder Hawking betrachtet. Über das Wesen des Universums erfahren wir etwas durch die Fraunhofer-Linien – den «Strichcode in den Sternen» – und ihre Verschiebung im Spektrum. Das Bild des Strichcodes führt uns weiter in die ganz andere, aber ebenso faszinierende Welt des Schalls («Strichcodes in der Luft») und dann zu den DNA-Fingerabdrücken («Strichcodes vor Gericht»), was mir die Gelegenheit verschafft, die Rolle der Naturwissenschaft in der Gesellschaft auch unter anderen Gesichtspunkten zu betrachten.
Der nächste Teil des Buches handelt von Täuschungen. In den Kapiteln «Märchen, Geister, Sternendeuter» und «Berechnete Schauer» befasse ich mich mit jenen normalen Abergläubischen, die nicht als hehre Poeten den Regenbogen verteidigen, sondern sich im Rätselhaften aalen und sich verraten fühlen, wenn man ihnen eine Erklärung liefert. Solche Leute lesen gerne Gruselgeschichten und denken sofort an Poltergeister oder Wunder, wenn etwas Ungewöhnliches geschieht. Sie lassen keine Gelegenheit aus, die berühmten Zeilen aus «Hamlet»
Es gibt mehr Ding im Himmel und auf Erden,
Als eure Schulweisheit sich träumt
zu zitieren, und die Antwort des Naturwissenschaftlers («ja, aber wir arbeiten daran») lässt sie unbeirrt. Wer ein richtiges Geheimnis durch Erklären lüftet, ist in ihren Augen ebenso ein Spielverderber, wie Newton es mit seiner Erklärung des Regenbogens für manche Dichter der Romantik war.
Michael Sheermer, der Redakteur der Zeitschrift Skeptic, kann ein Lied davon singen. Er berichtet, wie er einmal einen berühmten Fernsehspiritisten öffentlich entlarvte. Der Mann zeigte ganz normale Zaubertricks und führte die Zuschauer dabei so an der Nase herum, dass sie glaubten, er trete mit Verstorbenen und Geistern in Kontakt. Aber anstatt sich gegen den entlarvten Scharlatan zu wenden, griff das Publikum den Aufklärer an und unterstützte eine Frau, die ihm «ungehöriges» Verhalten vorwarf, weil er den Leuten ihre Illusion genommen hatte. Eigentlich hätte sie ihm dankbar sein müssen, weil er ihr die Augen geöffnet hatte, aber die Dame zog es offensichtlich vor, sie fest geschlossen zu halten. Nach meiner Überzeugung ist ein geordnetes Universum, das unabhängig von den Vorlieben der Menschen existiert und in dem es für alles eine Erklärung gibt – auch wenn wir vielleicht noch lange brauchen, bis wir sie finden–, etwas viel Schöneres als ein Universum, das sich durch irgendwelchen Hokuspokus austricksen lässt.
In der Parapsychologie kann man einen Missbrauch des legitimen Gefühls des Staunens sehen, das eigentlich von echter Naturwissenschaft genährt werden sollte. Eine andere Gefahr lauert in dem, was man als «schlechte Poesie» bezeichnen könnte. Das Kapitel «Wolkige Symbole von höchster Romantik» warnt vor der Verführung durch schlechte Poesie in der Naturwissenschaft und irreführende Rhetorik. Anhand von Beispielen befasse ich mich schwerpunktmäßig mit den Beiträgen eines Autors aus meinem eigenen Fachgebiet, der mit seinen phantasievollen Schriften – vor allem, aber nicht nur in Amerika – einen unverhältnismäßig großen und, wie ich meine, unglückseligen Einfluss auf das Evolutionsverständnis vieler, nicht wissenschaftlich geschulter Leser gewonnen hat. Aber die wichtigste Stoßrichtung des Buches ist die Förderung guter naturwissenschaftlicher Poesie. Damit meine ich natürlich keine wissenschaftlichen Erkenntnisse in Versform, sondern eine Naturwissenschaft, die ihre Inspiration aus dem poetischen Gefühl des Staunens bezieht.
Die letzten vier Kapitel behandeln vier verschiedene, aber zusammenhängende Themen und geben einige Hinweise, was Naturwissenschaftler tun könnten, die poetisch begabter sind als ich. Gene, so egoistisch sie auch sein mögen, müssen auch «kooperativ» im Sinne von Adam Smith sein (deshalb beginnt das Kapitel «Der egoistische Kooperator» mit einem Zitat dieses Autors, das sich allerdings eigentlich nicht auf das hier behandelte Thema, sondern auf das Staunen als solches bezieht). In den Genen einer Spezies kann man eine Beschreibung früherer Welten sehen, ein «genetisches Totenbuch». Auf ganz ähnliche Weise fügt das Gehirn die Welt wieder zusammen: Es schafft im Kopf eine Art «virtuelle Realität», die ständig aktualisiert wird. In «Ein Ballon zum Denken» stelle ich Spekulationen über die Ursprünge der einzigartigen Eigenschaften unserer Spezies an, um dann schließlich zum poetischen Impuls als solchem und seiner mutmaßlichen Rolle in unserer Evolution zurückzukehren.
Die Computersoftware ist die Triebkraft einer neuen Renaissance, und einige ihrer kreativen Genies sind Wohltäter und gleichzeitig selbst Renaissancemenschen. Charles Simonyi von Microsoft stiftete der Universität Oxford 1995 einen Lehrstuhl für öffentliche Wissenschaft, und ich wurde zu seinem ersten Inhaber ernannt. Ich bin Dr.Simonyi sehr dankbar, zunächst einmal natürlich für seine weitsichtige Großzügigkeit gegenüber einer Universität, mit der er zuvor in keiner Verbindung gestanden hatte, aber auch für seine phantasievolle Vision von Naturwissenschaft und ihrer Vermittlung. Diese brachte er in seiner schriftlichen Erklärung an das Oxford der Zukunft wunderschön zum Ausdruck (seine Stiftung ist auf Dauer angelegt, aber wie es seine Art ist, vermeidet er die schmucklose und sich nach allen Seiten absichernde Ausdrucksweise der Juristen). Inzwischen sind wir Freunde geworden und diskutieren ab und zu über solche Themen. Das vorliegende Buch kann man als meinen Beitrag zu diesem Gedankenaustausch und meine Antrittsrede als Simonyi-Professor sehen. Und wenn «Antrittsrede» nach zwei Jahren auf diesem Posten unpassend erscheint, möchte ich mir die Freiheit nehmen und noch einmal Keats zitieren:
Hiermit, Freund Charles, ist dir wohl demonstriert
Warum ich keine Zeile an dich je adressiert:
Weil, was ich dachte, niemals frei und klar
Und für ein klassisch Ohr kaum wohlgefällig war.
Dennoch liegt es auch in der Natur der Sache, dass das Verfassen eines Buches länger dauert als das von Zeitungsartikeln oder Vorträgen. Bei der Entstehung dieses Buches sind einige Produkte beider Gattungen und auch Fernsehsendungen nebenher abgefallen. Diese muss ich benennen, falls ein Leser hier und da einen Absatz wieder erkennt. Den englischen Titel «Unweaving the Rainbow» und das Thema von Keats’ Respektlosigkeit gegenüber Newton verwendete ich zum ersten Mal öffentlich, als ich 1997 aufgefordert wurde, die C.P.Snow Lecture am Christ College in Cambridge zu halten, Snows alter Hochschule. Ich habe zwar nicht ausdrücklich sein Thema der «zwei Kulturen» aufgenommen, aber es ist natürlich von großer Bedeutung. Noch wichtiger war das Buch Die dritte Kultur von John Brockman, der mir auch in ganz anderer Funktion, nämlich als mein Literaturagent, große Dienste erwiesen hat. Der englische Untertitel «Science, Delusion and the Appetite for Wonder». (Wissenschaft, Täuschung und die Lust auf Wunder) war die Überschrift meiner Richard Dimbledey Lecture im Jahr 1996.In der BBC-Aufzeichnung dieses Vortrages kommen einige Absätze aus einem frühen Entwurf des Buches vor. Ebenfalls 1996 moderierte ich auf Channel Four eine einstündige Fernsehdokumentation mit dem Titel Breaking the Science Barrier. Ihr Thema war die Naturwissenschaft in der Kultur, und einige der Grundgedanken, die ich zusammen mit dem Produzenten John Gau und dem Regisseur Simon Raikes entwickelte, haben dieses Buch ebenfalls beeinflusst. Im Jahr 1998 nahm ich einige Passagen des Buches in meinen Vortrag in der Reihe Sounding the Century auf, den das Hörfunkprogramm BBC 3 aus der Londoner Elizabeth Hall übertrug. (Für den Titel des Vortrages, «Science and Sensibility», danke ich meiner Frau; was ich davon halten soll, dass er unter anderem bereits von einer Supermarktzeitschrift übernommen wurde, weiß ich allerdings nicht.) Außerdem habe ich Passagen des Buches in Artikeln verwendet, die ich im Auftrag der Zeitungen Independent, Sunday Times und Observer verfasste. Als man mich 1997 mit dem International Cosmos Prize ehrte, wählte ich den Titel «The Selfish Cooperator». (Der egoistische Kooperator) für meinen Preisvortrag, den ich sowohl in Tokio als auch in Osaka hielt. Teile des Vortrages finden sich in überarbeiteter und erweiterter Form im Kapitel 9, das den gleichen Titel trägt.
Von großem Nutzen für das Buch war die konstruktive Kritik, die Michael Rodgers, John Catalano und Lord Birkett an einem früheren Entwurf übten. Michael Birkett ist für mich der ideale interessierte Laie. Seine scharfsinnig-kritischen Kommentare zu lesen, stellt schon ein Vergnügen für sich dar. Michael Rodgers lektorierte meine ersten drei Bücher und spielte, auf meinen ausdrücklichen Wunsch und dank seiner Großzügigkeit, auch bei den drei letzten eine wichtige Rolle. Danken möchte ich außerdem John Catalano, nicht nur für seine nützlichen Anmerkungen zu dem Buch, sondern auch für die Website http://www.spacelab.net/~catalj/home.htm, deren hohe Qualität – mit der ich nicht das Geringste zu tun habe – jeder erkennen wird, der sie besucht. Stefan McGrath und John Radziewicz, die Lektoren bei den Verlagen Penguin und Houghton Mifflin, halfen mir mit geduldiger Ermutigung und literarischen Ratschlägen, die ich sehr zu schätzen wusste. Sally Holloway redigierte unermüdlich und fröhlich die endgültige Fassung des Manuskriptes. Dank gebührt außerdem Ingrid Thomas, Bridget Muskett, James Randi, Nicholas Davies, Daniel Dennett, Mark Ridley, Alan Grafen, Juliet Dawkins, Anthony Nuttall und John Batchelor.
Meine Frau Lalla Ward übte an den einzelnen Entwürfen jedes Kapitels ein Dutzend Mal Kritik, und bei jedem Lesen half mir ihr sensibles Schauspielergehör, auf die Sprache und ihren Klang zu achten. Wann immer mir Zweifel kamen, glaubte sie an das Buch. Ihre Vision hielt es zusammen, und ohne ihre Hilfe und Ermutigung hätte ich es nicht vollenden können. Ich widme es ihr.
2 Im Salon der Herzöge
Jag durch dieselbe Mühle ihre Seelen,
Bind sie um Herz und Stirne fest genug;
Es wird der Dichter doch den Regenbogen wählen,
So wie sein Bruder folgt dem Pflug.
John Boyle O’Reilly (1844–1890),
«The Rainbow’s Treasure»
Die Betäubungswirkung des Vertrauten durchbrechen – das können Dichter am besten. Es ist ihr Beruf. Aber zu viele Dichter haben zu lange übersehen, welche Goldader der Inspiration die Naturwissenschaft darstellt. W.H.Auden, die führende Gestalt in seiner Dichtergeneration, empfand für die Wissenschaftler zwar eine schmeichelhafte Sympathie, aber auch er griff nur ihre praktische Seite heraus und verglich sie – zu ihren Gunsten – mit Politikern; welche dichterischen Möglichkeiten die Wissenschaft selbst birgt, erkannte er dagegen nicht.
Die eigentlichen Handelnden in unsrer Zeit, diejenigen, die die Welt verändern, sind nicht die Politiker und Staatsmänner, sondern die Wissenschaftler. Unglücklicherweise kann die Dichtung sie nicht feiern, weil ihre Taten auf Dinge, nicht auf Menschen gerichtet und deshalb wortlos sind.
Wenn ich mich in Gesellschaft von Naturwissenschaftlern befinde, komme ich mir stets wie ein schäbiger Vikar vor, der versehentlich in einen mit Herzögen angefüllten Salon geraten ist.
«Der Dichter und die Großstadt», Des Färbers Hand (1963)
Seltsamerweise geht es mir und vielen anderen Wissenschaftlern in Gegenwart von Dichtern genauso. Tatsächlich – ich werde darauf noch zurückkommen – ist das wohl die normale Einschätzung unserer Kultur, was das Verhältnis der Stellung von Wissenschaftlern und Dichtern betrifft, und es dürfte auch der Grund gewesen sein, dass Auden sich die Mühe machte und das Gegenteil feststellte. Aber warum behauptete er so entschieden, Dichtung könne Wissenschaftler und ihre Taten nicht feiern? Wissenschaftler verändern die Welt vielleicht nachhaltiger als Politiker und Staatsmänner, aber sie tun nicht nur das, und sicherlich ist es nicht das Einzige, wozu sie fähig sind. Wissenschaftler verändern auch unser Denken über die Welt als Ganzes. Sie helfen der Phantasie, sich rückwärts zur feurigen Entstehung der Zeit und vorwärts in die ewige Kälte zu begeben oder, mit den Worten von Keats, «unmittelbar in die Galaxis zu springen». Ist das sprachlose Universum kein lohnendes Thema? Warum soll ein Dichter nur Menschen feiern, nicht aber das langsame Mahlen der Naturkräfte, das sie hervorgebracht hat? Darwin versuchte das sehr tapfer, aber seine Begabung lag nicht in der Dichtung, sondern auf anderen Gebieten:
Es ist anziehend, eine dicht bewachsene Uferstrecke zu betrachten, bedeckt mit blühenden Pflanzen vielerlei Art, mit singenden Vögeln in den Büschen, mit schwärmenden Insekten in der Luft, mit kriechenden Würmern im feuchten Boden, und sich dabei zu überlegen, daß alle diese künstlich gebauten Lebensformen, so abweichend unter sich und in einer so komplizierten Weise von einander abhängig, durch Gesetze hervorgebracht sind, welche noch fort und fort um uns wirken… So geht aus dem Kampfe der Natur, aus Hunger und Tod unmittelbar die Lösung des höchsten Problems hervor, das wir zu fassen vermögen, die Erzeugung immer höherer und vollkommenerer Tiere. Es ist wahrlich eine großartige Ansicht, daß der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder nur einer einzigen Form eingehaucht hat, und daß, während unser Planet den strengsten Gesetzen der Schwerkraft folgend sich im Kreise geschwungen, aus so einfachem Anfange sich eine endlose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und noch immer entwickelt.
Die Entstehung der Arten (1859)
William Blake hatte religiöse und mystische Interessen, und doch würde ich mir wünschen, ich selbst hätte Wort für Wort den folgenden berühmten Vierzeiler geschrieben. Wäre ich sein Urheber, hätte ich damit eine ganz andere Inspiration und Bedeutung verbunden:
Die Welt zu sehn im Korn aus Sand,
Das Firmament im Blumenbunde,
Unendlichkeit halt’ in der Hand
Und Ewigkeit in einer Stunde.
«Weissagungen der Unschuld». (ca. 1803)
Diese Strophe kann man so lesen, als handele sie ausschließlich von Naturwissenschaft, ausschließlich von dem Standort im wandernden Scheinwerferkegel, von der Zähmung des Raumes und der Zeit, vom ganz Großen, das aus den Quantenkörnchen des ganz Kleinen aufgebaut ist, von einer einsamen Blume als verkleinertem Abbild der gesamten Evolution. Der Hang zu Ehrfurcht, Demut und Staunen, der Blake zum Mystizismus (und kleinere Geister, wie wir noch sehen werden, zu paranormalem Aberglauben) führte, ist genau der gleiche, der andere zur Naturwissenschaft führt. Unsere Deutung ist eine andere, aber angeregt werden wir durch dieselben Phänomene. Der Mystiker gibt sich damit zufrieden, sich am Wunder zu ergötzen und ein Geheimnis zu genießen, das wir nicht verstehen «sollen». Der Naturwissenschaftler empfindet das gleiche Staunen, aber er ist nicht damit zufrieden, sondern unruhig; erkennt er ein tiefgründiges Geheimnis, so fügt er hinzu: «Aber wir arbeiten daran.»
Blake mochte die Naturwissenschaft nicht – er fürchtete und verachtete sie sogar:
Denn Bacon und Newton, bewehrt mit grimmgem Stahl, die Eisenknute bedrohlich schwingen über Albion; Folgrungsketten, gleich riesgen Schlangen, winden sich um meine Glieder…
«Bacon, Newton, and Locke», Jerusalem (1804–1820)
Welche Vergeudung dichterischen Talents! Selbst wenn hinter seinem Gedicht ein politisches Motiv stand – und man kann sicher sein, dass moderne Kommentatoren darauf beharren werden–, bleibt es eine Vergeudung: Politik und die Beschäftigung damit sind im Vergleich so oberflächlich! Nach meiner Überzeugung könnten Dichter die Inspiration, die von der Naturwissenschaft ausgeht, viel besser verwenden, und gleichzeitig müssen Naturwissenschaftler die Klientel zu erreichen versuchen, die ich mangels eines besseren Wortes als Dichter bezeichne.
Das bedeutet natürlich nicht, dass man naturwissenschaftliche Erkenntnisse in Versform deklamieren sollte. Die gereimten Zweizeller von Erasmus Darwin, Charles’ Großvater, standen zwar zu seiner Zeit in erstaunlich hohem Ansehen, aber der Wissenschaft nützten sie nichts. Und wenn Naturwissenschaftler nicht gerade über die Begabung von Carl Sagan, Peter Atkins oder Loren Eiseley verfügen, sollten sie in ihren Ausführungen ganz bewusst einen Stil poetischer Prosa pflegen. Einfache, nüchterne Klarheit, die Tatsachen und Ideen für sich sprechen lässt, erfüllt den Zweck sehr gut. Die Poesie liegt in der Wissenschaft selbst.
Dichter können – manchmal mit gutem Grund – rätselhaft schreiben, und sie beanspruchen für sich zu Recht die Befreiung von der Pflicht, ihre Gedankengänge zu erklären. «Sagen Sie mir, Mr.Eliot, wie geht das im Einzelnen, wenn man das Leben mit Teelöffeln abmessen will?» Das wäre, gelinde ausgedrückt, alles andere als eine gute Gesprächseröffnung, aber ein Naturwissenschaftler muss mit solchen Fragen rechnen. «Wie kann ein Gen egoistisch sein?» – «Was fließt eigentlich in dem Fluss, der in Eden entspringt?»
Nach wie vor erläutere ich bei Bedarf, was der Gipfel des Unwahrscheinlichen bedeutet und wie man ihn langsam, Schritt für Schritt, erklimmt. Unsere Sprache soll erhellen und erklären, und wenn es uns mit einer Methode nicht gelingt, unsere Gedanken zu vermitteln, müssen wir uns eine andere ausdenken. Aber ohne an Klarheit zu verlieren – in Wirklichkeit bedeutet es sogar mehr Klarheit–, müssen wir für die wahre Naturwissenschaft wieder jene Haltung des ehrfürchtigen Staunens beanspruchen, die auch Mystiker wie Blake bewegte. Wahre Naturwissenschaft hat das gleiche Anrecht auf jenen Schauer im Rücken, der auf einer niedrigeren Ebene die Fans von Star Trek und Dr.Who fasziniert und der auf der alleruntersten Stufe von Astrologen, Hellsehern und Fernsehwahrsagern profitabel zweckentfremdet wird.
Die Zweckentfremdung durch Pseudowissenschaftler ist nicht die einzige Gefahr für unser Gefühl des Staunens. Eine andere droht durch populistische «Verdummung» – auch darauf werde ich später zurückkommen. Eine dritte ist die Feindseligkeit von Gelehrten, die in Zeitgeistdisziplinen zu Hause sind. So ist es zurzeit eine beliebte Marotte, in der Naturwissenschaft nur einen von vielen kulturellen Mythen zu sehen, mit nicht mehr Wahrheitsgehalt oder Gültigkeit als die Mythen jeder anderen Kultur. In den Vereinigten Staaten wird diese Haltung durch die Schuldgefühle wegen der entsetzlichen Behandlung der amerikanischen Ureinwohner genährt. Aber die Folgen dieser Einstellung nehmen manchmal lächerliche Züge an, so zum Beispiel im Fall des Kennewick-Menschen.
Der Mensch von Kennewick ist ein Skelett, das 1996 im US-Bundesstaat Washington entdeckt und mit der Radiokarbonmethode auf ein Alter von über 9000Jahren datiert wurde. Er faszinierte die Anthropologen, weil er anatomischen Indizien zufolge nicht mit den amerikanischen Ureinwohnern verwandt war und demnach vielleicht auf eine eigenständige, frühe Besiedelungswelle hinwies, die über die heutige Beringstraße oder vielleicht sogar aus Island kam. Man bereitete gerade die entscheidenden DNA-Untersuchungen vor, da wurde das Skelett von den Behörden beschlagnahmt; es sollte an Vertreter der örtlichen Indianerstämme übergeben werden, die es bestatten und alle weiteren Forschungen verbieten wollten. Natürlich führte das unter Naturwissenschaftlern und Archäologen zu einer Welle des Protestes. Selbst wenn der Kennewick-Mensch ein Vorläufer der heutigen Indianer war, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ihn eine enge Verwandtschaft mit jenen Stämmen verbindet, die 9000Jahre später zufällig in derselben Gegend leben.
Die Ureinwohner haben in den Vereinigten Staaten beträchtlichen juristischen Einfluss und wahrscheinlich hätte man «den Alten» tatsächlich an die Stämme übergeben, aber dann nahm die Sache eine bizarre Wendung. Die Asatru Folk Assembly, eine Gruppe, welche die nordischen Gottheiten Thor und Odin anbetet, reichte eine eigene Klage ein und behauptete, der Kennewick-Mensch sei in Wirklichkeit ein Wikinger. Der nordischen Sekte – ihre Ansichten kann man in der Zeitschrift The Runestone vom Sommer 1997 nachlesen – wurde sogar gestattet, über den Knochen einen Gottesdienst abzuhalten. Das wiederum erboste die Gemeinschaft der Yakama-Indianer; ihr Sprecher fürchtete, die Wikinger-Zeremonie könne «verhindern, dass der Geist des Kennewick-Menschen seinen Körper findet». Der Zwist zwischen Indianern und Nordländern wäre durch einen DNA-Vergleich ohne weiteres beizulegen gewesen, und die nordische Sekte war sehr erpicht darauf, dass eine solche Untersuchung stattfand. Die naturwissenschaftliche Analyse der Überreste hätte mit Sicherheit ein faszinierendes neues Licht auf die Frage geworfen, wann die ersten Menschen nach Amerika einwanderten. Aber schon die Idee, sich mit dieser Frage überhaupt zu befassen, erregt den Widerwillen der Indianerführer, denn nach ihrem Glauben leben ihre Vorfahren schon seit der Schöpfung auf dem Kontinent. Armand Minthorn, das religiöse Oberhaupt des Stammes der Umatilla, formulierte es so: «Aus unserer mündlich überlieferten Geschichte wissen wir, dass unser Volk seit Anbeginn der Zeiten ein Teil dieses Landes war. Im Gegensatz zu den Wissenschaftlern glauben wir nicht, dass unser Volk aus einem anderen Kontinent hierher gewandert ist.»
Für die Archäologen wäre es vielleicht am besten, wenn sie sich selbst zu einer Religionsgemeinschaft und die DNA-Typisierung zu ihrem Sakrament erklären würden. Das ist natürlich ein Witz, aber bei dem Klima, das Ende des 20.Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten herrscht, gibt es möglicherweise keinen anderen Ausweg. Mit einer Aussage wie «Die Radiokarbondatierung, die Mitochondrien-DNA und die archäologische Untersuchung der Keramik sprechen eindeutig dafür, dass es so und so ist» erreicht man gar nichts. Führt man dagegen «Ein grundlegender, unzweifelhafter Glaubenssatz meiner Kultur besagt, dass es so und so ist» ins Feld, hat man sofort die Aufmerksamkeit eines Richters erregt.
Ebenso erregt es in der akademischen Welt die Aufmerksamkeit derer, die Ende des 20.Jahrhunderts eine neue Form der wissenschaftsfeindlichen Rhetorik entdeckt haben – manchmal spricht man auch von «postmoderner Wissenschaftskritik». Am nachdrücklichsten wird sie von Paul Gross und Norman Levitt in dem 1994 erschienenen Buch Higher Superstition: The Academic Left and its Quarrels with Science (Höherer Aberglaube: Die akademische Linke und ihr Kampf mit der Wissenschaft) vertreten. Der amerikanische Anthropologe Matt Cartmill fasst die grundlegende Lehre so zusammen:
Wer behauptet, er besäße objektives Wissen über irgendetwas, versucht uns andere zu lenken und zu beherrschen… Objektive Tatsachen gibt es nicht. Alle angeblichen «Tatsachen» sind mit Theorien verunreinigt, und alle Theorien sind von moralischen und politischen Weltanschauungen durchtränkt… Wenn Ihnen also ein Typ im weißen Laborkittel erzählt, dieses oder jenes sei eine objektive Tatsache… muss hinter seinem gestärkten Kragen ein politisches Programm stecken.
«Oppressed by evolution», Zeitschrift Discover (1998)
Sogar innerhalb der Naturwissenschaften selbst gibt es eine kleine fünfte Kolonne, die solche Ansichten vertritt und damit uns anderen die Zeit stiehlt.
Nach Cartmills These gibt es eine unerwartete, unheilige Allianz zwischen der nichtswissenden, fundamentalistischen religiösen Rechten und der gelehrten akademischen Linken. Ein bizarrer Ausdruck dieser Allianz ist ihre gemeinsame Ablehnung der Evolutionstheorie. Die Gegnerschaft der Fundamentalisten ist ohne weiteres zu erkennen. Die der Linken ist eine Mischung aus allgemeiner Wissenschaftsfeindlichkeit, dem «Respekt». (einem der am meisten missbrauchten Wörter unserer Zeit) gegenüber den Schöpfungsmythen der Ureinwohner, und verschiedenen politischen Lehren. Die beiden seltsamen Verbündeten teilen eine Besorgnis um die «Menschenwürde» und betrachten es als Beleidigung, wenn Menschen als «Tiere» bezeichnet werden. Eine ähnliche Auffassung über die von ihnen so genannten «weltlichen Kreationisten» vertreten Barbara Ehrenreich und Janet McIntosh in ihrem Aufsatz «The New Creationism», der 1997 in der Zeitschrift The Nation erschien.
Die Anhänger von kulturellem Relativismus und «höherem Aberglauben» neigen dazu, die Suche nach der Wahrheit mit Hohn und Spott zu überschreiten. Das liegt unter anderem an ihrer Überzeugung, dass es in verschiedenen Kulturen verschiedene Wahrheiten gibt (das war der springende Punkt in der Geschichte über den Kennewick-Menschen), zum Teil aber auch an der Tatsache, dass Wissenschaftsphilosophen sich ohnehin nicht über die Wahrheit einigen können. Natürlich gibt es echte philosophische Schwierigkeiten. Ist eine Wahrheit schlicht eine bisher nicht widerlegte Hypothese? Welche Stellung hat die Wahrheit in der seltsamen Welt der Quantentheorie? Ist letztlich überhaupt etwas wahr? Andererseits hat kein Philosoph die geringsten Schwierigkeiten, sich der Sprache der Wahrheit zu bedienen, wenn man ihn fälschlicherweise eines Verbrechens beschuldigt oder wenn er den Verdacht hat, dass seine Frau fremdgeht. «Ist es wahr?» – das hört sich nach einer berechtigten Frage an, und wenn man sie im Privatleben stellte, würde sich kaum jemand mit einer Antwort voller logikverdrehender Sophisterei zufrieden geben. Wer Gedankenexperimente mit Quanten anstellt, weiß vielleicht nicht, in welchem Sinn es «wahr» ist, dass Schrödingers Katze nicht mehr lebt. Aber ob die Behauptung wahr ist, dass die Katze Jane aus meiner Kindheit nicht mehr lebt, weiß jeder. Und auch in der Naturwissenschaft behaupten wir bei vielen Wahrheiten nur, dass sie in dem gleichen alltäglichen Sinn wahr sind. Wenn ich Ihnen sage, Menschen und Schimpansen hätten einen gemeinsamen Vorfahren, können Sie den Wahrheitsgehalt meiner Behauptung anzweifeln und (vergeblich) nach Belegen suchen, dass sie nicht stimmt. Aber wir wissen beide, was es bedeuten würde, wenn sie wahr wäre, und was es bedeuten würde, wenn sie falsch wäre. Es ist die gleiche Kategorie wie in der Frage «Stimmt es, dass Sie am Abend des Verbrechens in Oxford waren?» und nicht die schwierige Kategorie nach dem Muster «Stimmt es, dass ein Quant eine Position hat?». Ja, die Wahrheit bereitet philosophische Schwierigkeiten, aber bis wir uns deswegen den Kopf zerbrechen müssen, können wir schon ziemlich weit kommen. Voreilig angebliche philosophische Probleme aufzubauen ist manchmal eine Taktik, um Unsinn zu verschleiern.
Eine ganz andere Bedrohung für das wissenschaftlich Sinnvolle ist die an Verdummung grenzende Popularisierung. Das Bestreben, «Naturwissenschaft allgemein verständlich zu machen», das in Amerika durch den triumphalen Einzug der Sowjetunion ins Weltraumzeitalter ausgelöst wurde und seine Triebkraft heute zumindest in Großbritannien aus der öffentlichen Besorgnis um mangelndes Interesse für naturwissenschaftliche Studiengänge bezieht, wird immer volkstümlicher. «Wissenschaftswochen» und «Wissenschaftsshows» verraten die ängstliche Sorge der Naturwissenschaftler, ob sie auch gemocht werden. Komische Hüte und quäkende Stimmen sollen die Menschen glauben machen, Wissenschaft sei Spaß, Spaß und immer nur Spaß. «Tolle Kerle» veranstalten Explosionen und zeigen Furcht erregende Tricks. In einer Lagebesprechung, an der ich kürzlich teilnahm, wurden Wissenschaftler gedrängt, in Einkaufspassagen etwas vorzuführen, um den Leuten die Freuden der Wissenschaft schmackhaft zu machen. Wir sollten nichts tun, so der Rat des Vortragenden, was man als Abschreckung deuten könnte. Immer sollst du dafür sorgen, dass deine Wissenschaft «von Bedeutung» für das Leben der normalen Menschen ist, für das, was sich in ihren Küchen und Badezimmern abspielt. Wenn möglich, wähle das Material für deine Experimente so, dass das Publikum es am Ende aufessen kann. Das wissenschaftliche Phänomen, das bei dem letzten, vom Vortragenden selbst organisierten «Event» die Aufmerksamkeit am stärksten fesselte, war das Urinal, das sich von selbst spülte, wenn man es verließ. Schon das Wort «Wissenschaft», so sagte man uns, sollten wir am besten vermeiden, weil «einfache Leute» es als Bedrohung empfinden.
Ich zweifle kaum daran, dass eine solche Verdummung Erfolg hat, wenn wir damit das Ziel verfolgen, bei unserem «Event» eine möglichst große Besucherzahl zu erzielen. Wenn ich aber protestiere, weil es sich bei dem, das hier vermarktet wird, nicht um wahre Wissenschaft handelt, werde ich wegen meiner «elitären Einstellung» getadelt, und man sagt mir, man müsse die Leute mit allen nur denkbaren Mitteln anlocken, das sei in jedem Fall der notwendige erste Schritt. Nun ja, wenn man das Wort schon verwenden will (ich würde es nicht tun), dann ist es vielleicht gar nicht so entsetzlich, wenn man elitär ist. Außerdem besteht ein großer Unterschied zwischen unnahbarem Snobismus und einer engagierten, mitteilsamen elitären Haltung, die danach strebt, dass auch andere ihr Wissen vermehren und in die Elite aufsteigen. Am schlimmsten – herablassend und gönnerhaft – ist die berechnete Verdummung. Als ich diese Ansichten kürzlich in Amerika in einem Vortrag äußerte, besaß ein Fragesteller am Ende – zweifellos mit einem Schuss politischer Selbstbeweihräucherung in seinem männlichen, weißen Herzen – die Unverschämtheit zu vermuten, diese Art der Popularisierung sei notwendig, um «Minderheiten und Frauen» an die Naturwissenschaft heranzuführen.
Wenn man Naturwissenschaft ausschließlich als lustig und spaßig und einfach hinstellt, dann, so meine Befürchtung, hebt man sich die Schwierigkeiten für die Zukunft auf. Wahre Wissenschaft kann schwierig sein (nun ja, oder eine Herausforderung, um der Sache einen positiven Klang zu geben), aber wie klassische Literatur oder Geigespielen ist sie der Mühe wert. Lockt man Kinder mit dem Versprechen von leichtem Spaß in die Wissenschaft oder jede andere lohnende Betätigung, stellt sich die Frage: Was werden sie tun, wenn sie schließlich der Wahrheit ins Gesicht sehen müssen? Die Werbung für den Soldatenberuf verspricht zu Recht keinen Picknickausflug: Dort braucht man engagierte junge Leute, die ihren Mann stehen können. «Spaß» ist das falsche Signal, und es zieht Menschen aus den falschen Gründen in die Wissenschaft. Eine ähnliche Gefahr der Aushöhlung besteht auch in den Geisteswissenschaften. Dort werden Bummelstudenten zu wertlosen «Kulturstudien» verführt, und man verspricht ihnen, sie könnten ihre Zeit mit dem Auseinandernehmen von Seifenopern, Boulevardblattprinzessinnen und Fernsehspots verbringen. Naturwissenschaft kann genau wie echte Geisteswissenschaft schwierig und anstrengend sein, aber Naturwissenschaft ist – ebenfalls wie richtig betriebene Geisteswissenschaft – etwas Großartiges. Naturwissenschaft kann sich auszahlen, aber wie große Kunst sollte sie es nicht müssen. Und wir sollten weder tolle Kerle noch lustige Explosionen brauchen, um uns vom Wert eines Lebens zu überzeugen, das sich der Frage widmet, warum wir überhaupt ein Leben haben.
Ich fürchte, ich war mit diesem Angriff zu pessimistisch, aber manchmal schwingt das Pendel so weit nach einer Seite, dass es eines starken Stoßes in die Gegenrichtung bedarf, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Natürlich macht Wissenschaft Spaß in dem Sinn, dass sie das Gegenteil von langweilig ist. Sie kann einen intelligenten Geist ein Leben lang fesseln. Sicher können praktische