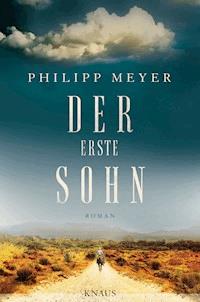
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das große Epos über den Gründungsmythos Amerikas.
Eli McCullough ist der erste Sohn der neuen Republik Texas, die am 2. März 1836 gegründet wird. Seine Eltern gehören zu jenen Siedlern, die sich ins Indianerland vorwagen, ein Paradies, das alles verheißt – nur keine Sicherheit. Bei einem Comanchenüberfall wird die Familie ausgelöscht. Eli wird verschleppt und wächst bei den Indianern auf. Als diese dem Druck der Weißen nicht mehr standhalten können, kehrt er zurück in eine ihm fremde Welt. Mit Härte gegen sich und andere, mit Cleverness, Skrupellosigkeit und Wagemut begründet er eine Dynastie, die durch Viehzucht und Öl zu immensem Reichtum und politischer Macht kommt. Doch Elis Nachkommen drohen an seinem Vermächtnis zu zerbrechen.
Mit seiner Geschichte über die Eroberung des amerikanischen Westens als große Familiensaga über drei Generationen, wird "Der erste Sohn" als „moderner amerikanischer Klassiker“ in einem Atemzug mit den Meisterwerken von Cormac McCarthy, John Dos Passos und Larry McMurtry genannt und stand wochenlang auf der New York Times Bestsellerliste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 890
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Philipp Meyer
Der erste Sohn
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Hans M. Herzog
Knaus
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
»The Son« bei Ecco, An Imprint of HarperCollins, New York
Durchgesehene Ausgabe
Copyright © der Originalausgabe by Philipp Meyer, 2013
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014
beim Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-09163-7
www.knaus-verlag.de
Für meine Familie
Im zweiten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung umfasste das Römische Reich die schönsten Gebiete der Erde und den kultiviertesten Teil des Menschengeschlechts.
… sein Geist lag im Staub darnieder, und Heere von unbekannten Barbaren, die aus den eisigen Regionen des Nordens aufgebrochen waren, brachten die schönsten Provinzen Europas und Asiens unter ihre siegreiche Herrschaft.
… die Wechselfälle des Schicksals, die weder den Menschen noch seine stolzesten Werke verschonen … lassen Imperien und Städte gleichsam untergehen.
EDWARD GIBBON
1. Kapitel
Colonel Eli McCullough
Aus dem Tonarchiv der amerikanischen Arbeitsbeschaffungsbehörde WPA (1936)
Mir wurde vorhergesagt, dass ich hundert Jahre alt werden würde, und da ich dieses Alter erreicht habe, sehe ich keinen Grund, an dieser Prophezeiung zu zweifeln. Ich sterbe nicht als Christenmensch, auch wenn mein Skalp unversehrt ist, und falls es die ewigen Jagdgründe gibt, bin ich dorthin unterwegs. Dorthin oder zum Fluss Styx. Doch selbst jetzt bin ich noch der Ansicht, dass mein Leben viel zu kurz war: Wie viel Gutes hätte ich tun können, wäre mir ein weiteres Jahr auf den Füßen vergönnt gewesen. Stattdessen bin ich an dieses Bett gefesselt und besudele mich wie ein kleines Kind.
Sollte es der Schöpfer für angebracht halten, mir Kraft zu schenken, so werde ich zu dem Fluss gehen, der im Osten durch mein Weideland fließt, zum Nueces River, auch wenn mir der Devil River immer lieber war. In meinen Träumen habe ich es sogar ganze drei Mal dorthin geschafft. Alexander der Große ist bekanntlich in der Nacht vor seinem Tod aus seinem Palast gekrochen, um in den Euphrat zu steigen, wohl wissend, dass, falls sein Leichnam verschwand, seine Untertanen annehmen würden, er sei als Gott gen Himmel gefahren. Kurz vor dem Wasser hielt ihn seine Frau auf und schleppte ihn nach Hause, wo er als Sterblicher verschied. Und da fragen mich die Leute, warum ich nicht wieder geheiratet habe.
Falls mein Sohn auftaucht, wäre es mir lieber, sein Siegerlächeln nicht ertragen zu müssen. Samen meines Untergangs. Ich weiß, was er getan hat, und vermute, dass er längst über den Jordan gegangen ist, denn Quanah Parker, der letzte Häuptling der Comanchen, hat dem Jungen kaum Gelegenheit gelassen, fünfzig Jahre alt zu werden. Im Austausch für diese Information schenkte ich Quanah und seinen Kriegern einen jungen Bison, einen erstklassigen Bullen, der nach alter Väter Sitte mit Lanzen auf meinem Weideland erlegt werden sollte, ihrem ehemaligen Jagdgebiet. Einer von Quanahs Begleitern war ein Arapaho-Häuptling, und als wir dasaßen und uns nach althergebrachter Art an der warmen Leber des Bullen labten, die wir in die Galle des Bullen tunkten, schenkte er mir einen silbernen Ring, den er George Armstrong Custer persönlich vom Finger gezogen hatte. Der Ring trägt die Gravur »7. Kav.« und weist eine tiefe Schramme von einer Lanze auf. Da ich keinen würdigen Erben habe, werde ich ihn mit in den Fluss nehmen.
Den meisten wird mein Geburtsdatum vertraut sein. Die Unabhängigkeitserklärung, die die Republik Texas aus mexikanischer Tyrannei befreite, wurde am 2. März 1836 in einer bescheidenen Hütte am Rande des Brazos River unterzeichnet. Die Hälfte der Unterzeichner war malariakrank, die andere Hälfte war nach Texas gekommen, um dem Strick des Henkers zu entgehen. Ich war der erste Sohn dieser neuen Republik.
Die Spanier waren mehrere Jahrhunderte in Texas gewesen, doch dabei war nichts herausgekommen. Seit Kolumbus hatten sie alle Eingeborenen unterworfen, die ihnen im Weg standen, und auch wenn ich nie einem Azteken begegnet bin, so scheinen sie mir doch ein Haufen verweichlichter Chorknaben gewesen zu sein. Da waren die Lipan-Apachen schon ein ganz anderer Gegner, sie hielten die alten Konquistadoren schließlich auf. Dann kamen die Comanchen. Seit den Mongolen hatte die Welt Krieger wie sie nicht mehr gesehen: Sie jagten die Apachen ins Meer, vernichteten das spanische Heer, machten aus Mexiko einen Sklavenmarkt. Ich sah einmal, wie Comanchen mexikanische Siedler den Pecos entlangtrieben, immer etliche Hundert zusammen, als wären sie eine Rinderherde.
Nachdem die Eingeborenen Mexiko eine vernichtende Niederlage verpasst hatten, entwickelte die mexikanische Regierung einen verzweifelten Plan zur Besiedlung von Texas. Jedermann, egal welcher Nationalität, der bereit war, sich westlich des Sabine River niederzulassen, erhielt tausendsechshundert Hektar Land. Das Kleingedruckte wurde jedoch mit Blut geschrieben. Wie die Comanchen mit den Neuankömmlingen umgingen, war von beinahe päpstlicher Gründlichkeit: Männer wurden gefoltert und getötet, Frauen vergewaltigt und getötet, die verwaisten Kinder vom Stamm adoptiert oder versklavt. Auswanderer aus dem alten Europa nahmen das Angebot der Mexikaner kaum an. Genauer gesagt, es kam gar keiner. Nur die Amerikaner strömten herein. Frauen und Kinder hatten sie im Überfluss, und wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens.
Mein Vater traf 1832 in Matagorda ein, wie so viele damals, für die die Gefahr, von einem Erschießungskommando getötet oder von den Comanchen skalpiert zu werden, eine Art Heilsversprechen war. Doch inzwischen hatte die mexikanische Regierung, beunruhigt von den wachsenden Anglo-Horden innerhalb ihrer Grenzen, die weitere Zuwanderung von Amerikanern nach Texas verboten.
Trotzdem war es dort besser als in den alten Staaten, wo man – außer als Sohn eines Plantagenbesitzers – nichts vom Leben zu erwarten hatte. In den historischen Archiven wird nachzulesen sein, dass die besseren Kreise, die Austins und Houstons, sich wohl liebend gern mit dem Verbleib in Mexiko abgefunden hätten, solange man ihnen ihre Ländereien ließ. Ihre Nachkommen haben später sogar ganze Propagandafeldzüge geführt, um den guten Ruf ihrer Familien wiederherzustellen und sich als Gründer der Republik Texas feiern zu lassen. In Wahrheit trieben nur Männer wie mein Vater, die nichts besaßen, Texas in den Krieg.
Er stand in der Schlacht von San Jacinto seinen Mann und arbeitete nach dem Krieg als Hufschmied, Büchsenmacher und Landvermesser. Er war ein umgänglicher, groß gewachsener Mann, mit aufrechtem Gang und kräftigen Händen, und die Menschen fühlten sich in seiner Gegenwart sicher, was sich für die meisten später allerdings als Trugschluss erwies.
Mein Vater war nicht religiös, und ich führe meine heidnischen Ansichten auf ihn zurück. Dennoch gehörte er zu den Menschen, die den Odem des bleichen Reiters im Nacken spüren. Zuerst wohnten wir in Bastrop, bauten Mais und Sorghumhirse an, züchteten Schweine und rodeten das Land, bis die neuen Siedler eintrafen – solche, die lieber abwarteten, bis die Bedrohung durch Indianer vorbei war, und dann mit ihren Anwälten auftauchten, um die Kaufverträge und Besitzrechte derjenigen anzufechten, die das Land zivilisiert und den roten Mann bezwungen hatten. Diese ersten Texaner hatten ihren Besitz mit der Originalwährung Mensch bezahlt, und die meisten konnten weder lesen noch schreiben. Als ich zehn war, hatte ich schon vier Gräber ausgehoben. Das leiseste Geräusch galoppierender Pferde weckte die ganze Familie, und wenn die Nachricht schließlich eintraf – irgendein Nachbar war zerlegt worden wie ein Spanferkel –, hatte mein Vater schon die Gewehre geladen, und er und der Bote verschwanden in der Nacht. Die Mutigen sterben jung: Das ist ein Sprichwort der Comanchen, doch es gilt auch für die ersten Anglos.
In den zehn Jahren, die Texas als eigenständige Nation existierte, suchte die Regierung verzweifelt Siedler, besonders solche mit Geld. Und tatsächlich, wie über eine unsichtbare Telegrafenleitung verbreitete sich in den alten Staaten die Nachricht, dass das Gebiet nun sicher sei. 1844 stand bei uns erstmals ein Fremder vor der Tür: Er hatte ein Friseurladenschild dabei, trug Kleider, die er im Laden gekauft hatte, und saß auf einem für Damen zugerittenen Fuchs. Er bat um Hafer, da sein Pferd kein Gras vertrug. Ein Pferd, das kein Gras fraß – so etwas hatte ich noch nie gehört.
Zwei Monate später klagten sie die Smithwicks von ihrem Land, bald darauf wurden die Hornsbys und die MacLeods ihre Grundstücke für ein paar Cents los. Mittlerweile gab es in Texas mehr Anwälte pro Einwohner als irgendwo sonst auf dem Kontinent, und binnen weniger Jahre waren alle frühen Siedler nach Westen vertrieben, zurück in Indianerland. Die feinen Leute, die das Land gestohlen hatten, waren überdies bereit, in den Krieg zu ziehen, um sich nicht von ihren schwarzen Sklaven trennen zu müssen; der Alte Süden wurde zum Untergang verdammt, aber Texas, ein Kind der Pioniere, ging aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg unversehrt hervor.
Unterdessen wurde meine Mutter immer mehr angefeindet. Sie stammte aus einer alten kastilischen Familie, hatte einen etwas dunkleren Teint, zugleich aber vornehme Gesichtszüge. Die neuen Siedler behaupteten jedoch, sie sei ein Mischling und zu einem Achtel schwarz. Der feine Plantagenbesitzer hatte für so etwas ein scharfes Auge.
Also zogen wir 1846 weiter und ließen uns auf dem Land am Pedernales River nieder, das meinem Vater zugewiesen worden war. Es war Jagdgebiet der Comanchen. Die Bäume dort hatten noch nie eine Axt gesehen, und das Land und alles, was darauf kreuchte und fleuchte, war satt und voller Leben. Gras, das einem bis zum Brustkorb reichte, Täler mit tiefer und schwarzer Krume, und selbst die steilsten Berghänge waren noch von Wildblumen übersät. Ganz anders als die trockene steinige Gegend, die es heute ist.
Verwilderte spanische Rinder ließen sich leicht mit einem Lasso einfangen – binnen eines Jahres hatten wir eine hundertköpfige Herde. Auch Schweine und Mustangs konnte man sich einfach nehmen. Es gab Hirsche, Truthähne, Bären, Eichhörnchen, gelegentlich einen Bison, Schildkröten und Fische aus dem Fluss, Enten, Pflaumen und wilden Wein, Bienenbäume und Persimonen – das Land war so voller Leben, wie es dort heute von Menschen wimmelt. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, seinen Skalp zu behalten.
2. Kapitel
Jeanne Anne McCullough
3. März 2012
Sie hörte Gemurmel und leise Stimmen, das Licht reichte aber nicht aus, um alles klar erkennen zu können. Sie war in einem großen Raum, den sie zuerst irrtümlich für eine Kirche oder einen Gerichtssaal hielt, und obwohl sie wach war, spürte sie nichts. Sie schien in warmem Badewasser zu schweben. Sie registrierte lediglich den trüben Schein der Kronleuchter, die Holzscheite, die im Kamin qualmten, die jakobinischen Stühle und Tische und die Büsten von alten Griechen. Den Läufer, den sie einst vom Schah von Persien bekommen hatten. Und sie fragte sich, wer sie wohl finden würde.
Es war ein riesiges, weiß getünchtes Haus im spanischen Stil, mit neunzehn Schlafzimmern, einer Bibliothek, einem großen Wohn- und Gesellschaftszimmer sowie einem Ballsaal. Sie und ihre Brüder waren alle hier geboren worden, doch jetzt kam sie nur noch an den Wochenenden hierher oder wenn Familientreffen stattfanden. Die Hausmädchen wären vor dem Morgen nicht zurück. Ihr Verstand war hellwach, doch beim Rest schien man den Stecker gezogen zu haben, und sie war sich ziemlich sicher, dass für ihren Zustand jemand anders verantwortlich war. Sie war sechsundachtzig Jahre alt und erzählte anderen zwar gerne, sie könne es nicht erwarten, endlich in das Land von Mañana überzusetzen, aber das stimmte nicht ganz.
Das Wichtigste im Leben ist ein Mann, der das macht, was ich sage. Das hatte sie einem Reporter von Time gesagt, und man hatte sie auf der Titelseite gebracht, wie sie auf ihrem Cadillac stand, vor einem Bohrfeld mit Pferdekopfpumpen. Mit einundvierzig Jahren noch immer eine sinnliche, begehrenswerte Frau. Sie war klein und zierlich, auch wenn man das rasch vergaß, sobald man sie kennengelernt hatte. Sie hatte eine kräftige Stimme, und ihre Augen waren grau wie eine alte Pistole oder wie der Himmel, wenn eisiger Nordwind wehte; eine auffallende Erscheinung, aber keine wirklich schöne Frau. Was der Yankee-Fotograf bemerkt haben musste. Er brachte sie nämlich dazu, die Bluse einen Knopf zu weit zu öffnen, und verwuschelte ihr Haar, als wäre sie gerade einem Cabrio entstiegen. Sie befand sich zwar nicht auf der Höhe ihrer Macht – das sollte noch ein wenig dauern –, doch es war ein wichtiger Augenblick. Man hatte angefangen, sie ernst zu nehmen. Jetzt war der Mann tot, der das Foto gemacht hatte.
Niemand wird dich finden, dachte sie.
Natürlich hatte sie es so kommen sehen; schon als Kind war sie meist allein gewesen. Die Stadt hatte ihrer Familie gehört. Mit den Menschen dort konnte sie jedoch nichts anfangen. Die Männer, mit denen sie so viele Gemeinsamkeiten hatte, wollten nichts mit ihr zu tun haben. Und die Frauen, mit denen sie überhaupt nichts gemein hatte, lächelten ihr zu viel und lachten zu laut. Sie erinnerten sie in erster Linie an Schoßhündchen, sie verplemperten ihr Leben mit der Einrichtung des Hauses und anderer Leute Klamotten. Für eine wie sie hatte es dort nie einen Platz gegeben.
Sie war jung, acht oder zehn Jahre alt, und saß auf der Veranda. Es war ein kühler Frühlingstag, die grünen Hügel erstreckten sich, so weit das Auge reichte, alles McCullough-Land. Doch etwas stimmte nicht: Draußen auf dem Rasen parkte ihr Cadillac, und die alten Stallungen standen auch nicht mehr, obwohl ihr Bruder sie noch gar nicht abgebrannt haben konnte. Ich werde jetzt aufwachen, dachte sie. Doch dann hörte sie die Stimme des Colonels, ihres Urgroßvaters. Ihr Vater war auch da. Sie hatte auch einmal einen Großvater gehabt, Peter McCullough, doch der war verschwunden, und niemand verlor je ein gutes Wort über ihn. Sie selbst, das wusste sie, hätte ihn wohl auch nicht gemocht.
»Ich dachte mir, du könntest dich mal am Sonntag in der Kirche sehen lassen«, sagte ihr Vater.
Der Colonel fand, solche Sachen sollte man besser den Negern und Mexikanern überlassen. Er war hundert Jahre alt und ließ sich von niemandem den Mund verbieten. Seine Arme waren dünn wie Ladestöcke, sein Gesicht fleckig wie altes Rohleder, und es hieß, wenn er das nächste Mal umfiele, dann in sein Grab.
»Die Sache mit Pfarrern ist die«, sagte er gern, »wenn sie nicht deinen Töchtern nachstellen oder sämtliche Brathähnchen und Pasteten in deinem Kühlschrank essen, bescheißen sie deine Söhne beim Pferdekauf.«
Ihr Vater war doppelt so groß wie der Colonel, aber er hatte, wie der Alte gern betonte, einen starken Rücken und einen schwachen Verstand. Ihr Bruder Clint hatte einmal von dem Priester ein Pferd samt Sattel gekauft, und es hatte unter der Decke eine wunde Stelle gehabt, beinahe pfannkuchengroß.
Ihr Vater schickte sie trotzdem in die Kirche, also stand sie in aller Herrgottsfrühe auf, weil sie nach Carrizo fahren musste, wo es eine Sonntagsschule gab. Ihr knurrte der Magen, und sie konnte die Augen kaum offen halten. Als sie die Lehrerin einmal fragte, was mit ihrem Urgroßvater geschehen werde, der in diesem Augenblick zu Hause saß und wahrscheinlich gerade einen Mint Julep trank, sagte die Lehrerin, er käme in die Hölle, wo Satan ihn persönlich in die Mangel nehmen werde. Wenn das so ist, begleite ich ihn, gab Jeannie zurück. Sie war ein elendes kleines Miststück, und wäre sie Mexikanerin gewesen, hätte sie den Rohrstock zu spüren bekommen.
Auf der Heimfahrt verstand sie nicht, warum ihr Vater sich auf die Seite der Lehrerin schlug, die eine Nase wie einen Adlerschnabel hatte und nach Verwesung roch. Die Frau war hässlich wie ein Teerfass. »Im Krieg«, sagte ihr Vater, »habe ich Gott versprochen, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen, wenn ich heil nach Hause komme. Aber kurz vor deiner Geburt hörte ich damit auf, weil ich vor lauter Arbeit keine Zeit mehr dafür hatte. Und weißt du, was dann geschah?« Sie wusste es, hatte es immer gewusst. Doch er erinnerte sie dennoch daran: »Deine Mutter starb.«
Jonas, ihr ältester Bruder, sagte, er solle ihr keine Angst einjagen, worauf ihr Vater Jonas schalt, er solle still sein. Clint kniff sie in den Arm und flüsterte: »Wenn du in die Hölle kommst, schieben sie dir zuerst eine Mistgabel in den Arsch.«
Sie schlug die Augen auf. Clint war seit sechzig Jahren tot. In dem halbdunklen Raum hatte sich nichts bewegt. Das Tagebuch, dachte sie. Sie hatte es einmal vor dem Brand gerettet und war nicht dazu gekommen, es zu vernichten. Jetzt würde man es finden.
3. Kapitel
Aus dem Tagebuch von Peter McCullough
10. August 1915
Mein Geburtstag. Bin heute – sogar ohne Wkiskey – zu folgendem Schluss gekommen: Ich bin ein Niemand. Wenn ich auf die vergangenen fünfundvierzig Jahre zurückblicke, sehe ich nichts, was sich zu leben gelohnt hätte, und das, was ich irrtümerlicherweise für meine Seele hielt, scheint eher ein schwarzer Abgrund zu sein. Ich habe mich bereitwillig von anderen formen lassen. Wenn man den Colonel fragt, bin ich der schlechteste Sohn, den er hatte – Phineas und sogar der arme Everett waren ihm immer lieber.
Dieses Tagebuch wird die einzige wahre Geschichte meiner Familie sein. In Austin planen sie eine Feier zum achtzigsten Geburtstag des Colonels, aber ich wüsste nicht, was man ehrlicherweise noch über einen Mann sagen könnte, der in höchsten Kreisen bereits gefeiert und als Held verehrt wird. Unterdessen geht der blutige Sommer weiter. Die Telefonleitung nach Brownsville ist dauernd unterbrochen – kaum ist sie repariert, jagen die Aufständischen sie wieder in die Luft. Letzte Nacht wurde die King Ranch von vierzig sediciosos angegriffen, in Los Tulitos gab es eine dreistündige Schießerei, und der Präsident der Bürgerwehr von Cameron wurde erschossen. Ob Letzteres ein Verlust oder ein Gewinn ist, wage ich nicht zu sagen.
Nach der Zahl der Mexikaner zu urteilen, die erschossen in Straßengräben lagen oder an Bäumen hingen, könnte man meinen, sie wären eine Landplage wie Pumas oder Wölfe. Der San Antonio Express berichtet nicht mehr über solche Vorfälle – dafür reicht der Platz nicht aus –, und so sterben die Tejanos, ohne dass jemand Notiz davon nimmt, und wenn überhaupt, werden sie nur notdürftig verscharrt oder mit einem Lasso dorthin geschleift, wo sie keinen stören.
Nachdem Longino und Esteban Morales letzten Monat ermordet wurden (wir wissen nicht, von wem, allerdings habe ich Niles Gilbert im Verdacht), verfasste der Colonel für alle unsere Vaqueros eine Art Passierschein: Dieser Mann ist ein guter Mexikaner. Lassen Sie ihn bitte in Ruhe. Wenn ich ihn nicht mehr brauche, bringe ich ihn selbst um. Unsere Männer tragen diese Zettel wie einen Orden; sie verehren den Colonel (so wie alle anderen auch), nuestro patrón.
Leider Gottes verlieren die Rinderzüchter in dieser Gegend aber weiterhin Vieh. Auf der Weide im Westen entdeckten Sullivan und ich eine Stelle, wo der Draht durchtrennt worden war, und bis zum Abend hatten wir nur 263 Kühe und Kälber wieder eingefangen, verglichen mit den 478, die beim letzten Zusammentrieb im Frühjahr noch gezählt wurden. Das ist ein Verlust von 20 000 Dollar, und alle Spuren deuteten – auf den ersten Blick zumindest – auf unsere Nachbarn, die Garcias. Ich für mein Teil würde lieber ein Königreich verlieren, als den Falschen an den Pranger stellen. Aber so denken nicht gerade viele.
Ich war immer der Meinung, ich wäre wohl besser in den alten Bundesstaaten zur Welt gekommen, wo der Boden zwar noch blutgetränkter ist als unserer, man aber wenigstens keine Waffen mehr braucht. Doch auch da käme ich freilich nicht zurecht. Für mich ist sogar Austin zu anstrengend, wo man sich vorkommt, als schrien alle sechzigtausend Einwohner gleichzeitig auf einen ein. Ich fand es schon immer schwierig, den Kopf davon freizubekommen – die Bilder und Geräusche begleiten mich noch jahrelang –, und genau darum bleibe ich hier, an dem einzigen Ort, der wirklich mir gehört, ob er mich will oder nicht.
Als wir den durchschnittenen Viehzaun untersuchten, wies Sullivan überflüssigerweise darauf hin, dass die Hufspuren geradewegs zum Land der Garcias führten. Es lag auf der anderen Seite des Flusses, der fast überall durchquert werden kann, weil es so trocken war.
»Ich hab nichts gegen den alten Pedro«, sagte er, »aber seine Schwiegersöhne sind schlimmer als eine Bande dreckiger Nigger.«
»Du bist schon viel zu lange beim Colonel«, sagte ich ihm.
»Er kennt seine Mexikaner.«
»Das sehe ich anders.«
»Boss, dann erklären Sie mir mal, warum ein durchtrennter Zaun zu Pedro Garcias Weideland führt und uns zweihundert Stück Vieh fehlen. Früher wären wir rübergeritten und hätten sie uns zurückgeholt, aber das übersteigt heutzutage ein wenig unsere Möglichkeiten.«
»Der alte Pedro kann genauso wenig jeden Zentimeter seines Landes im Auge behalten wie wir jeden Zentimeter unseres Landes.«
»Sie sind ein großer Mann«, sagte er, »und ich verstehe nicht, warum Sie sich benehmen wie ein viel kleinerer Mann.«
Danach hielt er sich mit Kommentaren zurück. Für ihn ist es ein persönlicher Affront, dass einem Mexikaner hier und heute so viel Land gehört. Und von den Vaqueros bekommt er auch keine Schützenhilfe: Die nennen Sullivan wegen seines Fliegengewichts und seiner hohen Stimme heimlich nur Don Castrado.
Pedro Garcia wiederum schien vom Unglück verfolgt zu sein. Zwei seiner Schwiegersöhne werden von der mexikanischen Polizei wegen Viehdiebstahls gesucht, eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, wie lax solche Dinge in der Regel gehandhabt werden. Als ich ihn letzte Woche besuchen wollte, wurde ich von José und Chico abgewiesen. »Don Pedro nicht fühlen gut«, sagten sie mir und taten, als verständen sie mein Spanisch nicht. Ich kenne Pedro schon mein ganzes Leben lang und wusste, dass er mich gern empfangen hätte. Aber stattdessen wendete ich wortlos mein Pferd.
Pedro hat schon so lange zu wenig Arbeiter, dass das Gestrüpp sein Land überwuchert und in den vergangenen beiden Jahren nur die Hälfte seiner Kälber ein Brandmal bekommen hatte. Jedes Jahr verdient er weniger Geld, jedes Jahr kann er weniger Männer anstellen, und deshalb verringert sich sein Einkommen zusehends.
Doch seiner Gutmütigkeit tut das keinen Abbruch. Ich habe seine Ranch der unseren immer vorgezogen. Wir beide schwelgten in Erinnerungen an die guten alten Zeiten, als das Land sanfter war, als es noch Straßen aus Caliche, hartem weißem Kalkstein, gab und Dörfer aus getrockneten Lehmziegeln. Kein Dornbusch war damals zu sehen gewesen, und das Gras reichte bis an die Steigbügel. Heute ist das Gestrüpp überall, und die alten Steindörfer sind verlassen. Die einzigen Häuser, die noch gebaut werden, sind schiefe, in Holzrahmenbauweise errichtete Ungetüme, die wie Pilze aus dem Boden schießen, aber genauso schnell verfaulen.
In vieler Hinsicht war Pedro für mich ein besserer Vater als der Colonel; falls er je ein barsches Wort für mich hatte, so behielt er es für sich. Er hatte immer gehofft, dass ich mich für eine seiner Töchter interessieren würde, und eine Zeit lang war ich tatsächlich in María verliebt, die Älteste, spürte aber, dass der Colonel strikt dagegen war, und wie ein Feigling ließ ich zu, dass das Gefühl wieder verging. María studierte in Mexico City; ihre Schwestern heirateten Mexikaner, die lediglich auf Pedros Land aus waren.
Meine größte Sorge ist, dass Sullivan recht hat und Pedros Schwiegersöhne hinter dem Viehdiebstahl stecken. Vielleicht begreifen sie nicht, welche Konsequenzen das haben wird; vielleicht begreifen sie nicht, dass Don Pedro sie nicht beschützen kann.
11. August 1915
Sally und Dr. Pilkington fahren Glenn, unseren Jüngsten, nach San Antonio. Er wurde heute Abend angeschossen, als wir im Dunkeln auf einige Reiter stießen. Die Kugel traf ihn oben in der Schulter und ist gewiss nicht lebensbedrohlich, und wäre der Colonel nicht gewesen, hätte ich meinen Sohn nach San Antonio begleitet.
Der Colonel hat entschieden, dass unsere Nachbarn die Schützen waren. Als ich zu bedenken gab, dass es zu dunkel war, um die Männer erkennen zu können, deutete er an, ich sei ein Verräter.
»Wenn du bloß irgendwas von dem gelernt hättest, was ich dir beigebracht habe«, sagte er. »Auf den Pferden saßen Chico und José.«
»Also, wenn du im Dunkeln weiter als eine Achtelmeile sehen kannst, musst du Augen wie ein Luchs haben.«
»Wie du sehr wohl weißt«, erwiderte er, »war meine Sehkraft immer besser als die anderer Männer.«
Etwa ein Viertel der Stadt (des weißen Teils) ist unten im Erdgeschoss versammelt. Außerdem die Rangers, alle unsere Vaqueros und auch die von der Midkiff-Ranch sind da. In wenigen Minuten reiten wir los – gegen die Garcias.
4. Kapitel
Eli McCullough
Frühjahr 1849, der letzte Vollmond. Wir lebten seit zwei Jahren am Pedernales River, nicht weit von Fredericksburg, als unserem Nachbarn am helllichten Tag zwei Pferde gestohlen wurden. Syphilis Poe, wie mein Vater ihn nannte, war aus den Appalachen hierher gezogen, weil er dachte, Texas sei ein Paradies für Faulpelze – dass sich hier das Feuerholz von selbst spaltete, einem die Dattelpflaumen direkt in den Schoß fielen und die Pfeife immer mit getrockneten Stechapfelblättern gestopft war. Solche Leute traf man im Grenzland am häufigsten an, obwohl es natürlich auch jede Menge Männer gab, die wie mein Vater waren – fest entschlossen, reich zu werden, sofern sie den Tag erlebten. Und es gab die Deutschen.
Ehe die Deutschen kamen, hielt keiner es für möglich, in dieser Hitze Butter zu machen. Das Gleiche galt für den Weizenanbau. Daran sieht man, was eine Gesellschaft, in der es Sklaven gibt, mit dem Verstand des Menschen anstellt. Die Deutschen jedoch, denen man nichts dergleichen erzählt hatte, kamen hierher, stellten jede Menge erstklassige Butter her und ernteten große Mengen des edlen Getreides, die sie ihren verdutzten Nachbarn mit hohem Profit verkauften.
Der Deutsche war alles andere als arbeitsscheu, was einem bald überall ins Auge stach. Wenn man an einem beliebigen Feld vorbeikam und merkte, dass der Boden gleichbleibend flach und die Reihen gerade waren, gehörte das Land einem Deutschen. War das Feld voller Steine, sahen die Reihen aus, als hätte ein blinder Indianer sie gezogen, schrieb man Dezember und die Baumwolle war noch nicht geerntet worden, wusste man, das Land gehörte einem der einheimischen Weißen, der aus Tennessee hergezogen war und hoffte, Mutter Natur mit ihren reichen Gaben würde auch noch einen Sklaven hervorzaubern.
Doch ich will nicht vorgreifen. An jenem Morgen sah mein Vater sich mit dem Problem konfrontiert, dass zwei klapperdürre Pferde gestohlen worden waren und eine auffällige Spur unbeschlagener Ponyhufe in die Hügel führte. Es sprach viel dafür, dass die Übeltäter noch irgendwo in der Nähe waren – kein Pferdedieb, der etwas auf sich hielt, würde sich mit Poes räudigen, an Senkrücken leidenden Stuten zufriedengeben. Doch im Grenzland galt das Gesetz, keinen ungeschoren davonkommen zu lassen, und so ritten mein Vater und die anderen Männer los. Mein Bruder und ich blieben mit je einer Flinte und zwei silberbeschlagenen Pistolen zurück, die in San Jacinto einem General abgenommen worden waren. Das galt als ausreichend, um eine stabile Holzhütte zu verteidigen, da die Armee in der Gegend patrouillierte und die Zeit der großen Indianerüberfälle – Anfang der 1840er Jahre – vorbei zu sein schien.
Die Männer ritten kurz vor zwölf Uhr mittags los, und mein Bruder und ich – die wir uns bereits zu den Erwachsenen zählten, auch wenn wir beide noch nicht ganz trocken hinter den Ohren waren – machten uns keine allzu großen Sorgen. Wir hatten keine Angst vor den Eingeborenen; in der Nähe lebten Dutzende Tonkawas und andere vereinzelte Indianer und warteten darauf, dass die Regierung ein Reservat eröffnete. Sie mochten Yankees ausrauben, die sich verirrt hatten, würden sich aber hüten, Einheimische zu belästigen: Wir alle wollten einen Indianerskalp und hätten den kleinsten Vorwand genutzt, um einen zu bekommen.
Mit zwölf hatte ich den größten Berglöwen erlegt, der je im späteren Blanco County gesehen wurde. Ich konnte Wild über felsigen Untergrund verfolgen, und mein Orientierungssinn war so gut wie der unseres Vaters. Sogar mein Bruder, der eine Schwäche für Bücher und Gedichte hatte, konnte besser schießen als jeder Mann aus den alten Staaten.
Trotzdem war er mir manchmal peinlich. Ich wies ihn auf Spuren hin, die er gar nicht sah, erzählte ihm, in welche Richtung der Bock den Kopf gedreht hatte, ob sein Bauch voll oder leer gewesen war und was ihn aufgescheucht hatte. Ich sah weiter, lief schneller und hörte Dinge, die ich mir seiner Ansicht nach einbildete.
Meinem Bruder war das alles egal. Aus mir unbegreiflichen Gründen fühlte er sich mir überlegen. Während ich jede neue Wagenspur, jeden Hinweis auf neue Siedler hasste, hatte mein Bruder schon immer gewusst, dass er später einmal in den Osten gehen würde. Ständig redete er davon, wie viel besser das Stadtleben sei und dass es nicht mehr lange dauern werde, bis sein Wunsch wahr würde – unsere Feldfrüchte waren schwer, unsere Herden wurden größer, und bald schon würden unsere Eltern einen Mann anstellen können, der ihn ersetzte.
Dank der Deutschen in Fredericksburg, die dort mehr Bücher zusammengetragen hatten, als es im ganzen Rest von Texas gab, galten Menschen wie mein Bruder plötzlich als völlig normal. Er verstand Deutsch, weil unsere Nachbarn es sprachen, Französisch, weil es eine kultiviertere Sprache war, und Spanisch, weil man in Texas ohne Spanisch nicht leben konnte. Er hatte Die Leiden des jungen Werthers im Original gelesen und behauptete, an seiner eigenen, verbesserten Version zu arbeiten, die er aber niemanden lesen ließ.
Von Goethe und Byron abgesehen, drehten sich die meisten Gedanken meines Bruders um unsere Schwester. Sie war ein hübsches Mädchen, das fast so gut Klavier spielte wie mein Bruder und auch schrieb, und es galt weithin als jammerschade, dass sie miteinander verwandt waren. Ich für mein Teil hatte ein ziemliches Raubvogelgesicht. Die Deutschen fanden, ich sähe wie ein Franzose aus.
Falls sich zwischen meinem Bruder und meiner Schwester je irgendetwas Ungehöriges abspielte, bekam ich es nie direkt mit. Aber wenn sie mit ihm sprach, waren ihre Worte zart wie Seide oder wie eine Süßigkeit, die auf der Zunge zergeht, während sie mit mir wie mit einem räudigen Hund umging. Mein Bruder schrieb dauernd Theaterstücke, in denen die beiden als todgeweihtes Paar auftraten, während ich den Indianer oder Bösewicht spielen durfte, der sie ins Verderben stürzte. Mein Vater täuschte Interesse vor, warf mir dabei aber vielsagende Blicke zu. In seinen Augen war mein Bruder nur deshalb halbwegs akzeptabel, weil ich nahezu perfekt geraten war. Doch meine Mutter war stolz. Sie setzte große Hoffnungen in meine Geschwister.
Die Hütte bestand aus zwei Zimmern, die durch einen überdachten Gang miteinander verbunden waren. Sie stand auf einem Felsvorsprung, wo eine Quelle aus dem Stein kam, deren Wasser weiter unten in den Pedernales floss. Die Bäume standen dicht an dicht wie zur Zeit der Schöpfung, und mein Vater sagte, sollte es je so weit kommen, dass der Wald nicht mehr direkt bis ans Haus reichte, würden wir wegziehen. Meine Mutter sah das natürlich anders.
Wir zäunten einen Küchengarten und einen Pferch ein und versahen sie mit Toren, bauten eine Räucherhütte, ein Maissilo und einen Pferdestall mit Schmiede. Wir hatten einen Holzfußboden und Glasscheiben in den Fenstern, dazu Fensterläden und einen Ofen, den die Deutschen gebaut hatten und der mit ein paar Scheiten die Nacht durchbrannte. Die Möbel sahen aus, als wären sie im Laden gekauft worden, fein gedrechselt und weiß lasiert, dabei stammten die Sachen von den Mormonen in Burnet.
In dem großen Zimmer hatten meine Mutter und mein Vater ein Himmelbett für sich, meine Schwester lag auf einer Pritsche; mein Bruder und ich teilten uns ein Bett in dem ungeheizten Raum auf der anderen Seite des Ganges; allerdings schlief ich oft draußen in den Ästen einer alten Eiche, zwischen die ich in etwa zehn Metern Höhe eine Rohhaut gespannt hatte. Mein Bruder zündete häufig zum Lesen eine Kerze an (ein Luxus, den ihm meine Mutter zugestand), was mich beim Schlafen störte.
In der Mitte des großen Raums stand ein spanisches Tafelklavier, das einzige Erbstück meiner Mutter. Es war eine Rarität, und sonntags kamen die Deutschen zum Singen vorbei und mussten dabei auch die Theaterstücke meines Bruders über sich ergehen lassen. Meine Mutter schmiedete Pläne, nach Fredericksburg zu ziehen, wo meine Geschwister wieder zur Schule hätten gehen können. Mich hielt sie offenbar für einen hoffnungslosen Fall, und wäre sie nicht bei meiner Geburt mit dabei gewesen, hätte sie jede Beteiligung an meiner Entstehung geleugnet. Sobald ich alt genug war, wollte ich mich den Texas Rangern anschließen und gegen die Indianer, Mexikaner oder jeden anderen reiten.
Im Nachhinein ist mir klar, dass meine Mutter eine Vorahnung hatte. Damals waren die Leute empfindsamer, sie registrierten jede kleinste Störung und Veränderung; sogar jemand derart Feingeistiges wie mein Bruder lebte im Einklang mit der Natur. Heutzutage ist der Mensch in seinem Körper eingeschlossen wie in einem Sarg. Er sieht und hört nichts. Land und Gesetze sind verdorben. Im Buch der Bücher steht: Ich will euch alle gen Jerusalem zusammentun und das Feuer meines Zorns unter euch entfachen. Und: Du bist ein Land, das nicht zu reinigen ist. Dem kann ich nur beipflichten. Wir brauchen ein großes Feuer, das von einem Meer zum anderen fegt, und ich schwöre, mich in Petroleum zu tauchen, damit es nicht erlischt.
Doch ich schweife ab. An jenem Nachmittag machte ich mich nützlich, so wie es Kinder damals eben taten, und schnitzte aus Hartriegelholz ein Ochsenjoch. Meine Schwester kam aus dem Haus und sagte: »Eli, geh rüber zum Brunnenhaus und bring Mutter die gesamte Butter und die Traubenmarmelade.«
Zuerst antwortete ich nicht, da sie mir nichts zu befehlen hatte. Außerdem waren die Reize, die sie früher vielleicht einmal gehabt haben mochte, schon seit Längerem verflogen. Ich gebe allerdings zu, dass ich oft fürchterlich eifersüchtig auf meinen Bruder war, wenn die beiden zusammensaßen und über Dinge lächelten, die sie sich erzählten. Auch hatte ich bei ihr nicht gerade einen Stein im Brett, da ich kürzlich das Pferd ihres bevorzugten Verehrers gestohlen hatte, eines Elsässers namens Hiebert. Obwohl ich das Pferd in besserer Verfassung zurückgab, als ich es vorgefunden hatte (denn endlich saß einmal ein guter Reiter im Sattel), hatte Hiebert ihr seitdem keinen Besuch mehr abgestattet.
»Eli!« Ihre Stimme klang, als wollte sie Schweine anlocken. Ich befand, dass mir der arme Schlucker leidtat, den sie irgendwann einfangen mochte.
»Wir haben fast keine Butter mehr«, schrie ich zurück. »Und Daddy wird wütend, wenn er nach Hause kommt und merkt, dass sie alle ist.« Ich widmete mich wieder meiner Schnitzerei. Es war angenehm dort im Schatten. In der Ferne die grünen Hügel, ganze sechzig Kilometer reichte die Sicht. Direkt unter mir der Fluss mit seinen kleinen Wasserfällen.
Außer dem Joch musste ich noch einen neuen Griff für meine Fällaxt machen. Dafür wollte ich das Milchorangenbäumchen nehmen, das ich bei meinen Ausflügen gefunden hatte. Der Griff würde elastischer sein, als es meinem Vater lieb war, aber dafür schloss er mit einem Hirschkuhhuf ab, damit er nicht aus der Hand glitt.
»Steh auf«, sagte meine Schwester. Sie stand über mir. »Hol die Butter, Eli. Ich mein’s ernst.«
Ich sah auf, wie sie da stand in ihrem besten blauen selbst genähten Kleid, und bemerkte einen frischen Eiterpickel in ihrem Gesicht, den sie mit Schminke zu übertünchen suchte. Als ich schließlich Butter und Traubenmarmelade brachte, hatte meine Mutter bereits den Herd angefacht und die Fenster geöffnet, damit es im Haus kühl blieb.
»Eli«, sagte meine Mutter, »geh runter und fang uns ein paar Fische, ja? Und vielleicht einen Fasan, wenn du einen siehst.«
»Und was ist mit den Indianern?«, sagte ich.
»Nun, wenn du einen fängst, bring ihn nicht mit her. Man sollte den Teufel nicht an die Wand malen.«
»Wo ist Sankt Martin?«
»Draußen, Brombeeren pflücken.«
Ich nahm meine Angelrute, eine Jagdtasche und die Jägerbüchse meines Vaters und arbeitete mich den Kalkfelsen hinunter bis zum Fluss vor. Die Jägerbüchse wurde mit Kugeln geladen, die eine ganze Unze wogen; sie hatte einen Doppelabzug und war eins der besten Gewehre im Grenzland, doch mein Vater fand das Nachladen zu umständlich, vor allem zu Pferd. Mein Bruder hatte als ältester Sohn ein Anrecht darauf, fand allerdings den Rückstoß zu heftig für seinen zarten Dichterkörper. Sie hatte hinten wie vorn Power, und ihre Kugeln durchschlugen selbst die Ältesten vom Stamme Ephraim oder zerfetzten, wenn einem das lieber war, ein Eichhörnchen auf fast jede Entfernung. Ich war froh, sie dabeizuhaben.
Der Pedernales River führte die meiste Zeit wenig Wasser; er war gerade mal hundert Meter breit und nur ein paar Fuß tief. An seinen Ufern standen alte Zypressen und Ahornbäume, und immer wieder gab es Badelöcher, Wasserfälle und schattige Tümpel, in denen es von Aalen nur so wimmelte. Wie die meisten texanischen Flüsse war er nicht schiffbar, was ich aber für einen Vorteil hielt, da das die Flussschiffer fernhielt.
Am Ufer grub ich ein paar Maden aus, sammelte ein paar Eichengallen von vorbeitreibenden Ästen und fand unter einer Zypresse ein schattiges Plätzchen. Über mir am Hang wuchs ein gewaltiger Maulbeerbaum, der so voller Früchte hing, dass selbst die Katzenfrette nicht alle fressen konnten. Ich zog mein Hemd aus und pflückte, so viel ich konnte, um sie später meiner Mutter zu bringen.
Dann warf ich die Angel aus. So ganz wohl war mir nicht in meiner Haut, weil ich das Haus oben nicht mehr sehen konnte. Indianer gingen gerne durchs Flussbett, und mein Vater hatte das einzige Repetiergewehr mitgenommen. Was andererseits wieder gar nicht schlecht war, weil ich deshalb alles ganz genau beobachtete – das über den Stein perlende Wasser, die Stinktierspuren im Schlamm, einen Reiher in einem weiter entfernten Tümpel. Ein Rotluchs geisterte durch die Weiden und wähnte sich unbeobachtet.
Weiter oben am Flussufer stand ein Grüppchen Pekanbäume, und ein Grauhörnchen nagte dort lauter grüne Nüsse an und ließ sie zum Verfaulen auf den Boden fallen. Ich fragte mich, warum die Viecher das machten: Ein Grauhörnchen vernichtete die Hälfte der Nüsse, ehe sie reif sind. Ich überlegte, ihm eine Lehre zu erteilen. Grauhörnchenleber ist außerdem ein Spitzenköder; wäre der Schöpfer ein Angler, würde er nichts anderes verwenden. Doch es war schwer, mit einer so schweren Kugel einen Buschschwanz zu treffen. Dafür hätte ich besser die .36er Kentucky meines Bruders mitgenommen. Ich fing an, von den Maulbeeren zu naschen, und bald waren sie alle weg. Mutter mochte Brombeeren sowieso lieber. Für sie waren Maulbeeren das Gleiche wie Sassafrastee – minderwertig.
Nach einer Stunde sah ich am gegenüberliegenden Ufer eine Schar Puten und schoss ein junges Truthuhn. Es war knapp siebzig Meter entfernt, doch der Schuss trennte den Kopf glatt vom Hals. Ich durfte auf den Kopf zielen, aber mein Bruder nicht – das junge Truthuhn schlug wild mit den Flügeln und versuchte zu fliegen, während das Blut wie eine Fontäne nach oben schoss. Ein rekordverdächtiger Schuss.
Ich klemmte meine Angelrute unter einen Stein, putzte den Lauf der Büchse, maß sorgfältig eine Pulverladung ab, lud eine Kugel nach und steckte das Zündhütchen auf den Piston. Dann watete ich durch den Fluss, um meine Beute zu holen.
Nicht weit von der Stelle, wo in einer Blutlache das Truthuhn lag, ragte eine lila Speerspitze aus dem Sand. Sie war zehn Zentimeter lang, und ich saß lange da und untersuchte sie gründlich; am unteren Ende hatte sie zwei Rillen, die sich bis heute nicht so nachmachen lassen. Die Feuersteine in dieser Gegend waren hellbeige bis braun, was mir einiges über diese Speerspitze verriet: Sie hatte eine lange Reise hinter sich.
Meine Angelrute trieb mittlerweile flussabwärts, und ich sah, dass sich ein großer Wels in meinen Köder verbissen hatte. Wieder etwas, was höchst selten vorkam. Ich zog an der Angel und dachte schon, der Fisch würde sich losreißen, doch er ließ sich problemlos aus dem Wasser ziehen. Das gab mir zu denken. Dann sah ich etwas am Himmel, das sonst nicht da war, und als ich es durch meine hohle Hand ins Visier nahm, merkte ich, dass es die Venus war. Am helllichten Tag. Ein schlechtes Omen, schlechter ging es nicht. Ich nahm Truthuhn, Wels und mein maulbeerfleckiges Hemd und flitzte zurück zum Haus.
»Das ging aber schnell«, sagte meine Mutter. »Nur einen Fisch?«
Ich hielt die Pute hoch.
»Wir haben uns Sorgen gemacht, als wir den Schuss hörten«, sagte meine Schwester.
»Ich wollte mich nicht so weit vom Haus entfernen.«
»Die Indianer werden dir nichts tun«, sagte meine Mutter. »Überall sind Soldaten.«
»Ich mache mir Sorgen um dich und Lizzie, nicht um mich«, sagte ich.
»Oh, Eli«, sagte meine Mutter. »Mein kleiner Held.« Sie schien mein ruiniertes Hemd nicht zu bemerken und roch nach dem Branntwein, der für wichtige Gäste reserviert war. Auch meine Schwester roch nach Branntwein. Er war ihr zu Kopf gestiegen, und sie kniff mich liebevoll in die Wange. Ich ärgerte mich über sie. Am liebsten hätte ich sie daran erinnert, dass vor nicht einmal einem Monat Miles Wallace entführt worden war. Doch im Gegensatz zu dem jungen Wallace, den die Comanchen mitgenommen hatten, um ihn ein paar Kilometer weiter zu skalpieren, war ich kein schielender Krüppel. Mir würde es wahrscheinlich sogar gefallen, entführt zu werden, weil die Comanchen den ganzen Tag nichts anderes machten als reiten und schießen.
Nachdem ich unseren Vorrat an Kugeln überprüft hatte, ging ich nach draußen, kletterte auf die Eiche und legte mich in meine Hängematte aus Rohhaut. Von dort aus überblickte ich den Fluss, die Straße und überhaupt die ganze Umgebung. Ich hängte die Jägerbüchse an einen Nagel. Schon länger wollte ich mal etwas schießen, während ich in der Hängematte schaukelte – das wäre das wahre Leben –, doch geklappt hatte es bisher noch nie. Durch die Hartriegelbäume bei der Quelle sah ich meinen Brombeeren pflückenden Bruder. Es wehte ein lindes Lüftchen, und es war angenehm dazuliegen und zu riechen, was meine Mutter gerade kochte. Mein Bruder hatte seine Flinte zwar dabei, sie aber weit von sich abgelegt, was purer Leichtsinn war. Mein Vater war in solchen Dingen rigoros – wenn man es für nötig hält, eine Schusswaffe mitzunehmen, dann sollte sie auch in greifbarer Nähe sein.
Doch an diesem Nachmittag hatte mein Bruder Glück, da keine Indianer zu sehen waren. Kurz vor Sonnenuntergang entdeckte ich etwas, das am Ufer zwischen den Zedern herauskam und wieder verschwand und sich als Wolf entpuppte. Er war so weit weg, dass er auch ein Kojote hätte sein können, doch Wölfe laufen mit stolz gerecktem Schweif, während Kojoten wie gescholtene Hunde den Schwanz einziehen. Dieser hielt den Schwanz gerade, und er hatte blassgraues, fast weißes Fell. Da die Äste mir die Sicht nahmen, kletterte ich vom Baum, stahl mich zum Rand des Abhangs und legte die Büchse an. Ich zielte auf den Rücken des Wolfs. Er war stehen geblieben, die Nase im Wind, nahm den Geruch unseres Abendessens auf. Dann drückte ich ab. Der Wolf sprang senkrecht hoch und fiel tot um. Mein Vater ließ uns als Kugelpflaster eingefettetes Wildleder nehmen, und unsere Kugeln flogen weiter und gerader, als wenn wir baumwollene Schusspflaster verwendet hätten, so wie fast alle anderen hier.
»Eli, hast du eben geschossen?« Das war meine Schwester.
»Es war nur ein Wolf«, rief ich zurück. Ich überlegte, nach unten zu gehen, um mir das Fell zu holen – ich hatte noch nie zuvor einen weißen Wolf gesehen –, entschied mich aber dagegen, denn es wurde bereits dunkel.
Weil so viel gekocht wurde, nahmen wir erst spät zum Abendessen Platz. Überall im Haus wurden sieben oder acht Talglichter angezündet, noch so ein Luxus. Meine Mutter und meine Schwester hatten den ganzen Tag am Herd gestanden und trugen eine Speise nach der anderen auf. Wir alle wussten, das war die Strafe für meinen Vater, weil er uns allein gelassen hatte und bei dieser aussichtslosen Verfolgung mitmachte. Doch niemand sagte etwas.
Mein Bruder und ich tranken kühle Buttermilch, meine Mutter und Schwester teilten sich eine Flasche Weißwein, die wir von den Deutschen bekommen hatten und die mein Vater für besondere Gelegenheiten aufbewahrte. Das Essen begann mit Brot und Butter und der letzten Kirschmarmelade, gefolgt von Schinken, Süßkartoffeln, Truthahnbraten, mit wildem Knoblauch gefülltem und in Talg gebratenem Fisch, gegrillten Steaks, die mit Salz und Chili eingerieben waren, den letzten, in Butter gebratenen Frühlingsmorcheln und einem warmen Salat aus Amarant und Rispen-Fuchsschwanz, selbiges auch in Butter und Knoblauch geschwenkt. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so viel Butter gegessen. Zum Nachtisch gab es zwei Kuchen: Brombeer und Pflaumen, Obst, das mein Bruder tagsüber gepflückt hatte. Die Speisekammer enthielt nur noch Hartkekse und gepökeltes Schweinefleisch. »Wenn er mit Syphilis Poe herumreiten will«, sagte meine Mutter, »dann soll er auch essen wie Syphilis Poe.«
Ich hatte ein schlechtes Gewissen, doch das hinderte mich nicht daran zu essen. Meine Mutter hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen. Sie hätte gern noch mehr Wein getrunken. Am Ende schliefen alle ein.
Ich trug den Schinkenknochen raus zum Brunnenhaus, wo ich mich hinsetzte und die Sterne betrachtete. Ich hatte ihnen eigene Namen gegeben – Rehbock, Klapperschlange, der laufende Mann –, aber mein Bruder überredete mich, die Begriffe von Ptolemäus zu nehmen, auch wenn sie keinen Sinn ergeben. Der Drache sieht nämlich aus wie eine Schlange, nicht wie ein Drache. Und der Große Bär erinnert an einen laufenden Menschen; in dem Sternbild ist nirgends ein Bär zu erkennen. Aber mein Bruder ließ nichts gelten, was mit dem gesunden Menschenverstand zu tun hatte, und deshalb scheiterte mein Versuch, den Himmel umzubenennen.
Ich brachte die Pferde in den Stall, verrammelte die Tür von innen und kletterte durch die Lücke im Dachvorsprung ins Freie. Indianer würden eine Weile brauchen, bis sie zu den Tieren vordrangen. Die Pferde wirkten ruhig, was ein gutes Zeichen war, da sie Indianer besser wittern konnten als unsere Hunde.
Als ich wieder ins Haus kam, hatten sich meine Mutter und meine Schwester in das Himmelbett meiner Eltern zurückgezogen, und mein Bruder lag auf der Pritsche meiner Schwester. Normalerweise schliefen mein Bruder und ich in dem Zimmer auf der anderen Seite des überdachten Durchgangs, doch ich ließ ihn in Ruhe. Nachdem ich meine Flinte, Jagdtasche und Stiefel an den Fuß des Bettes gelegt hatte, spuckte ich in die letzte Kerze und kroch neben meinen Bruder unter die Decken.
Gegen Mitternacht hörte ich alle unsere Hunde ein lautes Gekläff anstimmen. Ich hatte ohnehin nicht gut geschlafen, daher warf ich einen Blick durch die Fensterluke und hatte anfangs mehr Angst, dass meine Mutter oder Schwester sahen, was unter meinem Nachthemd strammstand.
Doch das vergaß ich sofort. Denn draußen am Zaun stand ein Dutzend Männer. Im Halbdunkel auf der Straße waren noch mehr, auch von der Seite kamen sie. Ich hörte einen Hund jaulen, und dann rannte der Kleinste aus der Meute, ein Mischling namens Perdida, fort ins Unterholz. Er lief geduckt wie ein Hirsch nach einem Bauchschuss.
»Alle sofort aufstehen, verdammt«, sagte ich. »Steh auf, Momma. Alle sofort raus aus den Betten.«
Der Mond stand oben am Himmel, und es war fast taghell. Die Indianer führten unsere drei Pferde vom Hof und den Hügel hinab. Ich fragte mich, wie sie in den Stall gekommen waren. Unsere Bulldoge lief hinter einem groß gewachsenen Krieger her, als wären sie beste Freunde.
»Geh zur Seite«, sagte mein Bruder.
Er, meine Mutter und Schwester waren aus den Betten gekommen und standen alle hinter mir.
»Da sind eine Menge Indianer.«
»Wahrscheinlich Rooster Joe und die anderen Tonks«, sagte mein Bruder.
Ich ließ mich von ihm beiseiteschieben, ging dann zum Feuer und schürte es, damit wir Licht hatten. Seit Texas ein eigener Bundesstaat war, hatten wir kaum noch Ärger mit Indianern gehabt; der größte Teil der U. S. Army war in Texas stationiert, um das Grenzland zu überwachen. Ich fragte mich, wo diese Soldaten jetzt waren. Ich wusste, ich sollte alle Schusswaffen laden, dann fiel mir ein, dass ich das schon getan hatte. Mir kam ein Spruch in den Sinn: Büffelhorngriff, Barlowstahl, das allerbeste Messer, verkürzt die Qual. Ich wusste, was geschehen würde – die Indianer würden an die Tür klopfen, wir würden sie nicht einlassen, und sie würden versuchen, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, bis es ihnen langweilig wurde. Dann würden sie das Haus in Brand setzen und auf uns schießen, sobald wir rauskamen.
»Was ist da los, Martin?«, sagte meine Mutter.
»Er hat recht. Es sind mindestens zwei Dutzend.«
»Dann sind es Weiße«, sagte meine Schwester. »Irgendwelche Pferdediebe.«
»Nein, es sind eindeutig Indianer.«
Ich holte mein Gewehr und setzte mich in eine Ecke, von wo aus ich die Tür gut im Blick hatte. Man sah Schatten und trübes rotes Licht. Ich fragte mich, ob ich wohl zur Hölle fahren würde. Mein Bruder ging auf und ab, und meine Mutter und Schwester hatten sich auf das Bett gesetzt. Meine Mutter strich meiner Schwester über die Haare und sagte: Ganz ruhig, Lizzie, alles wird gut. Im Halbdunkel waren ihre Augen leere Höhlen, als hätten die Geier sie schon entdeckt. Ich schaute weg.
»Los, hol schon deine Flinte«, sagte ich meinem Bruder, »und die Pistolen auch.«
Er schüttelte den Kopf.
»Wenn wir uns wehren, begnügen sie sich vielleicht mit den Pferden.«
Ich merkte, dass er das nicht so sah, doch er ging in die Ecke, nahm seine Kentucky.
»Ich hab sie schon geladen«, meinte ich.
»Vielleicht denken sie, dass wir nicht zu Hause sind«, sagte meine Schwester. Sie sah meinen Bruder an, doch der sagte: »Die sehen doch, dass bei uns ein Feuer brennt, Lizzie.«
Wir hörten, dass die Indianer in der Werkstatt meines Vaters mit Metall klapperten und sich leise unterhielten. Meine Mutter stand auf, zog einen Stuhl vor die Tür und stellte sich darauf. Weiter oben war noch eine Schießscharte, und sie entfernte das Brett und hielt das Gesicht davor. »Ich sehe nur sieben.«
»Es sind mindestens dreißig«, sagte ich ihr.
»Daddy ist schon hinter ihnen her«, sagte meine Schwester. »Er weiß bestimmt, dass sie hier sind.«
»Vielleicht wenn er die Flammen sieht«, sagte mein Bruder.
»Sie kommen.«
»Komm da runter, Mammy.«
»Nicht so laut«, sagte meine Schwester.
Als jemand gegen die Tür trat, fiel meine Mutter fast von ihrem Ausguck. Salir, salir. Die meisten wilden Stämme sprachen Spanisch. Ich dachte, die Tür würde höchstens ein paar Schüsse abhalten, und bedeutete meiner Mutter erneut, sie solle herunterkommen.
Tenemos hambre. Nos dan los alimentos.
»Das ist absurd«, sagte mein Bruder. »Wer glaubt denn so was?«
Lange blieb es still, dann sah Mutter uns an und sagte mit ihrer Oberlehrerinnenstimme: »Eli und Martin, legt bitte eure Waffen auf den Boden.« Als sie Anstalten machte, den Querriegel zurückzuschieben, wurde mir klar, dass alles stimmte, was man über Frauen sagte – sie waren unvernünftig, und trauen konnte man ihnen auch nicht.
»Mach die Tür nicht auf, Momma.«
»Halt sie fest«, sagte ich zu Martin. Doch er rührte sich nicht. Ich sah, wie der Riegel angehoben wurde, und stützte das Gewehr auf mein Knie. Das Mondlicht fiel wie weißes Feuer durch die Ritzen, doch das bemerkte meine Mutter nicht; sie schob den Riegel zur Seite, als begrüßte sie einen alten Freund, als hätte sie das seit dem Tag unserer Geburt erwartet.
In den Zeitungen stand immer wieder, dass Siedlermütter die letzten Kugeln für ihre Kinder aufsparten, damit sie nicht den Heiden in die Hände fielen, doch man hörte nie, dass jemand so etwas wirklich machte. Das genaue Gegenteil war der Fall. Wir alle wussten, dass ich im besten Alter war – die Indianer würden mich lebend haben wollen. Meine Geschwister waren vielleicht ein wenig zu alt, aber meine Schwester war hübsch, und mein Bruder sah jünger aus, als er war. Meine Mutter hingegen war fast vierzig. Sie wusste genau, was sie mit ihr machen würden.
Die Tür flog auf, und zwei Männer stürzten sich auf sie. Ein Dritter stand in der Türöffnung hinter ihnen und spähte in das dunkle Haus.
Als mein Schuss ihn traf, schlenkerte er mit einem Arm und fiel nach hinten um. Die anderen Indianer rannten wieder raus, und ich schrie meinem Bruder zu, er solle die Tür zumachen, doch er rührte sich nicht. Also lief ich rüber, um sie selbst zu schließen, doch der tote Indianer lag quer über der Schwelle. Ich packte seine Füße und wollte ihn reinziehen, um den Eingang freizuräumen, da trat er mir gegen den Unterkiefer.
Als ich wieder zu mir kam, schwankten die Bäume im Mondschein, und ich hörte einen lauten Krach nach dem anderen. Auf jeder Seite der Türöffnung standen Indianer, beugten sich kurz vor, um in das Zimmer zu schießen, und gingen dann wieder draußen in Deckung. Meine Schwester schrie auf: »Martin, ich glaube, sie haben mich getroffen.« Doch mein Bruder saß einfach nur da. Ich dachte, er hätte eine Kugel abbekommen. Da die Indianer eine Pause machten, damit sich der Pulverdampf legen konnte, riss ich ihm das Gewehr aus der Hand, vergewisserte mich, dass der Abzug gespannt war, und richtete es auf die Indianer. Aber meine Mutter hielt mich auf.
Dann lag ich plötzlich auf dem Bauch; zuerst dachte ich, das Haus sei eingestürzt, doch es war ein Mann, der auf mir hockte. Ich griff nach seinem Hals, doch mein Kopf prallte immer wieder auf den Boden. Auf einmal war ich draußen unter den Bäumen.
Ich versuchte aufzustehen, bekam aber Tritte versetzt, versuchte es erneut und wurde wieder getreten. Ich sah die Füße eines Mannes, dann den Boden neben ihnen. Dann wieder ein Paar Beine, in Wildleder gekleidet. Ich biss in seinen Fuß und wurde ein drittes Mal getreten. Jemand zog an meinen Haaren, als wollte er sie samt der Wurzeln ausreißen. Ich wartete auf den Schnitt des Messers.
Als ich die Augen öffnete, war da ein großes rotes Gesicht; der Kerl stank nach Zwiebeln und dreckiger Latrine, und er bedeutete mir mit dem Messer, dass er mir den Kopf abschneiden würde, falls ich keine Ruhe gäbe. Dann band er meine Hände mit einer Lederschnur zusammen.
Als er wegging, glich er keinem Indianer, den ich je gesehen hatte. Die unter den Weißen lebenden Eingeborenen waren schmächtig und ausgezehrt. Der hier war groß und untersetzt, hatte einen Quadratschädel und eine dicke Nase; er glich eher einem Neger als einem dürren, halb verhungerten Indianer, und er streckte beim Gehen den Brustkorb raus, als wäre es sein naturgegebenes Recht, sich alles zu nehmen, was uns gehörte.
Draußen vor dem Tor standen fünfzehn bis zwanzig Pferde, und genauso viele Indianer lehnten an unserem Zaun, lachten und rissen Witze. Von meiner Mutter, meinem Bruder oder meiner Schwester war nichts zu sehen. Die Indianer waren vom Kopf bis zur Hüfte nackt und mit Farbe und Mustern bemalt, als wären sie aus einem reisenden Varietétheater entflohen; einer hatte sein Gesicht wie einen Totenschädel angemalt, ein anderer seinen Brustkorb wie ein Skelett.
Einige Indianer durchstöberten das Haus, andere durchwühlten den Stall und die Nebengebäude, doch die meisten lehnten am Zaun und sahen ihren Freunden bei der Arbeit zu. Alle weißen Männer, die ich in so einer Situation erlebt hatte, waren noch stundenlang nach einem Kampf unruhig und nervös; sie liefen herum und redeten so schnell, dass man sie nicht verstand, doch die Indianer wirkten gelangweilt und gähnten, als kämen sie gerade von einem Abendspaziergang zurück. Nur der Mann, den ich angeschossen hatte, nicht. Der saß mit dem Rücken an die Hauswand gelehnt da. Sein Oberkörper war blutüberströmt, und er hatte Schaum vor dem Mund. Als einer seiner Freunde merkte, dass ich hinguckte, kam er rüber, sagte taibo nu wukupatū?i und verpasste mir einen Schlag gegen den Kopf.
Ich hatte einen langen Traum, in dem ich vor einen Mann treten musste, der mich wegen meiner Sünden richten sollte. Es war der heilige Petrus, allerdings in Gestalt des Lehrers an unserer Schule in Bastrop, der mich noch weniger gemocht hatte als alle anderen Schüler, sodass klar war, dass ich in die Hölle kam.
ENDE DER LESEPROBE





























