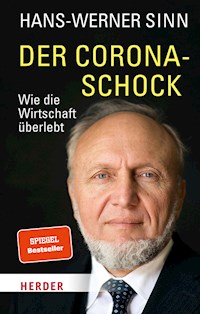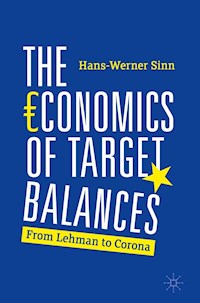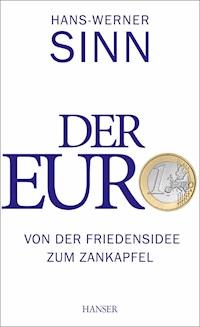
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Von Anfang an sollte der Euro mehr sein als eine Währung: Er verkörpert den Wunsch nach Einheit und Frieden in Europa. Doch gut ein Jahrzehnt nach seiner Einführung geht ein tiefer Riss durch Europa. Im Süden bleibt die Arbeitslosigkeit unerträglich, die Wirtschaft liegt am Boden. Der Norden sieht sich in die Rolle des Zahlmeisters gedrängt und wird von der EZB in Geiselhaft genommen. So wächst auf beiden Seiten die Unzufriedenheit. Wir haben einen politischen Weg eingeschlagen, der unsere Marktwirtschaft, die Demokratie und den Frieden in Europa gefährdet. Hans-Werner Sinn liefert in diesem Buch eine Analyse der jüngsten Entwicklungen und zeigt, was zu tun ist, um die Krise zu beenden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 899
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Werner Sinn
Der Euro
Von der Friedensidee zum Zankapfel
Von Florian Buck, Wolfgang Meister und dem Autor aus dem Englischen übersetzte und aktualisierte Auflage der Originalausgabe The Euro Trap. On Bursting Bubbles, Budgets and Beliefs, Oxford University Press, 2014.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder von Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2015 Carl Hanser Verlag München
1. Auflage 2015
www.hanser-literaturverlage.de
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Datenkonvertierung E-Book: Kösel Media, Krugzell
ISBN 978-3-446-44468-3
E-Book ISBN 978-3-446-44469-0
Für
Korbinian und Laurenz
mit besten Wünschen
für eine friedvolle und glückliche Zukunft
in einem gemeinsamen Europa,
das die Vielfalt seiner Kulturen bewahrt und Euch die Möglichkeit gibt, Euer Leben
selbständig und frei zu gestalten.
Danksagung
Dieses Buch ist die aktualisierte Übersetzung meines Buches The Euro Trap. On Bursting Bubbles, Budgets and Beliefs, das im Juli 2014 bei Oxford University Press herauskam. Das Buch wurde von Florian Buck und Wolfgang Meister vorübersetzt und auf den neuesten Datenstand gebracht. Danach habe ich es zur Gänze durchgearbeitet und inhaltlich aktualisiert.
Nachdem bereits eine chinesische und koreanische Ausgabe vereinbart waren, schien es mir angebracht, auch eine deutsche Fassung herauszubringen. Ich bin dem Hanser-Verlag dankbar für die Entscheidung, die Übersetzung zu veröffentlichen, obwohl er im Jahr 2012 bereits das Buch Die Target-Falle herausgebracht hatte, das ein geistiger Vorläufer war, sich aber doch in wesentlichen Punkten unterscheidet und im Übrigen natürlich die dramatischen Ereignisse, die nach diesem Jahr folgten, noch nicht erfassen konnte. Nicola von Bodman-Hensler und Christian Koth haben das neue Buch als Lektoren sorgfältig betreut.
Die nun vorliegende Monographie fasst mein aktuelles Wissen zur Eurokrise zusammen, mit der ich mich als ifo Präsident nun über viele Jahre beschäftigt habe. Es beleuchtet die Geschehnisse in der Europäischen Zentralbank und versucht die Ereignisse zu erklären, die Südeuropa in eine tiefe und noch lange nicht überwundene Depression gestürzt und viel Unfrieden und Streit zwischen den Ländern Europas hervorgerufen haben. Ich hoffe, dass dieses Buch dazu beitragen wird, ein tieferes Verständnis für die ökonomischen Hintergründe der Krise zu entwickeln und Wege zur Überwindung der Funktionsstörungen des Eurosystems zu finden, damit Europa das Knäuel seiner finanziellen Verstrickungen entwirren kann und wieder eine neue Chance bekommt.
Der Forschungsaufwand bei der Aufarbeitung des Geschehens und der Akkumulation von Wissen über das quasi aus der Retorte entstandene Eurosystem hat mich über Jahre hinweg bis an die Grenzen der physischen Belastbarkeit gefordert, zumal er angesichts der vielfältigen Belastungen als Präsident des ifo Instituts auf die Ferien und die Freizeit konzentriert war. Es war eine zum Teil detektivische Forschung, die sich nicht wie früher in meiner Karriere nur über wissenschaftliche Zeitschriften den Weg in eine Fachöffentlichkeit bahnte, sondern eine für jedermann sichtbare Analyse in vivo, quasi am lebenden Objekt, darstellte, die sich auch der Kommunikation über schneller publizierende Medien bediente. Die Fachzeitschriften, die normalerweise Jahre brauchen, bis ein wissenschaftlicher Artikel erscheint, haben zur intellektuellen Aufarbeitung des Krisengeschehens kaum etwas beitragen können, weil die Sachverhalte meistens schon lange bekannt waren, als über sie dort berichtet wurde. Der Vorteil der Direktkommunikation bestand auch darin, dass mir die Resonanz der Politik und einer aufgeklärten Medienöffentlichkeit dabei half, den Untersuchungsgegenstand besser zu orten und meine Argumente zu schärfen. In dieser Krise haben ernsthafte Journalisten und seriöse Zeitungen mehr intellektuelle Erkenntnis beigesteuert und angeregt, als es viele akademische Ökonomen wahrhaben wollen.
Bei meiner Arbeit wurde ich von den Mitarbeitern des ifo Instituts und meines Lehrstuhls an der Universität München, aber auch von vielen anderen Personen unterstützt. Neben Wolfgang Meister, der mir über Jahre hinweg ein festes statistisches Rückgrat für meine Aussagen geschaffen hat, sowie Florian Buck und Anja Rohwer, die bei der Internetrecherche und vielen anderen Dingen behilflich waren, habe ich von Christoph Zeiner und Christiane Nowack kompetente Hilfe bei der Erstellung der Abbildungen und grenzenlose Toleranz gegenüber meinen fortwährenden Änderungswünschen erfahren. Jakob Eberl und Christopher Weber halfen bei der Recherche bezüglich der schwer zu durchschauenden Pfänderpolitik der EZB. Nadjeschda Arnold, Christian Beermann, Marga Jennewein und Susanne Wildgruber waren am Lektorat beteiligt.
Die englische Fassung dieses Manuskripts wurde vollständig von Jürgen Stark, Christoph Trebesch und Timo Wollmershäuser gelesen. Sie gaben mir viele hilfreiche Kommentare. Bedanken möchte ich mich auch für die nützlichen Hinweise bei einzelnen Abschnitten, die ich von Philippine Cour-Thimann, Anil Kashyap, Harold James, David Laidler und Frank Westermann erhalten habe. Georg Milbradt und meine Frau Gerlinde Sinn haben die nun vorliegende deutsche Fassung zur Gänze redigiert und wichtige Korrekturvorschläge gemacht. Beide haben meine Forschung über Jahre hinweg begleitet und mich in vielen Gesprächen an ihren Erkenntnissen teilhaben lassen.
Ich habe aber auch vom Rat vieler anderer Kollegen profitiert. Hervorzuheben sind hier insbesondere Giuseppe Bertola, Beat Blankart, Michael Burda, Kai Carstensen, Giancarlo Corsetti, Paul De Grauwe, John Driffill, Achim Dübel, Klaus Engelen, Udo di Fabio, Martin Feldstein, Carl-Ludwig Holtfrerich, Otmar Issing, Harold James, Wilhelm Kohler, Kai Konrad, William Levine, Dietrich Murswiek, Manfred J. M. Neumann, Bernd Rudolph, Jan Scheithauer, Helmut Schlesinger, Jan-Egbert Sturm, Jens Ulbrich, Akos Valentinyi, Xavier Vives und Andreas Worms.
Allen genannten Personen danke ich herzlich für ihre Unterstützung. Verbleibende Fehler gehen allein auf mein Konto.
Ich bedanke mich auch bei drei anonymen Fachgutachtern, die Oxford University Press konsultierte und die mir in umfangreichen Stellungnahmen ihre Verbesserungswünsche unterbreiteten, bevor sie das Buch zur Publikation freigaben. Ferner danke ich weiteren Gutachtern, die es dem Verlag gestatteten, ihre Stellungnahmen zu publizieren.
München, August 2015
Inhalt
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Boxenverzeichnis
Einführung
Die Eurokrise
1 Wunsch und Wirklichkeit
Der Euroraum im Wandel
Der Euro und der Frieden
Die Vorteile des Euro für den Handel und den Kapitalverkehr
Eine unvollendete Gemeinschaft
Die Währungsunion als Preis der Wiedervereinigung?
Auf dem Weg zur Transfer- und Schuldenunion
Die Europäische Zentralbank
2 Scheinblüte in der Peripherie
Der Kapitalboom
Die Einebnung der Zinsunterschiede3
Entlastung der Staatsbudgets
Folgenlose Haushaltsdefizite
Italiens verpasste Gelegenheit
Das Auslandsschuldenproblem
Die Seifenblasen
Die Immobilienpreise
Das Privatvermögen
Marktversagen oder Staatsversagen?
3 Die andere Seite der Medaille
Eurogewinner und Euroverlierer
Kapitalexporte aus den Kernländern in die Peripherie
Massenarbeitslosigkeit in Deutschland
Agenda 2010
Der neue Bauboom
Ein fehlinterpretierter Tango
4 In der Wettbewerbsfalle
Prognose und Realität
Warum sich die Leistungsbilanzen verbessern
Sterbende Industrien
Zu teuer
Die notwendigen realen Abwertungen
Kaum Fortschritte
Wie hat es Irland geschafft?
Das Baltikum: Sparpolitik bewährt sich
Die wahren Rivalen
Gefangen im Euro: Das Drama der Deflation
5 Der »weiße Ritter«
Der Crash
Hilfe mit der Druckerpresse
Die Absenkung der Sicherheitsstandards und die Verlängerung der Laufzeiten
Moralisches Risiko
Notkredite
6 Target-Salden oder der Schatten der europäischen Zahlungsbilanzkrise
Das Zahlungsverkehrssystem »Target«
Explodierende Target-Salden
Warum die Target-Salden Kredite messen
Target-Salden als öffentlicher Kapitalexport
Binnengeld und Außengeld
Die Verdrängung der Refinanzierungskredite im Norden
7 Bestandsaufnahme 2015: Von Leistungsbilanzdefiziten, Kapitalflucht und Target-Salden in den Euroländern
Die Finanzierung der Zahlungsbilanzdefizite
Die griechische Tragödie
Portugal und Zypern: Leben von der Druckerpresse
Die irische Kapitalflucht
Der Rückzug aus Italien und Spanien
Kreditvermittler Frankreich
Deutschland: Die Exporte finanziert die Bundesbank
Finnland und die Niederlande als sichere Häfen
Rätsel Österreich
Bretton Woods und die Europäische Zahlungsunion
Der Transfer-Rubel
Das Schweizer Vorbild
Wie Überschüsse in den USA ausgeglichen werden
Die fundamentale Dichotomie der Rettungspolitik
8 Im Rettungswahn
Die sieben Stufen der Rettungsarchitektur
Die Stützungskäufe von Staatsanleihen: Das SMP
Kein Risiko für die Steuerzahler?
EFSF, ESM & Co
Ein Überblick über die Rettungskredite
Das Haftungsrisiko der Geberländer
Die OMT-Kontroverse
Das OMT vor Gericht
Das QE-Programm als Kompromiss und Hoffnung
Die Bankenunion
Baldrian gegen den Stress
Bail-in oder Bailout?
Ein Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone
Die Aushöhlung von Marktwirtschaft und Demokratie
9 Das Eurosystem überdenken
Kurswechsel
Von den USA lernen
Harte Budgetbeschränkungen
Die Tilgung der Target-Schulden
Unerträgliche Gesamtschulden
Schuldenerlass
Eine atmende Währungsunion: Zwischen Bretton Woods und dem Dollar-System
Das Prozedere des Austritts
Der Kardinalfehler der Rettungspolitik
Der Weg zur Einheit
Anmerkungen
Stellungnahmen zur englischen Originalausgabe dieses Buches
Abbildungsverzeichnis
1.1 Wachstum ausgewählter Länder und Regionen (2000–2014)
1.2 Arbeitslosenquoten in den GIPSIZ-Ländern, saisonbereinigt
1.3 Jugendarbeitslosigkeit (< 25 Jahre) in den GIPSIZ-Ländern, saisonbereinigt
1.4 Protest gegen Sparpolitik
1.5 Exportanteile in die Eurozone (1999–2014)
1.6 Stimmgewichte und Haftungsanteile im EZB-Rat 2015
2.1 Kapitalimporte (äquivalent zu Leistungsbilanzdefiziten) der GIPSIZ-Länder als Anteil am BIP (1995–2015)
2.2 Zinsen für zehnjährige Staatspapiere (1990 bis Juni 2015)
2.3 Preise für zehnjährige Staatspapiere
2.4 Zinslast öffentlicher Schulden in Prozent des BIP (1985–2015)
2.5 Die Defizitquoten ausgewählter Länder
2.6 Gesamter öffentlicher und privater Konsum ausgewählter Euroländer als Anteil vom Nettonationaleinkommen (1995–2014)
2.7 Staatsschuldenquote der Euroländer, 1995 und 2014
2.8 Hypothetischer und tatsächlicher Verlauf der italienischen Staatsschuldenquote (1995–2014)
2.9 Komponenten der Nettoauslandsposition (2012)
2.10 Spanische Nettoauslandsschulden im Vergleich (2014, in Milliarden Euro)
2.11 Immobilienpreise in der Eurozone
2.12 Haushaltsvermögen (2010)
3.1 Wachstum ausgewählter Euroländer in der Krise (2006–2014)
3.2 Wachstum ausgewählter Euroländer vor und in der Krise (1995–2014)
3.3 Die Reihung der Euroländer im Hinblick auf ihr BIP pro Kopf
3.4 Die weltgrößten Kapitalexporteure und andere Länder (1999–2014)
3.5 Gesamtwirtschaftliche Nettoinvestitionen als Anteil des Nettoinlandsprodukts (2003–2007)
3.6 Die Verwendung der deutschen Ersparnisse (2003–2007)
3.7 Internationale Bankenforderungen gegenüber dem öffentlichen und privaten Sektor von Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Italien zur Zeit der Lehman-Insolvenz
3.8 Arbeitslosenzahlen in Ländern der Eurozone, saisonbereinigt (1995–2015)
3.9 Entwicklung der westdeutschen Arbeitslosigkeit 1970–2014
3.10 Kapitalflüsse und Leistungsbilanzsalden in der Eurozone – der europäische Tango (1995–2014)
4.1 Die Griechenland-Prognosen des IWF und die Realität
4.2 Komponenten der Leistungsbilanz, saisonbereinigt und arbeitstäglich bereinigt (2002–2014)
4.3 Die Zinsgewinne der GIPSIZ-Länder
4.4 Exporte, Importe und Nettozinslast der GIPSIZ-Länder
4.5 Der Krise entkommen? Produktion im Verarbeitenden Gewerbe, saisonbereinigt
4.6 Preisänderungen zwischen 1995 und 2007 der in den Euroländern hergestellten Güter (BIP-Deflator)
4.7 Spanische Arbeitslöhne im Bausektor relativ zum Verarbeitenden Gewerbe (1990 bis zweites Vierteljahr 2014)
4.8 Reale Auf- und Abwertungen relativ zum Rest der Eurozone (1995–2007)
4.9 Die relativen Preise in der Eurozone (reale effektive Wechselkurse als BIP-Deflator relativ zum Rest der Eurozone)
4.10 Arbeitnehmerentgelte im öffentlichen Sektor und im Durchschnitt der Wirtschaft (Lohnsummen, 2005–2014)
4.11 Arbeitnehmerentgelt im Baltikum (2005–2014)
4.12 Exporte und Importe des Baltikums saisonbereinigt und arbeitstäglich bereinigt (2002–2014)
4.13 Arbeitskosten je Stunde im Jahr 2014 im Verarbeitenden Gewerbe der GIPSIZ-Länder im Vergleich mit osteuropäischen Ländern sowie der Türkei (2013)
5.1 Internationale Bankforderungen gegenüber dem öffentlichen und privaten Sektor in Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Italien
6.1 Kapitalströme im Zahlungsbilanzgleichgewicht und in der Zahlungsbilanzkrise
6.2 Akkumulierte Zahlungsbilanzsalden im Euroraum (Januar 2003 bis Dezember 2014 bzw. Juni 2015)
6.3 Nationale Target-Salden (Stand: August 2012)
6.4 Target-Salden (hellblau) und Auslandsvermögen als Anteil am BIP (2012)
6.5 Binnengeld und Außengeld in den GIPSIZ-Ländern (Januar 2007 bis Dezember 2014)
6.6 Die Struktur der Geldbasis und die Rolle der Target-Salden (Januar 2002 bis Dezember 2014)
6.7 Internationale Verlagerung der Refinanzierungskredite als Resultat der steigenden Target-Salden (Januar 2007 bis Dezember 2014)
6.8 Die Verdrängung des Binnengeldes in Deutschland und Finnland
7.1 Nettoauslandsschulden, akkumulierte Leistungsbilanzsalden, Target-Schulden und fiskalische Rettungsaktionen (GIPSIZ)
7.2 Griechenland
7.3 Portugal und Zypern
7.4 Irland
7.5 Italien und Spanien
7.6 Frankreich
7.7 Deutschland
7.8 Die Niederlande und Finnland
7.9 Österreich
7.10 Target-Salden und ISA-Salden als Anteil des BIP der Eurozone bzw. der USA (Januar 2003 bis Juni 2015)
8.1 Die Staatspapierkäufe des Eurosystems unter dem SMP
8.2 Öffentliche Kredite für die GIPSIZ-Länder (August 2012, in Milliarden Euro)
8.3 Entwicklung der CDS-Prämien für zehnjährige Staatspapiere der GIPSIZ-Länder
8.4 Inflationsrate und Kerninflationsrate im Euroraum
8.5 Staatsschulden und Bankenschulden in den GIPSIZ-Ländern (März 2015, Milliarden Euro)
9.1 Totale und partielle Staatskonkurse (1978–2013)
Tabellenverzeichnis
4.1Die notwendigen Ab- und Aufwertungen im Euroraum (ab dem dritten Vierteljahr 2010, relativ zum Durchschnitt der Eurozone)
5.1Veränderungen der Refinanzierungspolitik des Eurosystems (Zeitpunkt des Inkrafttretens)
8.1Internationale öffentliche Kredite (August 2012, Dezember 2014 und für Griechenland Juni 2015)
8.2Maximal mögliche Verluste für ausgewählte Euroländer im Falle einer Insolvenz der GIPSIZ-Länder und ihrer Geschäftsbanken (Dezember 2014)
8.3Notleidende Anlagen der Banken der GIPSIZ-Länder nach Schätzung des IWF (Q4 2013 bis Q1 2015)
9.1Tatsächliche und hypothetische Staatsschuldenquote (Dezember 2014, %)
9.2Öffentliche Kredite von Staaten oder internationalen Institutionen relativ zum tatsächlichen oder hypothetischen BIP der Empfängerländer (Dezember 2014, %)
Boxenverzeichnis
Box 2.1Zur Zeitverzögerung zwischen Portfolioumschichtungswünschen und Leistungsbilanzreaktionen
Box 5.1Der STEP-Markt
Box 8.1Zur Berechnung der Haftung der Nicht-GIPSIZ-Notenbanken
Einführung
Die Eurokrise
Die Europäische Union hat die Europäer vom Joch des Nationalismus befreit und den Völkern Europas Freiheit und Prosperität beschert. Ihre Stabilität beruht auf einem freiwilligen Zusammenschluss zur Erleichterung des Handels und zur Verfolgung gemeinsamer Ziele. Diese Stabilität wird jedoch heute durch die Eurokrise gefährdet. Seit Jahren schwelt der Streit über die ungelöste Schuldenproblematik und den richtigen Weg, die tief greifende Wirtschaftskrise Südeuropas und Frankreichs zu überwinden. Alte Geister, die man lange tot geglaubt hatte, leben wieder auf. So erfolgreich die Europäische Union agierte, als so problematisch erweist sich die Währungsunion.
Die Krise flackerte in den letzten Jahren mehrfach auf, zuletzt 2015, dem Jahr, in dem die deutsche, aktualisierte Übersetzung dieses zunächst 2014 bei Oxford University Press veröffentlichten Buches erscheint. In Griechenland war mit Syriza eine radikal-sozialistische gemeinsam mit einer radikal-nationalistischen Partei an die Macht gekommen, die den Leuten einredete, man könne die verhasste Austeritätspolitik durch einen Volksentscheid überwinden, wobei man freilich übersah, dass die Austerität, also die erzwungene Sparsamkeit, durch die internationalen Kapitalmärkte verhängt worden war, wohingegen die anderen Länder der Eurozone in riesigem Umfang Rettungsgelder zur Verfügung stellten, bis zum Juni 2015 immerhin 31.000 Euro für jeden Griechen, 344 Milliarden Euro insgesamt.1 Trotzdem ist Griechenland bankrott, wie es der europäische Rettungsschirm EFSF am 3. Juli 2015 offiziell verkündete. Auslandsüberweisungen wurden limitiert oder verboten, Kontoabhebungen wurden beschränkt, und schließlich mussten die Banken eine Zeit lang vollständig schließen, bis man sich entschloss, doch noch Verhandlungen über ein neues Rettungsprogramm im Volumen von 86 Milliarden Euro aufzunehmen.
Beim Streit um eine abermalige Griechenland-Rettung und ein drittes Hilfsprogramm für Griechenland ging es heftig zu. Die Regierungen verhakelten sich, bedrohten einander, beschuldigten sich unfairer Machenschaften und konstatierten wechselseitig ein zerstörtes Vertrauen. Griechische Reparationsforderungen aus dem Zweiten Weltkrieg kamen offiziell auf den Tisch, und demonstrativ suchte der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras die Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin.
Es stand Spitz auf Knopf. Nur durch das Eingreifen der französischen Regierung, die in Griechenland hinter dem Rücken von Angela Merkel die Verhandlungsführung übernahm,2 konnte der Austritt, den Finanzminister Yanis Varoufakis schon ein halbes Jahr lang vorbereitet hatte und am Abend nach dem Referendum den anderen Regierungsmitgliedern vorschlug,3 in letzter Sekunde verhindert werden. Dabei wurde sehr viel politisches Porzellan zerschlagen, sowohl zwischen Deutschland und Frankreich als auch in der deutschen Regierung, die sich nicht wirklich einig war, wie man vorgehen sollte. Während Finanzminister Wolfgang Schäuble den temporären Austritt Griechenlands auch noch nach der Rettungsentscheidung favorisierte,4 schien die Bundeskanzlerin erleichtert, dass ihr die Bürde der Entscheidung wieder einmal genommen worden war.
Als der Euro vor 20 Jahren, im Dezember 1995, auf dem Gipfel von Madrid endgültig beschlossen wurde, sah es überhaupt nicht so aus, dass es einmal so schlimm kommen könnte. Die Rede war von Heirat statt von Scheidung. Ganz Europa war von einer Welle der Begeisterung erfasst und sah die Zukunft der gemeinsamen Währung in rosigem Lichte.
Ich muss zugeben, dass ich selbst auch zu den Eurobefürwortern gehörte, die nicht auf die warnenden Stimmen der älteren und erfahrenen Ökonomen hören wollten. Ich war ein junger Theoretiker, der an die Einhaltung der Regeln glaubte, und ich muss zugeben, dass ich mich als überzeugter Europäer von erhabenen Gefühlen forttreiben ließ, statt den Skeptikern das ihnen gebührende Ohr zu gewähren. Damals schien Europa historisch an einem Punkt angekommen zu sein, an dem eine gemeinsame Währung als der nächste logische Schritt zur Stärkung von Frieden und Wohlstand erschien.
Inzwischen wissen wir, dass sich die hohen Erwartungen nicht erfüllt haben. Heute erinnert die Eurozone eher an einen Scherbenhaufen, auf dem man von Krise zu Krise stolpert. Während die Wettbewerbsfähigkeit des Südens Europas ruiniert ist, findet sich der Norden in einer Rettungs- und Verschuldungsspirale wieder, der er nicht mehr entkommen kann. Nur ein Masochist könnte die Entscheidung zur Einführung des Euro noch heute mit Enthusiasmus begrüßen, schreibt Martin Wolf in der Financial Times.5 Der ehemalige holländische EU-Kommissar Frits Bolkestein, einer der Architekten der EU, spricht gar von einem Fluch des Europrojekts und fordert den Austritt seines Landes aus der Währungsunion.6
Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission, verglich die Krise mit dem Zustand Europas im Jahr 1913, als sich niemand vorstellen konnte, dass bald ein Krieg ausbrechen würde.7 Obwohl dieser Vergleich reichlich übertrieben ist, lässt sich nicht bestreiten, dass sich das Nachkriegs-Europa heute in einer Periode befindet, in der die Ressentiments zwischen den Bürgern der verschiedenen Nationen plötzlich wieder anschwellen und man sich immer weiter voneinander entfernt. Nicht nur in Griechenland, sondern auch in Großbritannien gibt es maßgebliche Kräfte, die sich vom europäischen Gemeinschaftsprojekt abwenden wollen, wobei man in Großbritannien sogar die EU an sich meint.
Der Auslöser der heutigen europäischen Krise lag in den USA. In den Jahren 2007/2008 schwappte nämlich die US-amerikanische Finanzkrise, die den gesamten Bankensektor erfasst hatte, zu den Staaten Europas und ihren Banken herüber und trieb Europa sowie den Rest der Welt in die bislang schärfste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Fast ganz Europa war von ihr betroffen. Nur Polen wuchs weiter, als sei nichts gewesen. Deutschland und andere nördliche Länder konnten die Krise zwar schnell überwinden, doch Südeuropa lag schwer angeschlagen am Boden. Frankreich war ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen, weil in Südeuropa wichtige Kunden seiner Banken und Firmen sitzen.
Die Arbeitslosenzahlen in Spanien und Griechenland schwollen auf 30% an, ein Niveau, das die Welt zuletzt während der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre gesehen hatte. Die Jugendarbeitslosigkeit kletterte dort sogar auf 60%. Sie ging zwar 2014 temporär wieder auf 50% herunter, was vornehmlich an der Abwanderung junger Menschen lag, doch in Griechenland ist sie schon wieder im Steigen begriffen. In Italien war der Einbruch nicht so extrem, doch auch dort stieg die Jugendarbeitslosigkeit im Laufe der Zeit immer mehr an und hat zuletzt Werte von mehr als 40% erreicht. Die Industrieproduktion in Spanien, Italien und Griechenland kollabierte in einem Ausmaß, wie man es ebenfalls nur in der Weltwirtschaftskrise gesehen hatte. In Portugal verlief der Einbruch bislang etwas moderater.
Sicherlich gibt es auch Anzeichen einer Verbesserung. Die Weltwirtschaft hat sich mittlerweile erholt, und auch die Kapitalmärkte haben sich seit 2012 beruhigt. Die Medien erweckten im Jahr 2014 sogar den Anschein, dass das Gröbste der Krise überstanden sei. Davon bin ich nicht überzeugt, denn die Strukturkrise der südeuropäischen Länder ist im Jahr 2014 nur mit einer hohen Neuverschuldung der Staaten übertüncht worden, die nicht im Einklang mit dem gehärteten Fiskalpakt des Jahres 2012 steht, nach dem alle Staatsschuldenquoten pro Jahr um ein Zwanzigstel des Abstandes zu 60% fallen sollen. In keinem der Krisenländer ist die Quote bislang gefallen. Überall ging die Reise weiter bergauf. Erlaubt man einem Staat, sich zu verschulden, so kann er temporär Nachfrage in den lokalen Dienstleistungssektoren, am Bau und im Staatsapparat selbst entfalten, doch wird die Wettbewerbsfähigkeit dadurch nicht verbessert. Ganz im Gegenteil, es erlahmen die Kräfte, die in Krisenzeiten normalerweise schmerzliche Strukturreformen erzwingen.
Die neue Verschuldungswelle wurde durch die niedrigen Zinsen ermöglicht und angeregt, die selbst wiederum durch eine lockere Geldpolitik und die Kreditgarantien der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen des OMT-Programms sowie durch die günstigen Konditionen für fiskalische Rettungskredite erklärt werden. Mit einer strukturellen Verbesserung der Fundamentaldaten hat der Aufschwung des Jahres 2014 wenig zu tun.
Statt sich auf die Selbstkontrolle der Märkte gegenüber überzogenen Verschuldungswünschen zu verlassen, schuf man Institutionen, die das Insolvenzrisiko der Investoren auf die breite Masse der Steuerzahler und Transferempfänger der noch gesunden Länder abwälzen, und zum Schutz gegen Missbrauch schuf man auf dem Papier neue »gehärtete« Fiskalregeln, die aber allesamt in der Realität wiederum nicht beachtet werden. Insofern könnte sich die »wundersame Rettung« des Euro, die manche Analysten 2014 prognostizierten, schnell als Luftschloss erweisen. Wenn die potenziellen Verlierer des Risikospiels, nämlich die Steuerzahler der noch gesunden Länder, verstehen, was mit ihnen gespielt wird, könnte es auch für die Politik ein böses Erwachen geben. Langfristige politische Instabilität, Misstrauen und gar Ablehnung gegenüber EU-Institutionen könnten der Preis für die kurzfristige Stabilisierung der Finanzmärkte sein.
Die Verlagerung der Risiken von den Investoren auf die Steuerzahler ist auch rechtlich umstritten. Einerseits hatte das Bundesverfassungsgericht im Februar 2014 erklärt, dass das OMT das EU-Primärrecht verletze und dass die EZB ihr geldpolitisches Mandat überschreite,8 indem sie eine Rettungspolitik für Staaten betreibe. Andererseits hat der Europäische Gerichtshof diese Auffassung in einer Antwort auf eine Anfrage des deutschen Verfassungsgerichts im Juni 2015 beiseitegewischt.9 Das wird das deutsche Gericht zwar beeindrucken, kann es aber letztlich nicht zwingen, diesen Standpunkt in sein für 2016 erwartetes Urteil zu übernehmen, bei dem es um die Frage geht, ob die EZB mit der ausufernden Interpretation ihres geldpolitischen Mandats die vom Grundgesetz gewährleistete Budgethoheit des Deutschen Bundestages in noch zulässiger Weise beschränkt. Dieses Thema bleibt spannend.
Nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Südeuropa brodelt es heute. Internationale Rettungsprogramme, inklusive jener der EZB, konnten die Bürger zwar vor momentaner Not bewahren, doch der politische Unmut ist dabei, neue Organisationsformen zu finden. So gewinnen separatistische Bewegungen an Stärke. In Spanien versucht Pablo Iglesias mit seiner neuen linksradikalen Partei Podemos (»wir können«), den Erfolg von Alexis Tsipras in Griechenland mit einem ähnlichen Programm zu wiederholen.
Selbst Italien ist nicht vor Absetzbewegungen gefeit. Beppe Grillo, dessen Partei MoVimento 5 Stelle(Fünf-Sterne-Bewegung) bei den Wahlen 2013 in Italien die drittmeisten Stimmen erringen konnte, spricht sich offen für den Austritt Italiens aus der Währungsunion aus. Schon 2011 führte Silvio Berlusconi geheime internationale Verhandlungen über einen Austritt Italiens aus dem Euro,10 weil Italien vor einer zweiten Phase einer katastrophalen »Double-Dip-Rezession« stand, die im Jahr 2014 zu einer »Triple-Dip-Rezession« wurde: einem dritten Abschwung nach der Lehman-Krise des Jahres 2008.
Heute, zweieinhalb Jahre und drei Premierminister später, ist die Situation in Italien noch immer deprimierend. Der neue Premierminister Matteo Renzi hat zwar revolutionäre Veränderungen in der italienischen Politik angekündigt, doch den großen Sprüchen folgten bislang nur wenige Taten, jedenfalls keine, von denen man eine Erholung der italienischen Wirtschaft erwarten kann. Seine ganze Kraft hat Renzi bislang in die Reform eines zerrütteten politischen Systems gesteckt. Kritiker sagen, dass er dabei nur seine eigene Machtbasis stärken wollte. Mit wirklich tief greifenden Wirtschaftsreformen hat das Ganze jedenfalls bisher wenig zu tun.
Die internationalen Spannungen haben Politiker und Wähler dazu veranlasst, nach Sündenböcken zu suchen. In Italien machte Berlusconis Partei Forza Italia Deutschland für seine Probleme verantwortlich. Ähnlich argumentiert Beppe Grillo. Demonstrationen wendeten sich zunehmend gegen die deutschen Rufe nach Sparprogrammen in Griechenland, Portugal und Zypern, wobei Deutschland für den miserablen Zustand der öffentlichen Finanzen und für die Massenarbeitslosigkeit verantwortlich gemacht wurde.
Als die Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober 2012 Athen besuchte, musste die Stadt in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt werden, um gewaltsame Protestaktionen zu verhindern. Und in der neuen griechischen Krise des Jahres 2015 fielen die Hakenkreuzfahnen und SS-Uniformen, die Demonstranten den deutschen Politikern zugeordnet hatten, schon gar nicht mehr auf, weil man sich an die Bilder gewöhnt hatte. Offensichtlich hat sich der Euro nicht zu dem großen Friedensprojekt entwickelt, als das ihn Kanzler Helmut Kohl seinerzeit angekündigt hatte.
Auch anderswo kanalisiert sich der Ärger in Form neuer politischer Parteien. Die französische Partei Front National, angeführt von Marine Le Pen, und die holländische Partij voor de Vrijheid (Partei für die Freiheit), angeführt von Geert Wilders, die beide an der Spitze der Umfragen stehen, haben eine internationale Koalition gegen den Euro formiert. Sie betreiben den Austritt.
In Deutschland gründete der Ökonomieprofessor Bernd Lucke eine zunächst überraschend erfolgreiche eurokritische Partei, die Alternative für Deutschland (AfD). Sie wendete sich gegen die Rettungspolitik und plädierte für eine Verkleinerung der Eurozone, doch wollte sie nicht, dass Deutschland austritt. Inzwischen hat sich Lucke jedoch mit einigen Getreuen abgesetzt und eine neue Partei mit dem Namen Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA) gegründet, weil er sich von den radikalen und antiliberalen Kräften absetzen wollte, die sich in der AfD breitgemacht hatten. Ob er Erfolg haben wird, steht auch deshalb in den Sternen, weil sich inzwischen die FDP unter ihrem neuen Parteichef Christian Lindner von der kostspieligen Rettungspolitik distanziert hat und eurokritischere Töne anschlägt.
Die europäischen Spannungen resultieren aus einem fundamentalen Konflikt zwischen Wunsch und Wirklichkeit, dem sogenannten Primat der Politik über die ökonomischen Gesetze. Über Jahre hinweg kann die Politik ihren Willen durchsetzen und so tun, als gäbe es keine Budgetzwänge, keine ökonomischen Gesetze und keine Mathematik. Doch irgendwann fällt einem der Versuch, die Wirklichkeit zu überlisten, auf die Füße, und dann schmerzt es heftig, und zwar umso mehr, je länger man gezögert hat. Während die Empfänger der Rettungsmilliarden ihren geborgten Lebensstandard als Ansprüche verteidigen und ihn immer noch als unzureichend empfinden, weil das viele geborgte Geld die fehlende Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nur teilweise ersetzen kann, dämmert es den Geldgebern allmählich, wie teuer die Angelegenheit wird, und Widerstand baut sich bei ihnen auf. Das ist der Zeitpunkt des Konflikts. Durch neuen Kredit lässt sich dieser Zeitpunkt weiter hinausschieben, doch wird der Konflikt dann später umso größer, wenn sich herausstellt, dass auch nicht zurückgezahlt werden kann.
Griechenland bezieht nun schon seit 2008 keine Kredite mehr von den internationalen Kapitalmärkten und wird vollständig von der Staatengemeinschaft finanziert, die hinter der Eurogruppe, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds steht. Und trotzdem richtet sich der Unmut dieses Landes gegen die zurzeit noch wirtschaftlich gesunden Länder des nördlichen Teils der Eurozone, Deutschland allen voran, welches der bei Weitem größte Geldgeber für Griechenland ist.
Ähnlich, nur verhaltener ist die Situation in praktisch allen Ländern Südeuropas, die allesamt in den Genuss umfangreicher Kredithilfen der EZB und zum Teil auch der Rettungsschirme gekommen sind. Auch dort haben die Hilfen Ansprüche verfestigt, von denen man nur schwer wieder herunterkommt, während sich in den nordeuropäischen Ländern eine zunehmende Rettungsmüdigkeit breitmacht. Das liegt auch daran, dass einige dieser angeblich reichen Geberländer deutlich weniger wohlhabend als ihre südeuropäischen Nachbarn sind, wie eine jüngste Vermögensstudie der EZB zutage brachte. So lag das mittlere deutsche Haushaltsvermögen nach einer Umfrage der EZB, die im Jahr 2010 veröffentlicht wurde, bei weniger als der Hälfte des griechischen und nicht einmal einem Drittel des italienischen Haushaltsvermögens.11 Diese Zahlen sind natürlich Durchschnittszahlen und sagen nichts über die Verteilung in den Ländern aus. Während die Reichen ihr Vermögen in Sicherheit bringen, sieht man herzzerreißende Bilder notleidender Menschen, die dringend der Hilfe bedürfen.
Die zunehmenden Spannungen zwischen den durch Sparauflagen irritierten Menschen im Süden und den von Hilfsprogrammen genervten Menschen in den nördlichen Ländern lassen derzeit keine allzu günstigen Zukunftsprognosen für das europäische Projekt mehr zu.
Aus der Sicht vieler linker Ökonomen, die alles nur durch die Brille der kurzfristigen keynesianischen Konjunkturtheorie sehen, durchläuft Südeuropa lediglich eine Rezession, die durch schuldenfinanzierte zusätzliche Ausgaben überwunden werden kann. Je größer die Arbeitslosigkeit in der Volkswirtschaft, desto größer sei der Multiplikator neuer Schulden für das Wachstum, argumentieren sie. Ganz abgesehen davon, dass neue Schulden der Krisenländer heute nur möglich sind, wenn sie von den Steuerzahlern anderer Länder zur Verfügung gestellt oder zumindest garantiert werden, wäre eine solche Politik nur dann plausibel, wenn der südeuropäische Wirtschaftsraum strukturell stabil wäre und nur unter einem temporären Nachfrageausfall litte.
Doch tatsächlich leiden die fragilen Länder unter einem systemischen Mangel an Wettbewerbsfähigkeit, der durch weitere Nachfragestimulierung nur noch vergrößert wird. Die südeuropäischen Länder wurden durch die inflationäre Kreditblase, die der Euro mit sich brachte, zu teuer, weil sie ihre Löhne und Preise relativ zu den nordeuropäischen Ländern der Eurozone immer weiter erhöhten. Als im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts zudem noch mehrere osteuropäische Länder in die EU kamen und eine Niedriglohnkonkurrenz aufbauten, war die Standortkrise unvermeidlich. Die Industrielöhne sind in Griechenland und Spanien noch heute doppelt bis dreimal so hoch wie in Polen, während gleichzeitig polnische Arbeiter und Handwerker europaweit für ihr Geschick und ihren Fleiß bekannt sind. Ein solches strukturelles Handicap kann nur über einen langen Zeitraum überwunden werden, und keynesianische Schuldenfinanzierung ist hierfür nicht die richtige Medizin. Um Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen, müssen die südeuropäischen Länder vielmehr substanziell billiger werden, indem sie weniger stark als ihre Wettbewerber in der Eurozone inflationieren, wenn nicht sogar deflationieren. Eine relative Abwertung des Preisniveaus wäre also nützlich. Das jedoch erfordert weniger anstatt mehr Nachfragestimulus durch Schuldenprogramme.
Nachfrage- und liquiditätsstiftende Rettungsmaßnahmen haben verschiedene Nebeneffekte: Sie kaufen Zeit für jene Finanzinvestoren, die ihre Zelte abbrechen wollen; sie setzen das Geld der nordeuropäischen Steuerzahler aufs Spiel, die in Geiselhaft genommen werden; und sie reduzieren den Druck auf die südeuropäischen Regierungen, jene schmerzhaften Strukturreformen auf den Weg zu bringen, die die erforderlichen Lohn- und Preisanpassungen für die Wiedererlangung von Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen. Solche Rettungsmaßnahmen sind reine Schmerzmittel, die die Einnahme bitterer Medizin entbehrlich erscheinen lassen.
Gewiss können Finanzmärkte theoretisch sogenannte multiple Gleichgewichte haben, und gewiss können öffentliche Garantien unter bestimmten Bedingungen zu einem besseren Gleichgewicht führen, das niedrigere Zinssätze und ein nachhaltiges Schuldenmanagement ermöglicht, ohne dass diese Garantien jemals gezogen werden müssen. Ich nenne dies die Geldim-Schaufenster-Theorie. Nach dieser Theorie muss das Geld lediglich im Schaufenster liegen, um einen Beruhigungseffekt zu erreichen; genommen wird es nicht.
Jedoch gibt es zwei Gründe, warum diese Theorie nicht auf den europäischen Fall übertragbar ist. Erstens haben die Länder Südeuropas vor der Krise immense Leistungsbilanzdefizite akkumuliert, sogar als die Zinsen niedrig waren; die strukturelle Komponente dieser Defizite ist bis zum heutigen Tag noch nicht verschwunden. Diese Schwierigkeiten resultierten nicht aus der Finanzkrise, sondern haben tiefere Wurzeln.
Zweitens wurde das Geld, das im Schaufenster lag, bereits genommen. Auf dem ersten Höhepunkt der Eurokrise im August 2012 waren insgesamt 256 Milliarden Euro an Rettungsgeldern bezogen, sei es durch zwischenstaatliche Kredite, durch die EU oder den IWF. Im Juni 2015 waren es 361 Milliarden Euro. Zusätzlich bot die EZB ein großes Volumen an Rettungskrediten an, von dem die Öffentlichkeit aber kaum oder gar nichts wusste. Die EZB hat nicht nur in massivem Umfang Staatsanleihen der Krisenländer gekauft und angekündigt, die Käufe bei Bedarf unbegrenzt zu steigern, eine Politik, für die es z. B. im Federal Reserve System der USA keinerlei Parallelen gibt.
Vielmehr hat die EZB den Krisenländern und ihren ausländischen Gläubigern auch dadurch geholfen, dass sie den jeweiligen nationalen Notenbanken die Erlaubnis gab, die regionalen Finanzierungsprobleme mit der heimischen Druckerpresse zu lösen, was den Bürgern und Unternehmen den Import von Waren oder die Tilgung von privaten Auslandsschulden ermöglichte. Diese Hilfe aus der Druckerpresse fand durch eine zusätzliche Gewährung von sogenannten Refinanzierungskrediten an die lokalen privaten Geschäftsbanken statt. Sie nahm zu einem kleinen Teil die physische Form einer zusätzlichen Banknotenausgabe an, vor allem aber geschah sie elektronisch in Form eines Verleihs von Buchgeld, mithilfe dessen die Banken internationale Überweisungen finanzieren konnten. Diese internationalen Überweisungen fanden als sogenannte Target-Kredite ihren Niederschlag in den Bilanzen der nationalen Mitgliedsbanken des Eurosystems. Target (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) ist ein Akronym, das das System grenzüberschreitender Geldüberweisungen in der Eurozone bezeichnet. Wie in dem Buch gezeigt wird, wurde dieses System zusammen mit den lokalen Refinanzierungsoperationen der nationalen Notenbanken zum zentralen Rettungsanker für die Krisenländer. Die Target-Salden messen Überziehungskredite, die sich die lokalen Geschäftsbanken über ihre nationalen Notenbanken im Eurosystem besorgen konnten. Sie sind so etwas wie der Schatten der Krise, ähnlich wie Kontoauszüge mit negativen Salden bei Menschen, die in Zahlungsschwierigkeiten sind.
Quantitativ übertrafen die Target-Kredite alle anderen Rettungsmaßnahmen, die von europäischen Parlamenten beschlossen wurden, bei Weitem. Im August 2012 standen 1.003 Milliarden Euro Target-Kredite an die sechs Krisenländer zu Buche, nahezu vier Mal so viel wie die Summe der zwischenstaatlichen Kredite und der Kredite der EU und des IWF. Gleichzeitig verbuchte Deutschland als bei Weitem größter Target-Gläubiger eine Forderung gegen das EZB-System von 751 Milliarden Euro. Das Volumen der Target-Kredite nahm danach zwar deutlich ab, vor allem weil diese Kredite durch fiskalische Kredite aus den Rettungsschirmen ersetzt wurden, doch in der Griechenland-Krise des Jahres 2015 schossen die Werte, wieder nach oben.
Indem sie die Bedingungen schuf, unter denen die Selbstbedienung mit der Druckerpresse möglich wurde, hat sich die EZB in eine fiskalische Institution verwandelt, die bedrohten Wirtschaftsräumen Hilfskredite gewährt, wenn sie solche Kredite am Kapitalmarkt nicht mehr oder nur noch zu schlechten Konditionen bekommen können. Wie später gezeigt werden wird, gibt es für die unbeschränkten Target-Kredite kein Pendant im US-amerikanischen Federal Reserve System. In den USA kann die elektronische Druckerpresse keineswegs dazu benutzt werden, den einzelnen Regionen des Systems zu einem Kredit unterhalb der Marktzinsen zu verhelfen, denn wenn eine der Regionen des Fed-Systems mehr Geld herstellt, als es ihrer Größe entspricht, muss sie die dadurch entstehenden Verbindlichkeiten jährlich tilgen. Das System der unbeschränkten Überziehungskredite gibt es nur in Europa.
Leider wird dieses Buch vermutlich das letzte Dokument sein, das über den aktuellen Jahresendstand aller europäischen Target-Kredite berichten kann, denn einige nationale Notenbanken publizieren die Höhe der von ihnen bezogenen oder gewährten Überziehungskredite im Eurosystem nicht mehr bzw. wenn, dann nur mit anderen Posten zusammengerechnet, sodass man das Kreditvolumen nicht verfolgen kann. Das sind die Länder Irland, Portugal, Frankreich, Slowakei, Slowenien und Litauen. Bisher konnten Forscher als Hilfsgröße bei manchen Ländern Daten vom Internationalen Währungsfonds heranziehen,12 doch die entsprechenden Datenreihen werden dort inzwischen auch nicht mehr aktualisiert. Dass nun gerade zwei der Hauptkrisenländer, nämlich Irland und Portugal, die selbst riesige Überziehungskredite in Anspruch genommen haben, nicht mehr über die Höhe dieser Kredite berichten, sowie auch das stark angeschlagene Frankreich, ist höchst bedauerlich. Ein Schelm ist, wer dabei Böses denkt.
Glücklicherweise liegen aber die Daten, über die auch die EZB selbst nicht regelmäßig berichtet und die man sich aus den Einzelbilanzen und aus IWF-Statistiken zusammenklauben muss, für dieses Buch vollständig bis zum Jahresende 2014 vor, das ohnehin den generellen Redaktionsschluss darstellt. Wo es möglich war, wurden im Einzelfall auch noch aktuellere Daten bis zum ersten oder zweiten Quartal 2015 mit aufgenommen.
Das wiederkehrende Motiv des Buches und das Kernproblem in der Architektur des Eurosystems ist die Aufweichung der nationalen Budgetbeschränkungen der jetzigen Krisenländer vor und während der Krise. Vor dem Ausbruch der Krise wanderte zu viel Kapital aus dem Norden in den Süden, sodass eine inflationäre Kreditblase entstand, die den Süden seiner Wettbewerbsfähigkeit beraubte. Das zeigte sich an einer starken Zinskonvergenz und gewaltigen Leistungsbilanzsalden, die die Kapitalflüsse messen. Die exzessiven Kapitalflüsse resultierten primär aus dem impliziten Schutz der gemeinsamen Währung für Investoren. Diese sahen kein Insolvenzrisiko für Staaten oder ihre Banken, da die nationalen Notenbanken das notwendige Geld zur Schuldentilgung jederzeit drucken und verleihen konnten und man davon ausging, dass es im Notfall politisch unmöglich sein würde, sie davon abzuhalten. Die exzessiven Kapitalflüsse resultierten ferner aus den Anreizen, die die staatlichen Regulierungssysteme für die Banken und Versicherungen der kapitalexportierenden Länder setzten, ihre Gelder bedenkenlos an andere europäische Banken und europäische Staaten zu verleihen. All dies widersprach dem Grundsatz des Beistandsverbots des Vertrags von Maastricht, der, sofern er ernst genommen worden wäre, den Investoren Einhalt geboten und die Kapitalflüsse gezügelt hätte.
Nach dem Ausbruch der Krise wurde öffentliches Kapital über die EZB bereitgestellt, um den Niedergang der privaten Kapitalströme zu kompensieren. 2008, nach der Insolvenz der Lehman-Bank in den USA, war dies durchaus vertretbar, um einen sofortigen Kollaps der europäischen Volkswirtschaften zu verhindern. Anstatt jedoch später wieder zu den strengen Haftungsregeln einer Marktwirtschaft zurückzukehren, setzten die EZB und die Eurostaaten-Gemeinschaft ihre Politik der weichen Budgetbeschränkung fort, indem sie immer mehr öffentlichen Kredit unterhalb der Marktkonditionen zur Verfügung stellten und infolgedessen sowohl die Schuldner als auch ihre Gläubiger »retteten«. Die Übertragung der Haftung zerstörte nicht nur eine der Säulen des Maastrichter Vertrags. Er zerstörte auch einen der Grundpfeiler einer funktionierenden Marktwirtschaft, nämlich das Prinzip, dass ein jeder für die Folgen seiner Handlungen einstehen muss.
Das französische, deutsche und britische Bankensystem (in dieser Reihenfolge) war mit den Krisenländern wirtschaftlich stark verbandelt. Alle Gläubigerbanken profitierten insofern von der Rettungspolitik, weil sie ihr in die Krisenländer verliehenes Geld sonst wohl nicht zurückbekommen hätten. Aber sie litten auch unter den EZB-Krediten, und zwar insofern, als sie wegen der Konkurrenz der EZB selbst keine risikoadäquaten Zinsaufschläge mehr verdienen konnten.
Der ungarische Ökonom János Kornai prophezeite bereits 1980, dass weiche Budgetbeschränkungen zum Untergang der kommunistischen Systeme führen würden.13 Auch die Eurozone läuft Gefahr, von diesem Schicksal getroffen zu werden. Obwohl weiche Budgetbeschränkungen in der kurzen Frist helfen mögen, die Wahrscheinlichkeit eines Systemzusammenbruchs zu verhindern, verzerren sie die Anreize, strukturelle Reformen auf den Weg zu bringen. Indem überzogene Vermögenspreise und Bilanzsalden fortbestehen, wird fragilen Finanzinstituten in wettbewerbsunfähigen Ländern geholfen, aber zu dem Preis, dass die Rendite auf Realkapital unter dem Niveau liegt, das notwendig wäre, um neue Investitionen anzulocken, was eine Grundvoraussetzung für angebotsgetriebenes Wachstum ist. Als Folge einer solchen Rettungspolitik ist daher eine langfristige Stagnation zu befürchten. Die Volkswirtschaft wird nicht wirklich gerettet, sondern bloß daran gehindert, real abzuwerten, wie es nötig wäre, um wieder wettbewerbsfähig zu werden und zu wachsen.
Es ist mehr als fraglich, ob Europäer weiterhin in Eintracht zusammenleben, wenn sich eine solche öffentliche Bailout-Politik fortsetzt. Die in Gang gesetzte Rettungskaskade hebt Schuldner-Gläubiger-Beziehungen von der privaten auf eine politische Sphäre. Da es kein Zivilrecht gibt, um diese Konflikte zu lösen, kommt es zu hässlichen öffentlichen Debatten, die in Animositäten und Unfrieden münden, wie der Streit um die Griechenland-Rettung des Jahres 2015 in aller Deutlichkeit zeigt. Hätte man im Jahr 2010 nicht die privaten Gläubiger Griechenlands in Form der Rettungskredite der Staatengemeinschaft durch öffentliche Gläubiger ersetzt, so hätten sich Yanis Varoufakis und Alexis Tsipras an die Banken in Paris, Deutschland und London richten müssen, um ihrem Ärger Luft zu machen. So aber richtete sich der ganze Frust auf Angela Merkel und Wolfgang Schäuble als Vertreter ihres größten Gläubigerlandes. Die alte Volksweisheit, dass man Freunden keinen Kredit gibt, weil sie dann nicht Freunde bleiben werden, wurde von der europäischen Rettungspolitik sträflich missachtet. Man sollte eben Freundschaften oder Familienbande nicht durch Gläubiger-Schuldner-Beziehungen belasten. Solche Beziehungen sollte man möglichst nur mit Außenstehenden pflegen. Die Politik hat damals dem momentanen Druck nicht standgehalten, der von den Banken und Staaten Südeuropas ausgeübt wurde, und hat sich unter Bruch der No-Bailout-Regel des Maastrichter Vertrags dazu hinreißen lassen, die Rückzahlung privater Altkredite mit neuen Krediten der Steuerzahler zu ermöglichen. Das hatte erst einmal Ruhe gegeben und die Situation für die anstehenden Wahlen bereinigt. Doch schon fünf Jahre später kam so viel neuer Sturm auf, dass dabei das Verhältnis zwischen Griechenland und Deutschland nachhaltig zerrüttet wurde, während Frankreich als freundlicher Vermittler punkten konnte.
Die Geschichte ist voller Beispiele für die problematischen Beziehungen zwischen Gläubigern und Schuldnern, und eines der Beispiele aus den ersten Jahren der Vereinigten Staaten von Amerika wird im letzten Kapitel des Buches diskutiert. Die historische Liste der Konflikte zwischen staatlichen Gläubigern und Schuldnern ist abschreckend, selbst wenn sich das Horrorgebilde, das Jean-Claude Juncker ausgemalt hat, niemals bewahrheitet.
Die Situation ist festgefahren, und es gibt wenig Politikoptionen, die den Euro erhalten würden, ohne zugleich zentralplanerische Strukturen auf dem europäischen Kapitalmarkt zu errichten. Trotzdem sollte man einen Versuch wagen, die Implosion des Eurosystems zu verhindern und an der Idee des Euro als eines Friedensprojekts festzuhalten. Um dies zu erzielen, sind weitaus radikalere Reformen notwendig als jene, die Politiker heute ins Auge fassen.
Das vorliegende Buch versucht, das Krisengeschehen, das der Euro in Europa mitentfachte, zu begreifen. Es analysiert die Faktoren, die zu der Krise geführt haben, beschreibt den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der südeuropäischen Länder, dokumentiert die Rettungsmaßnahmen der EZB und der Staatengemeinschaft und diskutiert die wenigen Politikoptionen, die noch offenbleiben.
Ich werde erklären, warum das Eurosystem in seiner gegenwärtigen Form nicht überleben kann, und ich werde argumentieren, dass es im Interesse einzelner Euroländer liegen könnte, temporär aus dem Euro auszutreten und ihre neue Währung abzuwerten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen. Das wäre nicht nur für sie die einfachste Möglichkeit, sondern böte auch die Möglichkeit, das Eurosystem zu stabilisieren. Ich bin davon überzeugt, dass die Europäer beim Aufbau eines gemeinsamen Staates durch eine Phase des »atmenden Euro« gehen müssen, eine flexiblere Währungsunion, die irgendwo zwischen dem Dollar und einem Festkurssystem wie dem Bretton-Woods-System angesiedelt ist, das in der Nachkriegszeit herrschte. Es sollte eine große Schuldenkonferenz stattfinden, um die privaten und öffentlichen Bilanzen der austretenden Länder zu reinigen und sie von einer untragbaren Schuldenlast zu befreien. Je früher diese Schuldenkonferenz tagt, desto schneller wird eine Erholung stattfinden können. Eine solche Konferenz könnte die Steuerzahler langfristig entlasten, obwohl sie über die Rettungsschirme bereits selbst zu Gläubigern geworden sind, weil sie künftig davor geschützt werden, immer mehr Schulden der Banken und Staaten Südeuropas zu übernehmen. Außerdem würde sich ein disziplinierender Effekt für die Zukunft ergeben, weil Investoren wüssten, dass sie ein Risiko eingehen, wenn sie überschuldeten Staaten und Banken Geld leihen. Die Selbstkontrolle des Kapitalmarkts funktioniert zwar nicht immer, aber ganz bestimmt funktioniert sie nicht, wenn man den Anlegern sagt, dass die Konsequenzen einer Fehlentscheidung von der öffentlichen Hand übernommen werden.
Trotz meiner fundamentalen Skepsis bezüglich der Funktionsfähigkeit des Eurosystems gebe ich meine Hoffnung für den Euro nicht auf; noch weniger meine Hoffnung auf ein vereinigtes Europa. Angesichts der grauenhaften Ereignisse des 20. Jahrhunderts, für die Deutschland die größte Verantwortung trägt, sehe ich keine Alternative für eine Intensivierung der europäischen Integration. Tatsächlich würde ich sogar so weit gehen, die »Vereinigten Staaten von Europa« zu fordern. Ein gemeinsamer europäischer Staat würde jenen bindenden Versicherungskontrakt konstituieren, auf dessen Basis man eine Fiskalunion und eine gegenseitige Risikoteilung zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Teilregionen vielleicht realisieren könnte. Doch kann die Fiskalunion nicht vor der Gründung dieses Staates kommen. Das wäre so, als würde man eine Gütergemeinschaft bereits vor der Ehe in der Hoffnung beschließen, die Ehe käme dann schneller zustande.
Ich versuche, in einem späteren Teil des Buches herauszuarbeiten, welche Komponenten ein gemeinsamer europäischer Staat enthalten sollte und welche nicht. Die Schweizer Konföderation, die historisch zunächst einmal kein Haftungsverbund zwischen den Kantonen, sondern vor allem ein außenpolitisches Schutz- und Trutzbündnis ist, könnte hier ein nützliches Vorbild sein. Ich mache mir keine Illusionen über die Realisierungsmöglichkeiten eines solchen Projekts in naher Zukunft. Doch finde ich es richtig, ein Ziel zu formulieren, das zugleich Orientierung und Hoffnung für Europas Bürger bietet.
Es gibt nicht nur einen Weg zur Vertiefung der europäischen Integration, sondern viele. Daher sollte man sich nicht vor der vom britischen Premierminister David Cameron initiierten Debatte über ein Referendum für den Verbleib Großbritanniens in der EU scheuen.14 Da die ursprünglichen Ziele der europäischen Integration aus dem Auge verloren wurden, ist es höchste Zeit, die Entwicklungen der Europäischen Union während der letzten 20 Jahre kritisch zu hinterfragen. Manche Politiker wiederholen fortwährend, dass der einst eingeschlagene Pfad weitergegangen werden muss, ohne dass man nach links und rechts schauen darf, um zu prüfen, ob es noch andere Wege gibt. Wenn man dem Ziel nicht näher kommt oder gar in eine Sackgasse läuft, solle man nicht an dem Weg zweifeln, sondern einfach nur den Tritt beschleunigen. Indes lassen die alle paar Jahre von Neuem aufflackernde Krise des Eurosystems sowie das anhaltend hohe Niveau der Arbeitslosigkeit in Südeuropa Zweifel aufkommen. Vielleicht erweist es sich als besser, bis zur letzten Weggabel zurückzugehen, um eine andere Route auszuprobieren. Vielleicht sollte man wenigstens einmal innehalten, um zu prüfen, ob man tatsächlich auf dem richtigen Weg ist. Ich bedaure jene Politiker, Journalisten und Wissenschaftler, die keine andere Reaktion auf diese Zweifel kennen, als sie als »antieuropäisch« zu brandmarken und zu versuchen, die Schwäche ihrer Argumente mit Angriffen auf die Person des Zweifelnden zu übertünchen. Sich am Status quo festzuklammern ist mittlerweile weder politisch noch ökonomisch eine mögliche Alternative für Europa. Neue Wege müssen gefunden werden, wenn Europa auch in Zukunft erfolgreich sein möchte. Odysseus irrte seinerzeit zehn Jahre in der Ägäis herum, bevor er nach Ithaka zurückkehrte. Es bleibt zu hoffen, dass Europa seinen Weg früher findet.
München, August 2015
Hans-Werner Sinn
1 Wunsch und Wirklichkeit
Der Euroraum im Wandel — Der Euro und der Frieden — Die Vorteile des Euro für den Handel und den Kapitalverkehr — Eine unvollendete Gemeinschaft — Die Währungsunion als Preis der Wiedervereinigung? — Auf dem Weg zur Transfer- und Schuldenunion — Die Europäische Zentralbank
Der Euroraum im Wandel
Will man das Europrojekt angemessen beurteilen, muss man sich zunächst fragen, was Europas Politiker von ihm ursprünglich erhofften und was der Bevölkerung versprochen wurde. Im Zentrum standen die Erwartungen an die europäische Wirtschaft. Dies wird durch kein Zitat besser belegt als durch die Schlusserklärung der Lissabon-Agenda, formuliert auf einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs im März 2000:1
»Die Union hat sich heute ein neues strategisches Ziel für das kommende Jahrzehnt gesetzt: das Ziel, die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen – einen Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen.«
Die sogenannte Lissabon-Agenda bildete ein breit angelegtes europäisches Programm zur Förderung von Innovation und Wirtschaftswachstum, das als Komplement zu der Einführung des Euro gedacht war und seine Wirkung parallel zu der gemeinsamen Währung entfalten sollte. Man wollte eine neue Aufbruchsstimmung in Europa erzeugen und den Kontinent zu neuer Blüte bringen. Ein Jahr zuvor war der Euro bereits als Verrechnungseinheit für Banken eingeführt worden, und im Jahr 2002 sollte schließlich die physische Einführung folgen. Mit der ehrgeizigen Lissabon-Agenda und dem Euro schienen alle Weichen auf Wachstum und Wohlstand gestellt.
Zum Optimismus trug auch der Konjunkturaufschwung bei, der Europa und die Welt damals erfasst hatte. Jene Länder, die heute die Europäische Union bilden, wuchsen im Jahr 2000 um 3,9%, was wesentlich mehr als der Schnitt der vorangegangenen Dekade war. Die Arbeitslosigkeit ging ebenfalls merklich zurück. Es gab somit allen Grund, an bessere Zeiten zu glauben. Viele waren überzeugt, dass eine gemeinsame Währung auf unserem Kontinent eine Dynamik entfalten würde, wie man sie zuletzt in der Nachkriegszeit gesehen hatte. »Der Euro verhilft dem Alten Kontinent zu einer Frischzellenkur«, prognostizierte beispielsweise McKinsey-Chef Herbert Henzler.2 Bankenökonomen prophezeiten der Eurozone »eine goldene Kindheit«,3 und Vertreter europäischer Institutionen wie Christian Noyer, der Vizepräsident der EZB, priesen den Euro als »wahre Triebfeder für Wachstum«.4 Es gab viele solcher Stellungnahmen. Und auch der Verfasser muss zugeben, dass er, ohne den Enthusiasmus zu teilen, damals die Erwartung hegte, dass der Euro zu einer für Gesamteuropa nützlichen Umlenkung der Investitionen von Nord- nach Südeuropa führen würde.5
Die Realität sah jedoch leider anders aus. Der Wirtschaftsaufschwung entpuppte sich als Internet-Blase, die schon im Jahr 2001 platzen sollte. Zwar kam es zu den Kapitalströmen, doch Europa avancierte in dem Jahrzehnt, auf das sich die Lissabon-Agenda bezog, nicht etwa zur dynamischsten Region, sondern zum Schlusslicht der Welt. Abbildung 1.1 verdeutlicht dies. Von 2000 bis 2010 wuchs die Weltwirtschaft insgesamt um 47%, doch die EU lag mit einem Wert von nur 17% ganz am unteren Ende der Großregionen der Welt, knapp hinter den USA. Und sie war auch nur in Schlagdistanz zu den USA, weil die rasch wachsenden osteuropäischen Länder, die noch viel aufzuholen hatten, in der Statistik mitgezählt wurden. Für sich genommen wuchs Osteuropa, inklusive der ehemals kommunistischen Länder Mitteleuropas, um bemerkenswerte 45%; die heutigen Mitgliedsländer der Eurozone standen dagegen mit rund 12% weit abgeschlagen auf der Wachstumsskala. China war in der Vergleichsstatistik Spitzenreiter mit 171% Wachstum, und selbst Subsahara-Afrika und Lateinamerika wuchsen um 78% und 39%. Der wettbewerbsfähigste und dynamischste Wirtschaftsraum der Welt erwies sich als Luftschloss. Selten lagen Wunsch und Wirklichkeit so weit auseinander, wie es in Europa unter dem Euro der Fall war.
Und es sollte noch schlimmer kommen. Im Sommer 2007 schwappte die Finanzkrise, die bereits in den Jahren 2006/2007 in den USA begonnen hatte, mit voller Wucht nach Europa herüber. Bereits ein Jahr später befanden sich sämtliche Länder der Eurozone in einer Rezession, wie sie die Welt nach dem Krieg noch nicht gesehen hatte. In der Wissenschaft spricht man deshalb von der »Großen Rezession«, in Anlehnung an den englischen Begriff »Great Recession« für die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er-Jahre.6 Die südeuropäischen Länder der Eurozone haben sich davon bis zum heutigen Tage nicht erholt, weil ihre strukturellen Probleme, über die die nachfolgenden Kapitel informieren werden, nun offen zutage traten.
Abbildung 1.1 Wachsttum ausgewählter Länder und Regionen (2000–2014)
* Wachstum 2000–2010. ** inklusive der ehemals kommunistischen Gebiete Mitteleuropas.
Quelle : Internationaler Währungsfonds, World Economic Outlook, April 2015.
Die Volkswirtschaften Griechenlands, Ir- lands, Portugals, Spaniens, Italiens und Zyperns (zusammengefasst als GIPSIZ-Länder) wurden in solch enormem Maße in Mitleidenschaft gezogen, dass riesige internationale Rettungspakete von der Europäischen Zentralbank (EZB), dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der Europäischen Union (EU) und den anderen Ländern der Eurozone geschnürt wurden.7 Die beschlossenen Rettungsmaßnahmen boten Hilfe, aber keine Lösung der zugrunde liegenden strukturellen oder wettbewerblichen Probleme. Die makroökonomischen Schlüsselindikatoren zeugen zwar gegenwärtig, im Sommer 2015, von einer Entspannung der Krise, doch von ihrer Überwindung kann noch keine Rede sein. So waren, wie Abbildung 1.2 verdeutlicht, im April 2015 noch 26% der Griechen arbeitslos. In Spanien erreichte die Arbeitslosenzahl in den Monaten Februar bis April 2013 mit 26% ihren historischen Höchststand und ging danach auf 23% im Mai 2015 zurück, wobei eine genauere Analyse zeigt, dass dieser Rückgang vor allem auch damit zu tun hat, dass viele Arbeitslose ausgewandert sind. Die Arbeitslosenzahlen in Italien (12%), Portugal (13%) und Zypern (16%) sind, auch wenn sie deutlich niedriger ausfallen, ebenfalls alarmierend, wobei im größten südeuropäischen Land, Italien, nicht einmal eine Trendumkehr zu beobachten ist. Nur Irland hat sich aus Gründen, die in Kapitel 4 erläutert werden, aus der Rezession befreien können. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Stabilisierung, die man bei den kleineren südeuropäischen Ländern sieht, mehr ist als ein Strohfeuer, das durch eine Belebung der Binnennachfrage aufgrund des niedrigen Ölpreises, der Niedrigzinspolitik der EZB und der Lockerung der staatlichen Schuldenbremsen zustande kam. Die aktuelle Griechenland-Krise, die bei der Abfassung dieser Zeilen an Wucht zunahm, aber in den Statistiken noch nicht aufscheint, lässt Skepsis geboten sein.
Abbildung 1.2 Arbeitslosenquoten in den GIPSIZ-Ländern, saisonbereinigt
Quelle: Eurostat, Datenbank, Bevölkerung und soziale Bedingungen, Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit.
Die Zahlen über die Jugendarbeitslosigkeit sind noch beunruhigender. Die Arbeitslosigkeit ist bei Jugendlichen besonders hoch, weil ältere Arbeitnehmer häufiger in geschützten Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind. Abbildung 1.3 zeigt, dass die Jugendarbeitslosigkeit im Frühjahr 2015 für unter 25-Jährige in Spanien knapp unter 50% (Mai) und in Griechenland mit 53% (April) deutlich darüber lag. Die Jugendarbeitslosigkeit in Italien und Portugal ist mit Quoten von 42% und 33% zwar weniger dramatisch, aber dennoch alarmierend hoch; sie beträgt das Fünf- bis Sechsfache des deutschen Wertes (7%). Alarmierend ist wiederum, dass gerade in Italien bis zum Frühsommer 2015 keine Verbesserung, sondern nur eine Seitwärtsbewegung zu erkennen war.
Abbildung 1.3 Jugendarbeitslosigkeit (< 25 Jahre) in den GIPSIZ-Ländern, saisonbereinigt
Quelle: Eurostat, Datenbank, Bevölkerung und soziale Bedingungen, Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit.
Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass die Jugendarbeitslosigkeit allein schon deshalb so hoch ist, weil viele Jugendliche noch in der Ausbildung stecken. Das ist aber nicht der Fall. Die Schüler und Studenten sind im Regelfall weder bei den Arbeitslosen noch bei den jugendlichen Erwerbspersonen, auf die sich die Quote bezieht, mitgerechnet. Die Jugendarbeitslosigkeitsquote erfasst nur jene Jugendlichen unter 25 Jahren, die als beschäftigungssuchend registriert sind. Es ist ähnlich wie bei der Gesamtarbeitslosenquote, wo ja auch nur Erwerbspersonen erfasst sind, also Menschen, die Arbeit suchen oder Arbeit haben, und nicht etwa alle arbeitsfähigen Personen.
Die wirtschaftliche Situation in Südeuropa offenbart gefährliche Verwerfungen. Ungewiss ist, wie lange die Bevölkerung das noch mitmacht und wie stark die politische Radikalisierung voranschreitet. Es wäre schrecklich, wenn eine fortschreitende Krise das europäische Einigungsprojekt immer mehr in Misskredit bringen würde.
Insgesamt gesehen ist die Situation in Südeuropa nach wie vor höchst unbefriedigend, wenn nicht gar gefährlich. Am schlimmsten getroffen hat es die griechische Wirtschaft, die sich seit dem Ausbruch der Krise im freien Fall befindet. In den Jahren 2011, 2012 und 2013 schrumpfte die griechische Ökonomie um 8,9%, 6,6% und 3,9%. Im Jahr 2014 gab es mit einem Plus von 0,8% einen Hoffnungsschimmer, aber auch der ist inzwischen wieder verschwunden, denn seit dem vierten Quartal 2014 steckt Griechenland schon wieder in einer neuen Rezession. Nimmt man den Gesamtverlauf in den Blick, kommt man nicht umhin, für Griechenland eine schwere wirtschaftliche Depression zu diagnostizieren.
Auch wenn Griechenland einen Extremfall darstellt, so geht es doch auch vielen anderen Ländern der Eurozone heute außerordentlich schlecht, viel schlechter als Deutschland, das sich im Moment erstaunlich gut behaupten kann. Im Jahr 2011 wuchs das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone ohne Deutschland, die Niederlande und Österreich nur um kümmerliche 0,7%, schrumpfte dann um 1,3% im Jahr 2012 und um 0,7% im Jahr 2013, bevor es 2014 zu einem mageren Wachstum von 0,6% zurückfand. Selbst Frankreich wurde von der Krise erschüttert und leidet bis zum heutigen Tage unter einer hohen Arbeitslosigkeit. Mit 10% war die Quote im Mai 2015 gut doppelt so hoch wie die von Deutschland (5%; vgl. auch Kapitel 3, Abbildung 3.8). Die Jugendarbeitslosigkeit war mit 24% sogar mehr als dreimal so hoch wie in Deutschland.
Südeuropas zunehmende wirtschaftliche Probleme gingen mit einer wachsenden Kapitalflucht der Investoren einher. Allein zwischen Juni 2011 und August 2012 strömten 684 Milliarden Euro privaten Kapitals aus Italien und Spanien heraus (vgl. Kapitel 7). Der unkontrollierte Kapitalabfluss konnte schließlich im September 2012 eine Zeit lang gestoppt werden, als die EZB ihr OMT-Programm (Outright Monetary Transactions) verkündete und das Bundesverfassungsgericht den Weg für die deutsche Beteiligung an dem permanenten Rettungsschirm ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus) frei machte (vgl. Kapitel 8). Die Märkte interpretierten diese Programme als Garantie für den Kauf von Staatspapieren aus Krisenländern der Eurozone und beruhigten sich rasch. Die Realwirtschaft stabilisierte sich dennoch nicht nachhaltig, wie die geschilderte Arbeitslosenstatistik und die Wachstumszahlen unmissverständlich belegen. Es war deshalb nur eine Frage der Zeit, bis das Europäische Währungssystem in Form der Zypern-Krise (erstes Quartal 2013) und der dritten Griechenland-Krise (erstes Halbjahr 2015) seine nächsten Erschütterungen erlebte. Die Gefahr weiterer Krisen dieser Art ist noch lange nicht gebannt.
Die Politik Europas erschöpft sich derzeit im Management kollapsartiger Zustände. Die Politiker navigieren von einer Krise zur nächsten, und sie fahren auf Sicht und ohne Kompass. Sobald eine Krise irgendwo auflodert, werden über Nacht neue teure Rettungsmaßnahmen zur Eindämmung beschlossen, obschon sich wenige Monate oder Jahre später dasselbe Spiel mit erneuten Rettungspaketen und zum Teil anderen Adressaten wiederholt. Ein Ende der Krisenrettungsschleife ist nicht absehbar. So wurden in den letzten Jahren Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Zypern von zwischenstaatlichen Rettungsprogrammen an die Rettungsleine genommen und erhielten, genauso wie Italien, massive Unterstützung von der EZB (vgl. Kapitel 8 für einen Überblick). Keines der aufgeführten Länder braucht sich derzeit zu Marktbedingungen zu verschulden. Stattdessen werden die aufgenommenen Staatsschulden von den Ländern der Eurozone garantiert, wenn nicht gar übernommen. Dies verhindert, dass strukturelle Reformprozesse in Gang kommen. Die Krise Europas ist allgegenwärtig und weit von einer Lösung entfernt. Mit den Träumen der Lissabon-Agenda hat die Realität nicht das Geringste zu tun. Irgendetwas muss also in Europa schiefgelaufen sein.
Der Euro und der Frieden
Mit dem Euro verfolgte man allerdings nicht nur ökonomische Ziele.8 Seine Einführung war eine politische Entscheidung. So erklärten Helmut Kohl und François Mitterrand im Jahr 1990, es sei ihr Anliegen, »die Beziehungen zwischen den Nachbarstaaten in eine originär politische Union zu transformieren«.9 In diesem Lichte sind auch die Worte des ehemaligen französischen Finanzministers und Ministerpräsidenten Pierre Bérégovoy zu verstehen, der im Mai 1992 in der französischen Nationalversammlung nach der Unterzeichnung des Maastrichter Vertrags Folgendes sagte:10
»Ja, ich glaube an Europa, weil ich mir den Frieden leidenschaftlich wünsche. Frieden auf diesem Kontinent.«
Helmut Kohl begründete die Einführung des Euro gegenüber dem Bundestag am 23. April 1998 mit den folgenden Worten:11
»Der Euro stärkt die Europäische Union als Garanten für Frieden und Freiheit. … Von der heutigen Entscheidung – ich meine das nicht pathetisch – hängt es wesentlich ab, ob künftige Generationen in Deutschland und in Europa in Frieden und Freiheit, in sozialer Stabilität und auch in Wohlstand leben können.«
Später fügte er hinzu, dass »der Friedensgedanke das Bewegungsgesetz der europäischen Integration« sei und der Euro den entscheidenden »Baustein für die politische Einigung« bilde.12 Dass der Euro ein Friedensprojekt sei, haben auch andere Politiker Europas betont, so z. B. Jean-Claude Juncker.13 Es ist bemerkenswert, dass Bundeskanzlerin Merkel mit ganz ähnlichen Worten die gegenwärtigen Rettungspakete für Griechenland verteidigt.14
Aber auch in dieser Hinsicht hat der Euro die Erwartungen nicht erfüllt, denn die wirtschaftliche Not der Krisenländer und die Angst der Kapitalmärkte zerren an den Nerven aller und beginnen, die Eintracht im Euroraum zu stören. Mit jedem Gipfel werden die Gräben zwischen den Ländern tiefer, die Debatten heftiger. Einige fühlen sich durch die Krise an die Wand gedrückt, insbesondere die großen Länder Spanien und Italien, die anfangs noch gehofft hatten, von einer strukturellen Krise verschont zu bleiben. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Monti glaubte, dass die Spannungen »bereits die Züge einer psychologischen Auflösung Europas tragen«, und befürchtet, dass der »Euro zu einem Faktor des europäischen Auseinanderdriftens« werden könnte.15 Nicht zu vergessen, wie bereits in der Einführung erwähnt, Jean-Claude Juncker, der die Stimmung im Jahr 2013 mit der Selbstzufriedenheit des Jahres 1913 vergleicht, als nur wenige Menschen ernsthaft glaubten, dass noch einmal ein Krieg in Europa ausbrechen könnte.
Die hohen Arbeitslosenzahlen bilden den Nährboden für sozialen Unfrieden. In den vergangenen fünf Jahren brachten europaweite Proteste gegen Haushaltskürzungen und Arbeitslosigkeit viele Menschen in den Krisenländern auf die Straße. Einige der Szenen, die man erleben musste, sind in Abbildung 1.4 dargestellt. Unter der Parole »¡Democracia real ya!« (Echte Demokratie jetzt!) begannen im Mai 2011 in rund 50 spanischen Städten größere Demonstrationen. Allein in Barcelona brachten 80.000 Menschen ihren Zorn zum Ausdruck. Viele der Proteste waren gegen Zwangsräumungen gerichtet, da unzählige Spanier ihre Hauskredite infolge der Immobilienkrise nicht bedienen konnten; einige Hausbesitzer begingen sogar Selbstmord. Im September 2012 gingen rund eine Million Menschen in Portugal
unter der Parole »Zum Teufel mit der Troika« auf die Straße. Die Troika ist ein Kontrollgremium, das aus Vertretern der EZB, des IWF und der EU-Kommission zusammengesetzt ist und deren Aufgabe es ist, die Haushalts-politik jener Mitgliedsländer der Eurogruppe zu überwachen, die fiskalische Hilfskredite in Anspruch nehmen. Auch in Griechenland stehen Demonstrationen auf der Tagesordnung; sie haben sogar schon Todesopfer gefordert.16 Im Jahr 2011 organisierten die Gewerkschaften vier landesweite Streiks gegen die Sparpolitik. Oftmals stand während der Demonstrationen der öffentliche Personennahverkehr still, Ämter blieben geschlossen und Krankenhäuser reduzierten ihre Leistungen auf Hilfe in akuten Notfällen. In Italien demonstrierten im Oktober 2012 100.000 Menschen gegen die Reformen der Regierung Monti, unterstützt von Teilen der Presse, die eine zunehmend aggressive Position gegenüber Sparprogrammen einnahm;17 ein Generalstreik fand jedoch noch nicht statt. Am 14. November 2012 erreichten diese Spannungen schließlich ihren ersten Höhepunkt mit dem »Tag der Aktion und Solidarität« gegen Sparpolitik in insgesamt 23 Ländern.18
Die beschriebenen sozialen Spannungen haben die politische Landschaft in Europa tief greifend verändert. So verzeichneten rechtsextreme und euroskeptische Parteien bei der Wahl des Europäischen Parlaments im Mai 2014
Abbildung 1.4 Protest gegen Sparpolitik
Quelle: »Protesting against Austerity«, © REUTERS/Hugo Correia (oben links), © REUTERS/Yannis Behrakis (oben rechts), © REUTERS/Yannis Behrakis (unten links), © REUTERS/Yannis Behrakis (unten rechts). Genehmigter Nachdruck.
massive Stimmenzuwächse. Bei der britischen Parlamentswahl erzielten die Konservativen unter David Cameron mit einem europakritischen Kurs und der Ankündigung eines Referendums über die weitere EU-Mitgliedschaft einen erdrutschartigen Sieg. Aus der Parlamentswahl in Griechenland im Januar 2015 ging eine Links-Rechts-Regierung unter der Leitung von Alexis Tsipras von der Partei Syriza hervor; interessanterweise hatte er sich mit der rechtsextremen Partei Anexartiti Ellines (kurz: ANEL) zusammengetan, die ähnlich radikale Forderungen nach Abschaffung der Austeritätspolitik stellte wie Syriza. In Frankreich konnte beim zweiten Wahlgang der Departementswahlen im März 2015 der rechtsradikale Front National unter Marine Le Pen, die den Euro explizit abschaffen möchte, einen Stimmenanteil von 22% erzielen. Im Herbst oder Winter 2015 stehen Parlamentswahlen in Spanien an, bei denen Pablo Iglesias mit seiner Partei Podemos den Syriza-Erfolg mit einer eurokritischen Wahlkampagne wiederholen möchte.
In Portugal, Griechenland und Deutschland haben sich die obersten Gerichtshöfe derweil als wichtige Akteure in der politischen Arena herausgestellt. Das portugiesische Verfassungsgericht lehnte im Jahr 2013 die Kürzung von Urlaubsgeldern für Bedienstete des öffentlichen Sektors und Pensionäre ab, genauso wie Kürzungen bei der Arbeitslosen- und Krankenversicherungsunterstützung. Die portugiesische Regierung sah sich daraufhin gezwungen, alternative Haushaltskürzungen vorzunehmen.19 Der oberste Gerichtshof Griechenlands hat die 2012 vorgenommenen Rentenkürzungen, die auf Verlangen der Troika auferlegt wurden, als rechtswidrig beurteilt und die Rücknahme des Rentengesetzes erwirkt.20 Das deutsche Bundesverfassungsgericht zwang der Bundesregierung zum Vertrag zur Schaffung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ein Addendum auf, welches die gesamtschuldnerische Haftung der partizipierenden Länder zu einer proportionalen Haftung abschwächte (vgl. Kapitel 8).21 Weitere anhängige Verfahren könnten die zukünftige Beteiligung der Bundesbank an bestimmten europäischen »Rettungsmaßnahmen« beschränken oder im Extremfall dazu führen, dass Deutschland den Maastrichter Vertrag nachverhandeln muss.