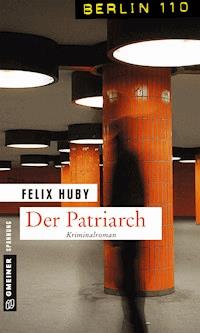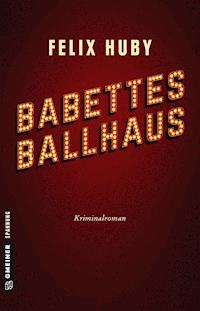7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Peter Heiland ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Peter Heiland, Anfang 30, Single, Schwabe und Kommissar in Berlin, kann auch in seinem Urlaub nicht richtig abschalten. Er wird Zeuge, wie Usedomer Fischer in ihrem Schleppnetz eine nackte Frauenleiche an Land ziehen- und steht vor seinem nächsten Fall. Zunächst sieht es nach einem Mord in der Drogenszene aus. Doch schon bald ist klar: Es steckt weit mehr dahinter. Die Spur führt zurück nach Berlin in die Welt der Nanotechnologie. Als Peter Heiland einem Geheimnis auf die Spur kommt, das die Welt verändern könnte, gerät auch sein Leben in Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Ähnliche
Felix Huby
Der Falschspieler
Krimi
FISCHER E-Books
Inhalt
1
Warum war er bloß nicht auf die Schwäbische Alb oder an den Bodensee gefahren, wie er es eigentlich den ganzen Winter über und auch noch im Frühjahr vorgehabt hatte. Das war sein erster Urlaub seit seinem Dienstantritt vor neun Monaten in der Hauptstadt. Kollegen hatten ihm vorgeschwärmt, Usedom sei die Badewanne Berlins, sonnensicher, und man atme dort eine Luft wie Champagner. Und jetzt? Über Insel und Meer lagen schwere graue Wolken, die ineinander verschwammen. Man konnte kaum erkennen, wo das Meer aufhörte und wo der Himmel anfing. Die Luft freilich war gut, wenn auch für die Jahreszeit viel zu kalt.
Peter Heiland lag schon seit vier Uhr morgens wach. Das Nebelhorn eines Schiffes, das zwei Kilometer vor dem Hafen Swinemünde auf Reede lag, tutete laut über die Ostsee herüber, gleichförmig dreimal, setzte dann aus, und wenn man meinte, endlich höre es auf, kamen wieder die gleichen drei Töne über das Wasser und bohrten sich in die Schläfen.
Peter Heiland stand schließlich entnervt auf und zog seinen Jogginganzug und die sündteuren Turnschuhe an, von denen es hieß, sie glichen jeden Stoß über ein raffiniertes System von Luftkammern und Gummipuffern aus. Von der Anlage in Heringsdorf, wo er eine kleine Wohnung gemietet hatte, waren es nur vierzig Meter bis zur Strandpromenade. Der Weg dorthin führte durch einen schön angelegten parkähnlichen Garten mit wunderbar gepflegten Rosenbeeten, die in der Sonne herrlich leuchten mussten, wenn die Sonne denn einmal scheinen sollte. Über einen schmalen Holzsteg ging es dann vollends hinab zum Strand.
Im dichten Grau sah er eine diffuse Lichtquelle etwa zweihundert Meter entfernt draußen auf dem Meer, oder war das ein Flugobjekt am Himmel? Peter Heiland kniff die Augen zusammen. Jetzt erkannte er: Das Licht kam von einem Boot.
Ungefähr fünfhundert Meter vor ihm tuckerte ein Traktor mit ungewöhnlich hohen Rädern von der Dünenkrone hinab zu der Stelle, auf die auch das Schiff zuhielt. Peter Heiland fiel in leichten Trab. Er wusste, dass die wenigen Fischer, die es in den drei Kaiserbädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin noch gab, um diese Zeit ihren Fang an Land brachten. Er hatte auch schon einmal beobachtet, wie die Ahlbecker die Kähne mit ihren schweren Bulldozern aus dem Wasser zogen: Der Traktor wurde etwa zehn Meter in die Fluten gefahren. Dann wendete ihn sein Fahrer in einem großen Bogen bis die Vorderräder wieder zum Land hin zeigten. Ein Stahlseil wurde am Bug des Bootes und an einem Anhängerhaken der Zugmaschine befestigt. Rechts und links gestützt von zwei Fischern in ihren bis unter die Achseln reichenden Gummihosen, wurde das Boot an Land gezogen. Gut zwanzig Meter weiter oben blieb es im Sand stehen. Was die Männer gefangen hatten, passte meist in drei, vier flache Kunststoffkörbe. Das Meer in Küstennähe gab nicht mehr viel her.
Normalerweise riefen sich die Fischer und ihre Helfer an Land in ihrem Usedomer Platt Satzfetzen zu, die Heiland nicht verstand.
Dennoch hörte er es gerne. Es klang derb und fröhlich zugleich. Aber heute sagte nur einer einen Satz. Alle gingen daraufhin zum Boot, starrten hinein und schienen wie gelähmt zu sein. Kein Wort wurde gesprochen, bis der Älteste von ihnen sagte: »Mein Gott, das arme Ding!«
Peter ging näher zu dem Boot, aber einer der Fischer fuhr zu ihm herum und machte eine abwehrende Bewegung. »Bleiben Sie weg!«
»Was ist denn passiert?«, wollte Peter Heiland wissen.
Ein anderer sagte: »Wir müssen die Polizei rufen.«
Peter hätte gerne gesagt: ›Ich bin von der Polizei‹, in dieser Situation hätte das freilich unglaubwürdig geklungen. Aber zurückweisen ließ er sich jetzt auch nicht mehr. Er schlug einen Bogen um den Fischer und erreichte das Boot am Heck. In einem graugrünen Netz zwischen Tang und toten Fischen lag die nackte Leiche einer Frau. Ein Glück, dass um diese Zeit und bei diesen Temperaturen kaum jemand am Strand war.
Peter trank in einer weißen Imbissbaracke nahe der Landungsbrücke einen Kaffee. Er saß dicht an einem Fenster und konnte von hier aus beobachten, wie zuerst die Polizei, dann ein Notarztwagen und schließlich die Fahrzeuge der Spurensicherung eintrafen. Das Treiben kam ihm fremd und unwirklich vor, obwohl er alles, was dort unten am Strand geschah, kannte und gut einordnen konnte. Schließlich erschien eine größere Limousine. Ein kleiner dicker Mann stieg aus, stülpte sich einen Leinenhut, der aussah wie ein Südwester, auf den Kopf und stapfte mit breit ausgestellten Füßen durch den tiefen Sand zu dem Fischerboot, das inzwischen mit weiß-roten Bändern vor den Neugierigen gesichert worden war. Peter sah auf seine Uhr. Es war kurz nach acht.
Um neun Uhr war Heiland wieder in der Ferienwohnung. Er duschte heiß und setzte sich in einen Sessel, der neben der Terrassentür stand. Durch die Sträucher und Bäume an der Uferpromenade schimmerten die Schaumkronen der Ostseewellen. Peter beschloss, noch am selben Tag abzureisen.
Zum Mittagessen ging er noch einmal in das Bistro auf der Heringsdorfer Landungsbrücke. Das rundum verglaste Gebäude saß wie ein Tempel auf der äußersten Spitze des hölzernen Stegs, der gut vierhundertfünfzig Meter ins Wasser hinaus reichte und bei der Anlegestelle für die Fahrgastschiffe endete. Peter Heiland hatte sich an einen Tisch mit Blick auf die offene See gesetzt und eine Fischsuppe bestellt. Das sollte sein Abschiedsessen sein. Er schrieb noch eine Ansichtskarte an seinen Opa Henry in Riedlingen. Als er danach den Kopf hob, entdeckte er am Nachbartisch den kleinen dicken Mann, den er am frühen Morgen bei den Fischern beobachtet hatte. Der Mann aß mit gutem Appetit einen Brathering mit Kartoffelsalat und trank ein großes Bier dazu. Als er das Glas wieder einmal zum Mund hob, begegneten sich ihre Blicke. Der kleine dicke Mann setzte das Glas wieder ab, ohne getrunken zu haben, und sagte: »Was interessiert Sie eigentlich so an mir?«
»Wir sind Kollegen«, sagte Peter Heiland.
»Und woher wissen Sie das?«
»Ich habe Sie heute Morgen gesehen. Dort drüben.« Er nickte zu der Stelle hin, wo die Fischerboote lagen. Die kleinen Schiffe waren plötzlich gut zu sehen, weil in diesem Moment die Sonne durch die Wolken brach.
»Sind Sie aus Schwaben?«, fragte der kleine dicke Mann. »Es hört sich so an.«
»Es hört sich nicht nur so an, es ist auch so.«
»Kripo Stuttgart?«
»Ja, früher mal.«
»Und jetzt?«
»LKA Berlin.«
Der kleine Mann nahm seinen Teller, sein Besteck und sein Glas und balancierte alles geschickt zu Peters Tisch herüber. Er setzte sich Heiland gegenüber. »Dann müssten Sie den Ernst Bienzle kennen.«
Peter Heiland nickte. »Der war mein Chef.« Er musterte den Kollegen. Er mochte ungefähr in Bienzles Alter sein.
»Wir haben früher mal zusammengearbeitet. Marstaller, mein Name. Leitender Hauptkommissar Ulrich Marstaller, Kripo Anklam.«
»Peter Heiland.«
Sie reichten sich die Hände über den Tisch.
»Weiß man, wer die tote Frau in dem Boot war?«
»Haben Sie sie gesehen?«
Peter nickte und schob die leere Terrine von sich.
»Wir haben keine Ahnung«, sagte Marstaller. »Aber sie hatte ein Gewicht an den Füßen. Die Füße waren gefesselt. Ein Unfall kommt also kaum infrage.«
»Irgendwelche Hinweise auf ihre Identität?«
»Mein Gott! Sie haben sie doch gesehen!«
Marstaller erzählte dann noch bereitwillig, man werde die Tote in der Gerichtsmedizin so weit herrichten, dass man ein Foto von ihr machen könne, auf dem sie halbwegs zu erkennen sei. Sie verabschiedeten sich und Peter Heiland kehrte in seine Ferienwohnung zurück.
Er nahm den Rucksack von dem Haken gleich neben der Tür und stopfte wahllos seine Schmutzwäsche hinein. Oben drauf packte er die noch saubere Wäsche, zwei Paar Socken und zwei Hemden, die ebenfalls noch nicht benutzt worden waren. Er warf den Rucksack unter der Garderobe auf den Boden und trat noch mal auf den Balkon hinaus. Eigentlich hatte er noch für fünf weitere Tage gebucht, und der Vermieter, ein wortkarger Pommer, würde ihm bestimmt nichts von der Miete nachlassen, wenn er früher abfuhr. Vom Meer her kam eine leichte Brise. Über den Kiefern der Uferpromenade wölbte sich ein makelloser blauer Himmel.
Peter Heiland beschloss, noch einmal zum Meer hinunterzugehen. Bis 20 Uhr 15 fuhr alle zwei Stunden die Bäderbahn bis Züssow, und dort hatte er Anschluss an einen Regionalexpress nach Berlin. Es war also noch Zeit. Wenn er den letzten Zug nehmen würde, wäre er um 0 Uhr 33 in Berlin.
Am Ende des Stegs setzte er sich in den Sand, zog seine langen Beine an und legte sein Kinn auf seine spitzen Knie. Ende September. Die Schulferien waren vorbei. Der Strand wurde vor allem von Familien mit Kindern im Vorschulalter bevölkert. Die meisten von ihnen schufteten mit großem Ernst an ihren Sandbauwerken. Peter Heiland sah begeistert zu, wie sie ganz in ihrer Arbeit aufgingen, Burgen zu bauen, Kanäle zu ziehen oder ihre auf dem Rücken liegenden Väter bis an den Hals zuzuschaufeln. Ein Stück weiter hatte eine Gruppe Jugendlicher ein Beach-Volleyball-Feld abgesteckt und ein Netz gespannt. Sie trieben den Ball bis zur totalen körperlichen Erschöpfung übers Netz. Ein Eisverkäufer schob seinen zweirädrigen Wagen durch den tiefen Sand. Er kam nur mit Mühe vorwärts. Ein Stück weiter ließen ein Vater und sein vielleicht fünfjähriger Sohn einen Drachen steigen, und auch als sich ihr Flugobjekt zum zehnten oder elften Mal schon nach wenigen Sekunden wieder in den Strand bohrte, ließen sie sich nicht entmutigen. Weit draußen zog eine hohe weiße Fähre vor dem Horizont entlang nach Westen.
Peter Heiland ließ sich zurückfallen, streckte die langen dünnen Beine weit von sich und schloss die Augen. Die Sonne wärmte sein Gesicht, und bald schon befand er sich in einem seltsamen Zustand zwischen Wachsein und Schlaf. Er spürte, wie ihn ein angenehmes Gefühl der Melancholie erfasste. Die Strandgeräusche gingen ineinander über und vermischten sich zu einem Sound, in dem man einzelne Geräusche nicht mehr unterscheiden konnte, wenn man sich nicht darauf konzentrierte. In solchen Momenten schien es Peter Heiland, als ob sein Leben sinnlos wäre. Ob es ihn gab oder nicht, wo war da der Unterschied? Er glaubte nicht, dass die Welt ihn brauchte. Na ja, sein Opa Henry vielleicht. Der alte Mann hing an seinem Enkel, das wusste Heiland wohl. Und er wusste auch, dass ihm Henry seinen Umzug nach Berlin übel nahm.
Plötzlich spürte Peter Heiland, wie ein Schatten auf sein Gesicht fiel. Er blinzelte und öffnete langsam die Augen.
»Ihnen geht’s gut«, sagte Marstaller, der breitbeinig über ihm stand.
»Ich bin ja auch im Urlaub!«
»Die Tote hatte Wasser in der Lunge!«
Peter richtete sich auf die Ellbogen auf. »Das bedeutet …«
»Ja, das bedeutet, dass sie bei lebendigem Leib ins Wasser geworfen wurde.«
Peter wollte sich das nicht vorstellen. »Warum erzählen Sie mir das?«, stieß er wütend hervor.
Marstaller ließ sich nicht beirren. »Sieht nach einer Bestrafungsaktion aus.«
»Lassen Sie mich in Ruhe!« Peter schnellte mit einer erstaunlich elastischen Bewegung auf die Füße.
Marstaller sah ihn anerkennend an. »Das habe ich früher auch mal gekonnt.«
Eine Frau in einem knappen gelben Bikini kam vorbei. Zirka dreißig, 172, schlank, gelocktes braunes Haar, sportlicher Gang. Peter registrierte das alles wie für einen Polizeibericht. Auch Marstaller sah ihr nach und sagte dann mehr zu sich selbst: »So jung, so schön und so tot! – Entschuldigung, ich musste grade wieder an das Mordopfer denken. Die Tote war dieser Typ.« Er nickte zu der Frau im gelben Bikini hinüber. »Vielleicht ein bisschen älter.«
Der Eisverkäufer hielt seine Karre ganz in der Nähe an. »Sie auch eins?«, fragte Marstaller.
»Laden Sie mich ein?«
»Ach so, ja, Sie sind ja Schwabe«, sagte der Kommissar aus Anklam vergnügt, ging zu dem Eismann und kam mit zwei mit Schokolade umhüllten Eis am Stiel zurück. »Morgen ist ein Bild von der jungen Frau in allen Zeitungen.«
Peter Heiland nickte. Das war Routine.
»Sehe ich Sie morgen noch hier?«, fragte Marstaller, und Peter Heiland antwortete zu seiner eigenen Überraschung mit »Ja«.
Marstaller ließ sich auf den Hintern plumpsen und kreuzte seine kurzen, dicken Beine. Auch Heiland setzte sich wieder in den Sand.
»Die Gerichtsmedizin hat schnell gearbeitet«, sagte der Kommissar aus Anklam. »Das Opfer hat einige Zeit vor seinem Tod eine größere Menge Kokain zu sich genommen. Offenbar eine Frau, die ausschweifend gelebt hat.«
Heiland sagte nichts dazu. Marstaller legte seinen runden Kopf schief und sah seinen jüngeren Kollegen von der Seite an. »War vielleicht ein rauschendes Fest auf irgendeiner Yacht. Da draußen auf hoher See.« Peter Heiland schloss die Augen und ließ seinen langen Oberkörper in den Sand zurücksinken, sagte aber immer noch nichts.
Peter Heiland wollte sich gegen die Bilder wehren, die in ihm aufstiegen. Eine junge Frau wird unter Drogen gesetzt. Ein Mann oder mehrere Männer fallen womöglich über sie her. »Irgendwelche Spuren von Gewalt?«, fragte er.
»Ja! Das kann man sagen. Bevor der oder die Täter ihre Beine gefesselt haben und schwere Gewichte dran hängten, muss sie sich heftig gegen ihre Peiniger gewehrt haben. Sie wurde niedergeschlagen und war vermutlich nicht mehr bei Bewusstsein, als sie über Bord gestoßen wurde.«
»Eine schreckliche Vorstellung«, sagte Peter Heiland.
Marstaller sah ihn an: »Solche Dinge gehören zu unserem Beruf.«
»Ich werd mich trotzdem nie daran gewöhnen!«, antwortete Heiland. Sandkörner knirschten zwischen seinen Zähnen. Er sprang auf und warf das restliche Eis in einen Abfallkorb. Als er zurückkam, sagte er zu Marstaller, der unverändert im Schneidersitz dasaß: »Entschuldigen Sie, aber ein solcher Tod macht mich wahnsinnig wütend.«
Marstaller lächelte. »Ja«, sagte er, »das kann ich gut verstehen. – Kann ich Sie für heute Abend zum Essen einladen?«
»Ja, gerne.«
»In die Tapas-Bar?«
»Ein Spanier auf Usedom?«, fragte Heiland.
»Kathrin und Henry stammen von hier, aber Henry ist ein besonders guter Koch, und wenn hier keine Saison ist, schließt er den Laden und studiert in anderen Ländern, wie man dort die Speisen zubereitet. Andalusien hat es ihm besonders angetan. Eigentlich könnten die spanischen Köche jetzt nach Heringsdorf kommen und sich bei ihm etwas abgucken.«
»Henry heißt er? Ist mir sympathisch. Mein Opa heißt auch so!« Heiland erzählte dem Kollegen, dass er von diesem Großvater aufgezogen worden war, dass der Mann Vater und Mutter in einer Person für ihn gewesen sei, nachdem seine Eltern durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren, und dass Opa Henry noch immer der wichtigste Mensch in seinem Leben sei.
Sie aßen nacheinander Pill Pill, eingelegte Kapernbeeren, Käse aus der La Mancha und tranken einen kräftigen Rotwein dazu. Es stellte sich heraus, dass Marstaller die Wirtsleute schon seit Jahren kannte. Oft fahre er nur schnell von Anklam herüber, um hier zu essen, sagte er.
Man saß an einfachen, groben Holztischen. Der Raum glich einem Gewölbekeller. Die Wände zierten Flaschenregale, in denen die berühmtesten andalusischen Weine aufgereiht waren.
»Nach Polen sind es nur drei Kilometer«, sagte Marstaller plötzlich.
»Ist ja jetzt alles Europa.« Peter Heiland beschäftigte sich intensiv mit einer Langustenschale, die sich ihm offenbar heftig widersetzte. Heiland war nicht besonders geschickt mit seinen Fingern.
»Das glauben aber auch nur Sie!«, erwiderte der Ältere. Peter sah ihn überrascht an. »Was meinen Sie, wie hier die Konkurrenz von drüben gefürchtet wird? Die Leute gehen ja zum Friseur nach Swinemünde rüber, weil ein Haarschnitt dort nur die Hälfte kostet. Billige Arbeitskräfte aus Polen nehmen den Einheimischen die Arbeitsplätze weg. Das ist auch der Grund dafür, dass es keine durchgehende Straße gibt. Dabei wäre es so einfach. Man müsste nur die Grenzbefestigung wegreißen.«
Für Peter war das Problem neu.
»Und noch etwas«, sagte Marstaller. »Der Strand in Polen ist genauso schön wie hier, die Landschaft ist die gleiche. Auch der Tourismus wird dort bald heftiger florieren als hier, und dann nehmen die Polen den braven Vorpommern die Feriengäste weg. Das gibt böses Blut!«
»Aber das alles hat nichts mit Ihrem Fall zu tun, oder?«
Marstaller wiegte den Kopf hin und her. »Wer weiß?«, sagte er. »Man konnte der toten jungen Frau ihre Nationalität ja nicht ansehen.«
Am nächsten Tag war das Bild der Toten in fast allen regionalen Zeitungen. Auch die Berliner Blätter bildeten die verstorbene junge Frau ab. Als Peter Heiland von seinem Morgenlauf in die Ferienwohnung zurückkehrte, las er auf dem Display seines Handys ›1 Anruf in Abwesenheit‹. Er hörte die Nachricht ab. Ron Wischnewskis Stimme tönte aus dem Telefon: »Wenn Sie noch auf Usedom sind, melden Sie sich. Und zwar sofort!«
Peter überlegte einen Moment, ob er den Anruf seines Chefs einfach ignorieren sollte. Schließlich war er im Urlaub. »Wenn Sie noch auf Usedom sind …«? Er konnte ja später immer sagen, er sei zu diesem Zeitpunkt längst woanders gewesen. Während ihm all diese Gedanken durch den Kopf schossen, wählte er bereits Ron Wischnewskis Nummer.
»Da oben auf der Insel ist ’ne Tote gefunden worden. Ermordet«, sagte der Kriminalrat.
»Ich war dabei!«, antwortete Peter Heiland. »Zufällig!«
Peter Heiland nahm sich vor, sofort aufzulegen, wenn Ron Wischnewski jetzt sagen würde: ›Es gibt keine Zufälle.‹ Aber der meinte nur: »Na, umso besser! Wir haben hier eine Frau, die das Opfer glaubt identifizieren zu können.«
»Der bearbeitende Kommissar heißt Marstaller.«
»Weiß ich«, bellte Wischnewski. »Aber jetzt ist es auch unser Fall. Die Frau wohnte in Charlottenburg. Wenn sie’s ist. Die Zeugin ist auf dem Weg nach Anklam, um die Tote zu identifizieren. Wäre gut, wenn Sie dabei sein könnten.«
»Ich bin hier im Urlaub!«
»Sie langweilen sich doch eh«, gab Wischnewski zurück. »Also tun Sie, was ich Ihnen sage. Ich werde keinen Beamten da raufschicken, wenn ich schon einen Mann dort habe. Berlin muss sparen!« Damit legte er auf.
Peter Heiland starrte sein Handy an. Am liebsten hätte er sofort zurückgerufen und zu seinem Chef gesagt: ›Sie können mich mal!‹ Aber auf dem Display war zu sehen, dass just in diesem Moment der Akku seines Mobiltelefons leer war. Das Ladekabel lag ganz unten in dem Rucksack, den Peter Heiland am Abend zuvor gepackt hatte. Er wühlte mit beiden Händen danach, konnte es aber zwischen seiner Schmutzwäsche nicht fühlen. Also kippte er den ganzen Rucksack um und schüttete den Inhalt auf den Teppichboden. Die kleine Wasserflasche, die er mit eingepackt hatte und in der er eine Vitamin-Brausetablette aufgelöst hatte, war wohl nicht vollkommen verschlossen gewesen. Jedenfalls ergoss sich der klebrige Inhalt jetzt über seine Klamotten und den Teppich. Als Peter nach der Flasche griff, rutschte sie ihm aus der Hand, und der Verschluss sprang vollends ab. Wütend pfefferte er die Plastikflasche in eine Ecke. Dort nässten die Reste des Vitamingetränks den Saum eines Vorhangs ein.
Es klingelte an der Tür. Peter wickelte sich ein Küchenhandtuch um seine klebrigen Finger und öffnete. Marstaller stand auf der Schwelle. »Sie arbeiten tatsächlich bei Ron Wischnewski? Das haben Sie mir gar nicht gesagt!«
»Warum sollte ich?«, brummte Peter unwillig.
»Ist was passiert?« Marstaller sah sich um. »Ist ja ’ne schöne Sauerei. – So was muss er gemeint haben.«
»Wer?«
»Na, Ihr Chef in Berlin. Er sagt, Sie seien ein bisschen linkisch und stünden sich manchmal selbst im Weg, aber sonst seien Sie ein ganz guter Mann.«
»Ich bin gerührt.« Peter Heiland versuchte mit dem Handtuch die Flecken aus dem Teppich zu reiben.
»Nicht reiben! Tupfen!«, rief Marstaller. »Geben Sie her. Haben Sie irgendwo ein Stück Seife – Kernseife am besten!«
Während nun Marstaller auf den Knien herumrutschte und den Teppich mit Wasser und Kernseife reinigte, sagte er: »Wischnewski kenne ich seit fünfzehn Jahren. Beruflich ist er top. Privat ist er eine arme Sau!«
»Er redet nie über sein Privatleben«, sagte Peter.
Marstaller ging nicht darauf ein. »Wischnewski sagt, Sie werden mich heute nach Anklam begleiten.«
Peter seufzte. Es nutzte ja nichts, wenn er widersprach. Er würde der Anweisung seines Vorgesetzten folgen. Und wenn er sich darüber beschwerte, hatte er auch nichts davon.
Am Himmel drängten sich tief hängende graue Wolken, hinter denen man die Sonne gelegentlich als schwachen Schemen wahrnehmen konnte. Offenbar war tags zuvor nur ein kurzes Zwischenhoch über Mecklenburg-Vorpommern hinweggezogen. Marstaller fuhr. Heiland saß schweigend neben ihm. Eigentlich hätte er seinen Rucksack gleich mitnehmen und in Anklam den Zug nach Berlin besteigen können. Aber als ihm das einfiel, rollte der Wagen schon auf die Hebebrücke über den Penestrom zu, die Usedom mit dem Festland verband. Die rote Ampel leuchtete auf. Ein Schlagbaum senkte sich. »Natürlich«, sagte Peter.
»Was ist natürlich?«
»Die Brücke geht hoch, wenn ich komme. Das ist immer so. Alle rutschen durch, nur ich …«
»Sie und noch ein paar andere«, sagte Marstaller. Er wuchtete seinen kleinen dicken Körper aus dem Wagen und zündete sich ein Zigarillo an. Zwei Brückenteile hoben sich, sahen vorübergehend aus wie ein Dach überm Wasser und richteten sich dann vollends in die Senkrechte auf. Im Strom dümpelten auf beiden Seiten der Brücke je drei Segelschiffe. Sie glitten nacheinander durch die enge Durchfahrt. Zuerst jene, die der See zustrebten, dann die anderen, die vom Meer her kamen und ins Landesinnere fuhren. Marstaller erklärte, man könne per Boot von hier bis nach Berlin schippern. Die Wasserstraßen seien hervorragend ausgebaut. Peter Heiland schlenderte auf die Brücke. Nur deren Mitte öffnete sich für die Schiffe. Der schlaksige Kommissar beugte sich über das Geländer. Ein schönes Bild war das schon, wie die Boote auf der sanft gekräuselten Wasserfläche sich nach und nach hintereinander einreihten wie Enten, die im Verband schwimmen. Ganz zum Schluss kam das größte Schiff. Eine elegante Segelyacht. Das Tuch war allerdings gerefft. Ein Motor schob das Boot langsam vorwärts. Peter zog seine Digitalkamera aus der Jackentasche und hielt das Bild fest. Die majestätische Yacht glitt nun als letztes Schiff auf den Durchlass zu. Ein Mann in einer gelben Segeljacke winkte herauf. Er war groß und breitschultrig, trug eine Kapitänsmütze und hatte eine Pfeife zwischen die Zähne geklemmt. »Herausgeputzt wie für ein Werbefoto«, sagte Heiland und winkte müde zurück. In diesem Augenblick kam ein kleinerer untersetzter Mann aus dem Niedergang des Schiffes und legte seine Hand auf die Schulter des Pfeifenrauchers. Unwillkürlich drückte Peter Heiland noch einmal auf den Auslöser. Das Schiff hieß Aurora.
Er ging über die Fahrbahn und sah dem eleganten Kahn nach. Am Heck tänzelte hinter dem großen Schiff ein kleines Motorboot, das mit einem Tau festgemacht war, auf dem Wasser wie ein Fohlen, das ein Reiter an den Sattel seines Pferdes gebunden hat.
Es hatte eine knappe Viertelstunde gedauert, bis die Schiffe den Brückendurchlass passiert hatten. Jetzt kamen die Autos wieder in Bewegung. Marstaller hielt neben Heiland und ließ ihn zusteigen, nicht ohne ihn darauf hinzuweisen, es sei streng verboten, die Brücke während der Durchfahrtmanöver zu betreten. Peter zuckte nur mit seinen knochigen Schultern und sagte nichts dazu. Im Zweifel hätte er eben seinen Polizeiausweis gezeigt.
Dorothee Ziemer war zweiunddreißig Jahre alt, fast so groß wie Peter Heiland und für seinen Geschmack viel zu dünn – so dünn etwa wie er selbst. Sie hatte ein ernstes Gesicht, und er vermutete, dass dies nicht allein dem Ereignis zuzurechnen war, dessentwegen sie nach Anklam gekommen war. Marstaller und er hatten die junge Frau am Anklamer Bahnhof abgeholt. Der schmucklose Backsteinbau stand verlassen am Ende einer Sackgasse, und Peter Heiland ertappte sich bei dem Gedanken, dass es etwas besonders Seltsames sein müsste, von hier aus eine Weltreise oder auch nur eine Fahrt nach Garmisch-Partenkirchen anzutreten.
Auf dem Weg zur Leichenhalle sprachen sie nur wenig. Dorothee Ziemer wirkte angespannt, aber nicht nervös. Sie trug einen eng anliegenden schwarzen Hosenanzug, darunter eine hellgraue Seidenbluse und um den Hals ein schmales silbernes Kettchen. Marstaller fragte sie, was sie beruflich mache. »Ich bin Chemikerin und arbeite bei einem Pharmazieunternehmen in Berlin.«
»Und Ihre Freundin?«
»Sie ist nicht meine Freundin. Im Übrigen sage ich nichts, bevor ich nicht weiß, ob sie es wirklich ist.«
Die beiden Männer schauten sich überrascht an. »Ich denke, Sie haben sie auf dem Foto erkannt«, sagte Peter Heiland.
»Eine gewisse Ähnlichkeit …« Dann verbesserte sie sich: »Eine starke Ähnlichkeit.«
Auf der restlichen Fahrt schwiegen alle drei. Als sie ausstiegen, sagte Marstaller zu Frau Ziemer: »Wenn Sie die Tote kennen, werden Sie mit uns reden müssen.«
»Selbstverständlich!«, antwortete sie knapp.
Eine halbe Stunde später verließen sie die Leichenhalle. Dorothee Ziemer war blass geworden und nahm dankbar Heilands Arm, als er ihn ihr anbot. »Sie waren sehr tapfer«, sagte Heiland leise.
»Danke! Man sieht ja so was in Filmen, aber wenn man so etwas erlebt, ist es doch etwas ganz anderes.«
Sie ließen den Wagen stehen und gingen zu Fuß bis zu einem kleinen Lokal dicht beim Oberen Tor. Marstaller bestellte noch unter der Tür drei Korn. Sie setzten sich an einen massiven runden Holztisch in eine ruhige Ecke. Dorothee begann nach einer Weile ganz von selbst zu erzählen. Marstaller unterbrach nur, um eine weitere Bestellung aufzugeben. Peter hatte seinen Stuhl weit vom Tisch abgerückt, die Beine lang gemacht und den Kopf in den Nacken gelegt. Die Augen hielt er halb geschlossen. Dennoch ließ er die junge Frau keine Sekunde aus den Augen.
Erstaunlicherweise gab es hier einen sehr guten Grauburgunder aus Baden.
Dorothee Ziemer sagte: »Sie heißt Heike Schmückle.«
»Klingt schwäbisch«, sagte Peter.
Dorothee nickte. »Heike kommt aus Geislingen …«
»Geislinge an dr Steig?«
»Ja, ich glaube.«
Peter beugte seinen Oberkörper plötzlich weit nach vorne. »Und was hat se g’schafft?« Und als er den befremdeten Ausdruck in Dorothees Augen bemerkte, verbesserte er sich: »Was hat sie gearbeitet – wenn überhaupt?«
»Oh ja, sie war sehr tüchtig und sehr erfolgreich. Eine absolute Koryphäe.«
»In was? Ich mein, worin?«
Zum ersten Mal huschte so etwas wie ein Lächeln über Dorothees Gesicht. »Festkörperphysik. Sie war auf Nanotechnik spezialisiert.«
Die beiden Männer schauten sich an. Alles Mögliche hatten sie erwartet, aber das nicht. »Und Sie sind sicher, dass die Tote diese Frau ist, von der Sie sprechen?«
»Ich habe keinerlei Zweifel.«
»Ein naher Verwandter wird sie auch noch identifizieren müssen«, sagte Marstaller.
»Mir ist egal, ob Sie mir glauben!« Dorothees Mund war sehr schmal geworden.
»Ich glaube Ihnen. Aber das Gesetz schreibt es so vor.«
Peter Heiland nahm wieder das Wort: »Sie war also Wissenschaftlerin. Und was war sie noch?«
Wieder diese Andeutung eines Lächelns. »Ein Luder!«
»Was?«, riefen Marstaller und Heiland wie aus einem Mund.
»Das ist doch heute ein gängiges Wort«, sagte Dorothee Ziemer. »Heike war lebenshungrig, wenn Sie’s altmodischer haben wollen. Oder nennen Sie sie eine ›Femme fatale‹. Ich hatte das Gefühl, sie stand ständig unter Strom. Sie gehörte zu den Menschen, die immer denken, es müsse mehr als alles geben. Deshalb konnten wir auch nicht befreundet sein. Ich brauche meine Ruhe, meine Pausen …«
Peter Heiland nickte. Das verstand er nur zu gut.
»Aber sie … sie hat keine Party ausgelassen. Na ja, sie war attraktiv, hatte Charme und Esprit, lange Beine und eine Figur wie Marilyn Monroe!«
»Klingt überhaupt nicht nach Nanotechnologie«, brummte Marstaller.
»In Ihrer Arbeit war sie absolut diszipliniert. Da konnte ihr keiner etwas nachsagen. Wie sie das alles unter einen Hut gebracht hat, weiß ich nicht. Aber es ist ihr gelungen. Heike muss eine unwahrscheinliche Kraft gehabt haben. Ich habe manchmal zu ihr gesagt, in dir stecken mindestens drei Weiber. Dann hat sie gelacht und geantwortet: ›Sechs, Dorothee – ein halbes Dutzend.‹«
»Irgendeine feste Beziehung?«, fragte Marstaller.
»Nur die zu ihrem Job. Alles andere war Fluktuation.«
»Ob so ein Mensch glücklich sein kann?«, fragte Peter Heiland.
»Wenn sie vielleicht manchmal unglücklich war, ist mir das verborgen geblieben.«
»Wie alt war sie denn?«, fragte Marstaller.
»Sechsunddreißig, ich glaube, im Dezember wäre sie siebenunddreißig geworden. Ja, im Dezember. Sie ist ja Schütze – ein ganz typischer Schütze …«
Die Kommissare fragten ihre Zeugin noch danach, ob sie wisse, mit wem Heike Schmückle am Wochenende verabredet gewesen sei.
»Über so etwas hat sie nicht geredet. Zumindest nicht mit mir.«
Erst jetzt fragte Marstaller: »Und woher kennen Sie Frau Schmückle?«
»Wir wohnen im selben Haus.«
»Wo?«
»Charlottenburg. Pestalozzistraße 34. Schöner Kiez.«
Peter nickte unwillkürlich. Er kannte sich in der Ecke aus. Seine Kollegin Hanna Iglau wohnte nicht weit davon in der Mommsenstraße. Im Stillen war er sehr damit zufrieden, dass er Bescheid wusste. In solchen Augenblicken war es ihm manchmal so, als sei er inzwischen in Berlin doch ein wenig heimisch geworden.
Das hätte er seinem Opa Henry freilich nicht sagen dürfen. Für den war Berlin nach wie vor so weit im Osten, dass er glaubte, gleich hinter den Stadtgrenzen beginne Sibirien. Deshalb hatte er sich bisher auch hartnäckig geweigert, seinen Enkel in der Hauptstadt zu besuchen. Dass Berlin überhaupt wieder zur Hauptstadt geworden war, hielt der alte Heiland für eine der schwersten politischen Sünden. »Onderm Adenauer hätt’s des net gebe!«, pflegte er zu schimpfen. Und als Peter einmal scheinheilig fragte: »Adenauer? Wer war denn des?«, obwohl er es natürlich wusste, war der Alte förmlich ausgeflippt. »Wenn du des net weischt, lass dir dein Schulgeld z’rückzahle! Den han i zwar nie g’wählt! Immerhin bin ich mein Leben lang Gewerkschafter gwesa. Aber wer des war, muss mr trotzdem wisse. Scho weil er die letzte Kriegsgefangene aus Russland heimg’holt hat!«
Schulgeld hatte man schon längst nicht mehr bezahlt, als Peter seinen ersten Schultag hatte. Aber das kümmerte Henry, der eigentlich ja Heinrich hieß, nicht. Jeder verstand schließlich, was mit diesem Spruch gemeint war. Und Peter hatte in Riedlingen genug Lehrer gehabt, die den vergangenen Dingen so verhaftet waren, dass sie nicht nur Adenauers Verdienste ständig im Munde führten, sondern manchmal noch die des Führers, wie sie Adolf Hitler auch zu jener Zeit noch nannten. »Er war schlimm! Ja, natürlich! Er war furchtbar. Aber er hat den Menschen Arbeit gegeben, und er hat die Autobahnen gebaut!« Peter hatte schon als kleiner Junge verstanden, wie verlogen das alles war. Er konnte sich später nicht erklären, warum ihm das sofort klar war. Vielleicht hatte auch sein Opa Henry einen Anteil daran. Womöglich hatte Peter schon damals ganz einfach ein Ohr für falsche Töne. Doch das war dann vermutlich auch ein Verdienst seines Großvaters gewesen.
»Sie wohnen im selben Haus?«, nahm Peter Heiland den Faden wieder auf. »Und weiter?«
»Ich habe ihre Katzen versorgt, wenn sie weg war. Und sie war ja oft weg.«
»Haben Sie sich geduzt?«, fragte Marstaller.
»Ja, aber das hatte nichts zu bedeuten. Ich glaube, Heike hat so ziemlich jeden geduzt. Vielleicht eine schwäbische Eigenart?«
»Um Gottes willa, noi!«, entfuhr es Peter Heiland.
Dorothee Ziemer hatte sich ein wenig entspannt. Jetzt lächelte sie zum ersten Mal wirklich. »Sie sind auch Schwabe, nicht wahr?«
»Das hört man ja«, sagte Marstaller.
Peter Heiland hatte schon vor ein paar Augenblicken beschlossen, am nächsten Tag nach Berlin zurückzukehren, obwohl sich etwas in ihm dagegen sträubte. Es würde ja vielleicht so aussehen, als geschehe das im vorauseilenden Gehorsam gegenüber seinem Chef Ron Wischnewski. »Ich werde morgen mal bei Ihnen vorbeischauen«, sagte er zu Dorothee Ziemer.
»Das wird nicht gehen. Jetzt, da ich schon mal hier bin, will ich noch eine Studienfreundin in Greifswald besuchen.«
»Übernehmen Sie die Ermittlungen?«, fragte Marstaller Peter Heiland.
»Natürlich nicht. Es ist ja Ihr Fall. Aber es interessiert einen halt.«
Marstaller sagte: »Sobald sich der Fall nach Berlin verlagert, gebe ich ihn nur zu gerne ab.«
2
Peter Heiland hatte sein Auto, das er erst seit drei Wochen besaß, seinem Freund Manuel überlassen. Der dunkelhäutige Artist, Schriftsteller, Menschenkenner und Philosoph holte den Kommissar am Ostbahnhof ab. Wie immer trug er eine bunte gestrickte Mütze auf dem Kopf. Um sich die Zeit bis zur – natürlich verspäteten – Ankunft des ICs aus Stralsund über Anklam, Pasewalk, Prenzlau und so weiter zu verkürzen, jonglierte er mit seinen bunten Bällen. Er hatte ihre Zahl erst kürzlich auf fünf erhöht. Die Fehlversuche überwogen die geglückten Nummern noch beträchtlich. Aber das machte ja einen echten Artisten aus: Rückschläge waren nichts anderes als Herausforderungen. Sein Freund Peter Heiland hatte ihm schon öfter gesagt, in der Kriminalistik sei dies nicht anders.
Als Peter aus dem Zug stieg, stand Manuel exakt vor der entsprechenden Waggontür. Er hielt das für absolut normal und hatte deshalb gar nichts anderes erwartet. Er umarmte den langen Heiland, und der fühlte sich wie immer unwohl dabei. Sein Großvater hatte ihn pietistisch erzogen. Und da umarmte man sich nicht, es sei denn heimlich, wenn es niemand sah, und auch dann nur zwischen Mann und Frau. Einmal hatte Peter dem Opa vorgeworfen, das Äußerste an körperlicher Zärtlichkeit zwischen ihnen sei es gewesen, wenn der Alte dem Enkel ein paar Brotkrümel vom Pullover geklaubt habe. Aber er hatte sofort gesehen, wie sehr dies den Großvater schmerzte. Vermutlich hatte er nicht weniger darunter gelitten als er selbst. In diesem Augenblick hatte er dann seinen Opa Henry zum ersten Mal in die Arme genommen. Überrascht sah er, dass dem Alten die Tränen in die Augen stiegen. Im gleichen Augenblick sagte Henry: »Ha komm! Ha komm! Was soll jetzt au des?«
»Ins Büro?«, fragte Manuel.
»Nein, Pestalozzistraße 34. Findest du das?«
»Ey, was is’n das für ’ne Frage. Ich war zwei Jahre lang Taxifahrer.«
»Du warst …?«
»Hab ich dir das nicht erzählt?«
»Du hast mir viel erzählt. Aber wo da noch zwei Jahre Taxifahren dazwischenpassen sollen, ist mir schleierhaft.«
Das Haus befand sich in einem kurzen Stück der Pestalozzistraße zwischen Kaiser-Friedrich- und Wilmersdorfer Straße, die in diesem Bereich Fußgängerzone war. Hinter der Wilmersdorfer setzte sich die Pestalozzi fort und führte bis zur Grolmannstraße. Manuel hielt vor einer kleinen Bäckerei mit Café. »Da muss es sein. Soll ich mitkommen?«
»Ne, lass mal.«
»Und das Auto?«
»Brauchst du es noch?«, fragte Peter Heiland.
»Und du?«
»Von hier komm ich ja prima mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter. Ich frag mich sowieso, warum ich mir überhaupt ein Auto angeschafft habe.«
»Dann kann ich den Wagen also noch behalten?«, fragte Manuel.
»Mhm«, machte Peter, »obwohl das kein ›Wagen‹, sondern a ganz normals kloins Auto ischt!«
»Den Rucksack bring ich zu dir nach Hause«, rief Manuel noch und brauste zufrieden davon.
Auf dem Weg nach Friedrichshain, wo Manuel wohnte, wiederholte er ein ums andere Mal: »… obwohl das kein ›Wagen‹, sondern a ganz normals kloins Auto ischt!« Beinahe hätte er einen Unfall gebaut, weil er das so komisch fand, dass er immer wieder lauthals drüber lachen musste.
Das Treppenhaus des Mietshauses war mit dem Duft frischer Backwaren erfüllt. Von außen hatte man dem Gebäude nicht ansehen können, dass es offenbar ein Jugendstilhaus war. In den Fünfziger- oder Sechzigerjahren musste ein verrückt gewordener Modernisierer allen Schmuck und jegliche Verzierung abgeschlagen und dem Haus einen Nullachtfünfzehn-Look verpasst haben. Jetzt war die Fassade mit schmucklosem, dreckig gelbem Rauputz zugekleistert. Aber innen ließ sich die einstige Schönheit noch erahnen. Decken und Wände waren mit Stuck geschmückt, der freilich unter einer Schmutzschicht kaum zu erkennen war. Der Handlauf der Treppe war kunstfertig gedrechselt. Die Türen zu den Wohnungen waren aus schwerem Holz. Nicht alle hatten so schöne Namensschilder wie jene, hinter der Heike Schmückle gelebt hatte. Peter Heiland sah sofort, dass die Doppeltür aufgebrochen worden war. Er drückte mit der flachen Hand gegen den rechten Flügel, der nach innen aufschwang. Vorsichtig betrat der Kommissar die Wohnung.
Am anderen Ende eines kurzen Korridors konnte man durch die geöffnete Tür direkt in die Küche schauen. Links ging eine hohe Flügeltür zum Wohnzimmer ab. Rechts befanden sich eine Kammer und ein Bad. Alle Türen standen offen.
Peter Heiland hörte ein Geräusch. Er fasste unter die Jacke und schalt sich im gleichen Moment einen Idioten. Natürlich hatte er seine Dienstwaffe nicht dabei – wie denn auch? Schließlich war er im Urlaub!