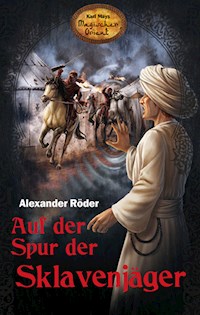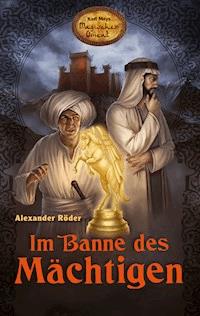Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Karl-May-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Karl Mays Magischer Orient
- Sprache: Deutsch
In der britischen Botschaft in Istanbul ertappt Kara Ben Nemsi die selbstbewusste albanische Freiheitskämpferin Qendressa bei einem Einbruch in das Geheimarchiv. Hierbei entdeckt er Dokumente, die ihn auf die Spur eines alten Feindes führen: den Schut! Zusammen mit seinem treuen Freund Hadschi Halef Omar und Scheik Haschim reist Kara Ben Nemsi in das Land der Skipetaren, um seinem totgeglaubten Erzfeind entgegenzutreten. Auch die mysteriöse Albanerin, die auf der Suche nach dem Grabmal des legendären Skipetarenfürsten Skanderbeg ist, schließt sich den Gefährten an. Auf ihrer Reise durch den südlichen Balkan bekommen sie es nicht nur mit Wiedergängern und Gestaltwandlern zu tun, sondern auch Qendressa scheint nicht das zu sein, was sie vorgibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 2
Alexander Röder
Der Fluch desSkipetaren
KARL-MAY-VERLAGBAMBERG•RADEBEUL
Herausgegeben von Thomas Le Blanc und Bernhard Schmid
In der Reihe „Karl Mays Magischer Orient“ sind bisher erschienen:
Band 1 – Alexander Röder Im Banne des Mächtigen
Band 2 – Alexander Röder Der Fluch des Skipetaren
Band 3 – Alexander Röder Der Sturz des Verschwörers(2017)
Band 4 – Alexander Röder Die Berge der Rache(2017)
Thomas Le Blanc (Hrsg.) Auf phantastischen Pfaden
Eine Anthologie mit den Figuren Karl Mays
Weitere Informationen zur Reihe „Karl Mays Magischer Orient“ finden Sie im Internet auf www.magischer-orient.karl-may.de
© 2016 Karl-May-Verlag, Bamberg
Alle Urheber- und Verlagsrechte vorbehaltenIllustration: Elif SiebenpfeifferUmschlaggestaltung: Petry & Schwamb, Freiburg
Lektorat: Jenny FlorstedtISBN 978-3-7802-1402-7www.karl-may.de
Inhalt
1 Auf fremdem Grund
2 Die Dame in Schwarz
3 Fassaden
4 Eine Dame erklärt sich
5 Akten und Insekten
6 Durch Istanbul
7 Nächtliche Begegnung
8 Trubel am Hafen
9 Schläge und Stürze
10 Eine Straße, zwei Begegnungen
11 In Edreneh
12 Geheime Bücher
13 Schattenspiele
14 Farbenlehre
15 Die Sterne des Scheitan
16 In den Fängen des Schut
17 Tod und Rosen
18 Eine Maskierung
19 Ein Tal in den Bergen
20 Das Monstrum
21 Entführer und Entführte
22 Die Höhle der Verschwörer
23 Rätselhafte Flucht
24 In der Ruine
25 Geheime Wege
26 Silber und Gift
27 Sieben Leben
28 Das öde Haus
29 Im Grab des Skipetaren
30 Der Schatten des Schut
Erstes KapitelAuf fremdem Grund
„O Sihdi“, sagte mein Freund und Gefährte Halef, der an meiner Seite stand. „Ich weiß nicht, wie wir dies überstehen sollen!“ Dabei warf er mir einen furchtsamen Blick zu, was ich nur äußerst selten bei ihm erlebt hatte.
Ich, Kara Ben Nemsi, schaute ihn an und nickte ihm Mut zu. Ich hatte mit Hadschi Halef Omar, dem kleinen Mann mit dem großen Herzen, schon viele Abenteuer und Gefahren überstanden. Und niemals hatte ich an seiner Tapferkeit zweifeln müssen, wenn es wirklich zum Kampf gekommen war. In diesem Augenblick aber, so muss ich gestehen, war auch mir etwas seltsam zumute, und wenn meine treuen Leser dies verwundern mag, die ihren Helden in vielen Reiseerzählungen doch niemals als zögerlichen Zauderer kennengelernt haben, so darf ich ihnen die näheren Umstände schildern.
Halef und ich befanden uns in Istanbul, Stambul genannt, der herrlichen Stadt am Bosporus, deren Jahrtausende währende Geschichte angefüllt ist von den Herrlichkeiten und Schrecknissen, welche die Menschheit an vielen Orten gebiert, aber wohl nirgends so schillernd und atemberaubend wie hier, am Schnittpunkt von Orient und Okzident. Allein die beiden früheren Namen dieser Metropole, Byzanz und Konstantinopel, erwecken in einem jeden mannigfaltige Vorstellungen und Bilder, in denen Pracht und Macht der großen Kulturen des Mittelmeerraums sich teils funkelnd, teils furchterregend darstellen. Wer dächte nicht an die sprichwörtlichen byzantinischen Schwelgereien, an den Aufstieg des östlichen Rom, nachdem das westliche Rom in Dekadenz versunken war? Wer erinnerte sich nicht an den großen christlichen Kaiser Konstantin, dessen Namensstadt später an die osmanischen Türken fiel, welche dadurch die Künste und Werte der alten Griechen ins finstere europäische Mittelalter brachten, in dem nach Italien fliehende Dichter und Denker die Renaissance begründeten?
Und hier erlebte ich mit meinem Gefährten Halef allerlei Abenteuer voller Rettungen und Rache, Entführungen und Ehrenduelle, die ich in früheren Bänden meiner Reiseberichte getreu wiedergegeben habe: Meinen Lesern ist daher der Genueserturm im Stadtteil Galata ein Begriff ebenso wie die Landzunge des Goldenen Horns, sie kennen Eyub und Baharive Keui, sie haben gehört von Pera, Tepe Baschi und Sankt Dimitri – alles Orte und Gegenden innerhalb der Stadtgrenzen Stambuls, die ich durchstreift oder gar durchrannt hatte, um den Guten Gerechtigkeit und den Bösen Bestrafung zu bringen.
Dies alles ist nun zwei Jahre her, und seitdem ist viel geschehen.
Nun aber, in diesem Sommer 1874, war ich wieder in Stambul. Und wieder war ich mit Halef auf Verbrecherjagd. Vor zwei Jahren hatten wir die Schurken Hamd el Amasat und Mübarek gejagt und zur Strecke gebracht, und an beide dachten wir mit Abscheu und angesichts der gerechten Schicksale durchaus mit Genugtuung. Aber was war mit ihrem Herrn Kara Nirwan, dem Schut, jenem größten der Bösewichte des Balkan? Wie ich im vorigen Band meiner neuesten Abenteuer schilderte, hatte ich zu unser aller Erstaunen nicht nur erfahren, dass er noch lebte und keineswegs bei dem Sturz in die Verräterspalte, einer tiefen Schlucht bei Rugowa, gestorben war, sondern dass er zudem durch finstere Pläne mit dem ruchlosen Machtmenschen Ahmar Al-Kadir verbunden war, welcher leider ungestraft hatte fliehen können. Wir hatten außerdem herausgefunden, dass sich Al-Kadir mit dem Schut irgendwo auf dem Balkan treffen wollte, um dort gemeinsam weiter zu versuchen, ihren Machtdurst in schreckliche Taten umzusetzen.
Halef und ich hatten also beschlossen, aus dem Maschrik, dem nordöstlichen Teil Arabiens, der zur Zeit unter türkischosmanischer Herrschaft stand, in die Hauptstadt des Reiches zu reisen, um Istanbul als Ausgangspunkt für unsere Hatz auf Al-Kadir und den Schut zu nehmen. Bevor wir uns aber auf den Weg durch den wilden Balkan machen konnten, hatten wir noch die eingangs erwähnte Situation zu meistern.
Wir standen also da, an einem uns nicht vertrauten Ort, und sahen uns einer nicht geringen Zahl eigentümlich gekleideter Menschen gegenüber, die uns anstarrten. Wir waren gerade durch die Tür getreten, in diesen großen Raum in einem großen Haus in einem gewissen Viertel von Istanbul, welches von nicht wenigen gemieden und von mindestens ebenso vielen geschmäht wird. Und in den Blicken der anderen vermeinten wir eine gewisse Abneigung, wenn nicht gar Feindseligkeit zu spüren!
Nun, solches waren Halef und ich als Reisende und Abenteurer durchaus gewöhnt. Die Menschen vieler Orte stehen fremden Neuankömmlingen, wenn nicht unbedingt feindselig, so aber doch misstrauisch gegenüber. Ob in der Wüste, im wilden Kurdistan, in den Schluchten des Balkan oder anderswo: Halef und ich hatten uns stets mit Freundlichkeit und Ehrerbietung behaupten können, und wenn die Dinge ärger liefen, so hatten wir auch die heftigsten Gefechte unbeschadet überstehen können. Doch heute waren wir unbewaffnet! Wir hatten weder Revolver noch Messer oder Säbel, und mein treuer Henrystutzen hing nicht über meiner Schulter. Doch die Menschen gegenüber hielten blitzende Dinge in den Händen, die mit ihren Augen um die Wette funkelten, als sie uns anstarrten.
„Nur Mut, Halef“, sagte ich jetzt zu meinem kleinen Gefährten. „Wir haben nichts zu befürchten. Wir werden auch dieses Abenteuer, diese Prüfung bestehen. Wir sind weitgereist und kampferfahren. Wir werden uns tapfer schlagen.“
„Aber Sihdi“, gab Halef zurück. „Ich fühle mich nicht ganz wohl, wie ich so dastehe. Du sprichst von früheren Kämpfen und Abenteuern. Ich will nicht klagen, dass wir unsere vertrauten Waffen nicht dabei haben. Wir werden andere Dinge finden. Aber früher waren wir immer angemessen gekleidet, praktisch und bequem. Diese Maskerade ist so unbequem.“
„Ich stimme dir zu, Halef. Auch ich vermisse die Stiefel und die Jacke, so wie du den Burnus vermisst. Aber ich muss dich auch berichtigen: Wir sind hier und jetzt sehr angemessen gekleidet und eine Maskerade ist es keineswegs.“
„Mir kommt es aber durchaus so vor, Sihdi“, meinte Halef. „Schau dich doch um! Ob unter Kurden oder Tscherkessen, ja nicht einmal unter Albanern habe ich so etwas gesehen.“
„Halef, sei nicht ungerecht“, erwiderte ich. „Jeder Stamm, jede Kultur hat ihre eigenen Gepflogenheiten, nicht nur was die Gebräuche, sondern auch was die Kleidung anbetrifft.“
„Aber es wirkt so unkultiviert“, beharrte Halef. „Diese Schlichtheit und Strenge und Eintönigkeit der Farben ist mir so gänzlich fremd. Und alle stehen herum, während sie rauchen. Niemand sitzt bequem.“
„Du wirst sehen, Halef“, sagte ich, „wenn wir uns erst einmal unter die Menge gemischt haben, wird es nicht mehr so schlimm sein.“
„Das hoffe ich, Sihdi“, gab Halef zurück. „Ich vertraue dir. Du hast noch immer Recht behalten.“ Er schaute noch einmal über die Menschenmenge. „Oder in den meisten Fällen.“
„Nun komm, Halef!“
Und dann betraten wir den großen Saal der britischen Botschaft in Istanbul, wo wir zu einer Abendveranstaltung zu Ehren der Königin Victoria geladen waren.
Der Raum war hoch und prächtig, wenngleich auf eine recht kühle Art. Im Licht der kristallenen Kronleuchter schimmerten Stuck und Marmor und die Messingkübel der Zimmerpalmen. Diese waren natürlich, wie der Name schon sagt, jene niedrige, fiedrige Art von Palmengewächsen, wie sie überall in Europa von Wohlhabenden und Bürgerlichen als Belebung ihrer heimatlichen vier Wände genutzt werden, und die sich von den großen Palmen des Orients, welche sich in Oasen und Plantagen finden lassen, deutlich unterscheiden. Und auch die Menschen in diesem Saal boten einen völlig anderen Anblick als die Orientalen, die sich in Basar und Karawanserei tummeln. Es war hier eben britischer Grund und Boden, auch wenn er sich in Istanbul befand. Die Gäste, oder vielmehr die geladenen Herrschaften, waren auch zum größten Teil Briten, standen ehrenhaft und steif da und hielten Konversation. In schwarzem Frack und weißem Hemd erschienen die Herren wie gravitätische Trauervögel, während die Damen sich paradieshaft geplustert hatten und zwar immer noch verhalten, aber eben doch farbenfroher als die Herren, in aufwändigen Kleidern und voluminösen Roben und funkelndem Schmuck nach Aufmerksamkeit heischten und diese auch erhielten: anerkennend durch die Herren, wohl eher neidisch und herablassend durch die anderen Damen.
Auch Halef und ich waren, wie erwähnt, passend und angemessen gekleidet. Wir beide trugen Frackschöße und Lackschuhe in Schwarz, Kragen und Schleife sowie Weste in Weiß, und alles aus den feinsten Materialien und dem edelsten Zuschnitt. Halef hatte Recht: Sonst trugen wir durchaus andere Kleidung, robust, bequem und weit, aus Leder und Kamelhaarwolle, dem heißen Klima und den sandigen, staubigen Landschaften geschuldet. Es war nun aber nicht so, dass wir für solche gesellschaftlichen Gelegenheiten wie diese auch immer Frack und Lack mit uns im Gepäck tragen würden. Stattdessen war Folgendes geschehen: Nach unseren Abenteuern in der Al-Badiya-Wüste und dem Beginn des Kampfes mit Al-Kadir hatten wir uns in Stambul mit unserem langjährigen Freund und Mit-Abenteurer Sir David Lindsay getroffen, dem spleenigen, aber sagenhaft reichen englischen Lord. Er hatte von hier aus zurück nach England reisen wollen, um einige Schätze in Sicherheit zu bringen, die er aus dem Wüstensand mitgebracht hatte. Als wir ihn trafen, eröffnete er uns, dass er in die britische Botschaft geladen worden war, um an einer kleinen Feier anlässlich des Geburtstags der Königin Victoria teilzunehmen. Er verkündete, dort nicht allein auftauchen zu wollen, denn ihm als honorigem Mitglied des Traveller’s Club zu London seien, bei aller Treue zur Königin, solche Veranstaltungen voll leerer Konversation und dem Leeren voller Champagnerkelche durchaus unangenehm. In Gesellschaft seiner Mit-Abenteurer und Freunde hingegen …
Kurzum, wir konnten dem Lord seine Bitte nicht abschlagen. Zumal er sich anbot, uns alle mit der notwendigen Abendgarderobe auszustatten. Er kenne selbstverständlich einen fähigen und zudem fixen Schneider, der ohne große Zeitverzögerung vier Fräcke modernen Zuschnitts anfertigen könne, gerade noch rechtzeitig für den großen Abend. Meine klugen Leser haben richtig gezählt. Vier Fräcke? Für Sir David Lindsay, Hadschi Halef Omar und Kara Ben Nemsi – aber da ist doch ein Frack überzählig, respektive fehlt eine Person? Völlig richtig. Denn seit unseren Erlebnissen in der Wüste begleitete uns der junge türkische Koch Abdollah, den Sir David als Diener und Reisebegleiter und eben auch als Koch angenommen hatte. Als Brite von Adel und Stand würde Sir David in der britischen Botschaft natürlich nur mit seinem Diener auftreten und dieser benötigte somit ebenfalls angemessene Gewandung.
Ich hatte den Lord gemahnt, er müsse sich nicht allzu sehr in Unkosten stürzen und einen Maßschneider mit dem Verfertigen unserer Fräcke beauftragen. Es gäbe heutzutage ja vielerlei Kleidung, die industriell hergestellt würde und tragfertig gekauft werden könne. So würden etwa in Berlin viele verschiedene Modelle von modischen Jacketts und Mänteln gefertigt und sehr erfolgreich nach Schweden, Dänemark, Rumänien und eben auch in die Türkei geliefert. Vielleicht würden für uns solcherlei Kleider doch ausreichen? Ich gebe zu, dass ich daran dachte, dass ein schlichter Anzug sowohl für mich selbst als auch für die anderen eine Anschaffung für kommende Zeiten und Gelegenheiten wäre, wohingegen ich gemeinhin keine Verwendung für Abendanzüge oder gar Fräcke habe. Wenn ich nicht rund um den Globus Abenteuer erlebe, verbringe ich meine Zeit in der heimatlichen Schreibstube, wo ich diese erlebten Abenteuer getreulich niederschreibe. Dort trage ich keinen Frack. Und selbst wenn ich meinen Verleger aufsuche, um mit ihm das eine oder andere zu besprechen, genügt ein rechtschaffener Straßenanzug. Aber im Grunde bliebe das gleiche Problem, nämlich den Frack oder Anzug von Stambul nach Deutschland zu schaffen. Zwischen diesen beiden Orten hätte ich keinerlei Verwendung dafür und die schönen Stoffe und die Arbeit des Schneiders wären doch nur Ballast. Nach dem gesellschaftlichen Abend würden die Anzüge verkauft, verschenkt oder was auch immer. Daran erinnerte ich Sir David, doch er beharrte auf seinen Plänen. Er erging sich kurz über den Niedergang von Textilindustrie und Mode, eben weil es jene Kleidung gäbe, die man wie mit der Stange vom Baum schüttelte und die zudem von minderer Qualität war, da die Stoffe nicht von eifrigen Webern liebevoll gewirkt würden, wie etwa der geschätzte britische Tweed, sondern weil sie auf dampfbetriebenen, maschinisierten Riesen-Webstühlen hastig zurechtgerumpelt wären.
Ich war erstaunt über diese Anwandlungen des Lords, der sich sonst nie so technikfeindlich und schon gar nicht so unmodern gegeben hatte, aber ich ließ ihn gewähren. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt auch keine Diskussion über soziale Themen eröffnen, die sich ja besonders an der Verelendung der deutschen Weber und der Geschundenen in den englischen Tuchfabriken aufhängen ließe. Obwohl gerade das erstere Thema mich stets bewegt und umgetrieben hat, auch aus persönlichen Gründen, beließ ich es also dabei und gab dem Lord nach. Am Ende sagte er noch, er würde die Fräcke ohne Weiteres seinem Gepäck für die Heimreise hinzufügen. Würden wir ihn dereinst einmal in London besuchen, so hätten wir dort gleich die passende Garderobe. Wir müssten bis dahin nur auf Linie halten. Halef empörte sich ein wenig darüber, als Schlemmer und Prasser verdächtigt zu werden; ich erwiderte gelassen, das wäre wohl kein Problem, bei unserem Abenteurerleben.
So standen Halef und ich also befrackt im Ballsaal der britischen Botschaft. Halef trat dann und wann von einem Fuß auf den anderen, weil ihn die neuen Schuhe drückten. Auch zog er häufig an seinem Kragen herum, der ihn am Hals zwickte. Immerhin fremdelte er nicht mit den langen Frackschößen, denn lange Gewänder war er als Araber ja gewohnt. Ich versicherte ihm, dass er sehr stattlich aussah und eine prächtige Mixtur aus einem westlichen Gentleman und einem orientalischen Ehrenmann darstellte. Denn auf Halefs Scheitel saß ein kunstvoll gewundener Turban aus weißer Seide. Diese Ausstattung schmeichelte seiner recht kleinen und schmalen Gestalt, und auch sein etwas dünner Bart war gewaschen und gebürstet und in gefällige Ringel gelegt. Vor unserem Besuch bei Schneider und Ausstatter hatten wir uns selbstverständlich ins Hamam, ins türkische Bad, begeben, um uns vom Staub der Reise und dem Schweiß der Abenteuer zu reinigen. Mein eigener Bart war sauber gestutzt, mein Haupthaar gekämmt, wenngleich ich auf Pomade und Parfüm verzichtet hatte. Halef hingegen duftete wie ein Rosengarten und eine Moschusherde gleichermaßen, es mochte auch etwas Ambra darunter sein, von der man nicht unbedingt wissen muss, woher diese wohlriechende Substanz stammt.
Neben uns hatte sich Sir David Lindsay postiert, ebenfalls im schwarzen Frack. Und wer jetzt gesagt hätte, dass dies eigentümlich sei, wo der Lord sich doch gemeinhin dem Spleen ergibt, ausschließlich Kleidung zu tragen, die aus graukariertem Stoff und Tuch verfertigt ist, den darf ich um einen genaueren Blick bitten. Denn tatsächlich war es so, dass sich nur bei schärfstem Beobachten, ja nachgerade kritischster Untersuchung, hellstes Licht vorausgesetzt, erkennen ließ, dass der mitternachtsschwarze Frack Sir Davids doch tatsächlich ein Karomuster aufwies, wenngleich kaum sichtbar, weil in, nun man könnte sagen, in vormitternachtsschwarzem, also etwas hellerem schwarzen Ton. Der Lord war und blieb so kurios in seinen Eigenheiten wie eh und je. Ich vermutete aus Erfahrung, dass er ohnehin so etwas wie karierte Socken trug, diese aber gefällig unter den Hosenbeinen und den Lackschuhen vor den Blicken aller verborgen blieben. Was er jedoch allen zeigte, war das spitznasige, breitmündige Gesicht derer von Lindsay und auf diesem lag das gefällige Lächeln des Stolzes, ein Brite zu sein.
Neben Sir David ragte die schlaksige Gestalt von Abdollah der Decke entgegen. Der gute Abdi, wie er in Verkürzung seines Namens genannt werden wollte, ruckte seinen großen Kopf auf seinem langen Hals umher, da er angesichts des prächtigen Saals und der nicht minder prächtigen Abendgesellschaft kaum wusste, wohin er zuerst schauen sollte. Dabei war er selbst ein höchst interessanter Anblick. Seine Augen waren groß und kullerhaft, die Ohren wahrhaftige Lauscher, die wie Rundsegel an seinem Schädel steckten. Sein Herz war treu, wenngleich sein Gemüt etwas schlicht war. Er war mutig und ein formidabler Koch, auch wenn sein Mut mit Küchenmessern und Töpfen weiter reichte als mit Waffen, die man auf dem Gefechtsfeld führt. Wie er sich auf diesem gesellschaftlichen Parkett schlagen würde, musste sich zeigen, aber da er bei einigen hohen Herren in kulinarischen Diensten gestanden hatte, würde er sich angemessen zu benehmen wissen. Ich ging sogar davon aus, dass er gar nicht anders konnte, als galant zu sein, denn er trug seinen Frack mit größtem Stolz, wenngleich ihm die langen Hosenröhren und die fast ebenso langen Frackschöße die Gestalt eines äußerst seltsamen Wat- und Staksvogels gaben. Nun, seinen Schnabel würde er wohl halten.
Denn jetzt kam der Gastgeber auf uns zu. Der britische Botschafter war groß, hager, und sein schmales Gesicht wurde eingerahmt von einem grauen Backenbart und dominiert von einer großen Nase. Sir David raunte mir hastig einige Informationen zu: „Das ist Sir Henry George Elliot. Er ist seit sieben Jahren im Amt. Vorher war er im diplomatischen Dienst in Sankt Petersburg, Den Haag, Wien, Kopenhagen und Neapel … Sein Vater ist übrigens Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, der zweite Earl of Minto …“
„Lindsay! Rasseln Sie schon wieder Titel herunter?“ Botschafter Elliot schüttelte erst den Kopf und dann die Hand Sir Davids. Dabei lächelte er spöttisch. „Aber wie schön, dass Sie es einrichten konnten, hier vorbeizuschauen. Ich nehme an, Sie sind dennoch auf dem Sprung, wie man so schön sagt? Auf der Reise von hier nach dort, ganz nach den Statuten des Traveller’s Club?“
Sir David lächelte zurück, durchaus freundlich, wie mir schien, obgleich dies bei seinem dünnen, schmalen Mund wie immer schwierig zu erkennen war. Ein gerechtes Urteil konnten wohl nur langjährige Freunde und Vertraute Sir Davids fällen. Der Botschafter schien sich zu diesen zählen zu dürfen, angesichts des Dialogs zwischen den beiden befrackten Herren.
„Und Sie, Elliot? Immer noch einen weiteren Empfang mit Champagner und Kanapees? Ganz nach den Statuten des Diplomatischen Korps?“, sagte Sir David.
„Selbstverständlich“, gab der Botschafter zurück. „Und welcher Anlass wäre diplomatischer als die Wiederkehr des Wiegenfests unserer hochgeschätzten Queen Victoria sowie ihres Krönungstags und ihres Regentschaftsbeginns!“
Sir David feixte. „Und ich dachte, es wäre eine Jubelfeier zur Wiederwahl von Benjamin Disraeli zum Premierminister. Aber nein – das wäre ja durchaus verspätet und damit unbritisch.“
Der Botschafter feixte ebenfalls. „Etwa so unbritisch, wie sich nicht an den Wahlen zu beteiligen, weil man wieder einmal im Ausland weilt.“
„Ich trage zur Lösung der Orientfrage sozusagen vor Ort bei.“
„Allerdings. Geradeso wie ich!“
Beide lachten, wenngleich ich den Eindruck hatte, dass hier unter all der Heiterkeit auch einige Spitzfindigkeiten verborgen waren. Das Thema war, wie in diesen Jahren und in dieser Erdgegend stets, das Streben von England auf der einen Seite und das Russlands auf der anderen, das schwankende Osmanische Reich einerseits zu stützen, andererseits zu schwächen, und auf sozusagen niederer Ebene natürlich auch das Freiheitsstreben der Balkanländer, die sich wie etwa Bulgarien bemühten, das Joch der Hohen Pforte, wie man die türkische Regierung nannte, abzustreifen. Ich war überzeugt, dass dies nur in Aufstände und schließlich auch Kriege münden konnte. Mit dieser Ansicht stand ich nun nicht allein da, und wenn ich mit Diplomaten oder Herrschenden der genannten Länder über diesen Sachverhalt hätte diskutieren wollen, wären wir trotz unterschiedlicher Gewichtungen und Vorbehalte wohl übereingekommen. Ich wusste aber zudem, dass es in diesem Großen Spiel, wie der Konflikt zwischen England und Russland um Balkan und Orient gemeinhin genannt wurde, noch einen oder zwei weitere Spieler gab, und diese, namentlich Ahmar Al-Kadir und den Schut, musste ich selbst bekämpfen, da mir wohl niemand der in Landesinteressen verfangenen Herrschaften geglaubt hätte, um wen es sich handelte und mit welchen Mitteln sie welche Ziele erreichen wollten.
In diesem Augenblick waren aber weniger schwerwiegende Dinge wichtig. Der Botschafter wandte sich von Sir David ab und mir zu, musterte mich interessiert, stellte aber dennoch eine Frage an den Lord:
„Und wen haben Sie hier an illustren Herrschaften mitgebracht?“
Sir David reckte sich und stellte mich vor. „Das ist Kara Ben Nemsi Effendi. Ebenso wie ich ein vielerfahrener Weltreisender und zudem noch ein berühmter Schriftsteller.“
„Sehr erfreut“, sagte der Botschafter und drückte meine Hand. „Sie schreiben Romane wie der eben erwähnte Disraeli? Falls Sie nicht nur schreiben, sondern auch lesen, kann ich Ihnen seine Werke nur empfehlen. Benjamin Disraeli sah in jungen Jahren nicht nur aus wie Lord Byron, er schrieb auch mindestens genauso gut.“
„Nein, Herr Botschafter“, stellte ich höflich richtig, „ich schreibe keine Romane, sondern Reiseerzählungen, also Berichte über meine Reiseerlebnisse und Reiseerfahrungen. Herr Byron und Herr Disraeli brillierten auf ganz anderem literarischen Gebiet.“
„Ich gehe richtig in der Annahme, dass Sie kein Araber oder Osmane sind, trotz Ihres Namens? Bei jenen Völkern mangelt es doch ein wenig, was Belletristik angeht …“ Botschafter Elliot hob beschwörend die Hand. „Verstehen Sie mich nicht falsch! Ich bin diesem Land und dieser Kultur sehr verbunden, sonst wäre ich kaum hier, aber gewisse Defizite, was die schönen Dinge angeht, gibt es eben doch. Deswegen sehen wir Briten uns auch als Schutzmacht, nicht nur, was das Politisch-Militärische angeht, sondern auch im kulturellen Sinne.“
„Dann sollten Sie ja keine Bedenken gegen gewisse russische Einflüsse haben, denn die Herren Dichter Puschkin, Gogol, Dostojewski und Tolstoi sind Größen ihres Fachs und harren nur der angemessenen Übertragung in die Sprachen anderer Länder, damit sie auch dort gelesen werden können. Für jene, die kein Russisch sprechen können. Oder wollen.“
Neben mir hörte ich Sir David schnappend Luft holen, weil ich mir eine solche Spitze erlaubt hatte. Der Botschafter schaute mich etwas schmaläugig an und spitzte die Lippen.
„Sie sind Russe, Kara Ben Nemsi? Ach, richtig, das hätte ich mir denken können. Nemets ist ja russisch für Deutscher.“ Er hob erstaunt die Brauen. „Ja, was sind Sie denn nun?“ Dann warf er einen Blick zu Sir David. „Mein lieber Lindsay, wenn Sie nicht an Ihren Fähigkeiten des korrekten Vorstellens und einander Bekanntmachens arbeiten, werden Sie die Orientalische Frage dadurch lösen, indem Sie Krach und Zwist unter allen Parteien gleichermaßen entfesseln!“
„Hören Sie, Elliot …“, begann Sir David, aber ich wollte die Situation selbst entspannen.
„Herr Botschafter“, sagte ich, „Sie haben völlig Recht, ich bin Deutscher. Mein Name, unter dem ich im Orient bekannt bin, ist ein wenig verwirrend, da er durch kleine Missverständnisse entstand, dann aber aus Gewohnheit beibehalten wurde. Mein tatsächlicher Name, unter dem ich in Deutschland auch veröffentliche, ist …“ Ich nannte ihn und auch meinen Verlag.
„Nun, warum nicht gleich“, meinte der Botschafter jovial und drückte erneut meine Hand. „Vielleicht können Sie Ihren Verleger ja auch dafür begeistern, neben den diversen Russen auch Disraeli zu verlegen. Ich könnte da vermitteln. Wo sagten Sie, sitzt Ihr Verlag, in Hamburg?“
„Nein, in Bamberg.“ Der Botschafter hatte sich wohl verhört. Oder ihm war, wie so vielen Briten, als deutsche Stadt nur Hamburg bekannt, wohl weil es wegen Nebel und Hafen dem englischen London so ähnlich ist und die Bewohner hier wie dort etwas steif daherkommen. Obgleich ich von Geburt Sachse bin, schätze ich Bamberg und Franken sehr, wohl weil es sich quasi in der direkten Nachbarschaft befindet und auch des schmackhaften Biers und der Würste wegen. Trotz meiner Weitgereistheit und eines gewissen Weltbürgertums bin ich wohl doch ein typischer Deutscher. Und nun umso mehr, da es seit wenigen Jahren ein vereintes Deutsches Kaiserreich gab, das sich mit den anderen großen Monarchien Europas wohl messen konnte, und die jüngste französische Republik sei auch nicht verschwiegen.
Der Botschafter wies mit knapper Geste durch den Raum. „Wenn Sie erlauben, wenden wir uns von der Literatur zur Architektur hinüber. Sie sind ein kulturbeflissener Mensch, wie mir scheint. Wie gefällt Ihnen Pera House? Es wurde in den vergangenen beiden Jahren renoviert, nachdem es 1870 zu einigen Brandschäden gekommen war, und wir haben etliche Maßnahmen ergriffen, um für die Sicherheit zu sorgen …“
Ich fand es dem britischen Selbstverständnis durchaus angemessen, den ganzen Bau nach dem Stadtteil Istanbuls zu benennen, in dem er sich befand, namentlich in Pera, das früher auch das Venezianische und mittlerweile das Europäische Viertel genannt wurde, eben wegen der zahlreichen europäischen Botschaften, Vertretungen und Generalkonsulate, die in älteren oder neueren, stets aber prächtigen Bauten untergebracht waren. Des Botschafters Anspielung auf die Sicherheit entnahm ich, dass damit nicht allein der Brandschutz gemeint war, sondern auch die Tatsache, dass es in diesem Haus sowohl diplomatische als auch militärische Geheimnisse zu bewahren, wenn nicht gar zu verbergen galt.
„1870 war ohnehin ein bemerkenswertes Jahr, nicht wahr?“, meinte der Botschafter. „In der Nähe hat damals auch die neugebaute schwedische Botschaft eröffnet. Und in Ihrem schönen Land wurde der Grundstein dafür gesetzt, dass Sie nun auch eine Botschaft in Istanbul haben dürfen. Aber leider nicht in Pera …“
Ich wusste, dass seit diesem Jahr die Bauarbeiten für die deutsche Botschaft begonnen hatten, da das alte Gebäude des preußischen Konsulats nicht mehr den repräsentativen Ansprüchen des Kaisers genügte. Leider aber war im Botschaftsviertel kein Baugrund mehr zu haben. Nun, ich war überzeugt, dass dies durch die Pracht des Hauses wettgemacht werden würde. Lage ist nicht alles.
„Man erzählt sich“, fuhr der Botschafter fort, „dass der Architekt reinen Klassizismus anstrebt. Mit nackten Ziegeln an der Fassade. Man ist sich einig, dass dies weder zum orientalischen Flair Istanbuls passt noch zu dem seit langer Zeit gepflegten italienischen Stil.“
Damit meinte er die jahrhundertealten Bauten der Venezianer wie auch die jahrzehntealte britische Botschaft, die in jenem Geschmack errichtet worden war.
„Nun“, meinte ich, „neue Staaten, neue Zeiten, neue Bauten. Vergönnen Sie es uns, Herr Botschafter. Wir werden uns zu benehmen wissen und dem britischen Königreich in den kommenden Zeiten sicher nicht solchen Ärger bereiten, wie es Amerika vor einem Jahrhundert getan hat.“ Ich gab mich ein wenig dem spitzfindigen Geplänkel hin, das unter den Angehörigen unterschiedlicher und unterschiedlich alter Nationen zwangsläufig ist.
„Davon bin ich überzeugt“, sagte der Botschafter und lächelte ein wenig herablassend. „Für die Franzosen hat es gereicht, aber es waren eben nur Franzosen.“ Er hob beschwichtigend die Hand. „Aber ich danke Ihnen für den Hinweis auf unsere frühere Kolonie. Ich bin äußerst glücklich, dass ich hier in Istanbul meinen Dienst fürs Vaterland leiste, und nicht jenseits des Atlantiks irgendwo in der Prärie unter den Indianern. Sie sind sicher auch froh, im farbenprächtigen Orient umherzureisen und nicht in jener neuweltlichen Einöde.“
„Sie haben völlig Recht, Herr Botschafter, klug und verständig wie Sie sind.“ Neben mir hörte ich Halef leise kichern, der ja nun wusste, dass ich auch in Nordamerika viele Abenteuer erlebt hatte und mir Land und Leute ans Herz gewachsen waren, vor allem die Apatschen vom Stamm der Mescalero. Ich beschloss, dass sowohl diese tapferen Krieger wie auch ich selbst die Größe besitzen konnten, dem britischen Botschafter seine chauvinistische Weltsicht ungescholten durchgehen zu lassen. Allerdings hatte nun mein kecker Halef auf sich aufmerksam gemacht. Der Botschafter fasste ihn scharf ins Auge.
„Nun, wen haben wir hier?“, fragte er. „Einen recht heiteren arabischen Gesellen?“
Halef nahm ein wenig Haltung an, da er wusste, dass es sich bei einem westlichen Botschafter um einen nicht gerade niedrigen Würdenträger seines Staates handelte. Halef war aber dennoch nicht unterwürfig und richtete sich gemeinhin nach meinem eigenen Auftreten dem jeweiligen tatsächlichen oder auch nur eingebildeten Machtmenschen gegenüber.
Sir David kam rasch seinen Vorstellungspflichten nach.
„Das ist der ehrenwerte Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas …“
„Gut, gut“, sagte der Botschafter und winkte ab. Er schüttelte Halef lächelnd die Hand. „Sir David ist ein begeisterter Verkünder von Titelreihen, nicht wahr? Werter Hadschi Halef Omar, ich sehe, Sie haben eine ebenso beeindruckende Reihe von Namen und damit Vorfahren wie ich selbst, deshalb seien Sie herzlich willkommen und genießen Sie den Abend. Ich darf Ihnen sagen, dass Sie prächtig gekleidet sind. Frack und Turban gehen gut zusammen, so wie ich hoffe, dass dies auch einst über Orient und Okzident gesagt werden kann.“
Halef nickte stolz, als habe der Botschafter ihn soeben zum Ehrenbotschafter für Völkerverständigung ernannt. Ich gönnte ihm dieses Gefühl und dachte bei mir, dass ich mich dem Gedanken Sir Henry Elliots gerne anschließen wollte. Der Botschafter wandte sich danach Abdi zu, der die ganze Zeit neben Sir David stehend ein wenig gezappelt hatte. Vielleicht lag es an der Aufregung oder aber an den Lackschuhen, die, so gebe ich zu, auch mich selbst ein wenig drückten. Jedenfalls wankte durch die Bewegungen auch der schöne neue rote Fes auf Abdis Scheitel und die schwarze Troddel schwänzelte herum. Ob sich der Botschafter dadurch gegrüßt fühlte, vermochte ich nicht zu sagen, auf jeden Fall aber erkannte er an dieser Kopfbedeckung Abdi als türkischen Untertan des Osmanischen Reichs.
„Einer der Männer, denen gegenüber ich zu repräsentieren habe“, nickte der Botschafter.
Sir David stellte vor: „Das ist Abdi, mein Diener und Koch. Ein formidabler Koch, möchte ich hinzufügen. Sein Onkel stand in Diensten des Schesahde Abdülhamid, des Neffen Sultans Abülaziz und …“
Der Botschafter unterbrach ihn. „Wie war der Name Ihres Dieners? Archie? Wie kurios! Lindsay, lassen Sie den Menschen doch ihre eigenen Namen …“
„Ach Unsinn, Elliot!“ Sir David schüttelte unwirsch den Kopf. „Foppen Sie mich nicht ständig! Als wenn ich jemanden mit dem absurden Namen Archie als Diener annehmen würde! Dies ist Abdollah, der auf eigenen Wunsch Abdi genannt werden möchte.“
Der Botschafter amüsierte sich über die eifrigen Worte Sir Davids und reichte Abdi seine Hand. „Willkommen, Abdi.“
Und dann geschah das Unglaubliche! Ich glaubte meinen Augen und Ohren nicht zu trauen, Sir David wurde die Nase vor Verwunderung noch spitzer und die Lippen noch schmaler, nur Halef wusste wohl nicht so recht, was geschah, außer dass es sich seiner Ansicht nach wieder einmal um eine Unmöglichkeit des tölpelhaften Abdi handelte.
Und dies ereignete sich: Abdi griff nach der Hand des Botschafters, drückte sie herzhaft – und dann vollführte er einen akkuraten Diener, indem er zackig Kopf und Schultern nach vorn kippte. Dabei sagte er mit lauter Stimme: „Kistand! Schamstadina!“
Dem Botschafter wurden die Augen groß – und dann lachte er. Er kicherte ganz und gar unbritisch, bis sich sogar einige Tränen zeigten. Er wischte sie mit den weißen Handschuhen fort und beeilte sich dann, dem wieder aufgerichteten, aber nun betreten dreinschauenden Abdi aufmunternd gegen den Arm zu klopfen. „Das habe ich lange nicht gehört! Seit den 1850ern! Eine schöne Zeit war das, die fünf Jahre in Wien. Vielleicht sollte ich wieder einmal dorthin.“
Abdi strahlte. Botschafter Elliot nickte uns der Reihe nach zu. „Und jetzt darf ich mich entschuldigen. Ich muss noch viele andere Gäste begrüßen. Amüsieren Sie sich. Bis später, Lindsay. Guten Abend, Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar. Servus Abdi, baba!“
„Servus, baba!“, winkte Abdi. Der Botschafter lachte, schüttelte den Kopf und tauchte in der Menge der anderen Gäste unter.
Halef stemmte die Fäuste in die Hüften und funkelte Abdi an. „Was hat das alles zu bedeuten? Wieso nennst du den ehrenwerten Ambassador-Ingles so schamlos vertraut Vater?“ Er schüttelte den Kopf. „Und er dich auch …?“ Halef blickte verwirrt zu mir. Sir David fand nichts Seltsames an der Verabschiedung. „Wieso Vater? Sie sagten beide schlicht bye-bye? Und at your service?“
Ich rieb mir amüsiert das Kinn. Während des ersten Abenteuers, bei dem Abdi uns begleitete, hatten wir, also Halef, Sir David und ich, erfahren, dass Abdi während seiner Ausbildung zum herrschaftlichen Koch im Gefolge des türkischen Sultans einige europäische Metropolen bereist hatte, namentlich London, Paris und eben – Wien. Abdi verstand und sprach also einige wenige Worte der jeweiligen Landessprachen. Überhaupt hatte er ein scharfes Gehör und deshalb wohl verstanden, was Sir David mir über den Botschafter zugeraunt hatte. Und so ist es kaum verwunderlich, dass Sir Elliot, der frühere britische Botschafter in Wien, der nun britischer Botschafter in Istanbul war, und unser Abdi sich mit der eigentümlichen Wiener Abschiedsformel bedachten. Ob das wienerische baba tatsächlich mit dem englischen bye-bye verwandt ist oder doch nur eine kindliche Wortspielerei, darüber sind sich selbst gestandene Sprachforscher uneins. Die seltsame Begrüßung, die Abdi in einem kuriosen Akzentmischmasch aus Türkisch und Wienerisch von sich gegeben und die den Botschafter so überraschend zum Lachen gebracht hatte, war, genau ausgesprochen oder vielmehr niedergeschrieben, die folgende: „Küss die Hand, gehorsamster Diener!“ Ich sah Abdi die etwas unpassende Verwendung nach und amüsierte mich mit allen anderen.
Es war nun an der Zeit, sich selbst unter die Gäste zu mischen, wie man dies gemeinhin nennt. Allerdings war es so bestellt, dass weder ich das bin, was man als Salonlöwen bezeichnet, noch meine drei Gefährten. Sicherlich, Sir David war mit den Gepflogenheiten von Abendgesellschaften vertraut, aber er bereiste den größten Teil des Jahres die verschiedensten Weltgegenden und nicht das Parkett von Villen und Herrensitzen. Abdi parlierte gemeinhin nicht mit feinen Herrschaften, sondern hielt Zwiesprache mit Viktualien und Küchengerätschaften. Halef war zwar Mitglied im Stammesrat der Haddedihn-Beduinen, erlebte aber viel häufiger mit mir Abenteuer im Orient. Und was meine Person anbetraf, so drittelt sich mein Leben in besagten Orient, den Wilden Westen Amerikas und die heimatliche Schreibstube. Da bleibt kaum Zeit für gesellschaftliches Leben. Ich gebe zu, dass ich daher dem plauderhaften Kurzgespräch durchaus abgeneigt bin, und sei es nur, weil es mir ungewohnt ist. Unter Wüstensöhnen und Westmännern hält man keinen small talk, wie Sir David dies genannt hätte. Es ist ja ohnehin ein wenig absurd, etwa angeregt über das Wetter zu reden, wenn man sich nicht unter einem festen Dach mit Kronleuchter und innerhalb fester Wände mit Stuck und Täfelung befindet, sondern eben mitten im Wetter, nämlich in Steppe und Prärie, in Wäldern und auf Bergeshöhen. Auch Klatsch und Tratsch darüber, was jener Herr oder diese Dame am vorigen Tage oder Abend getan oder unterlassen habe und mit wem und in welchem Aufzug – dies sind Dinge, die mich nicht interessieren, eben weil sie unnütz und langweilig sind. Aber niemand soll mich wegen meines häufigen Umgangs mit rohen, deftigen Menschen in wilder und ursprünglicher Landschaft nun selbst für ungeschlacht und verroht halten. Ich kann mich in jeglicher Umgebung behaupten – wie auch immer sie beschaffen und mit welchen Personen sie bevölkert sei.
Ich zog also meine Weste glatt und richtete die Frackrevers. Dann sagte ich zu meinen Gefährten: „Also dann, meine Herren!“
Die nächste Zeit verging recht gleichförmig. Ich sprach an, wurde angesprochen und dann und wann wurde ein Toast auf die britische Königin ausgebracht, welcher aus Gläserklingen und Segenswünschen bestand. Immerhin gestaltete sich dies nicht so preußisch-stramm, wie es sich wohl in einigen Jahren zu Kaisers Geburtstag in der deutschen Botschaft ereignen würde. Ob dies an den unterschiedlichen Völkern oder dem Geschlecht des gekrönten Haupts liegen würde, sei dahingestellt. Zur Ehrenrettung des britischen Militärs, welches natürlich durchaus darauf verzichten kann, von einem deutschen Zivilisten gerettet zu werden, darf ich erwähnen, dass die anwesenden Offiziere durchaus schneidig riefen und ihre Gläser erhoben. Die Diplomaten und Würdenträger und illustren Gäste aus anderen Ländern und Kulturen benahmen sich ebenfalls dem Anlass angemessen. Ich sah die Botschafter anderer Länder, Herren aus Politik und Wirtschaft, jeweils nebst Gattinnen und Damen, sofern dies kulturell erlaubt war. Vielerlei Sprachen waren zu hören, wenngleich das Englische vorherrschte, und auch wenn die Kleidung von Fräcken dominiert wurde, gab es auch reiche orientalische Gewänder und exotische Kopfbedeckungen, auch wenn mir selbst diese natürlich keineswegs exotisch, also fremd schienen. Und ebenso erging es den Herren des Parketts, als sie mich und meine Gefährten sahen. Sie starrten und staunten keineswegs, sondern gingen mit uns, wie mit den ihren und auch anderen, äußerst freundlich und höflich um. Die Situation war also nicht ganz so drastisch, wie von mir eingangs geschildert, und ich gebe freimütig zu, dass ich dies allein aus Gründen der Spannung tat. Die erfahrenen und weltgewandten Herren Diplomaten sind nämlich keineswegs überrascht, wenn im Rahmen einer Abendveranstaltung noch vier weitere befrackte Herren am Eingang des Ballsaals der britischen Botschaft in Istanbul erscheinen. Ebenso wenig wurden die anwesenden Wesire, also osmanischen Minister, bestaunt, die ohnehin Abendanzug und Fes trugen. Die wenigen arabischen Gäste, Männer in Djellaba und Turban, in Burnus und Kefije, fielen ein wenig durch ihre hellen Gewänder auf; ihr Auftreten war jedoch ebenfalls gewählt und diplomatisch. Es mochten wohl Würdenträger ihrer Stämme oder gar der Königshäuser sein. Und sie waren sicher nur geladen, weil es in diesem vergleichsweise zwanglosen Rahmen Gelegenheiten gab, auch heikle politische oder wirtschaftliche Dinge zu besprechen. Daran war wohl allen gelegen, in diesen schwierigen Zeiten, da hielt man sich nicht mit Äußerlichkeiten auf und wahrte Gesicht und Contenance.
Was sich jedoch dann ereignete, sorgte tatsächlich für Staunen und Raunen, zunächst aber für verblüffte Stille. Ich will nicht sagen, dass eine Uhr eine bestimmte Stunde schlug, aber es schien doch, als hielten alle für einen Augenblick den Atem an. Es gibt in kleineren Gesprächsrunden wie auch in größeren Gesellschaften jene eigentümlichen Momente, in denen durch Zufall alle Unterhaltungen zur selben Zeit zum Erliegen kommen. Hier wird überlegt, dort wird nachgesonnen und anderen Orts ist alles gesagt. Es herrscht Stille, wo zuvor das Summen einander überlagernder Stimmen den Raum beherrschte. Ein solcher Augenblick trat nun ein. Und in den Saal trat eine einzelne Person. In das vom Zufall geschaffene Schweigen fauchte ein Schwefelholz. Dessen Kopf fing Feuer, die Köpfe der Anwesenden wandten sich um. Ein Schwaden blauen Rauchs stieg auf, als eine schmale Zigarre an der Spitze aufflammte. Dann rauchte die Person. Niemand achtete darauf, wohin das verbrannte Zündholz verschwand, man starrte gebannt auf die Person. Denn sie war – eine Frau!
Zweites KapitelDie Dame in Schwarz
Es ist nun so, dass ich selbst nicht derart schockiert bin, eine Tabak rauchende Frau zu sehen, wie es die anwesenden Herren und Damen der höheren Gesellschaft waren. Ob im Orient oder auf dem Balkan oder im Wilden Westen habe ich viele Frauen gesehen, die im Rauchen und Schmauchen den Männern in nichts nachstanden. Aber auch ich war erstaunt darüber, was es für eine Frau war, die hier im Ballsaal der Botschaft rauchte.
Die Dame – ich will so höflich sein, sie hier so zu nennen – war von eleganter Erscheinung. Sie war hochgewachsen und schlank, sehr schmal in den Hüften und in ihrem Körpertypus insgesamt das, was man knabenhaft nennt, wenngleich sie keineswegs wie ein schwacher Halbwüchsiger wirkte, sondern kraftvoll und drahtig, aber dabei nicht unweiblich. Sie trug ein langes Kleid von schlichtem Schnitt, schmal in der Silhouette und ohne voluminösen Zierrat, wie etwa Rüschen oder Schleppe. Es war auf asiatische Art hochgeschlossen und besaß eng anliegende Ärmel. Die Arme der Frau waren dennoch bis zum Ellenbogen von langen Handschuhen bedeckt, die aber dem Anlass entsprechend nicht bis zum Oberarm reichten, wie es für einen Opernbesuch vorgeschrieben wäre. Der augenfälligste Unterschied zu den Kleidern und Roben der anderen anwesenden Damen war jedoch, dass diese helle, freundliche Farben in zarten sommerlichen Blütentönen trugen, die unbekannte Frau jedoch trug Schwarz, als besuchte sie keine diplomatische Feierstunde, sondern ein Trauerbegräbnis.
Als sei dies allein nicht genug, nach dem stummen Starren der Anwesenden ein erstauntes, wenn nicht gar empörtes Murmeln hervorzurufen, so zeigte sich nach Zigarre und Grabesflor noch eine dritte unerhörte Eigentümlichkeit. Die Dame trug ihr Haar – kurz.
Während ich nun fand, dass dies höchst treffend ihre Gesichtszüge unterstrich, die herb, wenn nicht gar streng zu nennen waren, der schmalen Nase und hohen Wangenknochen wegen, so war die Ansicht der Anwesenden doch völlig anders. Ringsum hörte ich es raunen: „Ein Tituskopf!“ – „Bei einer Frau!“ – „War dies nicht vor einem Dreivierteljahrhundert modern?“ – „Ja, bei Männern!“ – „Im Diréctoire, kurz nach der Französischen Revolution.“ – „Aber nur, damit die Köpfe besser rollen konnten.“ – „Ging es nicht mit der klassischen Griechenmode einher?“ – „Dann ist es hier und heute umso unpassender!“
Tatsächlich schien die Frisur der Dame eine Anlehnung an die bekannte Büste des römischen Kaisers Titus zu sein, und eine Frisur in jenem Stil war wirklich vor vielen Jahrzehnten neueste Mode gewesen. Aber die Unbekannte trug keine Ringellöckchen, die mit Pomade an den Kopf gelegt waren, sondern die kurzen, schwarzen Strähnen umwoben ihren klassischen Kopf recht ungestüm, wobei ich mir nicht sicher war, ob diese vorgebliche Unordnung nicht kunstvoll arrangiert worden war. Und vielleicht sollte diese schlichte Frisur, im Gegensatz zu den aufgetürmten und herausgeputzten Gebilden, welche die Damen der Gesellschaft trugen, auch nicht von dem ablenken, was sich als einziger Schmuck an der schlanken, schwarzen Gestalt befand: ein voluminöses Collier aus Gold, das um ihren Hals floss und sich unter den Schlüsselbeinen entfaltete. Mich erinnerte diese gesamte Erscheinung zum Teil an die Fotografie von Sofia Engastromenou, besser bekannt als Sofia Schliemann, auf dem sie das goldene Geschmeide aus dem Schatz des Priamos trägt. Und doch war diese Frau so ganz anders als die brave Gattin des berühmten Kaufmanns und Archäologen. Sie blickte über die Menge, als sei sie ihr Publikum, und doch schaute ihr niemand erwartungsvoll entgegen, als erhoffte man eine musikalische Darbietung, eine Arie oder auch nur ein Ständchen für die nicht anwesende Königin. Stattdessen setzte das allgemeine Geplauder wieder ein. Ich hörte nichts mehr, was sich auf die Dame in Schwarz bezog. Die Briten hatten offenbar ergiebigere Themen und ignorierten den modischen Affront, im Gegensatz dazu wie es vermutlich Franzosen getan hätten. Man war unausgesprochen übereingekommen, dass es sich hier sicherlich um keine Europäerin handelte, und damit war sie der Mühe, über sie zu sprechen, nicht wert. Und die Nichteuropäer unter den Geladenen ignorierten die Dame wohl in der Ansicht, es handele sich um eine der überspannten Weibspersonen, wie sie nur Europa hervorbringen konnte.
Ich hingegen interessierte mich sehr für diese Unbekannte, besonders, als ich gesehen hatte, dass Botschafter Elliot sie eilig und mit vollendetem Handkuss begrüßte. Möglicherweise hatte er auch dadurch ein weiteres Raunen unter den Gästen verhindert. Ich erkannte daran, dass die Dame dem Botschafter bekannt und ebenfalls zu diesem Abend geladen war. So eigensinnig sie sich gab, den üblichen gesellschaftlichen Gepflogenheiten stellte sie sich also nicht ganz entgegen, und hatte nicht etwa die Gesellschaft gesprengt, indem sie ohne Einladung aufgetaucht war. Und dass die Hürden, zu diesem Abend geladen worden zu sein, nicht sonderlich hoch gewesen waren, erkannte ich durchaus daran, dass auch Abdi, Halef und ich hier zugegen waren. Wir waren eben Bekannte des allseits geschätzten Sir David Lindsay. Wer wusste schon, wer für die Dame in Schwarz gebürgt hatte – oder wer sie überhaupt war. Dies zu erkunden, schien mir die interessanteste Gelegenheit des Abends zu sein, und so beschleunigte ich meine Schritte. Nicht, dass die Unbekannte wieder verschwand, wo sie doch so unvermutet und schillernd wie eine Fata Morgana erschienen war, wenngleich nicht über der Wüste, sondern über dem Parkett. Ich ging dieses Abenteuer allein an, denn Halef hatte sich an das Buffet verfügt, um die angebotenen Speisen zu verkosten. Die Botschaft hatte den Abend als mehr oder minder zwanglosen Stehempfang nach französischem Vorbild gestaltet, und so gab es keine festliche Tafel, an die zum Dîner gerufen werden würde, sondern die Gäste konnten sich an einem reich geschmückten und gedeckten Seitentisch selbst bedienen. Sir David und Abdi flanierten irgendwo durch den Saal.
Ich näherte mich also der schwarz gekleideten Dame. Nachdem der Botschafter sie begrüßt hatte und wieder gegangen war, stand sie noch immer allein im Raum; niemand suchte mit ihr das Gespräch, niemand begrüßte sie, niemand zeigte auch nur das geringste Interesse. Doch während andere Menschen sich von der Gästegesellschaft geschnitten und geschmäht fühlen würden, schaute die Dame ihrerseits in die Runde, rauchte und dachte sich ihren Teil, der angesichts ihres ruhigen, wenn nicht gar sphinxhaften Gesichtsausdrucks keinesfalls von Groll oder Häme bestimmt war.
Ich gebe zu, dass ich mich über mich selbst wunderte. Ich bin, wie erwähnt, kein sogenannter Salonlöwe und ich bin auch nie ein Glücksritter in amourösen Dingen gewesen. Die Damenwelt habe ich stets geschätzt, aber sie doch nie so erforscht und erkundet wie die wirkliche Welt, die sich unter der Windrose darbietet. Dass ich nun so forsch auf diese Frau zuging, konnte ich mir kaum erklären. Irgendetwas zog mich zu ihr hin, und dies konnte nicht der Drang des Forschers sein.
Jetzt hatte ich die Frau in Schwarz erreicht. Ich sah sie im Profil, das edel und streng war und jeder hellenischen Statue als Vorbild hätte dienen können, wenn dort nicht dann und wann die Zigarre an die geschwungenen Lippen geführt worden wäre und sich hernach die schönen Züge durch Rauch verschleiert hätten.
In diesem Moment wandte die Frau den Kopf und sah mich direkt an. Ihre bemerkenswert hellen, grauen Augen schienen geradezu den Nebel des Zigarrenrauchs zu durchdringen und sogar aufzublitzen. Die lächelnden Lippen zeigten einen winzigen Schimmer weißer Zähne. Dann drehte die junge Frau ihren Körper in einer perfekt gezirkelten Bewegung, ohne den Blick von mir zu wenden, und stand als schwarze Figur im schwindenden Rauchnebel vor mir. Nach ihren Augen und Zähnen begann nun auch das goldene Collier auf dem schwarzen Kleid zu schimmern. Die Bögen der einzelnen untereinander verbundenen Ketten bestanden aus winzigen Goldfigürchen, die als vierbeinige Wesen mit gehörnten Schädeln auftraten, in Reihen hintereinander schreitend. Ich wollte nicht unziemlich starren und erkannte so nicht recht, um was für Tiere es sich handelte. Aber es gab nur wenig Zweifel, dass es sich um die miniaturisierten Pendants dessen handelte, was als Hauptstück des Schmucks unter der Kehle seiner Trägerin prangte: ein flacher Goldanhänger von Faustgröße, der wie ein Ziegenschädel mit geschwungenen Hörnern geformt war. Der Schädel schaute den Betrachter aus schaurig leeren Augenhöhlen an. Es war also kaum verwunderlich, dass ich rasch einen angenehmeren Blickkontakt suchte. Leider wohl nicht rasch genug. Die Dame lächelte mich an.
„Ein historischer albanischer Halsschmuck. Vier Jahrhunderte alt. Er soll der Fürstin Donika Arianiti gehört haben. Oder der Fürstin Mamica Kastrioti. Das ist nicht sicher belegt …“
Ich nickte. „Dann stammt er wohl aus dem Schatz von Gjergj Kastrioti, dem Herrn von Burg Kruja.“
Die junge Frau musterte mich scharf. Ich erriet ihre Gedanken. Wir hatten ohnehin Englisch gesprochen, aber eine deutliche Zusicherung, dass ihr von mir keine Boshaftigkeiten drohten, schien mir angebracht.
„Ich weiß, wer Skanderbeg, in seiner eigenen Sprache Skënderbeu, ist. Wer kennt den albanischen Nationalheros und Kämpfer gegen die Osmanen nicht? Ich bin aber weder Albaner noch Osmane. Ich bin Deutscher. Doch im Orient nennt man mich Kara Ben Nemsi.“ Natürlich hätte ich mich viel früher namentlich vorstellen müssen. Aber die junge Frau war nicht nur in ihrer Erscheinung unkonventionell, sie hatte ja auch mit der Konversation begonnen, ohne auf ein offizielles Bekanntmachen zu warten.
„Dass Sie kein Osmane sind, habe ich mir gedacht. Sie tragen keinen Fes.“ Sie lächelte. „Und ein Osmane hätte mit den albanischen Namen auch nichts anfangen können, sie wohl nicht einmal als solche erkannt. Skanderbeg ist unter ihnen vergessen.“
„Deshalb tragen Sie offen diesen Schmuck und berichten freimütig von seiner Herkunft?“
Sie nahm einen Zug von ihrer schmalen Zigarre, die sie in der linken Hand hielt. „Ein wenig Abenteuer darf man sich auch auf dem diplomatischen Parkett erlauben.“ Sie streckte ihre rechte Hand aus und bot sie mir dar. Nicht zum Handkuss, sondern zum männlichen Händedruck. Ihr Griff war fest, und die seidenen Handschuhe schmeichelten meinen Fingern.
„Qendressa Albrizzi-Teotochi.“
„Sie sind Italienerin?“
„Ich stamme aus Italien. Ursprünglich aus dem Süden. Ich bin eine Arbëresh.“
„Also eine Albanierin aus der italienischen Diaspora. Dort leben sie seit der Osmanischen Eroberung Albaniens, seit vierhundert Jahren.“
„Ich selbst nicht ganz so lange“, sagte Qendressa kokett. Sie hielt noch immer meine Hand. Wäre sie ein Mann gewesen, hätte ich vermutet, sie wolle mit mir Kräfte messen.
„Und Teotochi ist doch griechisch …?“, fragte ich, ohne auf unsere Hände zu schauen.
„Ich wuchs bei Gräfin Elisabetta Albrizzi-Teotochi auf. Sie stammte ursprünglich von Korfu und heiratete nach Venedig. Daher komme ich auch jetzt gerade.“
Ich stutzte. „Ich habe von der Gräfin gehört. Sie führte einen bemerkenswerten Salon und ein offenes Haus für Künstler. Auch Madame de Staël und Alexander von Humboldt waren bei ihr zu Gast.“
„Ich verstehe, dass Ihnen nur jene beiden Herrschaften im Gedächtnis geblieben sind, die ebenfalls Deutsche sind oder zumindest eine Verbindung zu Deutschland hatten. Vergessen Sie aber nicht die italienischen Künstler. Auch wenn die Renaissance schon länger zurückliegt, ist Italien nicht unbedeutend – gerade jetzt, als vereintes Königreich. Das dürften Sie als Deutscher nachvollziehen können.“
„Aber natürlich“, gab ich zurück. „Doch ich habe ebenso bemerkt, dass Sie sich – für eine Dame ungewöhnlich – wesentlich älter gemacht haben, als Sie offenkundig sind. Gräfin Elisabetta ist ja bedauerlicherweise vor vier Jahrzehnten von uns gegangen. So konnten Sie doch kaum bei ihr aufwachsen …“
Qendressa ließ meine Hand los und wechselte die Zigarre in die Rechte. „Ich meinte natürlich: in ihrem Haus aufgewachsen. Aber der Geist der alten Dame durchwirkt dort jeden Raum …“
„Der Geist der Gräfin. Nicht ihr Geist, wie ich doch hoffe …“ Ich wollte mit einem Scherz die unangenehme Situation auflockern. Aber Qendressa stieß die nächste Rauchwolke mit einer Vehemenz aus, die darauf schließen ließ, dass sie ungehalten war.
„Aus Venedig kommen Sie?“, sagte ich rasch. „Was führt Sie nach Istanbul?“
Sie schaute mich über die glimmende Zigarrenspitze an. „Geschäftliches.“
„Darf ich fragen, welcher Art Geschäfte?“
Qendressa lächelte herablassend. „Kommerzieller konsularischer Dienst. Ich habe ein Abschlussdiplom von der Königlichen Handelshochschule Università Ca’ Foscari in Venedig.“
Ich nickte anerkennend. Sie hob eine Augenbraue. „Dachten Sie, ich hätte Kunstgeschichte studiert oder etwas ähnlich Damenhaftes?“
„Keineswegs“, sagte ich. „Ich wusste nur nicht, dass Italien in der weiblichen Hochschulfrage schon so weit ist wie etwa England.“
„Wobei England auch noch nicht so weit ist. Aber das ist einerlei, dank meiner Herkunft kannte ich einige Herren von Einfluss, Gründungsmitglieder der Universität. Die Herren sind jung, ebenso wie die Universität. Da ist man aufgeschlossen. Das in mich gesetzte Vertrauen gebe ich nun zurück, indem ich die historisch gewachsenen Beziehungen zwischen den Osmanen und den Venezianern pfleglich unterstütze.“
„Und die historisch gewachsenen Beziehungen zwischen Venezianern und Albanern ebenso, nehme ich an?“
„Selbstverständlich!“
„Dabei sollten Sie auch nicht die britischen Beziehungen vergessen. Aber deshalb sind Sie wohl hier.“
Qendressa blickte gelangweilt durch den Saal. „Völlig richtig.“ Dann nahm sie mich wieder in den kalten Blick. „Und Sie, Kara Ben Nemsi? Wie stehen Sie zu den Briten? Ich vermeine da weniger Englisch aus Ihrem Munde zu hören, als vielmehr Amerikanisch. Sie wurden doch nicht etwa aus Washington herbeordert? Stammen Sie von hessischen Söldnern ab, die im Unabhängigkeitskrieg auf der falschen Seite standen, und wollen nun Wiedergutmachung leisten?“
„Sie besitzen nicht nur eine scharfe Zunge und einen scharfen Blick, sondern auch ein scharfes Gehör, Signorina Qendressa.“
„Sie dürfen Zonjusch Qendressa sagen.“
„Ich habe nur selten Gelegenheit, Albanisch zu sprechen.
Mein gjuha shqipe – mein Albanisch – ist darum etwas dürftig.“
„Das dachte ich mir. Aber was tun Sie denn nun? Ich bezweifle immer mehr, dass Sie Diplomat sind.“
„Ich bin Schriftsteller.“
„Ja, dann …“ Sie stieß zischend Rauch aus. „Aber gewiss kein politischer …“
„Reiseschriftsteller. Und ja: Ich war im Wilden Westen.“
„Abenteuergeschichten also. Sie sind amerikanischer, als ich dachte. Sie schreiben also wie James Fenimore Cooper? Ich erinnere mich: Halbwüchsige lesen so etwas gern, Sie dürften also durchaus Erfolg haben.“
„Das habe ich in der Tat. Aber ich schreibe keine Geschichten, sondern erzählhafte Berichte über das, was ich …“ Manchmal leide ich darunter, den Menschen stets erklären zu müssen, dass ich mir meine Abenteuer nicht ausdenke, sondern nur wiedergebe, was ich tatsächlich erlebt habe. Die Menschheit zweifelt in solchen Dingen viel zu sehr, während sie in anderen Belangen allzu leichtgläubig ist.
„… und deshalb können Sie, Zonjusch Qendressa, sich sicher sein, dass ich politischer bin, als so mancher vermeint!“
„Und das von einem Deutschen. Zwei erfolglose Revolutionen. Aber Krieg können sie. Und deshalb bin ich Ihnen sogar dankbar.“
„Wie das?“ Diese Frau erschien mir sehr seltsam.
„Weil es nur durch den Preußisch-Französischen Krieg vor ein paar Jahren möglich war, dass sich für einige kurze Monate die Pariser Kommune hat bilden können. Das war eine große Chance für die Frauen. Ich selbst habe in Italien die Gründung der Union des femmes durch Elisabeth Dmitrieff und Nathalie Lemel verfolgt – falls Sie es nicht wissen sollten, was mich nicht verwundern würde – eine russische Adlige und eine französische Buchbinderin, und ich habe Louise Michel bewundert, die selbst auf den Barrikaden kämpfte! Wie zuvor schon Olympe de Gouges während der Französischen Revolution für die Rechte der Frau und Bürgerin gefochten hat! Ihr zu Ehren trage ich auch mein Haar à la victime – Sie glaubten doch sicher nicht, es wären modische Gründe?“
Ich hatte mich damit gedanklich nicht recht befasst und der murmelnden Menge zuvor ihr Urteil belassen, ohne mich einer der Ansichten anzuschließen, was die Haarfrage anbetraf.
„Nun“, sagte ich vorsichtig, denn Qendressa war in ihren vehementen Äußerungen etwas lauter geworden, „ich schätze kämpferische Frauen und kluge Frauen. Ich habe beiderlei erlebt und kann nur sagen, dass sie gute Vorbilder für jüngere Damen sind. Und ich befürworte durchaus revolutionäre Entwicklungen, wie etwa das Wahlrecht für Frauen. Im amerikanischen Bundesstaat Wyoming wurde es 1869 eingeführt …“
„Waren Sie vor Ort?“
„Nicht direkt. Zu diesem Zeitpunkt war ich …“
„Nicht wichtig“, sagte sie. „Sie sind ja kein Journalist und hätten ohnehin nicht darüber geschrieben. Verfassen Sie ruhig weiter Ihre Geschichten. Vielleicht finden Sie unter den anwesenden Herrschaften jemanden, der etwas Interessantes zu erzählen hat. – Ach nein, Sie erleben ja selbst! Viel Erfolg dabei. Guten Abend.“
Sie funkelte mich noch einmal an und verschwand in einer Rauchwolke. So erschien es mir zumindest. Natürlich wandte sie sich um und ging, während der Tabakdunst ihrer Zigarre vor mir in der Luft schweben blieb. Ich schaute ihr nach. Jetzt erst bemerkte ich, dass ich während des Gesprächs eine recht arrogante Pose angenommen hatte, den linken Arm angewinkelt und mit den Fingern der Linken in der Westentasche. Ich hatte mit dem Anhänger meiner Uhrenkette gespielt, ohne dass es mir bewusst gewesen wäre. Gemeinhin bin ich nicht zerstreut oder gar nervös. Nun, es war eine besondere Situation und eine besondere Begegnung gewesen. Es hatte nichts zu bedeuten.
Ich spürte, wie hinter meinem Rücken jemand an mich herantrat.
„Mister Nemsi“, hörte ich eine mir bekannte Stimme. „Sie scheinen keinen rechten Schlag bei Frauen zu haben. Wenngleich ich glaube, dass man bei derlei Damen ohnehin keinen Stich landen kann.“
Ich wandte mich langsam, sehr langsam um. Vor mir stand Edward Drax Bradenham. Ich hatte den Angehörigen der Britischen Ostindien-Compagnie, oder vielmehr den ehemaligen Angehörigen der jetzt ebenfalls ehemaligen Britischen Ost-indien-Compagnie, vor einigen Wochen in der arabischen Wüste kennengelernt. Er war dort als Leiter einer archäologischen Ausgrabung für die britische Altertumsbehörde berufen. Ich hatte mit ihm gemeinsam gegen einige Banditen Al-Kadirs gekämpft, aber auch einige Wortgefechte mit ihm selbst geführt. Über die Banditen hatten wir gesiegt, wer bei unseren persönlichen Zwisten gewonnen hatte, lag wohl im Empfinden des jeweiligen Beteiligten.
Bradenham stand feixend vor mir, glattrasiert und das blonde Haar gescheitelt. Er trug ebenfalls Frack, aber statt einer der üblichen weißen, tief und rund ausgeschnittenen Westen, wand sich um seine Taille ein kamarband, eine Schärpe aus weißer Seide. Wie so viele seiner Angewohnheiten stammte dies wohl ebenfalls aus Bradenhams langjähriger Heimat und seinem früheren Wirkungsbereich, der britischen Kronkolonie Indien. Immerhin hatte er sich den Gepflogenheiten des gesellschaftlichen Anlasses gebeugt und seine Vorliebe für bunte indische Stoffmuster zurückgestellt, denn wie erwähnt war die Schärpe weiß, ebenso die Schleife um seinen Kragen.
„Mister Bradenham“, gab ich zurück, „Ihre Ausdrucksweise lässt zu wünschen übrig. Sie sollten solche gewalttätigen Vokabeln nicht im Zusammenhang mit weiblichen Wesen verwenden. Sie sind Brite und müssten menschlichen Umgang doch verinnerlicht haben. Oder ist Ihnen als Anglo-Inder jegliches Gespür abhandengekommen? Gibt es eine Mrs. Bradenham, der das Schicksal der Witwenverbrennung droht, sollten Sie nach langem Leben einmal zur letzten Ruhe finden?“
Bradenham lächelte ungerührt. „Mister Nemsi, ich kommentiere diese Dreistigkeit Ihrerseits nicht und sehe von einer Riposte gegen eine etwaige Frau Nemsi ab, die wohl ohnehin anders heißen würde. Dies ist kein Herrenabend, deswegen sollten wir auch nicht von Damen reden. Über andere Herren aber schon. Ich habe bemerkt, dass Ihre Gefährten in voller Stärke angerückt sind? Der kleine Araber, der große Türke und, das Beste zuletzt, der ehrenwerte Sir David Lindsay.“
Ich schaute an Bradenham vorbei. In einiger Entfernung sah ich seinen langjährigen Vertrauten, den britischen Hauptmann Terbut-Chegley mit seinem roten Löwenbart über der roten Galauniform neben einem großen Mann im weißen sherwani, dem indischen Pendant zum europäischen Frack, wenn man so sagen mag. Der Inder trug einen weißen Turban und einen mit Weiß durchsetzten schwarzen Bart. Er wirkte durchaus aristokratisch auf mich, und ich schien mich darin nicht zu täuschen, denn der Hauptmann neben ihm hielt sich äußerst gerade und agierte nicht so ruppig, wie ich ihn kennengelernt hatte. Der Inder sagte dann und wann etwas und der Hauptmann nickte eifrig. Ich wandte mich wieder an Bradenham. „Aber Sie sind ebenfalls nicht allein hier. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mit mir reden, während Ihr Hauptmann die Konversation mit den höheren Herrschaften besorgt. Oder sollte sich der indische Gentleman zurückgesetzt fühlen, weil er mit einem britischen Militär sprechen muss, der vielleicht unschöne Dinge in Indien getan hat?“
Bradenham zuckte mit den Achseln. „Das dürfte den indischen Herrn nicht stören. Er ist selten zu Haus, sondern treibt sich in der Welt herum, geradeso wie Sie, Mister Nemsi.“
„Eine verwandte Seele, wie schön“, gab ich ungerührt zurück. „Wer ist er denn?“
„Niemand“, antwortete Bradenham. „Niemand von Belang. Angeblich ein Prinz Dakkar, Sohn des Radscha von Bandelkhand. Aber ein jeder kann sich mit einem Titel vorstellen. Ich nehme das hin und vermeide es, die Menschen bloßzustellen, auch wenn ich es besser weiß. Ich habe ein Auge für Hochstapler.“ Bradenham legte einen manikürten Finger an die Lippen. „Da fällt mir ein – was hatte sich denn mit diesem Banditenführer ergeben, dem selbst ernannten , Mächtigen‘, jenem Al-Kadir?“
„Das hat sich erledigt“, sagte ich knapp und sprach damit nur die halbe Wahrheit aus. Aber ich hatte kein Bedürfnis, mit Bradenham über diese Sache zu sprechen. Ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, mit ihm zu sprechen, auch wenn ich einige Fragen an ihn hatte, was eine gewisse Tempelsprengung in der Wüste Al-Badiya anbetraf. Ich griff aber kurz einen anderen Aspekt auf. „Es scheint sich aber auch Ihr Engagement in der Wüste erledigt zu haben. Ist an der Ihnen übertragenen historischen Stätte alles ausgegraben, was es auszugraben gab?“
Ich möchte hier klarstellen, dass ich Archäologie schätze und für einen ehrenhaften und wichtigen Zweig der Wissenschaft halte. Ich gab leider meinem unschönen Impuls nach, den impertinenten Bradenham mit gleichen Wortwaffen zu schlagen.
Bradenham nickte. „Sozusagen. Das Camp ist aufgelöst, die Herren Archäologen und Professoren sind auf dem Heimweg. Das Geld ist aufgebraucht, und die Kisten und Köpfe sind voller Dinge und Fakten, die auf Papier eingeordnet werden müssen. Auch ich werde in die kühle Heimat zurückkehren und in der warmen Schreibstube einige Artikel für die einschlägigen Wissenschaftsjournale verfassen. Ich kann doch nicht zulassen, dass alles Papier mit Abenteuergeschichten bedruckt wird.“
Ich ignorierte diesen Hieb. In dieser Hinsicht habe ich mir eine Hornhaut zugelegt, wie der Recke Siegfried. Aber natürlich ohne Drachenblut und auch ohne Lindenblatt. Edward Bradenham würde nie mein Hagen von Tronje sein.
„Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg“, sagte ich. „Und ich hoffe, dass Sie von den Fährnissen des Veröffentlichens verschont werden, wie etwa Druckfehler oder falsches Zitieren.“
Bradenham nahm diese Anspielung gelassen hin. „Zweifellos habe ich da die besten Voraussetzungen, die man für Geld wird kaufen können. Sir David Lindsay plant einen kleinen Privatdruck über ein gewisses prächtiges altes Schachspiel, bei dem ich ihn gern textlich unterstützen werde.“
Zu ärgerlich! Davon hatte der Lord mir noch gar nichts berichtet. Aber Halef und ich hatten ihn ja auch erst vor kurzer Zeit wieder getroffen, hier in Stambul. Sir David war auf dem Weg zurück nach London gewesen, um das große Schachspiel aus Gold und Silber, welches der Mittelpunkt unseres jüngsten Abenteuers gewesen war, in ein Museum zu bringen. In das Britische oder in sein eigenes, je nachdem. Auf der Zwischenetappe am Bosporus musste er wohl Bradenham begegnet sein, oder wohl eher umgekehrt. Bradenham erkannte meine unausgesprochene Frage und lächelte.