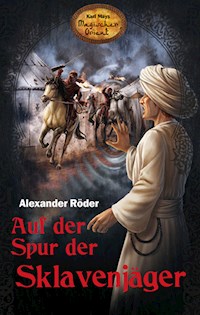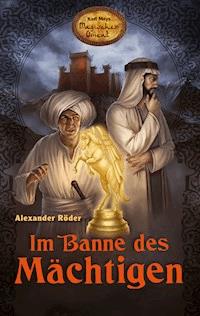Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Karl-May-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Karl Mays Magischer Orient
- Sprache: Deutsch
Nach den Kämpfen gegen den Schut und Al-Kadir trifft Kara Ben Nemsi auf die Niederländerin Marijke van Beverningh und befreit sie aus ihrer Gefangenschaft als Sklavin. Gemeinsam mit Marijke, Sir David Lindsay, Hadschi Halef Omar und Magier Haschim verfolgt er daraufhin die Sklavenhändler bis nach Katar. Dort gelingt es den Freunden zwar, sich in die Bande einzuschmuggeln, doch bald müssen sie fliehen: mitten durch die Wüste, wo sie gegen einen Dämon kämpfen, und weiter durch Zeit und Raum ins mystische Königreich von Saba. Hier wird vor allem Marijke von der intriganten Königin und ihren magischen Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Die einzelnen Teile des Episodenbandes: - Alexander Röder "An der Piratenküste" - Karl-Ulrich Burgdorf "Die Wüste des Todes" - Friedhelm Schneidewind "Die Gelehrten von Hadramaut" - Jacqueline Montemurri "Die Königin von Saba" - und ein Prolog "Eine Befreiung" von Thomas Le Blanc, Leiter der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar - und ein Epilog "Ein gesiegelter Brief" von Bestseller-Autorin Tanja Kinkel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 5
Sklavin undKönigin
vonAlexander Röder, Karl-Ulrich Burgdorf, Friedhelm Schneidewind und Jacqueline Montemurri
mit einem Prolog von Thomas Le Blanc und einem Epilog von Tanja Kinkel
KARL-MAY-VERLAGBAMBERG • RADEBEUL
Herausgegeben vonThomas Le Blanc und Bernhard Schmid
In der Reihe „Karl Mays Magischer Orient“ sind bisher erschienen:
Band 1 – Alexander Röder Im Banne des Mächtigen
Band 2 – Alexander Röder Der Fluch des Skipetaren
Band 3 – Alexander Röder Der Sturz des Verschwörers
Band 4 – Alexander Röder Die Berge der Rache
Band 5 – Alexander Röder u. a. Sklavin und Königin
Thomas Le Blanc (Hrsg.) Auf phantastischen PfadenEine Anthologie mit den Figuren Karl Mays
Weitere Informationen zur Reihe „Karl Mays Magischer Orient“finden Sie im Internet auf www.magischer-orient.karl-may.de
© 2018 Karl-May-Verlag, Bamberg
Alle Urheber- und Verlagsrechte vorbehalten
Illustration: Elif Siebenpfeiffer
Umschlaggestaltung: Petry & Schwamb, Freiburg
eISBN 978-3-7802-1405-8
www.karl-may.de
Inhalt
Prolog Eine Befreiung
Episode 1 An der Piratenküste
Erstes Kapitel Von Kairo in die Wüste
Zweites Kapitel Ahlan sadiki, Halef!
Drittes Kapitel Schurken und Schmuck
Viertes Kapitel Eine Karawane
Fünftes Kapitel In Dauha
Sechstes Kapitel Der Kapitän
Siebtes Kapitel Perlenhändler
Achtes Kapitel Ein Sklavenmarkt
Neuntes Kapitel Schwert und Peitsche
Zehntes Kapitel Freiheit oder Tod
Episode 2 Die Wüste des Todes
Elftes Kapitel Ali
Zwölftes Kapitel Der Stab der Macht
Dreizehntes Kapitel Nacht über der Wüste
Vierzehntes Kapitel Die Geisterkarawane
Fünfzehntes Kapitel Ein Hinterhalt
Sechzehntes Kapitel Ein Wiedersehen mit einem alten Feind
Siebzehntes Kapitel Der Stich des Skorpions
Achzehntes Kapitel Bitteres Wasser
Neunzehntes Kapitel Fieberträume
Zwanzigstes Kapitel Der Kuss der Schlange
Einundzwanzigstes Kapitel Die sieben Skelette
Zweiundzwanzigstes Kapitel Die Fahrt auf dem Totenschiff
Episode 3 Die Gelehrten von Hadramaut
Dreiundzwanzigstes Kapitel Ein wundersamer Empfang
Vierundzwanzigstes Kapitel Die Halle der Weisheit
Fünfundzwanzigstes Kapitel Bücher, Rollen, Pergamente
Sechsundzwanzigstes Kapitel Feuer und Schwert
Siebenundzwanzigstes Kapitel Tod und Wahnsinn
Achtundzwanzigstes Kapitel Ein magischer Zweikampf
Neunundzwanzigstes Kapitel Marijkes Musik
Dreißigstes Kapitel Eine mysteriöse Einladung
Einunddreißigstes Kapitel Durch Sand und Wüste
Episode 4 Die Königin von Saba
Zweiunddreißigstes Kapitel Das geheimnisvolle Tal
Dreiunddreißigstes Kapitel Die Königin von Saba
Vierunddreißigstes Kapitel Fremde Mauern
Fünfunddreißigstes Kapitel Abendrot über Saba
Sechsunddreißigstes Kapitel Verlockung
Siebenunddreißigstes Kapitel Offenbarung
Achtunddreißigstes Kapitel Im Sog der Königin
Neununddreißigstes Kapitel Entscheidung
Vierzigstes Kapitel Flucht
Einundvierzigstes Kapitel Nach Norden
Epilog Ein gesiegelter Brief
Über die Autoren
Thomas Le Blanc
Prolog
Eine Befreiung
Ich war erschöpft wie schon lange nicht mehr. Ich spürte, dass ich zur Bewahrung meiner inneren Kraft dringend eine längere Ruhepause benötigte, in der ich nicht ständig auf mögliche neue Gefahren zu achten hatte oder gegen böse Menschen ankämpfen musste. Mein Kopf fühlte sich leer an, meine Gedanken schweiften ständig ab, und ich tat mich schwer, mich zu konzentrieren. Meine Glieder waren schwer wie Blei, ich hing mehr auf meinem Pferd, als dass ich aufrecht saß, und ich spürte, dass ich beim Reiten einzunicken drohte. Glücklicherweise war Rih ein derart kluges Tier, dass er selber seinen Weg fand, indem er einfach Halef und dessen Pferd folgte und mich sicher durch die Berge Adschariens trug.
Hinter mir lag ein monatelanges Abenteuer, das auf dem Basar in Basra begonnen und uns in die Al-Badiya-Wüste geführt hatte, in die Dschesireh zu den Haddedihn, dann nach Istanbul, einmal quer durch den südlichen Balkan von Ost nach West bis ins österreichische Dalmatien und dann wieder von West nach Ost übers Schwarze Meer ins wilde Kurdistan und schließlich in den noch wilderen Kaukasus. Zwei schier übermächtige Bösewichter mussten besiegt werden, Al-Kadir und der Schut, und quasi nebenher zahlreichen ihrer Vasallen, Unterhäuptlinge und falschen Bewunderer das unsaubere Handwerk gelegt werden.
Und ich hatte bei diesen Abenteuern einige sonderbare Erscheinungen kennengelernt, die manche Menschen um mich herum als Magie bezeichneten, die mir aber zutiefst fremd geblieben waren, nicht in mein wohlgeordnetes Weltbild gepasst, ja, mich gelegentlich regelrecht verstört hatten. Vieles ließ sich als Aberglaube deuten, als Täuschung aufdecken, mit modernem wissenschaftlichen Denken erklären – doch blieb auch vieles für mich wie aus einer fremden Welt stammend, regelwidrig und nicht in die gewohnten Sinnzusammenhänge zwischen Natur und menschlicher Beherrschung passend. Auch waren mir einige Wesen begegnet, die aus einer anderen Schöpfung stammten, sowie Menschen, die allein dem Bösen huldigten, dem Chaos Vorschub leisteten und der Versuchung nachgaben; und nicht gegen all diese Mächte halfen meine Fäuste und meine Feuerwaffen – aber zuletzt doch mein Glaube an das Gute im Menschen.
In all diesen Monaten war mein treuer und tapferer Gefährte Halef mir stets zur Seite gewesen, und den größten Teil des Weges hatte mich mein ebenso treues Pferd Rih getragen. Mit dem aus königlichem Haus stammenden Scheik Haschim gewann ich in dieser Zeit einen neuen und engen Freund, dem ich mittlerweile auch mein Leben anvertrauen würde. Welchen Platz allerdings die Hexe Qendressa in meinem Leben eingenommen hatte, wusste ich nach all ihren mehr als widersprüchlichen Aktionen nicht zu sagen. Und zum Schluss hatte sogar die allgütige Marah Durimeh geholfen, dass die unvermeidlichen Überbleibsel des Bösen sich doch noch in etwas Nützliches verwandelten. Stets auf Ausgleich und auf Frieden bedacht, hatte sie mit ihrem mächtigen Wort Streitende versöhnt und vor allem Qendressa ihres Fluchs enthoben, sodass diese nun erstmalig die Chance bekam, sich für ein neues selbstbestimmtes Leben zu entscheiden – wobei wir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wussten, ob sie sich der weißen Seite ihrer Hexenexistenz zuwenden konnte oder ob Marah Durimeh ihr all ihre Zauberkräfte genommen hatte.
Ich war jetzt all dieser Begegnungen und Erfahrungen müde und nahm mir ganz egoistisch das Recht, nur noch nach Hause zu wollen. Mein Leben sollte wohl ein einziges Abenteuer sein, erlebt auf allen Kontinenten und gefordert durch vielfältige Gefahren, aber niemand konnte ständig unter Hochspannung leben, und auch mein Lebensmotor benötigte Ruhepausen, wenn er sich nicht verkanten oder heißlaufen wollte.
Außer Halef begleitete mich noch David Lindsays wagemutige Nichte Ann aus dem Kaukasus heraus nach Batumi, einer alten Stadt mit Tiefwasserhafen in der Südostecke des Schwarzen Meers, die zwar noch zum Osmanischen Reich gehört, nach der das zaristische Russland aber längst seine machtvolle Hand ausgestreckt hat. Dort sollte Lindsays privater Dampfer warten, mit dem ich hoffte, zur gegenüberliegenden Meeresküste, nämlich zum Mündungsdelta der Donau, zu gelangen, um dann ein Linienschiff zu besteigen, das mich flussaufwärts bis nach Preßburg oder Wien befördern sollte. Den restlichen Weg nach Radebeul würde ich mich der immer besser vernetzten Eisenbahn anvertrauen.
In dieser beschaulichen sächsischen Kleinstadt, in der ich nicht mit dem Revolver unter dem Kopfkissen und dem Bowiemesser griffbereit neben dem Bett schlafen musste, gedachte ich zunächst eine ganze Woche lang Schlaf nachzuholen, außerdem wieder einmal deutsche Küche zu genießen – und dann all die spannenden Abenteuer noch einmal im Geiste nachzuerleben, während ich sie für meine Leser niederschrieb.
Wir waren am frühen Abend noch in dem Küstengebirge, das Batumi umschließt, da gelangten wir in ein zwar kleines, jedoch recht ansehnliches Dorf, an dessen Eingang uns ein pfiffiger Junge abfing und uns und unseren Pferden den Han seiner Familie zur Übernachtung anpries. Er gestaltete seine Werbung so eloquent, dass selbst der wortgewandte Halef schmunzeln musste. Da ich keine Sehnsucht nach der lauten und geschäftigen Hafenstadt verspürte, beschlossen Halef und ich, hier im Dorf zu nächtigen. Ann Lindsay mokierte sich ein wenig über meine Müdigkeit; sie war so munter, dass sie allein weiterreiten wollte, um den Hafen nach dem Schiff ihres Onkels abzusuchen und ihn auf unser Kommen am Folgetag vorzubereiten. Um beweglicher zu sein, ließ sie das Packpferd, auf dem sich auch ein Teil ihrer Ausrüstung befand, in unserer Obhut.
Der Junge schilderte die Ställe und das Essen in den rosigsten Farben; die Zimmer sollten nach seinen Worten sogar mit richtigen Betten ausgestattet sein. Der Han stellte sich uns tatsächlich als ein recht großes Anwesen vor, mit einem zweistöckigen Haupthaus, zwei Anbauten, mehreren Ställen, die einen Hof umschlossen, sowie weiterem umzäunten Gelände drumherum, das zur Aufnahme von Pferden, Zugochsen, Kamelen und sogar Ziegen Platz bot. Doch als wir die Zimmer besichtigten, erwiesen sich die von dem Jungen als Betten bezeichneten Schlafstätten als auf dem Holzfußboden liegende Tierbälger, die mit altem Stroh gefüllt waren, das an einigen Stellen längst herausbrach, und die darauf liegenden Wolldecken waren von Schmutz durchzogen und zerschlissen. Außerdem musste man nicht zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass diese sogenannten Betten bereits bewohnt waren: von einem munteren Völkchen blutsaugender böcekler, wie der Türke sie nennt: Insekten, Kerfen aller Art, vornehmlich zur den Menschen und seinen Lebenssaft liebenden Gattung der Bett- oder Hauswanzen gehörig. Solche aktiven Bettgenossen wollten wir allerdings meiden.
Da war es im für die Pferde vorgesehenen Stall um vieles sauberer und angenehmer; deshalb wählten wir ihn für unser Nachtlager. Statt altem Stroh gab es hier frisches Heu, und auf Rihs kräftigen Flanken zu liegen war dermaßen bequem und beruhigend, dass ich – obwohl es erst früher Abend war – binnen weniger Augenblicke eingeschlafen war, während Halef noch vor sich hin plapperte und sich ärgerte, den Lockrufen des Jungen am Dorfeingang gefolgt zu sein:
„Sihdi, meinst du nicht, ich sollte diesem Halbwüchsigen, dessen Großmaul dem weit offenen Rachen eines kaukasischen Bären gleich ist, die heilsamen Segnungen meiner freundlichen Kurbatsch zuteil werden lassen, um ihn auf den Allah wohlgefälligen Pfad der Wahrhaftigkeit …“
Weiteres hörte ich nicht mehr, da der antike Gott Morpheus mich bereits in seine sanften Arme genommen hatte.
Doch wenn ich auch rasch eingeschlafen war, so bedeutete das nicht, dass mein Gefahreninstinkt ausgeschaltet war. Mitten in der Nacht wachte ich von einem Geräusch auf, das ich zunächst nicht identifizieren konnte, und spürte auch eine leichte Unruhe bei Rih, dem ich sogleich mit einem sanften Streicheln zeigte, dass ich aufmerksam geworden war, woraufhin er sich sofort wieder entspannte.
Am Eingang des Stalls, nur halb beleuchtet von einer Öllampe, die an einem Wandhaken hing, stand eine kleine Gruppe von Personen, die sich in unterdrückter Lautstärke stritten. Neben einem hochgewachsenen Mann, der in einen teuren Reisemantel gekleidet war und sichtlich nicht zu den Armen dieser Welt gehörte, standen drei von Kopf bis Fuß verhüllte Personen, in denen ich aufgrund der Art ihrer Kleidung und der devoten Haltung dem Mann gegenüber seinen Harem vermutete. Soweit ich das im Halbdunkel erkennen konnte, trugen sie alle einen Tschador, den traditionellen dunklen Umhang, der ihren gesamten Körper verbarg, und auch von ihren Gesichtern konnte ich aufgrund eines Tuchs nur einen Augenschlitz erkennen. Der Mann mochte ein Kaufmann sein, der mit seinen Frauen reiste und in diesem Han noch zu sehr später Stunde eine Unterkunft suchte.
Ich lag im Dunkeln und halb im Heu, sodass ich vom Eingang her kaum ausgemacht werden konnte; aufgrund meines niedrigen Blickwinkels hatte ich aber auch keine optimale Sicht auf das Geschehen. Dennoch nahm ich wahr, dass, während zwei der Frauen mit gesenktem Kopf und weitgehend unbeweglich neben ihrem Herrn standen, die dritte offensichtlich wegen irgendeiner Sache heftige Widerworte gab und sich in keiner Weise unterwürfig oder demütig zeigte, wie das sonst Frauen im Orient taten. Der Mann ließ sich aber nur einmal einen Widerspruch auf seine Vorhaltung gefallen, beim zweiten Mal fuhr er die Frau so deutlich an, dass sie sofort sichtlich zusammenzuckte und verstummte. Ich konnte zwar kein Wort der Auseinandersetzung verstehen, erkannte jedoch mit wachsender Anspannung, wie der Mann derart in Rage geriet, dass die zwei anderen Frauen sich leise zur Seite schoben und dabei versuchten, sich kleinzumachen, um den zu erwartenden Auswüchsen seiner Wut zu entgehen. Er griff nun die dritte Frau körperlich an, packte sie grob mit beiden Händen, drehte sie herum, beugte sie nach vorne, sodass ihr Oberkörper fast in die Waagrechte kam, schob ihre dunkle Bekleidung an den Hüften etwas hoch und klappte das gesamte mehrlagige Unterteil ihres Habits dann über ihren Rücken, sodass unvermittelt ihr nacktes Gesäß zu sehen war. Dann holte er aus und begann sie mit der flachen Hand auf ihr Hinterteil zu schlagen.
Nun verhält es sich leider so, dass Frauen, die schon in den europäischen Ländern nicht alle Rechte von Männern besitzen, im Orient sogar vollkommen rechtlos sind, als Eigentum ihres Ehemannes angesehen werden, dem sie in allen Dingen gehorchen müssen und der auch über ein jederzeitiges und nahezu unumschränktes Züchtigungsrecht verfügt. Für einen Fremden ist hierbei eine Einmischung eine unmögliche Angelegenheit, dennoch konnte und wollte ich nicht zulassen, dass diese Frau – gleich ob sie tatsächlich irgendeine Schuld auf sich geladen hatte oder nicht – derart gedemütigt und verletzt wurde.
Ich wählte eine anonyme, aber dennoch wirksame Einmischung. Ich stupste Rih ein wenig an, sodass er geräuschvoll schnaubte, sich regte und aufstand, zeigte mich aber weiterhin nicht, um das Delikate der Situation nicht herauszufordern.
Der Mann reagierte unmittelbar. Er erkannte die Silhouette eines sich bewegenden Pferdes und konnte sich nicht länger sicher sein, allein zu sein. Blitzschnell warf er die Bekleidung der Frau wieder herunter und richtete ihren Körper gerade auf, denn natürlich durfte kein Fremder einen Körperteil seiner Frau sehen und schon gar nicht einen solch intimen. Dann schob er seine Frauen zusammen, rief verärgert nach seinen Dienern und verschwand aus meiner Sicht.
Jetzt erst erhob ich mich, schlich mich zum Stalleingang und lugte vorsichtig hinaus. Ich sah ihn, wie er sich nun Richtung Haupthaus des Hans bewegte. Dort standen seine Reit- und Packpferde, die seine Diener nicht in den Stall, in dem ich mich befand, sondern in einen eigens abgesteckten Corral neben dem Haus trieben. Zwei Diener verblieben dort zur Bewachung; der Mann, seine drei Frauen und ein weiterer Mann begaben sich ins Haus.
Ich verfügte mich nun wieder in den hinteren Teil des Stalls und versuchte, für den Rest der Nacht neuen Schlaf zu finden – was mir aufgrund der miterlebten entwürdigenden Szene erst nach einer Weile gelang. Halef hörte ich schnarchen; er hatte von all dem nichts mitbekommen.
Am nächsten Morgen wurde ich schon früh wach. Da ich in der Nacht bei Rih eine ihn schmerzende Stelle gespürt hatte, führte ich ihn sogleich hinaus, um mir die mögliche Verletzung bei Tageslicht genauer anzuschauen. Sie erwies sich als ein nicht unerheblicher Hautriss an der Bauchunterseite, vermutlich beim Durchreiten eines Gebüschs durch besonders harte Dornen verursacht. Es war eine an sich harmlose Verletzung, die aber dann gefährlich werden konnte, wenn sie sich entzündete. Da der Riss jedoch recht lang war, musste er außerdem Schmerzen verursachen, und die wollte ich Rih wenn möglich ersparen. Ein Brei aus keimtötenden Kräutern, der zudem das Eindringen von Schmutz verhinderte, sollte ihm Linderung und Heilung bringen.
Ich redete beruhigend auf ihn ein, da meine Untersuchung wohl auch nicht ganz schmerzlos gewesen war, und erklärte ihm, dass ich mich um die Wunde kümmern wollte. Dabei formulierte ich meine beruhigenden Worte, ohne mir zunächst dessen bewusst zu sein, in Deutsch. Offenbar war ich doch noch nicht ganz wach. Rih mochte sich vielleicht wundern, nicht die gewohnten arabischen Laute zu hören, da es aber in unserer Kommunikation ohnehin auf den Tonfall und nicht auf die Wortinhalte ankam, zeigte er mir, dass er meine Zuneigung und mein Verständnis für seine Schmerzen verstand.
Gerade in dem Augenblick, da ich mit Rih sprach, gingen die drei verhüllten Frauen, begleitet von einem Diener, an mir vorbei und strebten offenbar auf die hinter dem Stall befindliche Latrine zu. Hier hatte der Hanci, der Besitzer des gastlichen Anwesens, statt einen Latrinengraben auszuheben, einfach an die Rückseite des Stalls drei Holzkisten stellen lassen, neben die Pfähle in die Erde gerammt waren, um sich daran festhalten zu können. Man hockte sich für seine Notdurft einfach über diese Holzkisten, und mit dem Wasser aus einem daneben stehenden Eimer konnte man sich anschließend reinigen. Die tragbaren Kisten ließen allerdings vermuten, dass die Einrichtung nicht allein der Bequemlichkeit diente. Die menschlichen Fäkalien fanden offenbar ebenso wie der tierische Dung aus dem Stall Verwendung als Dünger auf den Feldern.
Eine der drei Frauen zuckte, während sie an uns vorbeiging, kurz zusammen und wendete ihren Kopf ein wenig in meine Richtung, ging aber ebenfalls weiter. Hatte sie etwa auf meine deutschen Worte reagiert? Ich blickte den Frauen zunächst hinterher, bis sie hinter dem Stall verschwunden waren.
Ich war allerdings neugierig geworden, was meine kleine Beobachtung bedeutete – und ob sie überhaupt etwas bedeutete. Deshalb tat ich so, als untersuchte ich Rih noch immer, und sprach auch weiter auf ihn ein. Er hatte gegen diese bleibende Zuwendung natürlich nichts einzuwenden, und da Halef noch den Schlaf des Gerechten schlief, hatte ich auch alle Zeit der Welt für mein Abwarten.
Und tatsächlich geschah etwas.
Die drei Frauen und ihr männlicher Begleiter kamen nach einer Weile denselben Weg wieder zurück. Eine der Frauen begann plötzlich ihre Schritte etwas kürzer anzulegen, sodass sie, genau als die Gruppe mich passierte, ein wenig hinter den anderen zurückblieb. Sie schob sich außerdem etwas näher an mich heran, und während sie an mir vorbeiging, hörte ich sie in deutscher Sprache flüstern: „Rettet mich, Effendi! Ich wurde als Sklavin verkauft …“ Dann war sie vorbei.
Hier am Rande des Kaukasus deutsche Worte, fern von Deutschland, am östlichen Ende des Osmanischen Reichs, ausgesprochen von einer vollverschleierten Frau, die zum Harem eines türkischen Herrn gehörte! Ich war zutiefst erschrocken darüber, dass ich hier in meiner Muttersprache um Hilfe gebeten wurde. Doch mehr noch als die unerwartete deutsche Sprache hatte mich das Wort „Sklavin“ in Aufregung versetzt, und es stand für mich sofort außer Frage, dass ich helfen, dass ich die Frau retten musste, selbst wenn ich mich dabei in Gefahr begab! Ich sah es als meine Pflicht an, alles Menschenmögliche zu tun, um einen anderen Menschen, der in akuter Not war, daraus zu befreien – nur wer nicht wegsieht, wird der Verantwortung, die jeder für seinen Umkreis hat, auch gerecht. Eine solche Aufgabe spornte außerdem sofort meinen Tatendrang an!
Bei den wenigen Worten meinte ich, eine dialektale Färbung herausgehört zu haben, die ich aber noch nicht zuordnen konnte. Deshalb konnte ich auch nicht sagen, ob die Frau tatsächlich eine Deutsche war oder vielleicht eine Europäerin, die aus einem Nachbarland stammte und Deutsch zu sprechen gelernt hatte.
Jetzt ging es darum, möglichst rasch einen brauchbaren Plan zu entwickeln, wie dieser Frau zu helfen – ja, wie sie zu befreien war! Dazu benötigte ich Halef, dazu benötigte ich mehr Informationen über ihren Herrn und was er heute vorhatte, und dazu musste ich außerdem irgendeinen Trick ersinnen, wie ich die Frau über meine Vorgehensweise in Kenntnis setzen konnte, ohne dass gleichzeitig jemand anderer meiner Absichten gewahr wurde.
Wie aufs Stichwort sah ich Halef jetzt aus dem Stall kommen, sich noch ein wenig verschlafen reckend, aber bereits voll mit seinem fröhlichen Tatendurst und seinem alltäglichen Optimismus. Ich winkte ihn zu mir her, führte Rih aus dem Hof des Hans heraus auf eine freie Wiese, wo ich ihn grasen ließ, und berichtete dort Halef in aller Kürze, aber doch vollständig, was ich heute Nacht gesehen und heute Morgen gehört hatte.
Ich hatte recht daran getan, dass wir uns etwas vom Han entfernt hatten, denn Halef machte seinem Zorn sofort mittels einer Schimpftirade Luft. Seine Ehrerbietung für seine geliebte Ehefrau Hanneh übertrug er gerne auch auf andere Ehefrauen: Kein Ehemann durfte seine Angetraute schlecht behandeln!
Impulsiv, wie er nun mal war, wollte er außerdem sofort lospreschen: „Wir stürmen ins Haus, lassen den prügelnden Herrn meine Kurbatsch spüren und nehmen ihm seine Frau einfach weg. Er hat ja immer noch zwei. Außerdem“ – und hier dachte er nur logisch – „ist der Agha doch viel besser dran, wenn er sich mit einem solch widerspenstigen Wesen nicht länger herumärgern muss. Wir befreien ihn sogar von einer Last.“
„Lieber Halef“, bremste ich ihn, „man kann einem Mann seine Frau nicht so einfach wegnehmen, selbst wenn er sie schlecht behandelt. Wir setzen uns damit ins Unrecht.“
„Aber, Sihdi, er schlägt sie! Und auch noch auf den nackten …! Ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Und sie sagt, dass sie seine Sklavin ist.“
„Ja, deshalb will ich ihr ja auch helfen. Aber nicht so, dass wir anschließend verfolgt werden und sie somit Gefahr läuft, wieder zu ihrem Ehemann zurückgebracht zu werden. Das würde ihr Los nur noch schlimmer machen. Wir müssen ihre Befreiung auf eine Weise arrangieren, dass kein Verdacht auf uns fällt und sie außerdem so verschwindet, dass man sie nicht mehr auffinden kann. List geht immer vor Gewalt.“
Jetzt lächelte er verschmitzt. „Du willst mit mir einen Plan schmieden.“ Dann setzte er sich auf die Wiese. „Also lass uns schmieden!“
Ich schmunzelte und folgte seinem spontanen Platznehmen. So saßen wir uns mit untergeschlagenen Beinen gegenüber. Rih blickte einen Moment verwundert zu uns hinunter, dann aber erlosch sein Interesse wieder und er kümmerte sich mehr um die vereinzelten süßen Kleepflanzen, die sich zwischen dem härteren Gras herauszupfen ließen und eine herrliche Frühstücksbeilage abgaben.
In wenigen Worten erörterten wir die Möglichkeiten, die sich uns boten – in Art und Zeitpunkt allerdings davon abhingen, wie lange der Mann mit seinen Frauen noch bleiben wollte. Halef, der ja selten um ein Wort verlegen ist, brachte deshalb zunächst durch einen kleinen Plausch und ein etwas größeres Bakschisch beim Hanci in Erfahrung, dass der Agha ein vermögender anatolischer Kaufmann war, der mit seinem Harem, zwei Dienern und einem Eunuchen reiste und irgendwelche Waren zu verkaufen hatte – der Gastwirt wusste allerdings nicht welche, und wollte es wohl auch nicht wissen. Im Laufe des Tages erwartete dieser Agha noch einige geschäftliche Gesprächspartner, die mögliche Käufer seiner unbekannten Waren sein mochten. Deshalb wollte er auch noch mindestens eine Nacht im Han bleiben. Wir hatten also Glück.
Im Augenblick saß der Agha bei einem opulenten Frühstück im großen Gastraum des Hans und ließ sich vom Wirt bedienen. Sein vom Eunuchen bewachter dreiköpfiger Harem war auch dabei, saß jedoch etwas abwartend abseits und bekam seine Speisen erst nach dem Agha serviert.
Ich ging nun gemeinsam mit Halef ebenfalls in den Gastraum hinein und inszenierte dort ein mit ihm abgestimmtes Gespräch, das dazu gedacht war, wichtige Informationen an unterschiedliche Personen zu übermitteln.
Ich sprach zunächst den Hanci an, aber so, dass alle anderen anwesenden Personen das Gespräch mitbekamen: „Mein teures Pferd hat sich eine kleine Verletzung zugezogen. Könnt Ihr uns eine Kräuterfrau oder einen Apotheker hier im Ort nennen?“ Gleichzeitig winkte ich Halef heran, der ein paar Münzen in seiner Hand spielen ließ.
Der Wirt, von einem offenbar weitgereisten Effendi so höflich angesprochen, beeilte sich natürlich, behilflich zu sein, beschrieb den kurzen Weg zu einer Kräuterfrau im Dorf und nahm dafür dankend das bescheidene Bakschisch entgegen.
Daraufhin sprach ich zu Halef: „Geh und hole zum Einreiben etwas Beinwell, aber möglichst keine Tinktur, sondern als Salbe. Und übermittle der Kräuterfrau noch die lateinischen Angaben zur Zubereitung: ‚Schützt Bauchschmerzen vor und geht mehrfach zur Latrine, wir holen Euch hier heraus.‘ Sie weiß dann Bescheid, wie sie die Salbe anrühren soll.“
Ich hatte zwar zu Halef gesprochen, aber in türkischer Sprache und so laut, dass alle anderen es mitbekommen mussten. Eine Salbe aus aufgekochten und mit Bienenwachs versetzten Beinwellwurzeln war bei Verletzungen von Mensch und Tier ein gebräuchliches Mittel, das auch jeder besseren Kräuterfrau vertraut sein musste. Insoweit handelten wir vollkommen unauffällig. Der eingeschobene, angeblich lateinische Satz wurde von mir aber in deutscher Sprache ausgesprochen. Die versklavte Ehefrau würde ihn sicher verstehen, da sie mich ja auf Deutsch angesprochen hatte. Da alle anderen Anwesenden aber mit hoher Wahrscheinlichkeit weder Deutsch noch Latein sprachen, würde der Sinn der Worte von sonst niemandem aufgenommen werden.
Halef nickte, sprach ein eifriges „Ich eile, Sihdi!“, und war schon zur Tür hinaus.
Es dauerte keine halbe Stunde, bis er wieder zurückkam. Nun inszenierten wir mitten im Hof des Hans eine langwierige Einreibeprozedur mit zwischenzeitlichen leichten Bewegungsübungen mit Rih. Die Frau hatte uns offenbar verstanden, denn kaum waren wir eine Weile zugange, verließ sie schon das Haus, begleitet vom Eunuchen, und ging hastig hinter den Stall. Wir schauten uns unauffällig um, doch leider waren noch zu viele Personen in der Nähe, sodass wir diesmal nicht eingreifen konnten und die Frau nach dem Besuch der Latrine wieder unbehelligt ins Haus zurückgehen lassen mussten. Dabei bemühten wir uns, es so aussehen zu lassen, als ob wir uns weiterhin um Rih kümmerten.
Ihren Mann sahen wir nun das Haus verlassen und allein ins Dorf gehen. Da er uns keines Blickes würdigte, schien er sich auch nicht dafür zu interessieren, was wir machten. Möglicherweise waren seine Geschäfte etwas halbseiden, und er wollte nicht dadurch Aufmerksamkeit auf sich lenken, indem er uns ansprach. Wir hofften natürlich, dass die Frau seine Abwesenheit jetzt ausnutzte, und tatsächlich mussten wir nicht lange warten, da kam sie erneut heraus, während der sie begleitende Eunuch jetzt einen sichtlich verärgerten Eindruck machte.
Diesmal waren wir allein auf dem Hof.
Wir folgten zur Latrine, und als sich beide Personen hinter dem Stall befanden und somit vom Haupthaus aus nicht mehr sichtbar waren, wollte ich den Eunuchen mit meinem Jagdhieb auf seine Schläfe ausschalten. Darin war ich besonders geübt, und deshalb hatte man mir im Wilden Westen den Kriegsnamen Old Shatterhand gegeben: die Schmetterhand. Doch Halef kam mir zuvor. Mit einem Grinsen im Gesicht warf er über den Mann eine Handvoll von einem magischen Pulver. Und tatsächlich bewegte der Eunuch sich plötzlich nicht mehr, schaute mit leeren Augen in die Luft – und bekam erkennbar nicht mehr mit, was um ihn herum geschah. Halef hatte offenbar irgendwo einen Verwirrungszauber erstanden, den er jetzt einsetzte. Gewitzt, wie er war, fand er auf unseren Reisen immer wieder einen Händler, der ihm Utensilien für praktische Alltagsmagie besorgte.
Jetzt musste alles sehr rasch geschehen! Ich spürte fast, wie unser Blut etwas schneller in unseren Adern kreiste und wie mich die Aufregung belebte. Eine Haremsentführung war schon eine heikle Angelegenheit, die – wenn sie denn herauskam – böse ins Auge gehen konnte.
Mit einem leisen und knappen „Komm!“ zogen wir die Frau einen schmalen Seitendurchgang entlang in den hinteren Bereich des Stalls hinein, wo Halef bereits aus dem Gepäck von Ann Lindsay eine Hose und ein Paar Schuhe, von mir ein Hemd und eine Jacke und von sich selbst ein Turbantuch bereitgelegt hatte. Die Frau nahm zunächst ihr um den Kopf gebundenes schwarzes Tuch ab und öffnete ihren Tschador, und uns bot sich nun ein weiblicher Kopf mit heller Gesichtsfarbe und harten, leidenden und tiefeingeschnittenen Zügen, meerblauen Augen und kurzgehaltenem blonden Haar. Die Frau war keine 30 Jahre alt.
„Mein Name ist Marijke van Beverningh, ich stamme aus Utrecht. Ich wurde vor drei Jahren entführt und auf einem arabischen Sklavenmarkt verkauft“, sagte sie nur. Eine Niederländerin also, deshalb der Akzent.
Ich stellte mich mit meinem deutschen Namen vor und ergänzte dann: „Hier im Orient nennt man mich jedoch Kara Ben Nemsi. Ich bin auf der Heimreise nach Deutschland und kann Ihnen eine Passage auf einem britischen Dampfer anbieten, der in Batumi im Hafen wartet.“
Sie nickte knapp, dann schlüpfte sie bereits aus ihrem Habit. Beim nun erforderlichen Umkleiden ging es um ihr Leben, da war Scham fehl am Platz, und so vermochten Halef und ich uns lediglich aus Höflichkeit ein wenig zur Seite zu drehen. Während ich mit einem scharfen Pfiff Rih herbeirief, begann Halef schon die Lasten des Packpferds neu zu verteilen, damit es nun auch eine Reiterin tragen konnte. Wir bekamen aus den Augenwinkeln mit, wie die Niederländerin in Windeseile die Kleidung wechselte, und für einen Augenblick – bevor sie das bereitgelegte Hemd überzog – erblickte ich auf ihrem nackten Rücken eine ganze Landschaft mit halbverheilten Narben als auch frischen und offenen Striemen, die von beständigen Züchtigungen ihres Mannes zeugten. Halef hatte ihr bei der Kräuterfrau außerdem noch einen Tiegel mit irgendeiner Paste besorgt, die sie nun auf Gesicht und Hände auftrug, um eine dunkle Hautfarbe vorzutäuschen. Währenddessen trat Halef wieder zu ihr und wickelte ihr einen Turban um den Kopf, unter dem das blonde Haar verschwand. Binnen weniger Augenblicke hatte sie eine vollständige Verwandlung ihrer äußeren Erscheinung vorgenommen: Mit Jacke, Hose und Turban mochte sie, wenn man sie nicht allzu genau betrachtete, nun als Mann durchgehen. Und nach meinem bisherigen Eindruck schien sie auch die Nerven dazu zu besitzen, das mit ihrer Körperhaltung vorzutäuschen.
Wir führten unsere Pferde aus dem Stall, und während die Niederländerin und ich auf dem Hof unsere Pferde bestiegen und den Han bereits zügig verließen, ging Halef noch einmal ins Haupthaus zum Hanci, um unser Nachtlager plus einige verzehrte Lebensmittel zu bezahlen – und tat das, ohne wie sonst noch einmal um den Preis zu feilschen. Dann folgte er uns. Es begann ein angespannter Ritt.
Das Risiko, dass es möglicherweise jemandem auffiel, dass jetzt wieder eine dritte Person bei uns war, nachdem Ann Lindsay uns doch gestern verlassen hatte, erschien mir nicht allzu groß. Wir konnten einen heimischen Führer gedungen haben, oder unsere Begleitung war gerade wieder zurückgekehrt, um uns abzuholen, oder jemand, der dasselbe Ziel hatte, mochte sich uns angeschlossen haben – harmlose Erklärungen gab es durchaus, außerdem würde kaum jemand alle Reisegruppen durchzählen oder sich überhaupt für sie interessieren. Noch konnte das Verschwinden der dritten Haremsfrau nicht ruchbar geworden sein.
Der Eunuch würde sich, sobald er aus seiner Erstarrung erwachte und entdeckte, dass die Frau, auf die er zu achten hatte, auf dem gesamten Gelände des Hans nicht mehr auffindbar war, vermutlich ohne Lärm und unverzüglich in die Berge schlagen. Denn er musste sicher sein, dass der Zorn seines Herrn sich zunächst auf ihn richten würde und ihn vielleicht sogar das Leben kosten konnte. Wenn wir Glück hatten, verdächtigte der Agha vielleicht sogar den Eunuchen, seiner Frau zur Flucht verholfen zu haben, und verfolgte ihn. Dennoch konnten wir nicht wissen, ob wir nicht doch von irgendjemandem beobachtet worden waren, den wir nur nicht bemerkt hatten. Wir hatten lediglich einen Vorsprung, den wir klug nutzen mussten.
Nicht hastig, aber doch mit raschem Trab durchritten wir nun das Dorf, ohne dort dem Agha zu begegnen, und machten uns auf den direkten Weg nach Batumi. Außer Sichtweite des Dorfs hätten wir gerne unsere Pferde zu einer schnelleren Gangart angetrieben, doch das war auf dem mittlerweile stark bergabwärts gerichteten Weg zur Hafenstadt leider nicht möglich. Die Berge engten Batumi sehr ein, sodass alle Wege von der Topografie her steil angelegt waren. Es ging jetzt also langsamer voran, als uns lieb war, doch natürlich wollte sich niemand den Hals brechen. Außerdem begann es diesig zu werden, was die Sicht beeinträchtigte. Der Wind, der beständig vom Schwarzen Meer her wehte, brachte viel Feuchtigkeit mit, die an den Berghängen wieder kondensierte.
Wie ich es bei meinen Abenteuern nicht selten erlebt habe, erfuhr jedoch unsere Befreiungsaktion nun eine Belohnung durch eine himmlische Hand, und es bewahrheitete sich das Sprichwort, dass das Glück stets dem Tüchtigen zuteil wird. Denn kaum waren vor uns die Umrisse von Batumi schemenhaft hinter der feuchten Luft zu erkennen, kam uns auch schon Ann Lindsay entgegengeritten. Sie hatte das Schiff ihres Onkels entdeckt, hatte auch mit ihm gesprochen und wollte uns nun den Weg zum Liegeplatz des Dampfers weisen.
Wir hielten für einen Augenblick an und setzten sie mit wenigen Worten von unserem Abenteuer in Kenntnis. Daraufhin stimmte sie mit uns überein, dass wir nicht nur rasch, sondern vor allem gründlich verschwinden mussten, und zwar bevor wir in Verdacht gerieten. Sie führte uns mitten durch die ausgedehnten Teeplantagen, die Batumi an den Berghängen säumen und unsere Nasen mit einem herrlichen Aroma umfingen. Nachdem wir die ersten Häuser der Stadt passiert hatten, gelangten wir dann ohne größere Umwege durch die verwinkelten Straßen und Gassen in den ausgedehnten Hafen und dort zur Mole, an der der Dampfer festgemacht hatte. Von der architektonischen Schönheit der Stadt, die in der Antike das Tor zum sagenhaften goldreichen Land Kolchis gewesen sein soll, bekam ich deswegen nichts mit.
Am Anlegeplatz angekommen, gab Ann dem Kapitän sofort die Order, den Kessel zu befeuern, und als der Lord entspannt und in frischgebügeltem Karo vom Sonnendeck herunterkam, um uns zu begrüßen, waren wir schon abgestiegen, hatten die Pferde um das Gepäck erleichtert und führten sie vorsichtig über die Planken auf das Vorderdeck.
Lindsay breitete die Arme weit aus, um mich zu begrüßen, und achtete dabei weder auf Halef noch auf unsere unbekannte Begleitung. „Master Kara, welch eine Freude, Euch zu sehen!“
Ich unterbrach ihn: „Verzeiht meine Unhöflichkeit, die Begrüßung können wir gleich nachholen. Wir haben eine Begleiterin aus dem Königreich der Niederlande, die wir ihrem Mann entführt haben und die sofort außer Landes muss.“ Ich deutete auf die verkleidete Frau van Beverningh. „Könnt Ihr Befehl zum sofortigen Auslaufen geben? Wir erklären Euch anschließend alles.“
Da Lord Lindsay es gewohnt war, in meiner Gegenwart die spannendsten Abenteuer zu erleben, reagierte er blitzschnell und befahl den Kapitän zu sich. Die gesamte Mannschaft war bis auf zwei Matrosen an Bord, und da die beiden sich glücklicherweise in Schiffsnähe am Kai aufhielten, konnten sie mit ein paar kurzen Pfiffen herbeigerufen werden. Unser restliches Gepäck sowie noch an Land befindlicher Schiffsproviant wurden binnen Minuten verladen, dann wurde die Planke eingezogen, die Taue wurden gelöst, und da das Schiff im Hafen keinen Anker gesetzt hatte, sondern nur vertäut gewesen war, konnte es sofort langsame Fahrt aufnehmen. Mit Abmeldungen bei der Hafenmeisterei nahm es ein Kapitän sowieso nicht so genau, und da die Liegegebühr für eine Woche im Voraus entrichtet war und die Zollbeamten noch ihre ausgedehnte Mittagspause hielten, kümmerte sich auch keine Behörde um den plötzlich davonreisenden englischen Dampfer.
Noch stand der Kessel nur unter mäßigem Dampf, sodass auch die Fahrtgeschwindigkeit noch zu wünschen übrig ließ. Aber der Kapitän beorderte zwei zusätzliche Matrosen in den Kesselraum, um ordentlich zu befeuern, sodass das Schiff dann doch an Fahrt nach Westen aufs offene Meer hinaus aufnahm.
Als alle Aufregung sich ein wenig gelegt hatte und die Häuser der Stadt immer kleiner wurden, lud Lindsay uns auf das Oberdeck ein, um erstmal gemeinsam Tee zu trinken, Tee aus Britisch Indien, und ließ auch ein paar Sandwiches dazu reichen: natürlich aus Rücksicht auf Halef ohne Schinken, stattdessen mit hellem Putenfleisch, Ei und Salatblättern, wahlweise mit oder ohne georgischen Ziegenkäse, sowie natürlich das unvermeidliche Teesandwich mit Gurke und Ei. Für das Toastbrot hatte Lindsay übrigens eigens einen britischen Bäcker statt eines Kochs an Bord genommen, wie er verriet, denn er hatte das orientalische Fladenbrot für eine Zeitlang über.
Ich stellte nun Marijke van Beverningh vor, die sich bereits die dunkle Paste etwas aus dem Gesicht gewaschen hatte und jetzt ohne Turban zwischen uns saß, und bat sie, ausführlich zu berichten, was ihr widerfahren war. Denn auch ich kannte ja nur den allerletzten Teil ihrer Geschichte.
„Mein Mann stammte aus einer Familie von Kunstschreinern und führte in Utrecht eine Möbelmanufaktur in vierter Generation“, begann sie in fließendem Englisch, das ich für Halef leise ins Arabische übersetzte. „Er stellte hochwertiges Privatmobiliar her, war auch spezialisiert auf Restaurierungen von Möbeln und führte deshalb ein großes Lager mit den verschiedensten, auch exotischen Holzarten, das ständig aufgefüllt werden musste. Vor etwa drei Jahren hatte ich meinen Mann auf einer Einkaufsreise in den Orient begleitet, außerdem war sein jüngerer Bruder bei uns. In Larnaka auf Zypern charterte er ein Schiff komplett mit Mannschaft, mit dem wir nach dem libanesischen Tarabulus übersetzen wollten, um dort vor allem Zedernholz und Zypresse einzukaufen und das dann auf dem Seeweg zurück in die Niederlande zu bringen.“
Sie machte eine Pause, dann fuhr sie mit belegter Stimme fort:
„Etwa auf halber Strecke, mitten auf dem Meer, enttarnte sich der Schiffskapitän als Pirat. Er nahm meinem Mann all sein Geld ab, das er für den Holzeinkauf bei sich führte, tötete ihn und seinen Bruder, indem er beiden mit einem Säbel den Kopf abschlug, warf die Leichen über Bord und nahm mich gefangen. Statt nach Tarabulus, das zur osmanischen Provinz eines christlichen Mutasarrif gehörte und wo ich vielleicht noch Hilfe bekommen hätte, wurde ich zum weiter nördlich liegenden Hafen von Tartus gebracht, das eine jahrhundertelange Seeräubertradition besitzt, und dort an einen Araber verkauft – ja, ich habe gesehen, wie der Kapitän Geld für mich bekam. Dieser Araber, dessen Namen ich nie erfahren habe, verschleppte mich bis nach Abu Dhabi, wo ich zusammen mit vielen anderen geraubten europäischen Frauen auf einem öffentlichen Sklavenmarkt angeboten wurde.“
Ich hörte Halef leise grummeln und fluchen, während der Lord erregt aufstand und seinem Zorn laut Luft machte: „Ich werde dem Vertreter der britischen Admiralität in Istanbul Meldung machen. Zypern gehört zwar noch nicht uns, aber wir verhandeln mit der Hohen Pforte und haben auch bereits Flottenteile in Larnaka stationiert. Madam, wenn Ihr mir angeben könnt, wie das Schiff hieß, das Euer ermordeter Gatte gechartert hatte, dann könnten wir da vielleicht ansetzen.“
Natürlich war sie an einer Auffindung und Bestrafung des Piratenkapitäns interessiert – doch sie wollte mehr, viel mehr. Die drei Jahre hatten ihren Mut und ihre Willenskraft keineswegs gebrochen. Sie schien mir eine unbeugsame Frau zu sein, denn sie brannte förmlich darauf, etwas gegen diesen Handel mit Europäerinnen zu unternehmen. Wenn man ihrem Bericht folgte, gab es regelrechte geheime Sklavenkarawanen, mit denen von der Mittelmeerküste bis zu den Emiraten an der Piratenküste des arabisch-persischen Golfs gefangene europäische Frauen transportiert und dort an reiche Araber verkauft wurden. Das schien ein einträglicher Wirtschaftszweig geworden zu sein, offenbar noch lukrativer als der einstige Handel mit männlichen Arbeitssklaven aus Schwarzafrika, und dieses verabscheuungswürdige Geschäft wurde auch von den Emiren der Trucial States, der mit dem britischen Empire vertraglich verbundenen Fürstentümer am Golf, mehr oder weniger offen geduldet.
Sie war zunächst von einem arabischen Scheik ersteigert worden, aber – wie sie es trocken ausdrückte: „Er hatte wohl keine rechte Freude an mir.“ Sie hatte sich keinen Augenblick lang unterwürfig gezeigt, hatte sich gegen all seine Begehren heftigst gewehrt und war von ihm nicht zu bändigen gewesen. Da sie körperlich recht stämmig gebaut war und ihn um Kopfeslänge überragte, hatte er sich auch nicht getraut, sie zu schlagen. Sie hatte ihm wohl schließlich Angst gemacht, was er sich natürlich nicht eingestehen konnte. Deshalb hatte er sie bereits nach wenigen Wochen dem türkischen Agha zum Geschenk gemacht, der sie dann gegen ihren Willen nach islamischem Ritus heiratete und als dritte Ehefrau legal seinem Harem einverleibte.
Was folgte, war ein einziges Martyrium. Er nahm sie mit ins nördliche Anatolien, in einen kleinen Ort an der Schwarzmeerküste, wo er wohnte und ein einträgliches Handelsgeschäft mit Waren aller Art führte. Sie wurde Tag für Tag gedemütigt, geschlagen, eingesperrt. Ihre Aufsässigkeit spornte ihn nur zu noch mehr Grausamkeiten an. Doch sie hatte nicht fliehen können – wie und wohin auch, denn nach osmanischem Familienrecht war sie seine rechtmäßige Ehefrau, und als Frau besaß sie sowieso keine Rechte.
Zur Art ihrer Folter und zum Ausmaß ihren Demütigungen äußerte sie sich nicht, an dieser Stelle verstummte sie und ihr Gesicht versteinerte. Sie war zwar erkennbar eine starke Frau, aber es überforderte sie dennoch, darüber zu reden – wofür wir natürlich Verständnis hatten. So war sie während der weiteren Fahrt sehr einsilbig und verschlossen. Sie zeigte Kälte und Härte nach außen und ließ weder Gefühle heraus, noch Mitleid an sich heran.
Nach zwei Tagen steuerte der Dampfer wieder die Küste an, wo wir Halef und Rih sowie die weiteren Pferde in Iyidere nahe Rize absetzten. Von dort aus wollte er quer durch Anatolien nach Hause zu den Haddedihn in der Dschesireh reiten. Der Abschied fiel mir nicht leicht – aber ich wusste, wir würden uns beim nächsten Abenteuer im Orient wiedersehen.
Eine gute Woche später kam wenige Meilen vor der europäischen Küste die weißleuchtende Schlangeninsel, die Insula Serpilor, in Sicht, jener unrühmliche Ort, wo sich gerade einmal zwanzig Jahre zuvor die Flotten der westeuropäischen Großmächte gesammelt hatten, um an der Seite des Osmanischen Reichs gegen das zaristische Russland in den Krimkrieg zu ziehen – in einen Krieg, bei dem doppelt so viele Opfer an Krankheiten und Seuchen starben wie durch die eigentlichen Kriegshandlungen. Auch ich hatte den romanhaft ausgeschmückten Bericht meines Berliner Kollegen Hermann Goedsche gelesen, der unter dem Pseudonym Sir John Retcliffe und mit dem Titel „Sebastopol“ als vierbändiger Romanzyklus erschienen war. Er hatte damals den Krimkrieg als Journalist vor Ort erlebt. Ich nahm mir vor, meinen Verleger auf ihn aufmerksam zu machen.
Dann gelangten wir am Donaudelta in den Hafen von Sulina, wo ich erfuhr, dass ich bereits zwei Tage später ab Tulcea eine Passage auf einem Dampfer bekommen konnte, der mich donauaufwärts brachte.
Lindsay versprach mir, Marijke van Beverningh zur Königlich-Niederländischen Botschaft in Istanbul zu bringen und ihr in der Stadt auch einen fürsorglichen Arzt zu suchen – und zu bezahlen. Sie umarmte mich spontan zum Abschied und dankte mir noch einmal für ihre Befreiung. Diesmal sah ich einige wenige Tränen in ihren Augen.
Ob sie für ihre Peiniger nun Rache oder Bestrafung wollte, das wusste ich da noch nicht. Aber ich hatte in mir das sichere Gefühl, dass sich unsere Wege wieder kreuzen würden.
Etwa fünf Monate später bekam ich von ihr einen Brief, den sie nach Radebeul gesandt hatte. Sie hatte tatsächlich eine Spur der Sklavenhändler gefunden und konnte genau angeben, wann eine weitere Sklavenkarawane mit europäischen Frauen in der Nähe von Katar eintreffen würde. Und sie bat mich um Hilfe, weil sie nicht wusste, wem sie in den Emiraten trauen konnte. Marijke van Beverningh wartete in Kairo im britischen Konsulat auf mich.
Ich fühlte natürlich sofort wieder das Brennen nach Abenteuer in mir. Also schickte ich einen Brief an Halef und einen an Scheik Haschim voraus. Dann vertraute ich mich der Eisenbahn an, um nach Triest zu gelangen.
Alexander Röder
Episode 1
An der Piratenküste
Erstes Kapitel
Von Kairo in die Wüste
Ich stand an der Reling des französischen Dampfers Hirondelle, der mich über das Mittelländische Meer geflogen hatte. Vor mir sah ich: Ägypten!
Doch ich kam nicht als Forscher in dieses Land, wollte nicht den Spuren von Richard Lepsius folgen, des aus Naumburg gebürtigen Begründers der deutschen Ägyptologie. Auch kam ich nicht als Tourist, mit dem Reiseführer von Baedeker in der Tasche. Gewiss kam ich auch nicht als Eroberer wie Napoleon. – Ich kam als Befreier. Dies mag groß und mächtig klingen, und tatsächlich verspürte ich auch ein erhebendes Gefühl, dass ich nicht allein als Abenteurer hierherkam, doch gab es da auch einen Fakt, der mich wiederum ernüchterte. Jene, die es zu befreien galt, waren mir gänzlich unbekannt. Ich wusste nicht, wo sie sich befanden, und auch nicht, wer sie gefangen und versklavt hatte. Was mein Wissen betraf, so herrschte in mir also die sprichwörtliche ägyptische Finsternis, doch war es mir wie stets gegeben, die Dunkelheit zu erleuchten, mit der Fackel der Rechtschaffenheit und der Flamme des Tatendrangs. Meine Leser mögen mir verzeihen, dass ich so sehr die Tugenden beschwöre und mich dem Pathos hingebe. Sie müssen aber eines verstehen, selbst wenn ich es ihnen kaum erklären muss. Ich war nun nach langer Zeit in der Heimat wieder in der Fremde, oder vielmehr: in der Ferne, denn der Orient ist mir keineswegs fremd.
Doch schwindet die Vertrautheit mit der Ferne, und jene knappe Hälfte eines Jahres, die ich jüngst in Deutschland, in Sachsen, im Meißner Land, in Radebeul verbracht hatte, war doch recht zehrend gewesen. Denn ich hatte lange Stunden, bei Tag und in der Nacht, in meiner Schreibstube gesessen und meine jüngsten Erlebnisse zu Papier gebracht; am Ende würden diese vier nicht wenig umfangreiche Romane füllen. Ich hatte während dieser Niederschrift noch einmal alles erlebt, was sich in der Wüste jenseits von Basra, in den Schluchten und Wäldern des Balkan und den Bergen Kurdistans und des Kaukasus zugetragen hatte: die Kämpfe gegen den Schut, gegen Al-Kadir und die Hexe Qendressa, die ich mit meinen Gefährten Halef, Haschim und Sir David gemeinsam gefochten hatte. Und die vielen Begebenheiten mit erstaunlichen Menschen und an seltsamen Orten.
Doch ein Stuhl am Schreibpult ist kein Sattel, und eine Schreibfeder ist kein Säbel. Die Feder mag auf ihre Art eine mächtige Waffe sein, doch spuckt sie nur Tinte und kein Blei wie Henrystutzen oder Bärentöter. Und die Stube, das Haus, die Straße, die Stadt sind beschauliche Orte im Vergleich zu den Höhlen und Burgen und Türmen, in denen allerlei Schurken hausten oder Hinterhalte legten. Die behagliche Wärme von Kamin und Herd ist kein vorsichtig geschürtes Lagerfeuer, ein Federbett ist keine Satteldecke. Und die karge Kost des Reisenden und Abenteuers schwindet vor der Fülle der sächsischen Speisen.
Es mag nun niemand glauben, ich hätte angesetzt und wäre faul gewesen. Aber nein! Wiegebraten und Wickelklöße, saure Fleck und Spinat mit Sardellen, Stockfisch mit Erbsen, Bratwurst mit Äpfeln, aber auch die bescheidenen Kartoffeln mit Quark und Leinöl waren mir köstliche Gerichte, mit denen ich mich für die geistige Arbeit stärkte. Aber so wie der Kopf viel Nahrung benötigt, braucht der Leib seine Betätigung. Und so wanderte ich zum Ausgleich durch die Sandsteinhöhen des Erzgebirges und den dunklen Tann und dachte mir beim Atmen der kühlen Luft so manches Mal: Dort, der Fels – gemahnt er nicht an die Karstgebirge im Land der Skipetaren? Der alte Turm, erinnert er mich nicht an den Karaul des Schut? Das verwitterte Forsthaus, scheint es nicht wie die Berghütte, in welcher ich die Hexe traf? Überall fühlte ich mich an meine Abenteuer erinnert und eilte sogleich wieder an den Tisch, um mit Wort und Schrift alles festzuhalten. Und wenn der Schweiß ebenso geflossen war wie die Tinte aufs Papier, belohnte ich mich hernach mit Kaffee und auch mit Kuchen.
Doch nun hatte ich die heimeligen Blümchentassen und schweren Hefegebäcke hinter mir gelassen. Es riefen Kahwe und Baklawa! Doch deren Süße würde ich mir erst verdienen müssen.
Die Seeluft hatte mich belebt und allen Schreibstubenstaub und Bücherseitendunst hinfortgeblasen. Ich hatte daheim alles aus mir herausgeschrieben, nun fühlte ich mich frisch und neu wie ein Bogen Papier, der jüngst aus der Bütte geschöpft worden war. Ich hatte zuhause kaum bemerkt, wie das Fernweh sich gemehrt hatte: Jetzt packte es mich mit Macht.
Und neu und ungewohnt war auch, wie bereits erwähnt, dass mich nun nicht die reine Abenteuerlust antrieb. Ich war nicht in meiner Profession als Reiseschriftsteller hier, sondern nahte als Helfer heran. Und dies auf den Ruf jener Frau hin, die ein schweres Schicksal erlitten hatte, welches sie mit meiner Hilfe jedoch glücklich hatte überwinden können, und die nun danach trachtete, auch anderen bedauernswerten entführten und versklavten Frauen zur deren Freiheit zu verhelfen: die tapfere und kluge holländische Dame Marijke van Beverningh.
Deshalb ihr brieflicher Ruf nach mir und deshalb meine Reise nach Kairo.
Drang und Not hatten aus den Zeilen gesprochen, und so eilte ich zu Beistand und Hilfe. Man mag mir nachsehen, dass ich daher nicht in schwelgende Beschreibungen verfalle, wie es dem Reiseerzähler gemeinhin geziemt. Doch wer kann Land und Leute, Sitten und Gebräuche, Bauten und Natur mit schönen Worten malen, wenn die harsche Ungerechtigkeit das Leben Unschuldiger bedroht?
Darum sei mein Weg nur knapp beschrieben: Ich ging von Bord, nutzte Bahn und Wagen – und stand dann vor der Botschaft der Briten in Kairo, zwischen den Zähnen eine Stange Bamberger Süßholz, denn wenn ich unterwegs bin, rauche ich nur in Gesellschaft.
Ich war vom Staub der Reise bedeckt, hatte eine kleine Tasche mit dem Nötigsten an der Hand und einen Seesack über der Schulter, aus dem zwei lederumhüllte Stangen ragten. So konnte es dem Unwissenden erscheinen. Mancher Brite, der mich sah, mochte an seinen nationalen Schlagballsport denken; wer mich kannte, wusste jedoch, dass es nur mein Henrystutzen und der Bärentöter sein konnten. Auf vielerlei mag ich auf Reisen und Abenteuern verzichten können, doch nicht auf diese treuen Gewehre.
Dass ich nun recht schwer, wenngleich nicht offen bewaffnet in eine Botschaft spazieren durfte, war allein der Tatsache zu verdanken, dass ich einen reichen und angesehenen Fürsprecher hatte und erwartet wurde.
Eilig führte mich eine Ordonnanz in einen kleinen Raum, der britisch und schlicht-orientalisch zugleich wirkte. Ich hatte keinen Blick für die Details, aus eingangs geschilderten Gründen, aber in diesem Augenblick des Eintretens konnte ich auch kaum einen Blick ringsum werfen, denn das Zimmer wurde von einer ganz bestimmten Person dominiert.
Sir David Lindsay kam mir entgegen, groß, dünn und in graukariertes Tuch gekleidet wie stets. Er begrüßte mich freundlich, auch erleichtert, aber ein wenig fahrig, sodass sich eine kurze Szene der Unbeholfenheit ergab:
Ich hatte im ersten Moment ja keine Hand zum Schütteln frei und musste doch das Gepäck ablegen, als ein Griffwechsel nicht taugte.
„Well“, begann Sir David eifrig, „Ihr seid da, glücklich und letztendlich. Die Fahrt war gut, ja? Aber was rede ich, Ihr seid ein erfahrener Reisender, so wie ich – warum mit small talk aufhalten, indeed!“
Er schritt zu einem kleinen Tisch und griff zu den Gläsern und Flaschen. Ich lehnte den Whisky ab, selbst wenn die Tageszeit angemessen war, und beschied mich mit Sodawasser. Sir David jedoch sah sich genötigt, seine Nerven zu stärken. Er schaute auf die kleine Uhr auf dem Schreibtisch.
„Es ist nicht mehr viel Zeit. Gleich kommt Mrs. van Beverningh …“
Der Lord schaute für meine Begriffe nicht wie jemand, der seine Sekretärin erwartet, sondern …
Ich muss an diesem Punkt wohl einiges erläutern: Sir David hatte mir vor einem halben Jahr einen Brief gesandt, in dem er mich über all das informiert hatte, was seit unserem Abschied geschehen war. Er hatte Marijke van Beverningh wie versprochen nach Istanbul begleitet und sich auch dort ihrer angenommen, was er in onkelhafter Anteilnahme schilderte: Zunächst hatte er einige Ärzte, sowohl örtliche hekims als auch ausländische doctors geprüft, um die Dame mit deren Hilfe von ihren Strapazen und Wunden genesen zu lassen. Dann hatte er sie zur Königlich-Niederländischen Botschaft begleitet, damit sie neue Papiere erhielt und von dort aus ein Lebenszeichen in die Heimat senden konnte – und auch die betrübliche Kunde übermitteln musste, dass der Ehemann und dessen Bruder zu Tode gekommen waren.
Während der Wartezeit und der Heilung zeigte Sir David sich großzügig und selbstlos wie gewohnt, sorgte für Kleidung, Nahrung, Logis. Doch die Dame war trotz ihres Schicksals ungebrochen und stolz. Sie nahm die milden Gaben nur an, weil sie diese sogleich umwidmete und gewissermaßen auf ein moralisches Soll-Konto übertrug, nein, um genau zu sein, führte sie sogar tatsächlich Buch und notierte alles, forderte Quittungen und Belege – um alles später zu begleichen. Dies rührte wohl von ihrer Ehe mit dem holländischen Geschäftsmann her, vielmehr kam es aber aus ihrem eigenem Wesen, das durch die schrecklichen Erlebnisse noch verstärkt worden war. Sie hatte in der Sklaverei kein Mitleid erfahren und wollte es nun auch nicht erhalten, lehnte die Gaben und Zuwendungen zwar vernünftigerweise nicht ab, führte aber strenge Rechnung.
„Aber wie“, klagte mir Sir David, „sollte ich ihr denn Rechnungen und Quittungen vorlegen, wo ich mich doch um dergleichen nie kümmern muss? Ich bin reich – ich setze nicht auf Skonto bei Barzahlung oder spiele mit Fristen. Ich habe kaum je Rechnungen in der Hand gehalten, und wenn, dann habe ich sie doch nicht gesammelt und abgelegt, sondern beglichen, und dann waren sie mir aus Augen und Sinn.“ Er seufzte. „Das hat Mrs. van B. mir ausgetrieben …“
Endlich war dann Nachricht aus der holländischen Heimat gekommen – man war erfreut über das Lebenszeichen, betrübt über den Tod der Männer. Drei Jahre hatte man Schlimmes geahnt, doch die Geschäfte hatten weitergehen müssen, und so hatte ein Onkel die Firma übernommen.
„Dies nahm sie ungerührt hin“, bemerkte Sir David, „zumal die Firma unter der neuen Leitung florierte. Sie urteilte daraufhin, dass sie in Utrecht wohl nicht gebraucht würde, wenn dort alles zum Besten bestellt sei. Dafür könne sie dann Rache nehmen.“ Sir David leerte sein Glas und schluckte hart. „Kara Ben Nemsi, wir haben ja selbst gegen viele Schurken gekämpft und waren oft genug von Rache getrieben …“
Ich schaute ihn mahnend an.
„Nun“, korrigierte er, „das ist mir manchmal unterlaufen, wenn ich mein Englischsein vergessen habe. Das bringt orientalischer Umgang so mit sich …“
„Wenn man die Anlagen dazu hat, Sir David. Ihr wisst, dass es mir anders ergeht.“
„Ja, Ihr seid manchmal mehr Brite als ich, obgleich Ihr Deutscher seid. – Wie haltet Ihr es eigentlich mit den Rechnungen und Belegen?“ Er winkte ab. „Well, Mrs. van B. hatte von da an zwei Ziele: ihre Rache an den Sklavenhändlern – und es mir heimzuzahlen.“ Er schenkte sich Whisky nach. „Natürlich nur auf die Gelder bezogen, die ich für sie ausgelegt hatte. Nein – ich habe gern bezahlt. Sie selbst meinte, ich habe es nur ausgelegt und sie wolle dies abarbeiten. Deswegen drängte sie mich dazu, sie als Dolmetscherin einzustellen.“
„Eine treffliche Idee“, sagte ich, und als der Lord empört schaute, fügte ich an: „Weil sie doch eine in vielen Sprachen bewanderte Dame ist. Wenn ich mich recht erinnere, waren das neben Holländisch und Deutsch eben Englisch und auch Französisch, dazu Türkisch und Arabisch.“
„Ihr sprecht noch mehr Sprachen. Wozu brauche ich dann eine Dolmetscherin?“
„Ich bin aber nicht immer bei Euch, Sir David.“
„Das ist wahr. Und deshalb habe ich zugesagt. Zu einem sehr hohen Gehalt.“
„Doch nicht, damit die Schuld rasch abgeglichen ist?“
„Nein, weil sie auch gleichzeitig als Sekretärin und Gesellschafterin arbeitet. Sie hat eine hervorragende Handschrift, da brauche ich mich nicht mit meinem Reiseschreibpult abplagen.“
„Aber warum Gesellschafterin? Sie schien mir nicht sehr gesprächig, was angesichts ihres Schicksals verständlich ist. Und seit wann benötigt Ihr selbst zerstreuende Unterhaltung?“
„Nun, es ist wahr. Sie redet nicht viel. Aber liest umso mehr.“
„Ihr wollt jetzt nicht auf meine eigenen Bücher anspielen, Lord!“
„Keineswegs. Es geht ihr um Akten und Briefe und allerlei mehr. Das klingt aber offizieller, als es ist. Wir waren nicht in Archiven und Kontoren – oder eben doch. Sie hat die Geschäftsbeziehungen ihres seligen Gemahls genutzt, um hier und da anderen Geschäften nachzuspüren als dem Handel mit edlen Hölzern.“
„Sklaven.“
„Gewiss. Wir waren auf Zypern und im Libanon, zuvor eben in Istanbul und nun Kairo.“
„Mir scheint, Ihr seid vielmehr der Reisebegleiter und Gesellschafter der Dame als umgekehrt.“
„Nun, der Geldgeber mag ich sein. Die Informationen zu erlangen, kostete nicht nur Zeit, sondern auch Bakschisch. Der kam aber nicht auf das Konto der Dame. Davon konnte ich sie überzeugen. Ebenso, dass ich ihr ohne Entgelt das Schießen beigebracht habe. Sie wollte unbedingt mit Gewehr und Revolver umgehen können.“
„Das kann man ihr nicht nachtragen, nach all dem, was sie erlebt hat“, meinte ich. „Und da sie weiterhin in diesem Erdteil verblieben ist, in dem sich ihre Peiniger herumtreiben. Ich hoffe aber, dass sie gewissenhaft …“
„Aber sicher doch“, unterbrach mich Sir David – obgleich er mich völlig missverstanden hatte: „Ich habe Mrs. van B. im Zielen und Schießen und der Waffenpflege unterrichtet und sie mit einem schönen Taschenrevolver von Webley & Son of Birmingham bedacht.“ Er musterte mich und senkte die Stimme. „Keine Waffe für Männer, wie wir es sind. Aber eine Dame kann wohl kaum einen großen Armeerevolver mit sich herumtragen.“ Sir David nickte nachdrücklich. „Dennoch ist Mrs. van B. gut gerüstet. Der Webley hat zwar nur fünf Schuss in der Trommel, aber nun, jene, die auf ihn schwören, nennen ihn British Bulldog, und das sagt so einiges – und macht mich nachgerade stolz.“
„Euer Stolz hat nicht leiden müssen? Wollte Mevrouw van Beverningh das Geschenk nicht partout bezahlen?“
„No, no. Ich konnte sie an ihrem Namenstag damit überraschen. Und sie weiß wohl, dass wir Briten heikel sind, wenn es um Jagdutensilien geht.“
„Aber Ihr habt doch gemeinhin nach Altertümern gejagt?“
„Meine neue Beute sind Piraten und slave-traders. Ich sehe dies sehr persönlich. Das Empire hat sich mit den anderen Europäern dafür eingesetzt, dass der Handel mit Sklaven im Reich der Osmanen verboten wurde. Doch leider ist das Geschäft zu lockend, da es viel Geld einbringt. Also wird das Verbot schändlich ignoriert. Es hilft wohl nur, die Bestien zu jagen, welche den hilflosen Frauen nachstellen. Und der beste Jagdgefährte dafür werdet Ihr sein, Kara Ben Nemsi.“
Da öffnete sich die Tür. Sir David zuckte zusammen und warf einen Blick auf die Uhr.
In den Raum trat Marijke van Beverningh.
Ihr Blick war so meerblau wie je und von gleicher Härte, wenngleich ihre leidgeprägten Züge durch die vergangenen Monate der Freiheit sich etwas gemildert hatten. Energisch und entschlossen waren ihr Kinn und die spitze Nase noch immer. Ihr blondes Haar war in den vergangenen Monaten wohl gewachsen, doch sie trug es streng aufgesteckt. Streng war auch ihre Kleidung, es war das, was man einen hunting-dress nannte, ein britisches Jagdkostüm mit eng taillierter Jacke, deren lange Knopfleiste wie aus Gewehrkugeln gebildet wirkte, und einem langen Rock, unter dem jedoch keine damenhaften Schnürstiefelchen hervorlugten, sondern eben robuste Reitstiefel. Die Farbe von Stoff und Leder war ein dunkles Khaki, über dem das helle Gesicht, das helle Haar leuchteten, die Augen aber waren nur hell von Farbe, nicht vom Blick, mit dem ich gemustert wurde.
„Sie sind da, Mijnheer Kara. Seien Sie bedankt“, sagte Marijke van Beverningh. Sie war groß, und wenn ich auch bei unserem ersten Treffen bemerkt hatte, wie stämmig ihr Körperbau auch nach den Jahren des Leidens war, so schien sie nun mir selbst an Muskeln kaum nachzustehen. Ihr harter Händedruck bestätigte mir dies, als wir uns begrüßten. Diese Frau konnte Sir David wohl nicht nur als Sekretärin dienen, sondern auch als Leibwächterin. Jetzt fiel ihr Blick auf den Seesack.
„Eure Waffen. Sehr gut.“
Ich nickte. „Gewiss sind es keine Golfschläger. Wenngleich ich bemerkenswert finde, dass das Wort golf dem holländischen kolv ähnelt, welches …“
„Ich würde die Sklavenhändler auch mit Keulen schlagen, Mijnheer Kara. Aber eine Kugel ist rascher. Warum sich mühen und die Hände beschmutzen?“
„Gewiss …“
„Und wir sollten keine Zeit und keinen Atem mit dem verschwenden, was die Briten als small talk bezeichnen. Und zudem die Botschaft verlassen. Wir brechen auf. Wir haben eine weite Reise vor uns.“
„Ich habe bereits eine hinter mich gebracht. Sie riefen mich und ich eilte.“
Sie musterte mich. „Noch einmal, seien Sie bedankt. Aber Sie können verschnaufen, wenn wir am Golf von Persien angekommen sind. An der Piratenküste.“
Zweites Kapitel
Ahlan sadiki, Halef!
Ich glaubte nun nicht, dass uns Zeit zum Verschnaufen bliebe, wenn wir erst den Landstrich erreicht hätten, an dem die Sklavenhändler ihr Unwesen trieben – ja noch weniger, wenn wir ihnen auf die Spur gekommen wären. Aber ich erkannte in den Worten der Holländerin den drängenden Wunsch, endlich Kairo zu verlassen. Wir würden uns also nach Katar begeben, zum Emirat auf jener Landzunge, die in den Golf von Persien ragt. Gewiss begann die sogenannte Piratenküste erst viel weiter östlich, in Abu Dhabi. Aber im übertragenen Sinne sind auch Sklavenhändler auf Kamelen nichts anderes als Seeräuber, die mit ihren Wüstenschiffen die Sandmeere unsicher machen.
Wir traten unsere Reise zu Pferd an. Die Dame vervollständigte ihre Jagdkleidung mit einem Hut, der ihr Gesicht beschattete, zudem trug sie ein Schleiernetz vor dem Gesicht. Sir David hatte mir enthüllt, dass sich die Holländerin in der Öffentlichkeit stets auf diese Art verhüllte. Ich vermutete, dass sie sich in den Jahren ihres Sklaventums so sehr an einen Schleier gewöhnt hatte, dass sie dergleichen weiterhin freiwillig trug. Vielleicht lag ich mit meiner Interpretation auch falsch. Schließlich ist ein dünner Schleier in Europa durchaus ein modisches Beiwerk der Damen, nicht nur bei Bräuten oder Witwen. Eine Witwe war die Holländerin nun bedauernswerterweise, doch war ihr Schleier nicht schwarz und das Trauerjahr vorüber. Ich will nicht weiter über die Hintergründe spekulieren, denn es passte zum Wesen der Dame, die sich verschlossen und unnahbar zeigte, was mir nichts weniger als verständlich war. Bemerkenswert fand ich aber, dass Mrs. van B. – wie Sir David sie ja mit gewissem Respekt nannte, welcher an Ehrfurcht zu grenzen schien – im Damensattel ritt. Ich hatte dergleichen lange nicht gesehen, im Orient ohnehin nicht, doch auch in Europa ritten Damen gemeinhin auf „deutsche Art“, wie man eigenartigerweise die männliche Art zu reiten in Frankreich, Spanien und anderswo bezeichnet. Auf den Britischen Inseln hingegen hält man an der weiblichen Art des Pferdereitens für das weibliche Geschlecht fest, und so hatte Sir David nur allzu gern dem Wunsch entsprochen, einen Damensattel verfertigen zu lassen. Die Anekdote über den erstaunten arabischen Sattler erzählt der Lord bei Gelegenheit noch immer gern, ich aber will hier niemanden ob seiner Unwissenheit der Lächerlichkeit preisgeben. Ich hingegen war erstaunt, dass Sir David eine Art Leibwache mit sich führte, bestehend aus zwei schottischen Sergeanten, McIlroy und McMurray mit Namen. Diese ähnelten einander, waren wohl auch seit Langem miteinander vertraut und kleideten sich, nein, nicht im Kilt, im Schottenrock, sondern angemessen in Uniform für die Tropen, jedoch ohne ihre Herkunft zu verleugnen, denn ein jeder hatte eine Schärpe in seinen Klansfarben um den Leib gewunden. Ich wollte nun nicht scherzen, dass Sir David niemanden neben sich duldete, der gänzlich kariert gemustert einherging. Beide Schotten waren angemessen bewaffnet, mit Revolvern und Karabinern, und sie trugen sogar Klingen an der Seite, schottische Schwerter mit Korbgriff, die