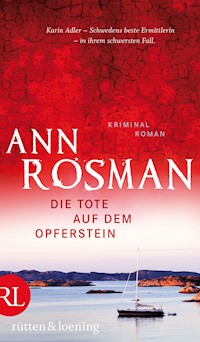9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Karin Adler ermittelt
- Sprache: Deutsch
Brennende Wellen vor Orkney.
Karin Adler ist schwanger und sollte kürzertreten, doch als vor den Orkneyinseln ein verlassenes Segelboot mit Blutsspuren an Deck gefunden wird, bitten die Kollegen der schottischen Polizei um ihre Hilfe, denn der vermisste Bootseigner ist Schwede. Auf der Suche nach dem ehemaligen Pioniertaucher Bosse fliegt Karin kurzentschlossen nach Stromness – und bald darauf treibt eine Leiche am Strand an. Nur, dass diese so gar nicht in das Bild des erfahrenen Seglers passen mag. Noch ahnt Karin nicht, dass der Fall sie tief in die Vergangenheit in das Jahr 1916 führen wird, als ein Panzerkreuzer der Royal Navy einer Mine auflief. Der angebliche Schatz an Bord: 55 Tonnen Gold ...
„Ein Kriminalroman, den man so schnell nicht wieder aus der Hand legen kann.“ Göteborgs-Posten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Brennende Wellen vor Orkney
Karin Adler ist schwanger und sollte kürzertreten, doch als vor den Orkneyinseln ein verlassenes Segelboot mit Blutsspuren an Deck gefunden wird, bitten die Kollegen der schottischen Polizei um ihre Hilfe, denn der vermisste Bootseigner ist Schwede. Auf der Suche nach dem ehemaligen Pioniertaucher Bosse fliegt Karin kurzentschlossen nach Stromness – und bald darauf treibt eine Leiche am Strand an. Nur, dass diese so gar nicht in das Bild des erfahrenen Seglers passen mag. Noch ahnt Karin nicht, dass der Fall sie tief in die Vergangenheit in das Jahr 1916 führen wird, als ein Panzerkreuzer der Royal Navy einer Mine auflief. Der angebliche Schatz an Bord: 55 Tonnen Gold ...
„Ein Kriminalroman, den man so schnell nicht wieder aus der Hand legen kann.“ Göteborgs-Posten
Über Ann Rosman
Ann Rosman ist passionierte Seglerin, die es auf ihren Langsegeltouren unter anderem bis zu den Äußeren Hebriden geführt hat. Sie hat Universitätsabschlüsse in Computertechnologie und Betriebswirtschaft absolviert. Als Aufbau Taschenbuch liegen von ihr vor: „Die Tochter des Leuchtturmmeisters“, „Die Tote auf dem Opferstein“, „Die Wächter von Marstrand“ und „Die Gefangene von Göteborg“. Ann Rosman lebt auf Marstrand, wenn sie nicht gerade durch die Weltgeschichte segelt. Mehr zur Bestsellerautorin unter: www.annrosman.com
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ann Rosman
Der Fluch von Orkney
Aus dem Schwedischen von Annika Krummacher
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Zitat
Prolog — 5. Juni 1916
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Nachwort
Quellen und Danksagung
Mündliche Quellen
Schriftliche Quellen
Landkarten und Seekarten
Rundfunksendungen
Zeitungsartikel/Filme & Urteile
Ein besonderer Dank geht an
Impressum
Buchtipps, die Ihnen ebenfalls gefallen könnten!
Für meine Eltern
Die Lösung für alles ist Salzwasser – Schweiß, Tränen oder Meer
Karen Blixen
Prolog
5. Juni 1916
Fregattenkapitän Herbert Savill stand an Bord der HMS Hampshire und steuerte gegen den Seegang am Pentland Firth an, der Meerenge zwischen dem schottischen Festland und den Orkney-Inseln. Der steife Wind war zu einem Sturm angewachsen und machte keinerlei Anstalten abzuflauen, ganz im Gegenteil. Die Gischt wurde von den Wellenkämmen geweht, und die Brecher donnerten über das Vorschiff. Wasserkaskaden schossen aufs Deck und durch die Speigatten wieder hinaus. Den ursprünglichen Plan, die Orkney-Inseln östlich zu umfahren – also auf der Route, die regelmäßig von deutschen Minen befreit wurde –, hatte man fallen gelassen, nachdem der Wind im Verlauf des Morgens immer weiter zugenommen hatte. Man fasste den Entschluss, die weite Reise nach Archangelsk an der Westküste der Inseln zu beginnen, damit diese dem Panzerkreuzer Schutz vor dem Sturm aus Nordost bieten konnten. Doch nun drehte der Wind auf beunruhigende Weise, die Wolken schienen in ihrer Flucht innezuhalten und abzuwarten, als wolle das ganze Meer tief Luft holen. Das Zentrum des Sturms musste über ihnen vorbeigezogen sein, und nun kam der Wind stattdessen aus Nordwest.
Lord Kitchener, der ein leichtes Abendessen eingenommen und danach in seiner Kabine geruht hatte, ließ die Kommandobrücke unterrichten, dass er unterwegs sei.
»Ein solches Wetter wurde uns nicht vorhergesagt, als wir die Route änderten«, sagte Kitchener und hielt sich an der Leiter fest. Mit großer Anstrengung gelangte er auf die Kommandobrücke und zum Navigationstisch. Dicht hinter ihm folgte mit ruhelosen Augen sein Leibwächter. Er bewegte sich so geschmeidig und souverän, als hätte er Saugnäpfe an Armen und Beinen, ganz im Gegensatz zum Kriegsminister, der sich krampfhaft mit beiden Händen festhalten musste, um nicht umzufallen. Statt mit dem Seegang mitzugehen, kämpfte er gegen die Wellen an.
»Der Wind hat gedreht.« Kapitän Savill warf einen Blick auf die Seekarte. Der ganze Atlantik würde sich mit voller Kraft gegen sie stellen. Vor den Orkney-Inseln gab es nichts, was das Meer bremsen könnte. Wenn sie die Wellen schon jetzt als hoch empfanden, so war das nichts gegen das, was sie in ein paar Stunden erwartete. Zwar würde die HMS Hampshire damit fertigwerden, denn sie war mit Stahlplatten aus englischen Werken gepanzert. Sie würde auch einen Beschuss überstehen, davon war Savill überzeugt, aber die Frage, wie es der Besatzung ergehen würde, konnte er nicht beantworten. Die Skagerrak-Schlacht wenige Tage zuvor hatte ihnen unfassbare Verluste eingebracht. Jeder an Bord hatte jemanden verloren, und die Gespräche waren spürbar leiser geworden, die Stimmung gedämpft.
»Die Zerstörer können unser Tempo nicht halten. Vielleicht sollten wir sie umkehren lassen, Sir?«
»In unserem Fahrwasser bringen sie ohnehin keinen großen Nutzen.«
Kapitän Savill beobachtete, wie Lord Kitcheners Gesicht unter dem üppigen Schnurrbart immer mehr an Farbe verlor. Bestimmt saß er stabil im Sattel seines Pferdes, wie Fotografien von ihm aus Ägypten und dem Sudan bezeugten, aber hier an Bord schien er zu schrumpfen. Es war offensichtlich, dass das Meer nicht sein Element war. Er versuchte, den Blick auf den Horizont zu richten, aber Himmel und Meer gingen ineinander über, und nach kurzem Murren kehrte er verärgert zurück in seine Kabine.
Unity und Victor, die beiden Geleitzerstörer, waren weit zurückgefallen und kämpften sich noch entlang der schwarzen Klippen der Insel Hoy, während die Hampshire das brodelnde Meer mit seinen stetigen achtzehn Knoten bezwang. Fünf nach sechs signalisierte Victor, der kleinere der beiden Zerstörer, dass er nur noch eine Geschwindigkeit von fünfzehn Knoten halten könne. Nach weiteren fünf Minuten ging die Meldung ein, dass Unity lediglich zwölf Knoten schaffte, die sich rasch auf zehn verringerten. Als sie sich um halb sieben am Abend auf Höhe des Hoy Sound in Sichtweite der Lichter von Stromness befanden, forderte Kapitän Savill die Geleitzerstörer auf, zum Flottenstützpunkt in Scapa Flow zurückzukehren, statt der Hampshire bis nördlich der Shetland-Inseln zu folgen. Es war so oder so geplant gewesen, dass das Schiff von dort aus ohne Begleitung weiterfahren sollte.
Nun pflügte sich der zweihundert Meter lange Panzerkreuzer mit seinen knapp siebenhundert Mann an Bord allein durch den Sturm. Seit einer halben Stunde machte die Hampshire nur noch dreizehneinhalb Knoten. Lord Kitchener und sein Stab waren in einer höchst ungewöhnlichen Mission unterwegs nach Archangelsk, zu einem Treffen mit dem russischen Zaren. Bei diesem Wetter würde die Reise lange dauern, und sie versprach alles andere als angenehm zu werden. Doch die Heizer machten ihre Arbeit gut, tüchtige Männer mit schwellenden Muskeln schaufelten rußig und verschwitzt die Kohlen, die das Schiff vorwärtsbrachten. Mit seinen 1950 Tonnen Kohle und diesen zähen Männern an Bord würde die Hampshire ihr Ziel erreichen.
Auf der Steuerbordseite ein Stück bugwärts erahnte man eine Seemeile entfernt die hohen Klippen bei Marwick Head. Wenig später zeigte ein weiterer Blick landwärts, dass die Geschwindigkeit weiter gesunken war.
Das Dröhnen des Windes wurde plötzlich von einer Explosion übertönt, die das ganze Schiff erschütterte. Alle nahmen eilig ihre Posten ein, bereit, sich gegen das zu verteidigen, was man zunächst für ein U-Boot hielt. Doch schon bald wurde Savill unterrichtet, dass es weitaus schlimmer sei – sie waren auf eine Mine gelaufen. Also waren die Deutschen doch hier gewesen. Der Kapitän forderte den Funktelegrafisten auf, umgehend Hilfe zu ordern, doch kurz nachdem er den Befehl erteilt hatte, flackerte die Beleuchtung der Kommandobrücke auf und erlosch. Der Strom war ausgefallen. Und ohne Strom kein Funk. Überall wurden die bereits für den Abend geschlossenen Luken geöffnet, und wie schiffbrüchige Ratten strömte die Besatzung an Deck. Die Männer bewegten sich Richtung Heck, weg von dem beschädigten Teil des Schiffes. Die Heizer, die vom Dampf im Maschinenraum verbrüht worden waren, schrien vor Schmerzen. Ihre Kleider waren zerfetzt, und ihre Haut schlug Blasen. Eine Wolke aus stickigem braunem Rauch quoll vor der Kommandobrücke empor und erschwerte die Sicht.
Zusammen mit seinem Leibwächter stieg Lord Kitchener die Leiter zur Brücke hinauf. Der Kriegsminister sah blass und älter als seine sechsundsechzig Jahre aus, als er krampfhaft das Geländer umklammerte.
»Es dringt verdammt viel Wasser ein«, sagte ein Offizier soeben. »Sir!« Hastig entbot er dem Kriegsminister einen militärischen Gruß, ehe er sich wieder an Kapitän Savill wandte. »Die Stahlplatten auf der Backbordseite zwischen Bug und Brücke sind aufgerissen. Ein gähnendes Loch, das sich nicht abdichten lässt. Es ist zu groß.«
Er verstummte und wartete auf einen Befehl, eine Ader an seiner Schläfe pulsierte heftig. Er hieß mit Vornamen James. Ein tüchtiger Mann, ein Schotte, der immer Fotografien seiner beiden Söhne in der Geldbörse mit sich herumtrug. Nun wäre wohl eine passende Gelegenheit, die Bilder herauszuholen. Eine weitere Explosion erschütterte den Schiffsrumpf.
»Wo befindet sich Ihr Munitionslager?«, fragte Kitchener.
Kapitän Savill sah die Hampshire schon sinken, spürte, wie sich die Bewegungen des Schiffs veränderten.
»Wir müssen die Mannschaft in die Rettungsboote schaffen«, sagte er und nickte James zu, ehe er einen Blick auf den Kriegsminister warf. Dieser wirkte so ruhig, als wäre er gekommen, um das Schiff zu inspizieren, und keineswegs so, als befände er sich inmitten eines unmittelbar bevorstehenden Infernos. Blass, aber konzentriert. Vielleicht, weil er nicht in Gänze den Ernst der Lage umriss.
Offizier James hatte sich einige Schritte der Treppe genähert, um sich an der Leiter festzuhalten.
»Sir, die großen Rettungsboote …«
»Wir müssen die kleinen Boote und die Flöße nehmen«, unterbrach Kapitän Savill, woraufhin der Schotte salutierte und die Kommandobrücke verließ.
»Warum lässt niemand die da zu Wasser?«, fragte Lord Kitchener und zeigte auf die großen Rettungsboote.
»Die können wir ohne Strom kaum abfieren«, antwortete Savill. »Und ohne Strom können wir auch keine Hilfe rufen, der Funk funktioniert nicht. Wenn Hilfe kommt, dann von Land.« Er holte tief Luft und verfluchte diesen blinden Glauben an die neue Technik, die Elektrizität. »Ich möchte, dass Sie in dem ersten Boot sitzen, das wir zu Wasser lassen, Sir.«
Er sollte nie erfahren, ob der Kriegsminister den letzten Satz gehört hatte, denn Lord Kitchener und sein Leibwächter waren schon unterwegs in Richtung Deck. Er sah, wie sie auf die Rettungsboote zugingen und die Männer aufforderten einzusteigen, aber er beobachtete auch, wie die kleinen Boote seitlich an den Schiffsrumpf schlugen und zerbarsten. Alle, die in einem dieser Rettungsboote gesessen hatten, fielen kopfüber ins brodelnde Meer und waren innerhalb eines Augenblicks verschwunden. Den verbliebenen Männern gelang es, einige der größeren Flöße zu Wasser zu lassen und einander hinaufzuhelfen. Auch die großen Rettungsboote füllten sich mit Männern, die hofften, dass sich die Boote lösen und auf dem Wasser schwimmen würden, wenn der Panzerkreuzer sank.
Um zehn vor acht, nur zehn Minuten nachdem die Mine das Loch in den Rumpf gerissen hatte, sank die HMS Hampshire. Ihr Steven tauchte unter die Wasseroberfläche, Flammen und Rauch drangen aus dem Raum hinter der Kommandobrücke, ehe sich das ganze Heck hob. Die Männer, die ihre Zuflucht in den großen Rettungsbooten gesucht hatten, wurden vom Sog des großen Panzerkreuzers mit in die Tiefe gerissen. Nur drei ovale Flöße aus Holz und Kork konnten dem sinkenden Schiff ausweichen. Das kalte Wasser war voller Männer, die um ihr Leben kämpften. Väter, Brüder und Söhne. Eines der Flöße trug sechs Mann, doch der Sturm warf es in der See hin und her, und als es schließlich anlandete, waren nur noch zwei von ihnen übrig. An Bord des größeren Floßes befanden sich ursprünglich fünfzig Mann, doch als es nachts um viertel nach eins am Strand nördlich der Bay of Skaill antrieb, waren die Männer vom Meer und Wind so ausgekühlt, dass etliche ihr Bewusstsein nicht wiedererlangten. Schaum trat aus ihren Mündern, und nur vier von ihnen überlebten. Das letzte Carley-Floß hatte ursprünglich vierzig Mann an Bord, und weitere dreißig wurden aus den Wellen aufs Floß gerettet. Doch als es frühmorgens die schwarzen Klippen in der schmalen Bucht Nebbi Geo nördlich der Bay of Skaill erreichte, waren nur noch sechs Überlebende an Bord – kaum noch bei Bewusstsein und umgeben von toten Kameraden.
Die Inselbewohner eilten zur Unterstützung. Doch ihre Boote wurden vom Militär am Auslaufen gehindert und die hilfsbereiten Menschen, die mit Tragen, Decken und trockener Kleidung an den Stränden auftauchten, unter Bajonettbedrohung weggescheucht. Die einzige Erklärung, die man ihnen gab, war, dass die HMS Hampshire in einem geheimen diplomatischen Auftrag unterwegs gewesen sei und man diesen keinesfalls durch die Einmischung von Zivilisten gefährden dürfe.
Von den in Seenot Geratenen, die es trotz allem an Land geschafft hatten, starben in jener Nacht etliche an den Stränden. Als der Morgen dämmerte, waren von den siebenhundert Mann der Hampshire nur zwölf Überlebende geblieben. Bereits da fragte man sich, was der Panzerkreuzer geladen haben mochte.
1
Es war fünf vor acht an diesem Septembermorgen, als Kriminalkommissarin Karin Adler im Polizeigebäude an der Skånegata einen Stuhl am Konferenztisch hervorzog und sich setzte. Als sie Marstrand mit der Fähre verließ, hatte sie das Gefühl gehabt, in die falsche Richtung zu fahren. Sehnsüchtig hatte sie die Masten im Hafen betrachtet und sich dann in ihren Saab gesetzt. Für einen Montagmorgen waren es verhältnismäßig viele Boote gewesen. Bestimmt hatten einige Segler angesichts des schönen Wetters das Wochenende verlängert. Die glitzernde Sonne hatte ihr in die Augen gestochen, als sie über die Instöbrücke fuhr. Karin wünschte, sie hätte wenden, die Rettungsweste überziehen und mit dem Segelboot in See stechen können. Vielleicht kam sie heute früher raus und konnte nachmittags noch einen Segeltörn machen. Hinaus zu den Pater-Noster-Schären, um Lippfische zu angeln, die sie einsalzen und als Köder beim Hummerfischen verwenden konnte. Oder sie machte einfach nur einen Spaziergang auf den Felsen und badete im klaren Wasser vor der Insel. Doch jetzt befand sie sich mitten in Göteborg zwischen roten Ampeln und Straßenbahnen, Abgasen und Menschen, die mit kabellosen Kopfhörern im Laufschritt ihren Kinderwagen in Richtung Kita vor sich herschoben. Karin atmete tief durch. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als das Beste daraus zu machen.
Sie nickte ihren beiden Kollegen zu und wunderte sich, dass Robert schon da war. Normalerweise kam er immer erst im letzten Moment. Folke zupfte seinen braun gemusterten Schlips zurecht und schlug eine neue Seite in seinem Notizblock auf. Er legte einen Druckbleistift, einen Radierer und einen Textmarker vor sich auf den Tisch. Sie alle hatten feste Plätze. Davon abgesehen würde Folke niemals Radierer sagen – »es heißt Radiergummi«. Dann griff er nach dem Bleistift, drückte die Mine heraus und achtete penibel darauf, dass die Länge stimmte. Robert funkelte ihn genervt an. Karin hatte den Verdacht, dass er am liebsten die Plätze von Folkes Textmarker und Radierer vertauscht hätte. Sie spürte es selbst in den Fingern jucken.
»Guten Morgen, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende«, sagte Kriminalkommissar Carsten Heed, der das Zimmer betreten und eine Mappe neben den Laptop auf den Tisch gelegt hatte. Er blieb stehen.
»Ich habe ja gearbeitet«, bemerkte Robert seufzend und spielte an der Frischhaltefolie seines mitgebrachten Baguettes herum. Er hatte dunkle Augenringe. Sieht man nach drei Kindern so aus?, fragte sich Karin. Nach der Besprechung müsste sie sich mit Carsten zusammensetzen und ihm erzählen, dass sie schwanger war. Auch wenn sie erst in der dreizehnten Woche war, musste sie ihn fragen, wie sie die nächste Zeit planen sollten. Am liebsten wäre sie im Außendienst geblieben, aber sie hatte den Verdacht, dass sie an den Schreibtisch gesetzt werden würde. Sie seufzte. Vielleicht sollte sie noch ein bisschen abwarten. Es hatte ja auch eine Weile gedauert, bis sie mit ihren Eltern gesprochen hatte, da konnte das Gespräch mit Carsten vielleicht auch noch warten. Ihr Bauch war noch nicht zu sehen, auch wenn sie ihn spürte und mittlerweile am liebsten Stretchjeans trug.
Carsten schien Robert nicht zuzuhören. Er hatte die Schultern hochgezogen und wirkte angespannt.
»Wir haben eine Anfrage von der Polizei auf Orkney bekommen.« Er richtete den Blick auf Karin.
»Orkney?«, entgegnete sie. »Worum geht es?«
Robert hatte den Mund voller Krabbensalat, aber er hob erstaunt die Augenbrauen.
Carsten versuchte, mithilfe der Fernbedienung den Beamer an der Decke anzuschalten. Das Gerät fuhr hoch, doch an der Wand erschien der Text »No source«. Er fluchte und drückte wild auf der Tastatur des Laptops herum und danach auf den Knöpfen der Fernbedienung, bis der Beamer protestierte und sich wieder ausschaltete.
»Neues Modell«, kommentierte Robert und wischte sich den Mund mit einer Serviette ab, ehe er die Fernbedienung entgegennahm und sie gen Decke richtete. Bald darauf erfüllte ein Foto das Whiteboard hinter Carsten. Es zeigte ein Segelboot. Weiß mit gesetzten Segeln und einer blau-gelben Flagge. »Orca, Marstrand« stand mit schwarzen oder vielleicht auch dunkelblauen Buchstaben an der Seite des Schiffs.
»Man hat ein schwedisches Boot ohne Besatzung gefunden.«
Karin nickte und dachte an die Lifeline, die sie immer so sorgfältig befestigte, wenn sie segelte, insbesondere wenn sie längere Strecken auf offenem Meer plante. Doch wenn dies einfach nur ein Unfall gewesen wäre, dann wäre der Fall auf dem Schreibtisch der schottischen Seenotrettung gelandet und nicht hier bei ihnen.
»Es wurden Hinweise auf ein Handgemenge an Bord gefunden.« Carsten machte eine Kunstpause. »Blut«, fügte er dann hinzu.
»Wie wurde das Boot aufgefunden?«, fragte Karin und lehnte sich vor. »Trieb es auf dem Meer, oder war es irgendwo vertäut? Lag es vor Anker?«
Carsten blätterte in seinen Unterlagen.
»Die Küstenwache hat es in irgendeinen Hafen bugsiert.«
»In Kirkwall?«, schlug Karin vor und betrachtete das Boot.
»Stromness«, antwortete Carsten, der jetzt den richtigen Ausdruck gefunden hatte.
Der Name weckte Erinnerungen in ihr. Ein steter Strom von Bildern in ihrem Kopf – der Hafen, die Häuser aus Stein, das Pub und die schmalen Straßen. Sie nickte und lächelte, konnte beinahe den Wind spüren, der über den Atlantik bis zu den grünen Inseln geweht war, obwohl sie in einem Betonklotz in Göteborg saß.
»Gibt es eine Landkarte?«, fragte Folke.
»Das ist momentan vielleicht nicht so wichtig«, meinte Carsten. »Die Orkney-Inseln liegen nördlich von Schottland.«
»Nicht so wichtig?«, wiederholte Folke.
Carsten war sichtlich bemüht, ruhig zu bleiben. Karin wusste, dass er gleich nach der Besprechung in sein Zimmer gehen, das Fenster öffnen und eine rauchen würde. Sie erhob sich und ging so nah wie möglich ans Whiteboard. Der Pullover hing über ihren Jeans, und dennoch zog sie mehr oder weniger bewusst den Bauch ein.
»Sieht aus wie eine Boström 37«, sagte sie.
»Ist das ein gutes Boot?«, wollte Carsten wissen. »Eines, mit dem man längere Strecken segelt?«
»Es ist ja offenbar bis zu den Orkney-Inseln gekommen«, bemerkte Folke.
»Ich kenne jemanden, der mal so eines hatte«, sagte Karin. »Es segelt gut bei steifem Wind und hat eine geringe Abdrift, aber es ist ziemlich schwer, sieben bis acht Tonnen. Der Bootseigner hat behauptet, man könne damit nicht rückwärtsfahren, und es sei schwierig zu manövrieren.«
»Vielleicht konnte er einfach nicht damit umgehen«, meinte Folke, schlug die Beine übereinander und betrachtete Robert. Karin begriff, dass das Gespräch nicht mehr von einem Segelboot handelte, sondern von etwas ganz anderem. Vermutlich ging es um Roberts Auto. Um das Reifenprofil, das Folke heimlich mit einer Münze gemessen hatte, oder um die Unordnung im Wageninneren. Bananenschalen, Rubbellose und Becher von McDonald’s. Vielleicht verlor man mit drei Kindern die Kontrolle über sein Leben. Sie räusperte sich, in erster Linie, um Folke und Robert wieder auf Spur zu bringen.
»Ich meine, die Boström 37 wurde auf derselben Werft angefertigt, wo Hallberg-Rassy seine größeren Yachten bauen ließ, insofern ist es wirklich ein gutes Boot. Ein Flossenkieler, aber solide.« Sie nickte. »Und wobei braucht die Polizei von Orkney unsere Hilfe?«
»Flossenkieler?«, wiederholte Folke.
Robert seufzte, und Karin holte tief Luft. Sie wusste, dass Folke den Betrieb aufhalten würde, bis die Frage beantwortet war.
»Ein bisschen vereinfacht könnte man sagen, dass der Kiel erst im Nachhinein angebolzt wird. Sonst wird der Schiffsrumpf aus einem Stück gegossen, das nennt man dann Langkieler. Ein Langkieler ist kursstabiler, während ein Flossenkieler leichter zu manövrieren ist. Er hat weniger Widerstand im Wasser und segelt oft schneller.«
Folke klopfte mit dem Stift auf den Tisch. »Eben hast du gesagt, dass ein Flossenkieler schwer zu manövrieren sei, und jetzt sagst du, es sei ganz einfach. Was denn jetzt?«
»Ich habe gesagt, dass der Schiffseigner fand, es sei schwer zu manövrieren.« Sie wandte sich wieder an Carsten: »Und was will die Polizei auf Orkney von uns?«
»Es klingt ausgesprochen gefährlich, den Kiel erst im Nachhinein anzubringen«, sagte Folke. »Was wäre, wenn er sich lösen würde?«
Karin sah Roberts genervte Miene und verzichtete darauf, sich selbst zu korrigieren und zu erklären, dass ein Langkieler nicht zwangsläufig aus einem Stück gegossen sein musste und dass der Kiel auch dort nachträglich angeschraubt werden konnte.
»Als Erstes haben sie uns gebeten, die Adresse des Bootsbesitzers aufzusuchen, um nachzusehen, ob jemand da ist.« Carsten hielt einen Bleistift in der Hand, als wäre es eine Zigarette. Gleich würde er sich vergessen und daran ziehen.
»Das heißt, sie wissen, wer der Eigner ist?«, fragte Karin.
Carsten setzte seine Lesebrille auf. »Die Kollegen hatten den Namen Orca und den Ort Marstrand, deshalb ist der Fall bei uns gelandet. Wir haben das Boot und damit auch den Besitzer im dritten Anlauf gefunden, nachdem wir bei mehreren Versicherungen angerufen hatten. Bei der Versicherungsgesellschaft Atlantica haben wir einen Treffer gelandet«, berichtete er. »Es ist tatsächlich eine Boström 37, das wussten wir aber nicht, als wir rumtelefoniert haben.«
»Okay«, sagte Karin. »Und wem gehört das Boot jetzt?«
»Einem gewissen Bo William Stenman, 1947 in Göteborg geboren. Vater unbekannt. Seine Mutter ist 1992 verstorben. 1969 hat er Lena Karlsson geheiratet, aber sie haben sich 1989 scheiden lassen. Zwei Töchter, Bodil und Katarina. Er ist Taucher im Ruhestand, scheint in Norwegen gearbeitet zu haben. Wurde 1984 wegen schwerer Körperverletzung verurteilt, ansonsten keinerlei Vorstrafen. Gemeldet ist er in Tången auf der Insel Klöverö bei Marstrand. Er ist als Einziger dort gemeldet. Wir haben es schon bei ihm auf dem Festnetz und unter seiner Handynummer probiert.«
»Tången«, sagte Karin und betonte dabei die zweite Silbe. »Aus irgendeinem Grund sprechen die Einwohner das so aus. Das liegt auf der Südseite von Klöverö, in der Nähe von Korsvik. Aber es ist ja nicht gesagt, dass er selbst mit dem Boot gesegelt ist. Er kann es ja auch verliehen haben.«
Carsten nickte. »Die Polizei auf Orkney steht bereits in Kontakt mit den Häfen und Marinas vor Ort, um herauszufinden, wo das Boot gesehen worden ist und ob sich jemand an die Besatzung erinnern kann. Ich nehme an, du weiß, wie das funktioniert, Karin?«
»Wenn man einen Hafen anläuft, wird das Boot registriert, und man muss eine Gebühr zahlen, die von der Größe des Boots abhängt. Je größer, desto teurer. Doch wenn man stattdessen in irgendwelchen Buchten anlegt, ist es gar nicht gesagt, dass man irgendwelche anderen Leute trifft. Auf den Orkney-Inseln ist es nicht wie hier an der Küste, wo sich die Boote im Sommer tummeln.«
»Er könnte auch über Norwegen gesegelt sein, insbesondere, wenn er dort gearbeitet hat. Aber jetzt finde erst mal heraus, ob unter Bo Stenmans Anschrift jemand anzutreffen ist. Kannst du dir ein Boot leihen, um nach Klöverö rauszufahren? Oder ist dein eigenes wieder fahrtüchtig, ich meine das mit dem Dieselleck?«
»Ich kann Johans nehmen.« Karin dachte an das stabile Motorboot ihres Lebensgefährten, das in den Siebzigern auf Nicanders Bootswerft in Marstrand gebaut worden war.
Carsten nickte vor sich hin. »Gut.« Er sah aus, als fragte er sich, ob er irgendetwas vergessen hatte. »Tången«, sagte er dann und betonte ebenfalls die zweite Silbe. »Nimm Robert mit. Wir beiden, Folke, reden gleich weiter.«
Carsten beendete die Besprechung und überreichte Karin die dünne Mappe zu Bo William Stenman. Ganz oben lag das Foto von der Boström 37.
Es war kurz nach zehn, als Karin den Motor von Johans Skäreleja startete und vom Steg in der Blekebucht losmachte. Immerhin bekam sie nun doch eine Bootstour, wenn auch unter anderen Umständen, als sie es sich vorgestellt hatte. Sie kam an den roten Bootshäusern am Rosenberget und der Wollmarswerft vorbei, die keine Werft mehr war, sondern für Feiern gebucht werden konnte. Nebenan lagen die alten Gebäude der Heringssalzerei, die schon seit Langem zu Sommerhäuschen mit Strandlage umgebaut worden waren. Karin betätigte den Motorhebel und war dankbar dafür, in einer Zeit zu leben, in der man nicht auf Wind warten musste, um sein Boot vorwärtszubewegen.
Der Sommer war vorbei, und der kleine Ort mit seinen Holzhäusern und den Einheimischen konnte durchatmen, eine weitere Saison war überstanden. Und während manche dem Sommer nachtrauerten, mochte auch Karin den September. Zwar waren die Abende dunkler, doch dafür kamen ihr die Farben klarer und intensiver vor, als hätten die Dinge schärfere Konturen. Und tagsüber konnte es genauso warm werden wie an einem Sommertag.
Sie zog den Motorhebel zurück, bis er im Leerlauf war, um auf die Fähre zu warten, die unterwegs nach Marstrandsö war. Robert hatte seine Jacke ausgezogen und sah hinüber zur Kirchturmuhr, deren Ziffern in der Morgensonne golden glänzten. Er nahm sich ein Sitzkissen und setzte sich neben Karin auf die Bank.
»Was meinst du? Hat er das Boot verliehen und sitzt jetzt zu Hause und fragt sich, was eigentlich passiert ist?«
»Die Hoffnung stirbt zuletzt.«
»Fast sechsundsechzig ist er. Wann geht Folke eigentlich in Pension?«, fragte Robert.
»Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie alt er ist. Weißt du das?«
»Nein.« Robert gähnte und fuhr sich übers Gesicht.
»Müde?«
»Zwei der Kinder sind heute Nacht zu uns ins Bett gekommen. Danach konnte ich nicht mehr einschlafen. Am Ende bin ich in Leos Zimmer gegangen und habe mich dort hingelegt, aber da war es schon nach vier Uhr morgens. Ich habe mich herumgewälzt und gefragt, ob ich alle Rechnungen bezahlt habe und ob die Kinder ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ob wir in den Winterferien verreisen oder das Geld lieber in eine Erdwärmebohrung investieren sollten, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ob ich eigentlich das Auto abgeschlossen habe und ob mein Zahnarzttermin diese oder nächste Woche ist.«
Karin lachte.
»Das sind viele Gedanken auf einmal«, sagte sie und grüßte einen Mann in orangefarbenem Overall auf einem entgegenkommenden Boot. »Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen?«
Robert deutete mit dem Kopf auf den Fischer und folgte ihm mit dem Blick. »Man sollte vielleicht etwas anderes machen, Fischer werden zum Beispiel.«
»Du – auf einem Boot?« Karin lachte. »Das mag vielleicht idyllisch aussehen, aber stell dir mal so ein richtiges Schietwetter im Oktober und Schneeregen im Dezember vor.« Sie zeigte auf die grüne Spierentonne, die im Albrektsunds-Kanal auf und ab schaukelte. »Gegenstrom«, meinte sie und versetzte dem Motorhebel einen Stoß. »Manchmal verschiebt das Eis die Spieren.«
»Spieren. Komischer Begriff. Sollte man nicht Seezeichen dazu sagen?«
»Das kannst du halten, wie du willst. Folke weiß bestimmt, warum man die Dinger Spieren nennt, falls du echtes Interesse und eine Stunde übrig hast.«
»Bist du verrückt? Ihn werde ich bestimmt nicht fragen. Nun ja. Bald ist Herbst, und dann kommt schon Weihnachten.«
»Hör auf. Im Moment gibt es doch gar keinen Grund, sich zu beschweren. Außerdem mag ich den Herbst, wenn man einen Strickpullover anziehen kann und mit einer Decke um die Beine in der Plicht sitzt. Oder wenn man im Kaminofen Feuer macht und den Regen hört, der aufs Roofdach prasselt.«
»Weiß Johan eigentlich, dass du wieder aufs Boot ziehen willst?«
»Ohne das Dieselleck würde ich immer noch an Bord wohnen«, murmelte sie und packte die Pinne fester.
Die Birkenzweige hingen ins Wasser, und Schafe weideten am Ufer des Kanals. Das Motorengeräusch verstärkte sich zwischen den Felswänden, ehe sie die südlichsten Spierentonnen passierten. Eine rote und eine grüne, dann den weiß gestrichenen Steinhaufen an der Ostspitze von Klöverö.
»Hier gab es früher jede Menge Trankochereien, das kann man sich heute kaum noch vorstellen«, sagte sie und zeigte auf Stensholm und die kahlen Inselchen in südlicher Richtung. »Jetzt ist nichts davon übrig. Sogar der letzte dauerhafte Bewohner von Långö ist umgezogen. Letztes Jahr.«
»Aber auf Klöverö wohnen doch Leute? Abgesehen von Astrid Edman?«
Karin nickte und dachte an die etwas schroffe Dame, die sie bei der Aufklärung eines Falls auf der Insel kennengelernt hatten. Die Edmans lebten schon seit Generationen auf Klöverö und waren Nachfahren eines berüchtigten Seeräubers, der erst 1854 gestorben war.
»Doch, in fünfzehn Häusern leben das ganze Jahr über Menschen.«
»Das ist doch gut.«
»Von sechzig Häusern insgesamt.«
»Aha. Dann ist es vielleicht nicht ganz so gut.«
»Kümmerst du dich um die Leinen und Fender?«
Bei Korsvik waren drei Häuser zu sehen. Ein großes weißes mit einem alten Stall daneben, eine schmutzig gelbe Baracke, vermutlich ein Sommerhaus, dachte Karin, und etwas abgelegen auf einer Landspitze ein hellgraues Holzhaus. Genau wie Johan es ihr beschrieben hatte, als sie ihn angerufen hatte. Jemand hatte eine schwarze Mine auf einen Felsen gemalt. Johan hatte sie ihr gegenüber erwähnt und von seinem Onkel Fredrik erzählt, der im Krieg Minen entschärft und eine ganze Menge Alkohol konsumiert hatte. Vielleicht war das nötig, um die Nerven zu betäuben, wenn man immer wieder den Tod überlistete.
Sie fuhr an der Untiefe direkt neben dem Bootssteg vorbei und zeigte Robert das Seegras unter der Wasseroberfläche.
»Clever«, sagte er. »Wusstest du von der Untiefe?«
»Glaubst du, ich fahre einfach nur auf gut Glück durch die Gegend?«
Sie legte den Rückwärtsgang ein und gab Gas. Das Wasser am Heck wirbelte auf, das Boot bremste und stoppte am Steg. Robert ging mit der Vorleine an Land und befestigte sie mit einem Eisenring am Steg. Karin folgte mit der Achterleine.
»Na dann«, sagte er. »Auf nach Tången.« Er zog die Rettungsweste aus und legte sie auf die Backskiste in der Plicht. »Die klaut hier keiner, oder?« Er sah sich um.
»Wohl kaum«, sagte Karin und machte einen großen Schritt auf den Steg. Heimlich überprüfte sie Roberts Knoten, ehe sie ihm auf dem gemähten Grasweg den Vortritt ließ. Der Weg war durchsetzt mit Steinblöcken und breit und stabil genug, um mit einem Transportwagen vom Steg bis zum Haus fahren zu können.
»Also muss alles mit dem Boot hierher transportiert werden?«, fragte Robert.
»Ganz genau. Kühlschränke, Essen, Heizkessel und Herde. Und alles, was kaputtgeht, muss mit dem Boot von hier weggebracht werden. Erst nach Marstrand, wo es in ein Auto umgeladen werden muss für den Weitertransport zum Recyclinghof oder zur Müllhalde in Kungälv.«
»Allein das klingt nach einer Vollzeitbeschäftigung.«
»Aber trotzdem. Stell dir vor, so zu wohnen.«
»Man muss vermutlich in aller Herrgottsfrühe aufstehen, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Ablegen und anlegen«, sagte Robert, während er den Weg entlangmarschierte.
»Und im November ist es dunkel, wenn du losfährst, und schon wieder dunkel, wenn du nach Hause kommst. Eis auf den Leinen und an Deck. Nein, das ist wohl nichts für dich, Robert. Aber stell dir vor, du kommst in dieser Jahreszeit von der Arbeit nach Hause und kannst Abendbrot auf den Felsen essen und eine Runde baden, ehe du ins Bett gehst. Das macht alles wett.«
Das hellgraue Haus, das laut dem Melderegister Bo Stenman gehörte, war von einem weißen Zaun umgeben. Das Gartentor aus Holz war schwergängig, und als Karin nachsah, entdeckte sie einen Stein, der an einem Seil hing und über einen Flaschenzug den Widerstand erzeugte. Sobald sie das Tor losließ, schloss es sich automatisch hinter ihnen. Pfiffig.
Robert war bereits an der Schwengelpumpe auf dem Hofplatz vorbeigegangen. Nun stand er auf dem obersten der Granitblöcke, die eine Treppe bildeten, und klopfte so fest an die Holztür, dass Karin die Scheibe im Glaseinsatz klirren hörte.
Wenn ein Brunnen so nah am Meer lag, müsste das Wasser dann nicht salzig sein?, grübelte sie. Die vertrockneten Blumen am Zaun sahen aus, als hätte es ihnen nichts ausgemacht, wenn das Wasser ein bisschen salzig gewesen wäre. Hauptsache, sie hätten überhaupt ein paar Tropfen abbekommen. Aber jetzt waren sie ohnehin nicht mehr zu retten. Die Brombeerbüsche schienen als Einzige überlebt zu haben, auch wenn die Beeren jämmerlich klein und noch immer rot waren. Sie würden vermutlich kaum reifen, ehe der erste Frost kam.
»Offenbar ist niemand zu Hause«, sagte Robert und sah zum Fenster im Obergeschoss hinauf, ehe er die Klinke hinunterdrückte. Die Tür war abgeschlossen. Er klopfte noch fester und rief: »Hallo? Wir sind von der Polizei. Ist jemand zu Hause?« Keine Antwort. Er wandte sich an Karin. »Was machen wir?«
»Wir drehen eine Runde ums Haus.«
Sie gingen um das Gebäude herum und schauten durch die Fenster hinein, wo es ihnen möglich war.
»Scheint niemand da zu sein«, sagte Robert. »Wenn nicht jemand im Obergeschoss liegt.« Er zeigte auf die oberen Fenster, als sie wieder auf dem Hofplatz standen.
»Es wird eine ganze Weile dauern, ehe ein Schlüsseldienst herkommt«, sagte sie und nahm die Tür genauer in Augenschein.
Robert folgte ihr. Er bückte sich und hob den Blumentopf hoch, der auf der Treppe stand. »Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn der Schlüssel hier gelegen hätte.«
»Wir müssen rein«, meinte Karin und nickte ihm zu. »Wie schätzt du das Schloss ein? Sieht aus wie eines mit Drehknauf auf der Innenseite.«
Robert betrachtete die Tür und das Schloss.
»Okay«, sagte er dann, nahm einen Stein und zerschmetterte die Scheibe. Vorsichtig schob er die Glassplitter beiseite, ehe er die Hand hineinsteckte und von innen aufschloss.
»Hallo? Polizei!«, rief er wieder und stieg über die Glassplitter im Flur.
Eine Schiffsglocke hing an der einen Wand. Ein Name war eingraviert, aber das gute Stück war so mit Grünspan überzogen, dass sie ihn nicht entziffern konnte. Sie durchsuchten das Haus Zimmer für Zimmer, um am Ende festzustellen, dass es leer war. Karin versuchte, sich ein Bild von dem Mann zu machen, der hier wohnte. Es roch wie im Sommerhäuschen ihrer Großeltern in Ammenäs bei Uddevalla. Ein angenehmer Duft, den sie mit Brotbacken und der Speisekammer ihrer Großmutter verband, die groß genug gewesen war, um sich darin mit einem Stapel alter Comics zu verkriechen. Die Küche war mit einem alten Holzherd ausgestattet, und über dem runden Esstisch mit Meerblick hing eine Petroleumlampe. Karin lehnte sich vor und sah hinaus. Falls jemand zu Hause gewesen war, der ihnen nicht begegnen wollte, hätte er das Boot kommen sehen und genug Zeit gehabt, um sich zu verziehen. Aber es sah so aus, als wäre schon länger niemand hier gewesen. Tote Fliegen lagen auf den Fensterbrettern, und eine kaum sichtbare Staubschicht bedeckte die Edelstahlspüle. Sie war niedrig, so wie früher. Einige Fischschuppen glitzerten auf den matten Fliesen. Damals mussten alle, die über zwölf Jahre alt waren, mit gebeugtem Rücken dastehen und abspülen und Fische ausnehmen. Die Unterschränke waren hellgelb und abgenutzt. Die Topfpflanzen in den Fenstern waren zwar grün, aber auch nur, weil sie aus Plastik bestanden. Sie waren ebenso von der Sonne ausgeblichen wie die Tapete. Der Fußboden in der Küche hingegen war neu, ein schlecht gemachtes Holzimitat.
Eine Seekarte war mit Reißzwecken an der Wohnzimmerwand befestigt. Es war eine Übersichtskarte über die Nordsee, auf der Schweden, Norwegen und Dänemark zu sehen waren. Karin blieb eine Weile davor stehen, ehe Roberts Stimme sie aus ihren Gedanken riss. Er wolle sich mal die Nebengebäude ansehen. Sie rief: »Okay!« und hörte, wie die Haustür geschlossen wurde. Auf einem Tisch in einer Ecke stand eine Sammlung von Messingobjekten und Flaschen, die wegen der Seepocken daran aussahen, als hätten sie auf dem Meeresgrund gelegen. Karin betrachtete ein Patentlog und ein Kompasshäuschen sowie einen weiteren Gegenstand, den sie nicht zuordnen konnte.
In dem Häuschen auf der Landspitze herrschte eine geschäftige Stimmung, obwohl niemand zu Hause war. Auf der einen Seite sah man das Meer, auf der anderen Wiesen und Weiden. Karin entdeckte die Straße, die auf eine Kuppe führte und dahinter außer Sichtweite quer über die Insel bis zur Bredelius-Werft verlief. Von dort aus konnte man hinüber zu den Inseln Koö und Marstrandsö sehen. So viel war in den vergangenen fünfzig Jahren hier offenbar nicht passiert, dachte sie und betrachtete die Deckenlampen aus dickem gelbem Glas. Obwohl es elektrischen Strom gab, schien sich der Bewohner des Hauses nicht darauf zu verlassen, wenn man an all die Petroleumlampen dachte, die es hier gab. Vielleicht gab es öfter Stromausfälle. Vom Wohnzimmer aus führte ein Gang in ein kleineres Zimmer mit Grastapeten und braunem Teppichboden. Das Zimmer hatte eine Bettnische aus dunklem Holz, die an eine Kajüte erinnerte, mit einem karierten Vorhang, den man zuziehen konnte, um das Tageslicht auszuschließen. An der entgegengesetzten Wand, neben einem Einbauschrank mit einem großen Türgriff aus grünem Glas, standen ein Schreibtisch und eine Seemannskiste.
An einer dicken, lackierten Teakholzplatte waren ein Barometer und eine Glocke befestigt, beides aus Messing. Darunter hing ein Foto von zwei jungen Männern in Taucheranzügen. Sie waren sonnengebräunt, ihre Zähne leuchteten weiß, und das Haar, das unter dem Kopfband der Tauchmaske hervorschaute, war nass, als wären sie gerade dem Meer entstiegen. Der Hellere der beiden hatte einen Schnurrbart und Haare, die von der Sonne gebleicht waren. Sein rothaariger Kamerad hatte den Arm um ihn gelegt und hielt etwas in die Kamera. Einen Fund, den sie gerade gemacht hatten? Karin nahm das Foto von der Wand und versuchte zu erkennen, was es war. Schließlich drehte sie es um. An den Schweden zum 30. Geburtstag!, stand mit schwarzem Filzstift auf der Rückseite. Mit ihrem Handy schoss sie ein Foto davon und hängte das Bild wieder an seinen Platz.
Der Schreibtisch war mit Papieren, Büchern, Zeitungen und Post übersät. Die Blätter schien der Tintenstrahldrucker auf dem Stuhl daneben ausgespuckt zu haben, die Texte waren auf Norwegisch. Folke hätte einen Herzinfarkt bekommen, wenn er dieses Durcheinander gesehen hätte.
Es gab noch viel zu untersuchen, aber als Erstes mussten sie den Bootseigner finden. Oder seine Angehörigen. Mit ein bisschen Glück wusste jemand vielleicht, wo er steckte.
Die oberste Schreibtischschublade ließ sich kaum öffnen, so voll war sie: Papier, Stifte, Tesafilm, Büroklammern, Knöpfe und Münzen aus aller Herren Länder. Der Boden hing auf beunruhigende Weise durch, und die Schublade gab ein scharrendes Geräusch von sich, als Karin sie wieder zuschob. In der nächsten Schublade entdeckte sie einen Taschenkalender und ganz hinten eine Goldmedaille, auf der Bo Stenmans Name eingraviert war. Darunter befand sich eine norwegische Inschrift: Für die edle Tat beim Alexander-L.-Kielland-Unglück 1980. Eine norwegische Ehrenmedaille mit dem Kopf König Olavs V. im Relief.
Alexander Kielland. Der Name kam ihr bekannt vor, aber sie konnte ihn gerade nicht zuordnen. Sie schoss ein weiteres Foto mit dem Handy, ehe sie nacheinander die anderen Schubladen öffnete, die weitere Unterlagen enthielten. Dann widmete sie sich dem Kleiderschrank. Die Innenseite der Tür war mit Fotos bedeckt – von Arbeitsschiffen, Versorgungsschiffen und Bohrinseln für Erdöl- und Erdgasgewinnung. Britische, amerikanische, vor allem aber norwegische Bohrinseln.
Taucheranzüge hingen auf Kleiderbügeln, und auf dem Boden standen zwei Paar gelbe Sauerstoffflaschen. Dort lagen auch etliche Taucherflossen und -schuhe. Einige davon sahen aus, als wären sie aus schwerem Metall gefertigt. Sie ging in die Hocke und wollte gerade die Tür des Kleiderschranks schließen, als ihr das Foto auffiel, das an der Innenseite der Tür klebte. Eine Bohrinsel, auf die der Name »Alexander L. Kielland« gedruckt war, in weißen Buchstaben vor dem blauschwarzen Meer. An einem der Gerüstbeine der Bohrinsel klebte eine Haftnotiz in Form eines Pfeils, auf den jemand Unfall? geschrieben hatte.
2
Montag, den 15. August 1977
Seine Hände rochen noch immer nach Öl, als Douglas mit dem Stift in der Hand den Vertrag durchlas. Die Arbeit an der Druckkammer hatte länger gedauert als geplant, und er war erst gegen zwei Uhr morgens fertig geworden. Sein Gehirn kämpfte mit den Formulierungen, doch er nahm sich Zeit, das ganze Dokument zu lesen, ehe er unterschrieb. Schweigepflicht, darum ging es. Ein Monat im Ausland. Dabei wusste er weder, wohin sie fahren würden, noch was zu tun war. Ihn befiel dasselbe kribbelnde Gefühl wie damals, als er seinen ersten Tauchauftrag bekommen hatte. Eigentlich hätte er blind unterschreiben können, einfach um mitfahren zu dürfen. Umfassende Arbeiten unter schwierigen Umständen, so viel hatte er verstanden, aber dennoch fühlte es sich wie ein Abenteuer an, von dem er eines Tages seinen Kindern erzählen würde. Falls sie welche bekamen. Erst mit Annika hatte er begonnen, an so etwas wie Kinder zu denken. Sie hatte besorgt ausgesehen, als er ihr das wenige verraten hatte, was er von dem Projekt wusste, aber hatte beim Zuhören weiter den Tisch gedeckt. Natürlich hatte sie gesehen, dass er kaum stillstehen konnte, natürlich hatte sie das Lächeln auf seinen Lippen gesehen und schon da gewusst, dass er diesen Auftrag annehmen musste.
Bosse saß neben ihm vor Torstens Zimmer und wartete. Seine Augen leuchteten auf eine Art, wie es immer seltener vorkam. Früher, erinnerte sich Douglas, hatte Bosse diese leuchtenden Augen gehabt, wenn er von der Arbeit auf den Bohrinseln zurückgekommen war, nach einem gelungenen Tauchgang mit schönen Fundstücken auf einem der vielen Wracks vor Marstrand oder wenn er sich mit einer Frau getroffen hatte, die er für die Richtige hielt. Obwohl Lena und die Kinder zu Hause auf ihn warteten.
Douglas nickte lächelnd.
»Unglaublich, dass wirklich was draus wird«, sagte er.
»Stimmt. Hast du die Druckkammer in Ordnung gebracht?«, fragte Bosse.
»Ich habe bis heute Nacht um zwei Uhr daran gearbeitet, aber jetzt funktioniert sie.«
Am liebsten wäre er über Nacht auf dem Schiff geblieben, aber er hatte Annika versprochen, nach Hause zu kommen, wenn es ging. Ansonsten hatte er alles, was er brauchte, an Bord. Die gesamte Ausrüstung, Kleidung und ein paar Bücher. Allerdings glaubte er nicht, dass er viel Zeit zum Lesen haben würde. Das kam selten vor. Und das hier war eine neue Technik für ihn. Für sie alle. Ein Boot mit einer Druckkammer, so etwas gab es nur in der Nordsee. Bosse, der dort arbeitete, hatte die Technik mit hierhergebracht. Sie würden die Ersten in ganz Schweden sein, hatte er nicht ohne Stolz in der Stimme verkündet.
»Sollen wir einen Probelauf machen? Was hältst du davon, wenn wir eine Tauchtiefe von siebzig Metern simulieren?«
Douglas wusste, dass es keinen Sinn hätte, wenn er jetzt sagte, dass das nicht nötig sei. Zwar vertraute Bosse ihm, aber er hatte ein außergewöhnlich starkes Kontrollbedürfnis. Vermutlich hatte ihn genau das bei seiner Arbeit im kalten Wasser rund um die Bohrinseln in der Nordsee und auf der ganzen Welt am Leben erhalten. Bosse entspannte sich nie – oder zumindest nicht, wenn er bei der Arbeit war. Er blieb stets wachsam und überprüfte alles ein zweites Mal. Von den anderen erwartete er dasselbe, verließ sich aber nicht darauf. Vielleicht war es vor dem Unfall mit Lasse anders gewesen. Douglas wusste es nicht, und er hatte sich nie getraut zu fragen.
Sie gingen hinaus auf den Kai, wo die Deep Water vertäut war. Fünfzig Meter lang mit dunkelblauem Rumpf und weißen Aufbauten. Ursprünglich als Minenräumboot für die Royal Navy gebaut, hatte sie auch als Trockenfrachtschiff, Kühlschiff, Seinerboot und zuletzt als Walfänger gedient.
Am Vordeck war eine Harpune befestigt gewesen, die allerdings vor einigen Monaten abmontiert worden war. Ein brutales Teil mit gefleckten Widerhaken, die sich im Inneren des Wals aufspreizten, wenn es sein Ziel erreicht hatte. Douglas war beim Kauf des Boots dabei gewesen, und ihm war ganz anders geworden, als der frühere Besitzer seine scheußlichen Geschichten von der Walfischjagd erzählte.
Den Mast mit dem zugehörigen Deckskran, der ebenfalls vorne auf der Back gestanden hatte, neben der vorderen Ankerwinde, hatte man behalten. Ein Kran konnte ihnen immer nützlich sein. Das Druckkammersystem an Bord hingegen war neu und eigens für die bevorstehende Expedition gefertigt worden.
Die Besitzer des Unternehmens für Tauchtechnik hatten den Besucher kaum ernst genommen, als er vor einem Jahr mit breitkrempigem Hut und ebenso breitem texanischem Akzent sein Anliegen erklärt hatte. Bosse hatte ihn dorthin gelockt.
Mit seinen Erfahrungen im Sättigungstauchen und der Arbeit in extremen Tiefen der Nordsee hatte Bosse keine Werbung für sich selbst machen müssen. Das übernahmen inzwischen andere für ihn. Fast jeder wusste, wer der »Schwede« war, aber der Amerikaner John Steele war gekommen, um mit Bosses Chef Torsten zu sprechen. Sie waren gemeinsam im Besprechungsraum verschwunden. Nach einer langen Unterredung öffnete sich die Tür, und Torsten machte sich auf den Weg, um Bosse hinzuzuholen.
»Can you do it?«, hörte Douglas den Amerikaner durch den Türspalt fragen.
Bosse erkundigte sich nach Details. Wussten sie etwas über die Tiefe? Sie diskutierten über Gezeiten, Wetter und Wind, Bootstypen und verschiedene Tauchtechniken, auch wenn es in Bosses Welt nur eine einzige gab, die wirklich zählte. Douglas hörte, wie der Amerikaner mit leiserer Stimme antwortete, und vermutete, dass sie sich gerade die Unterlagen anschauten, die er in seiner zweifarbigen Aktentasche aus Krokodilleder mitgebracht hatte.
»Ich möchte mein eigenes Team zusammenstellen«, erklärte Bosse.
»Selbstverständlich.«
»Wir kaufen ein Boot und bauen die Ausrüstung selbst. Aber zuerst müssten Sie eine Tauchgenehmigung einholen. Ihnen ist schon bewusst, dass es sich um ein Seekriegsgrab handelt?«
»Wenn Sie ein Team zusammenstellen und die Ausrüstung organisieren, kümmere ich mich um den Rest. Alright?«
»Alles klar.«
Als der Amerikaner wieder weg war, ging Bosse zu Douglas und berichtete ihm das wenige, was er von der Expedition verraten durfte. Dabei hatte er dieselbe Spannung in der Stimme wie damals, als er von der Bronzekanone erzählte, die er vor den Pater-Noster-Schären entdeckt hatte. Es war ihm zwar nicht gelungen, sie zu bergen, und mittlerweile hatte bestimmt jemand anderes in Marstrand sie als exklusive Dekoration in den Garten gestellt oder im Partykeller versteckt. Aber es war schon etwas ganz Besonderes, einen Gegenstand als Erster entdeckt zu haben. Die Aufregung, ehe man mit Sicherheit sagen konnte, worum es sich handelte – man musste vorsichtig heranschwimmen, ohne die Taucherflossen unnötig zu bewegen, damit man nicht die Sicht behinderte – und dann das Gefühl, wenn die Hände etwas berührten, das seit dem Untergang des Schiffes unangetastet dagelegen hatte. Dieses Gefühl kannten sie beide. Während Bosse von John Steeles Projekt erzählte, hatte er aber auch seine Befürchtung geäußert, dass diese Expedition nie zustande kommen würde. Ein Seekriegsgrab aus dem Ersten Weltkrieg – man würde eine Genehmigung der britischen Regierung brauchen, um dort tauchen zu dürfen. Und warum sollten sie einem schwedischen Tauchunternehmen so eine Genehmigung erteilen?
Drei Monate später aber war John Steele zurückgekehrt, in Begleitung eines Anwalts mit schütterem Haar. Er hatte seine sonderbare Aktentasche aus Krokodilleder geöffnet und ein Blatt herausgezogen.
»Ein Freund von mir, Jonathan Aitken, ist Parlamentsabgeordneter in Großbritannien«, erklärte er und schob das Papier über den Tisch zu Torsten und Bosse.
Zweimal hatte Bosse sich das Blatt durchlesen müssen, um sich zu vergewissern, dass er sich nicht verlesen hatte. Doch es war tatsächlich eine Tauchgenehmigung. Ein Dokument, das der AGUF, der Anglo-German-Underwater-Filming-Company, erlaubte, auf der HMS Hampshire zu filmen, die vor den Klippen der Orkney-Inseln am 5. Juni 1916 gesunken war.
»Und wer ist diese Anglo-German-Underwater-Filming-Company?«, hatte Bosse gefragt.
»Das sind wir. Das sind Sie.« John Steele deutete auf seinen Anwalt. »Tom geht mit Ihnen die Details durch.« Dann stellte er sich vor die Wand und betrachtete die Fotos, die dort hingen. Das größte zeigte den Stapellauf eines 240.000-Tonners im Trockendock der Werft von Arendal 1975.
Der Anwalt hatte fünfundvierzig Minuten geredet, mit wenigen Unterbrechungen durch Einwürfe von John Steele. Torsten hatte Fragen zur Finanzierung des Projekts gestellt, während Bosse sich wegen der Ausrüstung erkundigt hatte. Freie Hand, hatte Bosse gesagt. Wenn er nur freie Hand hatte, würde er das meiste organisiert bekommen. Aber Torsten verwaltete das Geld. Letztendlich musste Bosse ihn überzeugen und mit ihm verhandeln. Doch in diesem Moment ging es in erster Linie darum, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass sie mit ihnen die richtige Wahl getroffen hatten, damit sie nicht eine andere Firma beauftragten.
»We would like to take you to a nice restaurant«, erklärte Torsten in seinem holprigen Englisch. Bosse schämte sich, und um die mangelnden Englischkenntnisse seines Chefs zu kompensieren, ergriff er das Wort und begann vom Tauchen zu sprechen und von der Bohrinsel Borgny Dolphin, auf der er kürzlich gewesen war.
Vier Stunden später, nach einem langen Abendessen mit viel Wein, nahm Torsten Bosse beiseite. Er war schon angeheitert, und Bosse hoffte, dass sein Chef sich nicht danebenbenehmen möge. Schließlich steckten sie mitten in einer Verhandlung.
»Dieser Jonathan Aitken …«, sagte Torsten zu Bosse und legte ihm jovial den Arm auf die Schulter.
»Der Name kommt mir bekannt vor«, meinte Bosse.
»Das ist der Typ, der mit Margaret Thatchers Tochter Carol zusammen ist.«
Am Montag, den 15. August um fünf nach zehn abends verließen sie die Werft Nya Varvet. Kapitän Göte steuerte das Schiff aus der Hafeneinfahrt von Göteborg. Das dumpfe Geräusch des Dieselmotors drang durch das Deck nach oben. Ein gleichmäßiges Geräusch, ein ruhiger und wohlbekannter Rhythmus für Douglas. Er drehte eine Extrarunde an Deck, um die Verzurrung zu überprüfen. Eigentlich war das nicht seine Aufgabe, aber ihn beunruhigte insbesondere die riesige Sandpumpe. Wenn sich ein solches Gerät im Seegang bewegte, konnte es großen Schaden verursachen. Aber die Pumpe erwies sich als gut gesichert, und die Ketten waren ordentlich festgespannt.
Er stellte sich an die Reling und sah hinaus in den Sommerabend, während das Boot an den grauen Schären entlangglitt. Das Wasser erstrahlte vom Meeresleuchten, und die Schwallwelle der Deep Water war gelblich grün und vermittelte ihm das Gefühl, sich in einem Traum zu befinden.
»Wir haben einen Vertrag über sechzehn Tage«, sagte Bosse. Er stellte sich neben ihn und lehnte sich an die Reling.
Douglas wünschte, er könnte allein sein und einfach nur die Stimmung genießen.
»So ist das Leben. Nur schade, dass der Auftrag so kurz ist«, sagte Bosse, nachdem er eine Weile schweigend neben Douglas gestanden hatte.
»Der Auftrag kann sich ja noch verändern und gegebenenfalls verlängert werden. Dafür kannst du Torsten vorschicken, dann kann er sich auch ein bisschen nützlich machen«, schlug Douglas vor.
»Torsten?« Bosse verzog das Gesicht. »Ich habe gehört, wie er neulich mit den Amerikanern telefoniert hat. ›Yes, Sir‹ und ›No, Sir‹. Und dazwischen versucht er, auf ihrem Niveau zu spielen. Das ist peinlich, wenn du mich fragst.«
»Sie sind aber doch unsere Kunden«, gab Douglas zu bedenken.
»Aber es ist ein gemeinsames Projekt. Sie kommen nicht ohne unser Know-how aus. Zwar haben sie die Information über das Wrack angeschleppt und sich um die Tauchgenehmigung gekümmert, aber es gibt auch nicht so viele Unternehmen, die solch einen Auftrag übernehmen können.«
Douglas räusperte sich. »Wie weit ist es noch?«
Im Grunde hätte er gleich fragen können, wohin sie unterwegs waren.
»Zwei Tage, wenn wir nicht in einen Sturm geraten. Ich denke, wir sind übermorgen da, ungefähr um diese Zeit abends.«
Sie fuhren so nah am Leuchtturm von Gäveskär vorbei, dass sie durch die Fenster ins rot gestrichene Leuchtturmwärterhäuschen schauen konnten. An der Fahrrinne blinkten ihnen rote, grüne und weiße Wegweiser wohlwollend entgegen, bis von Westen das mächtige Leuchtfeuer von Vinga herüberschien. Und nach Vinga würden sie Richtung Westen weiterfahren.
Das Bullauge der Kombüse öffnete sich. Essensduft drang heraus, und eine Stimme rief: »In einer Viertelstunde gibt’s Abendessen!«
Baljan, der hundertdreißig Kilo schwere Koch, war den Großteil des Tages damit beschäftigt gewesen, den Reiseproviant in Empfang zu nehmen. Auf einer Liste hatte er eine Kiste nach der anderen abgehakt, die von der Firma Donsö Fischereigeräte und Schiffsausrüstung eingetroffen war.
Jetzt versammelte sich die Besatzung in der Messe. Alle außer Kapitän Göte, der dem Steuermann beim Essen den Vortritt ließ, ehe dieser die Hundewache auf der Brücke antrat.
Baljan hatte zwei Bleche Toast Hawaii mit einer großzügigen Käseschicht zubereitet. Außerdem gab es gekochte Eier, Sauermilch, Tee und Kaffee. Sören, der Chef der Maschinenanlage, kam in seinem blauen Overall. Er legte Wert darauf, mit »Chief« angesprochen zu werden, was albern war, weil er der Einzige unten im Maschinenraum war. Douglas hatte gehört, wie er sich erkundigte, welche der Tische für die Offiziere und welche für die Mannschaft vorgesehen seien. Der Chief betonte gern, dass er eigentlich auf größeren Schiffen arbeitete, mit mehreren Untergebenen. Nur damit klar war, dass er normalerweise keine Packungen wechselte und leckende Rohre abdichtete. Er mochte zwar ein anstrengender Mensch mit hohem Geltungsbedürfnis sein, aber wenn er an Bord war, dann lag es daran, dass er kompetent und lösungsorientiert war. Und daran, dass Bengt, der ihre erste Wahl gewesen wäre, nicht hatte mitkommen können.
Douglas fragte sich, wie viel die anderen über das Ziel ihrer Reise erfahren hatten. Er nahm sich zwei Toasts und ein Glas Milch und setzte sich Bosse gegenüber an einen der Tische. Eine Sekunde später gesellte sich Torsten zu ihnen.
»Dann sind wir jetzt also unterwegs«, sagte er. »Läuft alles nach Plan?«
Douglas nickte mit vollem Mund. Natürlich wusste Torsten, dass sie die Druckkammer schon früher am Tag ausprobiert hatten, aber manchmal redete er einfach drauflos, um die Stille zu füllen. Eine Stille, die nicht immer gefüllt werden musste. Verstohlen sah Douglas zu Bosse hinüber, der dasselbe zu denken schien.
»Na, dann«, sagte Torsten. »Das Essen sieht ja wirklich lecker aus.«
Ohne zu antworten, erhob sich Bosse, um sich noch einen Toast Hawaii von der Theke zu holen. Er hielt einen Becher Tee in der anderen Hand, als er zurückkam.
»So«, sagte Douglas und sah Torsten an. »Wann erfahren wir eigentlich das Ziel der Fahrt?«
»John Steele will euch selbst von dem Auftrag erzählen, und das wird er tun, wenn er an Bord geht. Aber ich darf schon verraten, dass wir auf dem Weg nach Schottland sind, nach Montrose.«
»Montrose?«, wiederholte Douglas. »Laden wir dort das restliche Gas ein? Wir haben doch nur Heliox dabei.«
»Ganz genau. Es gibt ja keinen Grund, so viel Gas quer über die Nordsee zu schleppen.«
»Aber das ist nicht unser Ziel, oder?«, fragte Douglas.
Bosse antwortete nicht. Torsten sah ihn mit einer Miene an, als fragte er sich, ob er Douglas mehr erzählt hatte als erlaubt. Doch Bosse schien sich nicht darum zu kümmern.
»Wann tauchen denn John Steele und die anderen auf?«, fragte er und sah Torsten an. »In Montrose oder auf den Orkney-Inseln?«
»Verdammt, Bosse.«
»Selber verdammt. Was ist denn das für ein Scheiß? Erzähl doch Douglas etwas mehr! Wenn du ihm als Druckkammerbediener das Leben der Taucher anvertraust, dann kannst du ihm ja wohl ein bisschen mehr Infos geben.«
»Es geht darum, dass John Steele selbst alle informieren will, wenn er an Bord geht. Und nicht einmal ich kenne alle Details.«
»Ach.« Bosse verzog das Gesicht und trank einen Schluck Tee.
Torsten seufzte. Dann beugte er sich vor und senkte die Stimme. »Also, es geht um ein Wrack, das westlich der Orkney-Inseln liegt. Ein Schiff, das während des Ersten Weltkriegs gesunken ist.«
»Ein Seekriegsgrab, nehme ich an«, sagte Douglas und versuchte, so zu klingen, als wüsste er das noch nicht.
»Ja.«
»Und was hatte das Schiff an Bord? Ich vermute ja, wir sind auf die Ladung aus, oder?«
»Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt«, antwortete Torsten. Er klang traurig darüber, dass man es ihm nicht anvertraut hatte. Oder er konnte inzwischen besser lügen.
Ein Kriegsschiff aus dem Ersten Weltkrieg. Und in Anbetracht der Pumpe, die sie dabeihatten, vermutlich im Sand begraben.
3
Robert stand im Sonnenschein auf dem Hof und redete mit einem Mann auf einem roten Quad, der eine Baseballkappe mit dem Logo des Bauernverbands und einen grünen Overall trug. Die Hosenbeine hatte er in die Gummistiefel gesteckt. Da der Mann sehr groß war, wirkte das vierrädrige Geländefahrzeug wie ein Spielzeug. Als er Karin bemerkte, stieg er rasch und geschmeidig ab, lüpfte die Kappe, die das wildwüchsige rote Haar gebändigt hatte, machte einen Diener und grüßte, als wäre sie eine Sonntagsschullehrerin.
»Meine Kollegin Karin Adler«, stellte Robert sie vor. »Sven Johansson besitzt den Hof dort drüben. Korsvik. Und er hat versprochen, eine provisorische Reparatur der Tür zu organisieren.«
»Danke«, sagte Karin.
Als Sven Johansson ihr die rechte Hand gab, umschloss er ihre Hand beinahe vollständig. Ihn umwaberte ein Geruch nach Stall und Kuhfladen, und sein Overall spannte über der Brust, dabei hatte er bestimmt die allergrößte Größe gewählt, die auf dem Markt erhältlich war.
»Bo Stenman und Sven Johansson sind zusammen aufgewachsen.«
»Nur im Sommer«, ergänzte Sven Johansson. »Bosse ist älter als ich, aber er war in den Sommerferien immer bei seinen Großeltern. Und als er das Haus geerbt hat, ist er hierhergezogen.«
»Dann hat er aber das ganze Jahr hier gewohnt, oder?«, fragte Robert.
Sven Johansson hörte auf zu lächeln. Karin kannte diese Miene. Die Einheimischen setzten sie manchmal auf, wenn sie mit Städtern redeten, die nicht den Reiz darin begriffen, den Wechsel der Jahreszeiten draußen auf den Inseln mitzuerleben.
»Ich wohne das ganze Jahr über in Marstrand«, erklärte Karin rasch. »Im Haus von Holger Eriksson in der Vinkelgata.«
»Nicht zu fassen, diese Sache mit Holger«, sagte Sven Johansson, aber nickte anerkennend. Karin nahm an, dass sich das auf ihre Behausung bezog. »Er war manchmal hier und hat sich Pferdeäpfel für seinen Kompost geholt. Sie dürfen sich übrigens auch welche mitnehmen, wenn Sie wollen. Natürlich nur, wenn sein Komposthaufen noch da ist.« Er machte eine Geste zur Koppel nebenan. Sie war leer, aber Karin vermutete, dass dort normalerweise Pferde weideten.
»Er hatte zwar seine ganz eigenen Ansichten, aber ich habe es erst gar nicht glauben können, als ich erfahren habe, dass er der Mann war, der erschlagen im Turist-Hotel aufgefunden wurde.« Sven Johansson spuckte sein Snus aus, holte eine Dose General Extra Strong aus der Tasche, knipste den schwarzen Deckel auf und nahm sich eine neue Prise Tabak.
»Es war schrecklich«, meinte Karin. »Jedenfalls müssen wir Kontakt zu Ihrem Nachbarn aufnehmen.«
Sven Johansson sog die Luft zwischen den Lippen ein und nickte.
»Geht es Bosse gut?«
»Das versuchen wir gerade herauszufinden. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«, fragte Karin.
»Ende Juli, glaube ich. Da hat er gerade sein Boot gepackt.«
»Wissen Sie, wo er steckt?«
»Er wollte segeln gehen, hat er gesagt.«
»Aber jetzt ist September, dann ist er ja schon eine ganze Weile unterwegs.«
»Er war wegen seiner Arbeit schon immer für längere Phasen weg. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ist irgendwas vorgefallen?«
»Aber jetzt arbeitet er doch nicht mehr?«
»Nein, er ist Rentner.«
»Wissen Sie, wo er hinwollte?«
»Bosse ist keiner, dem man viele Fragen stellt. Wenn er einem etwas erzählen will, dann tut er das, und wenn nicht, dann sagt er auch nichts. Genau wie Sie jetzt. Geht es ihm gut?«
»Sein Boot wurde vor den Orkney-Inseln aufgefunden, wo es herrenlos im Wasser trieb.«
»Verdammt.«
»Nördlich des schottischen Festlands«, fügte Karin hinzu, falls Johansson nicht wusste, wo genau die Orkney-Inseln lagen.
»Ich weiß schon. Viele von den Älteren hier haben vor den Shetland-Inseln und in der Nordsee Lengfisch gefischt.« Er schwieg eine Weile, ehe er fortfuhr: »Das Boot ist also im Wasser getrieben, oder war es auf Grund gelaufen?«
»Könnten wir uns irgendwo hinsetzen?«, fragte Karin, die ihren Kopf in den Nacken legen musste, um den Blick des Mannes zu erwidern.
»Ja, natürlich«, sagte Sven Johansson. »Bitte entschuldigen Sie, ich war nur so baff. Die Polizei hier bei uns und so. Kommen Sie mit hoch zu mir.«
Er deutete auf das weiße Haus, das dort lag, wo die Straße einen Bogen machte und auf den Hügel hinaufführte. Dann stieg er auf sein Gefährt und fuhr vorweg.
Der Hof Korsvik hatte einen rot gestrichenen Stall mit einer Scheune und weiteren Nebengebäuden. Zusammen mit dem weißen Wohnhaus umschlossen sie den Hofplatz.
Karin öffnete das Tor, das groß genug war, um drei Kühe nebeneinander hindurch zu pferchen, und vergewisserte sich dann, dass es sich hinter ihnen wieder schloss. Die Flechten auf den steinernen Fundamenten verrieten, dass die Häuser schon lange dort standen, dass Generationen von Menschen über den Hofplatz gegangen waren, um frühmorgens Kühe zu melken und Eier zu sammeln, die anschließend nach Marstrand gebracht und dort am Hafen verkauft wurden. Neben dem Geländefahrzeug stand ein grüner John-Deere-Traktor mit Anhänger, und vor dem Hauptgebäude befand sich am Fuß der Steintreppe eine Sitzgarnitur aus Holz, wie es sie oft auf Rastplätzen gibt. Karin zählte insgesamt sechs Katzen. Zwei davon lagen zusammengerollt auf dem Treppenabsatz, und als Sven Johansson die Tür öffnete und heraustrat, versuchten sie, durch den Türspalt ins Haus zu gelangen.