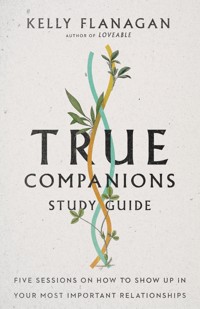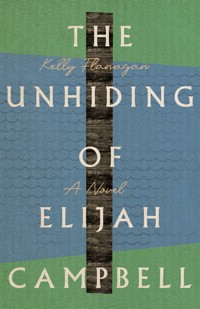Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Elijah Campbell steht an einem Wendepunkt in seinem Leben, denn mit einem Mal droht er alles zu verlieren, was ihm wichtig ist: seine Familie, seine Schriftstellerkarriere, seinen Glauben. Ein ständig wiederkehrender Albtraum aus seiner Kindheit bringt ihn dazu, in seinen Heimatort zurückzukehren. Dort begibt er sich auf eine imaginäre Reise in die Vergangenheit und begegnet einigen der prägendsten Menschen in seinem Leben wieder. Allmählich erkennt er, weshalb seine Frau ihn verlassen hat – und welche Rolle der Albtraum dabei spielt. Gleichzeitig wird ihm bewusst, dass er eine wichtige Entscheidung treffen muss: Wird er es wagen, die Maske abzulegen, hinter der er sich seit so langer Zeit versteckt? Mit seinem Debütroman ist Kelly Flanagan eine beeindruckende Geschichte über die Bedeutung unserer Identität als Kinder Gottes und deren Auswirkung auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gelungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Dr. Kelly Flanagan ist ein klinischer Psychologe, gefragter Redner und Autor diverser Sachbücher. Bekannt wurde er u. a. durch die Veröffentlichung eines herzergreifenden Briefes an seine kleine Tochter, der den beiden sogar einen Auftritt in der amerikanischen Today Show verschaffte. Mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern lebt er in der Nähe von Chicago, Illinois.
Er sagte: „Wir haben alle unsere Geheimnisse.Ich habe sie genauso wie jeder andere – Dinge, für die wir uns schämen und von denen wir uns wünschen, sie wären nie passiert. Verletzende Dinge. Längst vergangene Dinge. Wir sind alle verängstigt und einsam, aber die meiste Zeit verbergen wir das. Es ist, als hätte sich jeder von uns so sehr verirrt, dass wir nicht einmal mehr wissen, wo es nach Hause geht, und wir schämen uns, nach dem Weg zu fragen. Aber weißt du, was passieren würde, wenn wir zugäben, dass wir uns verlaufen haben, und fragten? Nun, Folgendes würde passieren: Wir würden herausfinden, dass wir uns gegenseitig ein Zuhause sein können.“
Frederick Buechner
0
Für Kathryn Helmers, meine Agentin, die immer wieder gefragt hat: „Was wäre, wenn?“Bis das „Wenn“ wahr wurde …
Prolog
Die Vergangenheit liegt hinter uns, aber sie ist auch immer in uns. Was bedeutet, dass sich die Vergangenheit in einem Moment tot und begraben anfühlen kann, und im nächsten Moment erscheint sie uns äußerst lebendig, atmend und präsent.Meine Vergangenheit wurde in Form eines Albtraums wieder lebendig, den ich seit über dreißig Jahren nicht mehr geträumt hatte.
Als ich ein Kind war, begann der Albtraum immer auf dieselbe Weise: Ich stand am Ufer eines Flusses und sah zu, wie das Wasser an mir vorbeirauschte, braun und trüb vor Schlamm, voller Äste und Gestrüpp von Stürmen und mit schäumenden Strudeln. Es war ein bedrohlicher Fluss von der Art, dass ein Mensch ohne Vorwarnung mitgerissen werden und für immer darin verschwinden konnte. Eine alte Holzbrücke spannte sich über das reißende Gewässer. Bei ihrer Errichtung war sie wahrscheinlich eine Meisterleistung der Menschheit gewesen, aber jetzt lagen ihre glorreichen Tage hinter ihr. Das Geländer war weggebrochen. Der Großteil des Stegs war längst vergessenen Stürmen zum Opfer gefallen. Die verbliebenen Bohlen waren morsch und lose, manche lagen an der Stelle, an der sie ursprünglich angebracht worden waren, andere kreuz und quer darüber. Große Lücken im Steg gaben den Blick auf das aufgewühlte Wasser nur wenige Meter darunter frei.
Jenseits der Brücke war die andere Seite des Flusses immer in Nebel gehüllt. Ich hatte keine Ahnung, was der Nebel verbarg, aber ich wollte es unbedingt herausfinden – mit einer Gewissheit, die man nur Glauben nennen kann, einer gespannten Erwartung von der Art, dass man es nur Hoffnung nennen kann, und einer Sehnsucht, die man nur Liebe nennen kann. Also schaute ich zu Boden, um mich auf den ersten Schritt vorzubereiten, und sah an meinen Füßen ein Paar abgenutzte blaue Turnschuhe mit gelben Rändern. Sie waren so schmutzig, dass das Gelb fast braun und das Blau fast schwarz aussah. Der Schuh an meinem rechten Fuß hatte vorn ein Loch, und mein großer Zeh, der in einer verdreckten Socke steckte, ragte heraus.
Jede Nacht schien der Traum alle Einzelheiten zu enthalten, die auch in den vorherigen Versionen aufgetaucht waren, sodass ich genau wusste, wie er enden würde. Ich wusste, ich würde auf die Brücke treten, das Wasser würde steigen, es würde unmöglich sein, ihm zu entkommen, und wenn es mich erreichte, würde ich lautlos schreien, bis ich aufwachte. Aber ich wusste auch, dass ich trotzdem auf die Brücke gehen würde, weil ich mich so sehr nach dem gegenüberliegenden Ufer sehnte, dass ich bereit war, den vertrauten Schreck ein weiteres Mal zu ertragen.
Irgendwann, als ich in der Mittelstufe war, schien der Traum zu sterben. Eines Nachts schlief ich ein, und er begleitete mich nicht länger. Wochen vergingen. Kein Albtraum. Es vergingen Monate, dann Jahre, und irgendwann vergaß ich den alten Albtraum ganz und gar. Es stellte sich jedoch heraus, dass er nicht gestorben war. Er hatte sich nur schlafen gelegt. Oder vielleicht war er gestorben, und fast drei Jahrzehnte später, an der Schwelle zu meinem vierzigsten Geburtstag, wurde er wieder lebendig.
Ich glaube nicht, dass die Zukunft jemals vorherbestimmt ist, aber ich glaube, dass unsere Zukunft auf lange Sicht davon abhängt, was wir aus „Auferstehungsmomenten“ wie diesem machen, vor allem dann, wenn sich solche Momente häufen und eine Art Brücke in der Mitte unseres Lebens bilden; eine Brücke, die wir überqueren können, um Neuland zu betreten, oder eine, von der wir uns abwenden können, um in die vertrauten Gefilde zurückzukehren, aus denen wir gekommen sind.
Meine Brücke bestand aus diesem alten Albtraum. Sie bestand auch aus einem Geheimnis, das ich so lange vor allen anderen verbarg, dass ich es schließlich auch vor mir selbst zu verbergen begann, und aus einem anderen Geheimnis, von dem ich lange Zeit nicht wusste, dass es überhaupt existierte. Meine Brücke bestand aus einer Handvoll geliebter Menschen, die ich verloren hatte und die durch die Gabe der Erinnerung und das Geschenk der Vorstellungskraft wieder zum Leben erwachten. Und sie bestand aus einem Gott, den ich einmal geliebt hatte, der verstummt war und dann eines Tages wieder zu mir zu sprechen begann, und zwar im Zuge jener imaginären Wiederbegegnung mit den Menschen, die ich liebte.
Die Bibel berichtet davon, dass Jesus an einem Freitag stirbt, und es wird viel darüber gesprochen. Dann wird er an einem Sonntag auferweckt, und darüber wird noch mehr gesprochen. Aber über den Samstag dazwischen wird nicht viel gesprochen. Tod und Auferstehung. Die wenigsten reden über das Und, das die Brücke bildet. Manchmal kann sich das ganze Leben wie dieses Und anfühlen. Jeder Tag kann sich anfühlen wie der Samstag zwischen dem, was einem passiert ist, und dem, was man daraus macht – oder auch nicht macht. Und wenn man die Brücke erst einmal als das erkannt hat, was sie ist, muss man sich entscheiden, ob man sie überqueren will, ohne die Garantie, dass man heil auf der anderen Seiten ankommt, und nur mit der leisesten Hoffnung, dass einen dort freundlicheres Gelände erwartet.
Ich habe lange gebraucht, bis ich mein Und – meinen Samstag, meine Brücke – als das erkannt habe, was es war. Zu lange. Es begann mit einem Bein auf meinen Oberschenkeln, mehr als ein Jahrzehnt bevor der Albtraum zurückkehrte.
Mein Name ist Elijah Campbell, und dies ist die Geschichte meines Gefundenwerdens.
1
Manchmal weiß man nicht, dass das eigene Leben auf Pause geschaltet ist, bis jemand oder etwas auf die Abspieltaste drückt. Mein Jemand war Rebecca. Mein Etwas war ihr Bein, das sie von dem in die Jahre gekommenen Betonboden der Terrasse hob, auf der wir uns gegenübersaßen, um es auf meine Oberschenkel zu legen und damit die Kluft zwischen uns zu überbrücken.
Es war schön, es war kühn – und es kam völlig überraschend.
Wir hatten uns einen Monat zuvor an der Universität von Pennsylvania kennengelernt, am ersten Orientierungstag für das Graduiertenprogramm in Klinischer Psychologie. Die meiste Zeit des Monats hatte sie sich bemüht, mit mir in Kontakt zu treten, und mir Signale gesendet, die völlig an mir vorbeigegangen waren. Schließlich hatte sie sich entschlossen, mir eines zu senden, das mir quasi direkt in den Schoß fiel.
Der Tag begann wie jeder andere. Ein Morgen mit Lernen, gefolgt von einem Mikrowellen-Hotdog zum Mittagessen, den ich auf einem Pappteller auf die rückwärtige Terrasse des heruntergekommenen Apartments hinaustrug, das ich für dieses Jahr gemietet hatte. Die Glasschiebetüren, die die Wohnung vom Garten trennten, sahen mit all dem Schmutz, der sich auf ihnen angesammelt hatte, nicht mehr allzu glasig aus, und zudem glitten sie nicht lautlos auf, sondern gaben beim Öffnen ein bedenkliches Knirschen von sich.
Es war ein Freitag im Oktober, ein sonniger Herbstnachmittag, der so perfekt zwischen Sommer und Winter lag, dass Ersterer eine ferne Erinnerung und Letzterer ein Ding der Unmöglichkeit zu sein schien. Ich saß in einem tannengrünen Plastikliegestuhl, den mir mein Vormieter überlassen hatte – einen halb verzehrten Hotdog auf dem Schoß, das Gesicht der Sonne zugewandt und die Augen geschlossen –, als Rebecca um die Ecke des Gebäudes kam. Ihr Schatten verdunkelte die Innenseiten meiner Augenlider, und als sie meinen Namen sagte, erschrak ich so heftig, dass der wackelige Stuhl nach hinten kippte und der Hotdog zu Boden fiel, wo er Reste von herabgefallenem Laub anzog.
Rebecca hob das verschmutzte Würstchen auf, untersuchte es theatralisch und sagte dann belustigt: „Campbell, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich bei dir dafür entschuldigen soll, dass ich dein Mittagessen ruiniert habe, oder ob du mir danken solltest, weil ich dich vor diesem undefinierbaren Stück Fleisch bewahrt habe.“
Meine Verlegenheit darüber, in einem so ungeschminkten Moment gesehen worden zu sein, wurde durch ihren spielerischen Ton kurzzeitig gelindert. Ich faltete die Hände im Schoß, wartete der Dramaturgie wegen einen Moment lang ab, senkte den Kopf und sagte betont feierlich: „Ich danke dir.“
Sie lachte hell auf, dann zog sie den einzigen anderen Liegestuhl – ursprünglich weiß, jetzt verwittert und zu einem trüben Olivgrün gealtert – heran und setzte sich mir gegenüber, sodass sich beinahe unsere Knie berührten. Wir plauderten ein wenig über unsere Kurse und Kommilitonen, und schließlich fragte ich sie beiläufig, was sie an diesem Abend vorhabe. Das war das Stichwort für ihr Bein auf meinen Oberschenkeln.
„Ich weiß nicht, Campbell“, erwiderte sie. „Was machst du heute Abend?“
Das Ganze versetzte mir einen Schock, in dem sich Hoffnung und Angst verwoben – die widersprüchliche Reaktion eines Menschen, dessen Einsamkeit seine größte Wunde und zugleich seine zuverlässigste Verteidigungsstrategie ist. Ich starrte auf das Silberreiher-Tattoo, das die noch sommerlich gebräunte Haut oberhalb ihres Knöchels zierte, und fühlte mich plötzlich wie die Zweitbesetzung, die bei der Theaterpremiere unvermittelt ins Rampenlicht gerufen wird. Die Hitze ihrer Aufmerksamkeit trieb mir kleine Schweißperlen auf die Stirn.
„Ich, äh, na ja … Also, weißt du … Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, ich habe tatsächlich etwas geplant, aber, äh, das ist keine große Sache. Ich könnte es wahrscheinlich absagen. Aber, na ja, vielleicht auch nicht, also, äh …“
Die Wahrheit war, dass mir mein Mitbewohner für diesen Abend ein Blind Date organisiert hatte.
Ich holte tief Luft und versuchte, meine zuverlässigste Art der Reaktion hervorzubringen, wenn die Gefahr bestand, dass meine Mauern durchbrochen wurden: ein Lächeln, das so strahlend war, dass keine Prüfung der Wattstärke ihm je standgehalten hatte. Es war kein aufgesetztes Lächeln; es war instinktiv – eines, das eng verwandt ist mit Aufrichtigkeit –, und wahrscheinlich war es deshalb so wirkungsvoll. Meist verband ich es mit der einen oder anderen charismatischen Frage, und voilà, das Rampenlicht wich von mir. Ich stand wieder im Dunkeln, aber wenigstens war ich in Sicherheit.
Ich strahlte also, aber die Wiederholung meiner ursprünglichen Frage – „Und was hast du heute Abend vor?“ – kam wohl ein bisschen zu verzweifelt daher.
Rebecca musterte mich nachdenklich mit ihren haselnussbraunen Augen. Ihr langes dunkles Haar, das ihr sanft über die Schultern fiel, glänzte im Sonnenlicht und offenbarte ein paar goldbraune Reflexe.
Die kleinen Schweißperlen auf meiner Stirn drohten zu Tropfen zu werden, während ich darauf wartete, dass sie die Augenbrauen hochziehen, ihr Bein wegnehmen und zu einem Typen weiterziehen würde, der die einfache Frage nach seinen Feierabendplänen beantworten konnte, ohne sich völlig zum Idioten zu machen.
Stattdessen setzte sie noch eins drauf, indem sie das zweite Bein hob und es über Kreuz auf das erste legte.
„Es war nicht fair, mit einer so schwierigen Frage anzufangen“, sagte sie ganz sachlich.
Wir wussten beide, dass die Frage nicht schwer gewesen war. Doch in ihrem Tonfall konnte ich Verständnis dafür hören, dass sie für mich schwierig gewesen war. Das fühlte sich wie ein Geschenk an. Seit langer Zeit hatte mir niemand mehr ein solches Geschenk gemacht.
„Ich sag dir was“, fuhr sie fort, „wenn du heute Abend schon etwas vorhast, sollten wir uns vielleicht jetzt gleich besser kennenlernen. Lass uns ‚Zwei Wahrheiten und eine Lüge‘ spielen.“
Es hörte sich nach einem Spiel an, mit dem ich mich nur zu einem Drittel wohlfühlen würde, aber ich war so dankbar für das Geschenk, das sie mir gerade gemacht hatte, dass ich den Vorschlag einfach nicht ablehnen konnte. „Davon habe ich noch nie gehört. Wie geht das?“ Ich bemühte mich, nicht zu verhalten zu klingen, und es gelang mir ziemlich gut.
„Es ist ganz einfach“, antwortete Rebecca mit einem Lächeln in der Stimme und auf den Lippen. „Ich erzähle dir drei Dinge über mich. Zwei davon sind wahr, eins nicht, und du musst erraten, welches nicht stimmt. Dann bist du dran. Alles klar?“ Sie hielt mir die geballte Faust für einen Fauststoß hin.
Erleichtert darüber, dass das Rampenlicht nun wieder auf sie fallen würde, ignorierte ich, dass es schließlich zu mir zurückwandern würde. „Cool“, stimmte ich zu, ballte ebenfalls eine Hand zur Faust und berührte ihre mit meiner. In diesem Moment schloss sich eine Art Stromkreis zwischen uns, und es traf mich wie der Blitz. Plötzlich war ich hellwach.
Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass ich geschlafen hatte.
„Okay. Hmmm“, sagte sie, und während sie überlegte, was sie sagen sollte, zog sie mit dem Zeigefinger die Unterlippe nach unten und ließ sie zurückschnellen, sodass ein Plopp zu hören war. Wieder und wieder. Plopp. Plopp. Plopp. Es war sehr unschuldig und zugleich ungemein attraktiv.
„Ich hab’s!“ Sie sah mir direkt in die Augen. „Einmal habe ich meinen Pass verloren, als ich illegal ein verlassenes Weingut in den Hügeln Italiens besetzte, und bin ohne jede Hilfe zurück nach Maryland gekommen. Ich bin schon zweimal Fallschirm gesprungen, und ich habe drei Tattoos. Okay, was davon ist eine Lüge?“
Sie überkreuzte die Beine andersherum. Die Farbe des Silberreihers an ihrem Knöchel wechselte von Blau zu Violett, als er vom Licht in den Schatten wanderte.
„Ich nehme an, das Letzte ist eine Lüge. Du hast nur dieses eine Tattoo.“
Sie lächelte wieder und drehte ihren rechten Arm, sodass die Tätowierung eines Kreuzes auf der Unterseite ihres Handgelenks sichtbar wurde. „Falsch. Ich habe tatsächlich drei Tattoos.“
Das dritte zeigte sie mir nicht. Das machte mich stutzig.
„Die Lüge“, verriet sie, „war, dass ich nur einmal Fallschirm gesprungen bin. Okay, jetzt bist du dran.“
Sie lehnte sich vor und stützte das Kinn auf die Hand wie Rodins Denker, um mir mit voller Aufmerksamkeit zuzuhören, und ihr forschender Blick war wie tausend Scheinwerfer – kein Lächeln von mir konnte ihn überstrahlen. Also rief ich mir in Erinnerung, dass Angriff die beste Verteidigung ist, und preschte vor.
„Ich komme aus einer kleinen Stadt in Illinois namens Bradford’s Ferry. So ziemlich jeder nennt mich Eli – ja, so wie in ‚Celli‘. Und …“, ich machte eine kurze Pause und versuchte, mir eine Lüge auszudenken, „meine Eltern sind beide tot.“ Das war natürlich eine schreckliche Art, aus dem Rampenlicht zu verschwinden. Der Typ, der von seiner Abschlussklasse zum sozial kompetentesten Schüler gewählt worden war, schien in die falsche Richtung abgebogen zu sein.
Rebeccas Augenbrauen zogen sich zusammen, und die Hand, auf die sie das Kinn gestützt hatte, wanderte zu ihrem Mund. „Oh nein. Ich hoffe, das Letzte stimmt nicht!“
Ich fuhr mir verlegen mit der Hand über die Stirn und wischte mir unwillkürlich den Schweiß weg. „Nein, das Letzte stimmt nicht. Tut mir leid. Es war gedankenlos von mir, das in ein harmloses Spiel einzubauen. Meine Mutter lebt noch und wohnt in Bradford’s Ferry. Aber mein Vater ist vor fast sieben Jahren gestorben.“ Ich sah die unausgesprochene Frage in ihren Augen und fügte hinzu: „Herzinfarkt beim Schneeschaufeln. Kurz bevor ich in meinem ersten Collegejahr zu Weihnachten nach Hause kam.“
„Das tut mir sehr leid“, sagte sie, und es klang aufrichtig.
„Ist schon okay. Ich meine, danke. Inzwischen komme ich ganz gut damit klar. Die Beziehung zu meinem Vater war kompliziert und –“ Ich brach ab, entsetzt über meinen offensichtlichen Eifer, ihr etwas zu erzählen, von dem ich vorgehabt hatte, es mit ins Grab zu nehmen. „Jetzt werde ich schon wieder so ernst. Okay, jetzt bist du dran, der Spielverderber zu sein!“ Selbstironie. Es funktionierte. Vielleicht war Mr Sozialkompetenz-King doch nicht komplett abgetaucht.
Rebecca lächelte wieder und trat zögernd, aber bereitwillig zurück ins Rampenlicht. Nachdem sie sich einen Moment Zeit genommen hatte, um sich zu sammeln, bot sie ihre nächste Runde an. „Eines Tages möchte ich als Therapeutin für unterprivilegierte Kinder arbeiten. Ich habe einmal eine zweibeinige Schildkröte gefunden und sie gesund gepflegt, und sie wurde mein Haustier. Ich habe sie Geppetto getauft. Und ich glaube, ich hab dich sehr gern, Elijah Campbell.“
Diesmal war mein Lächeln leichter zu finden, und jedes Lumen davon war echt. Meine Erwiderung kam ebenfalls wie von selbst. „Nun, ich hoffe sehr, dass Letzteres keine Lüge ist.“
„Ist es nicht“, antwortete sie unverzüglich und klang dabei fast zärtlich.
„Dann nehme ich an, es ist das Zweite.“
„Da liegen Sie richtig, Sir. Geppetto hatte drei Beine, nicht zwei.“
In diesem Moment entfloh mir ein echtes Lachen, und Rebeccas Gesichtsausdruck ließ vermuten, dass ein Lachen von mir die denkbar größte Belohnung für sie war.
„Okay, du bist dran“, sagte sie und nahm wieder ihre Denkerpose ein. Doch diesmal wurde ich durch ein Summen in ihrem Rucksack gerettet. Sie zog ihr Handy heraus, klappte es auf und legte den Kopf schief, um mit dem Anrufer zu sprechen. Weitere goldbraune Strähnchen schimmerten in ihrem Haar wie die goldenen Blätter des Ahorns neben der Terrasse.
Schließlich klappte sie das Telefon wieder zu. „Ich muss los“, verkündete sie, nahm die Beine von meinen Oberschenkeln und stand auf. „Meine Mitbewohnerin und ich sind auf der Suche nach einer gebrauchten Couch, und sie meint, sie hat eine heiße Spur.“
Sie hielt mir wieder die Faust hin. Wieder tippte ich sie an. Wieder diese Elektrizität zwischen uns.
Sie drehte sich auf dem Absatz um und rief über die Schulter: „Bis bald, Eli!“, wobei sie meinen Namen richtig aussprach. Sie hatte tatsächlich zugehört. Ihr Scheinwerferlicht wirkte schon etwas weniger bedrohlich als das der anderen. Und plötzlich war es die Aussicht, dass Rebecca gehen würde, die mir nicht behagte und mich impulsiv werden ließ. Der Impuls war, unser Gespräch noch ein wenig in die Länge zu ziehen.
„Hey!“, rief ich. Sie blieb stehen und drehte sich um. „Hast du einen Spitznamen?“
Sie schüttelte den Kopf. „Nö. Nur Rebecca. Der ganze Name. Ich wollte es nie anders haben. Es erinnert mich daran, immer mit allem, was mich ausmacht, in Erscheinung zu treten.“ Sie machte eine nachdenkliche Pause. „Und ich schätze, das erwarte ich auch von anderen – dass sie sich mir gegenüber mit allem zeigen, was sie ausmacht. Auch wenn sie ihren Namen abgekürzt haben.“ Sie lächelte spitzbübisch. „Nächsten Freitag schaue ich wieder bei dir vorbei. Vielleicht erwische ich dich ja, wie du dich wieder wie eine Schildkröte sonnst.“
Dann verschwand sie um die Ecke.
Wie eine Schildkröte.
Der Satz ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und eine Theorie über Rebeccas Interesse an mir begann in mir Gestalt anzunehmen: Wie eine Schildkröte hatte auch ich einen Panzer, und wie bei Geppetto spürte Rebecca die Wunde, die sich darunter verbarg. Sie selbst schien die Parallele nicht zu bemerken, aber mir verursachte der Vergleich einen Kloß im Hals.
2
Es gibt wahrscheinlich einen schmalen Grat zwischen heftiger Verliebtheit und Stalking. In der darauffolgenden Woche bewegte ich mich auf ebenjener hauchfeinen Linie.
Ich merkte mir, wo Rebecca in den verschiedenen Unterrichtsräumen saß, und war stets vor ihr da, um mich so zu positionieren, dass ich sie beobachten konnte, ohne dass sie es merkte. Jedes Mal, wenn sie an ihrer Unterlippe zupfte und sie gegen die Oberlippe zurückschnellen ließ, verliebte ich mich noch ein bisschen mehr in sie.
Ich änderte meine abendliche Laufroute, sodass ich genau in dem Moment an ihrer Wohnung im ersten Stock vorbeikam, wenn die Dämmerung einsetzte und die Lampen eingeschaltet waren, aber noch niemand daran gedacht hatte, die Vorhänge zu schließen. Mehrere Abende hintereinander sah ich sie mit ihrer Mitbewohnerin auf der neuen gebrauchten Couch sitzen und über irgendeine Sitcom lachen.
Am Donnerstagnachmittag machte ich sogar einen Umweg, um im Supermarkt in der Nähe ihrer Wohnung einzukaufen, in der Hoffnung, sie dort zu treffen. Und siehe da, es funktionierte. Jedenfalls mehr oder weniger. Ich warf gerade eine Packung Mikrowellen-Hotdogs in den Einkaufswagen, als ich aufblickte und sah, wie sie Salatköpfe begutachtete. Ich schämte mich so sehr für den Kauf von undefinierbarem Fleisch, dass ich mich auf den direkten Weg zur Kasse machte und den Laden so schnell wie möglich verließ.
Nach dieser Begebenheit hatte ich das Gefühl, dass ich eine einstweilige Verfügung gegen mich selbst erwirken sollte, und ich war nicht gerade stolz darauf.
Noch schlimmer für mich war, dass ich nicht sagen konnte, was mit mir los war. Bevor Rebecca auf meiner Terrasse aufgetaucht war, hätte ich jedem, der es wissen wollte, gesagt, dass es mir rundum gut ginge, danke der Nachfrage. Ein bisschen gelangweilt vom Leben vielleicht, aber im Grunde ganz okay. Doch in der letzten Woche hatte ich jedes Mal, wenn ich an Rebeccas Schildkröte dachte – an den Panzer, an das verlorene Bein –, einen dicken Kloß im Hals gehabt.
In gewisser Weise war ich mit diesem Kloß im Hals vertraut. Es war der Kloß, den ich fühlte, wenn ich mit dem Schmerz eines anderen Menschen konfrontiert wurde. Ein Studienberater hatte es Mitgefühl genannt und gesagt, es sei die Superkraft derer, die in sozialen Berufen arbeiten. Ich hatte auf ihn gehört und mich für Psychologie als Hauptfach entschieden, und der erste Monat am Graduiertenkolleg hatte meine Entscheidung bestätigt. Jeder Klient, den ich bisher gesehen hatte, hatte mir einen Kloß im Hals beschert, und ich war mehr denn je davon überzeugt, dass der größte Teil unseres Leidens unnötig ist: Unsere Verletzungen führen zu Verletzungen und unsere Fehler zu Fehlern, weil sich niemand die Zeit nimmt, mit uns darüber zu sprechen, sie anzuschauen, sie umzudrehen und näher zu untersuchen, damit wir sie wahrnehmen und mit ihnen umzugehen lernen.
Dieser Mangel an Reflexion geht meiner Meinung nach zurück bis ganz zum Anfang, bis zum Garten Eden.
Als Psychologiestudent stellte ich mir schon früh die Frage, was gewesen wäre, wenn Gott die Menschen im Garten behalten und mit ihnen über ihre Fehler gesprochen hätte, sodass sie nicht so unwissend darüber geblieben und in der Lage gewesen wären, sie fortan zu vermeiden. Was wäre gewesen, wenn er sie dazu eingeladen hätte, das Warum ihrer Fehler zu ergründen – das Wer, Was, Wo und Wann? Sie aus dem Garten zu vertreiben, ergab keinen Sinn für mich. Und ich kam zu dem Schluss, dass genau das der Grund war, weshalb Jesus für so viele Menschen so viel Sinn ergab. Er lud sie wieder in den Garten ein, durch Löcher im Dach, durch Momente an einem Brunnen, durch Brote und Körbe mit Fischen. Und als Therapeut wollte ich meinen Teil dazu beitragen, die Menschen wieder in den Garten einzuladen; zu einem guten Gespräch darüber, was in ihrer Vergangenheit schiefgegangen war.
Aber mir selbst gegenüber hatte ich diesen Kloß im Hals noch nie gespürt, und das beunruhigte mich. Die Ursache dafür sah ich in einer ungewohnten Sehnsucht, gesehen zu werden, gekannt zu sein. Allerdings betrachtete ich mich gern als einen Menschen, der am liebsten „für sich“ ist. Nicht ausweichend. Nicht ängstlich. Einfach nur … gern für sich. Ich trug diesen Charakterzug mit Stolz. Dann kam Rebecca. Und mit ihr Geppetto. Und mit ihm das Bild einer harten Schale, die ein fehlendes Körperglied verbarg. Die ganze Woche über war es schwierig für mich, in den Spiegel zu schauen, ohne darin eine Schildkröte zu sehen, die mich anstarrte.
Achtzehn Stunden nachdem ich mit einer Zehnerpackung Mikrowellen-Hotdogs aus dem Supermarkt geflohen war, saß ich an einem weiteren herbstlichen Freitagnachmittag auf meiner Terrasse, auch wenn es diesmal eher Winter als Sommer war. Der Himmel war bewölkt und grau, das Blätterdach des Ahorns neben der Terrasse eher spärlich, die Terrasse selbst komplett mit gefallenem Laub bedeckt. Ein kalter Nordwind ließ mir die zehn Grad vorkommen wie fünf.
Ich saß auf dem schmutzigen weißen Stuhl und hatte die Hände in den Jackentaschen vergraben. Ich hatte auf einen Hotdog verzichtet, in der Hoffnung, mit Rebecca zu Mittag essen zu können, falls sie auftauchen würde, und mein Magen begann schon zu knurren. Ich sah auf meine Armbanduhr. Ein Uhr. Dreißig Minuten später als letzte Woche. Ich verspürte einen Anflug von Enttäuschung. Ich verspürte einen Anflug von Erleichterung. Und ich bemerkte, dass die Enttäuschung stärker war, was mir abermals diesen Kloß in den Hals trieb. Schließlich stand ich auf und ging auf die Schiebetür zu, hielt aber inne, als ich das Rascheln von Blättern hörte. Ich drehte mich um. Und da war sie, sie stand unter dem Ahorn.
„Hallo“, sagte ich mit schlecht vorgetäuschter Nonchalance.
Rebecca stand einfach nur da und machte wieder dieses Ding mit ihren haselnussbraunen Augen. Sie sah mich an, machte eine Bestandsaufnahme. Ihr Lächeln sagte mir, dass sie wusste, dass ich auf sie gewartet hatte, und dass sie wusste, dass ich wusste, dass sie es wusste, und dass wir nicht darüber reden mussten. Die Geschenke hörten gar nicht mehr auf.
„Wollen wir was essen gehen?“, fragten wir gleichzeitig.
„Chipsy“, riefen wir wie aus einem Mund, gefolgt von synchronem Gelächter.
Ich nehme an, wenn man nicht wieder zum Kind wird, wenn man sich verliebt, dann ist es wahrscheinlich etwas anderes als Verliebtheit, das einen da gerade überfällt.
„Ich zahle“, sagte ich schnell, um ein weiteres „Chipsy“ zu vermeiden.
„Abgemacht, Campbell. Ich brauche jetzt unbedingt einen Big Mac.“
Ich atmete innerlich auf. Das Essen bei McDonald’s war relativ günstig, und das Geld aus meinem Studiendarlehen hatte sich schnell verflüchtigt.
Rebecca zitterte. Ich ging zu ihr, schlüpfte aus meiner Jacke und legte sie ihr um. Sie zog sie fest um sich und sagte: „Normalerweise stehe ich nicht so auf Ritterlichkeit, aber danke. Diese Kaltfront hat mich überrumpelt. Musst du dir noch was anderes zum Überziehen holen?“
„Nein, nein, schon okay“, antwortete ich und versuchte, lässig zu klingen.
Es war natürlich nicht okay. Ich fror. Aber ich hatte nur diese eine Jacke.
„In Ordnung“, sagte sie, nahm mich beim Wort und drehte sich um, wobei sie den Arm so anwinkelte, dass ich mich bei ihr einhaken konnte. „Sollen wir?“
Zum Glück war der nächste McDonald’s nur ein paar Gehminuten entfernt. Auf dem Weg dorthin erfuhr ich, dass Rebecca sich das Reiher-Tattoo hatte stechen lassen, weil es das Stadtsymbol von Seaside, Maryland, war, der Küstenstadt, in der sie aufgewachsen war. Ich sagte ihr, dass Tattoos für mich absurd seien – es gebe auch so schon genug Schmerz im Leben, weshalb man sich nicht freiwillig noch mehr davon zufügen müsse. Sie sagte, genau das sei es, was ihr an Tattoos so gut gefallen würde – sie täten weh, wenn sie entstünden, aber auf lange Sicht erfreue man sich daran, und sie habe vor, so viel Schmerz wie möglich in etwas zu verwandeln, woran man sich auf lange Sicht erfreuen könne.
Ich dachte an Geppetto, und der Kloß in meinem Hals kehrte zurück.
Wir bestellten zwei große Burger-Menüs und fanden einen Tisch, an dem man noch die trüben Spuren halbherziger Reinigungsversuche sehen konnte. Bis Rebecca ihren Big Mac verspeist hatte, wusste sie, dass ich ein Einzelkind war, und ich wusste, dass sie zwei jüngere Schwestern hatte, die sie vergötterte. Ich wusste, dass sie ihre Mutter von Herzen liebte, keine Frage, aber dass sie eindeutig „Papas Liebling“ war, auch wenn ich vermutete, dass sie sich über diese Bezeichnung aufregen würde. Ihr Vater war Anwalt. Meiner war auch Anwalt gewesen. Ich war froh, eine weitere Gemeinsamkeit mit ihr gefunden zu haben.
Das Gespräch lief gut, richtig gut, bis ich ihn sah.
Er saß allein an einem Zweiertisch, und über Rebeccas Schulter hinweg fiel mein Blick direkt auf ihn. Er war um die vierzig und trug ein kurzärmeliges Hemd mit einer nichtssagenden braunen Krawatte, die schlecht geknotet war und ihm locker um den Hals hing, nicht absichtlich, sondern aus Nachlässigkeit. Sein rotblondes Haar, für das ein Schnitt vermutlich schon einen Monat überfällig war, war überkorrekt zur Seite gekämmt und angeklatscht, was ihn wohl als weltmännisch ausweisen sollte, aber nur von vergeblichem Bemühen zeugte und somit den gegenteiligen Effekt hatte. Ein schlaffes Kinn unter dünnen Lippen, die von einem struppigen Schnurrbart überdacht waren. Ein Gesicht, das so jungenhaft war, dass es in keinem Umfeld respektiert werden würde, wo man das Tragen einer Krawatte voraussetzte. Sanfte, wässrige Augen mit Kummerfalten darum und eingerahmt von einer modisch äußerst fragwürdigen Brille. Er aß Pommes frites, immer eine nach der anderen, und sein Blick war geradeaus gerichtet, eigentlich direkt auf mich, aber tatsächlich durch mich hindurch. Der Blick eines Menschen, der immerzu in eine Vergangenheit blickt, der er nicht entkommen kann.
Der Kloß in meinem Hals war so groß, dass ich kaum atmen konnte, von essen ganz zu schweigen.
Ich versuchte, meine Aufmerksamkeit wieder auf die Unterhaltung mit Rebecca zu lenken. Offenbar war ihr Vater nicht nur Anwalt, sondern noch dazu ein sehr erfolgreicher. Die Art von Erfolg, die es einem ermöglicht, eines dieser Häuser an der Küste zu kaufen, an denen die Touristen im Sommer vorbeifahren, sich die Augen aus dem Kopf starren und sich fragen, womit solche Leute wohl ihr Geld verdienen – wobei sie natürlich annehmen, dass es sich dabei um etwas höchst Verwerfliches handeln muss. Der Beruf von Rebeccas Vater war jedoch alles andere als verwerflich. Der Mann war spezialisiert auf Umweltrecht und verklagte echt reiche Unternehmen, die dem Planeten echt schreckliche Dinge antaten. Die Erde schien sich bei ihm für seine Dienste zu bedanken, indem sie ihn mit einer ihrer schönsten Aussichten belohnte.
„Eli? Alles okay?“
In diesem Moment hatte ich das ungute Gefühl, Rebecca könnte mir eine Frage gestellt haben, auf die ich nicht geantwortet hatte. In ihrer Stimme schwang Besorgnis mit.
„Ja“, sagte ich und richtete meine Aufmerksamkeit wieder ganz auf sie. „Es ist nur dieser Typ da drüben. Er ist … Ich weiß nicht, irgendetwas ist mit ihm, und das bringt mich vollkommen durcheinander.“
Sie reagierte auf die Heiserkeit in meiner Stimme, indem sie kurz ihre Hand auf meine legte. Dann ließ sie wie beiläufig ihre Serviette zu Boden fallen und bückte sich, um sie aufzuheben, wobei sie den Kopf leicht drehte, um den Mann sehen zu können. Als sich unsere Blicke wieder trafen, lag Verständnis in ihrem.
„Du meine Güte, Eli, er wirkt so einsam.“
Bei dem Wort einsam löste sich etwas in mir; etwas, das für eine sehr lange Zeit sehr angespannt gewesen sein musste. Denn bis zu diesem Moment hatte ich nicht gewusst, dass es überhaupt existierte – im Gegensatz zu dem Kloß in meinem Hals, der es offenbar schon längst wusste.
Rebecca fragte ein weiteres Mal, ob alles okay sei. Ich hörte sie irgendwie und irgendwie auch nicht, als ich aufstand und zu dem Tisch ging, an dem der Mann saß. Ich wechselte ein paar Worte mit ihm, wobei die Teiche in seinen Augen etwas größer wurden und eine andere Art von Falten in seinen Augenwinkeln erschien, während seine Lippen ein angerostetes, zaghaftes Lächeln formten. Ich wünschte ihm einen schönen Tag und ging zurück zu unserem Tisch, von wo aus Rebecca mich mit leicht geöffnetem Mund beobachtet hatte.
„Bitte entschuldige“, sagte ich und setzte mich wieder. Ihr Mund stand immer noch offen, und ich spürte abermals Schweißperlen der Verlegenheit auf meine Stirn treten. „Es war unhöflich von mir, dich hier so sitzen zu lassen.“ Immer noch ein offener Mund. Die Tropfen auf meiner Stirn drohten zu einem echten Schweißausbruch anzuwachsen. „Ich weiß auch nicht, was über mich gekommen ist. Ich hoffe, du bist mir nicht böse.“
Ihre Zähne schlugen hörbar aufeinander, als sie den Mund schloss. „Was hast du zu ihm gesagt?“
„Nun, ich … Du hast ja selbst gesagt, er ist einsam. Das sickert ihm aus jeder Pore. Deshalb wollte ich ihn wissen lassen, dass er von jemandem gesehen wird.“ Ich stockte und überlegte, dann fing ich noch mal von vorn an. „Ich schätze, dass ich ihn das wissen lassen musste. Ich konnte nicht anders … Also habe ich mich entschuldigt, dass ich ihn beim Mittagessen störe, und ihm gesagt, dass Augen, wie er sie hat, für mich bewirken, dass die Welt sich ein wenig sicherer anfühlt.“
Es war mir zu peinlich, Rebecca in die Augen zu sehen, also schaute ich wieder an ihr vorbei zu dem Mann, der immer noch in die Ferne starrte. Sein Blick wirkte jetzt allerdings anders auf mich. Gut möglich, dass seine Vergangenheit für einen Moment vergessen war. Gut möglich, dass er in seine Zukunft blickte.
Rebecca schwieg. Ich zwang mich, den Blick wieder auf ihr Gesicht zu richten, innerlich schon gegen das gewappnet, was ich darin finden würde. Was ich tatsächlich sah, war eine Tränenspur auf ihrer Wange.
Sie sah mich einfach nur an. Aber dieser Blick von ihr verursachte mir kein Unbehagen. Im Gegenteil, ich empfand ihn als außerordentlich wohltuend. Er bewirkte etwas in mir, das ich schon lange nicht mehr gespürt hatte: eine Hoffnung, die frei war von Angst.
In diesem Moment erschien es mir tatsächlich möglich, dass auch Rebecca Miller in ihre Zukunft blickte und dass ich darin eine Rolle spielen könnte.
3
Rebecca und ich haben den Beginn unserer Beziehung nie wirklich offiziell gemacht. In der einen Woche legte sie ihr Bein auf meine Oberschenkel, in der nächsten aßen wir bei McDonald’s, und in der darauffolgenden Woche fiel es mir schwer, mich auf irgendetwas anderes als auf sie zu konzentrieren. Der Rest dieses Herbstes war verschwommen, die Art von Verschwommenheit, wie man sie sehen muss, wenn man von einer hohen Klippe in den Ozean springt. Rebecca war mein Ozean, und ich fiel schnell. Alles andere war nur die Welt, die ich beim Fallen zufällig passierte.
Als die Winterferien kamen, fühlte es sich schon unnatürlich an, getrennte Wege zu gehen. Trotzdem plante Rebecca, die Feiertage in Maryland zu verbringen, während ich überhaupt keine Pläne hatte. Ich hatte erwogen, für ein oder zwei Tage nach Bradford’s Ferry zu fahren. Im Draughty Den, einem gemütlichen, schummrigen Pub im Herzen der Stadt, würden sich alte Freunde treffen, darunter auch Benjamin, mein bester Freund aus Kindertagen und inzwischen ein angehender Literaturagent. Alle würden ihr Bierchen schlürfen und Geschichten aus der guten alten Zeit zum Besten geben, während draußen vor dem Fenster der Schnee fiel. Aber diese Belohnung war mir die Investition einfach nicht wert: die lange Busfahrt nach Hause, die bemühten Gespräche mit meiner Mutter, die ansonsten ohrenbetäubende Stille in meinem Elternhaus, die lange Busfahrt zurück.
Rebecca verließ den Campus am Freitag vor Weihnachten.
Drei Tage später, am kürzesten Tag des Jahres, wäre sie beinahe ums Leben gekommen.
Der Anruf ihrer Mutter weckte mich gegen Mittag. Kurz nach Mitternacht war Rebecca nach einer abendlichen Unternehmung mit alten Freunden nach Hause gefahren. Sie hatte nichts getrunken. Der andere Fahrer schon. Sie schaute nach links, sah, dass er trotz roter Ampel nicht langsamer wurde, und machte eine Vollbremsung. Der für Maryland untypische Schneefall sorgte für eine rutschige Fahrbahn. Rebeccas Wagen schlitterte auf die Kreuzung, und der andere Wagen raste mit gut sechzig Stundenkilometern auf sie zu und prallte in ihre Fahrerseite. Als Rebecca acht Stunden später aufwachte, bezeichneten die Ärzte ihr Überleben als ein Wunder, Seitenaufprall-Airbag hin oder her. Sie hatte ein paar kleinere Schnittwunden, mehrere starke Prellungen und zwei gebrochene Rippen, aber das Schlimmste war eine schwere Gehirnerschütterung. Das Erste, worum sie ihre Mutter nach dem Aufwachen bat, war, mich anzurufen. Es war das erste Mal, dass ihre Eltern von mir hörten. Rebecca hatte vorgehabt, ihnen am Weihnachtsmorgen von mir zu erzählen.
Ich fragte Mrs Miller, ob ich Rebecca besuchen könne. Ich hörte ein Zögern in ihrem Ja, tat aber so, als hätte ich es nicht bemerkt. Ich packte das Nötigste zusammen, kaufte eine Fahrkarte für den frühesten Zug ab Philadelphia und war zum Abendessen in Seaside, Maryland. Ich traf ihre Eltern im Wartezimmer des Krankenhauses. Ich war unrasiert und ziemlich sicher, dass ich mir vor der Abfahrt nicht die Zähne geputzt hatte, aber natürlich waren sie nicht wirklich auf mich fokussiert.
Rebecca war stark sediert, um ihrem Gehirn Zeit zum Heilen zu geben. Gleichzeitig war sie jedoch wach genug, dass sich ihre Mundwinkel nach oben zogen, als sie mich sah, und dass eine Träne über ihre Wange kullerte, als die Besuchszeit für alle außer den Familienangehörigen zu Ende war. Ich nahm diese Träne als Zeichen dafür, dass sie sich wünschte, ich wäre ein Teil ihrer Familie. Ich wünschte mir das Gleiche.
In den nächsten Tagen befand ich mich in einer seltsamen Situation: Ich lebte im Haus von Menschen, die mich kaum kannten, und wünschte mir nichts sehnlicher, als mich um ihre Tochter kümmern zu dürfen – wohl wissend, dass mein Name auf der Liste der Kandidaten von Bezugspersonen ganz weit unten stand. Also machte ich mich nützlich, indem ich den Millers anbot, im Haushalt einzuspringen. Sie nahmen mein Angebot zögernd an. Ich kaufte Lebensmittel ein. Ich wartete im Haus, um einige Last-Minute-Geschenkelieferungen entgegenzunehmen. Ich packte sogar einen Stapel Geschenke ein.
Als Rebecca am Weihnachtsmorgen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hatte ich die Einladung ihrer Eltern, den Rest der Winterferien bei ihnen zu verbringen, bereits dankbar angenommen. Sie waren so höflich zu fragen, ob meine Mutter vielleicht gekränkt sei, wenn ich die Feiertage nicht bei ihr verbringen würde. Ich sagte ihnen, dass meine Mutter mit der Größe ihrer Festtagsgesellschaft sicher sehr zufrieden wäre. Das war zutreffend. Zutreffend war auch, dass sie die Feiertage allein verbringen würde.
Unsere gemeinsame Zeit im Haus der Millers war wunderschön, aber die Schönheit dieser zwei Wochen ging weit hinaus über die geschmackvolle Einrichtung, die festliche Beleuchtung und die Sonnenaufgänge über dem Meer, die durch die Jalousien meines Schlafzimmers schimmerten. Die Zeit dort war so schön, weil es keine Verstellung gab, weil die Millers einander aufrichtige Zuneigung entgegenbrachten, weil sie unterschiedlich waren und diese Unterschiede feierten, und wegen des Gefühls, dass man hier mit nichts hinterm Berge halten musste. Als sich die Ferien dem Ende zuneigten, wollte ich nur ungern gehen.
In den Tagen vor unserer Abreise bot Rebeccas Vater an, ihr ein neues Auto zu kaufen. Sie lehnte aus demselben Grund ab, aus dem sie auch ihre Rückreise von Italien nach Hause allein bewerkstelligt hatte: Sie wollte beweisen, dass sie stark genug war, um auf eigenen Beinen zu stehen. Also organisierte sie uns einen Leihwagen, und gemeinsam fuhren wir zurück nach Philadelphia.
Bevor wir am darauffolgenden Tag den Mietwagen zurückgaben, ging ich mit ihr ein Auto kaufen. Rebeccas Erspartes reichte nur für einen Gebrauchtwagen. Also wies ich sie darauf hin, dass wir zusammen doch genug Geld hätten, um uns die Kosten für einen Neuwagen in einer vernünftigen Preisklasse zu teilen. Sie überlegte keine zwei Sekunden lang und stimmte zu. Unser erster gemeinsamer Wagen war ein Ford, aber ich glaube, es war mehr als ein Auto – es war ein Symbol für Rebeccas Anerkenntnis, dass ich ein Teil ihrer Unabhängigkeit geworden war, statt eine Bedrohung dafür darzustellen.
Der Kauf des Autos schöpfte Rebeccas Mobilitätsbudget für den Rest des Studienjahres aus. Bei mir verschlang er meine gesamten Ersparnisse. Aber das sagte ich ihr nicht. Schließlich gab es für solche Situationen Kreditkarten. Außerdem hatte ich nicht das Gefühl, dass ich gerade Tausende von Dollar ausgegeben hatte, die ich eigentlich gar nicht besaß. Ich fühlte mich, als hätte ich gerade meine Berufung gefunden, und das war unbezahlbar: Ich wollte Rebecca Miller das Leben geben, das sie verdiente.
0
Zum darauffolgenden Weihnachtsfest nutzte ich eine Kreditkarte, um den Verlobungsring für Rebecca zu kaufen. Die zusätzliche Verschuldung störte mich nicht, denn im Laufe des zurückliegenden Jahres waren Kreditkarten für mich sowohl eine Notwendigkeit als auch eine Gewohnheit geworden. Ich redete mir ein, dass nur noch ein paar Jahre und zwei Doktortitel zwischen uns und der finanziellen Freiheit stünden.
Im Jahr darauf störte es mich allerdings schon ein wenig mehr, als wir im Januar im Garten der Millers heirateten. Es störte mich, weil unsere Heirat bedeutete, dass wir bald unsere Finanzen zusammentun und anfangen würden, Rechnungen von einem gemeinsamen Konto zu bezahlen. Daher war Rebecca gewissermaßen im Begriff, die Hälfte ihres eigenen Verlobungsrings zu bezahlen.
Es war ein beschämender Gedanke, der in direktem Widerspruch zu dem Ziel stand, das ich mir für mein Leben gesetzt hatte. Also ignorierte ich ihn, so wie ich auch das Zögern in der Stimme ihrer Mutter ignoriert hatte, als sie zugestimmt hatte, dass ich Rebecca im Krankenhaus besuchen durfte. Mit anderen Worten: Zuerst wusste ich, dass es da war, aber ich schaute einfach lange genug weg, bis ich schließlich vergaß, dass es je existiert hatte. Ich war so gut darin geworden, Geheimnisse vor anderen zu bewahren, dass es mir sogar mir selbst gegenüber gelang.
0
Unsere Flitterwochen waren bescheiden, genau wie unser Auto und aus demselben Grund. Mr Miller – er hatte mich zwischenzeitlich gebeten, ihn „Dad“ zu nennen, aber ich konnte mich aus Gründen, die ich nicht verstand, nicht dazu durchringen – hatte angeboten, uns irgendwohin zu schicken, wo es Sonne, Strand und Meer gab, aber Rebecca hatte darauf bestanden, dass wir unsere Flitterwochen selbst bezahlten. Also verbrachten wir ein langes Wochenende in einer Weinregion in Upstate New York. Die Hauptreisezeit in dieser Gegend ist im Spätsommer und Frühherbst. Im Januar sind die Hotelpreise am niedrigsten, und die Weingüter freuen sich so sehr, wenn sie einen Besucher sehen, dass sie sehr großzügig mit ihren Gratiskostproben sind. Abgesehen von den gelegentlichen Weinproben gab es an diesem Wochenende nicht viel zu tun, doch das war uns nur recht. Wir waren nicht sonderlich motiviert, unser Hotelzimmer zu verlassen.
Das war wahrscheinlich der Grund, warum Rebecca mein Tagebuch fand.
Seit unserer ersten Verabredung bei McDonald’s hatte ich täglich Tagebuch geführt, aber bis Rebecca das Tagebuch entdeckte, gab es keine andere Menschenseele auf der Welt, die davon wusste.
Ich stand unter der Dusche, und sie durchstöberte gelangweilt den Bücherstapel, den ich in unseren Koffer gepackt hatte, als sie auf etwas Kleineres mit Ledereinband stieß. Man kann es ihr nicht wirklich verübeln, dass sie es öffnete, auch wenn ich versuchte, das zu tun, als ich aus dem nebligen Badezimmer kam und sah, dass sie es in der Hand hielt.
Sie wischte meine aufkommende Wut beiseite, wie man eine Mücke wegwischt, die einen von einem herrlichen Sonnenuntergang ablenkt. Sie war tief berührt, und das ist wirklich die beste Reaktion, die man sich von jemandem erhoffen kann, der dein Inneres nach außen gekehrt sieht.
Sie hielt das Tagebuch hoch und lieferte meine erste Rezension. „Eli, das ist brillant! Es ist, als würdest du zu all den Klienten sprechen, mit denen du gearbeitet hast. Es ist wie …“, sie schloss für einen Moment die Augen, um nach den richtigen Worten zu suchen, „es ist, als würdest du wieder zu diesem Mann bei McDonald’s sprechen. Es ist, als würde Gott durch dich zu jedem von uns sprechen und uns wissen lassen, dass wir ihm wichtig sind, egal, wie unwichtig oder beschämt wir uns fühlen. Woher … woher kommtdas?“
Es kam von der Stimme in meinem Inneren, die gnädiger geworden war, seit ich Rebecca getroffen hatte.
Als ich ein Kind war, erschien mir der Gott, von dem im Gottesdienst gesprochen wurde, distanziert, enttäuscht und gefährlich. Er war irgendwo dort oben im Himmel, meist unerreichbar, und ähnelte eher dem Weihnachtsmann mit seiner Liste, die er zweimal überprüft, als einem liebenden Vater. Es schien, als stünde man bei seiner letzten Bilanz immer als unartig da, und er schien es gern darauf anzulegen, einen in die ewige Verdammnis zu schicken. Ich beobachtete meine Eltern in den Kirchenbänken, wie sie zu all dem nickten, als ob es für sie absolut Sinn ergäbe, als ob eine solche Liebe etwas wäre, das sie sich gern zuteilwerden ließen. Ich fand, dass das viel über meine Eltern aussagte, und beschloss, dass ich mit all dem nichts zu tun haben wollte. Als ich dann an der Universität von Illinois studierte und einen Haufen Atheisten kennenlernte, die meistens glücklich, freundlich und gut waren, versuchte ich, einer von ihnen zu sein. Doch sosehr ich mich auch bemühte, den Gott meiner Eltern loszuwerden – es wollte mir einfach nicht gelingen. Und inzwischen fühlte er sich auch nicht mehr so distanziert an – vielmehr lebte er weiter, in Form einer enttäuschten und gefährlichen Stimme in mir.
Als Rebecca in mein Leben trat, gelang es mir endlich, mein Gottesbild zu hinterfragen. Mit einem Mal erschien es mir vollkommen logisch, dass ein Gott, der es wert ist, an ihn zu glauben, mich mit mindestens genauso viel Zuneigung betrachten muss, wie Rebecca es tat. Also begann ich, nach einer liebevolleren Stimme zu lauschen, und allmählich, in unserem ersten gemeinsamen Jahr, hörte ich sie immer öfter. Ich hörte sie in Rebeccas Worten, in den Büchern, die ich las, im Wind, der durch die Krone des großen Ahorns hinter meinem Apartment strich. Schließlich fing ich sogar an, sie in mir selbst zu hören – eine leise, unaufdringliche Stimme, die von meinem Wert und dem Wert aller Dinge sprach.
Ich begann, die liebevollen Worte, die ich hörte, in meinem Tagebuch festzuhalten, und ich erzählte niemandem davon.
In jenem Flitterwochen-Hotelzimmer sagte mir Rebecca, dass ich jedemdavon erzählen müsse.
Bis zu diesem Zeitpunkt meines Lebens hatte ich immer das Gefühl gehabt, ausgebremst zu werden. Rebecca war die Erste, die mich von Herzen anfeuerte.
4
In Bradford’s Ferry aufzuwachsen, bedeutete für uns Kinder, sich in den ersten Wochen der Sommerferien auf den Unabhängigkeitstag und das jährliche River Days Festival der Stadt zu freuen. Eine herrliche Woche lang gab es jeden Morgen ein Pfannkuchen-Frühstück im Park, Bootsrennen, Open-Air-Konzerte, einen Kunstwettbewerb, eine Parade, natürlich ein Feuerwerk – und einen Rummel. Jedes Jahr freute ich mich auf die Rückkehr meiner Lieblingsfahrgeschäfte, aber mein absoluter Favorit war der Scrambler. Er hob einen nicht in die Luft, sondern schleuderte einen durch die Luft, wobei die Welt um einen herum verschwamm, bis man den Scheitelpunkt der Umlaufbahn erreichte, wo man kurz innehielt, die Welt scharf sah und dann durch die wieder verschwommene Welt in die andere Richtung geschleudert wurde. Dann sah man wieder einen Moment lang scharf und so weiter. Unschärfe und Fokus, Unschärfe und Fokus.
Das erste Jahrzehnt unserer Ehe war verschwommen, mit gelegentlichen Momenten klarer Sicht.
Am Morgen nach unserer Rückkehr aus den Flitterwochen setzte ich mich in unserer bescheidenen Mietwohnung an meinen Computer, machte mich im Internet schlau, wie man dem Blogging-Hype beitritt, richtete eine Webseite ein und veröffentlichte die ersten von mehr als fünfhundert Einträgen aus meinen Tagebüchern. Ich nannte sie „Reflexionen“ und war sicher, dass sie keinerlei digitales Rampenlicht auf sich ziehen würden. Rebecca hingegen bestand darauf, sie „Inspirationen“ zu nennen, und sagte voraus, dass sie in der Blogosphäre auf einen Nerv treffen würden. Wie sich herausstellte, hatte sie recht mit ihrer Einschätzung. Meine Texte gingen viral, immer und immer wieder. Der Ritt hatte begonnen.
Das erste Jahr des Bloggens zog an mir vorüber wie ein verschwommener Film.
Dann, fast auf den Tag genau ein Jahr nach unserer Rückkehr aus den Flitterwochen, wurde Sarah geboren. Die Fahrt erreichte den Scheitelpunkt, und die Welt wurde kristallklar. Rebecca lag achtundvierzig Stunden lang in den Wehen, die letzten zwölf Stunden presste sie, erschöpft und angstvoll, aber sie kämpfte darum, unser kleines Mädchen auf die Welt zu bringen. Mein erster Blick auf Sarahs kahles Köpfchen. Ihr erster Schrei. Der gummiartige Widerstand der Nabelschnur gegen die Schere. Rebeccas Blick, als sie Sarah zum ersten Mal in die Arme nahm – ein Blick, wie man ihn einem geliebten Menschen zuwirft, wenn er von einer langen Reise zurückkehrt.
Das erste Lebensjahr von Sarah war noch verschwommener. Meine Online-Plattform wuchs exponentiell, und eine meiner Leserinnen war Lektorin bei einem großen Verlag. Sie schrieb mir eine Nachricht und fragte, ob ich einen Agenten hätte. Ich sagte Ja. Es war beinahe wahr. Benjamin hatte sich inzwischen als Literaturagent etabliert, und so fragte ich ihn, ob er mich bei dem Verlag vertreten wolle. Wir kniffen uns in die Arme – zwei Jungs aus Bradford’s Ferry, die zusammen Bücher veröffentlichen –, und innerhalb eines Monats hatte ich meinen ersten Buchvertrag in der Tasche.
Die erste Hälfte meines Vorschusses kam eine Woche vor unserem zweiten Hochzeitstag. Theoretisch habe ich das Geld auf die Bank gebracht. In Wirklichkeit habe ich damit Kreditkartenschulden bezahlt.
Eine Woche später hatte ich meine erste Panikattacke.
Ich war bereits durch meine verschiedenen Aufgaben stark beansprucht: Arbeit für die Studienseminare, klinische Ausbildung, Recherche für meine Dissertation, herausfinden, wie man ein guter Ehemann und Vater ist, und mein erstes Buch schreiben. Als es für Rebecca und mich dann an der Zeit war herumzureisen, um uns um klinische Assistenzstellen zu bewerben – die letzte Hürde vor der Promotion –, war das der letzte Anstoß, der, wenn man so will, Geppettos Panzer zum Bersten brachte. Ich hatte in meinen Lehrbüchern so einiges über Panikattacken gelesen, aber man kann sie nicht wirklich verstehen, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Das Herz hämmert wie wild, man schwitzt wie bei einer Hitzewelle im Hochsommer und ist sich sicher, dass bald das letzte Stündlein geschlagen hat.
Ich befürchtete, dass, wenn Rebecca mich in meinem schwächsten Moment sähe, sie jegliches Vertrauen in mich verlieren würde.
Stattdessen schenkte sie mir mehr.
Sie sagte, die zweite Hälfte meines Vorschusses würde ausreichen, um uns durch das nächste Jahr zu bringen. Sie sagte, dass es in einer Ehe keine zwei Menschen mit Doktortitel brauche. Sie sagte, ich sei ein toller Vater und könne im Homeoffice arbeiten. Sie sagte, ich solle das Doktorandenstudium abbrechen und mein Buch zu Ende schreiben. Sie strahlte, als sie das sagte. Ich überlegte kurz, ob ich ihre Annahmen bezüglich des Vorschusses korrigieren sollte – den ich größtenteils schon ausgegeben hatte –, aber ich tat es nicht. Ich wollte der Mann werden, den sie sich vorstellte, wenn ihr Lächeln von einem Ohr zum anderen reichte. Also hielt ich den Mund. Ich ließ die Wahrheit kurz am Rande meines Bewusstseins herumschweben, bis sie wieder verschwand. Und ich wurde Vollzeit-Schriftsteller.
Das meiste, was danach kam, war besonders verschwommen, obwohl das Leben hin und wieder lange genug in den Fokus kam, dass ich es wirklich sehen konnte.
Zum Beispiel der Morgen, an dem Rebecca erfuhr, dass sie ihre klinische Assistenz in Chicago absolvieren würde, nur ein paar Stunden östlich von Bradford’s Ferry. Der Tag, an dem wir eine Wohnung im zweiten Stock im Stadtteil Lincoln Park bezogen, nur wenige Gehminuten von dem Krankenhaus entfernt, in dem Rebecca ein Jahr lang als Assistenzärztin arbeiten würde. Später an diesem Tag, als Sarah, die gerade ihre ersten Schritte machte, auf dem Gehweg stolperte, sich das Knie aufschürfte und die Hand nach mir ausstreckte statt nach Rebecca.
Die Veröffentlichung meines ersten Buches Das Flüstern im Wind über das Hören auf die Stimme Gottes in uns. Die ersten Verkaufsstatistiken, die darauf hindeuteten, dass es keine Bestsellerlisten stürmen, vermutlich aber seinen Vorschuss verdienen und irgendwann ein wenig mehr Einkommen für unsere Familie bringen würde.
Rebeccas Abschluss an der Uni. Ihr Bewerbungsgespräch für ihren Traumjob in einem westlichen Vorort von Chicago: eine schlecht bezahlte Vollzeitstelle als Therapeutin in einem gemeinnützigen Zentrum für psychische Gesundheit. Das Gespräch darüber, ob meine Schriftstellerkarriere ihr mageres Gehalt kompensieren könnte. Meine anhaltende Klarheit über mein Ziel: Rebecca Miller das Leben zu geben, das sie verdient. Rebeccas Nervosität, als sie zu ihrem ersten Arbeitstag aufbrach. Ihre Freude bei ihrer Rückkehr.
Ein Vertrag für ein zweites Buch – Ein Manifest für die Ehe – über die Frage, wie die Seligpreisungen unsere Vision für die Ehe prägen können. Rebeccas Mutter, die mich aufzog, dass es einigermaßen kühn sei, ein solches Buch nur vier Jahre nach Beginn meiner eigenen Ehe zu schreiben. Benjamin, der mir von dem Vorschuss erzählte, der zwar höher war als der erste, aber nicht ausreichte, um unsere Geldprobleme zu lösen, die schneller wuchsen als ihre Lösungen. Die Woche, in der das Buch veröffentlicht wurde und mit einigen Bestsellerlisten flirtete. Der Moment, als ich erfuhr, dass es nur ein Flirt bleiben würde.
Der Nachmittag, an dem Benjamin anrief, um mir mitzuteilen, dass sich das Manifest so gut verkauft habe, dass mein Verleger mich um ein Exposé für ein drittes Buch bitten würde, das die Genres meiner ersten beiden Bücher verbinden sollte. Die Woche, in der wir unseren siebten Hochzeitstag und Sarahs sechsten Geburtstag feierten, und zugleich die Veröffentlichung von Das kontemplative Paar.Eine große Party zur Feier aller drei Meilensteine. Sarah, die am Esstisch auf einem Stuhl stand, in ihre Tröte blies und ein Loblied auf mein neues Buch Das konkurrierende Paar sang.
Benjamin, der mir berichtete, dass die Gemeinschaft, die sich um meine Bücher gebildet hatte, beginne, mich als eine Art geistlicher Mentor zu sehen, und dass mein Verleger das Momentum nutzen wolle. Das Wort Mentor,das sichanfühlte wie ein sehr heißes Rampenlicht. Ich, wie ich Benjamin sagte, dass ich nicht verstünde, warum die Leute dächten, ich hätte alle Antworten. Dass ich nicht schreiben würde, weil ich „angekommen“ sei, sondern weil ich mich selbst auch noch zu dem Ort durchkämpfen müsse, an dem meine Leser anzukommen hofften. Benjamin, der mir sagte, ich solle das mal hinter mir lassen, weil ich ein Angebot für ein viertes Buch hätte, eine Art Fortsetzung meines ersten Werkes. Arbeitstitel: Die Stimme in der Wüste.
Sarah, die auf dem Spielplatz von der Rutsche fiel und sich das Handgelenk brach. Ein paar Wochen später ich selbst, wie ich mir beim Basketball ebenfalls das Handgelenk brach. Tippen mit nur einer Hand. Ich, wie ich die Krankenhausrechnungen für die Behandlungen der beiden Brüche öffnete. Wie ich mich selbst in den Hintern hätte treten können, weil ich Rebecca geraten hatte, sich für eine Versicherung mit hoher Selbstbeteiligung zu entscheiden. Wie ich die Rechnungen in eine Schublade stopfte und versuchte, mich auf mein Manuskript zu konzentrieren.
Auf dem Scrambler in Bradford’s Ferry war es Unschärfe und Fokus, Unschärfe und Fokus, bis man plötzlich spürte, dass die Fahrt langsamer wurde und die Zeit um war. Es war mir nie in den Sinn gekommen, dass das Gleiche mit meinem Leben passieren könnte. Mit meinem Glauben. Mit den Worten in mir. Mit dem Ziel, das mich angetrieben hatte. Es war mir nie in den Sinn gekommen, dass meine Fahrt mit Rebecca zu einem Ende kommen könnte.
Es kam mir nicht in den Sinn, bis ich an einem ansonsten ganz normalen Freitagmorgen im August – nur wenige Monate vor unserem zehnten Hochzeitstag – durch ein Rascheln in unserem Kleiderschrank geweckt wurde.
5
Der Tag, bevor Rebecca mich verließ, begann wie jeder andere, mit einer Ausnahme: Es gab eine unnötige Hast in ihrer morgendlichen Routine, als könne sie gar nicht schnell genug aus dem Haus kommen.