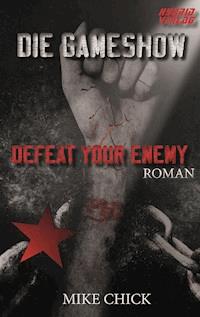5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: between pages by Piper
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
GÜNSTIGER EINFÜHRUNGSPREIS. NUR FÜR KURZE ZEIT! Ausgelöschte Erinnerungen. Eine Familie in Lebensgefahr. Eine mörderische Hetzjagd durch Karlsruhe. Für alle Leser:innen von Sebastian Fitzek & Camilla Way Seit einem Unfall vor zwei Jahren sind die Erinnerungen des Taxifahrers Lorenz Hahn wie ausgelöscht … Als er eines Nachts von einer langen Schicht übermüdet nach Hause kommt, erwartet ihn das Grauen. Seine Frau und seine zwei Kinder werden von einem maskierten Fremden festgehalten, der den Familienvater vor die Wahl stellt: Entweder findet er innerhalb von vierundzwanzig Stunden heraus, wer sich hinter der Maske verbirgt, oder seine Familie stirbt. Lorenz Hahn bleibt nichts anderes übrig, als sich zu erinnern und sich seiner Vergangenheit zu stellen. »Dramatik, Hochspannung, geballte Action und Einsichten in menschliche Hintergründe werden gut beschrieben. Ein absolut empfehlenswertes Buch für spannende Stunden.« ((Leserstimme auf NetGalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Der Fremde im Haus« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Michaela Retetzki
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorwort
Motto
Prolog
Teil I
Gedächtnislücken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Teil II
Alte Bekannte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Teil III
Der richtige Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Teil IV
Einige Monate später
1
2
3
4
5
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vorwort
Die letzte Veröffentlichung eines meiner Bücher ist nun mehr als ein Jahr her; ein Jahr, in dem mir sehr viel über das Schreiben von Geschichten und mich selbst klar wurde. Hierzu eine kleine Anekdote:
Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal in Kontakt mit einem Literaturagenten getreten bin, fragte mich dieser, ob ich mir vorstellen könne, einen Cosy-Krimi zu schreiben, der in Italien spiele. Die Gründe, warum er mich das fragte, waren simpel. Zum einen trage ich im wahren Leben einen italienischen Namen, der solche Geschichten mit mehr Authentizität unterlegen würde (Haha. Ich spreche kein Wort Italienisch), und zum anderen schien er mein Schreiben als gut genug zu empfinden. Um es kurz zu machen: Ich hatte keine Ahnung von Cosy-Krimis, weshalb das Manuskript zu … nun, sagen wir … zu heftig wurde. Dadurch floppte die Idee schon während ihrer Entstehung.
Kein großer Verlust.
Also besann ich mich wieder auf Geschichten, die mir lagen. Damals vornehmlich Horror und Thriller. Ich schrieb und schrieb und wurde besser, ich spürte es. Allerdings genügte das nicht, um einen Buchvertrag bei einem Verlag zu ergattern. Ich bewarb mich und wurde abgelehnt, bewarb mich und wurde abgelehnt, ich weiß nicht, wie viele Male. Irgendwann gab ich es auf. Nicht das Schreiben. Nur das Bewerben bei Verlagen.
Freunde von mir – von denen inzwischen eine Freundin eine erfolgreiche Bestsellerautorin ist (Meine besten Glückwünsche, Ayla!) – meinten, ich solle es nicht aufgeben, Thriller seien immer gefragt. Und ich würde doch so toll schreiben.
Ich habe mich überreden lassen. Habe exakt eine Bewerbung an einen Verlag geschickt. Zwei Monate passierte nichts. Keine Nachricht. Wieder hatte ich die Sache abgehakt. Und dann kam das Unverhoffte. Piper wollte Der Käfig – Entkommen ist tödlich haben. Ich war vollkommen verblüfft. Denn dieses Manuskript hatte ich aus Frust geschrieben. Wegen der vielen Ablehnungen. Ich hatte zu mir gesagt: Schreib etwas, worauf du Lust hast und das so brutal ist, dass es eh kein Verlag annehmen würde (Vielleicht abgesehen von wenigen, die ich damals noch nicht kannte). Und das hatte ich getan. Ich hatte meine ganze Wut in dieses Manuskript gelegt. Und siehe da: Es wurde genommen. Und es wurde gelesen. Von einigen. Dann geschah allerdings etwas, womit ich nicht gerechnet hatte und was mich verwirrte. Rezensionen. Leute reagierten tatsächlich auf mein Buch. Manche lobten es sogar in den Himmel. Was allerdings viel erstaunlicher war: Sie begannen, Erwartungen an mein nächstes Buch zu hegen. Erwartungen! Wie sollte ich damit klarkommen?
Wie sich herausstellte, erfüllte ich nicht jedermanns Erwartungen, als Vier Mal Angst das Tageslicht erblickte. Manche fanden das Buch richtig gut, andere wiederum fanden es schlecht. Das ist vollkommen in Ordnung, da ich ja selbst nicht jedes Buch liebe, das auf dem Markt erscheint. Manche lese ich nur zum Teil und lege sie dann weg, weil sie unterwegs irgendwo den Reiz verloren haben oder aus anderen Gründen. Wie auch immer. Was ich eigentlich sagen möchte: Ich kam mit diesen unerfüllten Erwartungen nicht klar. Sie haben mich bis in meine Träume verfolgt. Ein Jahr lang habe ich mir den Kopf zerbrochen, wie ich diese Erwartungen erfüllen und diese Leser*innen zurückgewinnen könnte. Ich schrieb weiter, brach meine Manuskripte aber oftmals ab, weil sie mir nicht gut erschienen. Nicht gut genug. Ich habe mir einen Perfektionismus auferlegt, der mich in meinem Tun hemmte. Statt zu schreiben, was mir gefiel, achtete ich darauf, was anderen gefallen könnte. Das stürzte mich – ohne jetzt Mitleid erregen zu wollen, denn das will ich wahrhaftig nicht – in eine Art Depression. So bescheuert das auch klingen mag, ich wusste nicht mehr, wie ich weiter fortschreiten sollte. Ich wusste nicht mehr, wie ich schreiben sollte. Oder ob ich schreiben sollte.
Dies ist mein drittes Buch, das bei Piper erscheinen wird. Wie man sieht, habe ich das Schreiben nicht aufgegeben. Und soll ich Ihnen etwas verraten? Als ich es zu schreiben begonnen habe, habe ich mir keinerlei Gedanken darüber gemacht, ob es die Ansprüche und Erwartungen von anderen erfüllen würde. Ich habe einfach geschrieben, was mir gefiel. Und immer noch gefällt. Denn ich mag das Manuskript. Ich mag, dass es anders ist als Der Käfig oder Vier Mal Angst. Ich mag seine Einzigartigkeit. Denn das ist es, was Bücher sein sollten, oder? Einzigartig.
So viel zu diesem Vorwort. Lassen Sie uns beginnen. Lassen Sie uns in die Dunkelheit abtauchen. Dorthin, wo es kein Erbarmen gibt. Dorthin, wo hinter jeder Ecke etwas lauern könnte. Etwas mit spitzen Zähnen. Etwas Gefräßiges.
Kommen Sie mit. Ich führe Sie.
Mike Chick, Dezember 2023
Motto
Die Vergangenheit ruht nicht
Unbekannt
Der Dämon steckt in unserer eigenen Haut
Christoph Martin Wieland
Prolog
Er hatte nur kurz eine Zigarette rauchen wollen. Er war nach unten vor die Haustür gegangen, weil Larissa den Qualm nicht ausstehen konnte. Aus einer Zigarette waren, neben unnützen Spielereien am Handy, vier geworden. Der Vorsorge halber. Zehn Minuten nachdem er seine letzte Kippe ausgedrückt hatte, und eine Ewigkeit nachdem er nach unten gegangen war, war er wieder zurückgekehrt, in der Erwartung, seine Frau wie so oft mit ihrem Strickzeug vor dem Fernseher vorzufinden. Stattdessen lag sie am Boden. Tot. Ohne Zweifel. Die Blutlache um ihren schlanken Körper war groß genug, dass man darin eine Katze hätte ertränken können.
Neben Larissa lag ihre gemeinsame Tochter. Mit dem Gesicht zur Decke gewandt. Reglos. Dann war da noch das Kissen, mit dem seine Frau es vermutlich getan hatte. Melinda war erst sieben Jahre alt gewesen. Ein kleines, schmächtiges Wesen mit blonden Locken und einem Strahlen, das die Temperatur im Raum um mehrere Grad ansteigen lassen konnte … gekonnt hatte. Jetzt würde sie nie wieder lachen. Nicht mal ein schwaches Lächeln war ihr mehr vergönnt.
Er hatte schon lange gewusst, dass etwas in seiner Frau vorging. Nur hatte er nicht darauf geachtet. Sie nicht genug beachtet. Und jetzt? Hätte er das alles verhindern können? Scheiße. Es wäre seine verdammte Aufgabe gewesen, auf Larissa aufzupassen. Ihr Aufmerksamkeit zu schenken. Ihr zuzuhören. Ihr eine helfende Hand zu bieten. Nur war immer etwas dazwischengekommen, nicht wahr? Die Arbeit. Der Haushalt. Arzttermine. Elternabende.
Die Stimme seines Vaters erklang in seinen Ohren. Vorwurfsvoll.
Das sind alles Gründe, aber keine Hindernisse.
Und plötzlich fragte er sich, ob das nicht alles seine Schuld war.
Er machte einen Schritt ins Wohnzimmer hinein, in den Raum, in dem die beiden Menschen, die er am meisten liebte und denen er am meisten aus dem Weg gegangen war, gestern noch Mensch ärgere dich nicht gespielt hatten. Seine Hände zitterten. Sein Herz pochte schmerzhaft. Der Anblick war kaum zu ertragen.
Warum? Warum?, dachte er. In letzter Zeit war doch alles in Ordnung. Nicht einmal Streit haben wir gehabt.
Er machte noch einen Schritt, blieb wieder stehen, roch die Ausdünstungen seines eigenen, nach Zigarettenrauch stinkenden Atems. Und das Blut. Der leicht metallische Geruch vom Blut seiner Frau. Sie hatte sich mit einem Küchenmesser die Pulsadern aufgeschnitten, gleich nachdem sie ihre eigene Tochter mit einem Kissen erstickt hatte; ein Kissen mit einer Meerjungfrau darauf. Arielle. Melindas Lieblingskissen. Wie oft war sie nachts aus den Federn gekrabbelt und hatte ihr Kissen gesucht, ohne das sie nicht einschlafen konnte? Jetzt schlief sie. Für immer.
Das war ein Albtraum. Es musste sich um einen handeln; einen, aus dem er jederzeit wieder erwachen und feststellen würde, dass alles in bester Ordnung war.
Wäre ich nicht nach unten gegangen … Und wäre ich nicht so lange unten geblieben …
Doch er hatte es getan. Und jetzt musste er mit dem Resultat leben. Seine Frau war tot. Seine Tochter auch. Nur er lebte noch. Er und sein nach Tabakrauch stinkender Atem.
»Melinda?«, hauchte er in das Wohnzimmer hinein. Ein Automatismus. Er hatte nicht darüber nachgedacht. Die Hoffnung, sie würde ihn hören, brachte er nicht auf.
Er machte noch einen Schritt vorwärts, hielt inne. Unter ihm, knapp vor seiner linken Schuhspitze endete die Blutlache seiner Frau. Wie ein kleiner See lag sie vor ihm. Das gelbliche Licht der Deckenleuchte schimmerte darin und färbte sie zu einem dystopischen Sonnenuntergang. Es funkelte auch in den winzigen Spritzern auf dem zarten, blassen Gesicht seiner Tochter. Wie Sommersprossen waren die Flecken auf der kleinen Stupsnase und den Wangen verteilt.
Blut zu Blut, dachte er irrational und spürte, wie sich etwas tief in ihm verkrampfte. Es hätte sein Magen sein können, und zuerst glaubte er das auch. Doch es war seine Seele. Sein Herz. Sein Ich.
Er dachte an sein Handy. Er dachte daran, die Polizei anzurufen, einen Krankenwagen.
»Wozu?«, japste er plötzlich. Dem folgte verrückterweise ein Lachen. Eines von der hysterischen Sorte. Er hatte sich nicht mehr im Griff. Alles war sprichwörtlich zugrunde gegangen; sein Wetteinsatz auf die Zukunft; seine Hoffnungen und Träume davon, einmal der stolze Vater eines klugen Mädchens zu werden, dessen Schulveranstaltungen er besuchen und bei dessen Auftritten er Beifall klatschen konnte, bis es Flügel bekam und alt genug wurde, die Welt auf eigene Faust zu erkunden, was er ebenfalls mit Beifall quittiert hätte. Weil Melinda seine Tochter war. Seine Tochter, um Himmels willen.
»Das ertrage ich nicht«, sagte er und meinte es auch so. Es war, als könnte er in seine eigene Zukunft sehen; als wüsste er bereits jetzt, dass dieser Schmerz, dieser unglaubliche Schmerz in seiner Brust, der noch dabei war anzuschwellen, niemals mehr vergehen würde.
Auch wenn er seine Frau betrachtete, fühlte er Schmerz. Doch dieser war von anderer Natur. Er war mit etwas Giftigem gemischt. Mit Wut. Unglaublicher Wut. Ob tot oder nicht, er spürte, wie er sie am liebsten am Kragen packen und schütteln würde; wie er ihr am liebsten ins Gesicht schreien würde, was für ein Miststück sie sei, ihm das Einzige wegzunehmen, was ihm etwas bedeutete. Hätte sie sich das Leben genommen, okay. Aber warum auch das seiner Tochter – seinem Kind –, seinem Ein und Alles?
Er brach in Tränen aus. Mit einem Mal waren sie da. Bitterlicher Kummer überschwemmte seine Wangen. Dann kam die Wut hinzu. Ebenso heftig. Ebenso erdrückend. Ohne darüber nachzudenken oder es auch nur zu bemerken, griff er nach etwas auf der Kommode und warf es quer durch den Raum. Erst während es die Luft durchschnitt, erkannte er, um was es sich dabei handelte. Ein Brieföffner aus Messing. Ein Elefant. Ein Erbstück Larissas von ihrem Großvater.
Noch während er dies registrierte, durchstieß der Elefant eine der Fensterscheiben. Aus einem Krachen wurde ein Klirren, als Tausende spitze Scherben auf das Laminat fielen und in Abertausende weitere Splitter zersprangen. Kühler Wind ließ die Vorhänge flattern und legte sich auf seine schweißnasse Stirn. Von draußen lächelte ihm höhnisch der Mond entgegen.
Seine Wut war wie weggeblasen. Der Kummer nicht. Er hatte sich in seine Eingeweide gekrallt wie ein beißwütiger Granatsplitter; so tief, dass er inoperabel war. Er atmete schwer, roch sich, roch die Zigaretten, die er trotz der Millionen gut gemeinter Vorwürfe seiner Frau nicht hatte sein lassen können. Und wieder wurde ihm bewusst, dass seine Tochter, sein Heiligtum, hätte er auf die Zigaretten wenigstens an diesem Abend verzichtet, noch leben könnte.
Ich … bin … schuld.
Es waren diese Worte, die noch in seinem Kopf echoten, als er zum Fenster trat, sich ein letztes Mal nach ihnen umblickte und sprang. In letzter Sekunde, als er bereits in der Luft war, entdeckte er etwas. Etwas, was nicht in die Ecke des Wohnzimmers gehörte.
Einen Schemen.
Teil I
Gedächtnislücken
1
Endlich Feierabend, dachte Lorenz Hahn, doch die zu erwartende Euphorie blieb aus. Es war zwei Uhr in der Nacht, und er war müde. In den letzten zehn Stunden hatte er kaum eine Pause einlegen können. Durch die Schlosslichtspiele war in der Stadt die Hölle los. Nüchterne sowie Betrunkene und Stinkbesoffene wollten nach Hause gebracht werden, wenngleich Letztere meist bequemer waren als die Betrunkenen. Bei Besoffenen lief man zwar Gefahr, dass sie einem die Rückenlehnen der Vordersitze verunstalteten, doch im Allgemeinen verhielten sie sich ruhig oder schliefen sogar ein. Betrunkene hingegen pöbelten gern mal oder wurden gar aggressiv, vor allem dann, wenn sie gerade von ihrer Angebeteten versetzt worden waren. Lorenz kannte das aus eigener Erfahrung. An freien Wochenenden ging er selbst in die eine oder andere Kneipe. Und er trank auch mal einen über den Durst. Nicht zuletzt wegen der Probleme, die er derzeit mit Verena hatte. Seiner Frau.
Er lenkte den KIA auf den Parkplatz, wo Dutzende weitere Taxis in derselben hässlichen knallgrünen Lackierung auf ihren Einsatz warteten oder geladen wurden, parkte, stellte den Motor ab – was dank Elektromotor akustisch kaum einen Unterschied machte – und blieb noch einen Moment hinter dem Lenkrad sitzen. Die Ruhe und die Entspannung seiner strapazierten Füße taten gut. Inzwischen hatte er die magische Grenze des vierzigsten Lebensjahrs geknackt, was er trotz seines bequemen Jobs jeden Tag zu spüren bekam. Mit dreißig hatte er geglaubt, erwachsen geworden zu sein. Mit fünfunddreißig hatte er bemerkt, dass es ihm nicht mehr ganz so leichtfiel, sein Gewicht zu halten und dass sein Haar dünner wurde. Mit vierzig bekam er schleichend das Gefühl, das Leben wäre schon halb vorbei. Und wenn er so weiterqualmte wie bisher, war das vielleicht sogar übertrieben.
Außerdem fiel es ihm manchmal schwer, sich an Dinge zu erinnern. Erst recht seit dem Unfall vor zwei Jahren. Er war mit dem Fahrrad am Schlossgarten entlanggefahren, als ihm plötzlich ein Junge in den Weg gelaufen war. Im verzweifelten Versuch, dem Jungen auszuweichen, hatte er den Lenker herumgerissen und war gegen einen Dekorstein von der Größe eines Medizinballs geknallt. Sein Vorderrad war eingeknickt und dadurch sofort zum Stehen gekommen, was ihn über den Lenker und mit dem Kopf voraus aufs Pflaster katapultiert hatte. Zwei Wochen hatte er im künstlichen Koma gelegen, und als er erwacht war, hatte er sich kurzzeitig nicht einmal mehr an seinen eigenen Namen erinnern können, geschweige denn an den Namen seiner Frau oder die Namen seiner Kinder. Das hatte vor allem bei den Kleinen für Tränen gesorgt.
Wie sich herausstellte, kamen mit der Zeit viele seiner Erinnerungen zurück. Allerdings längst nicht alle. Lorenz redete nicht viel darüber, weil dies für weiteren Kummer bei seinen Liebsten gesorgt hätte. Denn abgesehen von vielen Ereignissen in seiner Kindheit oder seiner Jugend, konnte er sich beispielsweise auch nicht an seinen Hochzeitstag erinnern. Er wusste, dass er und Verena geheiratet hatten – so stand es auf dem Papier –, doch wie der schönste Tag seines Lebens abgelaufen war, blieb für ihn bis heute ein Rätsel; etwas, was Verena ihm nicht verzieh, auch wenn er nichts dafürkonnte.
»Verena«, sagte er leise vor sich hin und spürte, wie es ihm beim Aussprechen ihres Namens die Brust zuschnürte. Er wusste, sie wartete darauf, dass er nach Hause kam. Er wusste, dass sie auf ihn wartete. Freuen konnte er sich darüber nicht. Nicht seitdem sie angefangen hatte, seinen Job als Taxifahrer als den Feind zu betrachten, der ihre ganze Familie auseinanderriss, weil er Lorenz angeblich die Zeit stahl, etwas mit den Kindern zu unternehmen oder sich im Haushalt zu beteiligen. Dabei war sie selbst Lehrerin und arbeitete, auch nachdem sie nach Hause kam, oft noch stundenlang an ihren Vorbereitungen und Klausuren und weiß der Teufel an was noch alles. Dadurch kam sie auch nicht zu viel mehr als er, wenn er mal wieder – wie heute Nacht – zehn Stunden am Stück unterwegs war. Das Einzige, wobei sie ihm tatsächlich voraus war, war das tägliche Essenzubereiten. Aber wie sollte er das auch erledigen? Wenn die Kinder von der Schule nach Hause kamen, war er meist schon unterwegs, ganz im Gegensatz zu ihr. Es war nur logisch, dass sie sich darum kümmerte.
Nur brachte es nichts, Verena mit Logik und Argumenten gegenüberzutreten. Weil es nicht wirklich um eine gerechte Arbeitsteilung ging. Es ging auch nicht um seine Arbeit oder die Zeit, die er manchmal in Kneipen verbrachte. Es war der Kinderwunsch, den sie hegte; der unerfüllte Kinderwunsch.
Lorenz seufzte, grapschte nach einer Schachtel R1 Red in der Mittelkonsole und zündete sich eine Zigarette an. Erst nach seinem ersten Zug wurde ihm bewusst, dass er nach wie vor in seinem Wagen saß. Er stieg aus.
Die Nacht war heiß und dunstig. Typisch für die Rheinebene im August. Typisch für Karlsruhe. Sofort sehnte sich Lorenz nach dem klimatisierten Inneren des KIA zurück. Er zog ein weiteres Mal an seiner Zigarette, mehr aus Frust denn aus Verlangen. Die Glimmstängel schmeckten ihm schon lange nicht mehr.
Er fragte sich, wie Verena nur an ein weiteres Kind denken konnte, wenn ihr die Arbeit jetzt schon zu viel war. Gleichzeitig tat sich die Frage auf, wie sie an ein weiteres Kind mit ihm denken konnte, wo sie doch ständig nur an ihm herumnörgelte. Vom Rauchen angefangen bis hin zum unerledigten Abwasch gab es an ihm offenbar nichts, was sie noch zufriedenstellte. Und dabei tat er alles Erdenkliche. Wenn er freihatte, kümmerte er sich natürlich um die Kinder, ging mit ihnen auf den Spielplatz oder in den Zoo. Und er half auch im Haushalt mit. Dabei scheute er sich nicht einmal, die Toilette zu putzen, was dank Jakob, der beim Zielen so seine Probleme hatte, nicht unbedingt der angenehmste Zeitvertreib war.
Wenn alles doch wieder so sein könnte wie früher, dachte er und ließ den Blick über den Parkplatz zu den anderen Wagen und der Hauptstelle des Taxiunternehmens Roman Taxi wandern. Sie lag so weit außerhalb der Stadtmitte, dass man über ihr die Sterne am Firmament funkeln sehen konnte. Ein romantischer Anblick, der für Lorenz ohne jede Relevanz war. Solang er und Verena sich nicht verstanden, brauchte er auch keine Sterne.
Er seufzte erneut und musste an die Paartherapeutin denken, die Verena und er in den letzten Wochen, auf ihren Wunsch hin, aufgesucht hatten; eine Frau um die sechzig mit grauem, lockigem Haar, die eine Vorliebe für Birkenstock-Sandalen und Wolljacken hatte.
Die Therapeutin hatte ihm und Verena empfohlen, sich eine Auszeit zu gönnen. Zeit zu zweit, ohne Kinder, in der sie wieder zueinanderfinden könnten. Dazu gekommen war es bislang nicht. Als Lehrerin hatte Verena um diese Jahreszeit Sommerferien, doch ihm wurde der Urlaub von seinem Chef untersagt. »In den Sommermonaten haben wir viel zu viel zu tun, als dass ich dich gehen lassen könnte«, hatte Jürgen Forster ihm gesagt, und damit hatte sich das Thema erledigt. Für Lorenz. Für Verena nicht. Sie war der Ansicht, solch einen Chef könne man den Hasen verfüttern. Oder mit anderen Worten: Lorenz sollte seinen Job an den Nagel hängen und sich eine neue, bessere Stelle suchen. Was Lorenz nicht getan hatte. Und nicht vorhatte. Weil er seinen Job mochte. Er mochte die Firma, das Klima zwischen ihm und seinen Kollegen, und er mochte die hässlichen grünen Kisten, in denen er die meiste Zeit seiner Tage verbrachte. Alles in allem: Er steckte in einem gottverdammten Dilemma. Entweder er zog seinen Job vor oder seine Frau. Beides miteinander zu vereinen, schien unmöglich.
Lorenz nahm noch einen letzten Zug, trat den Zigarettenstummel auf dem Asphalt aus und überlegte, sich eine weitere anzuzünden, nur um noch ein bisschen hier zu stehen und den Moment allein und die Ruhe zu genießen, bevor es wieder nach Hause ging. Dabei würde er sich weitere Gedanken über ihre Eheprobleme machen können. Auch darüber, dass Verena erst gestern eine mögliche Trennung angesprochen hatte; ein Thema, das für ihn selbst auch schon infrage gekommen war. Tatsächlich fragte er sich schon seit einiger Zeit, wie sein Leben wohl ohne Verena aussähe, und diese Vorstellung war nicht nur schlecht. Allerdings würde ein Leben ohne Verena auch ein Leben ohne Selina und Jakob bedeuten. Und das schmeckte ihm deutlich weniger als die Zigaretten. Denn Lorenz liebte seine Kinder über alles. Er vergötterte sie regelrecht.
Hoffentlich schläft Verena, wenn ich nach Hause komme. So muss ich wenigstens heute Nacht nicht mehr diskutieren.
Die Chancen dafür standen gut. Bis er mit der Straßenbahn zum Karlstor und von dort aus zu Fuß die Gartenstraße entlanggegangen sein würde, wäre es sicherlich nach drei Uhr. Sie musste einfach schon im Bett liegen.
Mit dieser halbwegs zufriedenstellenden Aussicht im Gepäck verzichtete er auf eine weitere Zigarette, gab den Schlüssel seines Taxis im Büro ab und machte sich auf den Weg zur nächsten Straßenbahnstation.
Er erreichte die Gartenstraße um 3:07 Uhr, das dritte Stockwerk des Mehrfamilienhauses, in dem sie wohnten, um 3:14 Uhr. Um möglichst keinen Lärm zu erzeugen, schlich er auf Zehenspitzen ins Dunkel der Wohnung. Die alten Dielen unter dem Linoleum beliebten zu knarren, weshalb er sich umso vorsichtiger verhielt. Wie eine Katze tapste er strumpfsockig auf den Zehenspitzen voran. Seine Schuhe hatte er am Eingang ausgezogen.
Drinnen herrschte Stille, was nicht ungewöhnlich war. Die Kinder mussten bereits seit einigen Stunden in ihren Betten liegen, und auch sonst ging es in dem Altbau eher leise zu. In den meisten Geschossen wohnten ältere Leute, die früh schlafen gingen.
Die Wohnung selbst war aufgebaut wie ein Schlauch, an dem die Zimmer angrenzten. Links lagen die Küche, die Toilette, danach folgte das Wohnzimmer. Gegenüber lagen die drei Schlafzimmer und Verenas Büro, in dem sie ihren Schulkram aufbewahrte. Um ins Badezimmer zu gelangen, musste man durchs gesamte Wohnzimmer. Aus welchen Gründen man es abseits des Mittelgangs geplant hatte, war ihm bis heute ein Rätsel.
Als Lorenz sich etwa auf Höhe der Toilette befand, blieb er plötzlich stehen. Er glaubte etwas gehört zu haben. Einen Laut, den er nicht genau definieren konnte. Er konnte auch nicht sagen, woher er gekommen war.
Vielleicht schläft Verena doch noch nicht, dachte er, wobei er seinen Kopf automatisch in Richtung der Schlafzimmer drehte. Unter der Vollholztür des Elternschlafzimmers drang kein Licht hervor. Auch unter der Tür von Verenas Büro war keines zu sehen. Dennoch überkam ihn ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Ihm graute davor, durchs Dunkel zu waten und sie plötzlich vor sich zu haben. Seit ihrer Schwangerschaft mit Selina vor zwölf Jahren schlief sie nur noch leicht. Das leiseste Knacken konnte sie bereits aus dem Schlaf reißen. Aber das mulmige Gefühl rührte noch von etwas anderem her. Und zwar von dem Laut, den er gehört hatte. Ein dumpfes »Mm-hm«, als versuchte jemand mit einem Kissen auf dem Mund zu sprechen.
Du träumst. Du bist müde und du träumst. Leg dich schlafen, du hattest einen anstrengenden Tag, sagte er sich und beschloss, dass er genau das tun würde. Er würde durchs Wohnzimmer ins dahinter liegende Badezimmer gehen, sich die Zähne putzen und sich dann wie jede Nacht auf die Couch legen. Den Fernseher würde er wohlweislich ausgeschaltet lassen, um Verena und die Kinder nicht zu wecken. Es war nicht auszuschließen, dass sie, wenn sie aufwachte, das Gespräch mit ihm suchen würde, und er fühlte sich weiß Gott nicht in der Verfassung, sich jetzt noch auf eine Diskussion zu konzentrieren. Die Müdigkeit zog an seinen Lidern wie zwei mit Klammern angebrachte Bleigewichte. Wenn er sich nicht etwas beeilte, würde er noch bevor er die Couch erreichte, im Stehen einschlafen. Womöglich beim Zähneputzen.
Die Vorstellung, wie ihm die Augen mitten beim Zähneputzen zufielen und wie er anschließend mit dem Kopf im Becken landete, während das aus dem Hahn strömende Wasser sein braunes mittellanges Haar durchnässte, zauberte ihm ein Schmunzeln aufs Gesicht. Solche absurden Fantasien hatten ihn als Kind oft wie aus dem Nichts überfallen. Wenn sie ihn heute einholten, war das ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass er sich schleunigst hinlegen sollte. Außerdem konnte er es kaum abwarten, seine Kinder am Morgen zu sehen; seine inzwischen pubertäre Tochter und seinen neunjährigen Sohn, der sich noch für all die schönen Dinge interessierte, für die sich Neunjährige nun mal interessierten. Fußball, Fahrradfahren und natürlich für die Playstation 5, die sie ihm gemeinsam zu seinem Geburtstag geschenkt hatten. Eine Investition, die sich, wenn man sie anhand ihrer Benutzung kategorisieren würde, durchaus gelohnt hatte.
»Mh-hm. Mhmm. Mhm-mhm.«
Lorenz blieb abrupt stehen und lauschte in die Dunkelheit. Diesmal, da war er sich ganz sicher, hatte er sich diese Laute nicht bloß eingebildet. Er mochte bereits vom morgigen Tag fantasiert haben, doch …
Ein Knarren. Dann ein stumpfer Schlag. Beides kam aus dem Wohnzimmer. Was war da los? War Verena vor dem Fernseher eingeschlafen und hatte vergessen, ihn auszuschalten? Es wäre nicht das erste Mal. Allerdings sah Lorenz kein Licht unter der Tür hindurchdringen. Nicht einmal ein leichtes Flackern. Das war merkwürdig. Zu merkwürdig. Er spürte wieder dieses Zusammenziehen seiner Brust.
Langsam schob er die Tür auf.
Das Wohnzimmer war ebenso stockfinster wie der Rest der Wohnung. Kein Fernseher lief. Nichts. Selbst die Rollläden waren geschlossen, wodurch Lorenz nicht das Geringste sehen konnte. Er war mit einem Mal versucht, »Hallo?« zu rufen, wie es in Filmen oft der Fall war, wenn ein Hausbesitzer vermutete, jemand Fremdes sei in sein Domizil eingedrungen. Nur war da natürlich niemand. Nur er und die Finsternis und …
»Mhmm!«
Das genügte Lorenz. Augenblicklich tastete er nach dem Lichtschalter. Ein leises Klack, dann brannte der billige IKEA-Kronleuchter in der Mitte des Raums. Das Licht der sieben LED-Kerzen war schneidend hell und blendete ihn. Doch damit konnte er leben. Womit er nicht leben konnte, war der Anblick, der sich ihm offenbarte.
2
Seine Müdigkeit war mit einem Mal erloschen. An ihre Stelle trat Entsetzen. Was Lorenz sah, hätte einer dieser Träume sein können, die er als Kind so häufig gehabt hatte, so grotesk und fürchterlich war das Bild vor ihm.
Auf dem Boden lagen drei Körper. Drei Personen. Gefesselt und mit weißen Tüchern geknebelt. Seine Kinder. Und seine Frau. Verena. Sie starrte ihn aus tränennassen blauen Augen an. Ihr schwarzes Haar hing feucht und strähnig über ihr panisches Gesicht. Das Gleiche galt für Selina. Hinter ihren dunkelbraunen langen Haaren blitzte die Kopie der Augen ihrer Mutter hervor.
Der Einzige mit kurzen Haaren, der Lorenz dadurch uneingeschränkt in der Tür stehen sehen konnte, war Jakob. Sein Gesicht war puterrot angelaufen. Lorenz kapierte, dass er derjenige gewesen sein musste, der die Mhm-Laute von sich gegeben hatte. In seinen Augen stand etwas, was die Panik seiner Mutter und seiner Schwester jäh überschritten hatte. Abgrundtiefe Angst. Mit neun Jahren war er der Jüngste von ihnen allen, kaum dem Alter entwachsen, in dem man ihm beim Zubinden der Schuhe unter die Arme greifen musste. Lorenz bekam mit einem Mal kaum noch Luft.
Doch das war noch nicht alles. Auf der Couch links von Lorenz saß in bequemer Haltung eine Gestalt. Der Größe und der Statur nach zu urteilen, ein Erwachsener. Lange schwarze Haare verdeckten das Profil.
»Endlich. Wurde auch Zeit.«
Die Stimme der Gestalt sagte Lorenz nichts. Außerdem klang sie gedämpft, als würde die Person hinter vorgehaltener Hand sprechen. Als sie sich zu Lorenz herumdrehte, erkannte er auch wieso. Der Mann auf der Couch trug eine Maske; eine schreckliche Halloween-Maske, die Lorenz nur allzu gut kannte. Als Jugendlicher war er ein großer Fan der Band Slipknot gewesen. Die Person, die nun vor ihm stand, sah aus wie der Drummer der Band.
Joey Jordison, schoss es Lorenz durch den Kopf. Teufel noch mal, er ist es. Er ist aus dem Grab auferstanden, um mich heimzusuchen. Er trägt sogar denselben beschissenen schwarzen Overall.
Natürlich war dies nicht der Drummer jener Metalband, die in den Neunzigerjahren ihren großen Durchbruch gehabt hatte. Aber er sah ihm täuschend ähnlich. Eine weiße Maske mit schwarzen Lippen und ebenso schwarzen Rändern um die Augen, von denen weitere schwarze, zackenartige Striche zur Stirn und über die rundlichen Plastikwangen verliefen. Nur die Größe stimmte nicht. Jordison war eine kleine Person gewesen. Der Mann, der sich nun mit schwarz behandschuhten Händen von der Couch abstützte und erhob, war bedeutend größer; größer als Lorenz selbst. Und er maß einen Meter achtundsiebzig.
Mit einem Mal setzte Lorenzʼ Herz einen Schlag aus. In der Hand des Mannes blitzte etwas Silbernes. Eine Pistole.
»W-Was wollen Sie?«, stotterte Lorenz hervor.
Die Gestalt – Joey, Nicht-Joey – kam einen Schritt auf ihn zu, und Lorenz stellte mit wachsendem Entsetzen fest, dass die metallene Schuhspitze der Springerstiefel, die sie trug, nur wenige Zentimeter vom Kopf seines Sohnes entfernt den Boden berührten. Ein weiterer kleiner Schritt und … Lorenz wollte sich dieses Bild nicht vorstellen, doch er konnte nichts dagegen unternehmen … Und der Mann würde den Kopf seines Sohnes unter seinem Gewicht zerquetschen.
»Nicht!«, stieß er aus und hob dabei eine Hand.
Der Unbekannte blickte nach unten, betrachtete Jakob, und obwohl Lorenz nichts von dem Gesicht hinter der Maske sehen konnte, glaubte er ein boshaftes Grinsen zu entdecken.
»Keine Sorge. Hätte ich deine Liebsten direkt umbringen wollen, hätte ich das längst getan.« Und als wäre das nicht unwesentlich: »Deine Frau war so freundlich, mir die Tür zu öffnen.«
Automatisch blickte Lorenz zu Verena. Schuldbewusst presste sie die Augen zusammen. Die Situation war zu viel für sie. Und Lorenz konnte es ihr nicht verdenken. Er kam sich selbst vor, als stünde er mitten in einem Thriller.
»Was wollen Sie?«, wiederholte Lorenz mit einer furchtsamen Stimme, die nicht nach seiner eigenen klang.
»Ich möchte dir eine Chance lassen, deine Familie zu retten. Wie ich schon sagte, ich hätte sie alle sofort töten können. Deine Frau. Deine Tochter. Deinen Sohn. Aber das wäre zu einfach für dich, Lorenz. Zu unbedeutend. Vor allem nach dem, was du mir angetan hast.«
»Ich?« Lorenz riss die Augen auf. »Was soll ich denn getan haben? Bitte. Ich bin Taxifahrer. Ich habe …«
»Schweig! Ich weiß, wer du bist. Ich habe jeden deiner Schritte nachverfolgt. Von deiner Jugend bis heute. Schließlich musste ich dich finden. Glücklicherweise bist du nie aus Karlsruhe weggezogen, was es mir nicht allzu schwer gemacht hat. Aber lassen wir das. Hierbei geht es nicht um mich, sondern um dich, Lorenz, mein Lieber. Es geht um dich und deine Familie. Und um die nächsten vierundzwanzig Stunden.«
»Was?« Lorenz wusste nicht, wie ihm geschah. Von was redete der Mann da? Was sollte er verbrochen haben?
»Das muss eine Verwechslung sein. Ich habe nie irgendetwas …«
»Bist du in einen Brunnen gefallen und hast dir den Kopf gestoßen? Ich sagte, du sollst schweigen.« Der Mann hob die Waffe. »Ah, ah, ah. Komm nicht auf dumme Gedanken.«
Lorenz, der sich fühlte, als hätte er beim Öffnen der Wohnzimmertür eine irreale Welt betreten, die der realen Welt auf schreckliche Weise bis auf den letzten Quadratzentimeter glich, hatte einen winzigen Schritt vorwärts gemacht. Jetzt sah er sich mit dem schwarzen Loch einer Pistole konfrontiert. Der Lauf deutete unmittelbar auf ihn. Er öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, dann schloss er ihn wohlweislich wieder und trat zurück. Die wenigen Zentimeter, die er von seiner Familie Abstand nahm, schmerzten ihn. Es fühlte sich an, als würde er sie im Stich lassen.
»So ist’s gut. Schön auf Abstand bleiben. Du möchtest doch nicht riskieren, dass ich es mir anders überlege und aus vierundzwanzig Stunden wenige Sekunden mache.«
»Was muss ich tun?«
Wieder glaubte Lorenz, hinter der Maske ein Grinsen zu entdecken.
»Jetzt geht’s in die richtige Richtung. Sehr gut.« Er deutete mit der Pistole auf einen Tisch hinter der Tür. Als Lorenz sich herumdrehte, erkannte er drei ihm fremde Gegenstände. Zwei schwarze kleine Kästchen und etwas, das in etwa wie ein Armband aus Kunststoff aussah.
»Nähere dich ruhig. Ich habe dich im Auge.«
Lorenz tat, wie ihm geheißen, und gab sich dabei alle Mühe, nicht zu nahe an seinen Sohn oder den Unbekannten heranzutreten. Jede Bewegung kam ihm wie ein großes Risiko vor.
Das ist ein Traum. Ich bin tatsächlich vor Müdigkeit mit dem Kopf ins Waschbecken geknallt. Dabei muss ich mir den Schädel so stark angeschlagen haben, dass ich nicht spüre, wie das Wasser aus dem Hahn über meinen Hinterkopf fließt.
Bei näherer Betrachtung erkannte Lorenz die Gegenstände als das, was sie waren. Das, was er zuvor für ein Armband gehalten hatte, war in Wahrheit eine Smartwatch, Marke Xplora. Bei den zwei Kästen handelte es sich um Bodycams ohne Aufdruck eines Herstellers.
»Das wirst du anlegen. Eine der Kameras an deiner Brust, die andere an deinem Rücken. So kann ich sehen, was vor und was hinter dir geschieht. Auch die Smartwatch wirst du tragen. Darauf ist eine App installiert, mit der ich durchgehend deinen Standort orten kann. Versuch gar nicht erst, die Polizei oder sonst jemanden zu kontaktieren. Ich denke, du weißt, was dann passieren wird.«
Die Worte ließen Lorenz erschauern. Ihm war noch immer nicht klar, was das hier sollte. Zudem fiel es ihm schwer, darüber nachzudenken. Hinter ihm lagen seine Frau und seine Kinder gefesselt auf dem Boden. Sie waren nicht verletzt. Das war gut. Aber wie lange würde das so bleiben? Was hatte dieser Mistkerl mit ihnen vor?
»Und was soll ich dann tun? In ein Pornokino gehen und heimlich Aufnahmen machen?«, fragte er und wünschte sich sofort, die Worte besser hinuntergeschluckt zu haben. Schon seine Lehrer in seiner Schulzeit hatten ihn ständig gemaßregelt, er neige dazu, in den falschen Momenten die Klappe zu weit aufzureißen.
»Netter Witz«, sagte die Stimme hinter ihm. »Aber es ist doch etwas Größeres. Nimm die Sachen an dich, dann dreh dich wieder zu mir um.«
Lorenz tat, was der Kerl von ihm verlangte. Natürlich fiel sein Blick sofort wieder auf seine Familie. Auf Jakob, der noch so klein war, dass sie für ihn in jedem Vergnügungspark nur den ermäßigten Preis zahlen mussten. Auf Selina, die ihnen vor nicht ganz einer Woche offenbart hatte, dass sie sich in einen Jungen aus ihrer Klasse verknallt hatte; Finn, wenn Lorenz sich recht erinnerte. Bei seinen Gedächtnislücken hätte es aber ebenso gut Tim oder Fridolin sein können.
Selbstverständlich fiel sein Blick auch auf Verena. Sie betrachtete er am längsten. Die Mischung an Gefühlen, die er dabei empfand, war kaum in Worte zu fassen.
»Und jetzt?«, fragte er.
»Jetzt darfst du gehen. Dann wird unser kleines Spiel beginnen.«
»Spiel? Was für ein Spiel soll das sein? Hören Sie zu, ich glaube nach wie vor, Sie halten mich für den Falschen. Ich weiß nicht, wer Sie sind, und ich wüsste auch nicht, inwiefern ich Ihnen ein Unrecht angetan haben soll. Meine Güte, ich bin Taxifahrer. Ich bringe Leute von A nach B, mehr nicht.«
»Wie ich schon sagte: Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, dass du nicht so unschuldig bist, wie du vorgibst zu sein. Aber das einzusehen liegt bei dir. Und jetzt geh. Vierundzwanzig Stunden. Ab jetzt. Um drei Uhr nachts hat der Spuk ein Ende. Was mit deiner Familie geschehen wird, hängt ganz von dir ab.«
»Vierundzwanzig Stunden, um was zu tun?« Lorenz spürte, wie ihn Wut packte. Er fühlte sich wie einer dieser Hunde, die die Zähne fletschten, während sie sich gleichzeitig innerlich vor jeder Auseinandersetzung fürchteten. Herrje, der Kerl hatte eine Waffe. Und er schien nicht ganz normal zu sein. Nein. Er war nicht ganz normal. Er war irre, hatte den Verstand verloren!
»Nicht so bärbeißig, mein Freund. Denk daran, wer hier das Sagen hat. Und vor allem solltest du daran denken, dass die Zeit bereits läuft.«
Stille. Lorenz gab keinen Ton von sich. Nur das Pulsieren seines Herzens sprach für sich.
»Du hast’s also kapiert«, sagte der Fremde nickend. »Also. Finde heraus, wer ich bin.«
»Was?«
»Andernfalls …« Er deutete mit der Pistole einen Schuss an, wobei er die Hand nach oben schnellen ließ. Lorenz fuhr innerlich zusammen.
»Wie soll ich das tun? Wie soll ich herausfinden, wer Sie sind, wenn ich doch gar keinen Anhaltspunkt habe?«
»Das ist dein Problem. Ich sage nur: Deine Zeit tickt. Ticktack, mein Lieber. Geh jetzt da rüber und bring die Kameras an.« Er deutete auf die Tür.
Lorenz gehorchte, wobei er erneut und widerwillig darauf achtete, seinem Sohn nicht zu nahe zu kommen. Als er sich an ihm vorbeischob, spürte er ganz deutlich, wie ein Teil von ihm darauf pochte, die Befehle des Mannes zu ignorieren, sich niederzuknien und diese verfluchten Knebel aus Jakobs und Selinas Mündern zu entfernen. Sie lagen so straff um ihre jungen Gesichter, dass sich die Lippen spannten. Mit neuerlichem Schreck musste er feststellen, dass sie tränennass waren.
Als Lorenz wieder an der offenen Tür stand, begann er unmittelbar damit, die Kameras mit einem vorgefertigten Clipverschluss am Kragen seines T-Shirts zu befestigen. Der Stoff war glücklicherweise fest genug, dass er unter dem Gewicht der Kameras nicht nachgab.
»Gut. Eine hinten, eine vorn. Jetzt die Smartwatch«, sagte der Maskierte und zuckte wiederholt mit seiner Waffe. Diesmal zielte er jedoch auf Lorenz selbst.
»Hören Sie zu … Wenn ich Ihnen irgendetwas angetan habe, wieso lassen wir dann nicht meine Kinder und meine Frau aus dem Spiel? Sie können gewiss nichts für … Nun, dafür, was ich getan haben soll. Können wir nicht …«
»Nein, können wir nicht. Und solltest du auch nur halb so klug sein, wie ich dich einschätze, wirst du früh genug herausfinden, weshalb nicht. Jetzt drücke auf den Knopf an der Seite.«
Lorenz tat es. Das Display der Smartwatch leuchtete auf. Sie musste schon vorab eingestellt worden sein, da ihn das System nicht dazu aufforderte, irgendwelche Daten einzugeben. Viel Mühe schien sich der Unbekannte jedoch nicht gegeben zu haben. Das Display zeigte die korrekte Uhrzeit, aber als Datum den 01. Januar 2000 an.
Als Lorenz von der Uhr aufblickte, bemerkte er, dass sich der Maskierte zwischen seinen Kindern und seiner Frau fortbewegt hatte. Nun stand er nicht mehr hinter seinem Sohn, sondern weiter rechts im Raum, direkt hinter Verena.
»Deine Zeit läuft, mein Lieber. Aber ich habe noch etwas für dich. Einen kleinen Hinweis, den ich mir soeben überlegt habe. Wie ich finde, wirkst du auf mich noch etwas zu entspannt. Zu selbstsicher. Zu wenig nervös.«
»Ich bin ganz sicher nicht entspannt«, antwortete Lorenz.
»Ich finde schon.« Er ging in die Knie, wobei er die Pistole weiterhin auf Lorenz gerichtet hielt. Jetzt hockte er da wie jemand, der im Wald ein Geschäft verrichten wollte. Seine langen schwarzen Haare hingen so tief, dass sie über Verenas Gesicht streichelten. Wie auch die Kinder hatte sie die Hände hinterm Rücken und die Beine mit Seilen zusammengebunden. Ihr Blick wanderte hektisch hin und her. Ihre Hilflosigkeit war schier zu greifen.
Bevor Lorenz auch nur erahnen konnte, was der Mann im Schilde führte, grapschte der nach einer von Verenas auf dem Rücken befestigten Händen.
»Nur damit du mir glaubst.« Der Mann griff sich einen von Verenas Fingern und bog ihn nach hinten um. Ein lautes Knacken ertönte.
Verenas erstickte Schreie hallten durch den Raum. Auch Selina schrie, als eiferte sie mit ihrer Mutter um die Wette. Jakob bebte am ganzen Leib vor Entsetzen. Er hatte die Augen fest zusammengekniffen.
»Hören Sie auf!«, rief Lorenz. Nein, er kreischte. »Hören Sie auf damit!«
»Vierundzwanzig Stunden, Lorenz. Keine Sekunde länger. Ticktack. Ticktack!«
3
Wieder auf der Straße, fühlte sich Lorenz, als wäre er soeben von einem Bulldozer überfahren worden; ein Bulldozer, der den Namen Realität trug. Einerseits konnte er nicht glauben, was gerade geschehen war, andererseits stand es ihm nur allzu deutlich vor Augen. Seine Frau, seine Kinder – sie alle befanden sich in der Gewalt eines Verrückten. Und warum? Weil dieser Mistkerl glaubte, dass … dass …
Dass ich irgendetwas verbrochen habe? Was soll das sein?
Er wusste es nicht. Und er konnte sich auch keinen Reim darauf machen. Seine Gedanken waren viel zu sehr damit beschäftigt, um seine Frau zu kreisen, die dort oben auf dem Boden lag und die Schmerzen wegatmete.
Das werde ich dir heimzahlen. Glaub mir, das verzeihe ich dir nicht.
Er drehte sich zu dem Sandsteingebäude herum. In der Nacht wirkte es grau. Da die Rollläden im Wohnzimmer heruntergelassen waren, war vom Licht hinter den Scheiben nichts zu erkennen. Natürlich nicht. So konnten die Nachbarn nicht sehen, was vor sich ging.
Was sollte er nur tun? Was sollte er tun?
Auf der Straße war nichts los. Linden’s Irish Pub an der Ecke zur Hirschstraße hatte bereits geschlossen, und die ganzen Studenten lagen entweder schon in ihren Nestern oder hatten sich während der Semesterferien aus der Stadt gestohlen. Nur auf der Brauerstraße, einer der Hauptverkehrsadern, befanden sich noch wenige Autos.
Lorenz fühlte sich, als wäre er der einsamste Mensch auf der Welt. Er wäre am liebsten wieder die Stufen hinauf in den dritten Stock gestiegen, um seine Familie wenigstens noch einmal zu sehen. Ein letztes Mal vielleicht. Wer wusste, wie die nächsten vierundzwanzig Stunden enden würden.
Schon jetzt spürte Lorenz, wie die Zeit verrann. Und obwohl er so angestrengt nachdachte, dass ihm die Schweißperlen auf die Stirn traten, fand er keinen Anhaltspunkt, um mit seiner Suche nach dem richtigen Namen zu beginnen.
Finde heraus, wer ich bin.
Warum verlangte der Mann das von ihm? Was ergab es für einen Sinn? Wenn er Lorenz etwas heimzahlen wollte, dann hätte er das vor nicht einmal fünf Minuten tun können. Teufel noch eins, er hätte es bereits tun können, als Lorenz noch nicht mal zu Hause gewesen war. Offensichtlich war es ihm ein Leichtes gewesen, Verena zu überwältigen und zu fesseln. Wahrscheinlich hatte er sie sich zuerst vorgenommen, bevor er die Kinder im Schlaf überraschte.
Deine Frau hat mir die Tür geöffnet.
Ganz wunderbar, Verena. Ganz wunderbar. Das hättest du nicht besser machen können. Und ich darf dich jetzt wieder aus der Scheiße ziehen wie so oft.
Eine Woge der Wut überkam ihn, genau wie in den Momenten ihrer Streitigkeiten. Sie warf ihm etwas vor – meist Faulheit –, und wenn sie dann in der Küche stand und das Fleisch in der Pfanne nicht so wollte wie sie, rief sie ihn um Hilfe; oder sie fragte ihn, ob er ihre E-Mails auf Fehler überprüfen könne, weil Madame sich wieder einmal zu viel vorgenommen hatte und er ja genügend Zeit hätte, sich zu kümmern, ganz gleich, mit was er sich gerade beschäftigte. Er konnte gerade dabei sein, Jakob eine Gutenachtgeschichte vorzulesen oder Selina bei den Hausaufgaben zu helfen, Verenas Wehwehchen gingen immer vor. Und wenn er nicht spurte, dann wurde die Geldkeule ausgepackt. Sie verdiene mehr. Sie sei diejenige, die am häufigsten zum Einkaufen ging. Sie war die Hoheitsperson der Familie, die Mutter, nach deren Regeln alles zu laufen habe, weil Frauen sich ja schließlich lange genug von ihren Männern haben unterdrücken lassen müssen. Und wie war es tatsächlich? Was war die Realität? Hatte er oder sie die Tür ins Dunkel geöffnet?
Hat man dir als Kind nicht beigebracht, keinem Fremden die Tür aufzumachen?
Lorenz hielt sich die Hände vors Gesicht und versuchte sich zusammenzureißen. Er musste die Gedanken, die sich ihm im Laufe der letzten Jahre bis ins Mark eingegraben hatten, ignorieren, sie aus seinem Verstand ausradieren, weil Vorwürfe jetzt nichts brachten. Sie brachten nie etwas, aber jetzt brachten sie erst recht nichts. Die Zeit tickte.
Du musst dich konzentrieren, Lorenz. Das Leben deiner Familie hängt davon ab.
Er schloss die Augen.
Versuch dich in die Situation von eben zurückzuversetzen. Genau wie du es in den Hunderten Kriminalfilmen gesehen hast. Was weißt du über den Kerl? Was kannst du über ihn sagen?
Er versuchte es. Angestrengt. Krampfhaft. Er dachte daran zurück, wie er das Licht im Wohnzimmer angeschaltet und den Fremden auf der Couch sitzen gesehen hatte. Er dachte an seine bequeme Haltung; ein Bein über das andere geschlagen. Dann an seine Größe – etwas größer als er selbst. Ein Meter fünfundachtzig, geschätzt. Dann die Statur. Unter dem wallenden Overall schwer zu erkennen, doch Lorenz glaubte, dass der Mann weder dick noch hager war.
Lange Haare.
Aber war das echtes Haar gewesen? Lorenz wusste es nicht. Und er konnte sich nur schwer konzentrieren. Seine Gedanken schweiften automatisch zu Jakob und Selina ab. Wie sie angstvoll auf dem Boden gelegen hatten, die Hände hinter ihren Rücken verknotet, die Münder mit …
Bleib bei der Sache!
Es brachte nichts. Da gab es nichts Auffälliges an dem Mann, was ihm einen Hinweis hätte liefern können. Nicht das kleinste Detail. Nicht einmal die Art seiner Sprechweise konnte Lorenz Aufschluss geben. Seine Stimme war ruhig gewesen. Fast schon gelassen hatte sie gewirkt. Doch jeder Arzt im Land neigte dazu, so zu sprechen. Jeder Anwalt. Jeder gottverdammte Politiker.
»Fuck!«, stieß Lorenz aus. Im nächsten Augenblick holte er mit dem Fuß aus und trat hart gegen einen vor dem Eingang des Hauses stehenden Papiercontainer. Ein lautes Tock hallte durch die Straße, gefolgt von einem leisen Schmerzensschrei. Lorenz humpelte zwei Schritte, dann verflüchtigte sich der Schmerz wieder. Zum Glück bestand der Container aus Kunststoff und nicht aus Metall. Ein gebrochener Fuß war das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte.
Das reichte. Er konnte nicht länger nur herumstehen. Er musste fort von hier. Hier hafteten seine Gedanken zu sehr an seinen Kindern.
In einem Tempo, das mehr von seinen Füßen als von seinem Verstand vorgegeben wurde, folgte Lorenz der Gartenstraße und den unter zahlreichen Bäumen geparkten Wagen in Richtung Karlstor. Es steckte keine Überlegung hinter dem Einschlagen dieses Wegs. Er ging hier entlang, weil er es immer tat, wenn er aus dem Haus kam und sich zur Arbeit aufmachte.
Leute begegneten ihm. Zwei Schwarze, die auf der anderen Straßenseite herzhaft lachten, während einer von ihnen ein leuchtendes Smartphone in den Händen hielt, und ein alter Betrunkener. Er kam aus einem der Lokale gestolpert, in denen man nur Männer antraf, die entweder tranken oder an den einarmigen Banditen saßen oder beides. Als er an Lorenz vorüberkam, stolperte er und rempelte Lorenz mit der Schulter an.
»Pass doch auf!«
Der Betrunkene sah ihn mit wässrigen, blutunterlaufenen Augen an. Sein Bart war so struppig wie ein Vogelnest.
»Passochselberauf«, lallte er abwinkend. Dann verschwand er in die Dunkelheit.
Lorenz sah ihm einen Augenblick nach, und plötzlich hatte er das Bild vor Augen, wie er aussehen würde, wenn der Maskierte sein Ziel erreichte; wenn Lorenz nicht herausfand, wer er war.
Ich würde mir das nie verzeihen können, dachte er und nahm wieder Tempo auf.
Er lief ohne Ziel. Und obwohl es sich einerseits entlastend anfühlte, weil er in Bewegung war, so spürte er doch, wie mit jedem zurückgelegten Meter weiter Zeit verrann. Was den Mann mit der Maske anging, so war er bislang auf keinen neuen Gedanken kommen; nichts, was ihn weiterführte. Er ließ die Szene in seinem Wohnzimmer wieder und wieder wie einen Film vor seinem geistigen Auge vorüberziehen, doch nichts, rein gar nichts wollte sich ihm offenbaren.
Die S-Bahn-Station Karlstor war im Gegensatz zu den Straßen wesentlich heller beleuchtet. Mehrere Passanten harrten auf den dortigen Bänken aus. Die S-Bahnen und die neue U-Bahn, die für einige Kontroversen gesorgt hatte, waren nach den Taxis die zügigsten Fortbewegungsmittel in der Stadt, weshalb es kein Wunder war, hier rund um die Uhr Leute anzutreffen. Auch Lorenz stellte sich an die Gleise. Nicht weil er unbedingt von hier fortwollte – das Gegenteil war der Fall –, sondern weil er sich von der Ruhe und dem Knattern der Räder auf den Schienen klare Gedanken erhoffte. Hier konnte er nichts tun, nichts verhindern.
Finde heraus, wer ich bin, echote es wieder und wieder in seinem Geist.
Aus dem Dunkel rollte die nächste Bahn an. Lorenz stieg ein.
4
Nachdem Lorenz aus der Wohnung verschwunden war, stieg der Maskierte über ihre Körper hinweg und ging ins Bad, von wo er mit einer dunkelblauen Sporttasche zurückkam. Verena beobachtete ihn dabei. Ihre Hand schmerzte entsetzlich und pulsierte heiß. Durch den Knebel in ihrem Mund bekam sie kaum Luft. Als sie noch ein Kind gewesen war, waren ihre Eltern mit ihr beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt gewesen, der festgestellt hatte, dass die kleine Verena eine krumme Nasenscheidewand hatte. Man hatte darüber nachgedacht, sie ihr in einer Operation zu brechen und neu zu formen, sodass sie besser atmen könne. Doch allein das Wort brechen hatte bei Verena zu solchem Entsetzen geführt, dass sie sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hatte. Ihr Vater hatte sie lange Zeit zu überreden versucht, war jedoch gescheitert. Wenn sie etwas nicht wollte, konnte Verena stur sein. Heute, mit achtunddreißig Jahren, bereute sie es, den Eingriff nicht hinter sich gebracht zu haben. Zum einen, weil sie beim Schlafen schnarchte, was ihr äußerst unangenehm war. Und zum anderen, weil sie jetzt kaum atmen konnte. Schon bevor ihr dieses Arschloch den Mittelfinger ihrer rechten Hand gebrochen hatte, war es ihr schwergefallen, mit der Nase direkt über dem Wohnzimmerteppich zu atmen. Ihr Körper gierte so sehr nach Frischluft, dass ihr schwindlig wurde und sie sich zusammenreißen musste, nicht bewusstlos zu werden. Viel tun konnte sie allerdings nicht. Alles, was ihr blieb, war, den Kopf von einer auf die andere Seite zu drehen.
Vor ihr lagen ihre beiden Kinder, die zwei schönsten Geschöpfe, die auf der Welt existierten. Sie auf dem Boden liegend, mit den Händen hinterm Rücken und geknebelt zu sehen, rief Verzweiflung in Verena hervor, wie sie sie noch nie zuvor gespürt hatte. Wie sie starrten … Wie Angst in ihnen loderte … Wie sie mit ihren Blicken zu rufen schienen. »Mama, Mama, bitte hilf uns hier raus, bitte.« Es fühlte sich an, als wäre ein Dolch in ihre Brust gestoßen worden, an dessen Griff sich irgendjemand lustvoll zu schaffen machte, ihn hin und her ruckte, um ihn ihr tiefer und tiefer ins Herz zu rammen. Sie hatte schon Verzweiflung gespürt, vor allem, wenn es um Lorenz ging. Aber nichts war mit dem hier vergleichbar.
Der Maskierte befand sich jetzt am Fernsehtisch. Über die Sporttasche gebückt, holte er einen flachen schwarzen Kasten hervor. Ein großes Tablet, wenn sie sich nicht täuschte. In aller Seelenruhe schloss er es an die am Tisch verbaute Steckdose an, lehnte es gegen den Fernseher und schaltete es ein. Dann zog er sich einen Stuhl heran und setzte sich davor.
Verena hatte im Vergleich zu Lorenz wesentlich mehr Zeit gehabt, ihn bei seinem Handeln zu beobachten. Ihr war längst aufgefallen, dass die schwarzen Haare nicht echt, sondern eine billige Kunststoffperücke waren, die man in jedem x-beliebigen Laden zur Karnevalszeit kaufen konnte. Die Maske, die der Unbekannte trug, wirkte nicht wesentlich qualitätsvoller. Sie jagte ihr dennoch eine Heidenangst ein.
Was ihr noch aufgefallen war, war die absolut gerade Haltung des Fremden. Als wäre er beim Militär gewesen, wobei die Art und Weise, wie er seine langen, feingliedrigen Finger benutzte, eher für einen feinmotorischeren Job sprach. Etwas, wobei man extrem vorsichtig sein musste, wenn es drauf ankam.
Seine Stimme sagte ihr nichts. Schon bevor er ihr den Finger gebrochen hatte, hatte sie darauf gehofft, sie zu erkennen und so irgendwie den Zugang zu ihm zu finden, genau wie sie es bei ihren Schülerinnen und Schülern tat, wenn diese wieder mal zu sehr in ihrer eigenen Gedankenwelt versanken und dem Unterricht nicht lauschten. Allerdings würde das wiederum voraussetzen, dass ihr Mund nicht mit einem Stück Stoff geknebelt wäre.
Wie hatte er das überhaupt geschafft? Wie hatte er sie so rasch überlisten können?
Weil ich ihm die Tür geöffnet habe. Weil ich diesen einen Fehler gemacht habe.
Der Trick, mit dem er sie dazu gebracht hatte, ihm die Tür zu öffnen, ohne zuvor durch den Türspion ins Treppenhaus zu spähen, war so simpel gewesen, dass sie sich dafür schämte, darauf reingefallen zu sein. Als sie gefragt hatte, wer da sei, hatte er einen Namen genannt; den ihres Nachbarn. Anton Kienholz. Anton war ein alter Mann mit brüchiger Stimme, der zwei Stockwerke über ihnen wohnte und so gut wie nie bei ihnen klingelte, da von der Post abgegebene Pakete meist bei den unten liegenden Parteien abgegeben wurden. Er kam höchstens vorbei, wenn ihm mal der Zucker oder das Salz ausgegangen war. Und genau so hatte der Fremde es auch angestellt. Er hatte behauptet, Anton Kienholz zu sein, hatte seine Stimme dabei etwas älter klingen lassen und behauptet, er habe sich ein Omelett machen wollen, doch ihm seien die Eier ausgegangen. Und so war es geschehen. Sie hatte ihm die Tür geöffnet. Er hatte sie mit seiner Pistole in die Hand in die Wohnung zurückgedrängt, sie gezwungen, sich mit der Brust voraus an eine der Wände zu stellen, und sie anschließend gefesselt. Das Seil hatte er aus seiner Sporttasche gezogen, die er kurz vor Lorenzʼ Ankunft im Badezimmer versteckt hatte. Wieso er das getan hatte, wusste sie nicht. Und es spielte auch keine Rolle. Das einzig Wichtige war, dass Lorenz sich etwas einfallen ließ; etwas, was sie rettete; etwas, was sie aus diesem Schlamassel befreite, bevor …
Eine Träne – eine von unzähligen – kroch aus ihrem Augenwinkel hervor und befeuchtete zuerst ihre Wange, dann das Tuch in ihrem Mund. Sie wollte sich nicht vorstellen, was mit ihren Kindern geschehen würde, wenn Lorenz versagte.