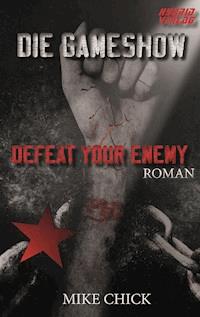5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Er wacht auf. Er weiß nicht, was passiert ist. Er weiß nicht, wo er ist. Er weiß nur, dass er diesem Käfig entkommen muss. Sofort. Denn bald schon kommt er wieder - der Mann mit den drei Gesichtern. »Da war Dunkelheit. Und da war Schmerz. Brennender, pochender Schmerz. Nicht lokalisierbar und doch mitten in ihm. Mehr wusste er nicht.« Marcus Nolte glaubt einen Schutzengel vor sich zu haben, als er Eddie Gal begegnet. Der alte Mann lässt ihn in sein Haus. Er bietet ihm Schutz vor dem Schneesturm, eine warme Mahlzeit – und setzt ihn unter Drogen. Als Marcus zu sich kommt, ist seine Welt ein Alptraum. Eingesperrt in einen Käfig, gibt es kein Entrinnen. Und er ist nicht allein. Eddie Gal beherbergt viele, Frauen wie Männer. Sogar ein junges Mädchen. Und das Schlimmste: Er hat etwas mit ihnen vor. Kann Marcus dem Grauen entkommen? »Die Geschichte finde ich hammermässig. So etwas habe ich noch nie gelesen.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Brutal, spannend, nichts für schwache Nerven!!! Für alle Chris Carter Fans zu empfehlen! Gerne mehr davon!« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Der Käfig. Entkommen ist tödlich« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Michaela Retetzki
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Emily Bähr, www.emilybaehr.de
Covermotiv: Rawpixel.com / lifeforstock / alineofcolor user21720231 / via Freepik
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Kapitel I
Schneesturm
1
Da war Dunkelheit. Und da war Schmerz. Brennender, pochender Schmerz. Nicht lokalisierbar. Er schwebte zugleich östlich und westlich von ihm, außerhalb seines Ichs, fern seiner Körperlichkeit und doch mitten in ihm. Mehr wusste er nicht.
Er wusste nicht, wo er war und wer er war. Er versuchte nachzudenken, doch der Schmerz ummantelte seine Gedanken.
Die einzige Frage, die blieb – sah so der Tod aus?
Konnte das Leben danach das Gesicht von Schmerz tragen?
Auch darauf fand er keine Antwort.
Das Einzige, was sich ihm offenbarte, war, dass Zeit verstrich. Er spürte, wie sie dahinsiechte, spürte, wie die Uhr des Schicksals tickte, so wie er es oft gespürt hatte, wenn er zu viel von dem Zeug zu sich genommen hatte, das Michelle immer als Gift bezeichnete.
Michelle … Sie hatte sein Herz ins Licht der Welt erhoben, nur um es ihm später wieder zu entreißen, was ihm das seine brach.
Seltsamerweise waren das klare Gedanken. Trotz des Schmerzes. Trotz der Dunkelheit. Zwei Personen. Zwei Gesichter. Das eine, jüngere – traurig. Das andere, erwachsene – voller Zorn.
Das Pochen in seinem Schädel schwoll an, wuchs sich zu einem Dröhnen zwischen seinen Ohren aus. Das winzige Licht, das er erblickt hatte, pulsierte, schrumpfte. Es drohte zu verschwinden. Der Schmerz arbeitete gegen ihn wie Wind gegen die schmale Flamme einer Kerze; dem einzigen Lichtblick im Dunkel seiner Existenz.
Er konzentrierte sich, klammerte sich am Bild Michelles fest, versuchte die Wut von ihren Lippen abzulesen. Denn obwohl er sie nicht zu hören vermochte, wusste er doch, dass in diesen stummen Worten sein Ich verborgen liegen musste. Und ja, da drang es zu ihm durch! Da ertönte das Wort, das er flehentlich ersuchte. Schwach, aber in seinem Dasein verbarg sich alles, was es brauchte, um zu wissen, dass er nicht nur Schmerz und Dunkelheit war. Es war sein Name.
Marcus Nolte.
2
Die Düsternis wich Nebel. Wie lange es dauerte, bis es dazu kam, war unmöglich zu schätzen. Es hätten Sekunden oder Tage sein können. Dennoch: es war ein Fortschritt. Der Nebel nahm ihn nicht vollkommen ein, er überschattete die Dinge vielmehr. Und Schatten – so tiefschwarz sie auch waren – konnte man durchdringen, nicht wahr? Marcus konnte spüren, wie er atmete, wie sich sein Brustkorb hob und senkte, wie ein feiner Hauch von seinen Nasenlöchern über seine Lippen strömte. Und er spürte Kälte, die vom Boden in seinen schmerzerfüllten Körper drang. Lag er auf Beton? Metall? Er wusste es nicht, aber ja, ja!, das waren Fortschritte.
Ein weiterer Fortschritt kam über seine Ohren hereingeströmt. Ein monotones Surren. Wie von … von …
Sein Verstand spielte das Spiel ohne ihn. Marcus versuchte ihm eine Antwort abzugewinnen, doch ohne Erfolg. Allerdings brachte das eine ganz andere Frage mit sich, die seine Situation womöglich erklären würde. Stimmte seine Mutmaßung, so wusste er, gab es ein Entkommen. Oder vielmehr ein Entgleiten. Denn wenn das hier nicht der Tod war, dann würde die Wirkung des braunen Pulvers – des Gifts – mit der Zeit nachlassen und ihn in die Welt zurückwerfen. Ein Blackout! Das war es, worunter er litt. Was sollte es auch anderes sein? Auch wenn er sich nicht erinnern konnte, wieder mal gedrückt zu haben, ergab nur das Sinn. David musste ihn besucht, sein Köfferchen geöffnet und ihm den Mund wässrig geredet haben wie auch die vielen Male zuvor. Daraufhin konnte nur eines geschehen sein – Marcus hatte die Nadel in seine Armbeuge gestochen und gedrückt.
Gott, steh mir bei, das hier ist nicht mehr als eine verfluchte überdimensionierte Dosis. Keine Überdosis, nur zu viel …
Das dachte er. Dann erinnerte er sich an etwas. Und ihm wurde bang ums Herz.
Denn David konnte nicht mit seinem Köfferchen vorbeigekommen sein. David würde überhaupt nie wieder kommen. Denn David, sein bester Freund, war tot; von einem Zug überrollt. Wie lange war das her? Marcus wusste es nicht. Sein Gedächtnis spielte erneut Verstecken mit ihm. Nur sein Unbehagen nicht. Es präsentierte sich mit stolzgeschwellter Brust.
Ein Geräusch stieß mit der plötzlichen Vehemenz eines Pistolenschusses durch seinen Gehörgang. Ein lauter werdendes Rasseln, das in einem ohrenbetäubenden Knall mündete. Ein Laut, der einen aus Albträumen reißen konnte. Nur war dies kein Traum. So real fühlten sich Träume nicht an. Der Nebel war manifest, der Schmerz in seinem Kopf von göttlicher Klarheit. Das hier war kein Traum, auch wenn er es sich wünschte.
»Lasst mich raus!«
Die Stimme kam von weit her. Die Wut einer zutiefst verängstigten Frau hallte mit ihr durch das Dunkel.
Dann: ein Klappern, metallisch, kalt. Wieder die Stimme. Dieselben Worte, dieselbe Wut. Wieder und wieder. Und je öfter sie ertönte, desto bitterer klang sie. Aus Wut wurde Verzweiflung.
Es folgte der dumpfe Knall einer sich rasch schließenden Tür. Dann nahm Stille den ganzen Raum ein wie eine Flaute auf hoher See. Oder der Triumph des Todes über das Leben.
Um Marcus herum gab es keinen Laut. Kein Geräusch. Kein Wispern. Nur das tieftonige Surren. In seiner Brust trommelte ein ganzes Orchester frisch erblühter Angst.
3
Nach der wiedergekehrten Dunkelheit folgte eine lange, beschwerliche Periode des Wahrnehmens; eine Wallfahrt durch den Sumpf seines mit Kopfschmerzen verschneiten Verstandes.
Seine Wanderung begann mit einem bitteren Geschmack auf der Zunge. Es war nicht viel, aber doch etwas. Ein weiterer kleiner Fortschritt auf seinem sich wehrenden Weg zu sich selbst und der Situation, in der er festsaß wie ein Vogel im Käfig.
Wie die Überbleibsel einer zerkauten Kopfschmerztablette, dachte Marcus. Und weiter dachte er, dass er so eine Tablette nun gut gebrauchen könne. Eine oder zwei oder ein Dutzend. Paracetamol, Aspirin, Exidrin, was auch immer, Hauptsache, dieses verfluchte Dröhnen in seinem Schädel würde endlich nachlassen!
Nein. Nein! So durfte er erst gar nicht zu denken anfangen. So stürzte er sich nur weiter in Ungnade. Er musste forschen, suchen, entdecken, herausfinden, was hier geschah.
Also weiter. Was kannst du hören? Was kannst du riechen? Was kannst du …
Er roch tatsächlich etwas. Ein tiefer, unwillkürlicher Atemzug bescherte ihm einen Geruch, den er aus einer Zeit vor dem Knast kannte. Schwach, aber doch da. Wieder kam ihm David in den Sinn; David, der mit zwölf Jahren Zigaretten von seinem Vater stahl, die sie gemeinsam im Wäldchen am Ortsrand pafften; David, der mit roten Augen in die Schule kam; David, der überhaupt nicht mehr in die Schule kam.
David, der von zu Hause weglief, um die Welt zu erkunden, und auf seinem Weg einmal zu oft falsch abbog.
Unglücklicherweise hatte Marcus ihn auf diesem Weg ein Stück begleitet. Und deshalb wusste Marcus auch, welche Substanz da in der Luft schwebte und seine Nasenschleimhäute zum Weinen brachte. Es war der Geruch, der an David gehaftet hatte, wenn er aus dem Labor kam – das Labor neben den Gleisen, die das Ende von Davids Weltreise besiegelt hatten. Was Marcus roch, war Ammoniak. Oder anders ausgedrückt: der Gestank abgestandenen Urins. Wo auch immer er sich befand, hier roch es wie in einer Bahnhofsunterführung.
Erneut fragte er sich, ob er nicht doch gedrückt hatte. Zu vieles sprach dafür. Selbst das »Lasst mich raus!«-Geschrei dieser Frau – oder war es ein Mädchen? – erbrachte kein standhaftes Gegenargument. An Orten, an denen Substanzen in Spritzen, als Tabletten und Pulver regierten, kam es nicht selten zu Wahnvorstellungen und Paranoia. Die Pot- oder Piece-Raucher waren da noch das angenehmste Volk. Wild ging es hingegen bei denjenigen zu, die Deep Purple, Crystal oder Amphis wie MDMA oder Ecstasy einnahmen. Sie wussten, wie man richtige Partys feiert, o ja! Nur … Nur konnte Marcus nicht glauben, dass er sich einen Schuss gesetzt hatte. Es war einfach undenkbar, denn er durfte nicht rückfällig geworden sein, weil er sonst Tina für immer verlor.
Tina.
Der Name blitzte in seinem Geist auf wie ein hell funkelnder Stern. Gleichzeitig fühlte er eine einmalige Wärme in seinem Herzen aufblühen. Sie war es, weswegen er zu drücken aufgehört hatte. Sie war der Grund, weshalb er durch die Hölle des Entzugs gewandert war. Sie war sein Orientierungspunkt durch das Fegefeuer und sämtliche Qualen hindurch; die Übelkeit, das hohe Fieber, das nie enden wollende Erbrechen. Sie war sein Polarstern, sein Kompass, denn sie war vier Jahre der bedingungslosen Liebe. Sie war Tina Nolte, seine Tochter – sein Herz.
Ich habe nicht gedrückt, dachte Marcus. Das darf ich einfach nicht!
Tatsächlich? Konnte er mit hundertprozentiger Sicherheit von sich behaupten, nicht rückfällig geworden zu sein? Die Antwort darauf war so klar und eindeutig, dass die Wärme in seiner Brust einer herzzerreißenden Kälte wich. Denn er konnte sich keineswegs sicher sein. Er wusste, dass ein Süchtiger auf ewig ein Süchtiger blieb. Egal wie klug er war, egal welchen Schulabschluss er hatte, egal wie oft und wie sehr er sich vornahm, den richtigen Weg zu finden, der Wald, durch den ein Junkie schritt, war stets mit dornigen Fallen und tiefen Schluchten gepflastert. Viele, sehr viele versuchten sich für die Familie durch dieses Dickicht zu kämpfen, und nur sehr wenigen gelang es. Der Wille ist ein mit Emotionen verbundenes, formbares Element. Heute möchte man den Mount Everest bezwingen, morgen erscheint die Spitze so fern wie der Mars. Der innerliche Druck, ohne ein »Yeah Baby, let it run!« in den Adern durchzukommen, wächst mit jedem erklommenen Meter, und selbst wenn man am Gipfel angelangt, fühlt man sich doch, als würde einem weit in den Untiefen des Meeres der Sauerstoff ausgehen. Man beginnt zu zittern, wenn man Fear and Loathing in Las Vegas im Fernsehen sieht; beim Fensterbummel in einer Fußgängerzone hält man unentwegt nach jemandem Ausschau, der nur annähernd danach aussieht, ein Beutelchen in seiner Manteltasche versteckt zu haben. Und wenn einem dann ein Schreiben des Familiengerichts ins Haus flattert, weil die Ex-Freundin das alleinige Sorgerecht einklagt, dann …
Ich habe nicht gedrückt!
Seine ohnehin kaum aushaltbaren Kopfschmerzen verdichteten sich wie in einer Linse aufgefangene Sonnenstrahlen. In seinen Ohren heulte eine Sirene los. Und es brannte. Seine Gedanken brannten, fingen Feuer, als er sich verbittert zu erinnern versuchte, als er versuchte, die Blase um sein Gedächtnis zum Platzen zu bringen.
Irgendwo über seinem reglosen Körper surrte etwas. Ein mechanisches Geräusch, das die Luft in Schwingungen versetzte, als wollte sie fliehen. Der Ammoniakgeruch breitete sich aus. Er grub sich durch seine Nase bis in seine Eingeweide. Übelkeit überkam ihn. Sein Magen verkrampfte sich. Und obwohl sich dies alles schrecklich, ja, grausam anfühlte, war Marcus zutiefst dankbar, als sich sein Mageninhalt den Weg nach oben bahnte. Er übergab sich, schmeckte Säure und Galle auf Zunge und Zahnfleisch. Er empfand es nicht als schlimm. Im Gegenteil. Dieses Brennen in seiner Kehle, der krampfhafte, rein körperliche Versuch, den Geschmack durch Schlucken zu verdrängen – all das bedeutete nichts anderes als Leben. Er fühlte sich hundeelend, aber er lebte!
Blinzelnd öffnete er die Augen. Was er sah, war keine Drogenhöhle.
Es war ein weitaus schlimmerer Schlamassel.
4
Es war, als wären die Kopfschmerzen Wächter gewesen, die seinen Verstand nicht zerreißen, sondern im Gegenteil, zu schützen versucht hatten. Als erschwerten sie ihm den Empfang äußerer Einwirkungen aus reiner Nächstenliebe. Wie ein Störsender auf der Empfangswelle eines Radiosenders einer diktatorischen Regierung. Die Sprache war Schmerz, die Absicht jedoch Gnade. Das wurde Marcus klar, als er die Augen öffnete und eine Flut unglaublicher Eindrücke seinen Verstand überschwemmte.
Was er um sich erblickte, konnte unmöglich real sein. Wäre Marcus sich nicht voll und ganz sicher gewesen, hätte er geglaubt, er träume. Kein Traum einer Realität, sondern eines Films, quasi ein Traum im Traum, so fiktiv kam ihm alles vor. In seiner Zeit auf dem Gymnasium – einer unberührten Zeit ohne Knasttattoos auf Schultern und Armen, als die Welt noch so groß und das Leben so unbekümmert wirkte – kristallisierte sich in Marcus eine Leidenschaft für die Gedichte Edgar Allen Poes. Und das vor ihm wirkte wie eines dieser Gedichte.
Alles, was wir sehen und scheinen, ist nur ein Traum in einem Traum.
So musste es sein. Nur so konnte es sein, denn wer zur Hölle käme schon auf die Idee, Menschen wie Tiere in …
Marcus fuhr sich mit beiden Händen über den haarlosen Kopf und betrachtete anschließend seine vom Schweiß nassen großen Hände. Dann tat er etwas, das er in der Zeit des Rausches und der Halluzinationen erlernt hatte.
Er atmete tief durch, schloss die Augen und zählte von zehn rückwärts.
Zehn … Neun … Acht …
Egal, was ich mir eingeflößt habe, es war ein Fehler …
Sieben … Sechs … Fünf …
Es war ein großer Fehler, weil ich Tina …
Vier … Drei …
Nie mehr wiedersehen werde, wenn …
Zwei … Eins …
Das nicht aufhört!
Null.
Er öffnete die Lider.
Ein Augenblick des Schwindels überfiel ihn. Dann musste er sich eingestehen, dass das hier weder ein Traum noch eine von Poes lyrischen Weltansichten, sondern die gewöhnliche, gottverdammte Realität war. Der bittere Geschmack auf seiner Zunge war real. Die Gerüche von Ammoniak und Kotze waren echt. Und auch die Gitterstäbe (Sorry, Bro. Diesmal ist es kein Bluff) waren echt. Marcus saß sprichwörtlich im wahren Leben gefangen. Dieses Begreifen verdrängte die Benommenheit mit einem Schlag.
»Hallo?«, keuchte er und rappelte sich auf. Mit Mühe gelang es ihm, auf die Füße zu kommen. Doch kaum streckte er die Knie, stieß er mit dem Kopf gegen etwas, das die Schmerzen jäh zurückbrachte. Über ihm ertönte ein hallendes Bong!, das durch seinen ganzen Körper vibrierte.
Er hielt sich die schmerzende Stelle und blickte auf. Erschrocken taumelte er um die eigene Achse, wo sich dasselbe grauenerregende Bild bot.
»Hallo?« Mit wiedergewonnener Stimme. »Ist da jemand? Hallo?«
Doch seine Rufe verhallten so nutzlos wie ein Biberfurz im Wald. Ein Teil des Halls wurde vom Stroh auf dem Boden geschluckt. Den größeren Teil jedoch warfen die vor Dreck und Spinnweben versifften gelblichen Fliesen an den Wänden zu ihm zurück. Was auch immer sich vor dieser Tür befand – entweder hörte ihn niemand oder man wollte ihn nicht hören. Denn auch nach weiterem Rufen und Flehen geschah nichts. Die Tür blieb geschlossen; und er allein mit seiner Furcht.
Sein Puls pochte. Rasch und frenetisch, als setze sein Herz alles daran, die Panik aus seinem Körper hinauszupumpen. Vergeblich. Sie regierte ihn bis in die letzte Zelle.
Wie im Rausch wendete er sich um sich selbst, versuchte etwas zu erblicken, was ihm einen neuen Anhaltspunkt verleihen würde, was in Gottes Namen hier vor sich ging. Dabei vergaß er, dass sein Gefängnis bei einer Höhe von einem Meter siebzig endete, und stieß sich erneut den Kopf, so hart, dass seine Zähne aufeinanderschlugen. Der Schmerz durchfuhr ihn wie ein Stromstoß. Erneut überkam ihn Schwindel. Alles drehte sich. Er versuchte sich auf den Beinen zu halten. Die Angst in ihm versuchte es. Dann ging er doch zu Boden. Er trat in sein eigenes Erbrochenes, rutschte aus und das war’s. Wie nach dem saftigen Kinnhaken eines Profiboxers rang er nach Besinnung.
Schwer atmend und entkräftet saß er da und konnte nicht fassen, in welche Scheiße er geraten war. Viel schlimmer war jedoch: Er wusste nicht einmal, um was für eine Scheiße es sich handelte.
Er schloss die Augen.
Konzentrier dich. Versuch dich zu erinnern, was vor der Dunkelheit geschah, riet ihm eine innere Stimme.
Aber alles, was ihm einfallen wollte, war das Antlitz seiner Tochter. Tina – wie sie auf der Schaukel hinterm Haus saß; das Haus, in dem auch er einst gewohnt hatte, bevor Michelle die Entscheidung traf, dass ein arbeitsloser Junkie nicht der richtige Umgang für sie und ihre Tochter war.
Er konnte Tina vor sich sehen, konnte das leise Quietschen der Schaukel hören, das durch den Wind und nicht durch ihre sonst so lebendige Freude entstand. Sie saß darauf. Das blaue Kleidchen wehte in der leichten Brise des Vor- und Zurückschaukelns. Ihre zartbraune Haut, die irgendwo in der Mitte zwischen der dunklen ihrer Mutter und seiner eigenen lag, schimmerte leicht im Sonnenuntergang. Er ging auf sie zu; auf sie und den grauen Stoffhasen auf ihrem Schoß. Er erinnerte sich noch genau, wie er die Sporttasche mit den Klamotten darin auf dem Rasen abstellte und auch die letzten Meter zu ihr überwand. Sie sagte nichts, blickte nur stumm über die Felder und Wiesen am Rande der Kleinstadt hinweg.
»Papa muss gehen«, sagte er zu ihr und hoffte insgeheim, Tina würde sich nicht zu ihm umdrehen. Er gab sich der Zuversicht hin, sie würde sein Gehen mit Schweigen quittieren. So wäre es für uns beide schmerzloser, dachte er in diesem Augenblick.
Doch so kam es nicht. Natürlich nicht. Denn Tina liebte ihren Vater, wie er auch sie liebte. Sie wandte sich ihm zu, sprang mit einem Satz von der Schaukel, rannte ihm in die Arme. Über ihre pausbackigen Wangen rannen schimmernde Bäche des Kummers.
»Nicht gehen, Papa«, flehte sie, ihr Gesicht gegen seine Brust gedrückt. »Du darfst nicht …«
Er hielt sie seinerseits fest, weinte jedoch nicht. Seine Tränen würden später fallen, wenn er allein war; fallen wie kalter Regen im Herbst.
Und so war es auch gekommen. Mit vor Dope zugedröhntem Schädel lag er auf Davids Couch, keine zehn Kilometer von Tinas Bettchen entfernt, und weinte. Es war ihm egal, dass die Couch nach nassem Hund und die Wohnung nach Alkohol und abgestandenem Zigarettendunst rochen. Es war ihm auch egal, dass die Bettfedern im Zimmer nebenan quietschten, weil David irgendeine Blondine mit nach Hause geschleppt hatte, um ihr nach ein bisschen weißem Zauber den Himmel auf Erden zu präsentieren. Es war ihm sogar egal, was Michelle von ihm hielt. Nur Tina war ihm nicht egal. Denn sie war sein Herz, sein Ein und Alles.
Als Marcus die Augen wieder öffnete, merkte er, dass er eingeschlafen sein musste. Zwar gab es hier drinnen keine Fenster und somit keine Sonne, die ihm einen Hinweis darauf geben konnte, wie spät es war, doch etwas schien sich in der Zwischenzeit verändert zu haben. Zuerst wusste er nicht, was es war. Dann fiel es ihm auf. Die Pfütze Erbrochenes … Sie war verschwunden. Auch der Ammoniakgestank war weg. Stattdessen roch es kräftig, fast gebieterisch nach frischem Stroh.
Wie der kürzlich ausgemistete Stall eines Kaninchens, dachte Marcus. Dann dachte er weiter, dass diese wenn auch minimale Veränderung etwas ganz Grundsätzliches bedeutete. Denn es hieß, wer auch immer ihn in diesem gottverdammten Käfig eingesperrt hatte, konnte nicht weit sein. Dieser Jemand musste sich in der Nähe aufhalten!
»Hallo?«, rief er. »Ist da jemand?«
Keine Antwort.
»Hallo?«
Das neue Stroh musste den Schall seiner Stimme um einiges besser aufnehmen als das verschmutzte zuvor. Seine Rufe wurden regelrecht verschluckt, wozu auch die sechs oder sieben Strohballen in einer Ecke beitrugen, die vorher noch nicht da gestanden hatten. Plötzlich kam Marcus der Raum, der etwa fünf auf fünf Meter maß und mindestens drei Meter in die Höhe ragte, deutlich kleiner vor, beengend. Und er, obwohl er einen Meter achtzig groß war und aufgrund seiner antrainierten breiten Oberarme im Knast nie große Probleme bekommen hatte, fühlte sich mit einem Mal sehr klein.
Das hier ist etwas anderes als Gefängnis. Das hier ist der totale Irrsinn!
»Hallo!«
Keine Antwort. Doch Marcus wollte, konnte nicht aufgeben. Das hier durfte nicht sein. Es war erniedrigend, grausam, unmenschlich! Marcus war in seinem Leben durch viele Täler gegangen – der Knast war das tiefste von allen gewesen –, doch dieses Tal versetzte ihn in eine nie dagewesene Panik.
Er umklammerte die Gitterstäbe mit den Händen, riss daran und schrie erneut. »Hallo!« Zwei, drei, zehn Mal schrie er und brachte die Scharniere des Käfigs, in dem er steckte, zum Erzittern. Er trat gegen das Metall, ohne über jedwede Konsequenzen nachzudenken. Sein Verstand hatte nur eines im Sinn: Er wollte hier raus. Jetzt!
Als er vor Erschöpfung in sich zusammensank, aufgab (Nur für den Moment, beteuerte er in Gedanken), öffnete sich die Metalltür zu seiner Linken. Die Scharniere quietschten. Dann fiel sie mit einem Donnern zurück ins Schloss. Kein Sonnenlicht war hereingedrungen. Überhaupt kein Licht. Stroh raschelte, als sich ihm jemand näherte. Marcus öffnete die Augen. Vor seinem Käfig stand jemand. Der Mann sagte nur einen Satz zu ihm. Oder zu sich selbst. Denn das, was er von sich gab, ergab keinen Sinn.
Er sagte: »Die Hühner legen keine Eier.«
5
Marcus betrachtete den Mann mit einer Mischung aus Verwunderung und Entsetzen. Der Mann war nur etwa einen Meter siebzig groß, circa Mitte fünfzig und schlank. Sein Gesicht wirkte abgehärmt und wetterrau. Seine letzte Rasur musste mindestens drei Tage zurückliegen. Auf seinem Kopf trug er eine dicke Stoffmütze mit Schild, die fast das gleiche karierte Muster wie seine dunkle Vliesjacke aufwies. Seine Beine steckten in einer Latzhose, die mit Schmutz und Flecken übersät war. All das kam Marcus befremdlich vor, jedoch nicht zwangsläufig anormal. Was Marcus jedoch entsetzte, waren das schmallippige Lächeln und der Blick. Der Mann sah Marcus zwar an, doch mit seinen hellgrünen Augen blickte er nicht etwa ihn an, sondern durch Marcus hindurch. Es war ein Augenblick, der ihm eine nie dagewesene Gänsehaut bereitete. Er spürte, wie sich seine Nackenhaare aufstellten, als strömte aus irgendeiner Ritze ein eiskalter Windhauch, der nur ihn erfasste.
»Wer sind Sie?«, fragte Marcus mit heiserer Stimme.
Der Mann hob die buschigen Augenbrauen, als verwunderte nun ihn, dass der Mann im Käfig nicht bloß schreien, sondern wahrhaftig sprechen konnte. Dann setzte er sich, ohne ein Wort von sich zu geben, in Bewegung.
»Haben Sie nicht gehört? Wer sind Sie? Was haben Sie mit mir vor?«
Der Mann umging den Käfig. Er gab keinen Mucks von sich, schüttelte nur den Kopf, als würde er irgendetwas nicht begreifen. Dann wiederholte er seine sinnlose Phrase. »Die Hühner legen keine Eier.«
Marcus konnte nicht an sich halten. Er brüllte den Mann an. »Was soll das heißen?«
Der Mann grinste und in diesem Lächeln lag nicht bloß Geistlosigkeit, sondern auch Stolz. Er hob den Zeigefinger gen Himmel wie ein Lehrer, der etwas mit dieser Geste zu verdeutlichen versuchte. »Das wird schon noch.« Er tippte sich mit der Seite des Fingers gegen die Krempe seiner Kappe. »Eddie Gals Mama hat keinen dummen Jungen großgezogen, ah, ah. Ich weiß, wie man die Viecher zum Eierlegen bringt. Ich brauch nur den richtigen Hahn.« Er lachte. Ein tiefes, kehliges Lachen.
»Sind Sie das? Ist das Ihr Name? Eddie Gal?«
Der Mann wandte sich den Strohballen zu. Mit Eifer griff er danach und verteilte das Stroh auf dem Boden.
»Heißen Sie Eddie Gal?«
Der Mann sah zu Marcus auf, grinste, antwortete aber nicht. In seinem Blick, erkannte Marcus, lag nicht nur matte Intelligenz, sondern auch die Introvertiertheit einer Person, die sich von der realen Welt zurückgezogen hatte. Womöglich schon vor langer Zeit.
»Lassen Sie mich raus, Herr Gal! Bitte! Was habe ich Ihnen denn getan?«
Keine Antwort. Der Mann arbeitete, verteilte in Seelenruhe Stroh auf dem Boden. Dabei fing er an zu summen. Ein Wiegenlied.
Hush, little Baby, don’t say a word …
»Lassen Sie mich raus!« Marcus spie die Worte durch die Gitter. Wut durchströmte ihn. »Sie haben nicht das Recht, mich gefangen …«
»Es wird Zeit«, sagte Eddie Gal kühl. In seinem Blick stand eine Ausdruckslosigkeit, die Marcus überhaupt nicht gefiel.
»Was? Wofür wird es Zeit? … Wofür wird es Zeit?«
»Zeit, die Hühner zu füttern.« Er sprach in einem sehr sanften Ton, als spräche er gutmütig zu einem Baby.
Dann, sich die Hände vom Stroh abreibend, verließ Eddie Gal den Raum, wie er ihn betreten hatte. Mit dem Quietschen eines Scharniers voraus und eines im Rücken. Er drehte sich nicht mehr nach Marcus um.
6
Es war sinnlos, eine Schwachstelle an diesem Käfig zu suchen. Das Ding war sicherer als eine Bärenfalle. Im Grunde bestand es aus einer Eisenplatte am Boden und daran festgeschweißten daumendicken Eisenrohren. Wohl wahr, an der oberen Seite des Käfigs befanden sich Scharniere, an denen man das Oberteil wie einen Deckel aufklappen konnte, doch Eddie Gal musste, was seine Sicherheitsvorkehrungen betraf, ein Pedant sein. Zwei dicke Vorhängeschlösser, so glänzend, dass sie nur neu sein konnten, verriegelten die Klappe. Das Eisen war korrodiert und an manchen Stellen sogar rostig, doch von Brüchigkeit keine Spur. Und an den Vorhängeschlössern, oh, da hatte Eddie Gal nicht gespart, o nein! Eddie Gals Mama hatte einen vorsichtigen Drecksack großgezogen.
Wider jede Vernunft rüttelte und zerrte Marcus daran, gab es aber bald auf. Es brachte ihm nur Schwielen an den Händen. Und wer wusste schon, wie lange er es mit ihnen hier drinnen aushalten musste.
Dieser Überlegung schloss sich ein Gedanke an, der ihm weit bedrohlicher vorkam. Was war, wenn er hier überhaupt nicht wieder rauskommen würde?
Nein, das war etwas, das er sofort wieder vergessen musste! Denn aus diesem Gedanken sprach Hoffnungslosigkeit, und wenn Marcus auch nicht zu den Fantasten dieser Welt gehörte, er war noch weit davon entfernt, die Hoffnung aufzugeben. Dafür war es eindeutig zu früh. Außerdem …
Wenn ich die Hoffnung aufgebe, gebe ich auch Tina auf, und so weit wird es niemals kommen!
Tina …
Die Stille um ihn machte ihn nervös und kribbelig. Wäre er älter und etwas gesetzter, hätte er seine Lage womöglich anders überblicken können, hätte vielleicht durch reines Grübeln Herr der Lage werden können. Doch Marcus war erst achtunddreißig und keineswegs gesetzt. In seinen Adern pochte noch ein Teil des Blutes seiner Jugend. Und nun brachten Wut und Adrenalin dieses Blut in Wallung. Zu allem Übel grummelte nun auch noch sein Magen. Ein schlechtes Zeichen. Denn hungrige Menschen denken nicht, wie sie denken könnten, das hatte schon seine Oma gewusst.
»Junge, iss«, hatte sie stets gefordert, wenn er nach der Schule zu ihr nach Hause gekommen war. Nicht aus Bedenken, er würde zu dünn, sondern weil Großmutter Nolte der Überzeugung war, dass die großen Denker dieser Welt ihre Einfälle und Erfindungen einem vollen Magen zu verdanken hatten. »Einstein wäre seine Relativitätstheorie nie eingefallen, hätte er an ein Omelett gedacht«, sagte sie aufschlussreich und schöpfte Marcus ein bisschen mehr auf den Teller.
Nur …
Marcus konzentrierte sich. Er spürte, dass der Hunger bei ihm genau das Gegenteil wie bei Einstein bewirken musste. Denn sein Geist, die Maschine in seinem Kopf, sprang endlich an. Er fühlte beinahe, wie sich die Zahnräder zu drehen begannen und den Film seiner Erinnerungen zurückspulten.
Er presste die Finger gegen die Schläfen. Die Kopfschmerzen hatten ihn nicht vergessen und das sagten sie ihm in diesem Moment, sie sagten: Hallo, da sind wir wieder, waren nur kurz einen Kaffee trinken und ein Hörnchen essen. Jetzt sind wir kräftig genug, um wieder richtig mit anzupacken.
Doch die Stille, die ihn zuvor nervös gemacht hatte, half ihm über die Schmerzen hinweg. Mit ihr gelang es ihm, sie beiseitezuschieben und sich voll und ganz auf den letzten verbliebenen Moment vor der Dunkelheit zu konzentrieren. Und jetzt begriff er auch, weshalb ihm der Hunger nicht im Weg stand, sondern zur Seite. Denn es war Hunger gewesen, der ihn getrieben hatte. Großer, knurrender Hunger. So immenser Hunger, dass ihm der Magen bis zu den Knien hing, während er über das mit Schnee bedeckte Feld im Süden Karlsruhes gestrauchelt war. Er erinnerte sich.
Kalter, schneedurchsetzter Wind peitschte ihm ins Gesicht. Die Straßen und Wiesen glichen einer Wüste aus eisigem Puderzucker, aus der schwarze Stämme mit störrigen, spitzen, laublosen Ästen emporragten wie einsame Wächter einer verlorenen Zivilisation. Betrachtete man die Landstraße in Richtung Ettlingen nicht, wo gelegentlich der eine oder andere Pkw sich seinen Weg durch das unendliche Weiß bahnte, hätte die Welt in diesem Moment genauso gut menschenlos sein können, so einsam fühlte Marcus sich.
Denn David war tot. Gestorben. Einfach so. Er war mit dem Hirn voller verrückter Ideen und LSD auf die Gleise vor dem Labor getreten, über sie hinwegbalanciert wie ein russischer Akrobat, lachend und grinsend. Und Marcus – so clean wie noch nie in seinem Leben – war ihm nachgerannt und rief dabei, er solle von den Gleisen runter. »Mach, dass du da verschwindest, du kranker Idiot!«, hatte er geschrien.
»David! David!«, hatte er geschrien.
Dann hatte er ohne jeden Zweck nur noch geschrien.
Der Zug erfasste David, noch ehe Marcus ihn auch nur entfernt hätte erreichen können. Der Zugführer hupte noch in letzter Sekunde, betätigte die Notbremse, doch es war zu spät. Nichts hält einen Zug davon ab, seinen Weg fortzusetzen, wenn er einmal richtig in Fahrt gekommen ist. Mit ohrenbetäubend quietschenden Rädern raste er auf David zu. Marcus hörte seinen Freund noch etwas rufen, etwas Fröhliches, offenbar sogar Lustiges. Etwas wie: »Ich bin der König der Welt!« Da erschien der Zug unmittelbar vor ihm. Das breite Lächeln auf Davids Gesicht klatschte geräuschlos gegen die Frontpartie der schreienden Maschine und verschwand in einem roten Fleck aus Blut.
Einen Augenblick lang hatte Marcus nicht gewusst, was er tun sollte. Der Zug hatte inzwischen angehalten und die Seitentür des Führerstandes schwang auf. Ein Mann um die fünfzig mit Schnauzbart und Schirmmütze stand bleich und ins Leere blickend in der Öffnung. Wind musste ihm ins Gesicht peitschen, wie er auch Marcus angriff. Erst in dem Moment, in dem der Mann seinen Weg zu den Gleisen hinunter fortsetzte, kam Marcus – der vor Schock reglos in einer Entfernung von etwa sechzig Meter verharrte – ein flüchtiger Gedanke an das offen stehende Labor. Der kleine Kastenbau mit Flachdach, der vor Jahrzehnten Bahnarbeitern Unterschlupf gegen Kälte und Hitze geboten hatte, stand sperrangelweit offen und war randvoll mit diversen Laborgeräten. Davids Schätze. Vor allem aber befanden sich darin Stoffe wie Abflussreiniger, Propan, Lampenöl und nicht zuletzt – Ammoniak. Würde jemand auf die Idee kommen – und Marcus war sich ganz sicher, dass jemand das würde –, das Häuschen aufzusuchen, um sich ein wenig unterzustellen oder mit dem alten und doch funktionstüchtigen Telefon an der Wand die Polizei oder seine Vorgesetzten anzurufen, dann würde derjenige all die Schadstoffe und Chemikalien finden. Es würde vielleicht ein, zwei Sekunden dauern, bis es klick machte, doch auch das würde ganz sicher geschehen. Und wäre Marcus dann noch in der Nähe, dann würden sie ihn …
Er brauchte nicht weiter nachzudenken, was passieren würde, wenn man ihn in unmittelbarer Nähe eines Drogenlabors vorfand. Genau deshalb nahm Marcus die Beine in die Hand und rannte. Er rannte und rannte, bis ihn die Gedanken an David – sein Lachen, als ihn der Zug erwischte – und sein Hunger fast zur vollkommenen Erschöpfung trieben. Gegen den Durst gab es ein Mittel, das ihm quasi vor die Füße geweht wurde, doch die Leere in seinem Magen kam ihm übermenschlich vor. In seinem Bauch rebellierte es wie der Erdboden unmittelbar vor einem Vulkanausbruch. Merkwürdigerweise konnte er jetzt, da er ausgehungert war, das Gewicht seines Magens spüren, als hätte er Steine geschluckt. Er fühlte sich, als habe er in seinem Leben noch nie solch einen Kohldampf gehabt.
Vielleicht, dachte er, eine psychosomatische Reaktion.
Das konnte durchaus stimmen, im Endeffekt war das jedoch scheißegal. Er brauchte etwas zu essen. Jetzt. Schnell.
Geld hatte er keines. Das stellte er nicht erst jetzt fest, das wusste er bereits, seitdem er von zu Hause fortgegangen war. Er hatte an einer Tankstelle Zigaretten kaufen wollen und feststellen müssen, dass seine Börse wie auch seine Schlüssel noch auf dem Tisch im Wohnzimmer lagen; dort, wo er gedöst hatte. Bis Michelle kam. Und ihn rausschmiss.
Was sollte er also tun, ohne Geld? Betteln?
Marcus fiel auf, dass er sich jetzt zum ersten Mal seit Beginn seiner Flucht umsah. Er hatte nicht darauf geachtet, wo er entlangrannte. Ihm war nur wichtig gewesen, so schnell wie möglich das Weite zu suchen.
Und das hatte er tatsächlich gefunden. Hier draußen befand sich nichts. Nur Schnee und kahle Bäume. Die Stadt lag mindestens zwei Kilometer in seinem Rücken.
Ohne es zu wollen, ging er weiter. Seine Füße schmerzten allmählich. Und jetzt, da er seinen Schritt drastisch verlangsamte, spürte er, wie die Kälte durch das Kunstleder seiner Schuhe drang. Seine Zehen fühlten sich an wie Eisklumpen. Ihm war kalt. Seine Zähne klapperten aufeinander wie Stepptänzer auf Koks.
Ihm wurde klar, dass er umdrehen musste. Würde er geradeaus weitergehen, würde er nichts als weitere Einöde finden. Klar, irgendwann würde er nach Ettlingen, die nächste Stadt im Süden, gelangen, doch bis dorthin würden nicht nur seine Füße, sondern sein ganzes Muskelgewebe hart wie das Eis unter dem Schnee sein.
Kehrte er allerdings um, dachte er, würde er unweigerlich an den Bahngleisen vorbeimüssen.
Marcus wandte sich der Stadt zu, deren Ausläufer er bereits am Horizont sehen konnte. So weit kam ihm der Weg gar nicht vor. Und wenn er einen Umweg um die Unfallstelle machte …
Du bist ein Idiot, schimpfte er sich. Ein großer, großer Idiot! Du hast es bis hierher geschafft, schlotterst wie auf Entzug und glaubst tatsächlich, bis in die Stadt zurückzugelangen? Ein Umweg würde dich schlicht umbringen. Bye-bye, Tina, Schatz. Dein Vater hat es geschafft, die Drogen hinter sich zu lassen, und nun scheitert er an kalten Füßen und einem leeren Ma…
Marcus runzelte die Stirn. Er war sich nicht sicher, ob ihm seine Hoffnung einen Streich spielte oder ob er wirklich glauben sollte, was er da sah. Keine hundert Meter östlich von ihm, hinter der herausragenden Ecke eines Wäldchens, erblickte er ein Gebäude.
Dem Stirnrunzeln entwuchs ein Grinsen, als er begriff, um was für eine Art Gebäude es sich handelte. Seine Füße bewegten sich vorwärts, noch ehe er es bemerkte.
Scheiße, wenn man das nicht Glück im Unglück nennt, weiß ich auch nicht. Die müssen da was zu essen haben. Und wenn ich anklopfe und ganz lieb bitte, werden die mir sicher was geben.
Und wenn sie dich nur aufwärmen lassen, dachte ein anderer, weit gesetzterer Teil von ihm, dann hättest du immer noch mehr gewonnen, als du verdienst.
Gleich da. Ich hab’s gleich geschafft, dachte Marcus. Und er schaffte es tatsächlich. Mit schmerzenden Füßen und einem Magen, der inzwischen irgendwo zwischen seinen Fersen baumelte, klingelte Marcus an einem Tag im Dezember irgendwo im Nirgendwo an der Haustür Eddie Gals.
7
Nun, da er sich erinnerte, ging es ihm auch nicht besser. Im Gegenteil. Vor allem der letzte Teil seiner Erinnerungen, der Abschnitt unmittelbar vor der ersten Dunkelheit, machte ihm bei genauerer Betrachtung mehr zu schaffen, als dieses sinnlose Herumsitzen in diesem gottverdammten Käfig.
Die Kopfschmerzen ließen nicht von ihm ab. Wie denn auch? Um sie loszuwerden, brauchte er etwas zu essen und zu trinken. Zwei Hamburger mit einer großen Portion Pommes, eine Cola und als Dessert mindestens vier Aspirin bitte. Gott, wie er sich dafür hasste, an dieser Tür geklingelt zu haben!
Nur habe ich keine andere Wahl gehabt, nicht wahr? Wie hätte ich denn auch sonst den Tag überstehen sollen, draußen in der Kälte?
Eventuell … Nur eventuell hätte er es zurück bis in die Stadt schaffen können, das wusste er. Die Wahrscheinlichkeit, sich dabei ein paar Fußzehen abzufrieren, wäre nicht gerade niedrig gewesen, aber hätte er dies in Kauf genommen, dann …
Es brachte nichts, darüber nachzudenken, das wusste er. Nur fiel ihm nichts Besseres ein, um die Zeit totzuschlagen. Er konnte ja schlecht sein Handy rausholen und …
Mein Handy!
Das Scheißding fiel ihm jetzt erst wieder ein.
Er klatschte mit den Händen seine Oberschenkel ab, doch die Taschen seiner Jeans waren leer und sein Hemd besaß keine. Er spürte, wie sein Herz jagte.
Das Arschloch wird es mir abgenommen haben, ganz klar, er wäre auch schön blöd, wenn er mich nicht nach Gegenständen durchsucht hätte. Zumindest dann nicht, wenn er nicht will, dass ich die Polizei alarmiere und ihm so in den knochigen Arsch trete.
Er fand sein Handy nicht. Natürlich nicht. Und ihm fiel auch ein wieso. Es musste in seiner Jacke stecken und diese musste Gal ihm abgenommen haben, bevor er ihn in diesen Käfig gesperrt hatte, denn hier war sie nicht.
Gut mitgedacht, du alter Drecksack. In meiner Jacke hatte ich nämlich auch ein Schweizer Taschenmesser, das mir gewiss einigen Nutzen gebracht hätte!
Er ertastete nichts in seinen Taschen. Gar nichts. Und obwohl er damit gerechnet hatte, zerrüttete es ihn. Nein, das wäre nicht richtig. Er war niedergeschlagen, fühlte sich wirklich am Boden. Er hatte nichts, womit er sich diesem Schicksal entgegensetzen konnte, außer seinen eigenen Händen. Und die brachten ihm nichts, solang es niemanden gab, gegen den er sie richten konnte. Dieser Verrückte war genauso abwesend wie Essen oder Trinken.
Eine neue Frage kam ihm in den Sinn. Was war, wenn dieser Kerl ihn schlicht verhungern lassen würde – wenn er ihn hier eingesperrt hatte, nur um ihn dann gänzlich zu missachten?
Das wird er schon nicht. Warum sollte er auch?
Nur was, wenn doch? Wusste er nicht aus dem Fernsehen, dass Verrückte nicht nach humanem Ermessen handelten? Wie viele Sendungen und Filme hatte er sich angesehen, in denen Psychopathen und Soziopathen und Schizophrene und weiß der Teufel noch welche Rubrik Gestörter manche Menschen misshandelten, nur um sie zu misshandeln? Wir können ja mal anfangen aufzuzählen. CSI, Bones, Criminal Minds, Criminal Intent, Cold Case und so weiter und so weiter. Basierten nicht manche dieser Drehbücher sogar auf wahren Begebenheiten – Serienkiller, die die unvorstellbarsten Gewalttaten mit ihren Opfern trieben und sie letztlich umbrachten? Warum nicht also diese Geschichte: Mann klopft an fremder Haustür, um sich ein wenig aufzuwärmen und eventuell etwas zu essen abzustauben, woraufhin der Kriminelle ihn schachmatt setzt und in einen Käfig einsperrt. Das macht er natürlich, weil seine Eltern ihn misshandelten und seine Mitschüler meinten, ein paar Hänseleien könnten nicht schaden. So wurde aus einem halbwegs intelligenten Burschen ein stupider Verbrecher, der Rache an der ihn misshandelnden Gesellschaft nimmt, indem er seine Opfer schlicht verhungern lässt. Sie quälen sich einen, zwei, drei Tage und am vierten Tag liegen sie regungslos in ihrem Kittchen. Als die Polizei eintrifft, ist es leider schon zu spät, aber die Cops bleiben die Guten, weil sie sich ja auf die Suche begeben haben. Abspann. War das nicht ein dolles Ding?
Scheiße. Allein bei dem Gedanken, hier drinnen zu verhungern, machte er sich fast in die Hose. Und das war ein Thema, das sich dem des Hungers nicht zwangsläufig unterordnete, nicht wahr? Früher oder später musste jeder mal. Klein und groß.
Wenigstens die Hühner bekommen Futter, dachte Marcus und spürte, dass ihn wieder dieser leichte Schwindel packte. Es musste die Nachwirkung irgendeiner Droge oder eines Medikaments sein, das ihm Eddie Gal verabreicht haben musste.
Was könnte es sein?, rätselte er. Sein Denken verringerte spürbar die Geschwindigkeit, was ebenfalls eine Nachwirkung sein musste. Er spürte, wie ihn eine unerwünschte Schläfrigkeit überkam. Ab jetzt lenkte ihn weniger sein Verstand als vielmehr sein Unterbewusstsein. Er kannte die Dinge, worüber er nachdachte, aus vergangenen Tagen. Lange vergangenen Tagen.
K.-o.-Tropfen werden es sicher nicht gewesen sein. Eher ein Schlafmittel. Vielleicht ein Benzodiazepin wie Bromazepam oder Lorazepam. Kommt auf die Wirkdauer an. Wie lange hat dieser miese … mich eigentlich außer Gefecht … Mit Tabletten? … Spritze … Spritze in den …
Marcus’ Lichter gingen aus. In dieser Welt. In seinen Träumen hingegen tobte ein eisiger Schneesturm.
8
Die Leute sind nett und gehen sich gegenseitig zur Hand, wenn sie können. Das sagen die Badener über sich selbst, wodurch sie sich von ihren Nachbarn, den Schwaben, abzugrenzen versuchen – von denen wiederum seit jeher behauptet wird, sie seien spießig, geizig und eben weniger hilfsbereit als die Badener. Das mochte stimmen oder nicht. Marcus jedenfalls baute nun auf diese Hilfsbereitschaft, denn er glaubte, jeder normale und vernünftige Mensch half einem Erfrierenden in Not.
Ein Mann mit struppigem grauem Mehrtagebart, Holzfällerhemd und Latzhose öffnete die Tür des Bauernhauses, nur einen Spaltbreit. Der größte Teil seines Gesichtes blieb verborgen. Mit dem sichtbaren grasgrünen Auge musterte er den Fremden skeptisch. Die Krähenfüße in seinem Augenwinkel vertieften sich wie auch die Falten um den herabhängenden Mundwinkel des Mannes.
Noch bevor Marcus etwas sagte – sagen konnte –, nahm er Gerüche aus dem Innenraum wahr; einen Hauch energiegeladener Luft eines Holzofens und etwas anderes, viel Kräftigeres. Sein Magen knurrte vor Erregung. Essen. Das war es, was er roch. Der intensive Duft gekochten Fleisches. Wild, womöglich. Schwer und durchdringend. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen.
»Ja?« Der Mann hinter der Tür betrachtete Marcus mit dem markanten Misstrauen eines Einsiedlers. Marcus konnte es ihm nicht verdenken. Da kam ein verschneiter Niemand, klingelte an seiner Tür und klapperte vor Kälte mit den Zähnen. Wer würde da nicht argwöhnen?
»Helfen … Sie mir … bitte.« Mehr bekam Marcus nicht heraus. Es verwunderte ihn, denn im Gegensatz zu seiner hakenden Sprechweise flossen seine Gedanken gleichmäßig.
Der Mann blickte an ihm vorbei in die Ferne, als überprüfte er, ob der Mann vor seiner Tür in Begleitung gekommen war. Als er sich vergewissert hatte, dass da niemand war, blickte er Marcus wieder an. Die Skepsis auf seinem Gesicht blieb jedoch.
»Is Ihr Auto steh’n geblieben oder sind Se einer dieser beknackten Leuchturmler?«
Einer Eingebung folgend, stimmte Marcus rasch zu. »Ja … Ja, ja. Auto … nicht weit von hier … Kam nicht mehr vorwärts … Dann … Sah ich das Haus … Bitte … Mir ist furchtbar … kalt.«
»Seh ich. Seh ich.« Der Landwirt fuhr sich mit der Zunge unter der Oberlippe über die Schneidezähne, was wohl ein Ausdruck des Grübelns sein mochte.
Marcus hatte nicht das Gefühl, es mit einem vom Volk der besonders Gescheiten zu tun zu haben, doch jeder wusste, auch der törichteste Hinterwäldler konnte ein gutes Herz haben.
»Bitte … es ist … so kalt hier … draußen«, stotterte Marcus.
»Sie sind kein Inspektor nichʼ, oder?«
»Nein.« Marcus schüttelte energisch den Kopf.
»Seh’n auch nich aus wie einer. Nun …«
Die Tür knallte ins Schloss und einen schrecklichen Augenblick lang fürchtete Marcus, dass es das gewesen war. Der Mann hatte ihn gesehen, gemustert und entschieden, dass eher die Hölle zufröre, bevor er ihn hereinließe.
Marcus riss den Mund auf, wie um zu schreien, doch ihm fehlte die Kraft. Mit einem Mal kam es ihm hier draußen deutlich kälter vor. Er zitterte am ganzen Leib. Die Gelenke seiner Finger schmerzten bei jeder Bewegung. Seine Füße fühlten sich an, als hätte man ihm Eisklötze an die Waden geschraubt. Er nahm sich zusammen und hob den Arm, um erneut anzuklopfen – nicht aufgeben! –, da klapperte es hinter der Tür und er erkannte, der Alte entfernte nur die Kette. Hoffnung keimte in ihm auf, obwohl der Vorgang eine gefühlte Ewigkeit dauerte. Eine Windböe erfasste seinen Nacken und schob eine Ladung feiner Schneeflocken in den Kragen seiner Jacke. Auf beiden Füßen tänzelnd, versuchte er die Kälte wenigstens geistig zu verdrängen. Dann ging die Tür auf.
»Ham Sie ’nen Käfer in der Hose oder müssen Sie pinkeln?«, fragte der Mann mit der Stimme eines Reibeisens.
»Mir ist nur … kalt. D-darf ich … r-reinkommen?«
Mit einem Ruck des Kinns stimmte der Landwirt zu, was Marcus dankend annahm. Hinter ihm schloss sich die Tür und sofort empfing Marcus eine wohlige Wärme. Er hatte es geschafft. Das Desaster mit David und dem Zug, das Labor und vor allem die Kälte lagen auf der anderen Seite der Türschwelle, hinter ihm.
»Schuhe auszieh’n«, grummelte der Mann und ging an Marcus vorbei in die Stube.
Marcus stand in einem schmalen Treppenhaus mit nur einer Treppe nach oben. Den Weg nach unten markierte eine geschlossene, in den Boden eingelassene Falltür aus hellem Holz. Ein dicker Eisenring diente als Griff. So etwas hatte Marcus nie zuvor gesehen. Er vermutete, dass sich dort unten einer dieser Gewölbekeller befinden musste, die man in früheren Tagen zur Aufbewahrung von Kartoffeln oder Äpfeln nutzte.
An der Wand über dem Schuhsammelsurium hing ein Spiegel mit kahlem Holzrahmen. Dass ihn jemand nutzte, war zu bezweifeln. Eine dicke Staubschicht lag auf dem Glas. Er hätte ohne Probleme das Wort Sau mit dem Finger hineingravieren können.
Marcus fiel allerhand auf. Auf dem Teppich im Flur lagen massenhaft Strohhalme verteilt. Viele davon grau und starr vor Schmutz. Die Kittel und Jacken wirkten, wie auch die meisten zu einer Pyramide aufgestapelten Schuhpaare darunter, wie das Handwerkszeug eines Landwirts, in dessen Leben es keine Frau gab. Die Pantoffeln waren ausgetreten, die grünen Gummistiefel schmutzverkrustet. Von ihnen gab es zwei Paare, wobei Marcus sich nicht viel dabei dachte. Womöglich wollte er nicht mit denselben Stiefeln in den Stall und in die Jauchegrube steigen, insofern es denn eine gab.
Er zog seine eigenen Sneaker aus. Auch aus den Socken schlüpfte er. Seine Mutter, hätte sie ihn dabei beobachtet, wie er barfuß durch die Wohnung eines Fremden tappte, hätte laut aufgekreischt, da man so etwas nicht tat. Aber man tat so viele Dinge nicht und Marcus beschloss, sich heute – wie auch so viele Male zuvor in seinem Leben – nicht darum zu scheren, was andere denken mochten. Ihn kümmerte es, was seine Füße brauchten beziehungsweise nicht brauchten, und das waren durchweichte Socken. Außerdem würde der Landwirt schon etwas sagen, störte er sich daran.
Als er in die Stube trat, blickte der Mann zwar auf Marcus’ nackte Füße, sagte jedoch nichts. Er kaute auf irgendetwas herum und verzog dabei das Gesicht. Als wollte er verdeutlichen, wie schwer es war, dieses Etwas mit den Zähnen zu bearbeiten. Dabei sah er Marcus wieder mit diesem einen zugekniffenen Auge an.
»Setzen«, sagte er und deutete auf einen Hocker vor einem Holzofen.
Es mochte sich dabei um eine Frage oder eine Aufforderung handeln, so genau ließ sich der Tonfall des Mannes nicht deuten. Überhaupt fiel es Marcus schwer, den Mann einzuschätzen. Seine Mimik war – wenn überhaupt – kaum ausgeprägt. Auch als Marcus sich setzte und ihm ein seichtes Lächeln schenkte, blieb sein Gesichtsausdruck steinern.
Marcus beschloss, sich auch damit nicht zu befassen. Das Feuer in dem Metallgehäuse knisterte und schlug wellenartig gegen den oberen Rand der Brennkammer. So nah vor dem Ofen war es nicht nur warm, sondern fast zu heiß. Dennoch fühlte es sich gut an, zu spüren, wie die Winterkälte von ihm abließ. So in etwa musste sich Captain America vorgekommen sein, als er seinem Eissarg entstieg, dachte Marcus.
Der Ofen war Teil des Wohn- und Essbereichs. Zu seiner Linken sah Marcus einen mit Glastüren versehenen Schrank. Fotos in Rahmen standen darin. Die Personen konnte er nicht erkennen, wohl jedoch, dass es sich dabei um eine Art Familienporträt handelte. Die Abgebildeten lächelten. Doch irgendwie behagte Marcus dieses Lächeln nicht. Neben dem Schrank stand eine Kommode mit einem alten silberfarbenen Radio darauf. Daneben lehnte an einer Vase mit welken Blumen ein gesticktes Heiligenbild. Marcus tippte auf den heiligen Hieronymus, was allerdings genauso korrekt wie falsch sein konnte. Es war Jahre her, dass er sich mit Religion befasst hatte.
Auf der anderen Seite des Raums befanden sich ein Tisch, eine Eckbank und zwei klapperdürre Stühle, allesamt aus Holz. Alles arrangiert unter dem gelblichen Licht einer schwachen Deckenleuchte, die es nicht annähernd schaffte, die dunklen Bodendielen aufzuhellen. Darüber hinaus entdeckte Marcus etwas, was ihn verwunderte. Auf dem Tisch standen zwei Teller, jeweils einer zu jedem Stuhl.
»Leben Sie allein?« Marcus versuchte, nicht zu neugierig zu klingen.
»Ja«, antwortete der Landwirt, der inzwischen in einem Sessel neben dem Radio Platz genommen hatte und mit einem Messer mit abgenutztem Holzgriff Walnüsse öffnete. Die Nussschalen knackten dabei wie unter Druck zerberstende Knochen. In der Stille des Augenblicks wirkte dieses Geräusch unbehaglich auf Marcus. Und wieder fiel ihm der steinerne Ausdruck auf dem Gesicht des Mannes auf. Er ließ Marcus nicht aus den Augen.
»Deck immer für zwei. Alte Angewohnheiten kann man sich nur schwer abgewöhn’n.«
Der Alte maß Marcus mit einem Blick, der ihm überhaupt nicht gefiel. Es war einer von der Art, wie man ein Schwein ansah, um zu überprüfen, ob es reif für die Schlachtung war. Dabei fuhr er sich erneut mit der Zungenspitze unter der Oberlippe über die Zähne. Wohl auch eine dieser alten Angewohnheiten.
»Hunger?«, fragte er.
Marcus nickte. »Einen Bärenhunger.« Er konnte sein Glück kaum fassen. Zwar war der Mann nicht der Gesprächigste und hatte offenkundig allerlei Eigenarten, doch trotz der Einöde und des einsamen Lebens auf dem Hof schien sein Sinn für Hilfsbereitschaft und Zuvorkommenheit nicht gelitten zu haben.
Der Landwirt stand auf und verschwand hinter einer Raumecke. Töpfe und Geschirr klapperten. Marcus fragte sich, ob er ihm womöglich etwas von dem brachte, was er riechen konnte. Fleisch in Soße, vermutete er. Es duftete köstlich.
Er hätte sich auch mit einem schlichten Brot zufriedengegeben. Seine Mutter hatte ihm als Kind stets eingebläut, man schaue einem geschenkten Gaul nicht hinter die Kiemen. Bei dieser Erinnerung schmunzelte er in sich hinein. Er dachte daran, wie er mit dem Einwand reagiert hatte, dass ein Pferd doch gar keine Kiemen habe, woraufhin sie ihm mit dem Finger gegen die Nase stupste. »Genau das ist ja der Witz dabei.«
Es hatte Jahre gedauert, bis er den Witz verstanden hatte.
Und dieser Mann wird ihn wahrscheinlich auch nicht verstehen. Jedenfalls macht er nicht den Eindruck auf mich.
»Am Ofen oder am Tisch?« Der Landwirt stand mit einem dampfenden Teller im Raum.
»Äh, am Tisch bitte. Hier wird es mir allmählich zu heiß.«
»Is’n guter Ofen, der verarscht einen nichʼ«, sagte er in einem Ton, der an Gleichgültigkeit grenzte. Es hätte ein Witz sein können, nur glaubte Marcus das nicht. Der Mann kam ihm zu ernst vor, um Witze zu reißen.
Er nahm auf der Eckbank Platz und kam sich mehr denn je vor wie der kleine Junge, der Mama danach fragte, wie viel Uhr es wäre und wann es Zeit sei, ins Bett zu gehen, und ob sie ihm denn noch eine Geschichte vorlesen könne. Das lag nicht allein daran, dass er sich auf der Eckbank klein fühlte, sondern an dem Mahl, das der Landwirt ihm vorsetzte. Gulasch. Eine Lieblingsspeise seiner Mutter, die im Hause Nolte als fast wöchentliche Mahlzeit serviert worden war.
Es roch gut, sogar richtig gut. Nur der Anblick ließ Marcus ein wenig davor zurückschrecken. Es sah aus wie schon mal gegessen. Der Alte musste das Fleisch in Brocken geschnitten und so lange gekocht haben, bis es komplett in seine Fasern zerfallen war. Die Soße hatte keine braune, sondern eine gräuliche Färbung. Dicke Fettblasen schwammen an ihrer Oberfläche. Und wäre das dem Appetitkiller nicht genug, setzte sich der Landwirt ihm auch noch genau gegenüber.
»Is’n gutes Fleisch. Eigene Züchtung«, sagte er und bleckte dabei die Zähne.
»Danke … Für die Einladung, meine ich.« Marcus hoffte, er klang ehrlich genug, den Mann zu überzeugen. Natürlich war er dankbar, gleichzeitig wünschte er sich, der Alte hätte ihm doch besser eine Scheibe Brot mit Margarine oder Butter angeboten. Das Zeug auf seinem Teller sah scheußlich aus.
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht hinter die Kiemen, rezitierte er in Gedanken und lud den Löffel, den der Landwirt ihm als einziges Utensil zur Verfügung gestellt hatte.
Der zerfledderte Fleischbrocken wirkte auf ihn weder wie Rind noch Schwein. Die Färbung ähnelte eher dem Fleisch einer Pute. Allerdings war es dafür zu faserig. Er stellte zudem fest, dass der Geruch jetzt weniger verführerisch auf ihn wirkte. Ganz im Gegenteil. Er war herb und undefinierbar wie auch der Rest. Einzig die verkochten Paprikastreifen, die wie rote Würmer knapp unter der Oberfläche trieben, waren klar erkennbar.
Er zögerte. Er konnte nicht anders. Dabei hob er unwillkürlich den Blick und stellte fest, dass die Mimik dieses Mannes doch nicht ausschließlich steinern war. In seinem Mundwinkel, glaubte Marcus, verbarg sich ein Lächeln.
»Essen Se ruhig, essen Se ruhig«, forderte er ihn auf, was Marcus wieder an seine Mutter erinnerte. Und an seinen leeren Magen. Wie viele Stunden hatte er nichts mehr gegessen?
Du zögerst, weil es furchtbar aussieht. Aber hättest du ein Gulasch besser hinbekommen?
Das hätte er. Wenn Marcus irgendetwas konnte, dann war es kochen. Er hatte es nicht von seiner Mutter oder seinem Vater erlernt, er hatte es sich selbst beigebracht. Aus der Not heraus. Früher kellnerte seine Mutter in einem Hotelrestaurant, meist von früh bis spät. In der restlichen Zeit schlief sie oder kümmerte sich um den Haushalt. Einen Mann an ihrer Seite gab es nicht. Edgar Nolte – Marcus erinnerte sich kaum an ihn – hatte seiner Frau Noemi den Schnaps leer getrunken, ihr ein Baby gemacht und verduftete eines Abends. Das alte Ich-gehe-Zigaretten-holen-Spiel. Zehn Jahre später erhielt sie einen Anruf. Edgar war gestorben, betrunken am Steuer verunglückt. Zu seinem Glück – oder dem eines anderen – hatte er niemanden mit in den Tod gerissen.
Das alles führte dazu, dass Marcus viel allein gewesen war. Er trieb sich überall herum und lernte rasch, sich selbst zu versorgen. Zu Anfang mit Sandwiches, danach folgten Gerichte wie Pizza oder Spaghetti mit Pesto. Was ein junger Bursche mit elf oder zwölf Jahren sich eben so zutraute. Sah man ihn heute an – die Totenkopf- und Knasttätowierungen auf dem ganzen Oberkörper, die schon in seiner Jugend antrainierten Muskeln –, würde man es ihm kaum zutrauen. Doch das weitestgehend unbehütete Leben hatte ihn nicht bloß zu Kochbüchern, sondern auch in die Welt der Romane und Sachbücher geführt. Die Schulbibliothek wurde quasi zu seinem zweiten Zuhause. Dort verbrachte er Stunden über Stunden. Bis David in sein Leben trat und der gemächlich dahinsiechende Fluss, auf dem er entlangschipperte, irgendwie zu einem Sturzbach wurde.
Sein knurrender Magen riss ihn wieder in die Gegenwart zurück. Marcus betrachtete erneut den zerfledderten Fleischbrocken. Dann gab er sich einen Ruck.
Es schmeckte gut. Tausendmal besser, als es aussah.
Mit einem Mal löffelte Marcus mit einer Inbrunst, die an Manie grenzte. In seinem Bauch rebellierte es, aber darauf achtete er nicht. Er aß. Und aß. Und aß. Und stoppte erst, als der Löffel einen irrationalen Salto aus seiner Hand auf den Tisch machte. Es klapperte, als er aufschlug. Soße spritzte in feinen Tropfen umher. Doch Marcus registrierte es nicht. Nicht einmal die Nachfrage des Alten, ob alles in Ordnung sei, nahm er richtig wahr. Denn die Stimme des Landwirts kam plötzlich nicht mehr von der gegenüberliegenden Seite des Tisches, sie drang aus weiter Ferne zu ihm. Wie ein Echo in einem geschlossenen Raum. Irgendetwas stimmte nicht.
»Was zur …«
Seine Zunge fühlte sich mit einem Mal schwer an. Seine Lippen, egal wie sehr er sich bemühte, wollten sich nicht weiter als einen Fingerbreit öffnen. Panik stieg in ihm auf. Eine Allergie. Daran dachte er zuerst. In seinen ganzen achtunddreißig Jahren hatte er nie unter einer Allergie gelitten. Nun strahlte dieser Gedanke die ihm einzig begreifliche Logik aus. Er musste wieder an seine Mama denken. Und an Bienen. Und an Mama, die von einer Biene gestochen wurde und blau anlief und zusammenbrach und …
»Hilfe«, krächzte Marcus. Doch in seinen Ohren hallte nur ein heiseres Keuchen wider.
Unwillkürlich schloss und öffnete er die Augen, hoffte, so wieder Herr seiner Sinne zu werden. Doch Schwindel überkam ihn, so plötzlich, dass er ihn nicht kommen sah.
Im nächsten Augenblick landete sein Kopf wuchtig auf der Tischplatte. Die Teller schepperten. Wieder versuchte er um Hilfe zu schreien. Doch seiner Kehle entrann nur noch ein tonloses »Hrch … Hrch«.
Hinter dem Schleier seiner verworrenen Wahrnehmung erkannte er noch den Landwirt, der aufstand und begann, in Seelenruhe den Tisch abzuräumen.
9
Marcus schreckte aus diesem Albtraum auf, als hätte man ihm eiskaltes Wasser über den Kopf geschüttet. Und tatsächlich liefen ihm Tropfen über Glatze und Gesicht. Schweißperlen, die von der Hitze seiner Angst herrührten.
Er fühlte sich schwach und mit jeder Minute, die verstrich, baute er weiter ab. Sein Zeitgefühl hatte er vollkommen verloren. Die Neonstrahler an der Decke brannten durchgehend, und da es keine Fenster gab, durch die er den Stand der Sonne oder des Mondes hätte bestimmen können, fehlte ihm jede Orientierung.
O Gott, wie lange saß er nun schon hier drinnen gefangen? Drei Stunden? Dreißig? Drei Tage?
Drei Tage konnten es nicht sein. Er wäre vor Dehydrierung zusammengebrochen. Nein, es waren weniger. Eventuell sogar wesentlich weniger. Aber wer wusste das schon, außer Gal, diesem Drecksack.
Nun, auch der Zugführer musste es wissen; der Zugführer, der ihn hatte weglaufen sehen, denn das hatte er ganz sicher, oder nicht? Doch! Das musste er. Denn wenn er es nicht hatte, dann gäbe es niemanden, der ihn in den letzten Tagen zu Gesicht bekommen hatte und ihn (mit Ausnahme von Tina – hoffentlich!) vermissen würde. Somit würde ihn auch niemand suchen. Es sei denn …
Es sei denn, der Zugführer hat dich tatsächlich entdeckt. Und nachdem er David entdeckte (das, was von David übrig war), hat er ganz sicher die Polizei informiert.
Marcus stellte sich vor, wie der Mann mit der Schirmmütze und dem kreidebleichen Gesicht vor einem Polizeibeamten stand und sagte: »Ja, da war jemand. Ist Richtung Süden gerannt, als wäre der Teufel hinter ihm her. Sie müssen nur seine Spuren im Schnee verfolgen, dann finden Sie diesen Hundesohn! Er hat sicher was hiermit zu tun. Wenn auch nicht Täter, ist er wenigstens ein Zeuge, richtig?«
Richtig, antwortete Marcus der Stimme in seinem Kopf. Genau so würde es laufen.
Tatsächlich? Nein. Auf gar keinen Fall. Das war Wunschdenken, nichts weiter. Die Polizei würde sich zwar vielleicht nach Marcus erkundigen, doch nur, weil viele wussten, dass er und David seit Kindheitstagen so gute Freunde gewesen waren, dass sie sich sogar gemeinsam über Nacht eine Zelle geteilt hatten, und nicht, weil der Zugführer ihn identifiziert hätte. Bestimmt nicht. Und selbst wenn die Polizei bei der Tatortinspektion auf die Idee gekommen sein sollte, den Fußspuren im Schnee nachzugehen, so hätten sie doch verdammt schnell handeln müssen. Denn der Wind wartete nicht, den Schnee zu verwehen und alle Spuren unkenntlich zu machen. Außerdem …
Außerdem ist niemand außer mir hier gewesen.
Dieser Gedanke beinhaltete eine solch eindringliche Einsamkeit, dass Marcus in Tränen ausbrach. Sie liefen seine Wangen hinab. Er hielt sie dabei nicht auf. Wozu auch? Es gab niemanden, der sich über ihn lustig machen konnte. Hier drinnen gab es nur ihn und niemanden sonst. Niemanden.
Er fragte sich, ob womöglich die Nacht hereingebrochen war. Es fühlte sich so an. Als würde der Mond selbst durch das Licht der Neonröhren einen Gruß in seine Zelle schicken. Der Mann im Mond, dachte er unbestimmt. Und diesem Gedanken folgte ein weiterer. An Tina; Tina, die in ihrem Bettchen lag und mit einem Lächeln auf den Lippen schlief; Tina, die im Garten auf der Schaukel saß und immer höher (»Bis zum Himmel, Papa!«) geschaukelt werden wollte; Tina, die Froot Loops zum Frühstück mampfte, sich einen der Ringe über den kleinen Finger steckte und sagte: »Jetzt bin ich deine Frau, Papa«. Oder Tina, die vielleicht doch nur schlief.
Hier drinnen, dachte Marcus, gab es nur eine Zeit – die Zeit des ewigen Lichts, die schwärzer war als jede Dunkelheit im All. Hier in diesem Raum gab es Wiesenheuduft und keine Luft zum Atmen. Hier drinnen gab es Leben, und doch fühlte er sich bereits wie tot.
Die Tränen liefen und liefen. Wie die Zeit.
»Das ist nicht fair!«, schrie er plötzlich. Verzweifelt riss er an den Gitterstäben. »Das ist nicht fair! Das ist kein bisschen fair! Ich habe nie jemandem ein Leid zugefügt. Klar, ich war nicht der beste Vater, und natürlich hätte ich mich noch mehr um einen Job bemühen können – von den Drogen wegzukommen, ganz zu schweigen –, aber was ich auch getan habe, ich bin hier zu Unrecht!« Weitere Tränen schossen aus seinen Augen. Jetzt waren es Tränen der Rage. Er umfasste die Metallstäbe noch fester. Mehrere seiner Gelenke knackten, was sich anhörte wie kleine Aufschreie. Komm zur Vernunft!
»Hörst du mich, du Drecksack? Ich bin mir sicher, dass du mich hörst. Du hast kein Recht, mich hier einzusperren. Du hast kein Recht, das hier mit mir anzustellen! Ich schwöre dir, wenn ich hier rauskomme, mache ich dich fertig! Ich reiß dir deine scheißgrünen Augen aus dem Schädel, du … DU …«
»Du was?«
Die Stimme tauchte so plötzlich und unvermittelt auf, dass Marcus zusammenfuhr. Eddie Gal klang ganz ruhig, unbeeindruckt, gleichgültig. Er drehte eine Runde um den Käfig und blickte Marcus dabei direkt in die Augen. Ein sonderbarer Moment. Denn Gals Ausdruck hatte sich vollkommen verändert. Als hätte er eine Art Weiterentwicklung vollzogen, sah Gal nun nicht mehr aus, als fehlten ihm mehrere Tassen im Schrank. Den Wahnsinn in seinem Blick konnte man ihm zwar definitiv nicht absprechen, jedoch wirkte es, als sei er in den Hintergrund gerückt, um etwas Neuem Platz zu machen. Und dieses Neue bereitete Marcus noch weitaus größeres Unbehagen. Denn er hatte das Gefühl, unter dem Grinsen auf Gals Lippen lauerte die Wachheit einer Raubkatze mit der Gier nach frischem Fleisch.
»Ich … Ich …« Marcus’ Wut brach in sich zusammen. Er erinnerte sich plötzlich an seinen Durst und an seinen Hunger und daran, wie abhängig er von diesem Mann war.
»Ja. Nur zu«, forderte Gal.
»Es ist … Ich wollte …«