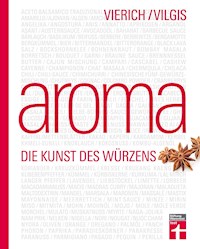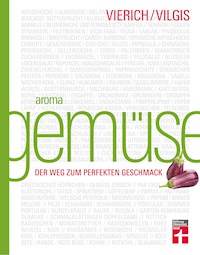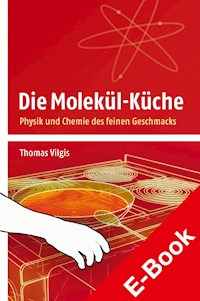Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wie kommt es, dass Rosmarinkartoffeln aus dem Schnellkochtopf besonders aromatisch schmecken? Und wozu kann ein Bunsenbrenner oder ein Sahnebläser in der Küche nützlich sein? Thomas Vilgis, Genussforscher und Physiker am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz, geht in der Küche auf Entdeckungsreisen und zeigt uns in seinen persönlichen Aufzeichnungen faszinierende Hintergründe des Kochens. Dabei entstehen ebenso ausgefallene wie köstliche Rezepte, wie z. B. eine Remoulade mit Kapern und Essiggurken, Forellenfilets in Rhabarber oder die perfekten Spätzle. Noch nie waren seine Erkenntnisse so greifbar und gut verständlich, denn leicht erzählend lässt er uns Teil haben an seinen Experimenten, die manchmal ganz simpel, manchmal etwas komplizierter, aber immer clever und raffiniert sind. Von seinen sympathischen Ausführungen kann man gar nicht genug bekommen! Ein literarisches Kochbuch mit wunderschönen Bildern und beeindruckenden Küchenphänomenen. Toll zum Schmökern – und natürlich zum Nachkochen der Rezepte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gas·tro·naut,Substantiv [der]jmd., der die Küchenphänomene unserer Welt mit physikalischem Hintergrundwissen und einer großen Portion Entdeckergeist erkundet. Hantiert für gewöhnlich ohne Einkaufszettel, orientiert sich an saisonalem Angebot. Kreiert Rezepte von A–Z im Kopf. Sieht vor geistigem Auge die wichtigsten Moleküle der Zubereitung, wie sie denaturieren, thermisch zappeln, Wasser binden, mit Salzen und Geschmacksstoffen wechselwirken, grenzflächenaktiv sind, emulgieren und Aromaverbindungen festhalten. Verschiebt dabei zusehends die Grenzen des bereits erschlossenen Küchenuniversums.
THOMAS A. VILGIS
Der Gastronaut
Erkundungeneines kochendenPhysikers
When I grow up, I want to be a Gastronaut, but if I can’t be a Gastronaut, I think I’ll be a physicist, a scientist.
Inhalt
Vorwort
Es gibt Leben hier drinnen! Mikrobakterielle Metamorphosen
Tokyo trifft Mainz, Koji trifft KartoffelPfälzer Kartoffelmiso · Gemüsesalat mit Pulpo
My personal kimchiKimchi mit Birke
RohmilchgeschichtenCremiges Rohmilchcamemberteis
Sanft beschwipstes GemüseSelleriewein
Ein MisoscherzelSchulterscherzel, löffelzart
Trinkjoghurt (»probiotisch«), Marke EigenbauRohmilchjoghurt · Bananen-Mango-Eis
Salzzitronen, Salzorangen, Salzgrapefruit? Alles geht!Salzzitrusfrüchte · Semisüße Johannisbeertartelette
Reise durch die fünf Geschmackskontinente nebst reizenden Abstechern
Auf Salz gegartJakobsmuscheln an Sauce Corail
Brot ohne Salz? »Pane sciapo«Salzfreies Brot mit Malz- oder Glutenzusatz
Fest, knackig und sauerLachsforelle mit rohem Rhabarber
Die RhabarberschwemmeRhabarbersaft und -püree · Essigfreier Knacksalat · Rhabarberpüree an Schwein süßsauer
Zu später TeestundeGans in Tee
Die Walnuss: knackig und bitterRotkohl mit Doppelknack
Die Umami-SpezialbeizeLammnieren mit Olivenkartoffelgratin
Dessert umami-süßUmami-Pannacotta · Kalter Kaffee mit Schuss
Unverhofft süß – Kürbis zum NachtischHokkaidocreme mit eingelegten Trockenfrüchten und glasierten Walnüssen
Pfeffer: eine scharfe GeschichteWinterobstsalat mit fünf Pfeffern
Some like it hot»Heißes« Tomateneis
Es knackt, kracht, schäumt und prickelt – überraschende Texturexperimente
Schuppen auf die Fische!Rote Knusperbarben mit Olivenpüree
Ölschäume – leichte Fluffies zu vielen GelegenheitenReiner Haselnussschaum · Sojamilchbasierter Olivenölschaum
Fettig, cremig, schmelzend – die perfekte RemouladeRemoulade nach Physikerart · Panierte Fischzylinder
Vom Mohrenkopfwecken zum SchokokussbrötchenSchokokusswecken · Eierlikörbomben
Spinat, knackig und garSpinat, Spinat, Spinat
Prickelnde Gurken: Tricks aus dem SahnebläserSaure Sektgurke
Ketchup aus PhysikersichtTomatenketchup roh, gekocht, floral
Die Kunst inverser EmulsionenSchwein auf Zwiebelradieschen mit Honig-Öl-Emulsion
Burger(ge)schichtenWinterburger mit Ente und Kürbis
Bier auf Wein, das ist feinWeingummi unter Sabayon de bière
Eine kleine KartoffelpüreephilosophieSpätzle-Kartoffelwürstle · Robuchons Klassiker · Purée de pommes de terre comme à Marseille
Quer oder längs zur Faser? Eine praktische StudieRinderzwerchfell, kurz gebraten · Skirtsteak, blitzgeschmort mit schwäbischem Kartoffelsalat
Fehler, Zufallsentdeckungen und andere Abwege
Kurkuma – kräftig gelb mit viel AromaKurkumaeis · Superobstsalat
Noch haltbar? Mut zu kruder KulinarikAntichi Antipasti
Getrocknete Zitrusfrüchte: Würzanlage für die KücheLeichter Fisch auf Pale-Ale-Kraut
Blanchieren, bester Schutz vor grauen SommernGrüne Gartentaschen
Was tun mit Korkwein?»Oxidierte« Sauce
Ein griechischer ScherzkeksXanthan und Xanthippe
Französisches StudentenfutterTartelette de Roquefort à l’alimentation salée des étudiants
Alle Jahreszeiten wieder
Bärlauch, der erste FrühlingsstarBärlauchöl · Käsegang mit Ziegenfrischkäse und Camembert
Radieschen – von der Wurzel bis zum Blatt»Rahmspinat« aus Radieschenblättern mit Spargel
Waldmeister oder warum ich im Mai an Weihnachten denkeWaldmeisterhähnchen auf Spargel
Erdbeeren am GastronautenhimmelEingeölter Beerensalat
Einkochen mit BelohnungTomatencoulis · Tomatenbonbon
Gemüsearoma 4.0Erbsenessenz · Zucchini, in Essenz gegart
Sommergrünes XälzFenchelxälz
Unterschätztes WurzelwunderSchwarzwurzelragout
Wild aus dem WaldWildschweinkeule
Glühwein, heiß und festGlühweinwürfel mit Orange
Gans saftig aus dem OfenGeflämmte Niedrigtemperaturgans: Brust und Keule
Fastnachtskrapfen – alle Jahre wieder neuSalzige Bierkreppel
Cooking, fast and slow
Homemade ConvenienceKichererbsen · Kichererbsensalat
Mikrowelle, nützlicher als gedachtNussige After-Work-Ofenkartoffeln
Schnelle Reste, schöne RingeResteverwertung mit Purple Rain
Früchtchen unter DampfZwetschgenkonfitüre im Schnellkochtopf
Kokumi und umami par excellenceHühnerbrühe · Rettichsuppe
Der Hype um die BrüheKnochenbrühe in Reinkultur · Kaffee mit Knochenbrühe
Tatar und Dry AgingTatar mit Rauchsardellen
Fleischreifung im RindertalgmantelSteak nebst verdünntem Whisky
Aufgewärmte GeschichtenSpitzkohl mit roten Linsen, grünem Speck und Vanille
Bequem und lang im Ofen garenGeschmorte Ochsenbacken
Lange Zungen – edle TeileWeinsaures Züngerl (ungepökelte Version) · Extra getimter Tafelzungenspitz
Vom Räuchern und Rösten
Der Glanz alter PfannenWürstchen mit Sud
Fisch aus dem RäuchertopfDorsch, geräuchert
Fischleber aus dem SmokerGeräucherte Seeteufelleber · Meeressalat
Roux – eine RehabilitierungDer Klassiker: Linsen mit Saitenwürschtle
Großmutters Trick mit der stark gebräunten ZwiebelKabeljau mit Universalzwiebel
Röstaromen allen Ursprungs vereinigt euch!Geflämmter Sellerie · Bratlinge mit Bierquark
Temperaturkontrollierte FaserseparationPulled Pork
Feuer bei die FischeMakrele à la crème
Kartoffelpüree mit versteckten RöstaromenErdig-röstiger Kartoffelstampf, milchsauer abgeschmeckt
Pfannen einbrennen: der Trick mit dem niedrigen RauchpunktFleischige Aubergine
Aus weiter Ferne und ganz nah
Wiesenkraut LöwenzahnForelle mit Löwenzahn
Indischer Bratkäse, selbst gemacht Paneer · Junges Gemüse mit Käsewürfeln
Spätzle mit Soß’Kocherursprungsspätzle mit Speck und Gorgonzola
BaschdaschuddahPasta dopo Tomasso
Foie gras: verboten, verhasst, verschmaustGänseleberschmelz
Avocado gras – die (nicht ganz) grüne AlternativeFakestopfleber mit Portweinzwiebeln
Handkäse mit MusikLauch mit getrocknetem Handkäse
Bouillabaisse – geschüttet, nicht gerührtÜberbrühte Fische
Kleine Stärkewunder: von Thüringer Klößen bis zu Hoorische KneppKlöße schwäbisch-thüringischer Art
Katalonischer Genuss oder Lob der EinfachheitPa amb tomàquet, la versió més senzilla
Rapunzel auf ReisenFeldsalat mit Orange, Datteln, Sauerkraut und Kokos
Register
Stichwortregister
Rezeptregister
Vorwort
Seit Jahrzehnten bin ich als Gastronaut im kulinarischen Universum unterwegs, von den ersten Schritten in der »Koch-AG, auch für Buben« über meine berufliche Spezialisierung auf dem Gebiet der Lebensmittelmolekularphysik bis hin zu Genussreisen in die Ferne und wieder zurück in die eigene Küche. Dieses Buch ist eine Art Logbuch meiner jüngeren Expeditionen. Notizen dafür entstanden im Laufe der letzten zwei, drei Jahre – bei neugierigen Experimenten im Labor und im häuslichen Küchenkeller, auf Reisen oder bei der Zubereitung meines Abendessens.
Ich koche täglich einfache Gerichte, um bei maximalem Genuss satt zu werden. Nicht abgehoben mit Hummer oder Nachtigallenzungen, sondern mit den saisonalen Produkten des Wochenmarkts, des Gartens, der Bäume und Sträucher, der Weiden und Ställe. Meist ganz altmodisch, wie es seit Jahrhunderten üblich ist. Mit Feuer, Topf und Pfanne oder alten Kochlöffeln. Bisweilen unterstützt von älterem Gerät wie Mikrowelle und Spätzlepresse – oder neuerem wie Lötlampe und Kammervakuumierer. Und oft einfach mit dem, was gerade im Kühl- oder Vorratsschrank zu finden ist: Nüsse, getrocknete Hülsenfrüchte, eine Handvoll Getreide oder Mehl. Ein kleiner Sellerie, eine Karotte, etwas Buchweizen und 1–2 Esslöffel Joghurt bergen schon ein hochdimensionales kulinarisches Potenzial. Auch oft verschmähte Lebensmittel kommen bei mir auf den Tisch: Innereien, Fischschuppen, Garnelenköpfe, lasches Gemüse, Blätter, Stiele, madiger Käse oder angedätschtes, leicht bräunliches Obst mit seinen wunderbar fruchtigen Aromen sind für mich persönlich kein Tabu. Im Gegenteil: Es reizt mich, das Letzte aus allen Lebensmitteln herauszuholen und Köstliches daraus zu zaubern. Denn es ist viel mehr essbar (und köstlich!), als manch einer denkt.
Ich bin bekennender Allesfresser. Das Einzige, was bei mir nicht auf den Tisch kommt, ist Convenience-Food. Eine Fertigpizza, egal ob aus dem (Bio)Supermarkt oder vom Lieferservice, wirkt auf mich nulldimensional. Ich lasse mich viel lieber von meinem eigenen Geschmack, den physikalischen, chemischen und sensorischen Eigenschaften der Lebensmittel und den wissenschaftlichen Grundlagen des Kochens treiben. In meiner wöchentlichen Radiokolumne »Gastro Jet«, die seit 2016 am Samstagnachmittag im SWR2 läuft, habe ich bereits regelmäßig die Esskultur aus physikalischer Perspektive betrachtet und zu jedem Thema ein Rezept notiert, das durch meine persönliche, naturwissenschaftliche und hin und wieder krakelige Handschrift geprägt ist. Dieses Material war die Grundlage für dieses Buch.
Inspirieren lasse ich mich außerdem gern auf Reisen. Die lokalen Märkte in fremden Städten, Regionen und Ländern sind für mich die spannendsten Erkundungen. So stehen immer, wenn es geht, authentische Gasthäuser und die ansässige Spitzengastronomie auf dem Programm, denn gemäß meiner Theorie lässt sich nur auf diese Weise die Kultur einer Stadt, einer Region, eines Landes erfahren. In pulsierenden Hafenspelunken, Apérobars oder Bistros, in die sich kaum ein Ortsfremder hineintraut, weil es laut und rau zugeht, ist weit mehr über die Menschen zu erfahren als in sterilen Museen. In Cafés, Gasthäusern und auf Märkten sauge ich wie ein schwarzes Loch alles auf, was sich im Riech-, Hör- und Sichtradius befindet und verschiebe dadurch stetig die Grenzen meines kulinarischen Horizonts.
Die Rezepte, die ich für dieses Buch zusammengestellt habe, sind, wie es sich für einen frei schweifenden Gastronauten gehört, nichts weiter als Ideen. Sie dürfen keineswegs mit religiösem Eifer grammgenau nachgekocht werden. Ich bin kein Rezeptentwickler, geschweige denn Koch, und so sind auch die Rezeptfotos mehr als Serviervorschläge zu verstehen, von denen Sie getrost abweichen können, wenn es Ihnen beliebt. Die meisten Gerichte sind einfache Teller und eignen sich kaum als Aufnahmegesuche in die Clubs der kochenden Männer. Aber sie haben mir ein Aha-Erlebnis beschert und stillten meinen Hunger, nicht nur im Magen, sondern auch in Hippocampus und Amygdala. So alltäglich die verwendeten Produkte auch erscheinen mögen: Lassen Sie sich überraschen, zum Beispiel von den röstigen Tiefen einer Sellerieknolle oder den diversen Nanopartikeln der Rohmilch. Und zum Schluss wird Ihnen selbst das Innere eines Soufflés genauso wenig mehr ein Geheimnis sein wie die Temperatur der fortwährend sterbenden Sonne.
Das kulinarische All ist vermutlich endlich, aber die Lebenserwartung eines Menschen erscheint mir zu kurz, um an die Grenzen dieses Universums vorzustoßen. Meine Aufzeichnungen sind als Einladung zu verstehen, kreativitätshemmende Dos and Don’ts und jedwede Bequemlichkeit hinter sich zu lassen und sich auf eigene Entdeckungsreise zu begeben – mit allen Sinnen durch Geschmackskontinente und Texturdimensionen, auf Um- und Abwege, hinein in die Welt der Bakterien und hinaus in die Regionalküchen der Welt.
Viel Vergnügen!
Thomas A. Vilgis, Gastronaut
Es gibt Leben hier drinnen! Mikrobakterielle Metamorphosen
Tokyo trifft Mainz, Koji trifft Kartoffel
My personal kimchi
Rohmilchgeschichten
Sanft beschwipstes Gemüse
Ein Misoscherzel
Trinkjoghurt (»probiotisch«), Marke Eigenbau
Salzzitronen, Salzorangen, Salzgrapefruit? Alles geht!
Tokyo trifft Mainz, Koji trifft Kartoffel
Wer weiß, was im Inneren der Lebensmittel passiert, kann schon mal auf »abwegige« Gedanken kommen – im positiven Sinne natürlich. So ging es mir vor einigen Jahren mit dem erstmaligen bewussten Erwerb von nicht pasteurisierter, original japanischer Misopaste in einem Biomarkt. Nicht pasteurisiert – da stellt mancher sich Schlimmes vor: In dem Behälter wuselt es gewaltig und gleich krabbeln kleine Tiere heraus. Das ist natürlich Unsinn, aber nicht pasteurisiert bedeutet tatsächlich: Es gibt Leben da drinnen!
Im Zentrum steht hier ein spezieller Pilz, der Koji-Pilz (Aspergillus flavus var. oryzae). In Japan spielt er die Hauptrolle bei allen Fermentationen, von Miso über Mirin bis hin zu Sake. Der Koji-Pilz wächst auf gedämpftem Reis als »Substrat« und produziert dabei Enzyme, die Proteine, Stärke und Fett »zerlegen« können. Diese Enzyme heißen Proteasen, Lipasen und Amylasen, sie sind nach den Namen der Verbindungen benannt, die sie bearbeiten: Proteasen zerschneiden Proteine, Lipasen Lipide und so weiter.
Wird diese hochaktive Misopaste nun einem Lebensmittel zugegeben, dessen Bestandteile den Enzymen zur Verfügung stehen, gehen diese unverzüglich ans Werk. Alles, was Proteine, Stärke oder Fett enthält, lässt sich auf diese Weise fermentieren. Warum also nicht einmal mit gedämpften oder gekochten Kartoffeln experimentieren? Unter der hohen Temperatur quillt die harte native Stärke der Kartoffeln auf, wird weich und ist damit zugängliches Futter für Amylasen. Diese produzieren dann beim Zerschneiden der Stärke Zucker (Glukose), die wiederum Aromen bilden und gleichzeitig eine Milchsäuregärung in Gang setzen, die den pH-Wert kontinuierlich absenkt. Des Weiteren zerschneiden die Proteasen der Pilzsporen die Proteine (die Kartoffel enthält immerhin 12 %); dabei entstehen ein würziger umami-Geschmack und in Kombination mit den Zuckern sogar Maillardprodukte (Röstaromen).
Das funktioniert übrigens auch ohne Vakuumierer: Einfach die zerdrückten gekochten Kartoffeln mit der Misopaste in einen Zipbeutel geben, die Luft möglichst gut herausdrücken, verschließen und warmstellen. Der zu Beginn noch vorhandene Sauerstoff wird rasch »veratmet«, bevor die gewünschte Fermentation, ähnlich wie im Vakuum, eintritt.
Was die Theorie nahelegt, zeigt sich in der Praxis ganz deutlich: Geschmack und Aroma sind zeitabhängig: Anfangs (nach ein paar Tagen) dominiert eine würzige Süße aus dem Proteinabbau (umami) und der Stärkespaltung, bei der sich freie Glukosen und Stärkebruchstücke (Oligosaccharide) bilden (süß). Dazu kommt ein Hauch Säure aus der beginnenden Milchsäuregärung, bei der auch die aus dem Sauerkraut bekannten Aromen entstehen. Je länger die Fermentation dauert, desto stärker überwiegt die Aromabildung durch die Enzymschnitte: Umami-Geschmack und Säure dominieren, während die Zucker zuletzt vollständig zu Aromen umgebildet sind. Wichtig ist dabei die genaue Zuordnung der Aroma- und Geschmacksbildung. Die Milchsäuregärung bildet neben dem säuerlichen Geschmack Aromen, die an Kimchi, Sauerkraut oder gar Joghurt erinnern. Sie bleiben aber im Hintergrund, denn die nach und nach einsetzende enzymatische Maillardreaktion bildet aus der abgespaltenen Glukose und den vielen Aminosäuren Röstaromen, die dominieren. Für den Umami-Anteil im Geschmack ist die Glutaminsäure aus den Kartoffelproteinen (und dem Miso) verantwortlich: Sie bleibt übrig, da sie nur sehr verhalten an der Reaktion zu Bräunungsstoffen beteiligt ist. Nach 3–4 Monaten ist das Kartoffelmiso fein säuerlich, umami und sehr pastös, da das meiste des »Strukturpolymers« Stärke zu kleinen Zuckern gespalten wurde.
Wer verschiedene Stadien probieren möchte, schweißt am besten mehrere Portionen des identischen Ansatzes ein und kostet alle paar Tage davon. Das ist wahre Experimentalküche – vor allem auf der Zunge. Mein Lieblingsstadium war übrigens schon nach 4 Wochen erreicht.
Aber was fängt man mit dem Ergebnis an, außer neugierig davon zu kosten? Nun, so eine Kartoffelmiso-Würze ist tatsächlich vielfältig einsetzbar. Ich habe Folgendes probiert: Das junge, eher würzig-süßliche Kartoffelmiso passt hervorragend zu Hülsenfrüchten und dient in Gemüsesalaten als essigfreie Säure. Länger fermentierte Proben lassen sich ähnlich wie Miso als intensive, mundfüllende Umami-Würze verwenden, etwa in einer Pastasauce. (Keine Sorge, den kartoffeligen Charakter hat das Kartoffelmiso nicht mehr, einer Kombination mit Teigwaren steht nichts im Weg.)
Wer eine feine Zunge und eine noch feinere Nase hat, kann mit der Kartoffelsorte spielen. Die Unterschiede zwischen fest-, vorwiegend festoder mehligkochend drücken sich in mal mehr, mal weniger Protein aus. Weniger Protein bedeutet letztlich: weniger Aminosäuren im Verhältnis zur Glukose. Was sich nach molekularer Erbsenzählerei anhört, hat natürlich für die Aroma- und Geschmacksbildung relevante Auswirkungen: Mehlige Kartoffeln entwickeln weniger Umami-Geschmack, etwas mehr Säure und liefern einen Hauch mehr Karamelltöne als proteinreichere festkochende Exemplare. Zumindest in der Theorie.
GRUNDREZEPT:PFÄLZER KARTOFFELMISO
300 g Kartoffeln (es funktioniert mit jeder Sorte) – 4 g Salz1 TL Misopaste (nicht pasteurisiert, aus dem Bioladen)
Die Kartoffeln in der Schale dämpfen, bis sie gar sind. Pellen und abkühlen lassen. Mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken, Salz und die Misopaste zugeben, gründlich vermengen. Vakuumieren und für mindestens vier Wochen an einem warmen Ort bei 25 – 30 °C fermentieren lassen.
GEMÜSESALAT MIT PULPO
1 Schalotte – 1 EL durchgegartes Kartoffelmiso(etwa 4 Wochen fermentiert)1 EL sehr trockener Sherry – 400 g roh essbare Gemüse der Saison(z. B. Möhren, Rote Bete, Kohlrabi oder Selleriestangen)3 EL Sesamöl – 1 gegarter Tentakel eines Tintenfisches (Pulpo)(vom wohlsortierten Fischhändler)
Die Schalotte schälen und fein würfeln, mit dem Kartoffelmiso und dem Sherry vermengen. Die Gemüse putzen und fein hobeln bzw. sehr dünn schneiden und unter die Miso-Schalotten-Mischung heben. Ca. 15 Minuten ziehen lassen. Das Sesamöl unterheben. Den Pulpo in dünne Scheiben schneiden und kurz vor dem Servieren unter den Salat heben. Anrichten und als Vorspeise reichen.
My personal kimchi
Kimchi kommt immer mehr in Mode – klar, es klingt auch exotischer als das heimische Sauerkraut, sein nächster Verwandter in Europa. Die koreanische Spezialität kommt in ihrer Heimat zu jeder Tageszeit auf den Tisch, sogar zum Frühstück – im Unterschied zu unserem Sauerkraut, das traditionell meist mit wenig frühstückstauglichen Schweinshaxen, Speck, Würstchen und Bier daherkommt. Doch Kimchi klingt nicht nur exotisch, beschwingt und weniger deftig, es ist tatsächlich aromatisch interessanter und – wegen der weiteren Beigaben von Gemüse, Kräutern und Gewürzen – vielseitiger einsetzbar!
Im Unterschied zum Sauerkraut, das in Deutschland und im Elsass meist lediglich aus geschnittenem und gesticheltem Weißkohl und der entsprechenden Menge Salz besteht, finden im Kimchi neben Kohl noch ganz andere Zutaten Platz. Kimchirezepte gibt es daher unzählige, wobei allen als Grundzutat der Chinakohl gemein ist, der von seiner Textur her feiner und in seinem typisch schwefeligen Kohlduft zurückhaltender ist als der Weißkohl. Ansonsten kommt alles hinein, was fermentiert werden kann und einen Hauch Schwefelaroma mitbringt: Rettich, Radieschen und / oder deren Blätter, Navets (kleine Rübchen) und / oder deren Kraut, Knoblauch und dessen Grün (auch der knollenarme Schnittknoblauch) oder Lauchzwiebeln, nicht zu vergessen Senfkohl oder Senfkraut. Schwefelarme Zutaten können ebenfalls beigemischt werden, wie etwa Gurken oder getrocknetes Obst, dessen hoher Zuckergehalt der Fermentation gewaltig auf die Sprünge hilft. In manchen Rezepten finden sich Zutaten wie Salzfische, Fisch- oder Austernsaucen, die den Umami- Geschmack betonen. Als Gewürz dient oft Chili. Kimchis weisen daher in der Regel eine gewisse Schärfe auf. Perillablätter und Ingwer sind ebenso gern gesehen. Welch ein Aromasegen! Und ganz nebenbei auch sehr praktisch, denn die große Freiheit bei der Zutatenauswahl macht Kimchi selbst in unseren Breiten zu einem saisonal unabhängigen Gericht, das man also nicht nur zu jeder Tages-, sondern auch zu jeder Jahreszeit genießen kann.
Der Clou am Ganzen ist – neben den Zutaten – das Fermentieren. Dabei wandeln sich ständig vermehrende Laktobazillen, die sich auf den Händen und auf den Gemüsen unvermeidlich befinden, Zucker in Milchsäure um: So entsteht das typische Grundaromaspektrum, das in allen Variationen zu riechen ist. In manchen Rezepten gibt man dem Gemüse noch Zucker oder etwas mit Wasser angerührtes, aufgekochtes Mehl mit. Der Zucker ist, ebenso wie die hin und wieder zugegebenen Trockenfrüchte, ein gefundenes Fressen für die Laktobazillen, sie können dann sofort loslegen und müssen nicht erst in mühsamer Arbeit als Erstes die Pflanzenzucker aus den Zutaten holen. Mehl liefert wiederum glutamatreiches Protein (Gluten), das den Aminosäurengeschmack in Richtung umami drängt. Außerdem wird ein Teil der (durch das Kochen gequollenen) Stärke wieder zu Glukose gespalten, sodass der Gärprozess am Laufen bleibt. Verantwortlich für diese Spaltung sind übrigens Enzyme aus wilden Hefen, die vor der Gärung aus der Umgebung in das Kimchi gelangen und kräftig mithelfen.
Ich fermentiere, wie meist, unter Vakuum. Den ganzen Kladderadatsch mit Salz einschweißen und an einen Ort stellen, an dem die Temperatur bei etwa 30 °C liegt: im Winter auf die Fensterbank über der Heizung, im Sommer in die Sonne oder auch mal ein paar Tage in den Backofen mit eingeschalteter Beleuchtung (das ergibt etwa 30 °C) – vorausgesetzt, im Ofen wird in der Zeit nicht gebacken, Joghurt hergestellt (siehe Seite 38) oder geschmort. Das Fermentieren im Vakuum hat den Vorteil, dass die Fermentation vollkommen anaerob (ohne Sauerstoff) startet und Stinkkeime, Fäulnis oder Schimmel daher keine Chance haben. Die Beutel blähen sich wegen der Kohlendioxidproduktion bedrohlich auf, und falls jemand Angst vor deren »Explosion« hat, sollte er sie einfach in eine Schüssel legen. Wer jedoch nicht über eine ordentliche Kammervakuumiermaschine verfügt, der sei beruhigt: Ein großes Einmachglas mit Gummiring und Verschluss tut’s auch. Dann ab und zu mal den Kohlendioxiddampf bzw. Druck ablassen – und ansonsten in aller Ruhe abwarten, während fleißige Laktobazillen die Arbeit tun.
Übrigens wird dem Kimchi wegen der gestatteten Zutatenorgie allerhand zugetraut. Während Sauerkraut vor allem mit Vitamin C, Ballaststoffen und probiotischen Milchsäurebakterien glänzt, wartet Kimchi mit mehr freien Aminosäuren, Mineralstoffen, Eisen, β-Karotinen und dergleichen auf, die nach der Fermentation und der damit einhergehenden Enzymaktivität physiologisch leicht verfügbar sind. Zugleich werden weniger gut verträgliche Pflanzenabwehrstoffe abgebaut. Daher wurde Kimchi inzwischen zu Superfood erklärt. Dem schließe ich mich gern an und empfehle der stetig wachsenden Gemeinde der Superfoodgläubigen dreimal täglich 500 g Kimchi. Wenn Sie fest daran glauben, werden Sie ganz bestimmt 200 Jahre alt. Alle andern essen es einfach, weil es ihnen schmeckt und sie damit auf ihren Tellern zaubern können: morgens statt Trinkjoghurt einen Löffel Kimchisud mit einem Löffel Kimchi, mittags als »mini side dish« in Extraschälchen zu leichten Gerichten, abends zum Apéro mit ein paar gerösteten Kichererbsen und Nüssen sowie der ein oder anderen Jahrgangssardine zur Einstimmung ins Abendmenü, am besten mit einem Glas belgischen Sauerbiers (im Ernst!). Ich mag Kimchi gern zur gebeizten Lachsforelle oder gar zum saftig-fettigen Räucheraal (den ich vom Bremerhavener auf dem Mainzer Wochenmarkt bekomme) mit etwas roher Roter Bete. Das ist dann der ultimative Zusammenprall der Esskulturen auf der Zunge.
KIMCHI MIT BIRKE
1 kleiner Chinakohl (ca. 500 g) – 1 Bund Mizuna5 Birkenblätter (der außergewöhnlichen Terpene wegen)200 g Daikonrettich – ½ frische Chilischote3 Knoblauchzehen – 3 Frühlingszwiebeln1 Stück Ingwer (1 cm) – 2 EL Milchzucker (Laktose)2 EL koreanische Fischsauce – Salz
Alle Zutaten zur Bestimmung des notwendigen Salzgewichts auswiegen. 2 % Salz des Zutatengewichts abwiegen.
Den Chinakohl vierteln. Knoblauch und Rettich schälen und alle Gemüse und Gewürze schneiden: Kohl, Mizuna und Birkenblätter in Streifen, Daikonrettich und Knoblauch in Stifte, Frühlingszwiebeln samt Grün und die Chilischote in Ringe. Den Ingwer schälen und hacken.
Alle Zutaten mit dem Salz in ein sauberes (mit kochendem Wasser gespültes) Einweckglas geben und dicht zusammenpressen. Nach oben etwas Luft lassen. An einem warmen Ort mindestens 3–7 Tage fermentieren, immer wieder kontrollieren und etwas »Dampf« ablassen. Aromabildung braucht Zeit, daher verändert sich selbiges mit steigender Fermentationsdauer.
Übrigens: Den säuerlichen Sud, der sich bildet, nicht wegwerfen. Er eignet sich hervorragend a) zum Trinken, b) zum Marinieren und c) für exotische Vinaigrettes.
Das Officemesser: ein altes Modell aus der Provence von 1998, bis heute allzeit griffbereit.
Rohmilchgeschichten
Rohmilch ist ein altes Kulturgut, das praktisch in allen Teilen dieser Welt vom Aussterben bedroht ist. Problematisch sind die kuheigenen Bazillen, die nicht durch Erhitzen abgetötet werden wie bei pasteurisierter Milch. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt auf seiner Internetseite: »Rohmilch ist ein empfindliches Lebensmittel, das aufgrund seiner Gewinnung unmittelbar vom Tier im Stall nach einem Filtrationsschritt ohne weitere Verarbeitung (Pasteurisierung) mit krankmachenden Bakterien wie zum Beispiel Salmonellen, Campylobacter oder Enterohämorrhagische Escherichia Coli (Ehec) kontaminiert sein kann. Diese Keime können zum Teil schwere Erkrankungen auslösen.« Das ist vollkommen richtig und jeder muss sich bewusst sein, ob er dieses Risiko eingehen will – oder nicht. Ich gehe es manchmal ein. Es schmeckt mir einfach zu gut.
So folgt an dieser Stelle aus traurigem Anlass zunächst ein Nachruf auf meine Lieblings-Rohmilchproduzenten, die ihre Arbeit aufgrund dieser Hygienevorschriften einstellen mussten: ein kleiner Bauernhof in der Nähe von Straßburg, der als Kooperative von enthusiastischen Bauern betrieben wurde, welche den Beruf Landwirt über den zweiten Bildungsweg oder autodidaktisch erlernt hatten. Die Milch war eine Offenbarung: cremige Trinksahne, direkt von der Kuh. Kein Wunder, die Erzeugerinnen gehörten zur Rasse Montbéliard, standen auf den Bergen der Vogesen und fraßen Gras, schauten ins Rheintal, hinüber in den Schwarzwald bis nach Basel und sahen, dass es gut war. Die Bauern molken die Kühe, tranken die Milch, machten daraus Käse, Joghurt, Butter und Sahne und brachten den Rest des weißen Rohgoldes samstags hinunter nach Straßburg zum Markt, wo glückliche Menschen für diese vorzügliche Milch mit leeren Flaschen Schlange standen, sie zu echt fairen Preisen abgefüllt bekamen und jahrelang genossen. 2014 war plötzlich Schluss. Eine französische Behörde meinte, so gehe das nicht. Die Rohmilch sei voller Bazillen. Hof und Molkerei müssten umgebaut werden, die Wände geplättelt sein. Die wackeren Bauern der Erzeugergemeinschaft scheuten keine Mühe und bauten in Eigenleistung den Hof um. Doch die Behörde kam, sah und siegte: Die Wandplatten in der Molkerei entsprächen nicht der Vorschrift, sie seien zu rau und taugten maximal für Joghurt und Käse.
Aufgrund dieser Anforderungen mussten viele individuelle Kleinstbetriebe schließen, bevor manch ein Bürger überhaupt die Möglichkeit hatte, sich von dem Genuss der problematischen Milch zu überzeugen. Ich selbst trinke seit Jahren Rohmilch, fertige daraus meine Joghurts (siehe Seite 39) oder experimentiere mit käseähnlichen Konstruktionen.
Neben der unbestrittenen Keimproblematik, die jeder für sich selbst beurteilen muss, ranken sich um Rohmilch und Rohmilchprodukte jedoch einige Mythen. Zum einen gibt es da das Märchen von der angeblich schädlichen, da körperfremden MicroRNA. Diese kleinen (nicht codierten) kuh- und kalbspezifischen Ribonukleinsäuren dienen den Kälbern beim Wachsen – und können beim Menschen entgegen manch anderslautendem Gerücht keineswegs Gene verändern, denn sie kommen erst gar nicht dorthin, wo sie Schaden anrichten können. Detaillierte Untersuchungen bei Mäusen haben erwiesen, dass die MicroRNAs die Magen-Darm-Passage nicht überleben. Erst greift die Magensäure mit dem niedrigen pH-Wert in die Struktur der MicroRNAs ein, den Rest besorgen danach Enzyme und die halbe Belegschaft der Darmflora. In sukzessiven Prozessen werden die winzigen RNAs in ihre Bestandteile zerlegt, die dann als Nährstoffe dem Körper zugeführt werden.
Ein anderes, eher wohlwollendes Gerücht gehört ebenfalls in das Reich der Märchen. Es besagt, Rohmilch sei gesünder als homogenisierte Milch, da die Nanopartikel bei homogenisierter Milch die Darmwände durchdrängen und Schaden anrichteten. Das ist allerdings pure Esoterik, da physikalisch unmöglich – die Partikel sind mit 2–10 μm immer noch zu groß, um Zellmembranen zu durchdringen. Der physikalische Unterschied zwischen Rohmilch und homogenisierter Milch liegt zwar tatsächlich im Aufbau der Partikel: In der Rohmilch sind die Fettpartikel zusätzlich von einer Zellmembran, um genau zu sein, einer Lipiddoppelschicht, umgeben, die beim Homogenisieren zerstört und umgebaut wird. Der Gesamtnährstoffgehalt bleibt dabei jedoch erhalten. Und die dafür zuständigen Pankreasenzyme schaffen sowohl die homogenisierten als auch rohen Fett- und Kaseinpartikel. Lediglich der zeitliche Verlauf ist geringfügig, aber nicht maßgeblich unterschiedlich und wegen der Länge des Verdauungstraktes sogar irrelevant. Das ist eben angewandte Verdauungsphysik.
Doch nun genug der wissenschaftlichen Mythendekonstruktion, hier folgt nun ein Rezept mit Rohmilch dreier Stufen.
CREMIGES ROHMILCHCAMEMBERTEIS
250 g sehr reifer Rohmilchcamembert (Brie de Meaux)150 ml Rohmilchjoghurt (am bestenaus der sehr fetthaltigen Jerseykuhmilch)100 ml Rohmilch (ebenfalls am besten von der Jerseykuh)50 ml Invertzucker (500 ml Wasser mit 500 g Zucker und etwasSäure wie Zitronensäure für 10 Minuten kochen) – 2 g Rauchsalz½ TL Pimentón de la Vera (geräuchertes Paprikapulver)2 sehr dünne Scheiben Sauerteigbrot (Roggen)
Eismaschine
Den Käse mit Rinde würfeln. Alle Zutaten, bis auf Gewürze und Brot, in einem Mixer sehr fein mixen und in einer Eismaschine gefrieren. (Protzige Alternative wie so oft: der Pacojet.) In kleinen Nocken abstechen und mit etwas Rauchsalz und Pimentón bestreut als Käsegang mit den getoasteten, noch warmen Brotscheiben servieren.
Mit einem nicht zu kalten Gläschen Rauchbier oder geräuchertem Tee genießen (es muss nicht immer Wein sein, besonders nicht beim Eis).
Sanft beschwipstes Gemüse
Im Sommer, ich gebe es zu, trinke ich schon mal gerne einen leicht gekühlten Beaujolais, Gamay oder auch vermeintlich leichte Rotweine von »meinen« Winzern um die Ecke. Als Essensbegleiter an warmen Tagen sind gerade diese »kleinen Weine« oft besser als mancher Rosé, der nur in Sichtweite des Saint-Victoire oder des Mont Ventoux schmeckt. Manchmal haben diese Qualitätsweine ganz ordentlich Alkohol, trotz der Sommer, die nicht gerade der Hit waren. Das liegt daran, dass in diesen Fällen bei uns und in manchen anderen Weinanbaugegenden Europas »chaptalisiert« werden darf (nach Jean-Antoine Chaptal, einem findigen französischen Chemiker, der Anfang des 19. Jahrhunderts dieses Prozedere entdeckte): Hat der Traubensaft zu wenig eigene Süße (in der Winzersprache: zu wenig Oechsle, in der Chemikersprache: zu wenig Glukose, Fruktose & Co.), darf der Winzer Zucker zugeben. Dieser landet zwar im Traubensaft, aber bei vollständiger Gärung nicht mehr im Wein. Die Hefe vervespert ihn und produziert daraus Alkohol samt fruchtigen Aromen, die zum Charakter des Weins beitragen – ganz so, als hätten die saftigen Trauben einen guten Sommer und einen noch besseren Herbst hinter sich. So weit, so gut.
Aber warum sollte das nur mit Wein und Trauben gehen? Auch Craft-Beer-Brauer geben hin und wieder sich dem Reinheitsgebot widersetzend Zucker, Fruchtsäfte oder gar Traubentrester mit Restglukose dazu, um dem Bier einen höheren Alkoholgehalt und mehr Körper zu verleihen und die Gärung am Laufen zu halten. Und warum nicht mal mit Gemüsesaft ähnlich verfahren, also: Gemüsewein? Das schwirrt mir schon lange im Kopf herum. Es wäre doch spannend, was dabei herauskommt.
Die Wahl der Gemüse dafür ist einfach. Sie sollten sowohl roh als auch gekocht gut schmecken, vor allem genügend Zucker haben und nicht zu viel Säure, denn ein niedriger pH-Wert würde der Hefe einen Teil ihres Mumms nehmen. Tomaten, zumindest die sauren Sorten, fallen daher aus, aber Sellerie, Pastinake, Petersilienwurzel, Rote Bete oder (mit Einschränkung wegen der Oligofruktose) Topinambur sind geeignete Kandidaten. Die Pflanzenzucker müssen nur noch von den Hefeenzymen in Alkohol und Aromen verwandelt werden – das ist das Ziel. Erreichen kann man es auf zwei Wegen: Entweder püriert man das rohe Gemüse zusammen mit zusätzlichem Zucker und Hefe sehr fein, dann erhält der Wein einen eher »rohen« Aromacharakter. Oder man dämpft das Gemüse vor dem Pürieren, dann spielen schweflige, »gekochte« Aromen eine Rolle und geben sogar ein gewisses Etwas an Rundheit und Mundfülle. Ich entscheide mich für die gekochte Präparation, das erscheint mir sicherer. Der gezielte Hefeeinsatz soll außerdem verhindern, dass eine spontane Gärung mit Milchsäurebakterien und wilden Hefen stattfindet, wie sie bei Orangewein, Sauerbieren oder der belgischen Bierspezialität Lambic üblich ist. Ich will ja in diesem Fall aus dem Zucker Alkohol gewinnen, keine Säure. Als Hefe wähle ich klassische Bierhefe aus dem Brauhandel (mit normaler Bäckerhefe aus dem Kühlregal funktioniert es aber ähnlich). Interessant wären sicher alle möglichen Sorten von Reinzuchthefen, die je nach Stamm ganz spezielle Aromen bilden können, aber so viel kann ich gar nicht trinken, bis ich alle durchprobiert hätte. Es gibt ja nach wie vor köstliche Biere und Weine. Da bleibe ich ganz Physiker: Die Methode muss funktionieren, der Rest ist Kür. Außerdem ist meine Wahl schließlich eher zufällig auf Sellerie gefallen. Es ist eines meiner liebsten Gemüse und ich hatte einen hellen Gemüsewein vor Augen. (Aus Roten Beten könnte man sicher einen schönen »Roten« zaubern … das probiere ich beim nächsten Mal.)
Als Starter- und Zusatzzucker für die Gärung wähle ich Honig, denn er hat neben anderen Sacchariden eine gute Glukose-Fruktose- Mischung und kommt damit dem Zuckerspektrum der Trauben einige Schritte näher. Außerdem bringt er ein paar Grundaromen mit, die den Gärprozess teilweise »überleben«; auch das ist erwünscht. Die Menge des Honigs bzw. des Zuckers bestimmt letztlich den Alkoholgehalt. Glückliche Besitzer eines Refraktometers (zur Bestimmung der Zuckerkonzentration) können, je nach Alkoholziel, mit mehr oder weniger Honig experimentieren. Schlimmstenfalls bricht die Gärung ab, das kann immer passieren, ähnlich wie beim Wein. Tragisch ist das nicht: Der alkoholschwächere Gemüsewein hat etwas Restzucker, ist also nicht trocken, aber für einen ordentlichen Mainzer »Schoppe« (mit »saurem Sprudel« aufgegossen) reicht es immer noch. Und wem er nun gar nicht schmeckt, der kippt ihn in die nächste Gemüsesuppe, wie so manchen untrinkbaren Korkwein (siehe Seite 169).
Mein Selleriewein ist jedenfalls schon beim ersten Versuch sensationell geworden, viel zu schade zum Kochen. Den Alkoholgehalt hatte ich nicht bestimmt, könnten 7–9 Vol.-% gewesen sein. Aber er war deutlich spürbar, die Gärung war vollständig, eine Restsüße war nicht auszumachen. Spannend war die Aromatik. Natürlich war die gewünschte Bitterkeit des Selleries wahrnehmbar, sie blieb aber weit hinter der von leicht gehopftem Bier zurück. Einige typische Sellerienoten blieben, etwa die karamell-curryartigen Noten des gekochten Selleries, auch das Erdige war deutlich auszumachen und es gesellten sich Fruchtaromen hinzu (vermutlich aus der Hefe) ebenso wie kräuterartige Düfte, die ein wenig an Petersilie erinnern. Verallgemeinerbar ist das alles nach diesem ersten Experiment natürlich nicht und weitere Forschung ist notwendig.
Ich habe den Selleriewein zu allen möglichen Gelegenheiten verkostet, um sein Potenzial auszuloten. Natürlich nur in winzigen Schlückchen, des lächerlich geringen Ertrags wegen. Zu gedünstetem oder gedämpftem Fisch war er eine kleine Offenbarung, für herzhafte Schmorgerichte viel zu schwach. Als Begleiter zu fleischfreien Gemüsegerichten kommt er wunderbar, vor allem zu frischen Zubereitungen auf Tomatenbasis. Dort springt seine vegetale Bitterkeit genau in die Lücke, die vielen Tomatensorten fehlt.
Ich kann das Experiment daher jedem empfehlen. Man braucht allerdings einen Gärballon und – angesichts der Gärzeiten von 7 – 14 Tagen – viel Geduld.
SELLERIEWEIN
1 Knollensellerie – 5 EL HonigBierhefe (aus dem Brauereifachhandel)
Gärballon
Den Sellerie mit der Schale im Ofen bei 200 °C ca. 20 Minuten vorgaren, um die darin enthaltenen Kohlehydrate den Hefeenzymen zugänglich zu machen. Alternativ die Knolle in der Mikrowelle ca. 2 Minuten bei 1 000 W blanchieren. Den Sellerie schälen und mit 1l Wasser und Honig (Starterzucker für die Hefe) pürieren. Mit der Hefe in einen Gärballon geben. In einem dunklen, nicht zu warmen Raum, am besten im Keller bei 15 °C, vollständig durchgären lassen, bis die Gasentwicklung abgeschlossen ist. Es sollte also nicht mehr blubbern und das Gärröhrchen keine Gasblasen mehr zeigen.
Filtern und probieren (bei zu starken Fehlaromen zur Sicherheit besser nicht trinken).
Als leichtes alkoholisches Getränk der Qualitätsstufe »trocken« ersetzt dieser Wein gekühlt zu so manchen Gemüsegerichten das Glas Wein oder Bier.
Gut verkorkt lässt sich der Wein übrigens ein wenig lagern, allerdings nicht allzu lange, denn er hat ja nur seine natürlichen Konservierungsstoffe und ist eher zum unmittelbaren Verzehr gedacht.
Der Winzerknorzen: zum finalen Herausoperieren alter Korkenrückstände im Flaschenhals.
Ein Misoscherzel
Immer wieder Miso. Es ist einer der spannendsten mikrobiologischen Küchenhelfer, die ich mir vorstellen kann. Ein Pilz namens Koji, der auf alle Arten von Getreide steht, hat es uns geschenkt. Miso ist lebendige japanische Küchenkultur im wahrsten und besten Sinne des Wortes. Logisch, dass mein »Pfälzer Kartoffelmiso«, das mich selbst überrascht hat (siehe Seite 19), nicht die einzige Erkundung in diese Richtung gewesen ist.
Doch zunächst will ich kurz erzählen, warum dieses Wundermittel überhaupt so wunderbar ist. Miso ist nämlich weit mehr als nur eine Würzpaste – sofern es nicht pasteurisiert ist, also noch »lebt«. Dann kann die Paste die Welt um sich herum verändern. Funktioneller Kern dieser Nanobiomaschine ist der Koji-Pilz (Aspergillus flavus var. oryzae), der ein breites Spektrum an Enzymen in die Umgebung sendet, die sowohl Proteine, Fette (Lipide) als auch Stärke schneiden können. Beim Kartoffelmiso-Experiment wurden neben der Stärke auch Proteine zu Aromamolekülen umgearbeitet. Was wäre also, wenn man das Miso auf Fisch oder Fleisch loslässt? Es wäre doch interessant zu sehen, was ein mit diversen Enzymen vollgestopfter Misobrei etwa bei bindegewebsreichem Schmorfleisch anrichten kann. Theoretisch kann das Miso hier zweifach genutzt werden: Es durchtrennt Verbindungen der Proteine auch in den härtesten Bindegewebsteilen, sodass das Fleisch zarter und geschmackvoller wird. Gleichzeitig fügt die Würzpaste einen erheblichen Anteil an Umami-Geschmack bei. Dieser entsteht zwar beim Schmoren ohnehin, aber die Sauce wird mit Misopaste deutlich runder und hat mehr »Mundfülle« (siehe Seite 242). Da gute Theorie fast immer in gute Praxis mündet, kann ich bereits verraten: Es wird eine kleine Sensation!
Für dieses Experiment habe ich Schulterscherzel (Neugastrodeutsch: flat iron) verwendet. Es wird in Österreich vorwiegend für Suppenfleisch verwendet, kommt aber genau in dieser Form in Sternehäusern auf den Tisch, oft mit Brühe, in der Brühe separat gegartem Wurzelgemüse und eventuell Kartoffeln. Schulterscherzel hat in der Mitte eine sehr harte Kollagennaht, die erst in schlotzige Gelatine umgewandelt werden muss, was beim langen Schmoren geschieht. Gleichzeitig ist der Anteil des längerfaserigen Muskelfleisches hoch. Eigentlich eine gute Kombination, denn wir bekommen sowohl trockenes Muskelfleisch als auch saftige Gelatineeinlagen – aber nur, wenn man es schafft, diese beiden so gegensätzlichen Komponenten irgendwie zu vermählen. Hier kommt nun das Miso ins Spiel, und zwar nicht nur bei der harten Kollagennaht, sondern auch im Muskelfleisch: Die durch das lange Schmoren eher trockenen längerfaserigen Muskelanteile sind immer etwas schwieriger zu essen. Werden die Muskelproteine jedoch durch die Proteasen der Misopaste während der Marinierzeit angeschnitten, wirken sie zarter und fügen sich enger an die schmelzende Gelatine der Bindegewebsnaht an. Noch perfekter, sprich intensiver, wird das Ergebnis, wenn man das Ganze nach dem Schmoren mindestens 3 Tage im Kühlschrank zur Aromabildung »reifen« lässt.
Natürlich könnte man auch die Kollagennaht aus dem Scherzel schneiden und die beiden Muskelteile kurz braten oder grillen. Das ist ebenfalls schmackhaft, jedoch nicht besonders raffiniert. Und mit der brachialen Gewalt des Messers könnte ja jeder arbeiten. Ich bevorzuge das feinere Besteck der Mikroorganismen und lasse andere für mich arbeiten. Also, lieber Koji-Pilz, ans Werk – oder »iku«, wie die Japaner sagen!
SCHULTERSCHERZEL, LÖFFELZART
500 g Schulterscherzel1–2 EL Misopaste (nicht pasteurisiert, aus dem Bioladen)80 g grüner Speck – 1 Bund Suppengrün – 1 Knolle Knoblauch1 Zwiebel – 3 EL Shiitakepulver – 1 TL gemahlener Kreuzkümmel3 Gewürznelken – 1 Stück Ceylonzimt (5 cm) – 1 kleine Chilischote(wer’s schärfer mag, gehackt)1 Flasche Rotwein – Salz
Das Schulterscherzel mit der Misopaste einreiben und mit Frischhaltefolie ummanteln. Ca. 4 Stunden bei Zimmertemperatur marinieren lassen.
Den Speck in Würfel schneiden. Das Suppengrün putzen und in Stücke schneiden. Die Zehen der Knoblauchknolle schälen und halbieren. Die Zwiebel halbieren und die Schnittflächen anbraten, bis sie sehr dunkel (schwarz) sind.
Das Schulterscherzel in einen Schmortopf geben, Speck, Suppengrün, Knoblauch, Zwiebel und alle Gewürze zufügen und den Rotwein angießen. In den kalten Backofen geben und die Temperatur auf 130 °C einstellen. Sobald es im Topf zu blubbern beginnt, die Temperatur auf 95 °C reduzieren und das Ganze 4 Stunden schmoren. Danach im Ofen auskühlen lassen. Den Topf samt Inhalt mindestens 3 Tage lang im Kühlschrank reifen lassen.
Zum Servieren erwärmen, bis der gelierte Schmorfond flüssig ist, das Fleisch vorsichtig aus dem Topf heben und im Ofen bei 80 °C erwärmen. Den Fond passieren und unter schwacher Hitze stark reduzieren, bis die Sauce dicklich wirkt. Notfalls mit etwas Butter und Stärke abbinden. Das Fleisch in Scheiben (quer zur Schulternaht) auf Tellern anrichten, die Sauce angießen.
Perfekte Beilagen sind gebratenes Wurzelgemüse, Kartoffeln und butterige Pürees.
Trinkjoghurt (»probiotisch«), Marke Eigenbau
Weiter vorn habe ich bereits ein Loblied auf die Rohmilch und die Klage über ihr Verschwinden angestimmt. Verschärfte Hygienemaßnahmen erlauben den Verkauf bald nicht mehr (siehe Seite 26). Dabei ist Rohmilch ein hervorragendes Grundprodukt für die eigene Küche, wenn man bereit ist, gewisse Risiken einzugehen! Schon oft habe ich Joghurt und Käse daraus hergestellt, und seit vielen Jahren (ungefähr zeitgleich mit dem Aufkommen der leider pappsüßen, angeblich wundergesunden, Abwehrkräfte stärkenden probiotischen Trinkjoghurts) produziere ich meinen eigenen Trinkjoghurt mit Rohmilch. Vergangenes Jahr ist er noch besser geworden, denn seitdem gibt es eine kleine Milchzapfstelle in der Nähe von Mainz, wo man Rohmilch von Jerseykühen bekommt … ein Traum! Die Milch punktet mit hohem Protein- und Fettgehalt, cremiger Textur und ihrem besonders sahnig-kokosähnlichem Aroma.
Apropos, das Rohmilcharoma. Als mein Bioland-Milchbauer noch Milch mit dem Qualitätsmerkmal »roh« produzierte, sagte er mir einmal, seiner Ansicht nach sollte Rohmilch vor der Joghurtproduktion auf jeden Fall aufgekocht werden, damit sich der reine Joghurtgeschmack durchsetzen könne. Das stimmt natürlich. Jede Joghurtkultur produziert schließlich ihr eigenes Aromaspektrum, wie man leicht feststellt, wenn man an verschiedenen Naturjoghurtprodukten riecht. Der Grund dafür liegt in dem Enzymspektrum des jeweiligen Lactobacillus. Diese Enzyme senken den pH-Wert (Milchsäure), produzieren aber eben auch sehr spezifische Aromen. Wird nun Rohmilch verwendet, kommen die Kuhkeime hinzu, die sich bei den angenehmen Temperaturen der Joghurtherstellung so lange wohlfühlen, bis der pH-Wert durch die Milchsäure zu niedrig wird (etwa 4,5) und sie langsam, aber sicher absterben. Letztlich gewinnen immer die Milchsäurebakterien und Joghurtbazillen, da sie deutlich säuretoleranter sind. Die anfänglich mögliche Vermehrung der Rohmilchkuhbazillen ist in aller Regel kein gesundheitliches Problem. Die im Joghurt umherschwimmenden »Leichen« der Rohmilchkeime aus dem Kuheuter trinkt man einfach mit. Auch das ist weder schlimm noch unappetitlich, denn abgestorbene Keime bestehen aus DNA, Proteinen, Phospholipiden und Glykoproteinen, mit anderen Worten: aus wertvollen Makronährstoffen.
Doch zurück zu den Anfängen der Joghurtfermentation: Solange die Kuhkeime leben, vermehren sie sich und senden ihre eigenen Enzyme aus. Diese produzieren ebenfalls Aromen, die eher in Richtung Sauermilch und Dickmilch weisen. Es ist also Geschmackssache, oder nein: Riechsache, natürlich. Möchte ich das reine Joghurtbacillusparfüm, dann heißt es aufkochen (oder die pasteurisierte Milch verwenden), habe ich es lieber etwas kerniger, gestatte ich den Kuhkeimen ihre Aromaproduktion, solange die Milchsäurebakterien den pH-Wert von etwa 4 noch nicht geschafft haben.
Tatsächlich hat man die Aromabildung und den finalen Duft des Trinkjoghurts buchstäblich in der Hand. Wer dem Joghurt seine ganz persönliche Handschrift geben möchte, badet seine Hände und Arme kräftig in der Milch, bevor diese in den Ofen kommt, denn die körpereigenen Milchsäurebakterien auf der Haut reichen im Prinzip aus. Was sich dabei ergibt, ist jedenfalls noch spannender und individuell.
All den Unsinn mit Joghurtbereitern kann man übrigens getrost vergessen. Backofen, ein Topf, das reicht.
GRUNDREZEPT:ROHMILCHJOGHURT
1 l Rohmilch (bzw. Vorzugsmilch) mit natürlichem Fettgehalt100 g Starterjoghurt (vorzugsweise mit ausgewiesenenStarterkulturen L. casei, L. acidophilus, L. bifidus, die esmittlerweile in Bioläden gibt)
Den Backofen auf 40 °C vorheizen (meist reicht das Einschalten der Lampe). Die Rohmilch in einem Topf auf 35 °C erwärmen und den Joghurt unterrühren. Ca. 8 Stunden zugedeckt fermentieren lassen. Danach mit dem Schneebesen cremig rühren und in eine saubere Milchflasche füllen. Der Rohmilchjoghurt ist gekühlt (2–4 °C) über 1 Woche haltbar. Der Joghurt ist aber auch die beste Grundlage für ein Eis oder Parfait, ganz ohne zugesetzte Stabilisatoren wie Eigelb oder Verdickungsmittel, denn viele Laktobakterien produzieren diese selbst.
BANANEN-MANGO-EIS
200 ml Rohmilchjoghurt1 sehr reife Banane (mit deutlich schwarzen Flecken auf der Schale,je mehr, desto süßer) – 1 EL sehr aromatisches Kokosöl1 EL feiner Bio-Zitronenabrieb200 ml sehr guter Saft aus exotischen Früchten1 reife Mango – 1–2 EL Olivenöl – 2–3 EL Kokosflocken
Eismaschine
Joghurt, Banane und Kokosöl sehr fein pürieren. Den Zitronenabrieb zufügen und in einer Eismaschine gefrieren. Den Fruchtsaft bei schwacher Hitze auf die Hälfte reduzieren, damit eine cremige Konsistenz entsteht. Mango schälen, das Fruchtfleisch in kleine Würfel (Brunoise) schneiden und leicht mit fruchtigem Olivenöl überziehen. Die Kokosflocken in einer Pfanne trocken anrösten. Die Mangowürfel in Schälchen anrichten. Eine Kugel des Joghurt-Bananen-Eises daraufsetzen, etwas reduzierten Fruchtsaft angießen und mit den gerösteten Kokosflocken bestreuen.
Übrigens: Zucker wird für das Eis nicht benötigt, da die reifen Bananen genug davon haben. Wer auf süß steht, kann der Eismasse etwas Invertzucker (1 Teil Wasser und 1 Teil Zucker mit etwas Zitronensäure aufkochen, 10 Minuten leicht sieden, abkühlen lassen) zufügen.
Der Zestenreißer: Der Siebeck hat's empfohlen. Ein Kultobjekt aus der Zeit vor der superscharfen Küchenreibe.
Salzzitronen, Salzorangen, Salzgrapefruit? Alles geht!
Essen aufzupeppen ist wirklich kein Problem, sofern ein paar Zutaten herumstehen, auf die man spontan zurückgreifen kann. Dazu gehören zum Beispiel Salzzitronen, Salzgrapefruit oder Salzorangen. Ja, richtig, Salzorangen. Was mit Zitronen funktioniert, klappt auch mit anderen Zitrusfrüchten, denn so unterschiedlich sind diese in ihren Grundzusammensetzungen nicht, außer dass Orangen (oder Mandarinen) etwas mehr Zucker haben. Dann haben ausgesuchte Milchsäurebakterien wenigstens ordentlich zu futtern, was der Aromabildung zugutekommt.