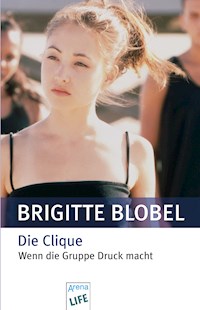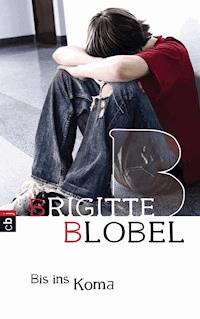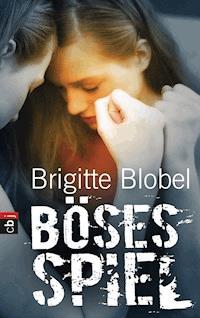4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Kindergärtnerin Gesine hat ihr Leben als Single leid und will dem Schicksal auf die Sprünge helfen. Irgendwo wartet doch sicher ihr Märchenprinz. Gesine ahnt noch nichts von der Existenz eines Mannes, der so genial mit den Träumen und Sehnsüchten romantischer Frauen spielen kann. Bis ihr genau dieser Mann fast zum Verhängnis wird und sie an ihren Träumen zu scheitern droht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Brigitte Blobel
Der geträumte Mann
Roman
Mit den Kindern in B. das Zukunftsspiel gespielt. »Und wen heirate ich einmal, einen großen Schlanken oder einen kleinen Dicken, und wohin werde ich reisen, und trägt er eine Brille, dann will ich ihn nicht.«
Marie Luise Kaschnitz, Orte
ICH MÖCHTE DIESEN SOMMER NICHT MEHR ALLEIN SEIN! SIEH DOCH, DER FRÜHLING IST SCHON DA, DER FLIEDER LÄNGST ERBLÜHT, UND WIR HABEN UNS NOCH IMMER NICHT GEFUNDEN! ICH MÖCHTE IN DEINEN ARMEN LIEGEN, BEVOR DAS ERSTE HEU GEMÄHT IST UND DIE BEEREN REIFEN. ICH MÖCHTE DICH LIEBEN, MIT DIR SINGEN, LACHEN, TANZEN, WEINEN. ICH MÖCHTE DEINE FRAU WERDEN FÜR DIE GUTEN UND DIE SCHLECHTEN TAGE. ICH BIN 28, MEINE FREUNDE NENNEN MICH HÜBSCH, HABE EINEN INTERESSANTEN BERUF, DER JEDOCH NUR MEINEN KOPF, NICHT ABER MEIN HERZ AUSFÜLLT!
WENN DU ÜBER 30 BIST, AUFGESCHLOSSEN, TOLERANT, KINDERLIEB UND ZÄRTLICH, DANN MELDE DICH BITTE SOFORT!
Hochzeitsglocken haben einen ganz besonderen Klang. Ein verheißungsvoller Klang, ein Jubelklang ertönte von den ockergelben Türmen der Josefskirche über den alpenländischen Ort Anklung hinweg, wurde weitergetragen vom Wind zu der Seepromenade, den Bootshütten, bis hin zu den versteckten Buchten, wo sich zwischen singenden Schilfrohren die Schwanenpaare liebten.
Ein mittäglich sonnenheißer Frieden lag über Anklung, als die ersten Limousinen auf den Kirchplatz rollten, der Lack poliert, die Chromteile glänzend gerieben, ja, der Zahnarzt hatte sogar Wert darauf gelegt, dass die weißen Felgen seines neuen Porsche ebenso leuchteten wie die Margeriten auf dem Sommerhut seiner Frau.
Die Zaungäste an der Kirchenmauer, obwohl nicht zu diesem Spektakel geladen, fühlten sich als Eingeweihte, als Teilnehmer dieses Festes. Kannten sie doch alle die Wagen, den Mercedes des Bürgermeisters, den BMW des Notars, den grünen Volvo, den der alte Herr oben vom Gut immer für seine Landfahrten benutzte. Das hellblaue Cabrio, aus dem jetzt die beiden heiratsfähigen Töchter des Immobilienmaklers stiegen, war ihnen ebenso vertraut wie das verbeulte, qualmende Vorkriegsmodell, in dem der Doktor seine Visiten machte. Dazwischen jedoch auch Wagen mit Düsseldorfer und Münchener Kennzeichen, Geschäftsfreunde des Brautvaters, Schulfreundinnen der Brautmutter, all die Yachtbesitzer, deren Boote im Privathafen von Tobias Lidl vor Anker lagen, die Stammgäste des Seehotels, das ebenfalls Tobias gehörte, und schließlich all die Freunde und Bekannten dieses Mannes, der es in Anklung so weit gebracht hatte wie kein anderer: Tobias Lidl, Großgrundbesitzer, stellvertretender Bürgermeister, Mitglied des Landtags, ausgezeichnet mit der goldenen Fremdenverkehrsmedaille der Stadt Anklung.
Tobias und Katharina Lidl, die Brauteltern, fuhren in einer Kutsche vor. Braune Rösser, eingebundene Mähnen und Schweife, poliertes Geschirr, ein leichter Jagdwagen, der vom Reitlehrer des Reiterhofs gelenkt wurde.
Der Kutscher hielt vor dem Kirchenportal. Tobias Lidl zog seinen Bauch ein, strich mit den Händen über die Samtweste seines Trachtensmokings, die Silberketten am Hosenbund klimperten, seine Manschetten waren blütenweiß, die rote Seidenschleife korrekt gebunden, auf dem kleinen Finger glitzerte ein Brillant, Tobias Lidl ließ den Nagel des kleinen Fingers immer etwas länger wachsen und von der Maniküre spitz zufeilen, wie er es im Spielkasino einmal bei einem Croupier gesehen und bewundert hatte. Er half seiner Frau, einer etwas plumpen Matrone mit Doppelkinn und wippendem Busen, den sie heute in ein Brokatmieder geschnürt hatte, beim Aussteigen. Die kleinen Brautjungfern trugen silberne Körbchen mit weißen Rosenblättern und blauen Kornblumen in den Händen. Frau Lidl raffte den Brokatrock und beugte sich zu den kleinen Mädchengesichtern herunter, um ihnen mit ihren roten Lippen einen schmatzenden Kuss aufzudrücken.
»Mei, seids ihr herzig!«, rief sie gerührt aus. »So etwas hätt’ ich mir auch für meine Hochzeit gewünscht, so was Schönes! Aber damals hat man an so etwas nicht denken können. Eine Kutsche für das Brautpaar! Eine Kutsche für die Eltern! Mei, mir ist’s beinah, als würden wir noch einmal unsere eigene Hochzeit feiern, mein Tobias, gell, so geht’s dir auch!«
Tobias verzog sein Gesicht und brummte etwas, das man für eine Zustimmung halten konnte. Er seufzte, als er darüber nachdachte, was die Zeit ihnen angetan hatte, seufzte, als er daran dachte, dass sein Töchterlein, sein Sonnenschein, nun nicht mehr um ihn sein würde. Leer das Haus. Kein Lachen, kein Kichern, Flirten, nicht mehr die blauen, strahlenden Augen des Kindes, nicht mehr dieses Gequietsche aus ihrem Zimmer, diese Popmusik, keine Freundinnen mehr, die hin und her liefen, keine hübschen jungen Mädchen mehr, die sich hinter den Rosenhecken im Garten sonnten. Tobias Lidl hatte schon oft geseufzt in der letzten Zeit, wenn er daran dachte, dass dies alles nun endgültig vorbei sein würde. Keine Jugend mehr in seinem Haus, keine Schönheit mehr. Nur noch Katharina und er.
Doch jetzt klapperten die Hufe der Pferde auf dem Kopfsteinpflaster, trabten die beiden Schimmel heran, stolze Rösser mit schnaubenden Nüstern und einem Federbusch auf dem Stirnband wie die Araber des Zirkus Krone, und es ging ein Raunen durch die Neugierigen, die rechts und links von der Einfahrt Spalier standen.
Das Brautpaar!
Strahlend sein Töchterlein Elisa. Leuchtend ihre Augen, ihre Haut überzogen mit rosigem Schimmer, sein Töchterlein gekleidet in spitzendurchwirktes Weiß, ein Schleierkrönchen auf den goldenen Locken, lachend stieg sie aus der Kutsche, fiel in die Arme ihres Bräutigams, küsste ihn ungeniert. Und er umspannte ihre Taille, diese schmale, zierliche Taille, setzte sie auf den Boden, sanft und behutsam, als sei sie ein Porzellanpüppchen, ein zerbrechliches Kleinod. »Ja, ich denke«, sagte Tobias Lidl, »er wird sie gut behandeln, unser Schwiegersohn, unser Ronnie. Er bekommt das beste Mädel von ganz Anklung. Hoffentlich weiß er das.«
»Wir können es nur hoffen«, seufzte Katharina. »Wir können es nur hoffen. Es sieht so aus, als wenn er sie wirklich liebt, nicht wahr?«
Tobias nickte. »Ja, es sieht so aus. Aber woran kannst du erkennen, ob er unser Töchterchen liebt und nicht unser Geld?«
»Hoffentlich werden sie glücklich«, murmelte Katharina. »Gib mir deine Hand, Tobias. Halt mich fest wie damals, als wir Mann und Frau wurden.«
»So ein Schmarrn«, brummte Tobias, aber er gab ihr doch seine Hand, schließlich war er genauso durcheinander wie seine Frau. Noch nie zuvor hatte ein Mädchen aus Anklung einen Amerikaner geheiratet. Und nun ausgerechnet seine Elisa! Noch dazu kannten sie Ronnie erst seit zwei Monaten.
Elisa schloss für den Bruchteil einer Sekunde die Augen, in denen Stolz blitzte, Triumph. Elisa genoss den leichten Schauder auf ihrer Haut, den sie immer verspürte, wenn Ronnie sie küsste, wenn sein Kinn, das immer ein wenig zu rau war, ihre Wange streifte.
»Halt mich fest«, flüsterte sie, »halt mich fest, Ronnie. Ich liebe dich. Ich bin so glücklich, Ronnie.«
»Well«, sagte Ronnie, »so am I.« Er half ihr, die Rüschen und Schleifen des teuren Brautkleides zu richten, bevor er ihr den Arm reichte, wie er es in den alten Filmen gesehen hatte. So war auch Scarlett O’Hara zum Altar geführt worden, in diesem Augenblick war er der stolze, unabhängige Amerikaner, der junge Leutnant, der sein Vaterland vertritt, der Soldat, der das Sternenbanner neben sich her flattern lässt. Heute ging er aufrecht über den roten Teppich auf das Portal der Josefskirche zu. Er hatte die Heiratsurkunde bereits in der Tasche, gestempelt und besiegelt und beglaubigt, sie konnten ihm das Mädchen nicht mehr nehmen, keiner konnte ihm Elisa nehmen, keiner konnte ihm das Glück wieder entreißen, es war alles amtlich. So leicht war alles gewesen, fast zu leicht, das Herz schlug ihm, wenn er daran dachte, wie viele Sorgen er sich gemacht hatte. Alles unnötig, wenn man einen Schwiegervater wie Tobias Lidl hat, Anklunger Bürger in der zwölften Generation.
»Bist du glücklich, Ronnie?«, flüsterte Elisa, die in ihren weißen Satinschühchen neben dem großen breitschultrigen Ronnie her trippelte, »oh, ich bin so glücklich, dass ich schreien könnte!«
»Well«, sagte Ronnie grinsend, »so am I.«
Das war in diesem Augenblick nicht einmal eine Lüge.
Natürlich hatten alle Kinder von der Hochzeit gehört. Und sie wussten auch, dass die Kutsche mit dem Brautpaar am Kindergarten vorbeifahren würde. Immer wieder stürzte eines zum Fenster, kletterte auf das Fensterbrett und drückte die Nase gegen die Scheibe. »Ich seh’ noch nichts!«, rief es dann, plumpste herunter und zwängte sich wieder in den Halbkreis um Gesine, die Kindergärtnerin, die mit dem dicken Märchenbuch auf dem Schoß dasaß und mit leiser Stimme den Kindern vorlas, während sie nach draußen lauschte, auf die Geräusche der Straße.
»Es war einmal eine Frau, die wollte so gerne ein Kind haben, aber sie wusste nicht, wie sie es bekommen könnte. Da ging sie zu der alten Zauberin und sagte zu ihr: ›Ich möchte so gerne ein Kind, kannst du mir nicht sagen, woher ich es bekommen kann?‹
›O ja, da will ich dir gerne helfen‹, sagte die Zauberin. ›Hier hast du ein Gerstenkorn; das ist kein gewöhnliches, wie es auf dem Busnerfelde wächst oder womit die
Hühner gefüttert werden. Lege es in einen Blumentopf, dann wirst du schon sehen, was ich meine …‹.«
»Die Glocken!«, kreischte die kleine Carola, die immerzu unruhig hin und her gehüpft war, während Gesine vorlas, »jetzt läuten die Glocken! Gleich müssen sie kommen!«
»Meine Mami hat gesagt, dass die Braut ein weißes Kleid trägt, genau wie im Märchen. Wie Schneewittchen eines zu ihrer Hochzeit angehabt hat, stimmt das, Fräulein Gesine?«
»Ich weiß nicht«, sagte Gesine mit einem müden Lächeln, »ich habe das Brautkleid nicht gesehen. Aber wenn deine Mama es sagt, wird es schon stimmen.«
Die Eltern der kleinen Carola waren Nachbarn von Lidls, Duzfreunde. Sie hatten eine herrliche Villa unten am See, mit Bootssteg und einer schmucken Segeljolle, die im Sommer an der roten Boje schaukelte. Gesine fragte sich oft, warum die Eltern ihre Kinder hier in den Kindergarten brachten, in diesen kleinen viereckigen, mit Kieseln belegten Hof, diesen winzigen Garten, in dem es außer ein paar hölzernen Spielgeräten, einer Rutsche und einem Sandkasten nichts Besonderes gab. Hatten sie nicht alle weitläufige Gärten, sanfte grüne Rasen, auf denen die Kinder herumtollen konnten, efeuumrankte Pavillons und Bootshäuser, in denen man Indianer spielen konnte, oder die Prinzessin und der Frosch, Bäume, auf die man klettern und in denen man sich ein Wolkenkuckucksheim errichten konnte?
Aber die Eltern hatten alle ihren Pestalozzi gelesen, sie fühlten die Verpflichtung, ihren Kindern die beste aller Erziehungen angedeihen zu lassen, sie wollten, dass ihre Kinder einmal nützliche Mitglieder der Gemeinde würden, soziale Wesen, die es rechtzeitig gelernt hatten, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Sie wünschten, dass ihre Kinder beim Eintritt in die erste Schulklasse bereits das Einmaleins und das Alphabet beherrschten, dass sie nicht mehr am Daumen lutschten und nicht mehr das Bett nässten.
Dafür wurde Gesine bezahlt. Das erwartete man von ihr, Gesine Lukas, einer Kindergärtnerin, die mit den besten Zeugnissen ins Berufsleben entlassen worden war, 25 Jahre alt, freundlich, leise und unauffällig, wie man es früher von guten Gouvernanten und Erzieherinnen gewöhnt war, ohne ausschweifende Wünsche, ohne auffallende Lebensgewohnheiten, ein stilles, junges Mädchen mit mittelblonden, glatten Haaren, graublauen, ruhigen Augen und einem Mund, den vielleicht viele schön gefunden hätten, wenn Gesine der blässlichen Farbe der Lippen mit einem Stift etwas nachgeholfen hätte.
»Die Kutsche«, schrie die kleine Veronika, »die Kutsche ist sogar mit rotem Samt ausgeschlagen worden, sagt meine Omi. Wie bei einem König!«
»Wenn ich einmal groß bin«, schwärmte Jasmina, das Mädchen mit den Sommersprossen, »dann will ich auch eine Prinzessin sein. Dann möchte ich ein Kleid haben, so lang, dass hundert Menschen die Schleppe tragen müssen. Genau wie bei einer ganz richtigen Prinzessin.«
»Und eine Krone willst du wohl auch haben«, fauchte Sandra eifersüchtig, »du willst immer alles haben! Alles für dich allein.« Schluchzend rannte sie aus dem Zimmer.
Jasmina verzog ihr Gesicht. »Was hat sie denn? Ich habe ihr doch überhaupt nichts getan.«
Gesine strich mit den Fingern über das aufgeschlagene Buch. »Möchtet ihr, dass ich die Geschichte vom Däumelieschen weiterlese?«
»Jaa!«, schrien die Kinder und setzten sich brav im Schneidersitz wieder hin, und für einen Augenblick war es in dem Zimmer fast still, als Gesine weiterlas.
»›Das ist eine schöne Blume!‹, sagte die Frau, und sie küsste die herrlichen roten und gelben Blätter, aber als sie sie küsste, öffnete die Blüte sich ganz plötzlich. Mitten in der Blüte, auf dem grünen Stempel, saß ein winzig kleines Mädchen, fein und lieblich. Sie war nicht größer als ein Daumen, und eben deswegen wurde sie Däumelieschen genannt.«
»Ich höre sie! Sie kommen!«, schrie Florian, der Sohn des Tankstellenbesitzers, der immer davon träumte, dass sein Vater einen richtigen Western-Saloon hätte, vor dem die Cowboys ihre Pferde anbinden würden. Er lief zum Fenster, zerrte an dem Riegel und riss es auf, die anderen Kinder waren ebenfalls aufgesprungen, neugierig starrten sie nach draußen, man hörte das Knirschen der eisenbeschlagenen Räder, das »Hü!« und »Hoho!« des Kutschers oben auf dem Bock, das Knallen der Peitsche und wie die Hufeisen auf das Kopfsteinpflaster schlugen.
Jetzt sah man die beiden Rösser, weiße herrliche, herausgeputzte Pferde, sie blähten die Nüstern und schnaubten, und der Kutscher hatte, obwohl es ein warmer Frühsommertag war, ein kariertes Reiseplaid über seine Knie gebreitet, wie man es oft auf alten Stichen und Ölgemälden sehen kann. Welch ein prachtvolles Bild. Das Brautpaar in der offenen Kalesche. Unter einer Wolke von Tüll und Schleiern die Braut. Die goldenen, langen Haare in kunstvolle Locken gelegt, die Hände auf dem Schoß, zwischen den Fingern einen Strauß Orchideen, blasse blaue und zarte rote Farben. Jetzt, als die Kinder vor Freude und Begeisterung schrien, schaute sie zu ihnen herüber, schlug den Schleier zurück und winkte mit dem rechten Arm, der bis zum Ellenbogen in einem Satinhandschuh steckte, und dann warf sie den kleinen Zuschauern fröhlich und ausgelassen eine Kusshand zu. Wie ihr Gesicht strahlte!
Wie ihre Augen blitzten, wie ihre Lippen leuchteten, wie sie sich zärtlich an ihren Bräutigam lehnte, wie er seine Hand von der Lehne nahm und sie um ihre Schultern legte, wie sie jetzt zu einem Bild verschmolzen, wie sie nicht mehr ein Mann und eine Frau, sondern ein Paar waren. Gesine schluckte. Sie spürte für einen Augenblick den stolzen Blick Elisas, in dem Triumph war und auch ein bisschen Mitleid. Ahnte Elisa, wie elend ihr zu Mute war, hier in dem stickigen, von Kindergeruch erfüllten Zimmer, an den Wänden Buntstiftzeichnungen und auch hier das Bild von einem Prinzen, der das Mädchen auf sein Pferd hebt und mit ihr auf sein Schloss reitet, und dann feiern sie Hochzeit, das ganze Volk schaut zu.
Die kleine Sandra, die unbemerkt wieder ins Zimmer zurückgekommen war, zupfte Gesine vorsichtig am Ärmel. Ihre großen neugierigen Augen schauten zu ihr auf. »Sie weinen ja, Fräulein Gesine«, rief sie verwundert. »Warum weinen Sie denn?«
Gesine versuchte zu lächeln. Mit einer hastigen Handbewegung wischte sie die Tränen von den Wangen. »Ich weiß auch nicht, Sandra«, sagte sie leise, »vielleicht weil ich so dumm bin.«
»Aber Sie sind doch nicht dumm! Sie sind doch ganz klug! Das sagt meine Mami auch immer!«
Gesine beugte sich zu dem kleinen schokoladenverschmierten Gesicht hinunter und küsste es stumm.
Das ist das Einzige, was ich habe, dachte sie bitter. Das sind die einzigen Küsse, die ich je gebe oder je bekomme. Küsse von Kindern, die nicht meine Kinder sind. Küsse, die nichts bedeuten. Und Liebeserklärungen von Kindern, die so ewig sind wie Erdbeereis, das in der Sonne schmilzt.
Es hatte für Gesine nie einen Zweifel gegeben, dass Kindergärtnerin für sie der richtige Beruf war. Sie hatte immer Kinder geliebt, hatte immer bereitwillig mit den Kindern im Sandkasten gespielt, auch als sie selbst längst zu alt dazu war. Arglos hatte sie sich von jungen Müttern ausnützen lassen, auf die Kleinen aufzupassen, wenn sie in einer Boutique neue Kleider probierten. Hatte weinende Babys, die im Kinderwagen vor dem Supermarkt abgestellt waren, in den Schlaf geschaukelt, und die heißen Tränen eines Dreijährigen, dem die Eistüte in den Schmutz gefallen war, rührten sie schon damals.
Als Gesine, gerade zehnjährig, nach Anklung gekommen war, sprach es sich schnell unter den jungen Eltern der Nachbarschaft herum, dass Gesine als Babysitter brauchbar war. Immer bereitwillig, immer lächelnd, nahm sie jeden Auftrag an, der ihr angeboten wurde.
Sie begleitete den sechsjährigen Sohn einer berufstätigen Mutter zum Zahnarzt, hielt Krankenwache bei einem Mädchen, das am Hüftgelenk operiert worden war, sie führte die Zwillinge des Rechtsanwaltes im Sportwagen auf der Seepromenade spazieren und fütterte mit den drei kleinen Buben der Handarbeitslehrerin nachmittags die Graugänse unten im Karpfenwinkel. Mit zwölf Jahren konnte Gesine flink und professionell wie eine Säuglingsschwester Babys wickeln, füttern und baden. Mit vierzehn organisierte sie Geburtstagspartys und Laternenfeste, während ihre Schulkameradinnen den Nachmittag mit ihren Freundinnen verbrachten, Musik hörten, Pullis häkelten und die Abendkleider der Mama probierten.
Gesine hatte die vielen Aufgaben, für die sie nur sehr kärglich entlohnt wurde, wohl auch angenommen, um vor der Einsamkeit zu fliehen. Sie wusste, dass die Mädchen ihrer Klasse sie nicht besonders mochten, sie war in die verschworene Gemeinschaft von Anklunger Töchtern nie wirklich aufgenommen worden. Wäre sie interessant gewesen, oder besonders hübsch, besonders reich vielleicht, auf eine Art exotisch, dann hätte sie womöglich größere Chancen gehabt. Idole waren immer gefragt. Aber Gesine war nichts von alledem. Ein mageres, etwas grobknochiges Mädchen mit blassem Gesicht und blonden Haaren, großen Füßen und dünnen Fingern, deren Nägel oft bis ins Nagelbett abgekaut waren. So hatte sie am ersten Schultag in der Klasse gestanden und war unbarmherzig taxiert worden von ihren Mitschülern, und noch während der Lehrer sie freundlich vorstellte und durch die mittlere Tischreihe an ihren Platz brachte, spürte Gesine die Ablehnung der anderen, spürte sie, dass sie die Prüfung nicht bestanden hatte.
Die Kinder aber liebten sie. Die Babys kreischten und strampelten, wenn Gesines Gesicht sich über den Kinderwagen beugte, die kleinen Mädchen hängten sich lachend und schmeichelnd bei ihr ein, und die Jungen hielten ihr vertrauensvoll das verbogene Spielzeug hin, damit sie es wieder richten könnte. So war das immer gewesen.
Und daher hatte sie ganz automatisch diesen Weg gewählt, nach der mittleren Reife das Fröbel-Seminar, die Frauenfachschule. Und dann war es so etwas wie ein Fingerzeig gewesen, dass ausgerechnet einen Monat, nachdem Gesine das Examen gemacht hatte, eine Praktikantin im Kindergarten von Anklung ausfiel. Das Mädchen, das später die Leitung des Kindergartens hatte übernehmen sollen, hatte sich in einen Soldaten von der Fernmeldeschule verliebt und war ihm, als er in einen holländischen Ort versetzt wurde, einfach gefolgt, ohne Abmeldung. Mitten in der Nacht, als sie es vor Sehnsucht nicht mehr aushalten konnte, hatte sie ihre Koffer gepackt und war morgens mit dem ersten Zug, der die Pendler nach München brachte, abgereist.
Natürlich hatte man Gesine gebeten auszuhelfen.
Und Gesine hatte sofort zugesagt. Vier Wochen Ferien wären ohnehin mehr gewesen, als sie gebrauchen konnte, Ferien daheim, im Haus ihrer Tante, unter den argwöhnischen Blicken, die es ihr verleideten, einfach nur im Liegestuhl unter dem Apfelbaum zu liegen, auf der Margeritenwiese, die nie gemäht wurde. Keinen Tag ließ die Tante verstreichen ohne die Frage: »Und nun, Kind? Was weiter? Was soll aus dir werden?« Und Gesine antwortete immer wieder: »Ich habe meine Bewerbungen verschickt, Tante, das weißt du doch. Ich warte auf Antwort.« Deshalb war es wie eine Erlösung, als der Anruf der Gemeindeschwester kam und man ihr den Praktikantinnenplatz im Kindergarten anbot.
Es war dann nur noch eine Frage der Zeit, bis man ihr die Leitung des Kindergartens übertrug und sie feierlich in ihr Amt eingeführt wurde. Von diesem Ereignis besaß Gesine sogar ein Foto. Es zeigte sie, in einem blaugrauen Kostüm mit Faltenrock, die Haare aus der Stirn gekämmt und im Nacken lose mit einer Samtschleife zusammengebunden, als sie aus der Hand des ersten Bürgermeisters die Ernennungsurkunde entgegennahm. Sie lächelte nicht, sie machte ein sehr ernstes, fast feierliches Gesicht. Der Bürgermeister hingegen schaute jovial, geradezu väterlich, und Gesine erinnerte sich, wenn sie das Foto betrachtete, dass er hinterher die Arme um ihre Schulter gelegt und ihr aufmunternd zugeraunt hatte:
»Nun mal ein bisschen lächeln, Fräulein Lukas! Sie sind ja ganz blass! Die Aufregung, was? Na, Sie schaffen das schon! Ganz Anklung hat Vertrauen in Sie!«
Gesine war, von dem Lob oder der Verpflichtung, die sie aus diesen Worten herauslas, mit einem Mal ganz rot geworden, und vor Verlegenheit hatte sie sich schnell in den Waschraum geflüchtet, wo sie, auf dem kleinen Hocker neben dem Handtuchhalter sitzend, gewartet hatte, bis die Hitze aus ihrem Gesicht gewichen war.
Zwei Tage später war das Foto von Gesine und dem Bürgermeister sogar in der Zeitung unter der Rubrik Leute.
Die Tante hatte ihre Lesebrille aus dem Futteral genommen, die Zeitung auf der Glasplatte des Wohnzimmertisches, die auf einem Korbgeflecht auflag, geglättet und lange studiert. Schließlich hatte sie den Kopf gehoben, die Lesebrille abgenommen, ihre Großnichte angeschaut und gesagt: »Das ist ein Glück, dass das Papier von diesen Zeitungen so schlecht ist. So sieht man wenigstens nicht dein Muttermal.«
Aber was hätte Gesine anderes erwarten sollen aus dem Mund ihrer zänkischen, ewig nörgelnden Tante? Etwas Nettes vielleicht, etwas Aufmunterndes, womöglich ein Wort, aus dem so etwas wie Liebe oder Anteilnahme oder gar Anerkennung sprach? Gesine hatte ihre Tante nur schweigend angeschaut, ihr das Zeitungsblatt aus der Hand genommen und es nach oben in ihr Zimmer getragen, wo sie es zusammenlegte und in der Schublade verbarg.
Andere Leute aus Anklung hingegen beglückwünschten Gesine zu ihrem beruflichen Erfolg. Bea, die Buchhändlerin, bei der Gesine mindestens einmal in der Woche hereinschaute, um eine Bestellung aufzugeben, kam um den Tisch herum und nahm sie spontan in den Arm. »Das haben Sie verdient, meine Liebe«, sagte sie warm, »niemand sonst hat diese Stelle so verdient wie Sie!«
Und die Frau vom Schlachtermeister, die ihr ein Stück Leberkäs herunterschnitt und es zwischen die Hälften einer Semmel legte, sagte: »Ich find’s wirklich pfundig, dass Sie den Job gekriegt haben, Fräulein Lukas.« Und während sie Gesines Frühstück in Alufolie wickelte, fügte sie hinzu: »Zum nächsten Kinderfest sagen’s mir zeitig genug vorher Bescheid. Da spendier ich Grillwürschtl für die ganze Bande. Gell, das wär doch was?«
Cäsar Bansun kam, um der Tante die Spritze gegen ihre Schmerzen zu geben. Während er sich die Hände im Bad wusch und Gesine ihm ein frisches Handtuch zurechtlegte, sagte er: »Das ist endlich mal eine vernünftige Entscheidung vom Gemeinderat. Sind ja echt über ihren eigenen Schatten gesprungen. So ein junges Mädchen schon zur Leiterin zu machen! Aber Sie haben’s wirklich verdient, Gesine. Ich hoff’ nur im Namen all der kleinen Krabben, für die Sie jetzt sorgen müssen, dass nicht gleich ein Prinz daherkommt, der Ihnen schöne Augen macht und einen Heiratsantrag. Und dann sind Sie weg, und Anklung hat wieder keine Kindergärtnerin.«
»Die und heiraten?«, rief die Tante, die im Nebenzimmer ihre Strümpfe hochrollte, »eher geht die Welt unter, als dass meine Nichte einen Mann bekommt! Die will doch keiner! Schauen Sie sich doch mal die hübschen fröhlichen Mädchen von Anklung an! Da wär doch einer dumm, der sich bei der Auswahl gerade für Gesine entscheiden würde – so ein stilles abweisendes Mädchen, das nicht lächelt, keine Feste besucht, sich nicht zurechtmacht, auch wenn sie kreidebleich ist, und die Abende immer nur in ihrem Zimmer verbringt!«
Der Doktor trocknete sich die Hände ab und schaute Gesine an. »Stimmt das?«, fragte er. »Sitzen Sie immer allein in Ihrem Zimmer?«
Gesine wurde rot. Aber nicht so sehr aus Verlegenheit wie aus Zorn gegen ihre Tante, die sich immer in Dinge einmischte, die sie nichts angingen. »Ich lese eben«, sagte sie. »Ich lese gern. Ist das vielleicht schlimm?«
»Aber was sie liest!« Die Tante war über den Flur gehumpelt gekommen, jetzt stützte sie sich keuchend an der Badezimmertür ab. »Märchen!«, sagte sie verächtlich, »immer bloß Märchen! Sie ist ja nicht gescheiter als die kleinen Knirpse in ihrem Kindergarten.«
Cäsar lächelte. »Märchen«, sagte er, »sind doch etwas Schönes. Etwas für die Fantasie, die unsere Welt bunt macht. Eine gute Medizin gegen das graue Einerlei des Alltags.«
Gesine sah Cäsar überrascht an. »Das klingt schön, wie Sie das erklären«, sagte sie.
»Ach, gehen Sie, Doktor!« Die Tante klopfte mit dem Stock gegen den Türrahmen. »Setzen Sie dem Kind bloß nicht noch Flausen in den Kopf!«
Gesine brachte den Doktor zur Tür. Cäsar Bansun legte leicht seinen Handrücken gegen ihre Wange. »Ich mag Sie, Gesine. Sie sind ein lieber Mensch.«
Hätte Gesine Tagebuch geführt, stünde nun unter dem 15. Mai des Jahres 1982: »Heute war der Doktor wieder bei der Tante. Zum Abschied hat er mir etwas Schönes gesagt. ›Ich mag Sie. Sie sind ein lieber Mensch.‹ Wie gut das tut, so etwas zu hören. Wie wohl einem dabei wird. Wie ich mich danach sehne, dass eine liebevolle, zärtliche Stimme sagt: ›Ich mag dich. Du bist ein lieber Mensch.‹ Ein lieber Mensch. Aber bin ich das wirklich?«
»Schön hat er wieder gesprochen, der Herr Pfarrer«, sagte Katharina Lidl, während sie an der Seite von Dr. Bansun durch das Mittelschiff der Kirche auf den Ausgang zuging.
Dr. Cäsar Bansun, Hausarzt der Familie Lidl seit Jahrzehnten, verbeugte sich leicht. Um seine Lippen spielte ein Lächeln. »Ganz recht, liebe Katharina, er spricht sehr schön. Wenn wir ihn nicht hätten, wären die Kirchen noch ein wenig leerer als sie ohnehin schon sind.«
»Leer?«, fragte Katharina entsetzt, »du willst doch nicht behaupten, unsere schöne Josefskirche sei leer?«
»Nun, nicht gerade ganz leer, aber doch so ziemlich. Bis auf die zehn, zwölf Damen aus dem Altenstift, die kostenlos im Gemeindebus zum Gottesdienst gefahren werden, verirrt sich kaum noch einer in die Kirche.« Er zwinkerte ihr zu. »Sonntags sitzt man eben lieber bei Lidls auf dem Bootssteg oder nimmt an einer Regatta teil oder trifft sich zum Brunch im Seehotel, um den neuesten Klatsch auszutauschen. Das ist alles viel amüsanter und viel spannender als die Predigten eines tattrigen Pfarrers, die sich seit siebenundzwanzig Jahren mit schöner Regelmäßigkeit wiederholen.«
Katharina wurde rot. »Du bist wirklich nicht sehr liebenswürdig, Cäsar! Wahrhaftig, ich glaube, je älter du wirst, desto bissiger werden deine Reden. Du mit deiner scharfen Zunge!«
»Mag sein, aber meine Zunge wird auch sensibler. Neulich habe ich zum Beispiel in eurem Rehragout das Maggi durchgeschmeckt.«
Katharina blieb stehen. Sie starrte ihn an. »Also das ist doch …«
Dr. Bansun lächelte amüsiert. »Beleidigt?«
»Nicht beleidigt! Aber … aber … wie soll ich sagen … also«, Katharina ließ das kleine Petit-Point-Täschchen auf- und zuschnappen. »Nun, es ist irgendwie ungehörig, mir so etwas zu sagen. An diesem Tage. Ich meine, immerhin bist du unser Gast, nicht wahr?«
Cäsar Bansun verneigte sich. »Ich bin tief in deiner Schuld, verehrte Katharina. Bitte verzeih’. Wieder einmal sind die Gäule mit mir durchgegangen.«
»Ach was. Du bist und bleibst ein altes Lästermaul. Bea hat schon recht mit dem, was sie sagt.«
Cäsar Bansun hob die Augenbrauen. »Was sagt denn unsere verehrte Buchhändlerin? Die Frau für alle Gelegenheiten nenne ich sie immer. Sie hat für jeden einen Spruch parat. Ganz Anklung liegt vor ihr wie ein aufgeschlagenes Buch. Da interessiert es mich doch, was die gute alte Bea sagt.«
»Erstens ist sie nicht so alt, wie du sie gerne machen möchtest«, sagte Katharina schnippisch, »und zweitens hat sie etwas sehr Treffendes über dich gesagt. Wenn du nicht wieder heiratest, hat sie gesagt, wirst du noch wunderlich werden. Ein wunderlicher alter Junggeselle. Ein Hagestolz, über den die Leute lachen. Ein Sonderling.«
Cäsar Bansun warf den Kopf zurück und lachte. »Das ist köstlich!«, prustete er los. »Wirklich ganz, ganz köstlich! Meint sie am Ende, dass sie mich vor dem Schicksal, ein Sonderling zu werden, bewahren muss?«
Katharina sah den Doktor von der Seite an. Wie er da schmunzelnd stand, seine Bartenden zwirbelte und sie amüsiert betrachtete, konnte man wirklich nie so sicher sein, was er eigentlich über sie alle dachte. Wenn er ernst war, musste man befürchten, dass dies seine Maske war, um eine ironische Heiterkeit zu verbergen, lachte er jedoch, hatte man immer das Gefühl, er wolle niemanden wissen lassen, wie ernst es ihm sei.
»Allerdings«, sagte Katharina spitz, »hat Bea einmal so etwas angedeutet.«
»Dass sie mich nehmen würde? Mich wunderlichen Junggesellen? Hat sie das wirklich gesagt? Ich dachte, Bea hat endgültig die Nase voll von der Ehe. Drei missratene Versuche – das sollte doch für ein Menschenleben reichen, nicht wahr?«
»Psst«, machte Katharina hastig, »da kommt sie.«
Beide wandten Bea das Gesicht zu. Cäsar Bansun verbeugte sich leicht, nahm Beas Hand und führte sie an die Lippen.
Bea lächelte amüsiert. »Einen Handkuss, Doktor? Nur, weil Sie heute einen Smoking tragen? Sie sind doch sonst nicht so förmlich.«
»Mag sein, dass ich schon ein bisschen sonderlich werde, wie?«
»Cäsar!«, zischte Katharina wütend. »Was soll das!«
Bea schaute argwöhnisch von einem zum anderen. »Habt ihr Geheimnisse?«
»Unsinn. Als wenn in Anklung überhaupt irgendeiner ein Geheimnis haben könnte.«
Bea nickte. »Das ist wahr. Ein Städtchen mit 10 000 Einwohnern, und trotzdem hat man das Gefühl, es wären nur ein paar hundert und man hätte mit ihnen allen bereits im Sandkasten gespielt. An Elisa zum Beispiel kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie sie zu mir in den Laden kam und ein Bilderbuch haben wollte, ein Bilderbuch mit ganz vielen süßen Häschen, wie sie sagte.«
»Da sieht man’s wieder! Die Kleine hat schon früh angefangen und gewusst, wie begehrt die süßen Häschen bei den Männern sind. Hat sich ja auch sicher nicht beklagen können, möchte ich meinen. Ich schätze, alle Anklunger Jungen zwischen achtzehn und fünfundzwanzig waren irgendwann mal in Elisa verliebt.«
Bea lachte. »Das klingt ja ziemlich frivol, lieber Doktor. Und ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag! Wie fühlst du dich denn so als Brautmutter, Katharina? Ein bisschen gerührt? Ein bisschen wehmütig?«
Katharina nickte. Sie tupfte mit einem Batisttuch ihre Nase ab. »Ganz merkwürdig fühle ich mich. Irgendwie glücklich, aber auch wieder voller Unruhe. Man weiß ja nie … ich meine, nichts gegen unseren Ronnie, er ist so wahnsinnig verliebt in Elisa, er trägt sie wirklich auf Händen, er liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab …«
»… aber man weiß eben nichts über ihn«, sagte Bea mitfühlend, »er ist hier ein Fremder.«
Katharina nickte. »Und dazu noch Amerikaner! Hätte Elisa nicht genug Auswahl hier in Anklung gehabt? Wieso einen Amerikaner? Ausgerechnet unsere Elisa!«
Cäsar Bansun verfolgte die Unterhaltung nur noch mit halbem Ohr. Er betrachtete Bea, als sähe er sie heute zum ersten Mal. Wie alt mochte sie sein? Vierzig? Fünfundvierzig? Oder vielleicht noch nicht einmal vierzig? Bea hatte kurze Haare, in denen dünne, graue Strähnen schimmerten. Ein fescher Bubikopf. »Intellektueller Haarschnitt«, dachte Cäsar Bansun. Der Schmuck kunstgewerblich, ein großer, tropfenförmiger Bernstein an einer silbernen, kunstvoll geschmiedeten Kette. Sie war schlank, wahrscheinlich hatte sie sogar eine sehr gute, eine fast jugendliche Figur, aber wie bei vielen Frauen ihres Typs kam man nie auf die Idee, diese Figur interessant oder aufregend zu finden. Sie trug ein Seidenkleid, das weich und weit geschnitten war, ohne aufregende Einblicke, ohne Verlockungen, ohne Aufforderungen. Die Schuhe waren etwas zu plump und zu derb, aber sicherlich bequem für jemanden, der den ganzen Tag hinter dem Ladentisch stehen muss.
Muss sie das eigentlich?, dachte Cäsar Bansun, den ganzen Tag hinter dem Ladentisch stehen? Er meinte sich plötzlich zu erinnern, sie immer sitzend gesehen zu haben, auf dem kleinen Chippendale-Stuhl, hinter dem Verkaufstisch, über Kataloge gebeugt und mit feiner, dünner Schrift Nummern und Titel auf Bestellzettel schreibend.
Wenn sie sprach, bewegte sie immerzu ihre Hände. Sie hatte schöne, schmale Hände, rund gefeilte Nägel mit einem sehr weißen Mond. Sie trug einen Topas an der rechten Hand, vielleicht ein wertvolles altes Stück. Er, Cäsar Bansun, hatte seinen Frauen nie einen Topas oder Bernstein geschenkt. Er liebte Smaragde und Saphire. Entweder, sagte er sich, man schenkt wirkliche Edelsteine, oder man lässt das ganze Schenken bleiben. Silberreifen hatte er nur verschenkt, als er Pennäler war und mittellos.
Bea hatte einen kleinen Beutel aus taubenblauem Nappaleder wie eine Umhängetasche über die Schulter gehängt. Es sah sehr jugendlich aus, wie sie dieses Täschchen so mit den Hüften schwenkte, es erinnerte ihn an die Studentinnen im Englischen Garten oder auf der Münchener Leopoldstraße. Er hatte das Gefühl, dass dieses Täschchen irgendetwas bedeutete, ein Symbol für etwas, das Bea besonders liebte oder das ihr besonders wichtig war – aber es war nur so eine Ahnung, nicht mehr. Intellektuellen Frauen wie Bea, die anthroposophische Bücher lasen und sich die Vorträge von Geisteswissenschaftlern anhörten, hatte Cäsar Bansun noch nie seine Aufmerksamkeit geschenkt. »Wer weiß«, murmelte er, während er ihren Schritten folgte und feststellte, dass sie sehr schmale Fesseln hatte, »wer weiß. Vielleicht wechsle ich mal das Fach.«
Gesine fühlte, dass ihre Geduld an diesem Tag eher als sonst erschöpft war. Gereizt reagierte sie auf das zänkische Geschrei der übermüdeten Kinder, die darauf warteten, abgeholt zu werden. Das klägliche Wimmern von Katja, die in der Ecke hockte und nicht aufstehen wollte, machte Gesine an diesem Tag besonders nervös. Dabei wusste sie, dass Katja ein Sorgenkind war, dass sie besonders viel Geduld und Liebe und Fürsprache brauchte seit der Hüftgelenksoperation. Nur mit Mühe schaffte sie es, jene Ruhe und Heiterkeit zu bewahren, die die Kinder wie selbstverständlich von ihr erwarteten.
Während sie sich bückte, um Fabian zum hundertsten Mal zu erklären, wie man aus den Schnürsenkeln eine Schleife bindet, während sie Jens die Nase putzte und Katjas Tränen behutsam trocknete, dachte sie, vielleicht bin ich einfach nur urlaubsreif. So etwas gibt es doch. Davon sprechen doch alle Leute. Ich brauche eben Abwechslung, Tapetenwechsel, eine Pause. Aber bis zu den Sommerferien im August war es noch lang. Jetzt war Mai. Der Wonnemonat. Der Heiratsmonat …
Nie hatte sie sich so schwer und so müde gefühlt.
Oder war Traurigkeit vielleicht das bessere Wort für diese Müdigkeit? War es nicht diese quälende, bohrende Frage, die sie den ganzen Tag über beschäftigte, an diesem Tag, an dem in Anklung die Hochzeitsglocken läuteten? Diese Frage: Warum nicht ich? Warum heiraten sie alle, eine nach der anderen, und ich bin immer noch allein?
Sie öffnete die Eingangstür zum Kindergarten. Ab vier Uhr wurden die ersten Kinder abgeholt, und das ewige Schlagen der Tür, das Quietschen der Scharniere machte sie so nervös, dass sie lieber vorher öffnete. Außerdem drängelten sich die Kinder meist schon im Flur, ungeduldig darauf wartend, dass endlich das ersehnte Auto vor der Gartentür hielt, die Mama ausstieg und sie ihr jubelnd entgegenlaufen konnten, das kleine Brottäschchen hinter sich herschleifend.
Kais Mutter, eine junge Frau, der man ihr häusliches Glück ansah, gab Gesine strahlend die Hand. »Alles in Ordnung? Der Kleine hat Ihnen hoffentlich keinen Kummer gemacht?«
Gesine lächelte. »Sie wissen doch, der Kai lacht den ganzen Tag. Hat immer etwas, über das er sich freuen kann.«
Kai strahlte seine Mami an. »Heute gab es Reibekuchen mit Apfelmus, Mami! Ich hab’ fünf Stück gegessen! Hier, fühl’ mal meinen Bauch!«
Die Mutter der kleinen Maren wollte auch noch ein paar Worte mit Gesine wechseln. Vielleicht dachte sie, dass die Kindergärtnerin so etwas von einer pflichtbewussten Mutter erwartete. »Sie sieht immer so blass aus, unsere Maren. Finden Sie nicht? Dabei bekommt sie jeden Morgen frisch gepressten Karottensaft! Glauben Sie, ich sollte einmal Doktor Bansun fragen, ob etwas mit ihr nicht in Ordnung ist?«
»Aber ich will nicht schon wieder zum Doktor, Mami! Ich bin doch ganz gesund!«
Dann kam Jasminas Mutter, die Frau des Zahnarztes. Wie immer außer Atem, mit flüchtig erneuertem Makeup, zerzausten Haaren und einer brennenden Zigarette, deren Asche achtlos auf den Boden fiel. Sie drückte ihre Tochter mit einer solchen Heftigkeit an sich, küsste und herzte sie, als müsse sie das Kind für irgendetwas um Verzeihung bitten. Sie benutzte ein indisches Parfum, das schwer und süß in ihren Kleidern hing. Die Elfenbeinringe an ihrem Arm klapperten leise, als sie Jasminas Pferdeschwanz hochband.
»Mami«, fragte Jasmina schmeichelnd, »geht ihr heute mit mir ins Kino? Ihr habt es mir versprochen!«
»Ich weiß noch nicht, Herzchen.« Die Stimme der jungen Frau klang immer noch etwas atemlos. »Das müssen wir mit Papi besprechen.«
Jasminas Mutter, mit ihren schweren dunklen Haaren und den besonders kleinen Füßen, die immer in zierlichen hochhackigen Lackschuhen steckten, erinnerte Gesine an die Frauen, die Maupassant beschrieben hatte. Biedere Bürgerfrauen aus der Provinz, die heimlich in den Morgenstunden, während sich der ahnungslose Ehemann an den Zähnen seiner Patienten zu schaffen machte, ihren Leidenschaften nachgingen. Morgens, wenn sie Jasmina in den Kindergarten brachte, war sie so fahrig, so ungeduldig, als könne sie es gar nicht erwarten, wieder ins Auto zu steigen und zu einem Rendezvous zu fahren.
Gesine ertappte sich dabei, dass sie sich diese Frau in den Armen ihres Geliebten vorstellte, wie sie die Zärtlichkeiten jenes Mannes genoss, und sie spürte so etwas wie Neid.
Jasminas Mutter hob den Kopf und blickte Gesine mit einem Ausdruck an, als hätte sie ihre Gedanken erraten. Gesine fühlte, wie sie errötete, und sie war froh, als Jasmina ihre Mutter ungeduldig an der Hand zerrte und rief: »Mami, Mami, nun komm doch endlich!«
Väter, die ihre Kinder abholten, warteten meist im Wagen. Sie hupten energisch, wenn die Kinder nicht gleich gelaufen kamen, öffneten dann die Wagentür am Beifahrersitz und ließen die Kinder in den Fond klettern.
Manche Mütter hatten Fahrgemeinschaften gebildet, dann verschwanden immer gleich vier oder fünf Kinder und es wurde schlagartig etwas stiller.
Gegen fünf Uhr waren nur noch Sonja und Xandi da, die beiden »Spätheimkehrer«, wie Gesine sie in Gedanken immer nannte. Die beiden fünfjährigen Kinder saßen stumm, die Brottaschen im Schoß, auf den kleinen Stühlchen im Vorraum und starrten durch die offene Tür auf die Straße. Jedes Mal, wenn sie ein Autogeräusch hörten, sprang eines von ihnen auf und lief erwartungsvoll zur Tür. Gesine sah, wie Sonja immer kleiner wurde vor lauter Warten. Die Kinder taten ihr leid.
»Ihr beiden«, sagte sie, »setzt euch ein bisschen zu mir ins Büro. Da gibt es eine Zauberuhr. Die zaubert eure Mamis ganz schnell her!«
»Wirklich? Eine richtige Zauberuhr?«, fragte Xandi begeistert. Sonja gab ihm einen Puff. »Du bist doof! Zauberuhren gibt es doch gar nicht!«
Scheu standen die beiden Kleinen an der Schwelle zum Büro. Normalerweise war es ihnen verboten, in dieses Zimmer zu gehen. Ehrfurchtsvoll strichen die Kinder am Bücherbord entlang. Sonja zeigte mit dem Finger auf ein Buch mit gelbem Buchrücken. »Da steht das Märchen drin, das Fräulein Gesine uns heute vorgelesen hat.«
»Stimmt«, sagte Xandi. »Von dem kleinen Daumen.«
»Däumelieschen heißt das doch! Und die ist ein Mädchen.« Sie trat auf Zehenspitzen hinter Gesines Schreibtischstuhl. »Dürfen wir uns mal die Bilder aus dem Buch ansehen, Fräulein Gesine?«
Gesine nickte. »Natürlich. Aber seid vorsichtig. Bücher muss man gut behandeln.«
Ganz behutsam hoben die beiden Kinder das Märchenbuch aus dem Regal. Dann setzten sie sich einträchtig nebeneinander auf den Boden und begannen zu blättern …
Sonjas und Xandis Mutter erschienen fast gleichzeitig. Etwas atemlos standen sie in der Tür.
»Ach, da seid ihr ja! Wir haben uns schon gewundert, dass ihr uns nicht entgegengelaufen seid! Hoffentlich waren sie brav, Fräulein Lukas!«
Gesine lächelte. »Sie sind schon brav, die beiden. Aber es kränkt sie, dass sie immer als Letzte abgeholt werden.«
»So?« Sonjas Mutter zog die Augenbrauen hoch. »Aber Sonja weiß doch, dass ich nicht eher hier sein kann.«
»Du kannst wohl!« Sonja blätterte heftig weiter in dem Buch.
»Aber ich hab doch immer Tennisstunde von vier bis fünf, mein Herzchen!«
»Bah! Das blöde Tennis!«
»Also Sonja! Was sind das für Töne! Fräulein Lukas wird mit dir schimpfen, wenn du so etwas sagst!«
Ich?, dachte Gesine bitter, ich soll mit dem Kind schimpfen, weil seiner Mutter die Tennisstunde so wichtig ist?
Wenn ich einmal Kinder habe, dachte Gesine. Wenn ich einmal Kinder habe …
Xandis Mutter drehte sich in der Tür noch einmal um. »Haben Sie etwas gesagt?«
»Ich?« Gesine fuhr sich mit den Händen durch die Haare. »Habe ich etwas gesagt? Ich glaube nicht.« Sie lächelte gequält.
Als endlich alle Kinder fort waren und alle Mütter, als man nicht mehr das Quietschen der Reifen, das Anlassen der Motoren draußen hörte, atmete Gesine erleichtert auf. Wie schwer einem manchmal die Arbeit ist. Und wie der Wille, seine Arbeit doch zu einem guten Ende zu bringen, manchmal alle Kraft aus dem Körper zieht und schwere Beine und einen müden Kopf zurücklässt. Gesine ging durch die Räume des Kindergartens, kontrollierte, ob die Fenster verschlossen waren, prüfte die Türen, die zum Spielplatz hinausführten, und ließ die Rollos herunter.
Gesine liebte diesen Augenblick, wenn alle fort waren und die beiden Putzfrauen noch nicht mit ihren Eimern und Schrubbern diesen besonderen Geruch aus den Zimmern vertrieben hatten. Da war eine Mischung aus Kinderseife und Kinderschweiß, da schmeckte man noch das süße, klebrige Zeug auf der Zunge, das sie immerzu lutschten und in irgendwelchen Taschen versteckt hatten: Himbeerbonbons und Salmiak-Pastillen, Mars und Bounty. Jemand hatte ein Glas umgekippt, in dem die Aquarellpinsel gesteckt hatten. Eines der Kinder hatte mal wieder seine Strümpfe ausgezogen und sie einfach unter dem Spieltisch liegen lassen, blaue Strümpfe mit gelben Ringeln.
Das Spielzimmer sah heute erstaunlich ordentlich aus. Die Holzklötze zu einem Berg in der Ecke getürmt, der Kran und der Bagger an ihrem Platz im roten Bord, sogar die Ringe und Bälle lagen in der roten Holzkiste. Bestimmt hatte Katja das alles aufgeräumt, Katja war die »Mutter vernünftig«, wie Gesine sie bei sich nannte. Ein Mädchen, das allein bei der Mutter aufwuchs, einer Frau, die bereits vierzig war, als das Kind kam, und die Katja früh zu einem vernünftigen, ernsten Mädchen erzogen hatte.
Gesine erinnerte sich an Katjas Tränen, an das leise Wimmern, das sie so gereizt hatte, und sie wünschte sich, dass sie Katja jetzt zu sich nehmen, auf den Schoß setzen, sie streicheln und ihr ganz leise eine Geschichte erzählen könnte, eine Geschichte von Elfen und Feen und Kobolden und Zauberern.
Einmal hatte Gesine so eine Geschichte erzählt, und Katja hatte ganz gebannt zugehört. Am nächsten Tag hatte sie ihren zerzausten Teddy mitgebracht und gesagt: »Ich hab meinem Teddy alles erzählt von der bösen Fee und den schönen Elfen. Aber ich kann es nicht so gut wie du. Kannst du dem Teddy die Geschichte auch noch einmal erzählen? Dann kann ich mich mit ihm abends im Bett immer darüber unterhalten.«
Im Bastelzimmer lagen die neuesten Werke der Kinder zum Trocknen auf dem langen Holztisch. Sie hatten mit Wasserfarben gemalt. Alle Mädchen hatten plötzlich malen wollen, ein Brautpaar wollten sie malen, eine schöne Braut und Blumen und eine Kutsche und eine Kirche.
Gesine schaute sich die Bilder noch einmal an. Da gab es Bräute mit roten, runden Gesichtern, aber auch welche mit ganz schmalen, die fast nur aus Mund und Nase bestanden. Manche hatten große Entenfüße und andere nur kleine spitze Dreiecke, die wie Lanzen unter dem bauschigen Kleid hervorsahen. Die meiste Mühe hatten die Mädchen sich mit dem Malen des Brautkleides gegeben, mit den Blumenkränzen, die sie der Braut ins Haar gewunden hatten. Mit dem Bräutigam hatten sie sich weniger Mühe gegeben, ein Strichmännchen im schwarzen Anzug, das eher finster dreinblickte. Aber zu den Füßen des Brautpaares wucherten meist Blumen, und über den Köpfen schwebte ein Engel.
Schon an der Einfahrt zum Seehotel, gleich dort, wo die Wagen von der Hauptstraße abbogen und den geschwungenen Weg zum Parkplatz herunterfuhren (natürlich ein überdachter Platz, der die Limousinen der Gäste vor Sonne und Regen schützte), schon an der Einfahrt sah man das große, handgemalte Schild, verziert mit Blümchen und Schleifchen, auf dem stand Geschlossene Gesellschaft. Die Wagen, die im Schrittempo den beiden Kutschen folgten, hatten die Antennen mit weißen Tüllstreifen geschmückt, die Fahrer nahmen die Hand nicht mehr von der Hupe, Leute am Straßenrand winkten, es war fast wie in Italien, heiter und fröhlich unter einem blassblauen, freundlichen Himmel. Das Portal mit einem Myrtenkranz umrandet, Flieder in hohen Bodenvasen rechts und links von der Tür, Flieder in der Eingangshalle, vor dem alten venezianischen Spiegel, den Tobias Lidl günstig aus einer Konkursmasse ersteigert hatte, Blumengestecke auf der mit weißem Damast festlich gedeckten Tafel. Die Kellnerinnen in hellblauen Dirndln, mit weißen Spitzenschürzen, weißen Söckchen und neuen gestärkten Häubchen, erwarteten die Gäste mit einem Drink auf dem silbernen Tablett.
Es war in der Tat eine geschlossene Gesellschaft, nicht einmal hundert Familien gehörten zum »inneren Kreis«, zu jenen Leuten, die Anklung zu dem gemacht hatten, was es jetzt war: eine feine wohlhabende Gemeinde in romantischer Umgebung, an einem See gelegen, dem man Trinkwasserqualität bescheinigte und in dem sich Felchen, Renken, Aale und Forellen tummelten. Hügeliges, waldiges Umland, saftige Weiden und stattliche Höfe, am stattlichsten natürlich das Gut Werenalp, 100 Hektar Ackerland und Weiden, 2000 Stück Mastvieh, Karpfenteiche und eine Hochwildjagd, das alles gehörte Thimo von Hasse. Der promovierte Jurist verbrachte seine Zeit auf der Jagd, beim Fischfang, er las komplizierte ökologische Abhandlungen, er pflegte seinen Weinkeller, züchtete Rosen und umsorgte seine Frau, Bettina von Hasse, die seit Jahren bettlägerig war und an einer Krankheit litt, die in der Fachwelt offenbar noch keinen Namen hatte.
Thimo von Hasse gehörte selbstverständlich auch zu dieser geschlossenen Gesellschaft, er ließ sich begleiten von Thomas, seinem jüngsten Sohn. Thomas war zur Welt gekommen, als Bettina von Hasse längst geglaubt hatte, das Klimakterium erreicht zu haben. Sie erholte sich nie von dem Schock, in diesem Alter noch ein Kind gebären zu müssen, und lebte seither zurückgezogen in den oberen Gemächern, liebevoll gepflegt von Gerda, dem Hausmädchen, und väterlich betreut von Dr. Bansun, der immer wieder mithilfe schön klingender Tinkturen und Pillen versuchte, ihren Lebensmut neu zu entfachen.
Thomas war nun zwanzig Jahre alt, ein Jahr älter als Elisa, die mit ihm das Gymnasium besucht hatte und die er einmal, bei einem Pfänderspiel an ihrem dreizehnten Geburtstag, auf die Lippen geküsst hatte. Es war sein erster Kuss gewesen, der erste Kuss, den er nicht auf die weichen, nachgiebigen Lippen seiner Mutter, nicht auf die herbe, rasierte Wange seines Vaters gedrückt hatte, sondern auf den festen, lachenden Mund eines Mädchens. Die Erinnerung an diesen Kuss trug er wochenlang wie einen Schatz mit sich herum, durchlebte den Augenblick immer wieder, durchatmete, durchträumte ihn. Elisa zeigte ihm nie, dass dieser Kuss auf sie einen ähnlich starken Eindruck gemacht hatte. Für sie schien es selbstverständlich zu sein, einen Jungen zu küssen, er hatte sie beobachtet hinter dem Bootshaus ihres Vaters, im dunklen Flur, der den Hoteltrakt mit dem Restaurant verband, an die Wand gepresst, von einem Jungen aus ihrer Schulklasse, er hatte sie beobachtet, wenn sie im knappen Bikini auf dem Bootssteg lag, die Beine gespreizt, die Lippen feucht, die Augen glänzend. Seine Sehnsucht nach diesem Mädchen wuchs von Sommer zu Sommer, von Hitze zu Hitze, und eines Tages erwachte er schweißgebadet von einem Traum, in dem er sie besessen hatte, ganz.
»Einen Penny für deine Gedanken, mein Sohn«, sagte sein Vater, der ihn eine ganze Weile von der Seite beobachtet hatte, den Sektkelch in den Händen drehend.
Thomas zuckte zusammen. Schuldbewusst sah er seinen Vater an. »Meine Gedanken? Ich glaube nicht, dass sie auch nur einen Penny wert wären.«
»Wenn du dich hättest sehen können, wie du die Braut angestarrt hast – wenn du das gesehen hättest …«
Thomas wurde rot. »Ich? Die Braut angestarrt? Das war mir gar nicht bewusst.«
»Angestarrt, als wolltest du sie ausziehen. Als wolltest du sie erwürgen, was weiß ich«, Thimo lächelte amüsiert. »Hat es einmal eine Geschichte zwischen dir und Elisa gegeben?«
Eine Geschichte, dachte Thomas bitter, so etwas heißt dann später eine Geschichte, dabei war es viel weniger und trotzdem viel mehr.
»Nun«, sagte sein Vater leichthin, »gleichviel. Was geht es mich an. Kinder erzählen ihren Eltern ohnehin nur das, was sie erzählen wollen. Die wichtigen Dinge bleiben alle ungesagt, habe ich recht?«
»Kann sein.« Er sah seinem Vater ins Gesicht. »Aber ich habe nichts vor euch zu verbergen. Ich habe keine Geheimnisse vor euch.«
»Schön, mein Sohn. Oder vielleicht nicht schön? Wäre vielleicht besser, du hättest ein paar Geheimnisse? Deine Mutter und ich, wir machen uns manchmal Sorgen um dich.«
»Sorgen? Was für ein Unsinn! Dazu besteht doch überhaupt kein Anlass.«
»Wir fragen uns, mein Sohn, warum du nie ein junges Mädchen zu uns heraufgebracht, warum du uns nie eine kleine Freundin vorgestellt hast. Das ist doch sehr hübsch, so eine junge, scheue Liebe. Deine Mutter und ich hätten das sehr genossen, teilzuhaben an diesem Glück.«
Eine zornige Röte überzog Thomas’ Gesicht. »Wie du redest, Vater! Wenn es das nun nicht gibt, was du das junge Glück nennst?«
»Wirklich nicht? Keine Tanzstundenliebe? Keine Schülerliebe? Keine Tennisfreundin? Keine Liebelei, die bei der Regatta entflammt ist? Nichts, gar nichts?«
»Gar nichts«, sagte Thomas hart.
»Oh, das tut mir leid, mein Sohn. Ich bedaure das sehr. In meiner Erinnerung waren eigentlich diese Jahre immer die allerschönsten. Unbeschwerte Liebesgeschichten, ohne Verantwortung, ohne Konsequenzen. Ich dachte immer, das sei heute auch noch so.« Er schaute zu dem Brautpaar hinüber, das jetzt gerade auf die Terrasse trat und mit einer Gruppe von Gästen lachend anstieß. »Manchmal beneide ich den alten Tobias um dieses Glück, Zeuge einer so jungen schönen Liebe zu sein.«
Thomas presste die Lippen zusammen und schwieg. Auch er schaute zu Elisa hinüber, dann zu Ronnie. Er fragte sich zum hundertsten Male, warum Elisa diesen Kerl geheiratet hatte. Diesen Fremden. Elisa, die zwischen den begehrtesten jungen Männern hätte wählen können. Zugegeben, Ronnie war ein schöner Mann. Er hatte breite Schultern und einen wilden Mund. Er hatte aufregende, weit auseinanderstehende Augen und buschige Brauen. Sein Bartwuchs war so stark, dass er sich zweimal täglich rasieren musste, und das Jackett des seidenen Smokings spannte über den breiten muskulösen Schultern. Ein stattlicher Mann. Sicher einer, der gut war im Bett, »ein toller Hecht«, wie seine Freunde immer sagten.
»Willst du das Brautpaar nicht beglückwünschen?«, fragte sein Vater jetzt, wieder mit diesem forschenden Blick, der ihn nie losließ, unter dem er sich immer unsicher und linkisch fühlte, der ihn verfolgte und lähmte, wo er auch ging.
Thomas bahnte sich einen Weg durch die Gäste, grüßte mit einem scheuen, kurzen Lächeln nach rechts und links, einmal stieß er mit einer Kellnerin zusammen, die Gläser klirrten leise, und er hielt erschrocken inne. »Verzeihung«, murmelte er. Die Kellnerin lachte ihn unbekümmert an. »Nichts passiert, Herr von Hasse.«
Wieder fühlte er den Blick seines Vaters im Rücken, er wurde rot, er ärgerte sich über dieses Missgeschick, über seine übertriebene Reaktion, es war ja wirklich nichts passiert, er hätte wirklich nicht so erschrocken zu reagieren brauchen.