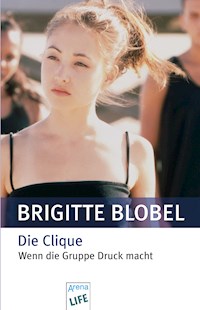5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Mirko lächelte und zog Mona zu sich heran. "Wir müssen das Gleiche fühlen", flüsterte er ihr ins Ohr, "wir müssen im gleichen Augenblick den Kick kriegen. Du wirst sehen, das ist das Größte, was du je erlebt hast." "Glückspillen" nennt Mirko die kleinen bunten Smarties, die vieles so viel leichter machen. Mirko, der Mona nie wehtun würde. Viel zu spät erkennt sie, wie falsch das Spiel ist, das Mirko mit ihr spielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Brigitte Blobel
Party Girl
Roman
Für Lilli
Veröffentlicht als E-Book 2010 © 2009 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: knaus. Büro für konzeptionelle und visuelle identitäten, Würzburg, unter Verwendung eines Fotos von Thomas Northcut © gettyimages E-Book-Umsetzung: CMS – Cross Media Solutions GmbH, Würzburg ISBN 978-3-401-80032-5
www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
1. Kapitel
Eigentlich hätte das, was mit Mona in diesem Herbst passierte, gar nicht geschehen dürfen. Eigentlich war es so gut wie ausgeschlossen, dass ausgerechnet sie in so eine Situation geraten würde.
Denn die Wahrheit war, dass Mona sich aus Partys gar nichts machte. Sie gehörte nicht zu den Mädchen, die abends unruhig wurden, sich stundenlang im Bad einschlossen. War keine, die sich vorher mit Musik zudröhnte, um schon mal in Stimmung zu kommen, die Anlage volle Power aufgedreht, immer auf der Suche nach einem Kick, einer Erregung, einem Abenteuer. Sie hatte keine Angst, etwas zu verpassen. Der Gedanke, dass sie vielleicht mit siebzehn oder achtzehn immer noch Jungfrau wäre und noch nie gekifft hätte, bereitete ihr keine schlaflosen Nächte.
Sie hatte auf dem einzigen Popkonzert, auf dem sie je gewesen war, keinen hysterischen Anfall bekommen, als der Sänger mit seiner Gitarre einen Geschlechtsakt simulierte, während Julia, die sie zu dem Konzert mitgenommen hatte, hysterisch kreischend ihre Bluse aufriss. Mona hatte auch noch nie einem Jungen heimlich einen Liebesbrief in seine Jackentasche geschmuggelt. Hatte überhaupt noch nie wegen eines Typen heiße Tränen vergossen, Herzrasen oder schlaflose Nächte gehabt.
Sie hielt sich selber, was Sex und Drogen betraf, für eine Spätentwicklerin. Sie war nicht stolz darauf, aber sie fand es okay.
Kuschelfeten und Schmusepartys, auf denen man wild herumknutschte und tanzte wie in Trance, fand Mona eher gruselig. Das alles wirkte so hysterisch! So überdreht! So wollte sie nicht sein. Sie tanzte zwar gern, behielt ihre Bewegungen dabei aber immer unter Kontrolle.
Wenn sie sah, wie sich ein Pärchen küsste, war ihr der Anblick grundsätzlich peinlich und es sah so stümperhaft aus! Nie so romantisch wie im Film. Sie litt mit dem Mädchen, wenn sie beobachtete, wie der Typ seine Zunge zwischen ihre Zähne schieben wollte, sie konnte förmlich die klebrigen Küsse schmecken, die verschwitzten Hände fühlte sie am eigenen Körper. Und sie schämte sich insgeheim dafür, dass das Mädchen das gierige Gefummel des Jungen kichernd über sich ergehen ließ als Preis dafür, dass sie ein Paar waren. Oder weil sie viel zu zugedröhnt war, um zu merken, was der Typ mit ihr anstellte.
Mona hatte bislang noch keinem Jungen erlaubt, seine Zunge in ihre Mundhöhle zu stecken und ihr unter den Pulli zu fassen. Sie stellte sich die ganze Fummelei zwischen Jungen und Mädchen schleimig und ein bisschen eklig vor. Das ganze Liebeskummer-Gerede ihrer Klassenkameradinnen ging ihr entsprechend auf den Nerv.
Gab es etwa nichts Wichtigeres, über das man reden konnte?
Gab es nichts anderes, worüber man sich Gedanken machen sollte?
Die Welt war voller Wunder und Überraschungen, aber die meisten in ihrem Alter merkten das nicht. Die Pubertät hatte sie fest im Griff und machte aus ihnen, wie Mona fand, peinliche, dumpfbackige, dampfende und schwitzende Teilnehmer einer Freak-Show.
Vor jeder Party, vor jedem Freitagabend das gleiche Theater: Alle Mädchen in heller Aufregung. Wie eine Schar aufgeregter Hühner tauschten sie Neuigkeiten über Schönheitstipps oder Aufputschmittel aus, über Pickelprobleme, Haarstyling oderSmokey Eyes,und wenn die Party vorbei war, ging das Getuschel und Gekicher, das Geraune und Geflüstere auf dem Schulhof nahtlos weiter. Wie viele Kleine Feiglinge wer runtergekippt hatte und welche Alkopops am besten wirkten. Oder welche Pillen-Kombi einem den schönsten Kick bescherte.
Das Ganze ging Mona furchtbar auf den Wecker. Wenn Verena, die neben ihr saß, bei jedem neuen Pickel vor einer Party einen Weinkrampf bekam; wenn Marcia am Tag nach der Party anfing, alle zehn Sekunden heimlich ihre SMS zu checken. Welcher Typ wollte ein Date mit ihr? Wer war scharf auf sie? Und: Wer konnte sich überhaupt noch an gestern Nacht erinnern?
Und ständig die immer gleiche Frage, die so ernsthaft und leidenschaftlich diskutiert wurde, als ginge es darum, wer den nächsten Nobelpreis für Medizin bekommen sollte: Was ziehst du an?
Als gäbe es nichts Bedeutenderes auf der Welt, als sich darüber den Kopf zu zerbrechen, ob Push-ups einen schöneren Busen machen als normale BHs. Ob Neckholder den Busen größer oder kleiner wirken lassen. Ob Hüfthosen dick machen. Oder ob man zum Minirock Western-Boots tragen kann. Oder Wollsocken zum Sommerkleid.
Mona interessierte sich nicht für Klamotten. Vielleicht, weil ihre Mutter für ihre Kleider ein Extrazimmer von den Ausmaßen eines Gymnastikraums brauchte. Okay, ihre Mutter war Schauspielerin. Und eine Schauspielerin ist das, was sie darstellt. Klamotten sind da so etwas wie eine zweite Haut oder dritte Haut oder Zwiebelhaut. Etwas, aus dem man sich schälen kann, je nachdem, was im Film gerade gebraucht wird oder was die Öffentlichkeit interessiert. Eine Schauspielerin muss einfach wissen, was IN ist und was OUT. Mona wusste das natürlich auch, sie lebte ja nicht auf dem Mond, aber sie hatte sich eine Null-Bock-auf-Klamotten-Attitüde angeeignet. Schon um sich zu beweisen, dass sie nicht einfach nur ein Abziehbild ihrer berühmten Mutter war. Sondern anders.
Mona war irgendwann klar geworden, dass sie auch in neuen Klamotten immer noch das gleiche Gesicht hatte, mit den gleichen graublauen Augen, den dichten Augenbrauen, der leichten Stupsnase und den Grübchen in den Pausbacken, die sie schon als Säugling gehabt hatte. Andere Klamotten würden da auch nicht groß weiterhelfen. Das hatte sie irgendwann so beschlossen und dabei wollte sie nun bleiben. Ein bisschen Konsequenz im Leben konnte nicht schaden, fand sie.
Ihre Mutter verstand das nicht. Wenn sie einmal einenganzen Nachmittag Zeit für ihre Tochter hatte, was selten genug der Fall war, schlug sie automatisch einen Shopping-Bummel vor.
»Wir zwei Hübschen«, sagte sie dann fröhlich, »gehen jetzt shoppen, bis die Kreditkarte glüht.«
Mona wusste, dass andere Mädchen ihren Müttern für so einen Satz um den Hals gefallen wären, aber sie zuckte nur mit den Achseln und sagte: »Können wir nicht einfach zu Hause bleiben? Und uns einen gemütlichen Nachmittag machen?«
Miriam Charlotte Preuss lächelte dann irgendwie schief, seufzte, nannte sie »Darling«, fand, dass Mona viel mehr aus sich machen könnte, wenn sie nur ein bisschen Spaß an Klamotten und Frisuren hätte.
Und startete einen neuen Versuch. Setzte sich neben Mo-na aufs Sofa, strich ihr eine Haarsträhne aus der Stirn(Ich weiß,dachte Mona,du findest meine Frisur todlangweilig)und sagte schmeichelnd: »Komm. Du wünschst dir doch bestimmt irgendetwas. Jedes Mädchen in deinem Alter hat Wünsche.«
Meistens entstand so eine Situation, wenn Charlotte von einem langen Außendreh zurückkam und ein schlechtes Gewissen hatte, weil ihre Tochter so lange allein gewesen war. Weil ihr die Zeit fehlte, sich um Mona zu kümmern. Aber neue Klamotten, fand Mona, machten das auch nicht wieder wett. Das sollte ihre Mutter irgendwann mal begreifen.
Sie waren vor vier Monaten nach München gezogen. Bis zu ihrem Umzug war Mona Mitglied bei den Pfadfindern gewesen, sie war mit ihnen in Norwegen gewandert und hatte auf einer Nordseeinsel ihre erste Jurte aufgebaut. Sie spielte ziemlich gut Handball und ziemlich schlecht Klavier, sie hatte Schwimmtraining und bekam Latein-Nachhilfe. Sie hatte weder Angst vor Spinnen noch vor irgendeinem anderen Gewürm oder Getier. Die Motten, die in ihrem Zimmer die Schreibtischlampe umschwirrten, schlug sie nicht tot, sondern lockte sie mit dem Strahl einer Taschenlampe ins Freie. Eine Spinne in der Badewanne spülte sie nicht einfach durch den Ausguss fort, sie fing sie mit einem Stück Papier, über das sie dann einen Becher stülpte, behutsam ein und setzte sie auf der nächsten Grünfläche wieder aus. Es machte ihr nichts aus, abends aus dem Keller eine Flasche Apfelsaft zu holen, auch wenn sie wusste, dass das Deckenlicht einen Wackelkontakt hatte und dass im Gang eine Mäusefalle stand. Sie schlief bei offenem Fenster und ohne Licht.
Nur in der Zeit nach dem Tod ihres Vaters hatte Mona immer ein kleines Lämpchen neben ihrem Bett brennen lassen, falls die Seele ihres Vaters sie besuchen wollte oder sein Schutzengel kam, um ihr zu sagen, dass sie sich nicht so viele Sorgen machen sollte. Das Lämpchen sollte ihnen den Weg zeigen.
Von Zigarettenrauch wurde Mona übel. Sie schnitt ihre Fingernägel immer sehr kurz, um nicht wieder in Versuchung zu kommen, daran herumzukauen. In der letztenZeit zog sie sich, wenn sie nervös war, stattdessen eine Haarsträhne vor die Augen und prüfte, ob sie Spliss hatte. Wenn sie ein Haar entdeckte, dessen Enden sich teilten, zog sie es kurzerhand aus.
Sie konnte, seit sie einmal die Sommerferien bei ihrer Tante Ische im Sauerland verbracht hatte (es war der Sommer, als sie bei ihrem Vater den Krebs entdeckten und die Eltern sie wegschickten, um selber erst einmal mit dem Gedanken klarzukommen, dass sie nicht zusammen alt werden würden), großartige Marmelade kochen. Ihre Himbeermarmelade und ihr Brombeergelee waren unschlagbar. Sie liebte es, Kochbücher über exotische Gerichte zu lesen, und versuchte, sich dabei vorzustellen, wie die Sachen schmeckten. Sie interessierte sich für aussterbende Tiere und Pflanzen und hatte in ihrem Computer zahlreiche Ordner angelegt, die sie einmal in der Woche auf den neuesten Stand brachte. Zu wissen, welche Versuche unternommen wurden, um bedrohte Tiere zu retten, fand sie wichtig.
Mona war fünfzehn Jahre alt. In zwei Monaten würde sie sechzehn werden und sie hatte es kategorisch abgelehnt, eine Party zu geben, auch wenn ihre Mutter alles versuchte, um sie dazu zu überreden.
Mona stellte sich ihren Geburtstag ganz anders vor: Nur zwei, drei Freundinnen einladen, vielleicht Tabea und Julie, schön essen gehen, am liebsten zu dem Japaner, bei dem man an einer niedrigen Bar saß, auf der Tellerchen mit rohem Thunfisch, mit Lachs-Negiri und Avocado-Sushi auf einem Fließband vorbeizogen. Kleine Suppentassen undaufgespießte Tempura-Shrimps. Man benutzte Löffelchen aus bemaltem Porzellan und rot lackierte Stäbchen und spülte das köstliche Essen mit Mengen von duftendem Jas-min-Tee herunter. Das war für Mona Glück.
Mona wusste, dass viele in ihrer neuen Klasse ganz wild darauf waren, zu ihr nach Hause zu kommen, um zu sehen, wie man so lebte, wenn man eine berühmte Mutter hatte. Und sie verstand das.
Aber deshalb gleich eine Party für alle organisieren?
Mona reichte schon der Gedanke an die Vorbereitungen, die mit so einer Feier verbunden waren: Gästeliste aufstellen, Einladungen schreiben (natürlich möglichst originell), überhaupt musste man ja erst mal das richtige Motto für die Party finden! Als Kind war Mona zu Harry-Potter-Partys eingeladen worden, bei denen die Mädchen alle wie Hermine aussehen wollten und die Jungen kleine runde Drahtbrillen mit Fensterglas trugen. Und zu unsäglichen Faschingsfesten, wo man wahlweise als Prinzessin oder als Hexe auftrat. Jetzt waren Beach-Partys oder Pool-Partys am angesagtesten, als Alibi dafür, möglichst wenig anzuziehen und schön sexy auszusehen.
Dann das Einkaufen. Wie viel Zeit, Geld und Energie das kostete, endlose Kisten mit Getränken zu schleppen, danach Häppchen zuzubereiten oder riesige Bleche mit Pizza zu backen, eine anständige Musikanlage aufzubauen (denn mit der richtigen Musik steigt und fällt die Party), schummrige Ecken zu schaffen, jede Menge Kissen auf dem Fußboden auszubreiten, Lampions aufzuhängen oder Lichterketten. Und wenn man dann völlig erledigt von den Vorbereitungen war, musste man auch noch während der Party für gute Stimmung sorgen, die Tanzmuffel in Schwung bringen, Getränke anbieten, das Buffet immer wieder auffrischen und lächeln, lächeln, lächeln.
Das alles nur, um spät in der Nacht die Zigarettenstummel vom Fußboden aufzuheben, zerknautschte Kissen auszuschütteln, volle Müllsäcke nach unten zu schleppen, die Küche zu wischen, Cracker-Krümel aus den Sofaritzen zu klauben, und wenn man Pech hatte und ein paar Typen zu viel Zeug durcheinandergetrunken hatten, auch noch die Kotze von den Badezimmerkacheln zu wischen. Nein, danke.
»Erklär es mir«, hatte ihre Mutter gesagt. »Ich will verstehen, warum du keine Lust hast, deinen Geburtstag groß zu feiern.«
Mona hatte nur den Kopf geschüttelt. Es war einfach so.
»Was bist du nur für ein merkwürdiges Mädchen!«, seufzte Charlotte in solchen Momenten theatralisch. »Als ich in deinem Alter war, da hab ich nur von einer Party zur anderen gelebt! Da hatte etwas anderes als Spaß überhaupt keinen Platz in meinen Kopf.«
»Tut mir leid«, schnappte Mona dann regelmäßig zurück, »dass ich nicht so bin wie du.«
»Darum geht es doch gar nicht, Darling.« Monas Mutter seufzte wieder. Immer wenn sie »Darling« sagte, war das von einem tiefen Seufzer begleitet. »Wir haben diese wunderbare Wohnung, die für Teenie-Partys zwar eigentlich zu edel ist, aber du dürftest das alles hier benutzen, weil ich dich liebe und dir wünsche, dass du Spaß hast . . .«
Das war die Stelle, an derMonajedes Mal am liebsten geseufzt hätte. Ihre Mutter lebte in einer künstlichen Welt, in der Filmwelt, der Theaterwelt. Von echten Teenie-Partys hatte sie einfach keine Ahnung. Was Charlotte kannte, waren die Feten, die Jugendliche im Film feierten, und die waren nicht so versifft, nicht so stinkend, chaotisch, nicht so entnervend und oft enttäuschend wie in Wirklichkeit. Noch an ihrer alten Schule, in der achten Klasse, hatte Mo-na eine Kellerfete im Haus eines Klassenkameraden erlebt, die vollkommen aus dem Ruder gelaufen und zu einem Albtraum geworden war. Jeder hatte eine Flasche hochprozentigen Alkohol dabeigehabt, jeder etwas anderes, man machte sich gar nicht erst die Mühe, aus Gläsern zu trinken, obwohl Gläser da waren, sondern hielt sich einfach nur die Flasche an den Mund und ließ sie kreisen. Als die Party sowieso schon in die Anarchie abgeglitten war, vermischten die Jungen alle Reste zu Cocktails und tranken das Zeug, angefeuert von ihren Kumpels, auf ex. Als dann noch fremde Typen auftauchten, die von der Party Wind bekommen hatten und mitfeiern wollten, waren alle schon zu betrunken, um sich gegen die Eindringlinge zu wehren. Die waren zugedröhnt und benahmen sich wie die Schweine.
Mona hatte irgendwann Jakobs kleinen Bruder entdeckt, schluchzend und wie ein Knäuel zusammengerollt unter dem Esstisch. Mischa hatte ihn einfach aus seinem Bett geworfen, um sich selbst hineinzulegen und kurz darauf alles vollzukotzen . . .
Nie hatte Mona mit ihrer Mutter darüber gesprochen. Alle waren sich damals stillschweigend einig gewesen, dass kein Wort über die Chaosparty nach außen dringen sollte. Aber manchmal, wenn Charlotte wieder einmal begann, von Teenie-Partys bei ihnen in der Wohnung zu schwärmen, wurde Mona richtig wütend. Sie musste sich, nach allem, was in der Vergangenheit passiert war, dann sehr zusammenreißen, um ihre Mutter das nicht spüren zu lassen.
Mona liebte ihre Mutter, sie hätte sich nicht eine Minute eine andere Mutter gewünscht als diese Miriam Charlotte Preuss, auch wenn das Zusammenleben mit einer kapriziösen Schauspielerin nicht immer leicht war. Selbst die Zeitungen benutzten, wenn sie über ihre Mutter schrieben, das Wort »kapriziös«. Mona hatte es vorher gar nicht gekannt, fand aber, dass es den Sachverhalt ziemlich gut traf. Kapriziös zu sein, ist ja nichts Schlimmes. Ist ja auch irgendwie liebenswert, ein bisschen schwierig, ein bisschen chaotisch, ein bisschen selbstverliebt, aber immer so lebendig.
Sie waren all die Jahre gut zurechtgekommen, sie und Charlotte, in leichten und schweren Zeiten. Sie hatten zusammen monatelang Tag und Nacht geweint, als Monas Vater auf einmal diese furchtbare Krankheit bekam und jeden Tag weniger wurde, immer unscheinbarer, bis er nur noch ein kleines bleiches Männlein in dem weißen Krankenhausbett war und nicht einmal mehr ihren schüchternen kleinen Händedruck erwidern konnte.
In der Zeit nach dem Tod ihres Mannes war Charlotte eine andere geworden. Hatte sich abgekapselt, alle Interviews abgesagt und ihrer Agentin verboten, irgendwelche Fotos rauszugeben. Sie wollte niemanden sehen. Nicht einmal Mona war an sie herangekommen.
Das war so fremd und beängstigend und Mona gab sich dafür die Schuld.
Denn sie waren nicht dabei gewesen, als Monas Vater gestorben war, alle beide nicht. Es war dann auf einmal so schnell gegangen. Auch die Ärzte hatten das nicht vorhersehen können.
Charlotte war an dem Morgen nach Berlin geflogen – zu einem wichtigen Casting. Sie wollte es eigentlich absagen, aber Monas Vater hatte darauf bestanden, er hatte gesagt: »Ich werde dich noch in diesem Film sehen, das verspreche ich dir.«
Als das Telefon bei den Preuss’ in Hannover klingelte, waren nur Mona und das Au-pair-Mädchen zu Hause gewesen. Das Au-pair-Mädchen war in Monas Zimmer gestürzt und hatte ihr einfach den Hörer hingehalten. Man teilte ihr mit, dass Dr. Alexander Preuss um 14 Uhr 44 gestorben sei.
Zehn Minuten später rief der erste Journalist an. Er klang besorgt und verständnisvoll (seltsamerweise konnte Mona sich bis heute an seine Stimme erinnern).
Und sie war einfach am Telefon zusammengebrochen. Obwohl Charlotte ihr eingeschärft hatte, nie mit Journalisten zu reden, sondern einfach nur an die Agentur zu verweisen, hatte Mona ausgerechnet bei diesem Gespräch allesvergessen, was sie sonst immer beherzigte. Sie war am Telefon zusammengebrochen. Sie hatte hemmungslos geschluchzt und sich furchtbar einsam gefühlt.
Am nächsten Morgen stand es in der Bild-Zeitung: Unter der SchlagzeileHat diese Frau kein Herz?erfuhr ganz Deutschland, wie die zwölfjährige Mona Preuss tief verstört über den Tod ihres Vaters einen Nervenzusammenbruch erlitt, während die berühmte Mutter in Berlin eiskalt an ihrer Karriere feilte. Daneben ein Foto von Charlotte, wie sie am Arm eines bekannten deutschen Schauspielers ein Berliner Nobelrestaurant betrat. Sie hatte in die Kamera gelächelt.
Dass das Foto viel früher entstanden war, interessierte niemanden. Allein die Tatsache, dass sie nicht am Sterbebett ihres Mannes gewesen war, genügte der Presse.
Es war der Anfang einer wahren Schlammschlacht in den Boulevard-Zeitungen gewesen und sie hatte sich bis weit nach der Beerdigung hingezogen.
Miriam Charlotte Preuss hatte danach jede Rolle abgelehnt. Sie wollte nicht mehr drehen, nicht auf der Bühne stehen, sie vergrub sich. Und dabei liebte sie ihren Beruf, sie war mit Leib und Seele Schauspielerin, sie war auf dem Gipfel des Erfolgs gewesen. Aber sie hatte sich selbst und Mona geschworen, nie wieder zuzulassen, dass ihr Leben in die Öffentlichkeit gezerrt wurde.
Doch es ging ihr nicht gut damit. Es ging ihr sogar entsetzlich schlecht. Denn in Wahrheit konnte Charlotte nicht ohne Publikum leben.
Mona war es schließlich gewesen, die ihre Mutter überredet hatte, wieder zu spielen, und allmählich wurde Charlotte wieder zu der, die Mona kannte. Mona wusste jetzt, dass Charlotte das Theater und den Film brauchte wie andere Menschen die Luft zum Atmen.
Inzwischen war Charlotte erfolgreicher als je zuvor, auch wenn sie nun extrem darauf achtete, ihr Privatleben strikt von der Schauspielerei zu trennen. Es gelang ihr nicht immer, aber sie hatte Wege gefunden, mit den Journalisten umzugehen.
Mona hatte sich erst wieder daran gewöhnen müssen, Charlotte manchmal wochenlang nicht zu sehen, wenn sie auf einem Auslandsdreh war. Aber sie beklagte sich nie. Sie war froh, dass ihre Mutter wieder arbeitete. Und sie sprach nie über dieses Vakuum, das sich in ihrem Inneren ausbreitete, wenn Charlotte sie aus irgendeinem fernen Land anrief. Und wie sie sich dann nachts zusammenkrümmte wie ein Baby und ihre Hände in die Magengrube presste, um die Leere irgendwie auszufüllen.
Es half ihr, dass Charlotte, egal wo sie drehte, jeden Tag anrief, um alles Wichtige mit Mona zu besprechen. Mona erzählte ihrer Mutter freimütig alles, was sie gerade beschäftigte. Sie hatten voreinander keine Geheimnisse. Charlotte hatte ihr, als Mona zwölf war, sogar angeboten, sieCharlottezu nennen, stattMamazu sagen. Um klarzumachen, dass sie nicht nur Mutter und Tochter, sondern gleichwertige Partner, die besten Freundinnen waren. Aber Freundinnen würde Mona in ihrem Leben noch viele haben können. Eine Mutter hingegen gab es nur einmal. Deshalb hatte Mona weiterMamagesagt.
Nur als Charlotte ihr vorgeschlagen hatte, nach München zu ziehen, weil sie dann in der Nähe ihrer Agentin wäre und in der Nähe der wichtigen Filmproduzenten, da hatte Mo-na insgeheim gedacht: Nein!
Aber sie hatte es nicht gesagt. Sie hatte nicht gesagt: »Ich will aber nicht weg aus Hannover! Ich möchte bei meinen Pfadfindern bleiben! Meine Pfadfindergruppe ist mein eigentliches Zuhause!«
Sie hatte es nicht gesagt, weil sie das ihrer Mutter nicht antun wollte.
Das war also Mona, sieben Wochen und einen Tag vor ihrem sechzehnten Geburtstag. Sie brauchte keine Partys, um glücklich zu sein, sie fühlte sich wohl, wenn sie allein durch die Stadt streifte, sie verstand, warum ihre Mutter nicht zu Hause sein konnte, sie vermisste nichts im Leben, sie kam klar.
Und natürlich wusste sie insgeheim, dass all das eine Lüge war. Mona belog sich selber. Aber es ist für niemanden leicht, mit sich selber ganz und gar ehrlich zu sein.
Sie konnte doch nicht zugeben, dass sie schüchtern war. So schüchtern, dass sie jahrelang trainiert hatte, nicht gleich ein puterrotes Gesicht zu bekommen, wenn jemand sie ansprach.
Dass sie Angst hatte, in ihrer neuen Klasse auf die Leute zuzugehen. Mit den Mädchen zu quatschen, herumzualbern, shoppen zu gehen, Partys zu feiern.
Und dass sie Angst vor Jungs hatte.
Das war überhaupt das Allerschlimmste. Mona hatte Jungen schon immer für fremde, geheimnisvolle Wesen gehalten, die sich anders bewegten, anders sprachen und über andere Dinge lachten. Heimlich beobachtete sie die Jungen in ihrer Umgebung, versuchte herauszufinden, was sie dachten, was sie fühlten, warum sie einmal schroff und dann wieder ganz verlegen waren. Warum sie sich für Fußball und Formel 1 interessierten, aber nicht für Ballett. Früher als Kind hatte es sie fasziniert, als ein Nachbarjunge, den sie ziemlich nett gefunden hatte, plötzlich in den Stimmbruch gekommen war. Sie war damals neun, er war fünfzehn oder so. Von einem Tag zum anderen sprach er auf einmal so rau und dunkel wie sein Großvater! Es musste schrecklich für ihn gewesen sein. Um ihn nicht in Verlegenheit zu bringen, hatte Mona nicht mehr mit ihm gesprochen.
Oder eine andere Frage, die sie zu der Zeit brennend interessiert hatte: Wieso wachsen den Jungen in der Pubertät plötzlich Haare im Gesicht?
Genauer, in der unteren Gesichtshälfte, am Kinn und auf der Oberlippe, manchmal nur ganz dünn und farblos wie ein Flaum, aber wenn man genau hinsah – und Mona hatte es trainiert, verstohlen GENAU hinzusehen –, konnte man doch sehen, an welchen Stellen die Barthaare zuerst zum Vorschein kommen würden.
Warum wuchsen Barthaare nur am Kinn und nicht zum Beispiel auf der Stirn?
Das waren Fragen, die Mona nicht einmal mit ihrer Mutter besprochen hatte. Sie fürchtete, dass Charlotte sie auslachen würde. Sie wollte in dieser Angelegenheit(Warum Jungen so anders sind?)aber nicht ausgelacht werden.
Und aus dem gleichen Grund konnte sie jetzt, fünf Jahre später, auch nicht zugeben, dass sie sich eigentlich danach sehnte, einen Freund zu haben. Jemanden, dem man eine SMS schicken konnte, der einen morgens in der Schule anlächelte und mit dem man auf dem Nachhauseweg ein Eis essen ging, wenn man Lust dazu hatte. Jemand, der neben einem saß und ganz anders roch!
Mona mochte es, wie Jungen rochen. Manchmal, wenn sie neben einem Jungen wie Dennis oder Benjamin saß (die beide besonders gut rochen), in Physik zum Beispiel, wenn der Raum wegen eines Experimentes abgedunkelt worden war, dann schloss sie die Augen und zog ganz tief diesen Geruch ein, der von ihnen ausging.
Ihre Schüchternheit war der wahre Grund, warum sie sich so dagegen wehrte, eine Geburtstagsparty zu veranstalten oder mit den anderen abends in Klubs oder auf Konzerte zu gehen.
Schon deshalb, weil sie panische Angst hatte, dass kein Junge sie ansprechen oder mit ihr tanzen würde. Dass die Jungen sie überhaupt nicht wahrnehmen würden. Durch sie hindurchschauten, als sei sie aus Glas.
Manchmal, wenn sie mal wieder aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen eine Einladung abgesagt hatte, lag sie im Bett, starrte an die Decke und stellte sich vor, dass sie als bleiches mauergraues Mauerblümchen in der Ecke stand,während alle anderen mit einem Jungen tanzten oder schmusten oder lachten oder irgendeinen Blödsinn machten. Nur sie war als Einzige von allen Mädchen allein. MAUERBLÜMCHEN war ein altmodisches Wort, sie hatte über so ein Mädchen mal in einem Roman gelesen (später war aus der Romanfigur eine ALTE JUNGFER geworden, die von ihrer Familie recht und schlecht geduldet wurde, bis sie sich freiwillig in ein Kloster zurückgezogen hatte). Mona war elf gewesen, als sie das Buch gelesen hatte, und weil sie damals gerade mit Röteln im Bett lag und gruselig aussah, so gruselig, dass sie sicher war, in ihrem ganzen Leben nie wieder unter Menschen gehen zu können, hatte sich das Wort MAUERBLÜMCHEN in ihrem Kopf festgesetzt, in der Datei für Katastrophen-Begriffe wie ATOMPILZ, HEILIGER KRIEG, AIDS, ERDBEBEN, AUSCHWITZ oder TSUNAMI.
So war die Situation mit Mona, knapp zwei Monate vor ihrem sechzehnten Geburtstag, und sie hatte keine Ahnung, wie sich daran je etwas ändern könnte. Bis zu dem Tag, als sie Mirko begegnete.
2. Kapitel
Es war an einem ganz gewöhnlichen Mittwoch im September, als die Sonne schon sehr schräg stand und Mona wie üblich vom Sport nach Hause kam (mittwochnachmittags hatten sie immer Schwimmtraining im Olympiabad), in ihrer Sporttasche nach dem Hausschlüssel suchte, dabei überlegte, ob sie sich einen Tee oder lieber einen Kakao kochen sollte, bevor sie mit den Hausaufgaben begann, und mit nichts Besonderem rechnete. Weil noch nie irgendetwas Besonderes passiert war, wenn sie vom Sport nach Hause kam. Schon gar nicht in München-Bogenhausen, in einer Straße mit herrschaftlichen Stadtvillen aus dem letzten Jahrhundert, mit verschnörkelten Balkonen und Erkern, Eingangstüren so hoch wie Kirchenportalen und marmornen Treppenhäusern, die so blank waren, dass man automatisch daran dachte, die Schuhe auszuziehen, wenn die Eingangstür hinter einem zufiel.
Auf einem der Blumenkübel, die die Straße säumten, saß ein Typ und streckte sein Bein aus, als sie vorbeiging. Einfach so. Und bevor sie sich darüber aufregen konnte, taumelte sie schon und versuchte verzweifelt, ihr Gleichgewicht zu halten, als jemand sie fest um die Taille fasste und in ihr Ohr raunte: »Immer schön aufpassen im Straßenverkehr. Denn das Leben ist voller Fallgruben.«
Mona wandte den Kopf und blickte in zwei kohleschwarze Augen, die lustig blitzten. Als Nächstes nahm ihre Nase einen Geruch wahr, der ihr Herz ein bisschen schneller schlagen ließ. Wie eine Mischung aus Dennis und Benjamin, aber dennoch ganz anders. Aufregender.
Und deshalb störte es sie auch nicht, dass der Junge mit den kohleschwarzen Augen sie etwas länger festhielt als nötig, und sie fragte sich auch nicht, was er sich dabei gedacht hatte, ihr ein Bein zu stellen, und was er überhaupt hier vor ihrer Haustür wollte.
Und wer er überhaupt war.
Sie fand alles gut so, wie es war. Als hätte sie insgeheim immer damit gerechnet, dass es eines Tages genau so passieren würde. Mehr noch: Als hätte sie schon ungeduldig darauf gewartet. Sie stellte keine Fragen, sie war nicht verwundert, nicht misstrauisch, ihre Antennen, die sonst so gut funktionierten, waren abgestellt. Sie verhielt sich wie ein Schaf, das sich freut, weil es auf eine saftige Kleewiese geführt wird. Das Schaf weiß nicht, dass am Ende der Wiese ein Abgrund lauert. Es blökt fröhlich, saugt den saftigen Kleegeruch ein und beginnt zu grasen. Und bewegt sich dabei unmerklich immer weiter auf den Abgrund zu.
Der Junge lächelte, streckte die Hand aus und sagte: »Hi, ich bin Mirko.«
»Und ich bin Mona«, sagte sie. Und lächelte dabei wie ein Schaf.
Mirko wohnte nicht in ihrem Viertel. Er sagte, er wohneweiter draußen, am Stadtrand, und deutete vage mit der Hand nach Norden. Er besuchte deshalb natürlich auch eine andere Schule, aber was für eine Schule das war, erfuhr Mona nicht.
Sie waren ans Isarufer gegangen. Er hatte es vorschlagen und Mona hatte genickt, als ob sie jeden Tag mit einem fremden Typen am Isarufer spazieren gehen würde.
Mirko hatte sich Monas Sporttasche über die Schulter gehängt. Sie hatten fast direkt vor ihrer Haustür umgedreht, auf der Maximilianbrücke die Isar überquert und gingen nun auf der anderen Seite durch die Grünanlagen.
»Was machst du für Sport?«, fragte er.
»Nur schwimmen. Im Olympiabad.« Sie lächelte.
»Sport ist Mord«, sagte Mirko. »Hat Churchill gesagt. Englischer Politiker.«
»Ich weiß, wer Churchill war«, sagte Mona. »Jedenfalls ungefähr. Wir sind in Geschichte gerade beim Zweiten Weltkrieg. Was nehmt ihr gerade durch?«
Mirko überhörte die Frage.
»An dem Typ gefällt mir nur der Satz über den Sport. Andererseits – Churchill hat geraucht wie ein Schlot. Und Whisky gesoffen. Macht ihn sympathisch, findest du nicht?«
Mirko trug teure silberne Nike-Sneaker und eine dunkelgraue Fleecejacke mit Kapuze, darunter ein weißes T-Shirt. Und zwar ein richtig weißes T-Shirt. Er stopfte seine weißen Klamotten also nicht mit den Farbsachen zusammen in dieMaschine. Solche Dinge fielen Mona auf, als sie neben ihm herging. Sie versuchte, sich diesem Typen, der dadurch in ihr Leben getreten war, dass er einfach ein Bein ausgestreckt hatte, irgendwie von außen nach innen zu nähern. Sie wusste von ihm ja nichts. Außer, dass er gut roch. Und eine schöne dunkle Stimme hatte, irgendwie samtweich.
Irgendwann machte er Halt, zog seine Fleecejacke aus, um sie am Isarufer auf den Kieselsteinen auszubreiten.
»Ist schön hier, oder?«, fragte er, nachdem er sich umgeschaut hatte und alles zu seiner Zufriedenheit war. »Hier sind nie viele Leute. Weiter vorn, am Isartor, da ist es immer so voll. Da hängen immer schräge Typen rum, die versuchen, Mädels abzuschleppen.« Er verzog abfällig sein Gesicht.
Mona verstand. Sie lächelte. Er war nicht so einer. Und sie auch nicht.
Sie beobachtete Mirko, während er dastand und kleine Kieselsteine über das flache Wasser flitzen ließ. Sie sah, wie sich seine Schultermuskeln, wenn er zum Wurf ausholte, unter dem T-Shirt bewegten. Mirko hatte eine Figur wie die Typen, die viel im Fitnesscenter trainierten. Unter dem rechten Ärmel lugte ein Stückchen von einem Tattoo hervor. Mona kannte niemanden, der ein Tattoo hatte, aber sie war fest entschlossen, das Gespräch nicht darauf zu bringen. Sie wollte nicht neugierig sein.
Er drehte sich zu ihr um. Seine Augen wurden ein bisschen schmaler, entweder weil er gegen die untergehende Sonne gucken musste, oder weil er sie ganz genau musterte.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
Mona wurde rot. Sie fühlte sich ertappt. »Klar«, sagte sie.
Er kam zu ihr zurück und ließ sich neben sie auf die Kieselsteine fallen. Er bat sie nicht, auf der Fleecejacke Platz zu machen, obwohl sie das an seiner Stelle getan hätte, es war schließlich seine Jacke. Er blieb auf Abstand und das fand Mona auch wieder gut.
Aber der Abstand war so groß, dass sie fast schon wünschte, er würde ein bisschen näher kommen. Denn so konnte sie nur das Wasser der Isar riechen, den feuchten Moder unter den sonnenwarmen Kieseln und das Herbstlaub, das ein bisschen wie Tabak roch.
Viel lieber hätte sie eine Prise von Mirkos Geruch in die Nase bekommen.
Mirko zog einen Tabakbeutel aus seiner Hosentasche (dazu musste er die Beine ausstrecken und ein Hohlkreuz machen, weil seine Jeans so eng war) und aus der anderen Tasche ein Päckchen mit Zigarettenpapier.
»Rauchst du?«, fragte er, während er geschickt mit den Fingern ein bisschen Tabak abzupfte und es auf einem Zigarettenpapier-Blättchen verteilte, das Blättchen dann anleckte und zusammenrollte.
Mona schüttelte den Kopf.
Mirko schaute sie lächelnd an. »Nie geraucht?«, fragte er.
»Nur mal probiert«, sagte Mona. »So aus Spaß.«
»Und wie war das?«, fragte Mirko. Er hatte sich die Zigarette auf die Unterlippe gelegt und da blieb sie, während er sprach, als klebte sie daran fest.
Er spielte ein bisschen mit dem Feuerzeug herum, ohnedie Zigarette anzuzünden. Es war ein silbernes Feuerzeug und es sah irgendwie so aus, als wenn es ziemlich viel Geld gekostet hätte.
»Na ja«, sagte Mona, sie lächelte. »Ich weiß nicht mehr.«
»Wie alt warst du?«
»Elf oder so. Zu jung eben.«
Mirko lehnte sich zurück und stützte sich auf den Ellenbogen ab, er hatte ihr sein Gesicht vollkommen zugewandt und schaute sie interessiert an. »Ich hab schon mit neun angefangen.«
Mona lachte. »Mit neun!«
»Ja. Und dann gleich zehn Zigaretten am Tag. Die erste Zigarette habe ich meinem großen Bruder geklaut und heimlich geraucht, das war wie ein Trip, weißt du, das war geil. Ich wusste beim dritten Zug, dass ich davon nicht wieder loskomme. Ich hab meinen Bruder von da an nach Strich und Faden beklaut. War echt nicht gut. Aber mit neun hast du einfach nicht genug Geld.«
»Stimmt«, sagte Mona. Sie überlegte, wie viel Taschengeld sie damals bekommen hatte. Es fiel ihr nicht ein. Geld war nie ein Thema bei ihnen gewesen. Sie hatte immer bekommen, was sie brauchte. Und geheime Wünsche hatte sie nie gehabt.
»Tja.« Mirko ließ das Feuerzeug aufflammen. »Wie gesagt: Das Leben ist voller Fallgruben.« Er grinste. Er schenkte ihr sein blitzendes Lächeln aus kohleschwarzen Augen. Es war, als schickte die Sonne in ihren letzten Minuten noch einmal ganz warme Strahlen und hüllte sie damit ein.
»Als mein Bruder es endlich bemerkte, war natürlich die Hölle los.«
»Was hat er gemacht?«
»Na, was wohl? Ich war grün und blau. Am ganzen Körper. Der hat mich richtig rangenommen, der Scheißkerl. Ich meine, es waren bloß verdammte Zigaretten! Ich kriegte drei Tage meinen Arsch nicht aus dem Bett.«
Mona versuchte, sich das vorzustellen. Sie lächelte schief. Irgendwie gelang es ihr nicht.
Mirko blies Rauchkringel in die Luft. »Das war der Tag, an dem ich mir geschworen hab, mich verhaut nie wieder jemand«, sagte er. »Auch keiner aus der eigenen Familie. Auch nicht der Vater. Nie wieder.«
Er schaute den Rauchkringeln nach, die wie auf einen unsichtbaren Faden gereiht in den Himmel stiegen. Einer immer größer als die anderen.
»Wie alt warst du da?«
»Elf«, sagte Mirko.
Ein zotteliger grau-weißer Hund kam auf sie zugerannt, fröhlich bellend.
Mirko sprang auf. Er drückte sofort die Zigarette zwischen den Steinen aus, bückte sich, schlug gegen seine Knie und rief: »Na, komm her. Na, komm spielen.«
Der Hund blieb stehen, schaute sich um.
Oben am Weg zwischen den hohen Kastanien stand jetzt ein Mann. Mit Lederjacke und Schal, als wär’s ein kalter Tag. Er tat nichts. Er schaute nur.
Mirko winkte dem Mann zu, da winkte der Mann zurück.
»Hey, Kumpel, komm her, ich tu dir nichts«, murmelte Mirko.
Der Hund wedelte mit dem Schwanz, er kam näher. Er blieb wieder stehen.