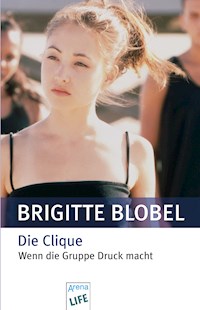4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Noch immer fühlt Leonie sich hoch im Norden fremd, wo ewig der Wind bläst, wo die Fischer in langem Stiefeln im Wasser stehen, wo manchmal an ihrer Türklinge ein Dorsch hängt, wo ihre Tochter Annkatrin aufwächst, ein aufsässiger Teenager mit roten Haaren, der weder ihr noch ihrem Vater Tjark ähnlich sieht. Die Nachbarn beäugen sie immer noch misstrauisch, nach all den Jahren, als erwarten sie, dass ihr dunkles Geheimnis irgendwann ans Licht kommt und ihnen recht gibt in ihrer Ablehnung. Und tatsächlich holt die Vergangenheit sie in diesem schönen heißen Sommer wieder ein. Sie war damals 17, von ihren Eltern nach Frankreich abgeschoben und zutiefst unglücklich. Doch da tauchte dieser Tjark auf, dieser freundliche Norddeutsche , der sie mitnahm in seine Heimat, ohne viele Fragen zu stellen, und dem sie dafür ewig dankbar sein möchte. Doch dann passiert etwas, das ihr fragiles Glück zu vernichten droht. Der Roman von Brigitte Blobel ist eine Überraschung. Sie kennt das Land, sie kennt die Charaktere dieser Menschen sehr genau. Ein seltenes, beeindruckendes und bedrohliches Buch über das Fremdsein und den Mut, bei sich selbst zu bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Brigitte Blobel
Das kalte Land
Roman
Prolog
Diese Gegend zwischen den Meeren oben am 55. Breitengrad ist nichts für zarte Seelen, schon gar nicht im Winter, und der dauert hier von November bis März.
Eine leichte Brise kann sich über Nacht zu einem Orkan auswachsen, der Bäume entwurzelt und aus dem Meer ein wütendes Ungetüm macht, das riesige Brocken Land aus der Steilküste beißt, Bäume und Sträucher in den Abgrund reißt und Teile eines eben erst angelegten Wanderweges zwischen den Heckenrosenfeldern einfach zum Absturz bringt.
Stürme von der Windstärke elf oder zwölf lassen Schiffe kentern, und im Nebel laufen Frachter aus südländischen Meeren auf Sandbänke auf. Das warnende Dröhnen der Schiffssirenen frisst sich durch die dicken Nebelschichten, welche die lange, schmale Landzunge im Belt tage-, ja wochenlang einhüllen können.
Sogar die Einheimischen vergessen dann die Umrisse ihres Dorfes, können sich kaum noch an die Linie des Horizontes erinnern oder die genaue Position des Leuchtturms bestimmen am äußersten Zipfel der Landzunge, die unter Naturschutz steht. Alles versinkt. Manche Nebel steigen im Morgendämmern wie aus dem Nichts aus dem eisigen Wasser auf, ziehen in feinen Schleifen über die Oberfläche, getrieben von leichten Nordwinden. Stauen sich am Küstenstreifen, in den flachen Wassern, die unter Eisschollen glucksen, tote Krebsschalen vor sich herschiebend und Strandgut am Ufer ausspuckend.
Der einsame Angler, der bis zu den Hüften im seichten Meerwasser steht, ist eben noch deutlich zu sehen gewesen. Ein athletischer Oberkörper, helle Haare, die sich am Rand der Pudelmütze ringeln. In einer Latzhose aus Gummi, wetterfest und gegen hohe Kältegrade imprägniert. Wenn er die Angel auswirft, schlägt sie wie eine Peitsche auf das Wasser. Im nächsten Moment jedoch steigen Nebel auf und verschlucken den Mann. Und kein Laut. Nichts.
Wer kann Himmel und Meer, Küste und Land noch voneinander trennen? Der Angler hat nur noch die glucksenden Wasser um seine Stiefel, das leichte Surren der Rolle, von der die Schnur abspult, und das Ufer ist so fern wie der Mond.
1
Hauke Lorenzen angelt an diesem Februarmorgen Dorsche. Er ist vor dem Morgengrauen aufgestanden, ohne seine Frau zu wecken, die um diese Zeit ganz fest schläft. Ist geräuschlos in seine Angelkleidung gestiegen, hat sich in der Küche einen Becher Pulverkaffee aufgegossen, zwei Zwiebacke eingesteckt und ist mit dem Angelzeug draußen, als eben der erste helle Lichtstreifen sich im Osten zeigt.
Die Bucht am Ende der Landzunge, in der Hauke am liebsten fischt, hat aus der Vogelperspektive die Form einer Sichel. Hellgelber Muschelkalk, der das graue Meer von grünen Koppeln trennt. Ein ebenmäßiger schöner Bogen, mit der Mondsichel am dritten Tag nach Neumond vergleichbar.
Im Norden ist die Bucht von einem verwilderten Obstgarten begrenzt. Die Gatter längst verrottet, die Zäune morsch, zerborsten. Und an den verschrumpelten Äpfeln, die im Herbst ins hohe Gras fallen, sind nicht einmal die Vögel interessiert. Das Obstgärtchen gehört zu einem Gut, das früher einmal im Besitz einer dänischen Baronin war. Ihre Großtante wanderte nach Kenia aus, um dort glücklos in zu großer Höhe Kaffee anzubauen. Jetzt sucht Ole Jürgensen, der Immobilienhändler, seit Jahren einen Kaufinteressenten für das Land. Aber Experten haben Bodenproben genommen und festgestellt, dass die Wiesen versalzen und die Äcker überdüngt sind. Wer kauft schon ein Gut mit saurem Boden?
Im Süden der Bucht die Reetdachkate, die im siebzehnten Jahrhundert für den Amtsrichter der Gegend gebaut worden war, den man damals den Hardesvogt nannte und der ein ärmliches Leben wie die Lehensbauern führte. Zwei Zimmer, Küche, Wirtschaftsraum. Das Bad wurde erst Ende der Fünfzigerjahre eingebaut. Imposant ist nur die Allee mit den Ulmen, die auf das Haus zuführt, und die beiden keltischen Grabsteine rechts und links der Einfahrt. Seit die Ulmenkrankheit in Jütland grassiert, bangt Hauke Lorenzen um seine Ulmen. Sein Stolz, die ganze Pracht dieser Gegend. Ein Wahrzeichen, das die Fischer, wenn sie draußen mit ihren Booten unterwegs sind, immer erkennen. Acht Ausrufezeichen auf einem langen Gedankenstrich. Ohne die Ulmen würde sein Haus schutzlos wirken. Hilflos vor Sturm, Kälte und dem Schnee, der gegen die Fenster treibt.
Ein Pilz, der sich in dem Wasseradergeflecht der Wurzeln bis hoch in die Zweige festsetzt, verstopft die Wasserwege und lässt jahrhundertealte Bäume im Sommer verdursten.
Im Juli werden die Blätter schon gelb, und im August stehen sie ohne Laub da. Und Käfer tragen die Krankheit unterdessen von einem Baum zum anderen. Die Baumfäller werden reich und fühlen sich unglücklich. Jeder Baum hier hat eine Geschichte. Jeder Baum wird geliebt.
»Ohne die Ulmen«, sagte Hauke einmal zu seiner Frau Rieke, »wäre unser Haus beim Verkauf nur noch die Hälfte wert.« – »Aber wir wollen das Haus doch gar nicht verkaufen«, rief Rieke, und Hauke nickte. »Nie im Leben.«
Hauke wirft die Angel wieder aus und wartet. An diesem Morgen ist er der einzige Angler in der Bucht. Manchmal stehen sie im Abstand von zwanzig oder fünfzig Metern und rufen sich gegenseitig ihre Fangquoten zu. Heute gäbe es nicht viel zu prahlen. Am Ufer steht der Plastikeimer. Der nasse schwere Sand ist von einer dünnen Schneekruste bedeckt, die leise knackt, wenn der Dorsch im Eimer um sein Leben kämpft. Manchmal geht Hauke den Weg mit dem Angelzeug und dem Eimer zu Fuß nach Hause. Aber heute parkt sein Wagen oben bei den Pappeln. Neben der Bank, auf der im Sommer die Feriengäste sitzen und das glitzernde Meer bestaunen. Reglos stehen die Möwen auf den schwankenden Bojen, die Köpfe alle in die gleiche Richtung, damit der Wind ihnen nicht ins Gefieder greifen kann. Oder sie sitzen auf den Schiffsplanken und den Algenbergen, die von der letzten Flut angeschwemmt wurden.
Hauke kann das Linienschiff nach Faarborg nicht sehen. Zwei Meilen nördlich zieht es vorbei und stößt in gleichmäßigem Abstand warnende Nebelhornrufe aus. Manchmal hört man in den Pausen das sanfte Klatschen von Rudern, die aufs Wasser fallen. Aber sehen kann man in der Nebelsuppe nichts.
Hauke spürt seine Füße schon lange nicht mehr. Jetzt werden auch die Waden taub. Er muss vorsichtig sein, wenn er die Angel einrollt und mit seinem Fang zum Ufer zurückstakst. Er hat nach ein paar Stunden im drei oder vier Grad kalten Meer kein Gefühl mehr für den Untergrund, für die Form der Kiesel und Steine am Boden, kann sich in den Algen verfangen, ohne den Widerstand zu merken.
Oft dauert es den halben Tag, bis seine Füße wieder warm werden. Manchmal länger. Er spürt es an dem Prickeln, das zuerst an den Knöcheln beginnt und dann im großen Zeh. Es ist, als würden aus einem Blasrohr lauter winzige spitze Pfeile auf seine Beine abgeschossen. Es tut weh, aber trotzdem ist es ein schönes Gefühl.
Hauke lehnt sich dann immer von seinem Schreibtisch zurück, zieht die Knie so an den Körper, dass die Füße noch auf der Sitzfläche seines Schreibtischstuhles Halt finden, umschlingt die Zehen in den Wollsocken mit den warmen Händen und sagt »Aah«.
»Na«, fragt Martin dann, der wieder einmal gerade davon träumt, irgendwann einen ganz großen Gangsterboss in flagranti zu erwischen, »kommt das Leben zurück?«
Und Hauke nickt und lächelt versonnen in sich hinein. Wenn er beschreiben sollte, was er unter Glück versteht, wäre es wahrscheinlich das: wie die Wärme in den Körper zurückkommt. Wie alles, Muskelfasern, Nerven, das Adergeflecht wieder fühlbar wird. Hauke hat Bücher gelesen über die Möglichkeit, sich einfrieren und im dritten Jahrtausend wieder auftauen zu lassen. Er kann sich vorstellen, was diese Menschen in den ersten Stunden fühlen. Er wäre, wenn die Zeit für solche Experimente reif ist, gerne dabei, fürchtet aber, dass er das nicht mehr erlebt.
So lange wird er weiter im Winter in der Bucht oben an der dänischen Grenze fischen, in den Nebel starren, auf das warnende Horn der Fährschiffe lauschen, die den Liniendienst mit den kleinen dänischen Inseln auch bei Eisgang aufrechterhalten.
Sein Wagen parkt weiter westlich, wo der Boden nicht ganz so sumpfig ist nach den letzten großen Regenfällen. Die Heckklappe ist geöffnet, der Wagenschlüssel steckt. Jeder könnte einfach einsteigen und wegfahren. Wahrscheinlich liegen die Wagenpapiere griffbereit im Handschuhfach.
Aber er ist unbesorgt. In dieser Gegend hat es noch keine Autodiebstähle gegeben, jedenfalls nicht um diese Jahreszeit. An einem neblig-eisigen Februarmorgen, an dem nicht einmal die Dorsche beißen.
2
Der einzige Fisch, den er in drei Stunden gefangen hat, zappelt in dem roten Plastikeimer, der einsam auf dem gefrorenen Sand steht. Er krümmt sich und schlägt mit der Schwanzflosse in einem fast verzweifelten Kraftakt gegen die Wand des Eimers. Aber es genügt nicht, um hinauszuschnellen. Er gibt auf. Seine Augen werden glasig, die Kiemen sind weit geöffnet. Und er rührt sich nicht mehr, als der Angler seine Schnur einrollt und zum Eimer geht, ihn hochhebt und hinüberträgt zu seinem Auto. Der Dorsch ist ein guter Dreipfünder, eine ausreichende Mahlzeit für drei Personen. Er wird ihm eine Schnur durch die Kiemen ziehen und ihn an Leonies Tür hängen. Er wird nicht klingeln. Nicht darauf warten, dass Leonie öffnet und etwas zu ihm sagt. Auch wenn er gerne ihr Lächeln sähe an so einem Tag, in dem sonst alles im Nebel versinkt.
Dieses Lächeln, das die Landschaft, wie er findet, ein bisschen heller macht. Wird er sich das versagen? Nicht aus Schüchternheit. Nicht, weil es ihm peinlich wäre, dass Leonie endlich wüsste, wer ihr morgens manchmal einen Fisch an den Haustürknauf hängt. Er ist einfach so.
Er drängt sich nicht auf. Leonie ist eine verheiratete Frau, und er will ja nichts, als ihr eine Freude machen.
Es genügt ihm schon, wieder ins Auto zu steigen und sich ihr Erstaunen auszumalen, wenn sie morgens aus dem Haus tritt, in ihrer Gartenkluft, und plötzlich den silbernen Fisch entdeckt. Es genügt ihm, sich vorzustellen, dass sie dann lächelt und sich überlegt, wer das wohl war.
Das Haus, in dem Leonie mit ihrem Mann Tjark und ihrer Tochter Annkatrin wohnt, liegt auf dem höchsten Punkt der kleinen Halbinsel von Börmoos. Es liegt höher als die anderen Häuser des Dorfes. Selbst die Kirche, ein aus großen grob gehauenen Felsquadern im dreizehnten Jahrhundert errichteter klotziger Bau, liegt ein bisschen tiefer als Leonies Haus. Nur die Kastanienbäume, deren Wurzeln manchmal die Grabsteine an den Friedhofsmauern aufheben und umstürzen lassen, ragen, vom Meer aus gesehen, über Leonies Reetdach hinaus. Das hat er oft festgestellt. Im Sommer, wenn er mit dem Boot unterwegs ist.
Rieke wird er nicht erzählen, dass er etwas gefangen hat. Er hat keine Lust auf ihre Fragen. Dabei mag sie gar keinen Dorsch. Aber einer anderen gönnt sie die Fische auch nicht. Schon gar nicht Leonie.
»Wieso der?«, hat sie gefragt, als er einmal unvorsichtig genug war zu sagen: »Ich habe den Fisch an Leonies Tür gehängt.« Ebenso gut hätte er sagen können: »An Tjarks Tür.« Und es wäre okay gewesen. Denn Tjark ist einer von hier. Einer aus dem Dorf.
Ein bisschen hat ihn schon der Teufel geritten, als er Leonies Namen ins Spiel gebracht hat. Er weiß, wie die Frauen im Dorf über sie reden. Sie ist ihnen mit ihren dreiunddreißig Jahren ein bisschen zu langbeinig, ein bisschen zu stolz, die Figur zu mädchenhaft, zu attraktiv. Und sie ist wortkarg. Hinter ihrer glatten hohen Stirn verbergen sich Gedanken, die keiner kennt. Sie blickt den Leuten in die Augen, ohne zu zucken. Weicht keinem Blick aus. Verweigert nie eine Antwort. Aber lacht nicht, wenn andere lachen.
Der Witz, bei dem Leonie Broders lacht, hat jemand neulich beim Skatturnier gesagt, als die Rede zufällig auf sie kam (die Rede kommt oft zufällig auf Leonie), der muss noch erfunden werden.
Mit Leonie tratscht keine der Frauen von Börmoos. Sie erfährt nichts über die Dinge, die im Dorf passieren. Und es geschieht vieles, und nicht alles ist gut. Der Pastor macht manchmal Andeutungen in seiner Predigt von der Kanzel.
Doch Leonie geht nicht in die Kirche. Nicht zu Taufen, Konfirmationen und Beerdigungen. Als der alte Hinnerk aus dem Dorf gestorben ist, hat nur Tjark seinen schwarzen Anzug aus dem Schrank geholt und den Trauerzug begleitet.
Wie eine Mauer aus Felsstein ist das Schweigen um Leonies Haus herum. Das Gewisper und Geflüster im Dorf, das Tratschen und Tuscheln prallt an dieser Wand ab, sucht sich seinen Weg darum herum.
Sie hilft ja nicht einmal bei den Vorbereitungen zur Adventsfeier, nicht beim Weihnachtsbasar. Sie hat mit Tjark den Silvesterball noch vor Mitternacht verlassen. Vielleicht nur, um sich nicht an der großen Umarmung, an der Küsserei zu beteiligen. An dem Partnertauschtanz in Sektlaune nach alten Frank-Sinatra-Platten. In ihrem hautengen schwarzen Kleid, hochgeschlossen, aber so kurz, dass man die wohlgeformten Schenkel sehen konnte, hat sie an Tjarks Seite den Ballsaal in Roikier verlassen. Und so einer hängt Riekes Mann einen Dorsch an die Tür und macht sich im Dorf zum Narren. Glaubt er denn, die anderen merken das nicht? Glaubt er denn, bei Kalle Jensens Haus bewegt sich nicht die Gardine, wenn sein Wagen vor Leonies Tür hält?
»Es wird schon seinen Grund haben«, knurrt Rieke, »dass niemand sonst ihr etwas steckt. Dass niemand sonst mit ihr redet. So was hat immer seinen Grund.«
Hauke Lorenzen hebt die Schultern. Rieke mustert ihren Mann von ihrem Sessel aus, die geschwollenen Beine hoch gebettet.
Sie hat ihn lange nicht so angeschaut. Wie eine Fremde betrachtet sie den Mann, mit dem sie zwanzig Jahre verheiratet ist, und stellt fest, dass er noch ziemlich gut beieinander ist. Besser als sie jedenfalls. Viel, viel besser. Immer noch gut gebaut und der Gang wie ein Athlet. Und wenn er da am Tisch sitzt, seinen Tabaksbeutel ausrollt, ein Zigarettenblatt nimmt, Tabak hinaufrieseln lässt, das Blättchen anfeuchtet mit dem Blick gegen die Zimmerdecke, als erfordere das unglaubliche Konzentration, das Blatt mit der Zunge anfeuchtet, die Enden festklopft, das silberne Feuerzeug aufflammen lässt und die Tabakkrümel von den Fingerkuppen bläst, dann ahnt sie, wie die Mädchen der Handballer ihm wohl hin und wieder Blicke zuwerfen. Dann ist er für sie nicht der alte Champion, der die Jungs trainiert, einer, der seine aktiven Sportjahre schon lange hinter sich hat, sondern einer, mit dem man, wenn es sich so ergibt, durchaus noch was anfangen könnte … Hauke spürt ihren Blick. Er bläst Rauchkringel in die Luft.
»Na?«, fragt er. »Noch was?«
Rieke nickt. »Ja«, sagt sie. »Und es wird seinen Grund haben, dass ausgerechnet mein Hauke so scharf auf diese Frau ist.«
Hauke steht auf. Sucht den Aschenbecher. Geht dicht an seiner Frau vorbei, legt seine Hand auf ihren Nacken. Massiert sie ein bisschen.
»Ich interessiere mich nur von Berufs wegen«, sagt er sanft. »Spinn dir jetzt ja nicht was zusammen. Rein von Berufs wegen.«
Rieke nickt. Aber sie glaubt ihm nicht.
Die Luft ist voller Geschrei, den ganzen Morgen schon, voller Gekrächze und Gezänk. Mit dem Aufwachen hat es begonnen. Selbst bei geschlossenen Fenstern hat man es gehört. Tjark schläft lieber so, mit heruntergezogenen Rollos. Sie könnte immerzu die Luft und den Wind hereinlassen. Die Geräusche draußen hört sie sowieso, das Käuzchen und den heiseren Schrei des Fasanenmännchens, der den Fuchs verschreckt. Bei Nordwind das Brummen der Fernlaster, die in Gelting die erste Fähre nach Faarborg erreichen wollen, das Husten der Schafe hinten auf der Koppel: sie hört sowieso alles. Sie kann nicht abschalten, auch nicht nachts. Manchmal träumt sie schon von den Krähen, bevor sie überhaupt auf der Kastanie gelandet sind, das blauschwarze Gefieder schütteln. Sogar das kann sie hören.
»Du musst das einfach wegknipsen, dieses Geräusch«, sagt Tjark, »mich stört das doch auch nicht.«
Leonie sagt nichts dazu. Was soll sie auch sagen? Tjark wirft den Krähen manchmal morgens auf dem Weg zur Garage ein paar Brotkrumen hin. Sie beobachtet es vom Küchenfenster aus. Sie weiß nicht, ob er es tut, um sie zu ärgern. Sie kann es sich nicht vorstellen, aber er lacht, wenn er sieht, wie die Vögel sich gierig ganz nah an ihrem Haus auf den Boden fallen lassen, um jede Krume zanken und sich mit scharfen Flügelhieben gegenseitig von der Futterstelle vertreiben.
Der Morgen ist hell und klar, ein Februartag.
Der eisige Ostwind hat etwas nachgelassen – Windstärke sechs bis sieben, hat der Radiosprecher angekündigt. Sie könnte ebenso gut ein bisschen im Garten arbeiten. Seit fünf Tagen hat es keinen Frost gegeben, die Erde müsste wieder weich sein. Vielleicht vertreibt ihre Geschäftigkeit draußen die Vögel, vielleicht lässt es sie für eine Weile verstummen. Krähen sind neugierige Tiere. Möglich, dass sie über dem Zuschauen das Schreien vergessen. Sie könnte sich Ohrenschützer aufsetzen oder einen Wollschal um den Kopf binden. Aber das nützt gar nichts. Sie hat alles schon versucht. Das Gekrächze der Vögel dringt durch jede Pore in sie hinein; sie weiß es, sie kann nichts dagegen tun.
Die Krähen sitzen seit dem Morgengrauen in ihrer Kastanie, der großen, vielleicht achtzig oder hundert Jahre alten Kastanie an der Westseite des Hauses, hüpfen auf den Ästen herum, picken zornig auf die Rinde, hacken sich gegenseitig, flattern auf, lassen sich auf einem anderen Ast nieder. Manchmal lassen sie sich fallen, wie tot, landen trotzdem weich abgebremst auf dem Rasen, der braun und morastig ist von dem langen, nassen Winter. Faules Obst liegt noch da; sie war wieder nicht sorgfältig genug. Die Krähen sehen alles. Auch das Stückchen Butterbrotpapier auf dem Kompost, um das sie sich zanken, als gälte es das Leben. Sie sehen genau, was Leonie in der Emaille-Schüssel nach hinten bringt. Von der Küchentür zum Kompost. Es sind gekochte Kartoffeln. Das wird sich wie ein Lauffeuer herumsprechen, und weitere Krähenscharen werden in der Nacht über ihren Garten herfallen. Sie hört das im Schlaf, fühlt das im Schlaf, auch wenn sie lautlos kommen, sich lautlos im Schutz der Nacht ihren Platz in der knorrigen Baumkrone suchen, den Kopf eingezogen, den Schnabel gegen die Brust gepresst, die starren kalten Augen geschlossen. Es gibt auch andere Leute in der Gegend, die Krähen nicht leiden können. Die sie fürchten wie böse Geister aus dem Totenreich.
Sie steht an dem Küchenfenster, von dem aus sie einen Teil der Bucht sehen kann, trinkt ihren zweiten Becher Kaffee und hört ein Oboenkonzert von Vivaldi.
Die Nebel haben sich fast aufgelöst. Nur noch Fetzen wie von zerrissenen Tüchern jagen sehr flach über das Meer in Richtung Süden. Sie lehnt auf dem Arbeitstisch unter dem Fenster und kann sich nicht satt sehen an diesen durchsichtigen Schleiern, an der Eile, mit der sie sich auflösen, neu gruppieren und schließlich hinter den blinkenden Getreidesilos verschwinden. Dieser Seenebel, der sich in nichts auflöst, fasziniert sie. Wie das angehen kann: dass eben alles noch so grau, so undurchdringlich, so ausweglos war, auf einmal wie durch Zauberhand klar und einfach und schillernd schon daliegen kann.
An dieser Stelle ihrer Gedanken wirkt der klare Ton der Oboe auf einmal verzerrt, und Leonie schließt gepeinigt die Augen. Sie kann nicht herausfinden, warum die CD mal glatt durchläuft und dann wieder hakt. Es wird Zeit, mit Musik aufzuhören und in den Garten zu gehen. Im Wetterbericht gestern Abend haben sie ein neues Tief aus Norwegen angekündigt. Das wird am Abend schon da sein, und dann kann sie vielleicht wieder tagelang nicht draußen arbeiten.
Tjark schaut sie dann, wenn er abends heimkommt, immer so mitleidig an, als wisse er, wie ihr das fehlt. Das Schuften draußen in der kalten Luft, das Auslüften, das Durchpusten des Kopfes. Wenn sie am Tag im Garten gewesen ist, hat sie nachts sanftere Träume. Ob Tjark das ahnt?
Leonie, in Jeans, dicken Wollsocken und Holzpantinen, geht durch die Küche, den Wirtschaftsraum mit den Waschmaschinen, dem Trockner und der Kühltruhe in den Schuppen. Sie holt die Schubkarre, eine Forke, einen Spaten. Sie wird Komposterde unter das Malvenbeet neben der Haustür arbeiten; dort ist die Erde weich, auch wenn woanders der Frost im Boden steckt. Es ist zu nah am Haus, außerdem die Südseite. Vielleicht laufen auch Rohre in der Nähe, Warmwasserrohre. Irgendetwas, das den Frost aufhält.
Als sie die Schubkarre neben dem Beet absetzt und sich aufrichtet, um eine Haarsträhne aus dem Gesicht zu schieben, fängt ihr Auge einen Blitzstrahl auf, wie ein Messer, das man dreht, bis das Licht in einem bestimmten Winkel darauf fällt. Etwas silbern Blinkendes hängt an ihrer Haustür. Es ist ein Fisch. Bei jedem Windstoß schwankt er ganz leicht, und die Sonne verfängt sich in den Schuppen. Leonie stellt den Spaten weg, wischt die Hände an den Jeans ab und geht auf die Haustür zu.
»Ein Dorsch«, sagt sie. Und fügt hinzu: »Schon wieder.«
Sie weiß natürlich, dass man im Winter in dieser Gegend fast nur Dorsche und Makrelen fängt. Dennoch ist sie ein bisschen enttäuscht. Sie schaut sich um. Es ist niemand zu sehen. Sie blickt in den Briefkasten. Keine Nachricht, kein Zettel. Also wieder Hauke Lorenzen. Wieder hat er ihr einen Fisch an den Türknauf gehängt. Und noch immer weiß sie nicht, warum er das tut. Ihre Finger sind ein bisschen klamm und ungelenk. Sie hat Schwierigkeiten, den Bindfaden vom Türknauf zu lösen. Irgendwann gelingt es, und sie trägt den Fisch in die Küche, lässt ihn ins Spülbecken gleiten und dreht den Wasserhahn auf. Als sie den Fischkopf anhebt, kommt es ihr vor, als blicke der Fisch sie an. Als wäre in seinem Gesicht ein Ausdruck, den sie an den anderen Fischen, die schon in diesem Becken auf ihre Zubereitung gewartet haben, nicht bemerkt hat. Sie lässt den Fisch wieder los. Er rutscht ins Becken zurück.
»Meinetwegen«, sagt sie zu ihm, »hättest du nicht sterben müssen.«
Zwei Stunden später, als das Malvenbeet längst versorgt ist und sie eigentlich in der Küche stehen und das Mittagessen für sich und Annkatrin zubereiten sollte, steht sie mit einem Kännchen an der Gartenpforte, um die alten Scharniere zu ölen. Sie tut es wegen Tjark. Tjark ist in der letzten Zeit jedes Mal wach geworden, wenn die Gartenpforte quietscht. Es ist wirklich ein abscheuliches Geräusch, und Tjark wird so leicht nicht wach.
Sie war schon vorher wach gewesen, hatte das Auto gehört, das vor der Tür gehalten hatte. Die Stimme ihrer Tochter, das Lachen, dann eine dunklere, unbekannte Stimme. Das Schlagen von Wagentüren und dann Stille, endlos, ewig, bis die Wagentüren noch einmal schlugen und sie noch einmal die Stimme ihrer Tochter hörte. Dann endlich das Quietschen der Gartentür.
»Was ist los?«, Tjark schreckt aus dem Schlaf. Sie legt ihre Hand auf seine Schulter und murmelt besänftigend: »Nichts. Schlaf weiter.«
Sie liegt mit offenen Augen und lauscht weiter auf die Geräusche im Haus. Annkatrin unten in der Küche holt sich aus dem Kühlschrank etwas zu trinken. Immer, wenn sie heimkommt, hat sie Durst. Möchte möglichst wenig Lärm machen. Zieht vor der Treppe ihre Stiefel aus. Schleicht sich nach oben in ihr Zimmer. Kommt wieder heraus. Verschwindet im Bad. Das dumpfe Brummen, wenn die Dusche läuft. So lange unter der Dusche, mitten in der Nacht. Es ist halb eins. Und Annkatrin muss am nächsten Morgen um Viertel vor sieben wieder raus. Und steht eine halbe Stunde unter der Dusche mitten in der Nacht.
Besser, sie ölt die Scharniere der Gartentür. Besser, Tjark wird nicht misstrauisch. Tjark und Annkatrin verstehen sich so gut. Er liebt das Mädchen, von ganzem Herzen. Das weiß Leonie. Und manchmal verspürt sie einen Stich von Eifersucht, wenn sie das geheime Verständnis der beiden beobachtet. Dieses stillschweigende Vertrauen. Dabei lügt Annkatrin, und es macht ihr nichts aus, dass Leonie das weiß. Sie lügt zum Beispiel, wenn Tjark sie fragt, wann sie nach Hause gekommen ist von ihrer Freundin. »Oh«, sagt Annkatrin, »so gegen elf, glaube ich.«
Dabei war es eins, und bei der Freundin ist sie auch nicht gewesen. Besser, Tjark erfährt es nicht.
Daran denkt sie, als ein Motorengeräusch sie aufblicken lässt. Der Wagen biegt von der Norderstraße ab und kommt an den Höfen von Sieks und Martens vorbei die Straße nach Börmoos herauf.
Als der Wagen zwischen der Scheune und der Rübenmiete auftaucht und ein Sonnenstrahl die Breitseite erhellt, sieht sie, dass es ein Polizeiwagen ist. Hauke Lorenzen also.
Sie überlegt, welcher Tag heute ist. Sie schaut verstohlen auf die Uhr. Es gibt keinen Grund, warum sie den Tag überlegt und die Uhrzeit kontrolliert. Sie beugt sich über das Gartentürchen und arbeitet ruhig weiter, während sie auf das Motorengeräusch des Wagens hört. Dabei bemerkt sie doch, wie ein unerwarteter Sonnenstrahl dem gelben Krokus auf dem Rasen eine fast schmetterlingshafte Form gibt. Die weit geöffneten Blütenblätter und der schamlos dargebotene Samenständer und fast gleichzeitig weit entfernt ein Rauchpilz, der aufsteigt, sich ausbreitet, zu einer Spirale zusammenzieht und als feiner Wolkenstreifen vom Wind auf sie zutreibt. Das war immer schon ihre Art gewesen, alles gleichzeitig zu sehen und in einen Zusammenhang zu bringen, den niemand außer ihr verstand.
Sie zerrt das Samtband aus ihren Haaren und schüttelt wild den Kopf, weil ihre Kopfhaut sich auf einmal zusammenzieht. Aber auch das ist nicht neu. Sie muss aufhören, sich die Haare so straff zu einem Pferdeschwanz zu binden. Tjark sagt das schon lange. Bei deinem schönen Haar, sagt er. Du machst dich mutwillig älter. Sie weiß aber, dass sie ohne diese Frisur wie zwanzig aussehen würde. Ihre Knie zittern, als sie merkt, dass Hauke Lorenzen sein Polizeiauto abbremst, dass er immer langsamer fährt, so, als wolle er die gelben Müllsäcke, die an den Hecken abgestellt sind, auf ihren Inhalt kontrollieren, so langsam fährt er plötzlich. Man kann tatsächlich ziemlich gut sehen, was die Leute in die gelben Säcke packen. Die Milchtüten, die Joghurtbecher, das ist erlaubt. Aber was ist mit den Bierdosen, die Annkatrin und ihre Freunde immer heimlich in die Säcke schmuggeln?
Sieht er das auch?
Als wenn Leonie nicht wüsste, dass Annkatrin Bier trinkt. Als wenn man es nicht riechen könnte, abends, wenn sie heimkommt. Als wenn man es ihren Freunden, die sie manchmal heimbringen, nicht am Gang ansehen könnte. Aber wozu regt sie sich auf? Tausendmal hat sie alles gesagt. Tausendmal.
Das Kniezittern gab es früher nicht, wird aber häufiger, wenn etwas Unvorhergesehenes oder etwas, wovor sie sich in Träumen schon gefürchtet hat, auf einmal Wirklichkeit wird. So, als hätten die Gelenke keine Sehnen mehr. So, als könnte ganz einfach das Gelenk des Knies aus der Kugel springen.
Hauke Lorenzen bremst vor dem Gartentor, stößt die Fahrertür auf und steigt aus. Er lehnt sich auf das Autodach, ein Bein wahrscheinlich auf dem Trittbrett, und grinst. Auf dem Beifahrersitz sitzt ein junger Mann, den Leonie nicht kennt. Er trägt auch eine Uniform, er kurbelt das Fenster herunter und mustert sie neugierig. Dann fällt sein Blick auf die Schubkarre. Auf die Forke.
»Ist das nicht ein büschen früh, Leonie?«, fragt er lachend.
»Was?«
»Na, das Graben und Pflanzen. Wir kriegen bestimmt noch mal Frost.«
»Ich pflanz’ ja noch nicht. Hab’ nur den Kompost untergearbeitet. Da im Malvenbeet.«
»Ach so.« Hauke Lorenzen schlägt die Tür zu und kommt näher.
Das Zittern der Knie wird stärker. Hinter seiner linken Schulter ist die Rauchsäule. Vielleicht brennt ein Bauer in Haneby sein altes Stroh ab. Hauke Lorenzen lächelt. Er reibt sein Knie. Er blickt ihr ins Gesicht, und Leonie versucht, diesem Blick standzuhalten. Dabei spannt sich ihre Kopfhaut so, dass sie sie am liebsten mit allen Fingern rubbeln würde.
»Sonst alles in Ordnung?«, fragt er, sich irgendwie beiläufig umsehend. »Keine besonderen Vorkommnisse?«
»Was für Vorkommnisse?« Leonie muss sich räuspern, ihre Stimme ist heiser und ohne Modulation. Früher hat sie eine schöne weiche Stimme gehabt. Das hat man ihr immer wieder gesagt, eine Rundfunkreporterstimme. Sie hat lachen müssen, als sie das zum ersten Mal hörte. Rundfunkreporter! Wenn es was gab, das ihr ferner lag, dann das. In der Öffentlichkeit stehen! Vor anderer Leute Augen etwas sagen oder gar fragen! Leute aushorchen müssen! Über Dinge reden, die keinen Fremden etwas angingen, und zwar ganz ausführlich. Indiskret sein, schamlos sein, forsch und frech! Sie und eine Reporterstimme! Manche Leute haben eben von nichts eine Ahnung.
Was Hauke sieht, muss ihn arglos stimmen. So ein schönes Haus, zweihundertundsiebzig Jahre alt. Im Sommer ganz zugewachsen mit Efeu und Clematis an der Nordseite, duftenden Kletterrosen im Süden und Westen und Kletterhortensien im Osten. Alles lange vor ihrer Zeit gepflanzt. Aber es findet durchaus ihre Billigung, wie fast alles an diesem Haus, wenn man das Äußere meint, das Sichtbare, das Greifbare. Jetzt sieht man natürlich nur die armdicken verschlungenen Triebe der Clematis und der Rosen. Blattlos sehen sie den Winter über nicht anheimelnd aus. Und immerzu tropft die modrige Feuchtigkeit aus dem Reet, hin und wieder fällt ein Moosbrocken auf die Steine und den Kies, aber manchmal erblüht mitten im Februar aus so einem Moosteilchen plötzlich ein kleines Veilchen oder eine Primel, einmal sogar eine Birke. Vielleicht Samen, von Vögeln beim Moospicken im Reet abgelegt.
»Annkatrin in der Schule?«, fragt Hauke Lorenzen mit einem Blick auf den Fahrradschuppen, dessen Türen offen stehen. Das Garagentor ist geschlossen. Ebenso gut hätte er fragen können, ob Tjark im Büro ist, aber nach dem fragt er nie.
»Ich denke schon«, sagt Leonie.
Hauke lacht. Er beugt sich über das Gartentor und legt ihr flüchtig die Hand auf den Arm.
»Das war gut gesagt, Leonie.« Er lacht wieder. »Was wissen Eltern schon über ihre Kinder, was?« Er geht zu seinem Wagen zurück, fährt dabei mit der Hand fast zärtlich über den Kühler. Er hat den neuen Dienstwagen erst im Dezember bekommen. Leonie schaut zum ersten Mal den Beifahrer an. Sieht ihm ins Gesicht. Er ist doch nicht so jung, bestimmt über dreißig. Er hat einen blonden Schnauzer und braune Augen. Für diese Gegend und für seinen Beruf ungewöhnlich langes Haar. Jedenfalls über die Ohrläppchen hinaus.
»Das ist übrigens ein neuer Kollege«, sagt Hauke, als er Leonies Blick bemerkt. »Hilft mir ab jetzt ein bisschen bei der Arbeit. Wird ja doch immer mehr, was? Selbst hier, in dieser Gegend. Mann, wenn ich denke, früher, da hatten wir bloß ein Polizeirevier in Flensburg, und das genügte für die ganze Geltinger Bucht. Ich sag ja, amerikanische Verhältnisse haben wir bald.«
Leonie nickt dem jungen Kollegen zu, ohne zu lächeln, und er grüßt aufmerksam zurück. Er mustert sie. Das ist ihr unangenehm. Sie sieht, dass sie sich die erdigen Hände an den Jeans abgewischt hat. Immer wieder an der gleichen Stelle. Er sieht es auch.
»Das ist Martin Remmers. Kommt direkt von der Polizeischule. Ist noch grün hinter den Ohren. Aber schlau. Hat beste Zeugnisse.«
»Na, übertreib man nicht.« Martin poliert mit dem Jackenärmel das Zifferblatt seiner Uhr. »Ist schon büschen her, dass ich auf der Polizeischule war.«
»Stimmt.« Hauke zwinkert Leonie zu. »Da war doch noch was?« Er macht einen Schritt auf sie zu und gibt seiner Stimme einen verschwörerischen Ton.
»Er hat ein Spezialtraining hinter sich. Kein Verbrecher ist vor ihm sicher, was, Martin?«
Leonie merkt, dass er immer mal wieder einen Blick zur Haustür wirft, als wolle er ganz sicher sein, dass sie den Fisch auch abgehängt hat. Oder wartet er darauf, dass sie sich bedankt?
»In dieser Gegend«, sagt Martin, »passiert ja nichts.«
Als er Leonies Blick bemerkt, wird er ein bisschen rot und fügt schnell hinzu: »Gott sei Dank, wollte ich sagen. Gibt ja inzwischen kriminelle Gegenden genug, oder?«
»Er kommt aus der Gegend«, sagt Hauke. »Ist in Kattrott zur Schule gegangen. In den Bergen, wo er ausgebildet wurde, da hat er Platzangst gekriegt. Stimmt’s, oder stimmt’s nicht?«
»Wer hier in der Gegend aufgewachsen ist«, sagt Martin, »will immer wieder zurück. So ist das.«
»Das musst du der Leonie Broders nicht erzählen. Die weiß davon nichts. Die ist ganz woanders aufgewachsen: wo eigentlich genau?«
Leonie war auf die Frage nicht vorbereitet. Andererseits hat sie das sichere Gefühl, dass sie Hauke ebendiese Frage früher schon einmal beantwortet hat.
»Ich komm aus dem Hessischen«, sagt sie. »Frankfurter Gegend.« Sie meint in Haukes Blick ein kurzes Erstaunen zu erkennen. Hatte sie damals was anderes gesagt? Sie lächelt.
»Im Sommer ist es hier schöner.«
Hauke, ganz entspannt, lächelt zurück. Er gibt Martin einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und wendet sich dem Auto zu.
»Im Winter auch«, sagt Martin. »Dieser Wahnsinnige da geht sogar bei Eis und Schnee zum Angeln.«
Hauke und Leonie werfen sich über das Autodach einen Blick zu. Ist das jetzt der Moment?, fragte Leonie sich.
»Komm, Martin, wir halten die Frau nur von der Arbeit ab. Die Tochter kommt bald aus der Schule und will was zu essen auf dem Tisch haben.«
Eine kurze Pause. Wie ein Augenzwinkern.
»Und? Was gibt’s denn Schönes?«
Leonie schaut ihn an. Martin hat die Tür vom Beifahrersitz geöffnet. Umständlich öffnet er die Jacke, um sich hinzusetzen. Dabei sieht Leonie den Pistolenhalfter. Bestimmt hat er das extra so eingerichtet. Wer auf der Spezialschule war und von großen Verbrechern träumt, braucht so was.
»Dorsch«, sagt Leonie. »Ganz leckeren frischen Dorsch.«
Als Hauke winkend davonfährt, sieht Leonie noch eine Weile das Gesicht des Polizisten vor sich, das vor Freude wie erleuchtet wirkt.
»Na?«, sagt Hauke Lorenzen. »Was meinst du?«
Sie fahren gerade an der Friedhofsmauer entlang. Eine aus riesigen Felsbrocken aufgeschichtete Wand, durch die sich armdicke Baumwurzeln der Kastanien zwängen. Manchmal heben sie die Steine wie kleine Murmeln einfach aus dem Mauerwerk. Und dann poltern sie auf die Straße. Aufpassen muss man immer. Die Kirche steht schon seit fünfhundert Jahren, und der Friedhof soll ebenso alt sein. Grabsteine noch aus dem siebzehnten Jahrhundert. Seeleute, Kapitäne, Walfänger darunter. Auch eine brasilianische Prinzessin, die ein Seefahrer einfach als Geisel mitgenommen hat. Fünfzehn Jahre ist sie nur alt geworden. Dann rollen sie rechts die Anhöhe wieder hinunter auf das Meer zu, das unter einer dicken Nebelbank liegt, noch immer. Nur an den Küsten reißt die Nebelschicht schon etwas auf. Lässt mal ein Windrad, einen Getreidesilo oder einen Leuchtturm auf der Klippe erahnen.
»Wozu willst du meine Meinung?«, fragt Martin.
»Na, zu ihr. Leonie Broders.«
Martin hebt die Schultern. »Wer so einen Typ mag«, sagt er. »Für mich wär’s nichts.«
Hauke lächelt. »Und wieso nicht?«
»Weiß nicht. Zu kühl irgendwie.« Er lacht plötzlich. »Ich wette, die kratzt und beißt, wenn man die ganz harmlos küssen würde. Irgendwie männerfeindlich, oder? Ist die in einem Frauenclub oder so?«
Hauke hat beide Hände am Lenkrad. Trommelt eine Melodie. Schüttelt sanft den Kopf. Martin blickt ihn von der Seite an. Plötzlich kommt ihm eine Idee. »Wahrscheinlich müsste sie einfach mal lächeln. Dann hätte man irgendwie weniger Komplexe. Echt. Die Frau macht mir Komplexe. Aber wenn sie lachen würde … oder wenigstens so ein kleines Lächeln …«
»Vielleicht«, sagt Hauke, »hat sie nicht so viel Grund zum Lächeln.«
Sie tauchen in eine Nebelbank ein. Instinktiv stützt Martin sich am Armaturenbrett ab. »Langsamer … Mann!«, ruft er.
Hauke tritt auf die Bremse. »Keine Angst, Martin. Hier kenn’ ich jeden Stein.«
»Auch jeden Hund, der einfach über die Straße rennt im Nebel?«, sagt Martin gereizt. »Das ist tückisch, Mann.«
Martin schaut ihn an. Hauke sagt nichts weiter, bis sie in den Weg nach Roikier einbiegen. Meistens steht hier ein Rudel Rehe auf der Koppel, und Habichte hocken reglos auf den Zaunmasten. Vielleicht auch jetzt, wo der Nebel alles verschluckt. In der Ferne die Fähre nach Faarborg, roter Bug mit weißen Aufbauten. Genau wie dieses Schiff, das damals in der Ostsee untergegangen ist und vierhundert Leute mit in die Tiefe gezogen hat. Mit dieser hoch aufragenden Heckklappe für die Autos. Hauke musste manchmal diese Fähre nehmen und hat immer Angst davor. Aber das verrät er nicht einmal seiner Frau, die ja im Wagen sitzen bleibt während der Überfahrt, mit vorwurfsvollem Gesicht, dass er oben an Deck spazieren geht und sich vielleicht rechtzeitig durch einen Sprung ins Schlauchboot retten könnte, wenn etwas passiert. Aber würde er das tun? Seine Frau unten absaufen lassen und sich selber davonstehlen? Das glaubst du doch selbst nicht, sagt er zu sich, morgens vor so einer Fahrt, wenn er sich vor dem Spiegel rasiert.
»Hast du was mit ihr?«, fragt Martin.
Hauke runzelt die Stirn. Er hatte diesen Habicht beobachtet, der gerade im Zeitlupentempo die Schwingen ausbreitete und sich aufrichtete, den Blick starr auf einen Punkt des Feldes gerichtet. Er schüttelt den Kopf. Fragt: »Wie alt schätzt du sie?«
»Solche Frauen kann ich nicht schätzen.«
Hauke schaut kurz zur Seite, die Augenbrauen hochgezogen. »Sie ist erst dreiunddreißig.«
Er betrachtet Martin. Was hinter dessen Stirn so alles vorgeht. Man weiß ja noch nichts voneinander, obwohl man sich duzt. Seit ein paar Tagen, seit dieser Nacht, als sie beim Pils so richtig versackt waren. Im »Klönschnack« in Harrislee. Vielleicht ist das ein Fehler gewesen. So ein ›Sie‹, das schafft mehr Distanz. Aber er hat, als Martin ihm das Du anbot, nicht den Vorgesetzten, nicht den Älteren herauskehren wollen. Dabei muss dem doch auch mal einer gesagt haben, dass immer der Ältere dem Jüngeren das Du anbietet und nicht umgekehrt. Aber was soll’s. Der Verfall der Sitten, das Verkommen der Tugenden. Über so was ereifern sich ja derzeit sogar sogenannte linke Intellektuelle, hat er sich sagen lassen.
»Ich hab nichts mir ihr gehabt. Und ich will auch nichts mit ihr haben.«
Hauke gibt jetzt Gas. Diese Strecke nach Roikier kennt er im Schlaf; ist er damals, als sie den Schulheimskandal hatten, jeden Tag mindestens zweimal gefahren.
»Und warum hast du sie mir dann gezeigt?«, fragt Martin. »Ich wollte mal dein Urteil«, sagt Hauke.
Martin schaut ihn an.
»Wieso hast du mir das nicht früher gesagt? Dann hätte ich genauer hingeguckt. Urteil über was?«
»Glaubst du, jemand könnte dieser Frau das Dach über dem Kopf anzünden?«
Martin hält die Luft an. Dann stößt er einen leisen, ganz langsamen Pfeifton aus.
»Nicht dein Ernst!«, sagt er.
Hauke hebt die Schultern. Das Meer liegt jetzt direkt vor ihnen. Grau wie Alu. Ebenso der Himmel. Nur am Horizont, ungefähr einen Zentimeter über dem Meer, ein schmaler Streifen Licht. Lässt das Wasser an der Stelle glänzen wie ein ewig langes Schwert, das eben aus der Scheide gezogen wird.
»Sie hat mir mal von so einem Traum erzählt, die Leonie. Ich hatte damals gedacht, sie tut es mit Absicht. Um mir was klarzumachen. Aber was?«
Die Augen können einem schmerzen, wenn man lange genug hinschaut. Links auf dem Acker, der zum Gut Engelsby gehört, umkreist ein Schwarm Möwen einen Traktor, der eine Egge hinter sich herzieht.
»Was ist passiert?«, drängt Martin. »Nun rede doch schon.«
Hauke seufzt. »Das ist es ja«, sagt er. »Bis jetzt noch nichts. Und das macht mir Angst. Diese Ruhe, weißt du?«
Martin entspannt sich. Aber seine Stimme ist gereizt.
»Na also. Und ich dachte Wunder, was jetzt kommt.«
»Vielleicht kommt ja was«, sagt Hauke.
Er bremst. Schlammspuren von einem Güllewagen auf der Straße. Er folgt der Güllespur. Jeder hier in der Gegend weiß, dass man so etwas entfernen muss. Jeder Bauer weiß das. Aber manche halten sich einfach nicht dran. Schlimm genug, dass es in dieser Gegend stinkt wie das Pissoir eines Fußballstadions. Schlimm genug.
»Leonie Broders denkt es jedenfalls.«
Irgendwann, denkt Hauke, während Martin ihn forschend anschaut, wird man die Bauern zwingen, die Scheiße, die ihre Mastviecher produzieren, anders zu entsorgen, als sie einfach über Felder und Wiesen zu gießen.
Es gibt doch ohne das schon genug Scheiße auf der Welt.
3
Annkatrin kommt mittwochs um halb zwei aus der Schule. Es ist der einzige Tag in der Woche, wo sie so früh kommt. Deshalb kocht Leonie an dem Tag schon mittags etwas Warmes. Sie deckt dann den Tisch im Esszimmer. Am hellsten Fenster des Hauses, sodass sie ihre Tochter genau sehen kann, wenn sie miteinander essen und reden. Sie schaut ihre Tochter gerne an. Ein fünfzehnjähriges Mädchen, fast sechzehn, groß wie alle hier in der Gegend, kräftig, mit der weißen, von Sommersprossen übersäten Haut und dem rötlich schimmernden Haar. Das ist selten hier, so viele Sommersprossen. So leuchtendes Haar. Hexenhaar hat man früher gesagt.
Es soll Männer geben, die sich vor Rothaarigen fürchten. Annkatrin kam einmal weinend aus der Schule, da war sie dreizehn. Ein Journalist hatte sie besucht, er arbeitete für eine Fernsehzeitschrift, er hielt einen Vortrag in der Klasse, im Kunstunterricht. Später fiel Annkatrin ein, dass er wahrscheinlich kein Journalist, sondern ein Grafiker war. Das Wort ›Art déco‹ hatte sie noch nie vorher gehört. Warum auch. Er war zu ihr gegangen, hatte sich vor sie auf den Tisch gesetzt, lässig natürlich, seinen Turnschuhfuß auf ihre Schultasche gestellt und die Arme über der Brust verschränkt. Er kam sich unheimlich cool vor in seinen schwarzen Lederklamotten und den Kreolen im Ohr. Annkatrin hat ihn so haarfein geschildert, dass Leonie sich alles vorstellen konnte. Er sah aus wie ein Filmheld, wie einer aus einer anderen Welt. Und er wusste das, und er genoss es und tat alles, um diesen Gegensatz noch zu unterstreichen.
»Ein Mädchen wie dich«, hatte er gesagt, »mit diesem roten Schopf würde man zum Beispiel nie auf eine Titelseite nehmen.«
Annkatrin hatte – Leonie konnte sich das gut vorstellen – ein bisschen trotzig und gleichzeitig schüchtern zu ihm hochgeschaut, mehr auf seine verschränkten Arme als auf sein Gesicht, und er hatte hinzugefügt: »Rothaarige Titelmädchen verschrecken die Käufer. Solche Titel liegen wie Blei in den Regalen.« Er hatte gelacht. »Hexenmädchen, verstehst du? In den Augen der meisten gelten Mädchen deiner Sorte als Hexen.«
Die ganze Klasse hatte gekichert. Annkatrin war immer so stolz auf ihre wilde rote Mähne gewesen.
Leonie sagt, Annkatrin hat die Haare von ihrer Großmutter. Aber das ist eine Lüge.
Von der Großmutter gibt es nur zwei, drei kleine vergilbte Schwarz-Weiß-Fotos. Deshalb kann niemand ihr das Gegenteil beweisen. Annkatrins Verwandte sind tot. Es gibt keine Oma, keinen Opa, keinen Onkel, keine Tante. Und das ist auch gut so. Niemand, den sie fragen kann, von wem sie die Sommersprossen und das rote Haar geerbt hat. Tjark hat strohblondes Haar, das sein Gesicht noch gröber macht, durchzogen von winzigen roten Äderchen, die leicht platzen und seine Wangen so gut durchblutet erscheinen lassen. Bei Frost platzen sie besonders schnell. Nach einem Spaziergang im Nordsturm, wenn die Eisschollen an den Strand getrieben werden und man über gefrorenen Tang geht, der unter den Gummistiefeln zu Eisstaub zerbricht, kann man zusehen, wie sein Gesicht immer roter wird.
Leonies Haare haben die Farbe von Heu. Sie hat schon oft mit dem Gedanken gespielt, sie zu färben, in ein leuchtendes Blond, dieses Girlie-Blond der amerikanischen Fernsehserienheldinnen. Aber dann, wenn sie schon fast entschlossen ist und auf dem Friseurstuhl Platz genommen hat, kommt sie sich albern vor. Im Sommer und wenn sie sich gut fühlt, glänzt ihr Haar wie Naturseide. Dann gefällt es ihr selbst.
Es ist halb zwei, und der Tisch ist gedeckt. Aber Annkatrin kommt nicht. Leonie hebt den Deckel vom Kochtopf und rührt die Linsen um, nimmt einen Teelöffel voll heraus, probiert, gibt etwas Curry hinzu, eine Kelle kochendes Wasser und schließt den Deckel wieder. Die Dorschfilets reibt sie mit Haushaltspapier ab, salzt und pfeffert sie, träufelt Zitronensaft darüber. Annkatrin und sie essen gerne Fisch. Tjark mag lieber Fleisch. Und Nudeln in jeder Form. Aber eigentlich schmeckt ihm alles, was Leonie kocht. Wie ihm auch sonst alles gefällt, was sie tut. Er ist ein freundlicher Mann. Leonie bindet ihren Pferdeschwanz neu und tritt ans Fenster. Jeden Augenblick muss Annkatrin kommen, aber sie will den Fisch nicht in die Pfanne tun, bevor sie da ist. Annkatrin hasst es, wenn sie sich sofort an den Tisch setzen muss, kaum dass sie die Haustür hinter sich geschlossen hat. Wenigstens drei Minuten verschnaufen, sagt sie immer und wirft sich in den Sessel oder sperrt sich im Bad ein. Hast du etwa die ganze Zeit am Fenster gestanden und auf mich gewartet? Sie verdreht die Augen, wenn Leonie nur wortlos lächelt. O Mann, wie das nervt.
Zurzeit nervt Annkatrin eine ganze Menge. Aber das ist sicher normal in dem Alter. Leonie würde gerne mit anderen Frauen, mit den Müttern ihrer Freundinnen, darüber reden, ob die auch oft so zickig und so unberechenbar sind. Aber eine Gelegenheit dazu findet sie nie. Annkatrin hält die Mütter ihrer Freundinnen von ihr fern. Aber vielleicht kommt ihr das nur so vor. Warum sollte Annkatrin etwas dagegen haben, wenn sie sich mit ihnen trifft? »Ruf sie doch an«, sagt Annkatrin, sich in den Sessel werfend. »Da ist das Telefon, da das Telefonbuch. Ruf sie an, und lad sie zum Kaffeeklatsch ein. Du wirst ja sehen, was du davon hast.«
»Was hab ich denn davon?«, fragt Leonie dann.
Annkatrin sieht ihre Mutter an, fassungslos wegen dieser Frage. Dann die Augen verdreht, die Mähne geschüttelt und aufgesprungen.
»Was gibt es zu essen?«
Es ist nicht einfach, mit pubertierenden Mädchen zurechtzukommen. Sie hat sich das anders vorgestellt. Als Annkatrin noch die kleine süße Zuckermaus war, anhänglich und schmusig wie ein Kätzchen, da hat Leonie sich immer so eine Freundschaft ausgemalt, so eine innige, selbstverständliche Verbundenheit zwischen Mutter und Tochter. Sie hoffte, aus dem Mutter-Tochter-Verhältnis würde sich etwas herausschälen, etwas Besonderes, eine Beziehung, wie Annkatrin sie sonst mit niemandem auf der Welt hätte. Sie wären Vertraute, die sich alles erzählten, alle Geheimnisse miteinander teilten und alle Ängste auch. Aber so ist es nicht gekommen. Sie schweigen immer länger, wenn sie zusammen sind. Immer größere Pausen. Immer mehr Dinge geschehen, von denen Leonie nichts weiß. Immer öfter hört sie Annkatrin in ihrem Zimmer schluchzen, und wenn sie klopft, ist das Zimmer abgeschlossen, und Annkatrin ruft trotzig: »Lass mich in Ruhe, ja?«
Natürlich lässt sie das Kind in Ruhe.
»Liebeskummer«, flüstert sie Tjark abends zu. »Das hat man in dem Alter, Tjark.«
Tjark lächelt und schließt das Mädchen in seine großen Arme. Annkatrin lehnt sich an ihn, reibt ihre geballten kleinen Fäuste an seiner Strickjacke, bis sie sich ein bisschen elektrisch aufgeladen haben und es knistert, wenn sie über den Kunststoffteppich zu ihrem Stuhl geht. Das macht Spaß.
»Mein Daddy macht sich Sorgen«, sagt sie lachend. Ihre Lider sind noch ein bisschen rot, aber sonst ist alles in Ordnung.
»Was war denn?«, fragt Leonie bei solcher Gelegenheit. Aber sofort erlischt das Lächeln, und Annkatrin schaut sie ernst, fast streng an über den Tisch.
Aber Leonie glaubt, dass Tjark mehr weiß. Tjark ist Annkatrins Vertrauter. Mit ihm teilt sie ihre Sorgen. Mit ihrem Daddy, mit ihrer Mutter nicht.
Leonie versucht sich zu erinnern, seit wann Annkatrin sich vor ihr verschließt. Grübelt, ob es einen Anlass gegeben hat, aber kann sich nicht vorstellen, was es sein könnte. Sie könnte fragen, aber dazu fehlt ihr der Mut. Und es gibt niemals einen Anlass, bei dem man wie von ungefähr das Gespräch auf so etwas bringen könnte. Sie fürchtet, Annkatrin noch mehr zu verschrecken. Noch weiter von sich wegzutreiben.
Mit ihr reden Tjark und sie nur über Alltägliches. Banales. Fragen sie, was es Neues gibt, und wissen, dass sie niemals etwas Neues erzählen kann. Bei ihr landet der Dorftratsch nicht. Zu ihr kommen die anderen Frauen nicht, um Neuigkeiten weiterzugeben. An ihrem Haus gehen sie vorbei, nicht hastig, aber doch ohne den Schritt zu verlangsamen. Auch wenn Leonie ganz vorne am Zaun arbeitet und nur darauf wartet, dass jemand mehr sagt als »Moin.«
Aber vielleicht wartet sie ja gar nicht darauf. Vielleicht denken die Nachbarn, dass sie sich nicht für Klatsch interessiert. Und damit haben sie sogar recht.
»Mami«, sagt Annkatrin manchmal schaudernd, »wie du das aushältst.«
»Was denn?«
»Na.« Annkatrin schaut sich um. »Das Ganze. Dieses Haus, diese Familie, der Garten, der Haushalt und sonst nichts. Ich meine, wieso dir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Wieso du nicht irgendwie auf die Idee kommst, mal was zu machen.«
»Was denn machen?«, fragt Leonie. Ihre Stimme ist ruhig, aber innerlich zittert sie. Ist das der Augenblick, einmal wirklich ernsthaft miteinander zu reden?
Aber Tjark hat entschieden, dass dies nicht der Augenblick ist. »Sie hat doch den Garten«, sagt er. »Und die Schafe.«
»Mein Gott. Die blöden Schafe«, stöhnt Annkatrin.
Leonie sagt nichts. Dabei war es Annkatrin gewesen, die die Lämmchen unbedingt haben wollte. Sie sind sooo süß, Mami, hatte sie gebettelt. Stumm füllt Leonie die Teller. Sie muss aufstehen, um die langen Spaghetti mit den Holzlöffeln aus der Schüssel zu nehmen. Manche fallen seitlich am Schüsselrand herunter, und Leonie fängt sie mit der Hand auf und legt sie auf die Teller. Annkatrin schiebt ihren Teller zurück.
»Ich hasse es, wenn du die immer mit deinen Fingern anpatschst, sie dann ableckst und wieder die nächsten anpatschst«, sagt sie. Tjark und Leonie wechseln einen Blick.
»Aber wir sind doch eine Familie«, sagt Tjark sanft. »Sie ist doch deine Mutter.«
»Lass man, Tjark. Schon gut«, murmelt Leonie. »Ich tu’s nicht wieder. Entschuldige, Mäuschen.«
Annakatrin brummelt etwas und senkt den Kopf. Soweit Leonie sich erinnert, verläuft der Rest eines solchen Abendessens schweigend. Wie man überhaupt immer weniger spricht in diesem Haus.
Es ist viertel vor zwei, und Annkatrin ist immer noch nicht da. Leonie tritt vor die Haustür. Sie kann über die Felder schauen bis zum Horizont. So viel weites ebenes Land. So viel Himmel darüber. Manchmal findet man nichts, an dem der Blick sich festhalten kann.
Aus einer dunklen Wolke, die rasend schnell über sie hinwegzieht, wirbeln kleine trockene Schneeflocken, luftleicht, die nirgends haften bleiben und von den Grashalmen wieder nach oben getrieben werden wie von einem Aufwind, der vom Boden aufsteigt. Alles wirbelt um sie herum. Von Sekunde zu Sekunde stärker. Ein kleiner Schneesturm, der im nächsten Augenblick den Himmel völlig verdunkelt. Aus den offenen Fensterluken des Maststalles von Bauer Clausen kommt das ängstliche Gebrüll der Kälber. Clausen will sich in diesem Winter eine elektrische Waschanlage für seine Milchkühe anschaffen. Es hat in allen Zeitungen gestanden. Die Kühe, hat er gesagt, hätten Tränen des Glücks in den Augen, wenn sie aus solch einer Anlage herauskämen. Die Bürsten würden den Staub, die Milben, den Schmutz aus dem Fell massieren. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Hinnerk Clausen hat Leonie eingeladen, sich das anzusehen. Nur weil sie so interessiert seiner Schilderung zugehört hatte. Das würde sie wirklich gerne sehen, so richtig glückliche Kühe. Das würde sie vielleicht entschädigen für die Schreie der eingesperrten Masttiere. In Börmoos betreiben alle Bauern intensive Landwirtschaft. Das ist die offizielle Bezeichnung für etwas ganz und gar Unnatürliches. Wenn Leonie mit dem Rad durch das Dorf fährt, im Frühjahr, kurz bevor es wenigstens für die Kühe und Kälber die Chance gibt, auf die Weide zu kommen, hört sie überall das Gebrüll der Tiere. Nicht zornig: eher verzweifelt. Sie fragt sich, warum nie einer nachts durch das Dorf geht und alle Ställe öffnet und die zusammengepferchten Viecher hinaus ins Freie treibt. Das würde sie gerne erleben. Aber es selbst zu tun, das traut sie sich nicht. Schon wegen Tjark. Die Bauern sind alle seine Kunden. Er macht für sie die Steuererklärungen. Er berät sie bei der Anschaffung neuer Geräte, beim Bau von Scheunen und Ställen. Sie vertrauen ihm.
Aber selbst wenn jemand die Masttiere befreien würde; am nächsten Tag wären neue da und würden brüllen.
Ein apfelgrüner Ford hält vor der Garageneinfahrt, millimetergenau neben den zwei Kartons mit den leeren Flaschen, die nie jemand mitnimmt. Dabei gibt es einen Altglascontainer gleich neben dem Sportplatz. Sie wartet jeden Morgen, ob Tjark vielleicht daran denkt. Er muss praktisch beim Rückwärtsfahren die Kartons überrollen, aber er lässt sie stehen. Und die dicke Marie auch, wenn sie mittwochs mit dem Putzen fertig ist. Aber sie hat ja schon genug damit zu tun, sich selber auf dem Fahrrad im Gleichgewicht zu halten.
Leonie wünscht sich ein Auto. Sie weiß nicht mehr, warum sie damals geglaubt hat, ohne eigenes Auto ginge es genauso gut. Für den Schrottwert ihres alten hat sie sich beim dänischen Antiquitätenhändler eine Kirchenbank aus dem siebzehnten Jahrhundert gekauft. Die steht jetzt im Flur, mit einer hohen geraden Lehne und einer sehr schmalen Sitzfläche. So unbequem, dass man sich nur hinsetzt, um die Gummistiefel auszuziehen. Aber Kirchenbänke sollen ja auch nicht behaglich sein.
In dem apfelgrünen Auto mit den Rallyestreifen sitzt ihre Tochter und lässt sich von dem Fahrer küssen. Leonie kann nur seine schwarzen Haare sehen, glatt und glänzend, pomadig. Von dem Rückspiegel an der Windschutzscheibe baumeln blau-gelbe Fußballstiefelchen. Auch das noch, denkt Leonie.
Annkatrin hat sie noch nicht gesehen. Bestimmt schließt sie beim Küssen die Augen, wie alle Mädchen, die fünfzehn sind und sich den Kerl zurechtträumen, der ihnen gerade die Zunge zwischen die Zähne schiebt. Einen wie ein Hollywoodstar wahrscheinlich. Oder die Nummer eins der Weltrangliste im Tennis. Vielleicht auch ein Formel-1-Rennfahrer. Nicht einmal das wusste Leonie. Erst einmal weicht sie zurück in den Schutz der Hecke.
Annkatrin sitzt am helllichten Tag in einem Auto und lässt sich küssen. Sie ist fünfzehn und nimmt abends, wenn sie einschläft, ihren Stoffhasen in den Arm. Die Puppen, mit denen sie einmal gespielt hat, sitzen noch, hübsch angezogen, oben auf ihrem Kleiderschrank. Und alle Enid-Blyton-Bücher stehen noch im Regal. Als Annkatrin vor zwei Jahren ihre Tage bekam, hat sie es ihr nicht einmal gesagt. Leonie hat es nur gemerkt an den Blutflecken in der Wäsche und auf dem Laken. Als sie (sie hatte sich lange überlegt, wie sie das Gespräch beginnen sollte) Annkatrin so eine Art Sexualkundeunterricht geben wollte, hat Annkatrin sie angeschaut, mit eisiger Verachtung.
»Mami, in welchem Jahrhundert lebst du?«
Leonie sieht Annkatrins roten Haarschopf. Hin und wieder die Hand des Jungen, seine Stirn, sein Ohr. Als drehten sie sich wie ein Kreisel. Sie kann sich vorstellen, wie der Junge riecht. Eine Mischung aus Zigarettenrauch, der in seinen Kleidern steckt und vor allen Dingen in diesem Tuch, das er um den Hals geknotet hat. Schweiß und Schuhcreme. Bestimmt trägt er Cowboystiefel, die er jeden Tag liebevoll einfettet. Das Einzige, was er an sich pflegt. Sie könnte wetten, dass sich alles immer wiederholt.
Sie glaubt, Annkatrins Kichern zu hören. So backfischhaft, so anhimmelnd. Das Strahlen ihrer Augen, die auf diesem Jungen ruhen, der ein Mädchen wie Annkatrin garantiert nicht verdient hat. Sie hört das Klimpern der Plastikreifen am Arm des Mädchens. Die sind jetzt modern, wie damals in den Sechzigern. Alles kommt wieder. Es erschreckt Leonie, wenn sie sich das ansieht in den Modezeitschriften, in den Katalogen, in den Gratisprospekten, die der Zeitung beigelegt sind.
So hat sie als junges Mädchen auch ihre Augen mit einem schwarzen Kajal umrandet. So hat sie sich auch die Augenbrauen bis auf einen feinen Strich gezupft. Mit einer abgeflachten Pinzette. Sie kann sich heute noch an den jähen kleinen Schmerz erinnern, als säßen die Augenbrauenhärchen direkt auf einem Nervenstrang. Solche kurzen, unten etwas ausgestellten Kleider hat sie sich auch immer gewünscht. Zitronengelb oder orange. Und dazu apfelgrüne Ohrclips aus Plexiglas, kugelrund. Und für Elvis und Las Vegas, für Memphis Blues und Jungs mit pomadig-schwarzer Tolle hat sie auch geschwärmt.
Annkatrin stößt die Tür auf und springt heraus. Leonie weicht einen Schritt zurück, hinter die Hecke. Aber sie weiß nicht, was sie da soll. Sie sieht lächerlich aus mit der Küchenschürze und den Birkenstocksandalen, draußen im Schnee. Annkatrin trägt ihre schwarzen Schnürstiefel und darüber grobe, graue Wollsocken über den blickdichten Strumpfhosen. So machen es alle im Winter. Ein Militärmantel aus schwarzem Tuch, den sie auf einem Flohmarkt erstanden hat, im letzten Herbst, bei einer Klassenreise nach Prag. Wieso gibt es in Prag französische Militärmäntel aus dem Ersten Weltkrieg? Auch Tjark konnte sich das nicht erklären.
Leonie tut, als habe sie nach der Post geschaut. Sie fasst in die Röhre aus weißem Blech, in der die Zeitungen und Werbeprospekte immer stecken. Natürlich ist nichts da. Sie hat heute beim zweiten Frühstück schon alles gelesen. Annkatrin rennt an ihr vorbei. Lacht.
»Steig doch aus. Komm doch rein«, ruft sie im Laufen.
Da erst sieht sie ihre Mutter.
»Mami. Ich muss gleich wieder weg«, ruft sie.
Leonie weiß nicht, ob sie warten soll, bis der Junge aus dem Auto ausgestiegen ist, oder ihrer Tochter folgen. Sie entschließt sich zum Zweiten. Annkatrin hat ihre Schultasche auf den Boden geschleudert, die Schnur ist aufgegangen. Ihre Schultasche ist ein alter Rucksack, bemalt und dreimal geflickt. Und die Schnur ist eine selbst geflochtene Kordel aus bunten Wollbändern, die sich von selbst aufdröselt. Was alles herausfällt. Eine Dose mit Kunststoffperlen, Bärchen-Notizblock, Haarspangen, Stifte, Radiergummis, zerknüllte Zettel, Fotos, ein Brief, Lippenstifte, Parfumpröbchen. Leonie macht einen großen Schritt.
»Annkatrin?«
»Mami, ich habe keine Zeit. Kommt Ricky nicht rein? Ruf ihn doch mal. Ich glaube, er traut sich nicht.«
Annkatrin rumort in ihrem Zimmer.
Aber Ricky traut sich doch. Er steht schon in der Haustür. Eine niedrige Tür aus dem achtzehnten Jahrhundert. Damals waren die Menschen noch nicht so groß. Ricky muss den Kopf einziehen. Er grinst.
»Hallo«, sagt Leonie.
»Ach ja, klar.« Er nickt cool in ihre Richtung. »Hallo. Ich bin der Ricky.«
Ach nee, denkt Leonie. Sie ärgert sich und weiß nicht, warum. Der Junge, Leonie schätzt ihn auf unter zwanzig, achtzehn oder neunzehn, schaut sich ohne die geringste Verlegenheit um. Zieht ironisch die Augenbrauen hoch, als er die Blumen auf dem Tisch sieht, das Bild mit dem Segelboot an der Wand, neben dem Strohblumengesteck. Findet er natürlich alles unheimlich spießig und wird es Annkatrin nachher auch sagen. Ganz cool. Ohne zu fragen, zieht er eine Zigarette aus einer verknautschten Packung und steckt sich eine an. Lässt das Feuerzeug aufflammen, so wie er es in Mickey-Rourke-Filmen gesehen hat. Bläst die Luft durch die Nasenlöcher. Grinst. Streckt ihr das Päckchen hin.
»Tschuldigung. Echt unhöflich, was? Auch eine?«
Leonie schüttelt den Kopf. Soll sie sagen, dass in diesem Haus nicht geraucht wird? Dass sie vom Zigarettenrauch, der kalt und abgestanden in den Zimmern hängt, Kopfschmerzen bekommt? Wortlos geht sie in die Küche, holt einen Keramikteller und stellt ihn auf den Tisch in der Diele. Er sagt nicht einmal danke. Er poliert mit einem Taschentuch seine Stiefel. Die glänzen wie nichts sonst an ihm. Es hat sich, seit sie so jung war wie Annkatrin, wirklich gar nichts geändert.
Seine Lippen wirken wie geschwollen. Vielleicht haben die beiden sich ein bisschen zu lange geküsst. Überhaupt wirkt alles an ihm irgendwie zerdrückt. Verschwitzt und verknautscht.
Sie muss sich alles ansehen und sich ihren Teil denken. Seine Jeans sind sehr eng. Er kann kaum gehen in diesen Jeans. Er hat die Daumen in die Gürtelschnalle gesteckt. Er geht ein bisschen breitbeinig, als würden sich die Oberschenkel gegenseitig behindern.
»Wo steckt die Kati denn?«
Kati nennt er sie.
Na ja, warum nicht. Annkatrin ist wirklich ein bisschen lang, obwohl sie nie Mühe hatte mit dem Namen. Sie hat Annkatrins Namen nie verhunzt. Nie abgekürzt. Nur der Tjark, der sagt manchmal Ännchen zu ihr. Aber nur in seltenen, besonders zärtlichen Momenten. Sie selbst würde das nie sagen. Ännchen. Das ist nicht das Bild, das sie von ihrer Tochter hat. Ännchen von Tharau ist die, die mir gefällt. »Hier. Ich bin hier.«
Annkatrin taucht schon wieder auf. Sie hat etwas unter ihren Mantel gestopft. Leonie weiß nicht, was es ist. Sie fragt nicht. Sie wird nicht fragen, wenn Annkatrin es nicht von selbst sagt. »Mami«, sagt Annkatrin. »Das ist Ricky. Ricky, meine Mami.« Ist das nicht lieb. Vorstellung wie auf einem Abschlussball. Ricky grinst.
»Ich habe Dorschfilet«, sagt Leonie, weil ihr sonst nichts einfällt. Immerzu schaut sie auf die Ausbuchtung unter Annkatrins Mantel. Als wäre sie im achten Monat schwanger. Warum hat Annkatrin ein Geheimnis vor ihr? Aber vielleicht ist es ihr auch nur peinlich, wegen diesem Ricky.
»Ich hab keinen Hunger, Mami.« Annkatrin gibt ihr einen Kuss. Vor Ricky. Ricky schaut sich alles an. Leonie lächelt nicht. Es fällt ihr nicht ein, dass sie jetzt vielleicht lächeln sollte, um einen guten Eindruck zu machen. Es ist heute wichtig, dass die Freunde der eigenen Kinder einen guten Eindruck von den Eltern haben. Sonst reden sie schlecht, und das treibt einen Keil zwischen Kinder und Eltern. Die Kinder schämen sich dann irgendwann. Denken, dass ihre Freunde mit dem Urteil recht haben. Kommen immer seltener nach Hause. Bleiben immer länger fort. Weil die Eltern nicht richtig sind. Nicht das Richtige gesagt haben, nicht gelacht haben, als es notwendig war zu lächeln. Aber es fällt Leonie in diesem Augenblick nicht ein. Ihr Herz schlägt. Sie kennt diesen Ricky nicht. Annkatrin hat noch nie seinen Namen erwähnt bei den Plaudereien aus der Schule. Er sieht auch nicht aus, als würde er in Annkatrins Klasse gehen. Er sieht nicht aus, als würde er noch zur Schule gehen. Er hat etwas Herausforderndes, Erwachsenes an sich. Wie er die Hände in die Lederjacke steckt. Wie er so breitbeinig vor ihr steht, so ohne Respekt. Und ohne zu überlegen, was das alles für einen Eindruck auf sie macht. Sie weiß nicht, warum sie denkt, dass er nicht auf Annkatrins Schule geht. Es ist nur so ein Gefühl.
»Mann«, sagt Ricky, »deine Mama hat extra gekocht.«